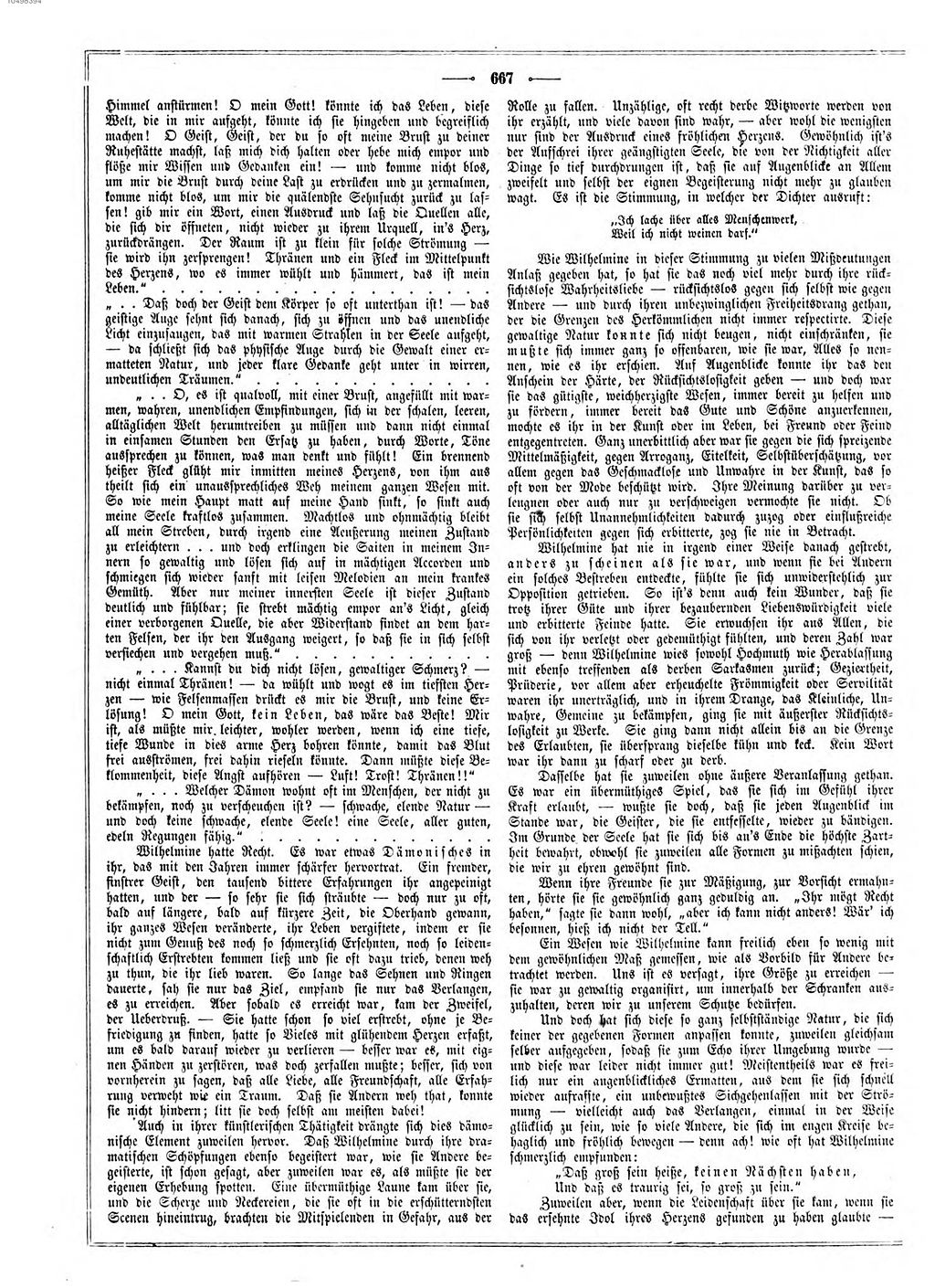| verschiedene: Die Gartenlaube (1860) | |
|
|
Himmel anstürmen! O mein Gott! könnte ich das Leben, diese Welt, die in mir aufgeht, könnte ich sie hingeben und begreiflich machen! O Geist, Geist, der du so oft meine Brust zu deiner Ruhestätte machst, laß mich dich halten oder hebe mich empor und flöße mir Wissen und Gedanken ein! – und komme nicht blos, um mir die Brust durch deine Last zu erdrücken und zu zermalmen, komme nicht blos, um mir die quälendste Sehnsucht zurück zu lassen! gib mir ein Wort, einen Ausdruck und laß die Quellen alle, die sich dir öffneten, nicht wieder zu ihrem Urquell, in’s Herz, zurückdrängen. Der Raum ist zu klein für solche Strömung – sie wird ihn zersprengen! Thränen und ein Fleck im Mittelpunkt des Herzens, wo es immer wühlt und hämmert, das ist mein Leben.“ …
„… Daß doch der Geist dem Körper so oft Unterthan ist! – das geistige Auge sehnt sich danach, sich zu offnen und das unendliche Licht einzufangen, das mit warmen Strahlen in der Seele aufgeht, – da schließt sich das physische Auge durch die Gewalt einer ermatteten Natur, und jeder klare Gedanke geht unter in wirren, undeutlichen Träumen.“ …
„… O, es ist qualvoll, mit einer Brust, angefüllt mit warmen, wahren, unendlichen Empfindungen, sich in der schalen, leeren, alltäglichen Welt herumtreiben zu müssen und dann nicht einmal in einsamen Stunden den Ersatz zu haben, durch Worte, Töne aussprechen zu können, was man denkt und fühlt! Ein brennend heißer Fleck glüht mir inmitten meines Herzens, von ihm aus theilt sich ein unaussprechliches Weh meinem ganzen Wesen mit. So wie mein Haupt matt auf meine Hand sinkt, so sinkt auch meine Seele kraftlos zusammen. Machtlos und ohnmächtig bleibt all mein Streben, durch irgend eine Aeußerung meinen Zustand zu erleichtern … und doch erklingen die Saiten in meinem Innern so gewaltig und lösen sich auf in mächtigen Accorden und schmiegen sich wieder sanft mit leisen Melodien an mein krankes Gemüth. Aber nur meiner innersten Seele ist dieser Zustand deutlich und fühlbar; sie strebt mächtig empor an’s Licht, gleich einer verborgenen Quelle, die aber Widerstand findet an dem harten Felsen, der ihr den Ausgang weigert, so daß sie in sich selbst versiechen und vergehen muß.“ …
„… Kannst du dich nicht lösen, gewaltiger Schmerz? – nicht einmal Thränen! – da wühlt und wogt es im tiefsten Herzen – wie Felsenmassen drückt es mir die Brust, und keine Erlösung! O mein Gott, kein Leben, das wäre das Beste! Mir ist, als müßte mir leichter, wohler werden, wenn ich eine tiefe, tiefe Wunde in dies arme Herz bohren könnte, damit das Blut frei ausströmen, frei dahin rieseln könnte. Dann müßte diese Beklommenheit, diese Angst aufhören – Luft! Trost! Thränen!!“
„… Welcher Dämon wohnt oft im Menschen, der nicht zu bekämpfen, noch zu verscheuchen ist? – schwache, elende Natur – und doch keine schwache, elende Seele! eine Seele, aller guten, edeln Regungen fähig.“ …
Wilhelmine hatte Recht. Es war etwas Dämonisches in ihr, das mit den Jahren immer schärfer hervortrat. Ein fremder, finstrer Geist, den tausend bittere Erfahrungen ihr angepeinigt hatten, und der – so sehr sie sich sträubte – doch nur zu oft, bald auf längere, bald auf kürzere Zeit, die Oberhand gewann, ihr ganzes Wesen veränderte, ihr Leben vergiftete, indem er sie nicht zum Genuß des noch so schmerzlich Ersehnten, noch so leidenschaftlich Erstrebten kommen ließ und sie oft dazu trieb, denen weh zu thun, die ihr lieb waren. So lange das Sehnen und Ringen dauerte, sah sie nur das Ziel, empfand sie nur das Verlangen, es zu erreichen. Aber sobald es erreicht war, kam der Zweifel, der Ueberdruß. – Sie hatte schon so viel erstrebt, ohne je Befriedigung zu finden, hatte so Vieles mit glühendem Herzen erfaßt, um es bald darauf wieder zu verlieren – besser war es, mit eignen Händen zu zerstören, was doch zerfallen mußte; besser, sich von vornherein zu sagen, daß alle Liebe, alle Freundschaft, alle Erfahrung verweht wie ein Traum. Daß sie Andern weh that, konnte sie nicht hindern; litt sie doch selbst am meisten dabei!
Auch in ihrer künstlerischen Thätigkeit drängte sich dies dämonische Element zuweilen hervor. Daß Wilhelmine durch ihre dramatischen Schöpfungen ebenso begeistert war, wie sie Andere begeisterte, ist schon gesagt, aber zuweilen war es, als müßte sie der eigenen Erhebung spotten. Eine übermüthige Laune kam über sie, und die Scherze und Neckereien, die sie oft in die erschütterndsten Scenen hineintrug, brachten die Mitspielenden in Gefahr, aus der Rolle zu fallen. Unzählige, oft recht derbe Witzworte werden von ihr erzählt, und viele davon sind wahr, – aber wohl die wenigsten nur sind der Ausdruck eines fröhlichen Herzens. Gewöhnlich ist’s der Aufschrei ihrer geängstigten Seele, die von der Nichtigkeit aller Dinge so tief durchdrungen ist, daß sie auf Augenblicke an Allem zweifelt und selbst der eignen Begeisterung nicht mehr zu glauben wagt. Es ist die Stimmung, in welcher der Dichter ausruft:
„Ich lache über alles Menschenwerk,
Weil ich nicht weinen darf.“
Wie Wilhelmine in dieser Stimmung zu vielen Mißdeutungen Anlaß gegeben hat, so hat sie das noch viel mehr durch ihre rücksichtslose Wahrheitsliebe – rücksichtslos gegen sich selbst wie gegen Andere – und durch ihren unbezwinglichen Freiheitsdrang gethan, der die Grenzen des Herkömmlichen nicht immer respectirte. Diese gewaltige Natur konnte sich nicht beugen, nicht einschränken, sie mußte sich immer ganz so offenbaren, wie sie war, Alles so nennen, wie es ihr erschien. Auf Augenblicke konnte ihr das den Anschein der Härte, der Rücksichtslosigkeit geben – und doch war sie das gütigste, weichherzigste Wesen, immer bereit zu helfen und zu fördern, immer bereit das Gute und Schöne anzuerkennen, mochte es ihr in der Kunst oder im Leben, bei Freund oder Feind entgegentreten. Ganz unerbittlich aber war sie gegen die sich spreizende Mittelmäßigkeit, gegen Arroganz, Eitelkeit, Selbstüberschätzung, vor allem gegen das Geschmacklose und Unwahre in der Kunst, das so oft von der Mode beschützt wird. Ihre Meinung darüber zu verleugnen oder auch nur zu verschweigen vermochte sie nicht. Ob sie sich selbst Unannehmlichkeiten dadurch zuzog oder einflußreiche Persönlichkeiten gegen sich erbitterte, zog sie nie in Betracht.
Wilhelmine hat nie in irgend einer Weise danach gestrebt, anders zu scheinen als sie war, und wenn sie bei Andern ein solches Bestreben entdeckte, fühlte sie sich unwiderstehlich zur Opposition getrieben. So ist’s denn auch kein Wunder, daß sie trotz ihrer Güte und ihrer bezaubernden Liebenswürdigkeit viele und erbitterte Feinde hatte. Sie erwuchsen ihr aus Allen, die sich von ihr verletzt oder gedemüthigt fühlten, und deren Zahl war groß – denn Wilhelmine wies sowohl Hochmuth wie Herablassung mit ebenso treffenden als derben Sarkasmen zurück; Geziertheit, Prüderie, vor allem aber erheuchelte Frömmigkeit oder Servilität waren ihr unerträglich, und in ihrem Drange, das Kleinliche, Unwahre, Gemeine zu bekämpfen, ging sie mit äußerster Rücksichtslosigkeit zu Werke. Sie ging dann nicht allein bis an die Grenze des Erlaubten, sie übersprang dieselbe kühn und keck. Kein Wort war ihr dann zu scharf oder zu derb.
Dasselbe hat sie zuweilen ohne äußere Veranlassung gethan. Es war ein übermüthiges Spiel, das sie sich im Gefühl ihrer Kraft erlaubt, – wußte sie doch, daß sie jeden Augenblick im Stande war, die Geister, die sie entfesselte, wieder zu bändigen. Im Grunde der Seele hat sie sich bis an’s Ende die höchste Zartheit bewahrt, obwohl sie zuweilen alle Formen zu mißachten schien, die wir zu ehren gewöhnt sind.
Wenn ihre Freunde sie zur Mäßigung, zur Vorsicht ermahnten, hörte sie sie gewöhnlich ganz geduldig an. „Ihr mögt Recht haben,“ sagte sie dann wohl, „aber ich kann nicht anders! Wär’ ich besonnen, hieß ich nicht der Tell.“
Ein Wesen wie Wilhelmine kann freilich eben so wenig mit dem gewöhnlichen Maß gemessen, wie als Vorbild für Andere betrachtet werden. Uns ist es versagt, ihre Größe zu erreichen – sie war zu gewaltig organisirt, um innerhalb der Schranken auszuhalten, deren wir zu unserem Schutze bedürfen.
Und doch hat sich diese so ganz selbstständige Natur, die sich keiner der gegebenen Formen anpassen konnte, zuweilen gleichsam selber aufgegeben, sodaß sie zum Echo ihrer Umgebung wurde – und diese war leider nicht immer gut! Meistentheils war es freilich nur ein augenblickliches Ermatten, aus dem sie sich schnell wieder aufraffte, ein unbewußtes Sichgehenlassen mit der Strömung – vielleicht auch das Verlangen, einmal in der Weise glücklich zu sein, wie so viele Andere, die sich im engen Kreise behaglich und fröhlich bewegen – denn ach! wie oft hat Wilhelmine schmerzlich empfunden:
„Daß groß sein heiße, keinen Nächsten haben,
Und daß es traurig sei, so groß zu sein.“
Zuweilen aber, wenn die Leidenschaft über sie kam, wenn sie das ersehnte Idol ihres Herzens gefunden zu haben glaubte –
verschiedene: Die Gartenlaube (1860). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1860, Seite 667. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1860)_667.jpg&oldid=- (Version vom 14.9.2022)