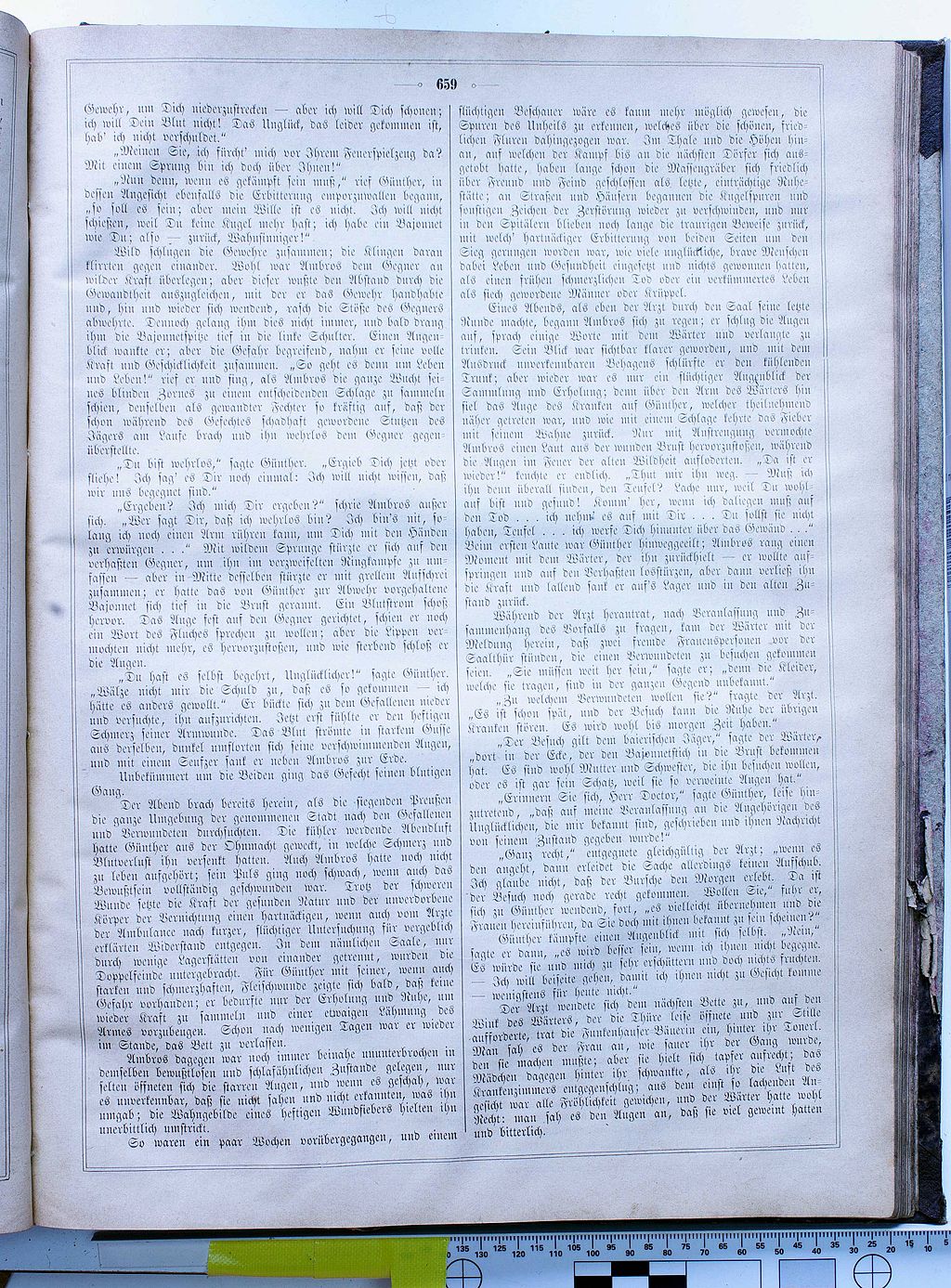| verschiedene: Die Gartenlaube (1868) | |
|
|
Gewehr, um Dich niederzustrecken – aber ich will Dich schonen; ich will Dein Blut nicht! Das Unglück, das leider gekommen ist, hab’ ich nicht verschuldet.“
„Meinen Sie, ich fürcht’ mich vor Ihrem Feuerspielzeug da? Mit einem Sprung bin ich doch über Ihnen!“
„Nun denn, wenn es gekämpft sein muß,“ rief Günther, in dessen Angesicht ebenfalls die Erbitterung emporzuwallen begann, „so soll es sein; aber mein Wille ist es nicht. Ich will nicht schießen, weil Du keine Kugel mehr hast; ich habe ein Bajonnet wie Du; also – zurück, Wahnsinniger!“
Wild schlugen die Gewehre zusammen; die Klingen daran klirrten gegen einander. Wohl war Ambros dem Gegner an wilder Kraft überlegen; aber dieser wußte den Abstand durch die Gewandtheit auszugleichen, mit der er das Gewehr handhabte und, hin und wieder sich wendend, rasch die Stöße des Gegners abwehrte. Dennoch gelang ihm dies nicht immer, und bald drang ihm die Bajonnetspitze tief in die linke Schulter. Einen Augenblick wankte er; aber die Gefahr begreifend, nahm er seine volle Kraft und Geschicklichkeit zusammen. „So geht es denn um Leben und Leben!“ rief er und fing, als Ambros die ganze Wucht seines blinden Zornes zu einem entscheidenden Schlage zu sammeln schien, denselben als gewandter Fechter so kräftig auf, daß der schon während des Gefechtes schadhaft gewordene Stutzen des Jägers am Laufe brach und ihn wehrlos dem Gegner gegenüberstellte.
„Du bist wehrlos,“ sagte Günther. „Ergieb Dich jetzt oder fliehe! Ich sag’ es Dir noch einmal: Ich will nicht wissen, daß wir uns begegnet sind.“
„Ergeben? Ich mich Dir ergeben?“ schrie Ambros außer sich. „Wer sagt Dir, daß ich wehrlos bin? Ich bin’s nit, so lang ich noch einen Arm rühren kann, um Dich mit den Händen zu erwürgen …“ Mit wildem Sprunge stürzte er sich auf den verhaßten Gegner, um ihn im verzweifelten Ringkampfe zu umfassen – aber in Mitte desselben stürzte er mit grellem Aufschrei zusammen; er hatte das von Günther zur Abwehr vorgehaltene Bajonnet sich tief in die Brust gerannt. Ein Blutstrom schoß hervor. Das Auge fest auf den Gegner gerichtet, schien er noch ein Wort des Fluches sprechen zu wollen; aber die Lippen vermochten nicht mehr, es hervorzustoßen, und wie sterbend schloß er die Augen.
„Du hast es selbst begehrt, Unglücklicher!“ sagte Günther. „Wälze nicht mir die Schuld zu, daß es so gekommen – ich hätte es anders gewollt.“ Er bückte sich zu dem Gefallenen nieder und versuchte, ihn aufzurichten. Jetzt erst fühlte er den heftigen Schmerz seiner Armwunde. Das Blut strömte in starkem Gusse aus derselben, dunkel umflorten sich seine verschwimmenden Augen, und mit einem Seufzer sank er neben Ambros zur Erde.
Unbekümmert um die Beiden ging das Gefecht seinen blutigen Gang.
Der Abend brach bereits herein, als die siegenden Preußen die ganze Umgebung der genommenen Stadt nach den Gefallenen und Verwundeten durchsuchten. Die kühler werdende Abendluft hatte Günther aus der Ohnmacht geweckt, in welche Schmerz und Blutverlust ihn versenkt hatten. Auch Ambros hatte noch nicht zu leben aufgehört; sein Puls ging noch schwach, wenn auch das Bewußtsein vollständig geschwunden war. Trotz der schweren Wunde setzte die Kraft der gesunden Natur und der unverdorbene Körper der Vernichtung einen hartnäckigen, wenn auch vom Arzte der Ambulance nach kurzer, flüchtiger Untersuchung für vergeblich erklärten Widerstand entgegen. In dem nämlichen Saale, nur durch wenige Lagerstätten von einander getrennt, wurden die Doppelfeinde untergebracht. Für Günther mit seiner, wenn auch starken und schmerzhaften, Fleischwunde zeigte sich bald, daß keine Gefahr vorhanden; er bedurfte nur der Erholuug und Ruhe, um wieder Kraft zu sammeln und einer etwaigen Lähmung des Armes vorzubeugen. Schon nach wenigen Tagen war er wieder im Stande, das Bett zu verlassen.
Ambros dagegen war noch immer beinahe ununterbrochen in demselben bewußtlosen und schlafähnlichen Zustande gelegen, nur selten öffneten sich die starren Augen, und wenn es geschah, war es unverkennbar, daß sie nicht sahen und nicht erkannten, was ihn umgab; die Wahngebilde eines heftigen Wundfiebers hielten ihn unerbittlich umstrickt.
So waren ein paar Wochen vorübergegangen, und einem flüchtigen Beschauer wäre es kaum mehr möglich gewesen, die Spuren des Unheils zu erkennen, welches über die schönen, friedlichen Fluren dahingezogen war. Im Thale und die Höhen hinan, auf welchen der Kampf bis an die nächsten Dörfer sich ausgetobt hatte, haben lange schon die Massengräber sich friedlich über Freund und Feind geschlossen als letzte, einträchtige Ruhestätte; an Straßen und Häusern begannen die Kugelspuren und sonstigen Zeichen der Zerstörung wieder zu verschwinden, und nur in den Spitälern blieben noch lange die traurigen Beweise zurück, mit welch’ hartnäckiger Erbitterung von beiden Seiten um den Sieg gerungen worden war, wie viele unglückiche, brave Menschen dabei Leben und Gesundheit eingesetzt und nichts gewonnen hatten, als einen frühen schmerzlichen Tod oder ein verkümmertes Leben als siech gewordene Männer oder Krüppel.
Eines Abends, als eben der Arzt durch den Saal seine letzte Runde machte, begann Ambros sich zu regen; er schlug die Augen auf, sprach einige Worte mit dem Wärter und verlangte zu trinken. Sein Blick war sichtbar klarer geworden, und mit dem Ausdruck unverkennbaren Behagens schlürfte er den kühlenden Trunk; aber wieder war es nur ein flüchtiger Augenblick der Sammlung und Erholung; denn über den Arm des Wärters hin fiel das Auge des Kranken auf Günther, welcher theilnehmend näher getreten war, und wie mit einem Schlage kehrte das Fieber mit seinem Wahne zurück. Nur mit Anstrengung vermochte Ambros einen Laut aus der wunden Brust hervorzustoßen, während die Augen im Feuer der alten Wildheit aufloderten. „Da ist er wieder!“ keuchte er endlich. „Thut mir ihn weg. – Muß ich ihn denn überall finden, den Teufel? Lache nur, weil Du wohlauf bist und gesund! Komm’ her, wenn ich daliegen muß auf den Tod … ich nehm’ es auf mit Dir … Du sollst sie nicht haben, Teufel … ich werfe Dich hinunter über das Gewänd …“ Beim ersten Laute war Günther hinweggeeilt; Ambros rang einen Moment mit dem Wärter, der ihn zurückhielt – er wollte aufspringen und auf den Verhaßten losstürzen, aber dann verließ ihn die Kraft und lallend sank er auf’s Lager und in den alten Zustand zurück.
Während der Arzt herantrat, nach Veranlassung und Zusammenhang des Vorfalls zu fragen, kam der Wärter mit der Meldung herein, daß zwei fremde Frauenspersonen vor der Saalthür stünden, die einen Verwundeten zu besuchen gekommen seien. „Sie müssen weit her sein,“ sagte er; „denn die Kleider, welche sie tragen, sind in der ganzen Gegend unbekannt.“
„Zu welchem Verwundeten wollen sie?“ fragte der Arzt. „Es ist schon spät, und der Besuch kann die Ruhe der übrigen Kranken stören. Es wird wohl bis morgen Zeit haben.“
„Der Besuch gilt dem baierischen Jäger,“ sagte der Wärter, „dort in der Ecke, der den Bajonnetstich in die Brust bekommen hat. Es sind wohl Mutter und Schwester, die ihn besuchen wollen, oder es ist gar sein Schatz, weil sie so verweinte Augen hat.“
„Erinnern Sie sich, Herr Doctor,“ sagte Günther, leise hinzutretend, „daß auf meine Veranlassung an die Angehörigen des Unglücklichen, die mir bekannt sind, geschrieben und ihnen Nachricht von seinem Zustand gegeben wurde!“
„Ganz recht,“ entgegnete gleichgültig der Arzt; „wenn es den angeht, dann erleidet die Sache allerdings keinen Aufschub. Ich glaube nicht, daß der Bursche den Morgen erlebt. Da ist der Besuch noch gerade recht gekommen. Wollen Sie,“ fuhr er, sich zu Günther wendend, fort, „es vielleicht übernehmen und die Frauen hereinführen, da Sie doch mit ihnen bekannt zu sein scheinen?“
Günther kämpfte einen Augenblick mit sich selbst. „Nein,“ sagte er dann, „es wird besser sein, wenn ich ihnen nicht begegne. Es würde sie und mich zu sehr erschüttern und doch nichts fruchten. – Ich will beiseite gehen, damit ich ihnen nicht zu Gesicht komme – wenigstens für heute nicht.“
Der Arzt wendete sich dem nächsten Bette zu, und auf den Wink des Wärters, der die Thüre leise öffnete und zur Stille aufforderte, trat die Funkenhauser Bäuerin ein, hinter ihr Tonerl. Man sah es der Frau an, wie sauer ihr der Gang wurde, den sie machen mußte; aber sie hielt sich tapfer aufrecht; das Mädchen dagegen hinter ihr schwankte, als ihr die Luft des Krankenzimmers entgegenschlug; aus dem einst so lachenden Angesicht war alle Fröhlichkeit gewichen, und der Wärter hatte wohl Recht: man sah es den Augen an, daß sie viel geweint hatten und bitterlich.
verschiedene: Die Gartenlaube (1868). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1868, Seite 659. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1868)_659.jpg&oldid=- (Version vom 15.9.2022)