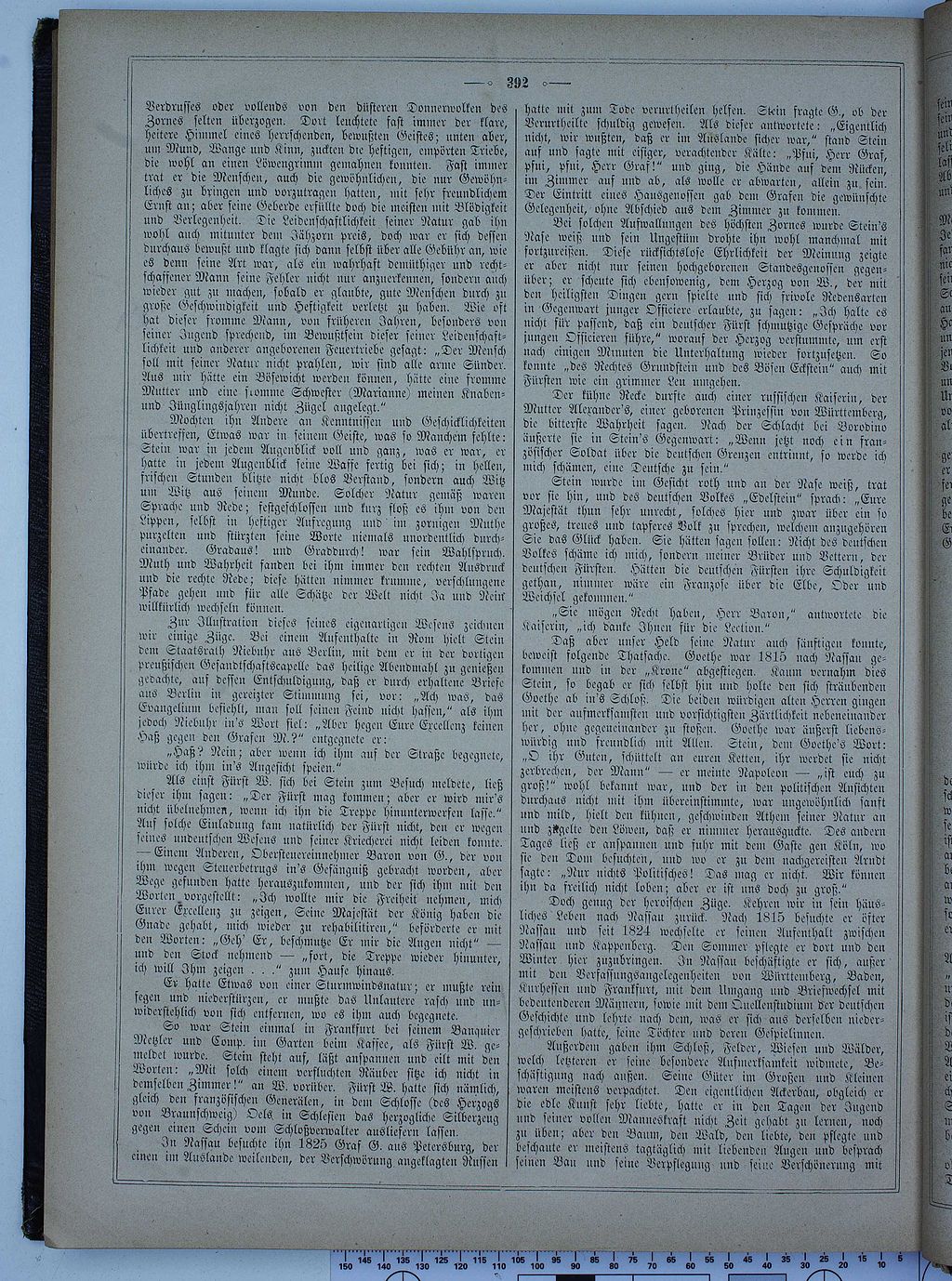| Verschiedene: Die Gartenlaube (1870) | |
|
|
Verdrusses oder vollends von den düsteren Donnerwolken des Zornes selten überzogen. Dort leuchtete fast immer der klare, heitere Himmel eines herrschenden, bewußten Geistes; unten aber, um Mund, Wange und Kinn, zuckten die heftigen empörten Triebe, die wohl an einen Löwengrimm gemahnen konnten. Fast immer trat er die Menschen, auch die gewöhnlichen, die nur Gewöhnliches zu bringen und vorzutragen hatten, mit sehr freundlichem Ernst an; aber seine Geberde erfüllte doch die meisten mit Blödigkeit und Verlegenheit. Die Leidenschaftlichkeit seiner Natur gab ihn wohl auch mitunter dem Jähzorn preis, doch war er sich dessen durchaus bewußt und klagte sich dann selbst über alle Gebühr an, wie es denn seine Art war, als ein wahrhaft demüthiger und rechtschaffener Mann seine Fehler nicht nur anzuerkennen, sondern auch wieder gut zu machen, sobald er glaubte, gute Menschen durch zu große Geschwindigkeit und Heftigkeit verletzt zu haben. Wie oft hat dieser fromme Mann, von früheren Jahren, besonders von seiner Jugend sprechend, im Bewußtsein dieser seiner Leidenschaftlichkeit und anderer angeborenen Feuertriebe gesagt: „Der Mensch soll mit seiner Natur nicht prahlen, wir sind alle arme Sünder. Aus mir hätte ein Bösewicht werden können, hätte eine fromme Mutter und eine fromme Schwester (Marianne) meinen Knaben- und Jünglingsjahren nicht Zügel angelegt.“
Mochten ihn Andere an Kenntnissen und Geschicklichkeiten übertreffen, Etwas war in seinem Geiste, was so Manchem fehlte: Stein war in jedem Augenblick voll und ganz, was er war, er hatte in jedem Augenblick seine Waffe fertig bei sich; in hellen, frischen Stunden blitzte nicht blos Verstand, sondern auch Witz um Witz aus seinem Munde. Solcher Natur gemäß waren Sprache und Rede; festgeschlossen und kurz floß es ihm von den Lippen, selbst in heftiger Aufregung und im zornigen Muthe purzelten und stürzten seine Worte niemals unordentlich durcheinander. Gradaus! und Graddurch! war sein Wahlspruch. Muth und Wahrheit fanden bei ihm immer den rechten Ausdruck und die rechte Rede; diese hätten nimmer krumme, verschlungene Pfade gehen und für alle Schätze der Welt nicht Ja und Nein willkürlich wechseln können.
Zur Illustration dieses seines eigenartigen Wesens zeichnen wir einige Züge. Bei einem Aufenthalte in Rom hielt Stein dem Staatsrath Niebuhr aus Berlin, mit dem er in der dortigen preußischen Gesandtschaftscapelle das heilige Abendmahl zu genießen gedachte, auf dessen Entschuldigung, daß er durch erhaltene Briefe aus Berlin in gereizter Stimmung sei, vor: „Ach was, das Evangelium befiehlt, man soll seinen Feind nicht hassen,“ als ihm jedoch Niebuhr in’s Wort fiel: „Aber hegen Eure Excellenz keinen Haß gegen den Grafen M.?“ entgegnete er:
„Haß? Nein; aber wenn ich ihm auf der Straße begegnete, würde ich ihm in’s Angesicht speien.“
Als einst Fürst W. sich bei Stein zum Besuch meldete, ließ dieser ihm sagen: „Der Fürst mag kommen; aber er wird mir’s nicht übelnehmen, wenn ich ihn die Treppe hinunterwerfen lasse.“ Auf solche Einladung kam natürlich der Fürst nicht, den er wegen seines undeutschen Wesens und seiner Kriecherei nicht leiden konnte. – Einem Anderen, Obersteuereinnehmer Baron von G., der von ihm wegen Steuerbetrugs in’s Gefängniß gebracht worden, aber Wege gefunden hatte herauszukommen, und der sich ihm mit den Worten vorgestellt: „Ich wollte mir die Freiheit nehmen, mich Eurer Excellenz zu zeigen, Seine Majestät der König haben die Gnade gehabt, mich wieder zu rehabilitiren,“ beförderte er mit den Worten: „Geh’ Er, beschmutze Er mir die Augen nicht“ – und den Stock nehmend – „fort, die Treppe wieder hinunter, ich will Ihm zeigen …“ zum Hause hinaus.
Er hatte Etwas von einer Sturmwindsnatur; er mußte rein fegen und niederstürzen, er mußte das Unlautere rasch und unwiderstehlich von sich entfernen, wo es ihm auch begegnete.
So war Stein einmal in Frankfurt bei seinem Banquier Metzter und Comp. im Garten beim Kaffee, als Fürst W. gemeldet wurde. Stein steht auf, läßt anspannen und eilt mit den Worten: „Mit solch einem verfluchten Räuber sitze ich nicht in demselben Zimmer!“ an W. vorüber. Fürst W. hatte sich nämlich, gleich den französischen Generälen, in dem Schlosse (des Herzogs von Braunschweig) Oels in Schlesien das herzogliche Silberzeug gegen einen Schein vom Schloßverwalter ausliefern lassen.
In Nassau besuchte ihn 1825 Graf G. aus Petersburg, der einen im Auslande weilenden, der Verschwörung angeklagten Russen hatte mit zum Tode verurtheilen helfen. Stein fragte G., ob der Verurtheilte schuldig gewesen. Als dieser antwortete: „Eigentlich nicht, wir wußten, daß er im Auslande sicher war,“ stand Stein auf und sagte mit eisiger, verachtender Kälte: „Pfui, Herr Graf, pfui, pfui, Herr Graf!“ und ging, die Hände auf dem Rücken, im Zimmer auf und ab, als wolle er abwarten, allein zu sein. Der Eintritt eines Hausgenossen gab dem Grafen die gewünschte Gelegenheit, ohne Abschied aus dem Zimmer zu kommen.
Bei solchen Aufwallungen des höchsten Zornes wurde Stein’s Nase weiß und sein Ungestüm drohte ihn wohl manchmal mit fortzureißen. Diese rücksichtslose Ehrlichkeit der Meinung zeigte er aber nicht nur seinen hochgeborenen Standesgenossen gegenüber; er scheute sich ebensowenig, dem Herzog von W., der mit den heiligsten Dingen gern spielte und sich frivole Redensarten in Gegenwart junger Officiere erlaubte, zu sagen: „Ich halte es nicht für passend, daß ein deutscher Fürst schmutzige Gespräche vor jungen Officieren führe,“ worauf der Herzog verstummte, um erst nach einigen Minuten die Unterhaltung wieder fortzusetzen. So konnte „des Rechtes Grundstein und des Bösen Eckstein“ auch mit Fürsten wie ein grimmer Leu umgehen.
Der kühne Recke durfte auch einer russischen Kaiserin, der Mutter Alexander’s, einer geborenen Prinzessin von Württemberg, die bitterste Wahrheit sagen. Nach der Schlacht bei Borodino äußerte sie in Stein’s Gegenwart: „Wenn jetzt noch ein französischer Soldat über die deutschen Grenzen entrinnt, so werde ich mich schämen, eine Deutsche zu sein.“
Stein wurde im Gesicht roth und an der Nase weiß, trat vor sie hin, und des deutschen Volkes „Edelstein“ sprach: „Eure Majestät thun sehr unrecht, solches hier und zwar über ein so großes, treues und tapferes Volk zu sprechen, welchem anzugehören Sie das Glück haben. Sie hätten sagen sollen: Nicht des deutschen Volkes schäme ich mich, sondern meiner Brüder und Vettern, der deutschen Fürsten. Hätten die deutschen Fürsten ihre Schuldigkeit gethan, nimmer wäre ein Franzose über die Elbe, Oder und Weichsel gekommen.“
„Sie mögen Recht haben, Herr Baron,“ antwortete die Kaiserin, „ich danke Ihnen für die Lection.“
Daß aber unser Held seine Natur auch sänftigen konnte, beweist folgende Thatsache. Goethe war 1815 nach Nassau gekommen und in der „Krone“ abgestiegen. Kaum vernahm dies Stein, so begab er sich selbst hin und holte den sich sträubenden Goethe ab in’s Schloß. Die beiden würdigen alten Herren gingen mit der aufmerksamsten und vorsichtigsten Zärtlichkeit nebeneinander her, ohne gegeneinander zu stoßen. Goethe war äußerst liebenswürdig und freundlich mit Allen. Stein, dem Goethe’s Wort: „O ihr Guten, schüttelt an euren Ketten, ihr werdet sie nicht zerbrechen, der Mann“ – er meinte Napoleon – „ist euch zu groß!“ wohl bekannt war, und der in den politischen Ansichten durchaus nicht mit ihm übereinstimmte, war ungewöhnlich sanft und mild, hielt den kühnen, geschwinden Athem seiner Natur an und zügelte den Löwen, daß er nimmer herausguckte. Des andern Tages ließ er anspannen und fuhr mit dem Gaste gen Köln, wo sie den Dom besuchten, und wo er zu dem nachgereisten Arndt sagte: „Nur nichts Politisches! Das mag er nicht. Wir können ihn da freilich nicht loben; aber er ist uns doch zu groß.“
Doch genug der heroischen Züge. Kehren wir in sein häusliches Leben nach Nassau zurück. Nach 1815 besuchte er öfter Nassau und seit 1824 wechselte er seinen Aufenthalt zwischen Nassau und Kappenberg. Den Sommer pflegte er dort und den Winter hier zuzubringen. In Nassau beschäftigte er sich, außer mit den Verfassungsangelegenheiten von Württemberg, Baden, Kurhessen und Frankfurt, mit dem Umgang und Briefwechsel mit bedeutenderen Männern, sowie mit dem Quellenstudium der deutschen Geschichte und lehrte nach dem, was er sich aus derselben niedergeschrieben hatte, seine Töchter und deren Gespielinnen.
Außerdem gaben ihm Schloß, Felder, Wiesen und Wälder, welch letztere er seine besondere Aufmerksamkeit widmete, Beschäftigung nach außen. Seine Güter im Großen und Kleinen waren meistens verpachtet. Den eigentlichen Ackerbau, obgleich er die edle Kunst sehr liebte, hatte er in den Tagen der Jugend und seiner vollen Manneskraft nicht Zeit gehabt zu lernen, noch zu üben; aber den Baum, den Wald, den liebte, den pflegte und beschaute er meistens tagtäglich mit liebenden Augen und besprach seinen Bau und seine Verpflegung und seine Verschönerung mit
Verschiedene: Die Gartenlaube (1870). Leipzig: Ernst Keil, 1870, Seite 392. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1870)_392.jpg&oldid=- (Version vom 9.9.2019)