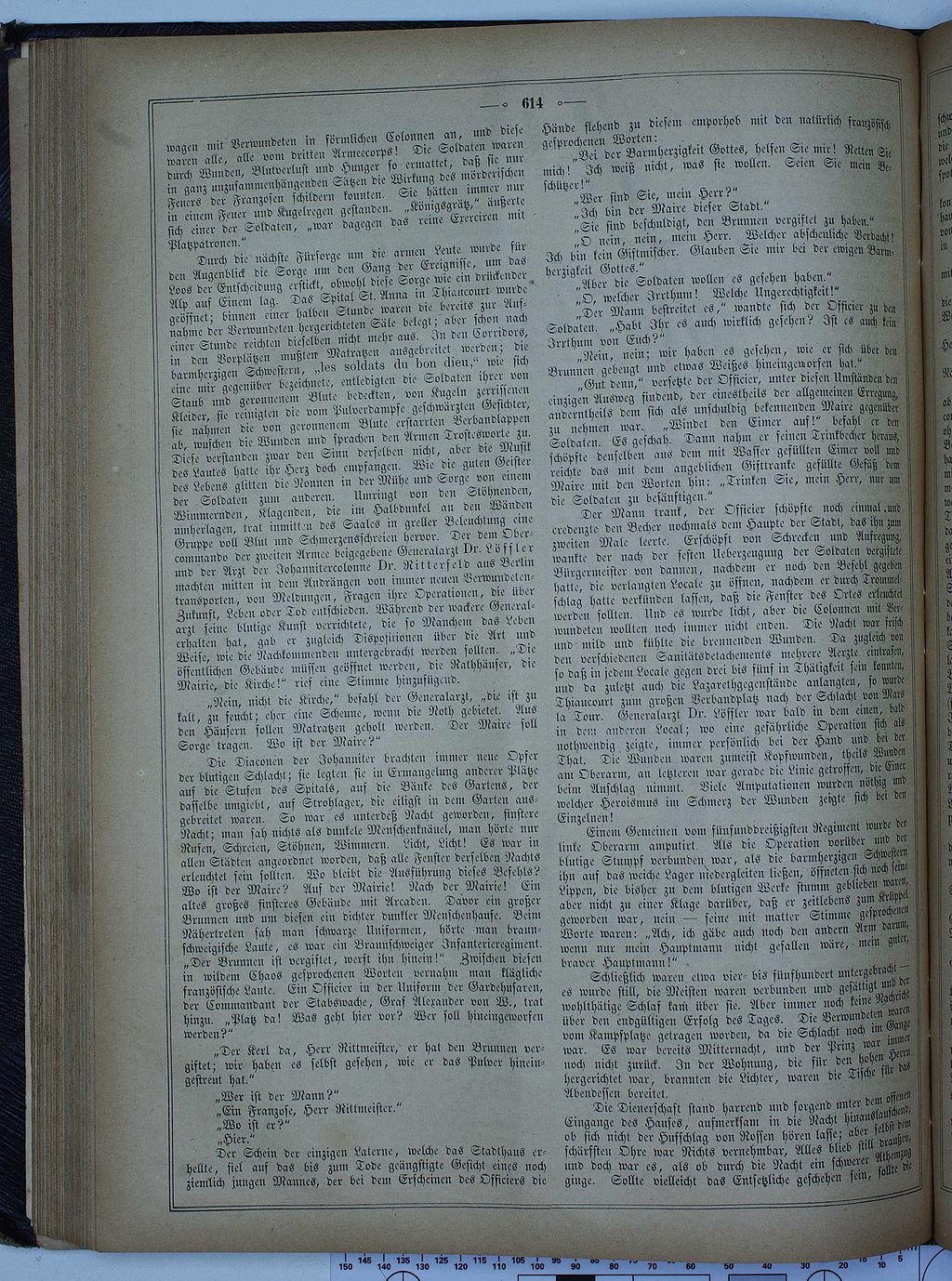| Verschiedene: Die Gartenlaube (1870) | |
|
|
mit Verwundeten in förmlichen Colonnen an, und diese waren alle, alle vom dritten Armeecorps! Die Soldaten waren durch Wunden, Blutverlust und Hunger so ermattet, daß sie nur in ganz unzusammenhängenden Sätzen die Wirkung des mörderischen Feuers der Franzosen schildern konnten. Sie hätten immer nur in einem Feuer und Kugelregen gestanden. „Königsgrätz,“ äußerte sich einer der Soldaten, „war dagegen das reine Exerciren mit Platzpatronen.“
Durch die nächste Fürsorge um die armen Leute wurde für den Augenblick die Sorge um den Gang der Ereignisse, um das Loos der Entscheidung erstickt, obwohl diese Sorge wie ein drückender Alp auf Einem lag. Das Spital St. Anna in Thiaucourt wurden geöffnet; binnen einer halben Stunde waren die bereits zur Aufnahme der Verwundeten hergerichteten Säle belegt; aber schon nach einer Stunde reichten dieselben nicht mehr aus. In den Corridors, in den Vorplätzen mußten Matratzen ausgebreitet werden; die barmherzigen Schwestern, „les soldates de bon dieu“ wie sich eine mir gegenüber bezeichnete, entledigten die Soldaten ihrer von Staub und geronnenem Blute bedeckten, von Kugeln zerrissenen Kleider, sie reinigten die vom Pulverdampfe geschwärzten Gesichter, sie nahmen die von geronnenem Blute erstarrten Verbandlappen ab, wuschen die Wunden und sprachen den Armen Trostesworte zu. Diese verstanden zwar den Sinn derselben nicht, aber die Musik des Lautes hatte ihr Herz doch empfangen. Wie die guten Geister des Lebens glitten die Nonnen in der Mühe und Sorge von einem der Soldaten zum anderen. Umringt von den Stöhnenden, Wimmernden, Klagenden, die im Halbdunkel an den Wänden umherlagen, trat inmitten des Saales in greller Beleuchtung eine Gruppe voll Blut und Schmerzensschreien hervor. Der dem Obercommando der zweiten Armee beigegebene Generalarzt Dr. Löffler und der Arzt der Johannitercolonne Dr. Ritterfeld aus Berlin machten mitten in dem Andrängen von immer neuen Verwundetentransporten, von Meldungen, Fragen ihre Operationen, die über Zukunft, Leben oder Tod entschieden. Während der wackere Generalarzt seine blutige Kunst verrichtete, die so Manchem das Leben erhalten hat, gab er zugleich Dispositionen über die Art und Weise, wie die Nachkommenden untergebracht werden sollten. „Die öffentlichen Gebäude müssen geöffnet werden, die Rathäuser, die Mairie, die Kirche!“ rief eine Stimme hinzufügend.
„Nein, nicht die Kirche,“ befahl der Generalarzt, „die ist zu kalt, zu feucht; eher eine Scheune, wenn die Noth gebietet. Aus den Häusern sollen Matratzen geholt werden. Der Maire soll Sorge tragen. Wo ist der Maire?“
Die Diaconen der Johanniter brachten immer neue Opfer der blutigen Schlacht; sie legten sie in Ermangelung anderer Plätze auf die Stufen des Spitals, auf die Bänke des Gartens, der dasselbe umgiebt, auf Strohlager, die eiligst in dem Garten ausgebreitet waren. So war es unterdeß Nacht geworden, finstere Nacht; man sah nichts als dunkle Menschenknäuel, man hörte nur Rufen, Schreien, Stöhnen, Wimmern. Licht, Licht! Es war in allen Städten angeordnet worden, daß alle Fenster derselben Nachts erleuchtet sein sollten. Wo bleibt die Ausführung dieses Befehls? Wo ist der Maire? Auf der Mairie! Nach der Mairie! Ein altes großes finsteres Gebäude mit Arcaden. Davor ein großer Brunnen und um diesen ein dichter dunkler Menschenhaufe. Beim Nähertreten sah man schwarze Uniformen, hörte man braunschweigische Laute, es war ein Braunschweiger Infanterieregiment. „Der Brunnen ist vergiftet; werft ihn hinein!“ Zwischen diesen in wildem Chaos gesprochenen Worten vernahm man klägliche französische Laute. Ein Officier in der Uniform der Gardehusaren, der Commandant der Stabswache, Graf Alexander von W., trat hinzu. „Platz da! Was geht hier vor? Wer soll hineingeworfen werden?“
„Der Kerl da, Herr Rittmeister, er hat den Brunnen vergiftet; wir haben es selbst gesehen, wie er das Pulver hineingestreut hat.“
„Wer ist der Mann?“
„Ein Franzose, Herr Rittmeister.“
„Wo ist er?“
Der Schein der einzigen Laterne, welche das Stadthaus erhellte, fiel auf das bis zum Tode geängstigte Gesicht eines noch ziemlich jungen Mannes, der bei dem Erscheinen des Officiers die Hände flehend zu diesem emporhob mit den natürlich französisch gesprochenen Worten:
„Bei der Barmherzigkeit Gottes, helfen Sie mir! Retten Sie mich! Ich weiß nicht, was sie wollen. Seien Sie mein Beschützer!“
„Wer sind Sie, mein Herr?“
„Ich bin der Maire dieser Stadt.“
„Sie sind beschuldigt, den Brunnen vergiftet zu haben.“
„O nein, nein, mein Herr. Welcher abscheuliche Verdacht! Ich bin kein Giftmischer. Glauben Sie mir bei der ewigen Barmherzigkeit Gottes.“
„Aber die Soldaten wollen es gesehen haben.“
„O, welcher Irrthum! Welche Ungerechtigkeit!“
„Der Mann bestreitet es,“ wandte sich der Officier zu den Soldaten. „Habt Ihr es auch wirklich gesehen? Ist es auch kein Irrthum von Euch?“
„Nein, nein; wir haben es gesehen, wie er sich über den Brunnen gebeugt und etwas Weißes hineingeworfen hat.“
„Gut denn,“ versetzte der Officier, unter diesen Umständen den einzigen Ausweg findend, der einesteils der allgemeinen Erregung, anderntheils dem sich als unschuldig bekennenden Maire gegenüber zu nehmen war. „Windet den Eimer auf!“ befahl er den Soldaten. Es geschah. Dann nahm er seinen Trinkbecher heraus, schöpfte denselben aus dem mit Wasser gefüllten Eimer voll und reichte das mit dem angeblichen Gifttranke gefüllte Gefäß dem Maire mit den Worten hin: „Trinken Sie, mein Herr, nur um die Soldaten zu besänftigen.“
Der Mann trank, der Officier schöpfte noch einmal und credenzte den Becher nochmals dem Haupte der Stadt, das ihn zum zweiten Male leerte. Erschöpft von Schrecken und Aufregung wankte der nach der festen Ueberzeugung der Soldaten vergiftete Bürgermeister von dannen, nachdem er noch den Befehl gegeben hatte, die verlangten Locale zu öffnen; nachdem er durch Trommelschlag hatte verkünden lassen, daß die Fenster des Ortes erleuchtet werden sollten. Und es wurde licht, aber die Colonnen mit Verwundeten wollten noch immer nicht enden. Die Nacht war frisch und mild und kühlte die brennenden Wunden. Da zugleich von den verschiedenen Sanitätsdetachements mehrere Aerzte eintrafen, so daß in jedem Locale gegen drei bis fünf in Thätigkeit sein konnten und da zuletzt auch die Lazarethgegenstände anlangten, so wurde Thiaucourt zum großen Verbandplatz nach der Schlacht von Mars la Tour. Generalarzt Dr. Löffler war bald in dem einen, bald in dem anderen Local, wo eine gefährliche Operation sich als nothwendig zeigte, immer persönlich bei der Hand und bei der That. Die Wunden waren zumeist Kopfwunden, theils Wunden am Oberarm, an letzterem war gerade die Linie getroffen, die Einer beim Anschlag nimmt. Viele Amputationen wurden nötig und welcher Heroismus im Schmerz der Wunden zeigte sich bei den Einzelnen!
Einem Gemeinen vom fünfunddreißigsten Regiment wurde der linke Oberarm amputirt. Als die Operation vorüber und der blutige Stumpf verbunden war, als die barmherzigen Schwestern ihn auf das weiche Lager niedergleiten ließen, öffneten sich noch seine Lippen, die bisher zu dem blutigen Werke stumm geblieben waren, aber nicht zu einer Klage darüber, daß er zeitlebens zum Krüppel geworden war, nein – seine mit matter Stimme gesprochenen Worte waren: „Ach, ich gäbe auch noch den andern Arm darum, wenn nur mein Hauptmann nicht gefallen wäre, mein guter, braver Hauptmann!“
Schließlich waren etwa vier- bis fünfhundert untergebracht – es wurde still, die meisten waren verbunden und gesättigt und der wohltätige Schlaf kam über sie. Aber immer noch keine Nachricht über den endgültigen Erfolg des Tages. Die Verwundeten waren vom Kampfplatze getragen worden, da die Schlacht noch im Gange war. Es war bereits Mitternacht, und der Prinz war immer noch nicht zurück. In der Wohnung, die für den hohen Herrn hergerichtet war, brannten die Lichter, waren die Tische für das Abendessen bereitet.
Die Dienerschaft stand harrend und sorgend unter dem offenen Eingange des Hauses, aufmerksam in die Nacht hinauslauschend, ob sich nicht der Hufschlag von Rossen hören lasse; aber selbst dem schärfsten Ohre war Nichts vernehmbar, Alles blieb still draußen und doch war es, als ob durch die Nacht ein schwerer Athemzug ginge. Sollte vielleicht das Entsetzliche geschehen sein, sollte die
Verschiedene: Die Gartenlaube (1870). Leipzig: Ernst Keil, 1870, Seite 614. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1870)_614.jpg&oldid=- (Version vom 29.12.2019)