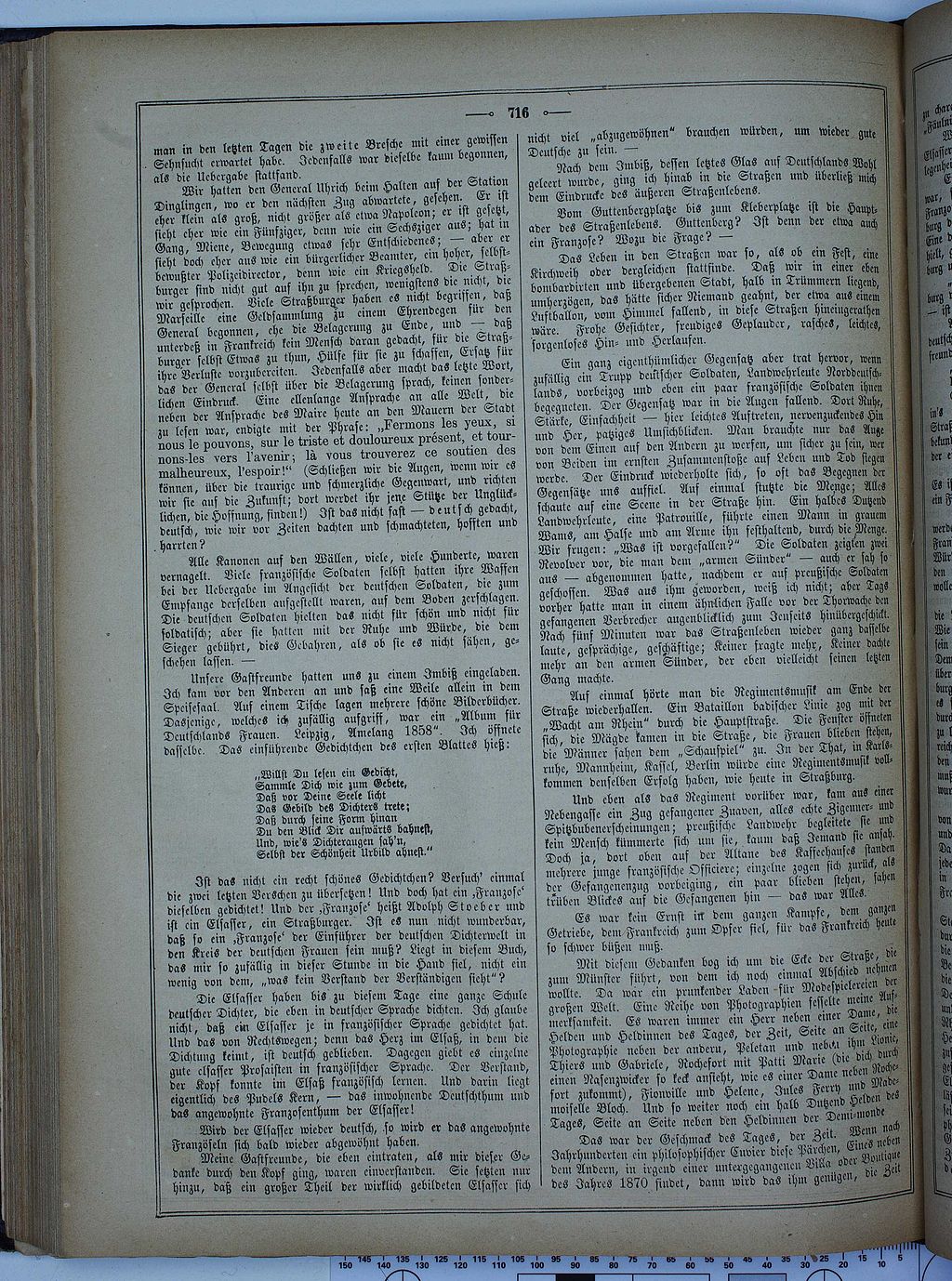| Verschiedene: Die Gartenlaube (1870) | |
|
|
man in den letzten Tagen die zweite Bresche mit einer gewissen Sehnsucht erwartet habe. Jedenfalls war dieselbe kaum begonnen, als die Uebergabe stattfand.
Wir hatten den General Uhrich beim Halten auf der Station Dinglingen, wo er den nächsten Zug abwartete, gesehen. Er ist eher klein als groß, nicht größer als etwa Napoleon; er ist gesetzt, sieht eher wie ein Fünfziger, denn wie ein Sechsziger aus; hat in Gang, Miene, Bewegung etwas sehr Entschiedenes; – aber er sieht doch eher aus wie ein bürgerlicher Beamter, ein hoher, selbstbewußter Polizeidirector, denn wie ein Kriegsheld. Die Straßburger sind nicht gut auf ihn zu sprechen, wenigstens die nicht, die wir gesprochen. Viele Straßburger haben es nicht begriffen, daß Marseille eine Geldsammlung zu einem Ehrendegen für den General begonnen, ehe die Belagerung zu Ende, und – daß unterdeß in Frankreich kein Mensch daran gedacht, für die Straßburger selbst Etwas zu thun, Hülfe für sie zu schaffen, Ersatz für ihre Verluste vorzubereiten. Jedenfalls aber macht das letzte Wort, das der General selbst über die Belagerung sprach, keinen sonderlichen Eindruck. Eine ellenlange Ansprache an alle Welt, die neben der Ansprache des Maire heute an den Mauern der Stadt zu lesen war, endigte mit der Phrase: „Fermons les yeux, si nous le pouvons, sur le triste et douloureux présent, et tournons-les vers l’avenir; là vous trouverez ce soutien des malheureux, l’espoir!“ (Schließen wir die Augen, wenn wir es können, über die traurige und schmerzliche Gegenwart, und richten wir sie auf die Zukunft; dort werdet ihr jene Stütze der Unglücklichen, die Hoffnung, finden!) Ist das nicht fast – deutsch gedacht, deutsch, wie wir vor Zeiten dachten und schmachteten, hofften und harrten?
Alle Kanonen auf den Wällen, viele, viele Hunderte, waren vernagelt. Viele französische Soldaten selbst hatten ihre Waffen bei der Uebergabe im Angesicht der deutschen Soldaten, die zum Empfange derselben aufgestellt waren, auf dem Boden zerschlagen. Die deutschen Soldaten hielten das nicht für schön und nicht für soldatisch; aber sie hatten mit der Ruhe und Würde, die dem Sieger gebührt, dies Gebahren, als ob sie es nicht sähen, geschehen lassen. –
Unsere Gastfreunde hatten uns zu einem Imbiß eingeladen. Ich kam vor den Anderen an und saß eine Weile allein in dem Speisesaal. Auf einem Tische lagen mehrere schöne Bilderbücher. Dasjenige, welches ich zufällig aufgriff, war ein „Album für Deutschlands Frauen. Leipzig, Amelang 1858“. Ich öffnete dasselbe. Das einführende Gedichtchen des ersten Blattes hieß:
„Willst Du lesen ein Gedicht,
Sammle Dich wie zum Gebete,
Daß vor Deine Seele licht
Das Gebild des Dichters trete;
Daß durch seine Form hinan
Du den Blick Dir aufwärts bahnest,
Und, wie’s Dichteraugen sah’n,
Selbst der Schönheit Urbild ahnest.“
Ist das nicht ein recht schönes Gedichtchen? Versuch’ einmal die zwei letzten Verschen zu übersetzen! Und doch hat ein ‚Franzose‘ dieselben gedichtet! Und der ‚Franzose‘ heißt Adolph Stoeber und ist ein Elsasser, ein Straßburger. Ist es nun nicht wunderbar, daß so ein ‚Franzose‘ der Einführer der deutschen Dichterwelt in den Kreis der deutschen Frauen sein muß? Liegt in diesem Buch, das mir so zufällig in dieser Stunde in die Hand fiel, nicht ein wenig von dem, „was kein Verstand der Verständigen sieht“?
Die Elsasser haben bis zu diesem Tage eine ganze Schule deutscher Dichter, die eben in deutscher Sprache dichten. Ich glaube nicht, daß ein Elsasser je in französischer Sprache gedichtet hat. Und das von Rechtswegen; denn das Herz im Elsaß, in dem die Dichtung keimt, ist deutsch geblieben. Dagegen giebt es einzelne gute elsasser Prosaisten in französischer Sprache. Der Verstand, der Kopf konnte im Elsaß französisch lernen. Und darin liegt eigentlich des Pudels Kern, – das inwohnende Deutschthum und das angewohnte Franzosenthum der Elsasser!
Wird der Elsasser wieder deutsch, so wird er das angewohnte Französeln sich bald wieder abgewöhnt haben.
Meine Gastfreunde, die eben eintraten, als mir dieser Gedanke durch den Kopf ging, waren einverstanden. Sie setzten nur hinzu, daß ein großer Theil der wirklich gebildeten Elsasser sich nicht viel „abzugewöhnen“ brauchen würden, um wieder gute Deutsche zu sein.
Nach dem Imbiß, dessen letztes Glas auf Deutschlands Wohl geleert wurde, ging ich hinab in die Straßen und überließ mich dem Eindrucke des äußeren Straßenlebens.
Vom Guttenbergplatze bis zum Kleberplatze ist die Hauptader des Straßenlebens. Guttenberg? Ist denn der etwa auch ein Franzose? Wozu die Frage? –
Das Leben in den Straßen war so, als ob ein Fest, eine Kirchweih oder dergleichen stattfinde. Daß wir in einer eben bombardirten und übergebenen Stadt, halb in Trümmern liegend, umherzögen, das hätte sicher Niemand geahnt, der etwa aus einem Luftballon, vom Himmel fallend, in diese Straßen hineingeraten wäre. Frohe Gesichter, freudiges Geplauder, rasches, leichtes, sorgenloses Hin- und Herlaufen.
Ein ganz eigenthümlicher Gegensatz aber trat hervor, wenn zufällig ein Trupp deutscher Soldaten, Landwehrleute Norddeutschlands, vorbeizog und eben ein paar französische Soldaten ihnen begegneten. Der Gegensatz war in die Augen fallend. Dort Ruhe, Stärke, Einfachheit – hier leichtes Auftreten, nervenzuckendes Hin und Her, patziges Umsichblicken. Man brauchte nur das Auge von dem Einen auf den Andern zu werfen, um sicher zu sein, wer von Beiden im ernsten Zusammenstoße auf Leben und Tod siegen werde. Der Eindruck wiederholte sich, so oft das Begegnen der Gegensätze uns auffiel. Auf einmal stutzte die Menge; Alles schaute auf eine Scene in der Straße hin. Ein halbes Dutzend Landwehrleute, eine Patrouille, führte einen Mann in grauem Wams, am Halse und am Arme ihn festhaltend, durch die Menge. Wir frugen: „Was ist vorgefallen?“ Die Soldaten zeigten zwei Revolver vor, die man dem „armen Sünder“ – auch er sah so aus – abgenommen hatte, nachdem er auf preußische Soldaten geschossen. Was aus ihm geworden, weiß ich nicht; aber Tags vorher hatte man in einem ähnlichen Falle vor der Thorwache den gefangenen Verbrecher augenblicklich zum Jenseits hinübergeschickt. Nach fünf Minuten war das Straßenleben wieder ganz dasselbe laute, gesprächige, geschäftige; Keiner fragte mehr, Keiner dachte mehr an den armen Sünder, der eben vielleicht seinen letzten Gang machte.
Auf einmal hörte man die Regimentsmusik am Ende der Straße wiederhallen. Ein Bataillon badischer Linie zog mit der „Wacht am Rhein“ durch die Hauptstraße. Die Fenster öffneten sich, die Mägde kamen in die Straße, die Frauen blieben stehen, die Männer sahen dem „Schauspiel“ zu. In der That, in Karlsruhe, Mannheim, Kassel, Berlin würde eine Regimentsmusik vollkommen denselben Erfolg haben, wie heute in Straßburg.
Und eben als das Regiment vorüber war, kam aus einer Nebengasse ein Zug gefangener Zuaven, alles echte Zigeuner- und Spitzbubenerscheinungen; preußische Landwehr begleitete sie und kein Mensch kümmerte sich um sie, kaum daß Jemand sie ansah. Doch ja, dort oben auf der Altane des Kaffeehauses standen mehrere junge französische Officiere; einzelne zogen sich zurück, als der Gefangenenzug vorbeiging, ein paar blieben stehen, sahen trüben Blickes auf die Gefangenen hin – das war Alles.
Es war kein Ernst in dem ganzen Kampfe, dem ganzen Getriebe, dem Frankreich zum Opfer fiel, für das Frankreich heute so schwer büßen muß.
Mit diesem Gedanken bog ich um die Ecke der Straße, die zum Münster führt, von dem ich noch einmal Abschied nehmen wollte. Da war ein prunkender Laden für Modespielereien der großen Welt. Eine Reihe von Photographien fesselte meine Aufmerksamkeit. Es waren immer ein Herr neben einer Dame, die Helden und Heldinnen des Tages, der Zeit, Seite an Seite, eine Photographie neben der andern, Peletan und neben ihm Lionie, Thiers und Gabriele, Rochefort mit Patti Marie (die dich durch einen Nasenzwicker so keck ansieht, wie es einer Dame neben Rochefort zukommt), Fionville und Helene, Jules Ferry und Mademoiselle Bloch. Und so weiter noch ein halb Dutzend Helden des Tages, Seite an Seite neben den Heldinnen der Demi-monde.
Das war der Geschmack des Tages, der Zeit. Wenn nach Jahrhunderten ein philosophischer Cuvier diese Pärchen, Eines neben dem Andern, in irgend einer untergegangenen Villa oder Boutique des Jahres 1870 findet, dann wird das ihm genügen, die Zeit
Verschiedene: Die Gartenlaube (1870). Leipzig: Ernst Keil, 1870, Seite 716. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1870)_716.jpg&oldid=- (Version vom 29.12.2019)