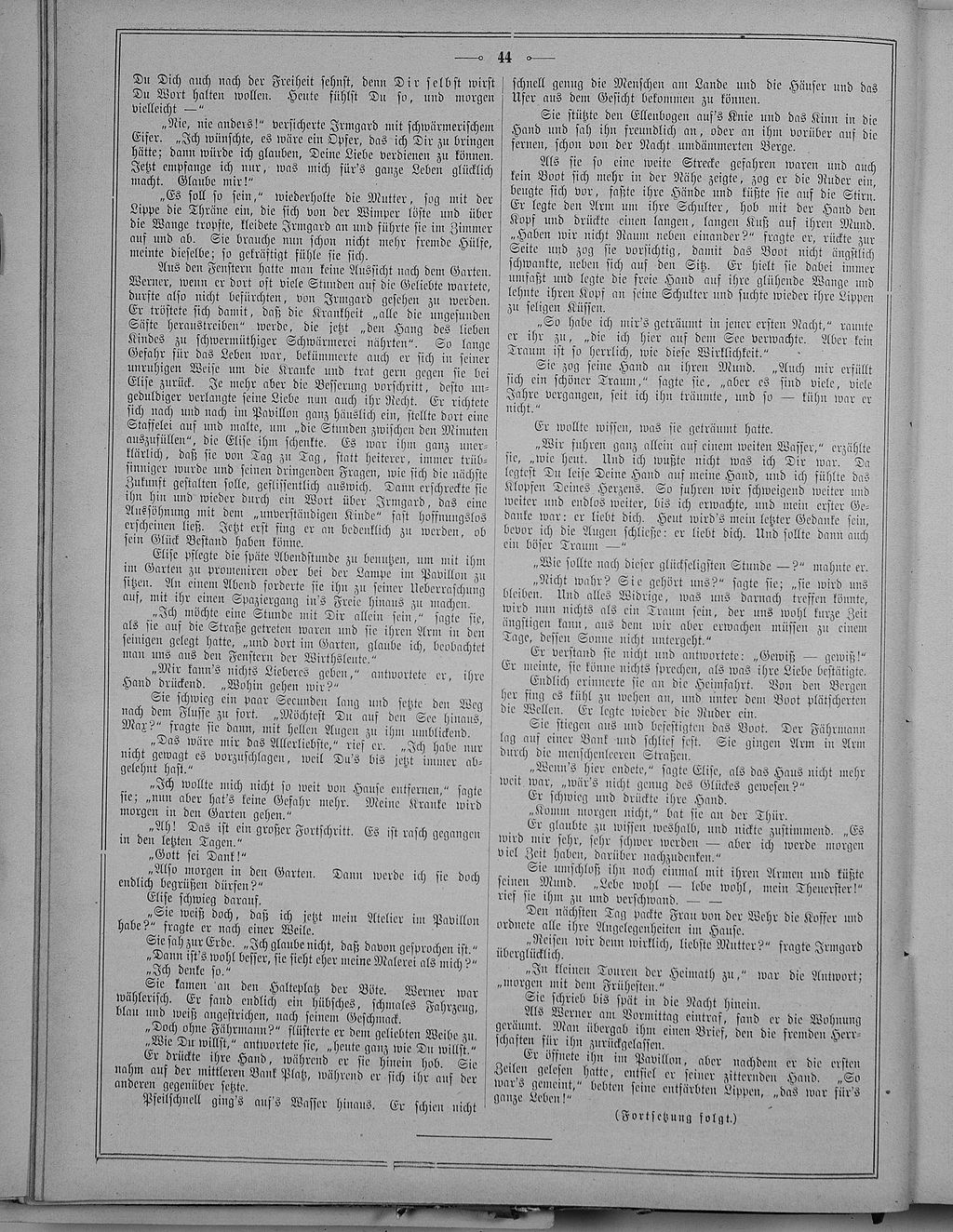| Verschiedene: Die Gartenlaube (1878) | |
|
|
Du Dich auch nach der Freiheit sehnst, denn Dir selbst wirst Du Wort halten wollen. Heute fühlst Du so, und morgen vielleicht –“
„Nie, nie anders!“ versicherte Irmgard mit schwärmerischem Eifer. „Ich wünschte, es wäre ein Opfer, das ich Dir zu bringen hätte, dann würde ich glauben, Deine Liebe verdienen zu können. Jetzt empfange ich nur, was mich für’s ganze Leben glücklich macht. Glaube mir!“
„Es soll so sein,“ wiederholte die Mutter, sog mit der Lippe die Thräne ein, die sich von der Wimper löste und über die Wange tropfte, kleidete Irmgard an und führte sie im Zimmer auf und ab. Sie brauche nun schon nicht mehr fremde Hülfe, meinte dieselbe; so gekräftigt fühle sie sich.
Aus den Fenstern hatte man keine Aussicht nach dem Garten. Werner, wenn er dort oft viele Stunden auf die Geliebte wartete, durfte also nicht befürchten, von Irmgard gesehen zu werden. Er tröstete sich damit, daß die Krankheit „alle die ungesunden Säfte heraustreiben“ werde, die jetzt „den Hang des lieben Kindes zu schwermüthiger Schwärmerei nährten“. So lange Gefahr für das Leben war, bekümmerte auch er sich in seiner unruhigen Weise um die Kranke und trat gern gegen sie bei Elise zurück. Je mehr aber die Besserung vorschritt, desto ungeduldiger verlangte seine Liebe nun auch ihr Recht. Er richtete sich nach und nach im Pavillon ganz häuslich ein, stellte dort eine Staffelei auf und malte, um „die Stunden zwischen den Minuten auszufüllen“, die Elise ihm schenkte. Es war ihm ganz unerklärlich, daß sie von Tag zu Tag, statt heiterer, immer trübsinniger wurde und seinen dringenden Fragen, wie sich die nächste Zukunft gestalten solle, geflissentlich auswich. Dann erschreckte sie ihn hin und wieder durch ein Wort über Irmgard, das eine Ausöhnung mit dem „unverständigen Kinde“ fast hoffnungslos erscheinen ließ. Jetzt erst fing er an bedenklich zu werden, ob sein Glück Bestand haben könne.
Elise pflegte die späte Abendstunde zu benutzen, um mit ihm im Garten zu promeniren oder bei der Lampe im Pavillon zu sitzen. An einem Abend forderte sie ihn zu seiner Ueberraschung auf, mit ihr einen Spaziergang in’s Freie hinaus zu machen.
„Ich möchte eine Stunde mit Dir allein sein,“ sagte sie, als sie auf die Straße getreten waren und sie ihren Arm in den seinigen gelegt hatte, „und dort im Garten, glaube ich, beobachtet man uns aus den Fenstern der Wirthsleute.“
„Mir kann’s nichts Lieberes geben,“ antwortete er, ihre Hand drückend. „Wohin gehen wir?“
Sie schwieg ein paar Secunden lang und setzte den Weg nach dem Flusse zu fort. „Möchtest Du auf den See hinaus, Max?“ fragte sie dann, mit hellen Augen zu ihm umblickend.
„Das wäre mir das Allerliebste,“ rief er. „Ich habe nur nicht gewagt es vorzuschlagen, weil Du’s bis jetzt immer abgelehnt hast.“
„Ich wollte mich nicht so weit von Hause entfernen,“ sagte sie; „nun aber hat’s keine Gefahr mehr. Meine Kranke wird morgen in den Garten gehen.“
„Ah! Das ist ein großer Fortschritt. Es ist rasch gegangen in den letzten Tagen.“
„Gott sei Dank!“
„Also morgen in den Garten. Dann werde ich sie doch endlich begrüßen dürfen?“
Elise schwieg darauf.
„Sie weiß doch, daß ich jetzt mein Atelier im Pavillon habe?“ fragte er nach einer Weile.
Sie sah zur Erde. „Ich glaube nicht, daß davon gesprochen ist.“
„Dann ist’s wohl besser, sie sieht eher meine Malerei als mich?“
„Ich denke so.“
Sie kamen an den Halteplatz der Böte. Werner war wählerisch. Er fand endlich ein hübsches, schmales Fahrzeug, blau und weiß angestrichen, nach seinem Geschmack.
„Doch ohne Fährmann?“ flüsterte er dem geliebten Weibe zu.
„Wie Du willst,“ antwortete sie, „heute ganz wie Du willst.“
Er drückte ihre Hand, während er sie hinein hob. Sie nahm auf der mittleren Bank Platz, während er sich ihr auf der anderen gegenüber setzte.
Pfeilschnell ging’s auf’s Wasser hinaus. Er schien nicht schnell genug die Menschen am Lande und die Häuser und das Ufer aus dem Gesicht bekommen zu können.
Sie stützte den Ellenbogen auf’s Knie und das Kinn in die Hand und sah ihn freundlich an, oder an ihm vorüber auf die fernen, schon von der Nacht umdämmerten Berge.
Als sie so eine weite Strecke gefahren waren und auch kein Boot sich mehr in der Nähe zeigte, zog er die Ruder ein, beugte sich vor, faßte ihre Hände und küßte sie auf die Stirn. Er legte den Arm um ihre Schulter, hob mit der Hand den Kopf und drückte einen langen, langen Kuß auf ihren Mund. „Haben wir nicht Raum neben einander?“ fragte er, rückte zur Seite und zog sie vorsichtig, damit das Boot nicht ängstlich schwankte, neben sich auf den Sitz. Er hielt sie dabei immer umfaßt und legte die freie Hand auf ihre glühende Wange und lehnte ihren Kopf an seine Schulter und suchte wieder ihre Lippen zu seligen Küssen.
„So habe ich mir’s geträumt in jener ersten Nacht,“ raunte er ihr zu, „die ich hier auf dem See verwachte. Aber kein Traum ist so herrlich, wie diese Wirklichkeit.“
Sie zog seine Hand an ihren Mund. „Auch mir erfüllt sich ein schöner Traum,“ sagte sie, „aber es sind viele, viele Jahre vergangen, seit ich ihn träumte, und so – kühn war er nicht.“
Er wollte wissen, was sie geträumt hatte.
„Wir fuhren ganz allein auf einem weiten Wasser,“ erzählte sie, „wie heut. Und ich wußte nicht was ich Dir war. Da legtest Du leise Deine Hand auf meine Hand, und ich fühlte das Klopfen Deines Herzens. So fuhren wir schweigend weiter und weiter und endlos weiter, bis ich erwachte, und mein erster Gedanke war: er liebt dich. Heut wird’s mein letzter Gedanke sein, bevor ich die Augen schließe: er liebt dich. Und sollte dann auch ein böser Traum –“
„Wie sollte nach dieser glückseligsten Stunde –?“ mahnte er.
„Nicht wahr? Sie gehört uns?“ sagte sie, „sie wird uns bleiben. Und alles Widrige, was uns darnach treffen könnte, wird nun nichts als ein Traum sein, der uns wohl kurze Zeit ängstigen kann, aus dem wir aber erwachen müssen zu einem Tage, dessen Sonne nicht untergeht.“
Er verstand sie nicht und antwortete: „Gewiß – gewiß!“ Er meinte, sie könne nichts sprechen, als was ihre Liebe bestätigte.
Endlich erinnerte sie an die Heimfahrt. Von den Bergen her fing es kühl zu wehen an, und unter dem Boot plätscherten die Wellen. Er legte wieder die Ruder ein.
Sie stiegen aus und befestigten das Boot. Der Fährmann lag auf einer Bank und schlief fest. Sie gingen Arm in Arm durch die menschenleeren Straßen.
„Wenn’s hier endete,“ sagte Elise, als das Haus nicht mehr weit war, „wär’s nicht genug des Glückes gewesen?“
Er schwieg und drückte ihre Hand.
„Komm morgen nicht,“ bat sie an der Thür.
Er glaubte zu wissen weshalb, und nickte zustimmend. „Es wird mir sehr, sehr schwer werden – aber ich werde morgen viel Zeit haben, darüber nachzudenken.“
Sie umschloß ihn noch einmal mit ihren Armen und küßte seinen Mund. „Lebe wohl – lebe wohl, mein Theuerster!“ rief sie ihm zu und verschwand. – –
Den nächsten Tag packte Frau von der Wehr die Koffer und ordnete alle ihre Angelegenheiten im Hause.
„Reisen wir denn wirklich, liebste Mutter?“ fragte Irmgard überglücklich.
„In kleinen Touren der Heimath zu,“ war die Antwort; „morgen mit dem Frühesten.“
Sie schrieb bis spät in die Nacht hinein.
Als Werner am Vormittag eintraf, fand er die Wohnung geräumt. Man übergab ihm einen Brief, den die fremden Herrschaften für ihn zurückgelassen.
Er öffnete ihn im Pavillon, aber nachdem er die ersten Zeilen gelesen hatte, entfiel er seiner zitternden Hand. „So war’s gemeint,“ bebten seine entfärbten Lippen, „das war für’s ganze Leben!“
Verschiedene: Die Gartenlaube (1878). Leipzig: Ernst Keil, 1878, Seite 44. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1878)_044.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)