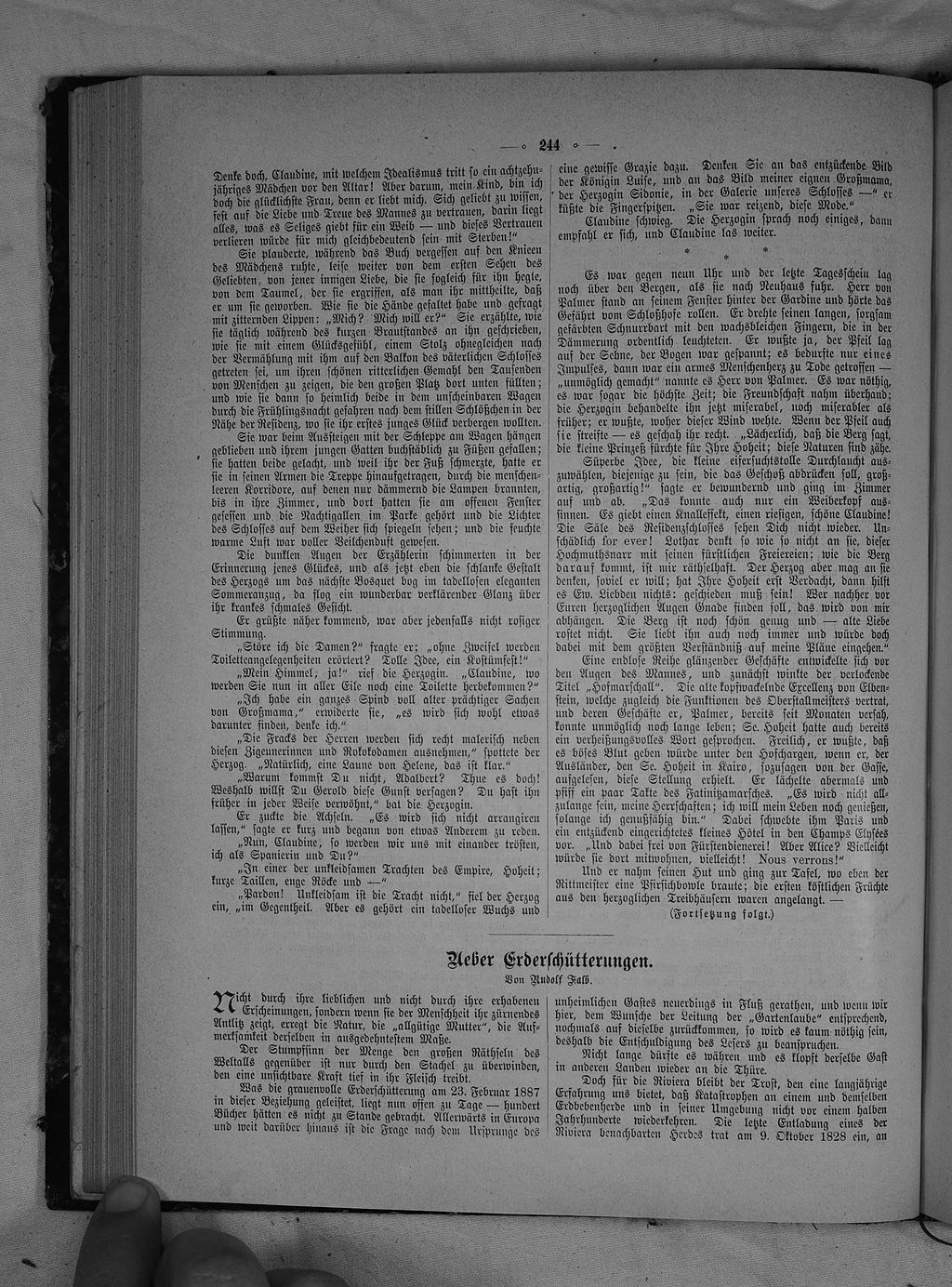| Verschiedene: Die Gartenlaube (1888) | |
|
|
Denke doch, Claudine, mit welchem Idealismus tritt so ein achtzehnjähriges Mädchen vor den Altar! Aber darum, mein Kind, bin ich doch die glücklichste Frau, denn er liebt mich. Sich geliebt zu wissen, fest auf die Liebe und Treue des Mannes zu vertrauen, darin liegt alles, was es Seliges giebt für ein Weib – und dieses Vertrauen verlieren würde für mich gleichbedeutend sein mit Sterben!“
Sie plauderte, während das Buch vergessen auf den Knieen des Mädchens ruhte, leise weiter von dem ersten Sehen des Geliebten, von jener innigen Liebe, die sie sogleich für ihn hegte, von dem Taumel, der sie ergriffen, als man ihr mittheilte, daß er um sie geworben. Wie sie die Hände gefaltet habe und gefragt mit zitternden Lippen: „Mich? Mich will er?“ Sie erzählte, wie sie täglich während des kurzen Brautstandes an ihn geschrieben, wie sie mit einem Glücksgefühl, einem Stolz ohnegleichen nach der Vermählung mit ihm auf den Balkon des väterlichen Schlosses getreten sei, um ihren schönen ritterlichen Gemahl den Tausenden von Menschen zu zeigen, die den großen Platz dort unten füllten; und wie sie dann so heimlich beide in dem unscheinbaren Wagen durch die Frühlingsnacht gefahren nach dem stillen Schlößchen in der Nähe der Residenz, wo sie ihr erstes junges Glück verbergen wollten.
Sie war beim Aussteigen mit der Schleppe am Wagen hängen geblieben und ihrem jungen Gatten buchstäblich zu Füßen gefallen; sie hatten beide gelacht, und weil ihr der Fuß schmerzte, hatte er sie in seinen Armen die Treppe hinaufgetragen, durch die menschenleeren Korridore, auf denen nur dämmernd die Lampen brannten, bis in ihre Zimmer, und dort hatten sie am offenen Fenster gesessen und die Nachtigallen im Parke gehört und die Lichter des Schlosses auf dem Weiher sich spiegeln sehen; und die feuchte warme Luft war voller Veilchenduft gewesen.
Die dunklen Augen der Erzählerin schimmerten in der Erinnerung jenes Glückes, und als jetzt eben die schlanke Gestalt des Herzogs um das nächste Bosquet bog im tadellosen eleganten Sommeranzug, da flog ein wunderbar verklärender Glanz über ihr krankes schmales Gesicht.
Er grüßte näher kommend, war aber jedenfalls nicht rosiger Stimmung.
„Störe ich die Damen?“ fragte er; „ohne Zweifel werden Toiletteangelegenheiten erörtert? Tolle Idee, ein Kostümfest!“
„Mein Himmel, ja!“ rief die Herzogin. „Claudine, wo werden Sie nun in aller Eile noch eine Toilette herbekommen?“
„Ich habe ein ganzes Spind voll alter prächtiger Sachen von Großmama,“ erwiderte sie, „es wird sich wohl etwas darunter finden, denke ich.“
„Die Fracks der Herren werden sich recht malerisch neben diesen Zigeunerinnen und Rokokodamen ausnehmen,“ spottete der Herzog. „Natürlich, eine Laune von Helene, das ist klar.“
„Warum kommst Du nicht, Adalbert? Thue es doch! Weshalb willst Du Gerold diese Gunst versagen? Du hast ihn früher in jeder Weise verwöhnt,“ bat die Herzogin.
Er zuckte die Achseln. „Es wird sich nicht arrangiren lassen,“ sagte er kurz und begann von etwas Anderem zu reden.
„Nun, Claudine, so werden wir uns mit einander trösten, ich als Spanierin und Du?“
„In einer der unkleidsamen Trachten des Empire, Hoheit; kurze Taillen, enge Röcke und –“
„Pardon! Unkleidsam ist die Tracht nicht,“ fiel der Herzog ein, „im Gegentheil. Aber es gehört ein tadelloser Wuchs und eine gewisse Grazie dazu. Denken Sie an das entzückende Bild der Königin Luise, und an das Bild meiner eignen Großmama, der Herzogin Sidonie, in der Galerie unseres Schlosses –“ er küßte die Fingerspitzen. „Sie war reizend, diese Mode.“
Claudine schwieg. Die Herzogin sprach noch einiges, dann empfahl er sich, und Claudine las weiter.
*
Es war gegen neun Uhr und der letzte Tagesschein lag noch über den Bergen, als sie nach Neuhaus fuhr. Herr von Palmer stand an seinem Fenster hinter der Gardine und hörte das Gefährt vom Schloßhofe rollen. Er drehte seinen langen, sorgsam gefärbten Schnurrbart mit den wachsbleichen Fingern, die in der Dämmerung ordentlich leuchteten. Er wußte ja, der Pfeil lag auf der Sehne, der Bogen war gespannt; es bedurfte nur eines Impulses, dann war ein armes Menschenherz zu Tode getroffen – „unmöglich gemacht“ nannte es Herr von Palmer. Es war nöthig, es war sogar die höchste Zeit; die Freundschaft nahm überhand; die Herzogin behandelte ihn jetzt miserabel, noch miserabler als früher; er wußte, woher dieser Wind wehte. Wenn der Pfeil auch sie streifte – es geschah ihr recht. „Lächerlich, daß die Berg sagt, die kleine Prinzeß fürchte für Ihre Hoheit; diese Naturen sind zähe.
Süperbe Idee, die kleine eifersuchtstolle Durchlaucht auszuwählen, diejenige zu sein, die das Geschoß abdrücken soll, großartig, großartig!“ sagte er bewundernd und ging im Zimmer auf und ab. „Das konnte auch nur ein Weiberkopf aussinnen. Es giebt einen Knalleffekt, einen riesigen, schöne Claudine! Die Säle des Residenzschlosses sehen Dich nicht wieder. Unschädlich for ever! Lothar denkt so wie so nicht an sie, dieser Hochmuthsnarr mit seinen fürstlichen Freiereien; wie die Berg darauf kommt, ist mir räthselhaft. Der Herzog aber mag an sie denken, soviel er will, hat Ihre Hoheit erst Verdacht, dann hilft es Ew. Liebden nichts: geschieden muß sein! Wer nachher vor Euren herzoglichen Augen Gnade finden soll, das wird von mir abhängen. Die Berg ist noch schön genug und – alte Liebe rostet nicht. Sie liebt ihn auch noch immer und würde doch dabei mit dem größten Verständniß auf meine Pläne eingehen.“
Eine endlose Reihe glänzender Geschäfte entwickelte sich vor den Augen des Mannes, und zunächst winkte der verlockende Titel „Hofmarschall“. Die alte kopfwackelnde Excellenz von Elbenstein, welche zugleich die Funktionen des Oberstallmeisters vertrat, und deren Geschäfte er, Palmer, bereits seit Monaten versah, konnte unmöglich noch lange leben; Se. Hoheit hatte auch bereits ein verheißungsvolles Wort gesprochen. Freilich, er wußte, daß es böses Blut geben würde unter den Hofchargen, wenn er, der Ausländer, den Se. Hoheit in Kairo, sozusagen von der Gasse, aufgelesen, diese Stellung erhielt. Er lächelte abermals und pfiff ein paar Takte des Fatinitzamarsches. „Es wird nicht allzulange sein, meine Herrschaften; ich will mein Leben noch genießen, solange ich genußfähig bin“ Dabei schwebte ihm Paris und ein entzückend eingerichtetes kleines Hôtel in den Champs Elysées vor. „Und dabei frei von Fürstendienerei! Aber Alice? Vielleicht würde sie dort mitwohnen, vielleicht! Nous verrons!“
Und er nahm seinen Hut und ging zur Tafel, wo eben der Rittmeister eine Pfirsichbowle braute; die ersten köstlichen Früchte aus den herzoglichen Treibhäusern waren angelangt. –
Nicht durch ihre lieblichen und nicht durch ihre erhabenen Erscheinungen, sondern wenn sie der Menschheit ihr zürnendes Antlitz zeigt, erregt die Natur, die „allgütige Mutter“, die Aufmerksamkeit derselben in ausgedehntestem Maße.
Der Stumpfsinn der Menge den großen Räthseln des Weltalls gegenüber ist nur durch den Stachel zu überwinden, den eine unsichtbare Kraft tief in ihr Fleisch treibt.
Was die grauenvolle Erderschütterung am Februar 23. Februar 1887 in dieser Beziehung geleistet, liegt nun offen zu Tage – hundert Bücher hätten es nicht zu Stande gebracht. Allerwärts in Europa und weit darüber hinaus ist die Frage nach dem Ursprunge des unheimlichen Gastes neuerdings in Fluß gerathen, und wenn wir hier, dem Wunsche der Leitung der „Gartenlaube“ entsprechend, nochmals auf dieselbe zurückkommen. so wird es kaum nöthig sein, deshalb die Entschuldigung des Lesers zu beanspruchen.
Nicht lange dürfte es währen und es klopft derselbe Gast in anderen Landen wieder an die Thüre.
Doch für die Riviera bleibt der Trost, den eine langjährige Erfahrung uns bietet, daß Katastrophen an einem und demselben Erdbebenherde und in seiner Umgebung nicht vor einem halben Jahrhunderte wiederkehren. Die letzte Entladung eines der Riviera benachbarten Herdes trat am 9. Oktober 1828 ein, an
Verschiedene: Die Gartenlaube (1888). Leipzig: Ernst Keil, 1888, Seite 244. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1888)_244.jpg&oldid=- (Version vom 16.3.2018)