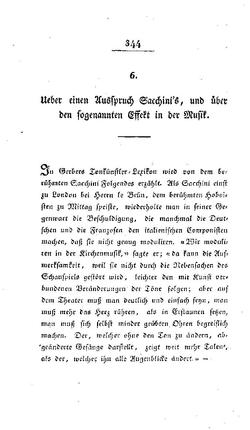Ueber einen Ausspruch Sacchini’s, und über den sogenannten Effekt in der Musik
Ueber einen Ausspruch Sacchini’s, und über den sogenannten Effekt in der Musik.
In Gerbers Tonkünstler-Lexikon[WS 1] wird von dem berühmten Sacchini[WS 2] Folgendes erzählt. Als Sacchini einst zu London bei Herrn le Brün,[WS 3] dem berühmten Hoboisten, zu Mittag speiste, wiederholte man in seiner Gegenwart die Beschuldigung, die manchmal die Deutschen und die Franzosen den italienischen Componisten machen, daß sie nicht genug moduliren. „Wir moduliren in der Kirchenmusik,“ sagte er; „da kann die Aufmerksamkeit, weil sie nicht durch die Nebensachen des Schauspiels gestört wird, leichter den mit Kunst verbundenen Veränderungen der Töne folgen; aber auf dem Theater muß man deutlich und einfach seyn, man muß mehr das Herz rühren, als in Erstaunen setzen, man muß sich selbst minder geübten Ohren begreiflich machen. Der, welcher ohne den Ton zu ändern, abgeänderte Gesänge darstellt, zeigt weit mehr Talent, als der, welcher ihn alle Augenblicke ändert.“ –
Dieser merkwürdige Ausspruch Sacchini’s legt die ganze Tendenz der italienischen Opernmusik damaliger Zeit an den Tag, und im Wesentlichen ist sie auch wol bis auf die jetzige Zeit dieselbe geblieben. Die Italiener erhoben sich nicht zu der Ansicht, daß die Oper in Wort, Handlung und Musik als ein Ganzes erscheinen, und dieses untrennbare Ganze im Totaleindruck auf den Zuhörer wirken müsse; die Musik war ihnen vielmehr zufällige Begleiterinn des Schauspiels, und durfte nur hin und wieder als selbständige Kunst, und dann für sich allein wirkend, hervortreten. So kam es, daß im eigentlichen Fortschreiten der Handlung alle Musik flach und unbedeutend gehalten wurde, und nur die Prima Donna und der Primo Huomo[WS 4] in ihren sogenannten Scenen in bedeutender, oder vielmehr wahrer Musik hervortreten durften. Hier galt es aber dann wieder, ohne Rücksicht auf den Moment der Handlung, nur den Gesang, ja oft auch nur die Kunstfertigkeit der Sänger im höchsten Glanze zu zeigen.
Sacchini verwirft in der Oper alles Starke, Erschütternde der Musik, welches er in die Kirche verweist; er hat es im Theater nur mit angenehmen, oder vielmehr nicht tief eingreifenden Empfindungen zu thun; er will nicht Erstaunen, nur sanfte Rührung erregen. Als wenn die Oper durch die Verbindung der individualisirten Sprache mit der allgemeinen Sprache der Musik nicht eben die höchste, das Innerste tief ergreifende Wirkung auf das Gemüth, schon ihrer Natur nach beabsichtigen müsse! Endlich will er durch die größte Einfachheit, oder vielmehr Monotonie, auch dem ungeübten Ohr verständlich werden; allein das ist ja eben die höchste, oder vielmehr die wahre Kunst des Componisten, daß er durch die Wahrheit des Ausdrucks Jeden rührt, Jeden erschüttert, wie es der Moment der Handlung erfodert, ja diesen Moment der Handlung selbst schafft, wie der Dichter. Alle Mittel, die der unerschöpfliche Reichthum der Tonkunst ihm darbietet, sind sein eigen, und er braucht sie, so wie sie zu jener Wahrheit als nothwendig erscheinen. So wird z. B. die künstlichste Modulation, ihr schneller Wechsel an rechter Stelle, dem ungeübtesten Ohr in höherer Rücksicht verständlich seyn, das heißt: nicht die technische Struktur erkennt der Laie, worauf es auch gar nicht ankommt, sondern der Moment der Handlung ist es, der ihn gewaltig ergreift. Wenn im Don Juan die Statue des Kommandanten im Grundton E ihr furchtbares: Ja! ertönen läßt, nun aber der Componist dieses E als Terz von C annimmt, und so in C dur modulirt, welche Tonart Leporello ergreift: so wird kein Laie der Musik die technische Struktur dieses Ueberganges verstehen, aber im Innersten mit dem Leporello erbeben, und eben so wenig wird der Musiker, der auf der höchsten Stufe der Bildung steht, in dem Augenblick der tiefsten Anregung an jene Struktur denken, denn ihm ist das Gerüste längst eingefallen, und er trifft wieder mit dem Laien zusammen.
Die wahre Kirchenmusik, nämlich diejenige, die den Cultus begleitet, oder vielmehr selbst Cultus ist, erscheint als überirdische – als Sprache des Himmels. Die Ahnungen des höchsten Wesens, welche die heiligen Töne in des Menschen Brust entzünden, sind das höchste Wesen selbst, welches in der Musik verständlich von dem überschwänglich herrlichen Reiche des Glaubens und der Liebe redet. Die Worte, die sich dem Gesange beigesellen, sind nur zufällig, und enthalten auch meistens nur bildliche Andeutungen, wie z. B. in der Missa. In dem irdischen Leben, dem wir uns entschwungen, blieb der Gährungsstoff des Bösen zurück, der die Leidenschaften erzeugte, und selbst der Schmerz löste sich auf in die inbrünstige Sehnsucht der ewigen Liebe. Folgt nicht aber hieraus von selbst, daß die einfachen Modulationen, die den Ausdruck eines zerrissenen, beängsteten Gemüths in sich tragen, eben aus der Kirche zu verbannen sind, weil sie gerade dort zerstreuen und den Geist befangen mit weltlichem, irdischem Treiben? Sacchini’s Ausspruch ist daher gerade umzukehren, wiewol er, da er sich ausdrücklich auf die Meister seines Landes bezieht, und gewiß die älteren im Sinn hatte, unter dem häufigeren Moduliren in der Kirchenmusik nur den größern Reichthum des harmonischen Stoffs meinte. Rücksichtlich der Opernmusik änderte er auch wahrscheinlich seine Meinung, als er Gluck’s Werke in Paris gehört hatte, denn sonst würde er, dem von ihm selbst aufgestellten Prinzip zuwider, nicht die starke, heftig ergreifende Fluchscene im Oedip auf Colonos[WS 5] gesetzt haben. -
Jene Wahrheit, daß die Oper in Wort, Handlung und Musik als ein Ganzes erscheinen müsse, sprach Gluck zuerst in seinen Werken deutlich aus; aber welche Wahrheit wird nicht mißverstanden, und veranlaßt so die sonderbarsten Mißgriffe! Welche Meisterwerke erzeugten nicht in blinder Nachahmerei die lächerlichsten Produkte! Dem blöden Auge erscheinen die Werke des hohen Genie’s, die es nicht vermochte in einem Brennpunkt aufzufassen, wie ein deformirtes Gemälde, und dieses Gemäldes zerstreute Züge wurden getadelt und nachgeahmt. Göthe’s Werther veranlaßte die weinerlichen Empfindeleien jener Zeit; sein Götz von Berlichingen schuf die ungeschlachten, leeren Harnische, aus denen die hohlen Stimmen der biderben Grobheit und des prosaisch tollen Unsinns erklangen. Göthe selbst sagt: (Aus meinem Leben, dritter Theil) die Wirkung jener Werke sey meistens stoffartig gewesen, und so kann man auch behaupten, daß die Wirkung von Glucks und Mozarts Werken, abgesehen von dem Text, in rein musikalischer Hinsicht nur stoffartig war. Auf den Stoff des musikalischen Gebäudes wurde nämlich das Auge gerichtet, und der höhere Geist, dem dieser Stoff dienen mußte, nicht entdeckt. Man fand bei dieser Betrachtung, vorzüglich bei Mozart, daß, außer der mannigfachen, frappanten Modulation, auch die häufige Anwendung der Blasinstrumente die erstaunliche Wirkung seiner Werke hervorbringen möge; und davon schreibt sich der Unfug der überladenen Instrumentirung und des bizarren, unmotivirten Modulirens her. Effekt wurde das Losungswort der Componisten, und Effekt zu machen, koste es was es wolle, die einzige Tendenz ihrer Bemühungen. Aber eben dieses Bemühen nach dem Effekt beweiset, daß er abwesend ist, und sich nicht willig finden läßt, da einzukehren, wo der Componist wünscht, daß er anzutreffen seyn möge. – Mit einem Wort: der Künstler muß, um uns zu rühren, um uns gewaltig zu ergreifen, selbst in eigner Brust tief durchdrungen seyn, und nur das in der Extase bewußtlos im Innern Empfangene mit höherer Kraft festzuhalten in den Hieroglyphen der Töne (den Noten) ist die Kunst, wirkungsvoll zu componiren. Fragt daher ein junger Künstler, wie er es anfangen solle, eine Oper mit recht vielem Effekt zu setzen, so kann man ihm nur antworten: Lies das Gedicht, richte mit aller Kraft den Geist darauf, gehe ein mit aller Macht Deiner Phantasie in die Momente der Handlung: Du lebst in den Personen des Gedichts, Du bist selbst der Tyrann, der Held, die Geliebte; Du fühlst den Schmerz, das Entzücken der Liebe, die Schmach, die Furcht, das Entsetzen, ja des Todes namenlose Qual, die Wonne seliger Verklärung; Du zürnest, Du wüthest, Du hoffest, Du verzweifelst; Dein Blut glüht durch die Adern, heftiger schlagen Deine Pulse; in dem Feuer der Begeisterung, das Deine Brust entflammt, entzünden sich Töne, Melodien, Akkorde, und in der wundervollen Sprache der Musik strömt das Gedicht aus Deinem Innern hervor. Die technische Uebung durch Studium der Harmonik, der Werke großer Meister, durch Selbstschreiben bewirkt, daß Du immer deutlicher und deutlicher Deine innere Musik vernimmst, keine Melodie, keine Modulation, kein Instrument entgeht Dir, und so empfängst Du mit der Wirkung auch zugleich die Mittel, die Du nun, wie Deiner Macht unterworfene Geister, in das Zauberbuch der Partitur bannst. – Freilich heißt das Alles nur so viel, als: Sey so gut, Lieber, und sorge nur dafür, ein recht musikalischer Genius zu seyn; das Andere findet sich dann von selbst! Aber es ist dem wirklich so, und nicht anders.
Dessen ungeachtet läßt sich denken, daß Mancher den wahren Funken, den er in sich trägt, überbaut, indem er, der eigenen Kraft mißtrauend, den aus dem Innern keimenden Gedanken verwerfend, ängstlich Alles, was er in den Werken großer Meister als effektvoll anerkannt, zu benutzen strebt, und so in Nachahmerei der Form geräth, die nie den Geist schafft, da nur der Geist sich die Form bildet. Das ewige Schreien der Theaterdirektoren, die, nach dem auf den Brettern kursirenden Ausdruck, das Publikum gepackt haben wollen: „Nur Effekt! Effekt!“ und die Foderungen der sogenannten ekeln Kenner, denen der Pfeffer nicht mehr gepfeffert genug ist, regen oft den Musiker an, in einer Art verzagter Verzweiflung, wo möglich, jene Meister noch im Effekt zu überbieten, und so entstehen die wunderlichen Compositionen, in denen ohne Motive – das heißt, ohne daß die Momente des Gedichts nur irgend den Anlaß dazu in sich tragen sollten – grelle Ausweichungen, mächtige Akkorde aller nur möglichen Blasinstrumente, auf einander folgen, wie bunte Farben, die nie zum Bilde werden. Der Componist erscheint wie ein Schlaftrunkener, den jeden Augenblick gewaltige Hammerschläge wecken, und der immer wieder in den Schlaf zurückfällt. Tondichter dieser Art sind höchlich verwundert, wenn ihr Werk, trotz den Bemühungen, womit sie sich gequält, durchaus nicht den Effekt, wie sie sich ihn vorgestellt, machen will, und denken gewiß nicht daran, daß die Musik, wie sie ihr individueller Genius schuf, wie sie aus ihrem Innern strömte, und die ihnen zu einfach, zu leer schien, vielleicht unendlich mehr gewirkt haben würde. Ihre ängstliche Verzagtheit verblendete sie und raubte ihnen die wahre Erkenntniß jener Meisterwerke, die sie sich zum Muster nahmen, und nun an den Mitteln, als demjenigen hängen blieben, worin der Effekt zu suchen sey. Aber, wie schon oben gesagt, es ist ja nur der Geist, der, die Mittel in freier Willkühr beherrschend, in jenen Werken die unwiderstehliche Gewalt ausübt; nur das Tongedicht, das wahr und kräftig aus dem Innern hervorging, dringt wieder ein in das Innere des Zuhörers. Der Geist versteht nur die Sprache des Geistes.
Regeln zu geben, wie man den Effekt in der Musik hervorbringen solle, ist daher wol unmöglich: aber leitende Winke können den, mit sich selbst uneins gewordenen Tondichter, der sich wie von Irrlichtern geblendet, abwärts verirrte, wieder auf Weg und Steg zurückbringen.
Das Erste und Vorzüglichste in der Musik, welches mit wunderbarer Zauberkraft das menschliche Gemüth ergreift, ist die Melodie. – Nicht genug zu sagen ist es, daß ohne ausdrucksvolle, singbare Melodie jeder Schmuck der Instrumente u. s. w. nur ein glänzender Putz ist, der, keinen lebenden Körper zierend, wie in Shakspeare’s Sturm,[WS 6] an der Schnur hängt, und nach dem der dumme Pöbel läuft. Singbar ist, im höhern Sinn genommen, ein herrliches Prädikat, um die wahre Melodie zu bezeichnen. Diese soll Gesang seyn, frei und ungezwungen unmittelbar aus der Brust des Menschen strömen, der selbst das Instrument ist, welches in den wunderbarsten geheimnißvollsten Lauten der Natur ertönt. Die Melodie, die auf diese Weise nicht singbar ist, kann nur eine Reihe einzelner Töne bleiben, die vergebens danach streben, Musik zu werden. Es ist unglaublich, wie in neuerer Zeit, vorzüglich auf die Anregung eines mißverstandenen Meisters (Cherubini’s),[WS 7] eben die Melodie vernachlässigt worden, und aus dem Abquälen, immer originell und frappant zu seyn, das gänzlich Unsingbare mehrerer Tongedichte entstanden ist. Wie kommt es denn, daß die einfachen Gesänge der alten Italiener, oft nur vom Baß begleitet, das Gemüth so unwiderstehlich rühren und erheben? Liegt es nicht lediglich in dem herrlichen, wahrhaft singenden Gesange? Ueberhaupt ist der Gesang ein wol unbestrittenes einheimisches Eigenthum jenes in Musik erglühten Volks, und der Deutsche mag, ist er auch zur höhern, oder vielmehr zur wahren Ansicht der Oper gelangt, doch auf jede ihm nur mögliche Weise sich mit jenen Geistern befreunden, damit sie es nicht verschmähen, wie mit geheimer, magischer Kraft einzugehen in sein Inneres und die Melodie zu entzünden. Ein herrliches Beispiel dieser innigsten Befreundung giebt der hohe Meister der Kunst, Mozart, in dessen Brust der italienische Gesang erglühte. Welcher Componist schrieb singbarer, als er? Auch ohne den Glanz des Orchesters dringt jede seiner Melodien tief ein in das Innere, und darin liegt ja schon die wunderbare Wirkung seiner Compositionen. –
Was nun die Modulationen betrifft, so sollen nur die Momente des Gedichts den Anlaß dazu geben; sie gehen aus den verschiedenen Anregungen des bewegten Gemüths hervor, und so wie diese – sanft, stark, gewaltig, allmählig emporkeimend, plötzlich ergreifend sind, wird auch der Componist, in dem die wunderbare Kunst der Harmonik als eine herrliche Gabe der Natur liegt, so daß ihm das technische Studium nur das deutliche Bewußtseyn darüber verschafft, bald in verwandte, bald in entfernte Tonarten, bald allmählig übergehen, bald mit einem kühnen Ruck ausweichen. Der ächte Genius sinnt nicht darauf, zu frappiren durch erkünstelte Künstlichkeit, die zur argen Unkunst wird; er schreibt es nur auf, wie sein innerer Geist die Momente der Handlung in Tönen aussprach, und mögen dann die musikalischen Rechenmeister zu nützlicher Uebung aus seinen Werken ihre Exempel ziehen. Zu weit würde es führen, hier über die tiefe Kunst der Harmonik zu sprechen, wie sie in unserm Innern begründet ist, und wie sich dem schärfer Eindringenden geheimnißvolle Gesetze offenbaren, die kein Lehrbuch enthält. Nur um eine einzelne Erscheinung anzudeuten, sey es bemerkt, daß die grellen Ausweichungen nur dann von tiefer Wirkung sind, wenn, unerachtet ihrer Heterogeneität, die Tonarten doch in geheimer, dem Geist des Musikers klar gewordener Beziehung stehen. Mag die anfangs erwähnte Stelle des Duetts im Don Juan auch hier zum Beispiel dienen. – Hieher gehören auch die wegen des Mißbrauchs oft bespöttelten, enharmonischen Ausweichungen,[WS 8] die eben jene geheime Beziehung in sich tragen, und deren oft gewaltige Wirkung sich nicht bezweifeln läßt. Es ist, als ob ein geheimes, sympathetisches Band oft manche entfernt liegende Tonarten verbände; und ob unter gewissen Umständen eine unbezwingbare Idiosynkrasie[WS 9] selbst die nächstverwandten Tonarten trenne. Die gewöhnlichste, häufigste Modulation, nämlich aus der Tonika in die Dominante und umgekehrt, erscheint zuweilen unerwartet und fremdartig, oft dagegen widrig und unausstehlich. –
In der Instrumentirung liegt freilich ebenfalls ein großer Theil der erstaunlichen Wirkung verborgen, die oft die genialen Werke hoher Meister hervorbringen. Hier möchte es aber wol kaum möglich seyn, auch nur eine einzige Regel zu wagen: denn eben dieser Theil der musikalischen Kunst ist in mystisches Dunkel gehüllt. Jedes Instrument trägt, rücksichtlich der Verschiedenheit seiner Wirkung in einzelnen Fällen, hundert andere in sich, und es ist z. B. ein thörichter Wahn, daß nur ihr Zusammenwirken unbedingt das Starke, das Mächtige auszudrücken im Stande seyn sollte. Ein einzelner, von diesem oder jenem Instrumente ausgehaltener Ton bewirkt oft inneres Erbeben. Hiervon geben viele Stellen in Gluck’schen Opern auffallende Beispiele, und um jene Verschiedenheit der Wirkung, deren jedes Instrument fähig ist, recht einzusehen, denke man nur daran, mit welchem heterogenen Effekt Mozart dasselbe Instrument braucht – wie z. B. die Hoboe. – Hier sind nur Andeutungen möglich. – In dem Gemüth des Künstlers wird, um in dem Vergleich der Musik mit der Malerei zu bleiben, das Tongedicht wie ein vollendetes Gemälde erscheinen, und er im Anschauen jene richtige Perspektive, ohne welche keine Wahrheit möglich ist, von selbst finden. – Zu der Instrumentirung gehören auch die verschiedenen Figuren der begleitenden Instrumente; und wie oft erhebt eine solche richtig aus dem Innern aufgefaßte Figur die Wahrheit des Ausdrucks bis zur höchsten Kraft! Wie tiefergreifend ist nicht z. B. die in Oktaven fortschreitende Figur der zweiten Violine und der Viola in Mozarts Arie: Non mi dir bel idol mio etc.[WS 10] Auch rücksichtlich der Figuren läßt sich nichts künstlich ersinnen, nichts hinzumachen; die lebendigen Farben des Tongedichts heben das kleinste Detail glänzend hervor, und jeder fremde Schmuck würde nur entstellen, statt zu zieren. Eben so ist es mit der Wahl der Tonart, mit dem Forte und Piano, das aus dem tiefen Charakter des Stücks hervorgehen, und nicht etwa der Abwechselung wegen dastehen soll, und mit allen übrigen untergeordneten Ausdrucksmitteln, die sich dem Musiker darbieten.
Den zweifelhaften, nach Effekt ringenden, mißmuthigen Tondichter, wohnt nur der Genius in ihm, kann man unbedingt damit trösten, daß sein wahres, tiefes Eingehen in die Werke der Meister ihn bald mit dem Geiste dieser selbst in einen geheimnißvollen Rapport bringen, und daß dieser die ruhende Kraft entzünden, ja die Extase herbeiführen werde, in der er wie aus dumpfem Schlafe zum neuen Leben erwacht und die wunderbaren Laute seiner innern Musik vernimmt; dann giebt ihm sein Studium der Harmonik, seine technische Uebung die Kraft, jene Musik, die sonst vorüberrauschen würde, festzuhalten, und die Begeisterung, welche das Werk gebar, wird im wunderbarem Nachklange den Zuhörer mächtig ergreifen, so daß er der Seligkeit theilhaftig wird, die den Musiker in jenen Stunden der Weihe umfing. Dies ist aber der wahrhaftige Effekt des aus dem Innern hervorgegangenen Tongedichts. –
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Ernst Ludwig Gerber, Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, in zwei Bänden 1790–1792, in vier Bänden 1812–1814.
- ↑ Antonio Sacchini (1730–1786), die Anekdote steht in Band 2 (1792), Spalte 361–362.
- ↑ Ludwig August Lebrun (1752–1790), Oboen-Virtuose und Komponist der Mannheimer Schule, weilte 1779–1781 in London.
- ↑ Die Primadonna, die „Erste Dame“, ist die Haupt-Solistin eines Sängerensembles. Analog dazu seitens der Männerstimmen, der „Primo Huomo“.
- ↑ Sacchinis Oper Oedipe à Colone (Text: N. F. Guillard), eine Tragédie lyrique, wurde 1786 in Versailles uraufgeführt in der Übersetzung von C. Herklot unter dem Titel Oedip zu Colonas am 17. Oktober 1797 im Königlichen Nationaltheater Berlin erstmals gegeben. Hoffmann schrieb über die Berliner Aufführung am 17. September 1815 eine Rezension, die am 30. September im Dramaturgischen Wochenblatt Nr. 13, S. 99-100 erschien Google. Eine zweite Rezension Oedip auf Kolonos (aufgeführt am 15. Mai 1816) in derselben Zeitschrift 2. Halber-Jahrgang, Nr. 23 vom 8. Juni 1816, S.179-180 Google.
- ↑ William Shakespeare, Der Sturm, Vierter Aufzug, Erste Szene.
- ↑ Luigi Cherubini (1760-1842), italienischer Komponist und einflussreicher Lehrer am Pariser Konservatorium.
- ↑ Enharmonische Verwechslung bezeichnet syntaktisch verschiedene, aber von der Tonhöhe (jedenfalls in der Wohltemperierten Stimmung) her gleiche Töne. Auf dem Klavier ist z.B. Fis und Ges dieselbe Taste; doch wäre es ein Fehler in ♯-Tonarten Ges (oder in ♭-Tonarten Fis) für diesen Ton zu notieren. Durch Modulationen mit enharmonischer Verwechslung können auch sehr entfernte Tonarten elegant erreicht werden, was in der klassischen Musikästhetik allerdings verpönt war und erst in der musikalischen Romantik zum Ausdrucksmittel wurde.
- ↑ Idiosynkrasie, ein unüberwindbarer Widerwillen.
- ↑ Non mi dir, bell’idol mio – „Sag’ mir nicht, o Heißgeliebter“, Arie der Donna Anna im 2. Akt, Szene 12 von Mozarts Don Giovanni.