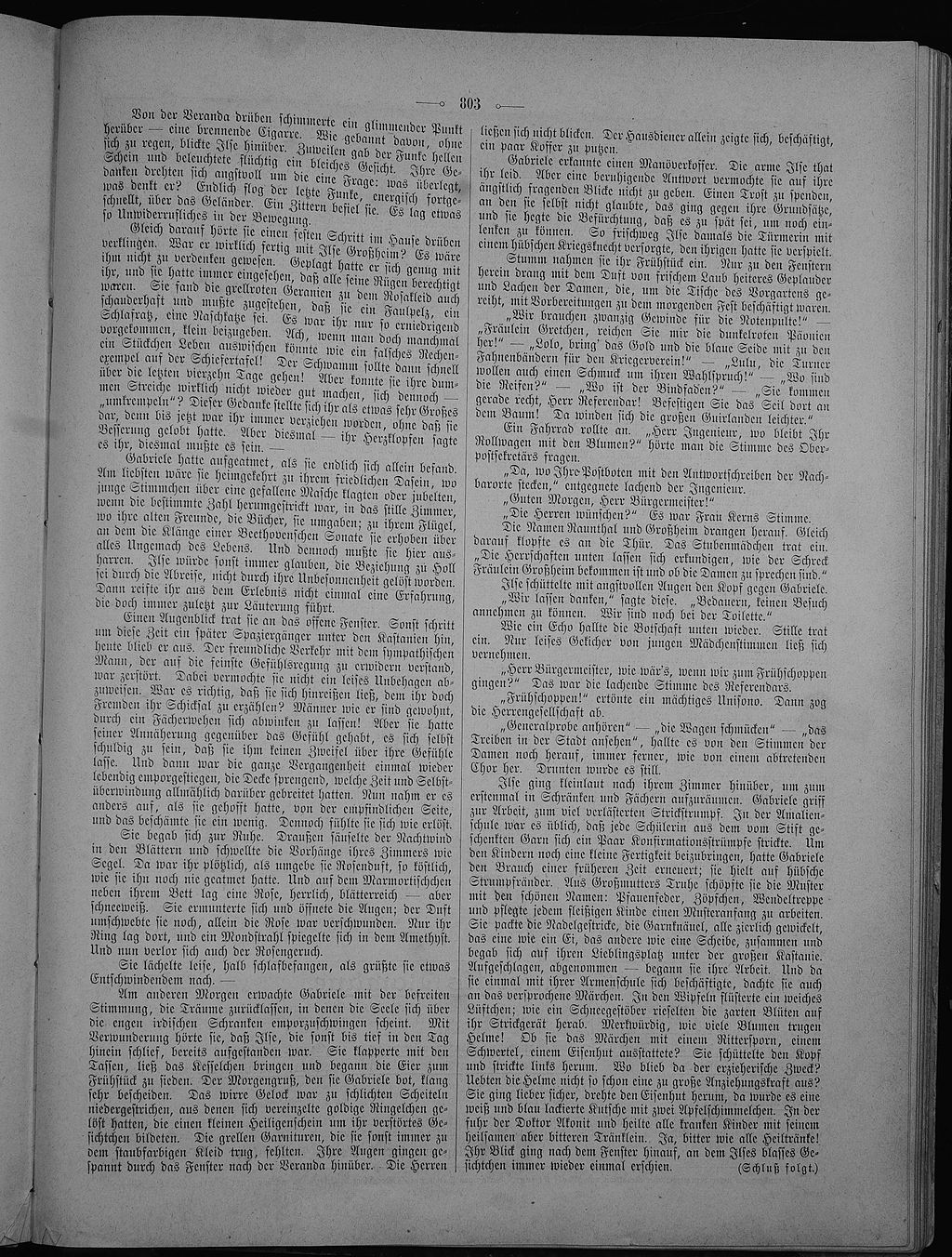| Verschiedene: Die Gartenlaube (1894) | |
|
|
Von der Veranda drüben schimmerte ein glimmender Punkt herüber – eine brennende Cigarre. Wie gebannt davon, ohne sich zu regen, blickte Ilse hinüber. Zuweilen gab der Funke hellen Schein und beleuchtete flüchtig ein bleiches Gesicht. Ihre Gedanken drehten sich angstvoll um die eine Frage: was überlegt, was denkt er? Endlich flog der letzte Funke, energisch fortgeschnellt, über das Geländer. Ein Zittern befiel sie. Es lag etwas so Unwiderrufliches in der Bewegung.
Gleich darauf, hörte sie einen festen Schritt im Hause drüben verklingen. War er wirklich fertig mit Ilse Großheim? Es wäre ihm nicht zu verdenken gewesen. Geplagt hatte er sich genug mit ihr, und sie hatte immer eingesehen, daß alle seine Rügen berechtigt waren. Sie fand die grellroten Geranien zu dem Rosakleid auch schauderhaft und mußte zugestehen, daß sie ein Faulpelz, ein Schlafratz, eine Naschkatze sei. Es war ihr nur so erniedrigend vorgekommen, klein beizugeben. Ach, wenn man doch manchmal ein Stückchen Leben auswischen könnte wie ein falsches Rechenexempel auf der Schiefertafel! Der Schwamm sollte dann schnell über die letzten vierzehn Tage gehen! Aber konnte sie ihre dummen Streiche wirklich nicht wieder gut machen, sich dennoch – „umkrempeln“? Dieser Gedanke stellte sich ihr als etwas sehr Großes dar, denn bis jetzt war ihr immer verziehen worden, ohne daß sie Besserung gelobt hatte. Aber diesmal – ihr Herzklopfen sagte es ihr, diesmal mußte es sein. –
Gabriele hatte aufgeatmet, als sie endlich sich allein befand. Am liebsten wäre sie heimgekehrt zu ihrem friedlichen Dasein, wo junge Stimmchen über eine gefallene Masche klagten oder jubelten, wenn die bestimmte Zahl herumgestrickt war, in das stille Zimmer, wo ihre alten Freunde, die Bücher, sie umgaben; zu ihrem Flügel, an dem die Klänge einer Beethovenschen Sonate sie erhoben über alles Ungemach des Lebens. Und dennoch mußte sie hier ausharren. Ilse würde sonst immer glauben, die Beziehung zu Holl sei durch die Abreise, nicht durch ihre Unbesonnenheit gelöst worden. Dann reifte ihr aus dem Erlebnis nicht einmal eine Erfahrung, die doch immer zuletzt zur Läuterung führt.
Einen Augenblick trat sie an das offene Fenster. Sonst schritt um diese Zeit ein später Spaziergänger unter den Kastanien hin, heute blieb er aus. Der freundliche Verkehr mit dem sympathischen Mann, der auf die feinste Gefühlsregung zu erwidern verstand, war zerstört. Dabei vermochte sie nicht ein leises Unbehagen abzuweisen. War es richtig, daß sie sich hinreißen ließ, dem ihr doch Fremden ihr Schicksal zu erzählen? Männer wie er sind gewohnt, durch ein Fächerwehen sich abwinken zu lassen! Aber sie hatte seiner Annäherung gegenüber das Gefühl gehabt, es sich selbst schuldig zu sein, daß sie ihm keinen Zweifel über ihre Gefühle lasse. Und dann war die ganze Vergangenheit einmal wieder lebendig emporgestiegen, die Decke sprengend, welche Zeit und Selbstüberwindung allmählich darüber gebreitet hatten. Nun nahm er es anders auf, als sie gehofft hatte, von der empfindlichen Seite, und das beschämte sie ein wenig. Dennoch fühlte sie sich wie erlöst.
Sie begab sich zur Ruhe. Draußen säuselte der Nachtwind in den Blättern und schwellte die Vorhänge ihres Zimmers wie Segel. Da war ihr plötzlich, als umgebe sie Rosenduft, so köstlich, wie sie ihn noch nie geatmet hatte. Und auf dem Marmortischchen neben ihrem Bett lag eine Rose, herrlich, blätterreich – aber schneeweiß. Sie ermunterte sich und öffnete die Augen; der Duft umschwebte sie noch, allein die Rose war verschwunden. Nur ihr Ring lag dort, und ein Mondstrahl spiegelte sich in dem Amethyst. Und nun verlor sich auch der Rosengeruch.
Sie lächelte leise, halb schlafbefangen, als grüßte sie etwas Entschwindendem nach. –
Am anderen Morgen erwachte Gabriele mit der befreiten Stimmung, die Träume zurücklassen, in denen die Seele sich über die engen irdischen Schranken emporzuschwingen scheint. Mit Verwunderung hörte sie, daß Ilse, die sonst bis tief in den Tag hinein schlief, bereits aufgestanden war. Sie klapperte mit den Tassen, ließ das Kesselchen bringen, und begann die Eier zum Frühstück zu sieden. Der Morgengruß, den sie Gabriele bot, klang sehr bescheiden. Das wirre Gelock war zu schlichten Scheiteln niedergestrichen, aus denen sich vereinzelte goldige Ringelchen gelöst hatten, die einen kleinen Heiligenschein um ihr verstörtes Gesichtchen bildeten. Die grellen Garnituren, die sie sonst immer zu dem staubfarbigen Kleid trug, fehlten. Ihre Augen gingen gespannt durch das Fenster nach der Veranda hinüber. Die Herren ließen sich nicht blicken. Der Hausdiener allein zeigte sich, beschäftigt, ein Paar Koffer zu putzen.
Gabriele erkannte einen Manöverkoffer. Die arme Ilse that ihr leid. Aber eine beruhigende Antwort vermochte sie auf ihre ängstlich fragenden Blicke nicht zu geben. Einen Trost zu spenden, an den sie selbst nicht glaubte, das ging gegen ihre Grundsätze, und sie hegte die Befürchtung, daß es zu spät sei, um noch einlenken zu können. So frischweg Ilse damals die Türmerin mit einem hübschen Kriegsknecht versorgte, den ihrigen hatte sie verspielt.
Stumm nahmen sie ihr Frühstück ein. Nur zu den Fenstern herein drang mit dem Duft von frischem Laub heiteres Geplauder und Lachen der Damen, die, um die Tische des Vorgartens gereiht, mit Vorbereitungen zu dem morgenden Fest beschäftigt waren.
„Wir brauchen zwanzig Gewinde für die Notenpulte!“ – „Fräulein Gretchen, reichen Sie mir die dunkelroten Päonien her!“ – „Lolo, bring’ das Gold und die blaue Seide mit zu den Fahnenbändern für den Kriegerverein!“ – „Lulu, die Turner wollen auch einen Schmuck um ihren Wahlspruch!“ – „Wo sind die Reifen?“ – „Wo ist der Bindfaden?“ – „Sie kommen gerade recht, Herr Referendar! Befestigen Sie das Seil dort an dem Baum! Da winden sich die großen Guirlanden leichter.“
Ein Fahrrad rollte an. „Herr Ingenieur, wo bleibt Ihr Rollwagen mit den Blumen?“ hörte man die Stimme des Oberpostsekretärs fragen.
„Da, wo Ihre Postboten mit den Antwortschreiben der Nachbarorte stecken,“ entgegnete lachend der Ingenieur.
„Guten Morgen, Herr Bürgermeister!“
„Die Herren wünschen?“ Es war Frau Kerns Stimme.
Die Namen Raunthal und Großheim drangen herauf. Gleich darauf klopfte es an die Thür. Das Stubenmädchen trat ein. „Die Herrschaften unten lassen sich erkundigen, wie der Schreck Fräulein Großheim bekommen ist und ob die Damen zu sprechen sind.“
Ilse schüttelte mit angstvollen Augen den Kopf gegen Gabriele.
„Wir lassen danken,“ sagte diese. „Bedauern, keinen Besuch annehmen zu können. Wir sind noch bei der Toilette.“
Wie ein Echo hallte die Botschaft unten wieder. Stille trat ein. Nur leises Gekicher von jungen Mädchenstimmen ließ sich vernehmen.
„Herr Bürgermeister, wie wär’s, wenn wir zum Frühschoppen gingen?“ Das war die lachende Stimme des Referendars.
„Frühschoppen!“ ertönte ein mächtiges Unisono. Dann zog die Herrengesellschaft ab.
„Generalprobe anhören“ – „die Wagon schmücken“ – „das Treiben in der Stadt ansehen“, hallte es von den Stimmen der Damen noch herauf, immer ferner, wie von einem abtretenden Chor her. Drunten wurde es still.
Ilse ging kleinlaut nach ihrem Zimmer hinüber, um zum erstenmal in Schränken und Fächern aufzuräumen. Gabriele griff zur Arbeit, zum viel verlästerten Strickstrumpf. In der Amalienschule war es üblich, daß jede Schülerin aus dem vom Stift geschenkten Garn sich ein Paar Konfirmationsstrümpfe strickte. Um den Kindern noch eine kleine Fertigkeit beizubringen, hatte Gabriele den Brauch einer früheren Zeit erneuert: sie hielt auf hübsche Strumpfränder. Aus Großmutters Truhe schöpfte sie die Muster, mit den schönen Namen: Pfauenfeder, Zöpfchen, Wendeltreppe und pflegte jedem fleißigen Kinde einen Musteranfang zu arbeiten. Sie packte die Nadelgestricke, die Garnknäuel, alle zierlich gewickelt, das eine wie ein Ei, das andere wie eine Scheibe, zusammen und begab sich auf ihren Lieblingsplatz unter der großen Kastanie. Aufgeschlagen, abgenommen – begann sie ihren Arbeit. Und da sie einmal mit ihrer Armenschule sich beschäftigte, dachte sie auch an das versprochene Märchen. In den Wipfeln flüsterte ein weiches Lüftchen; wie ein Schneegestöber rieselten die zarten Blüten auf ihr Strickgerät herab. Merkwürdig, wie viele Blumen trugen Helme! Ob sie das Märchen mit einem Rittersporn, einem Schwertel, einem Eisenhut ausstattete? Sie schüttelte den Kopf und strickte links herum. Wo blieb da der erzieherische Zweck? Uebten die Helme nicht so schon eine zu große Anziehungskraft aus? Sie ging lieber sicher, drehte den Eisenhut herum, da wurde es eine weiß und blau lackierte Kutsche mit zwei Apfelschimmelchen. In der fuhr der Doktor Akonit und heilte alle kranken Kinder mit seinem heilsamen aber bitteren Tränklein. Ja, bitter wie alle Heiltränke! Ihr Blick ging nach dem Fenster hinauf, an dem Ilses blasses Gesichtchen immer wieder einmal erschien.
(Schluß folgt.)
Verschiedene: Die Gartenlaube (1894). Leipzig: Ernst Keil, 1894, Seite 803. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1894)_803.jpg&oldid=- (Version vom 21.9.2023)