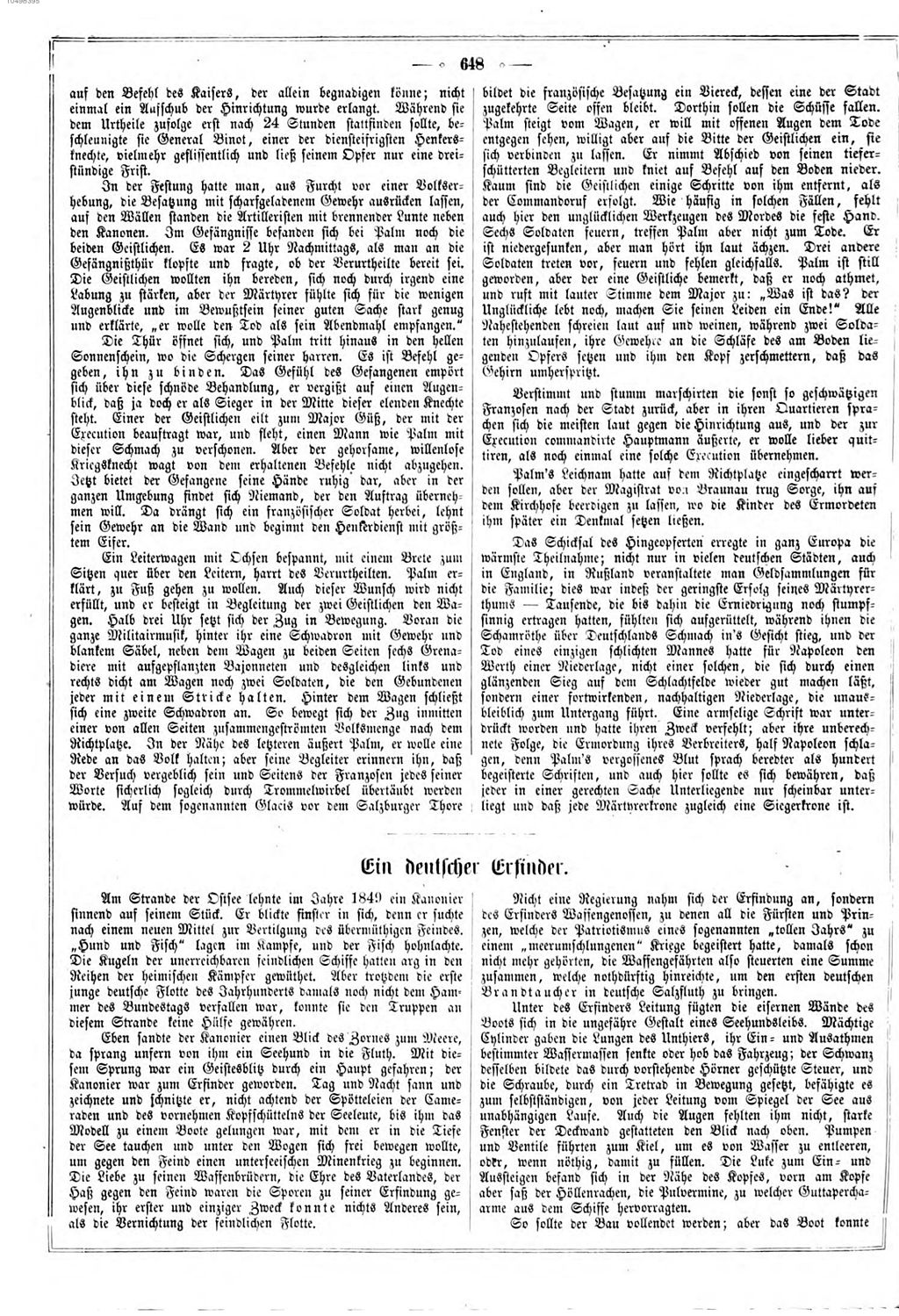| verschiedene: Die Gartenlaube (1861) | |
|
|
auf den Befehl des Kaisers, der allein begnadigen könne; nicht einmal ein Aufschub der Hinrichtung wurde erlangt. Während sie dem Urtheile zufolge erst nach 24 Stunden stattfinden sollte, beschleunigte sie General Binot, einer der diensteifrigsten Henkersknechte, vielmehr geflissentlich und ließ seinem Opfer nur eine dreistündige Frist.
In der Festung hatte man, aus Furcht vor einer Volkserhebung, die Besatzung mit scharfgeladenem Gewehr ausrücken lasten, auf den Wällen standen die Artilleristen mit brennender Lunte neben den Kanonen. Im Gefängnisse befanden sich bei Palm noch die beiden Geistlichen. Es war 2 Uhr Nachmittags, als man an die Gefängnißthür klopfte und fragte, ob der Verurtheilte bereit sei. Die Geistlichen wollten ihn bereden, sich noch durch irgend eine Labung zu stärken, aber der Märtyrer fühlte sich für die wenigen Augenblicke und im Bewußtsein seiner guten Sache stark genug und erklärte, „er wolle den Tod als sein Abendmahl empfangen.“
Die Thür öffnet sich, und Palm tritt hinaus in den hellen Sonnenschein, wo die Schergen seiner harren. Es ist Befehl gegeben, ihn zu binden. Das Gefühl des Gefangenen empört sich über diese schnöde Behandlung, er vergißt auf einen Augenblick, daß ja doch er als Sieger in der Mitte dieser elenden Knechte steht. Einer der Geistlichen eilt zum Major Güß, der mit der Execution beauftragt war, und fleht, einen Mann wie Palm mit dieser Schmach zu verschonen. Aber der gehorsame, willenlose Kriegsknecht wagt von dem erhaltenen Befehle nicht abzugehen. Jetzt bietet der Gefangene seine Hände ruhig dar, aber in der ganzen Umgebung findet sich Niemand, der den Auftrag übernehmen will. Da drängt sich ein französischer Soldat herbei, lehnt sein Gewehr an die Wand und beginnt den Henkerdienst mit größtem Eifer.
Ein Leiterwagen mit Ochsen bespannt, mit einem Brete zum Sitzen quer über den Leitern, harrt des Verurtheilten. Palm erklärt, zu Fuß gehen zu wollen. Auch dieser Wunsch wird nicht erfüllt, und er besteigt in Begleitung der zwei Geistlichen den Wagen. Halb drei Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Voran die ganze Militairmusik, hinter ihr eine Schwadron mit Gewehr und blankem Säbel, neben dem Wagen zu beiden Seiten sechs Grenadiere mit aufgepflanzten Bajonneten und desgleichen links und rechts dicht am Wagen noch zwei Soldaten, die den Gebundenen jeder mit einem Stricke halten. Hinter dem Wagen schließt sich eine zweite Schwadron an. So bewegt sich der Zug inmitten einer von allen Seiten zusammengeströmten Volksmenge nach dem Richtplatze. In der Nähe des letzteren äußert Palm, er wolle eine Rede an das Volk halten; aber seine Begleiter erinnern ihn, daß der Versuch vergeblich sein und Seitens der Franzosen jedes seiner Worte sicherlich sogleich durch Trommelwirbel übertäubt werden würde. Auf dem sogenannten Glacis vor dem Salzburger Thore bildet die französische Besatzung ein Viereck, dessen eine der Stadt zugekehrte Seite offen bleibt. Dorthin sollen die Schüsse fallen. Palm steigt vom Wagen, er will mit offenen Augen dem Tode entgegen sehen, willigt aber auf die Bitte der Geistlichen ein, sie sich verbinden zu lassen. Er nimmt Abschied von seinen tieferschütterten Begleitern und kniet auf Befehl auf den Boden nieder. Kaum sind die Geistlichen einige Schritte von ihm entfernt, als der Commandoruf erfolgt. Wie häufig in solchen Fällen, fehlt auch hier den unglücklichen Werkzeugen des Mordes die feste Hand. Sechs Soldaten feuern, treffen Palm aber nicht zum Tode. Er ist niedergesunken, aber man hört ihn laut ächzen. Drei andere Soldaten treten vor, feuern und fehlen gleichfalls. Palm ist still geworden, aber der eine Geistliche bemerkt, daß er noch athmet, und ruft mit lauter Stimme dem Major zu: „Was ist das? der Unglückliche lebt noch, machen Sie seinen Leiden ein Ende!“ Alle Nahestehenden schreien laut auf und weinen, während zwei Soldaten hinzulaufen, ihre Gewehre an die Schläfe des am Boden liegenden Opfers setzen und ihm den Kopf zerschmettern, daß das Gehirn umherspritzt.
Verstimmt und stumm marschirten die sonst so geschwätzigen Franzosen nach der Stadt zurück, aber in ihren Quartieren sprachen sich die meisten laut gegen die Hinrichtung aus, und der zur Execution commandirte Hauptmann äußerte, er wolle lieber quittiren, als noch einmal eine solche Execution übernehmen.
Palm’s Leichnam hatte auf dem Richtplatze eingescharrt werden sollen, aber der Magistrat von Braunau trug Sorge, ihn auf dem Kirchhofe beerdigen zu lassen, wo die Kinder des Ermordeten ihm später ein Denkmal setzen ließen.
Das Schicksal des Hingeopferten erregte in ganz Europa die wärmste Theilnahme; nicht nur in vielen deutschen Städten, auch in England, in Rußland veranstaltete man Geldsammlungen für die Familie; dies war indeß der geringste Erfolg seines Märtyrerthums – Tausende, die bis dahin die Erniedrigung noch stumpfsinnig ertragen hatten, fühlten sich aufgerüttelt, während ihnen die Schamröthe über Deutschlands Schmach in’s Gesicht stieg, und der Tod eines einzigen schlichten Mannes hatte für Napoleon den Werth einer Niederlage, nicht einer solchen, die sich durch einen glänzenden Sieg auf dem Schlachtfelde wieder gut machen läßt, sondern einer fortwirkenden, nachhaltigen Niederlage, die unausbleiblich zum Untergang führt. Eine armselige Schrift war unterdrückt worden und hatte ihren Zweck verfehlt; aber ihre unberechnete Folge, die Ermordung ihres Verbreiters, half Napoleon schlagen, denn Palm’s vergossenes Blut sprach beredter als hundert begeisterte Schriften, und auch hier sollte es sich bewähren, daß jeder in einer gerechten Sache Unterliegende nur scheinbar unterliegt und daß jede Märtyrerkrone zugleich eine Siegerkrone ist.
Am Strande der Ostsee lehnte im Jahre 1849 ein Kanonier sinnend auf seinem Stück. Er blickte finster in sich, denn er suchte nach einem neuen Mittel zur Vertilgung des übermüthigen Feindes. „Hund und Fisch“ lagen im Kampfe, und der Fisch hohnlachte. Die Kugeln der unerreichbaren feindlichen Schiffe hatten arg in den Reihen der heimischen Kämpfer gewüthet. Aber trotzdem die erste junge deutsche Flotte des Jahrhunderts damals noch nicht dem Hammer des Bundestags verfallen war, konnte sie den Truppen an diesem Strande keine Hülfe gewähren.
Eben sandte der Kanonier einen Blick des Zornes zum Meere, da sprang unfern von ihm ein Seehund in die Fluth. Mit diesem Sprung war ein Geistesblitz durch ein Haupt gefahren; der Kanonier war zum Erfinder geworden. Tag und Nacht sann und zeichnete und schnitzte er, nicht achtend der Spötteleien der Cameraden und des vornehmen Kopfschüttelns der Seeleute, bis ihm das Modell zu einem Boote gelungen war, mit dem er in die Tiefe der See tauchen und unter den Wogen sich frei bewegen wollte, um gegen den Feind einen unterseeischen Minenkrieg zu beginnen. Die Liebe zu seinen Waffenbrüdern, die Ehre des Vaterlandes, der Haß gegen den Feind waren die Sporen zu seiner Erfindung gewesen, ihr erster und einziger Zweck konnte nichts Anderes sein, als die Vernichtung der feindlichen Flotte.
Nicht eine Regierung nahm sich der Erfindung an, sondern des Erfinders Waffengenossen, zu denen all die Fürsten und Prinzen, welche der Patriotismus eines sogenannten „tollen Jahrs“ zu einem „meerumschlungenen“ Kriege begeistert hatte, damals schon nicht mehr gehörten, die Waffengefährten also steuerten eine Summe zusammen, welche nothdürftig hinreichte, um den ersten deutschen Brandtaucher in deutsche Salzfluth zu bringen.
Unter des Erfinders Leitung fügten die eisernen Wände des Boots sich in die ungefähre Gestalt eines Seehundsleibs. Mächtige Cylinder gaben die Lungen des Unthiers, ihr Ein- und Ausathmen bestimmter Wassermassen senkte oder hob das Fahrzeug; der Schwanz desselben bildete das durch vorstehende Hörner geschützte Steuer, und die Schraube, durch ein Tretrad in Bewegung gesetzt, befähigte es zum selbstständigen, von jeder Leitung vom Spiegel der See aus unabhängigen Laufe. Auch die Augen fehlten ihm nicht, starke Fenster der Deckwand gestatteten den Blick nach oben. Pumpen und Ventile führten zum Kiel, um es von Wasser zu entleeren, oder, wenn nöthig, damit zu füllen. Die Luke zum Ein- und Aussteigen befand sich in der Nähe des Kopfes, vorn am Kopfe aber saß der Höllenrachen, die Pulvermine, zu welcher Guttaperchaarme aus dem Schiffe hervorragten.
So sollte der Bau vollendet werden; aber das Boot konnte
verschiedene: Die Gartenlaube (1861). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1861, Seite 648. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1861)_648.jpg&oldid=- (Version vom 10.9.2022)