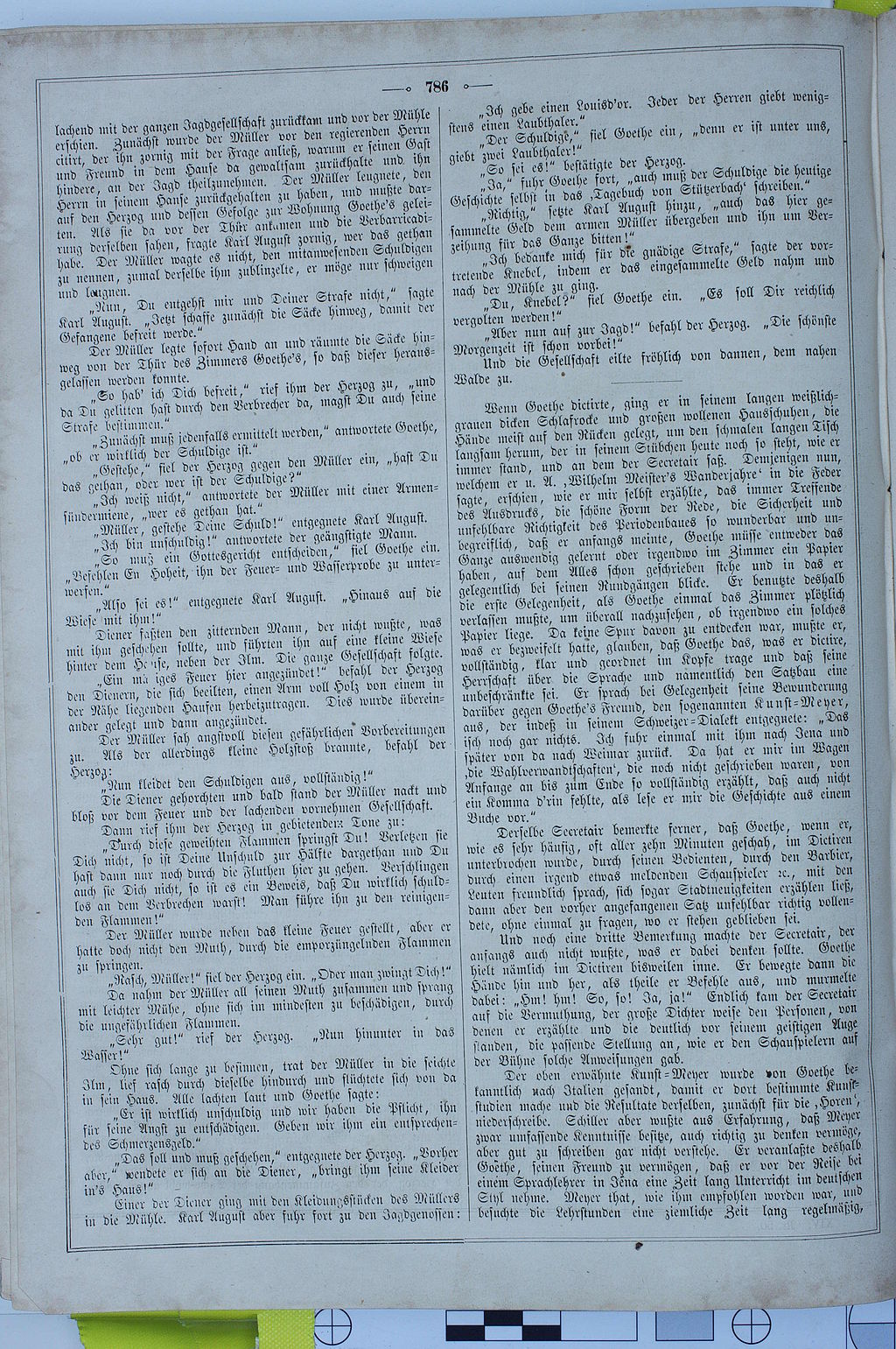| verschiedene: Die Gartenlaube (1866) | |
|
|
lachend mit der ganzen Jagdgesellschaft zurückkam und vor der Mühle erschien. Zunächst wurde der Müller vor den regierenden Herrn citirt, der ihn zornig mit der Frage anließ, warum er seinen Gast und Freund in dem Hause da gewaltsam zurückhalte und ihn hindere, an der Jagd theilzunehmen. Der Müller leugnete, den Herrn in seinem Hause zurückgehalten zu haben, und mußte darauf den Herzog und dessen Gefolge zur Wohnung Goethe’s geleiten. Als sie da vor der Thür ankamen und die Verbarricadirung derselben sahen, fragte Karl August zornig, wer das gethan habe. Der Müller wagte es nicht, den mitanwesenden Schuldigen zu nennen, zumal derselbe ihm zublinzelte, er möge nur schweigen und leugnen.
„Nun, Du entgehst mir und Deiner Strafe nicht,“ sagte Karl August. „Jetzt schaffe zunächst die Säcke hinweg, damit der Gefangene befreit werde.“
Der Müller legte sofort Hand an und räumte die Säcke hinweg von der Thür des Zimmers Goethe’s, so daß dieser herausgelassen werden konnte.
„So hab’ ich Dich befreit,“ rief ihm der Herzog zu, „und da Du gelitten hast durch den Verbrecher da, magst Du auch seine Strafe bestimmen.“
„Zunächst muß jedenfalls ermittelt werden,“ antwortete Goethe, „ob er wirklich der Schuldige ist.“
„Gestehe,“ fiel der Herzog gegen den Müller ein, „hast Du das gethan, oder wer ist der Schuldige?“
„Ich weiß nicht,“ antwortete der Müller mit einer Armensündermiene, „wer es gethan hat.“
„Müller, gestehe Deine Schuld!“ entgegnete Karl August.
„Ich bin unschuldig!“ antwortete der geängstigte Mann.
„So muß ein Gottesgericht entscheiden,“ fiel Goethe ein. „Befehlen Eure Hoheit, ihn der Feuer- und Wasserprobe zu unterwerfen.“
„Also sei es!“ entgegnete Karl August. „Hinaus auf die Wiese mit ihm!“
Diener faßten den zitternden Mann, der nicht wußte, was mit ihm geschehen sollte, und führten ihn auf eine kleine Wiese hinter dem Hause, neben der Ilm. Die ganze Gesellschaft folgte.
„Ein mäßiges Feuer hier angezündet!“ befahl der Herzog den Dienern, die sich beeilten, einen Arm voll Holz von einem in der Nähe liegenden Haufen herbeizutragen. Dies wurde übereinander gelegt und dann angezündet.
Der Müller sah angstvoll diesen gefährlichen Vorbereitungen zu. Als der allerdings kleine Holzstoß brannte, befahl der Herzog:
„Nun kleidet den Schuldigen aus, vollständig!“
Die Diener gehorchten und bald stand der Müller nackt und bloß vor dem Feuer und der lachenden vornehmen Gesellschaft.
Dann rief ihm der Herzog in gebietendem Tone zu:
„Durch diese geweihten Flammen springst Du! Verletzen sie Dich nicht, so ist Deine Unschuld zur Hälfte dargethan und Du hast dann nur noch durch die Fluthen hier zu gehen. Verschlingen auch sie Dich nicht, so ist es ein Beweis, daß Du wirklich schuldlos an dem Verbrechen warst! Man führe ihn zu den reinigenden Flammen!“
Der Müller wurde neben das kleine Feuer gestellt, aber er hatte doch nicht den Muth, durch die emporzüngelnden Flammen zu springen.
„Rasch, Müller!“ fiel der Herzog ein. „Oder man zwingt Dich!“
Da nahm der Müller all seinen Muth zusammen und sprang mit leichter Mühe, ohne sich im mindesten zu beschädigen, durch die ungefährlichen Flammen.
„Sehr gut!“ rief der Herzog. „Nun hinunter in das Wasser!“
Ohne sich lange zu besinnen, trat der Müller in die seichte Ilm, lief rasch durch dieselbe hindurch und flüchtete sich von da in sein Haus. Alle lachten laut und Goethe sagte:
„Er ist wirklich unschuldig und wir haben die Pflicht, ihn für seine Angst zu entschädigen. Geben wir ihm ein entsprechendes Schmerzensgeld.“
„Das soll und muß geschehen,“ entgegnete der Herzog. „Vorher aber,“ wendete er sich an die Diener, „bringt ihm seine Kleider in’s Haus!“
Einer der Diener ging mit den Kleidungsstücken des Müllers in die Mühle. Karl August aber fuhr fort zu den Jagdgenossen:
„Ich gebe einen Louisd’or. Jeder der Herren giebt wenigstens einen Laubthaler.“
„Der Schuldige,“ fiel Goethe ein, „denn er ist unter uns, giebt zwei Laubthaler!“
„So sei es!“ bestätigte der Herzog.
„Ja,“ fuhr Goethe fort, „auch muß der Schuldige die heutige Geschichte selbst in das ‚Tagebuch von Stützerbach‘ schreiben.“
„Richtig,“ setzte Karl August hinzu, „auch das hier gesammelte Geld dem armen Müller übergeben und ihn um Verzeihung für das Ganze bitten!“
„Ich bedanke mich für die gnädige Strafe,“ sagte der vortretende Knebel, indem er das eingesammelte Geld nahm und nach der Mühle zu ging.
„Du, Knebel?“ fiel Goethe ein. „Es soll Dir reichlich vergolten werden!“
„Aber nun auf zur Jagd!“ befahl der Herzog. „Die schönste Morgenzeit ist schon vorbei!“
Und die Gesellschaft eilte fröhlich von dannen, dem nahen Walde zu.
Wenn Goethe dictirte, ging er in seinem langen weißlichgrauen dicken Schlafrocke und großen wollenen Hausschuhen, die Hände meist auf den Rücken gelegt, um den schmalen langen Tisch langsam herum, der in seinem Stübchen heute noch so steht, wie er immer stand, und an dem der Secretair saß. Demjenigen nun, welchem er u. A. ‚Wilhelm Meister’s Wanderjahre‘ in die Feder sagte, erschien, wie er mir selbst erzählte, das immer Treffende des Ausdrucks, die schöne Form der Rede, die Sicherheit und unfehlbare Richtigkeit des Periodenbaues so wunderbar und unbegreiflich, daß er anfangs meinte, Goethe müsse entweder das Ganze auswendig gelernt oder irgendwo im Zimmer ein Papier haben, auf dem Alles schon geschrieben stehe und in das er gelegentlich bei seinen Rundgängen blicke. Er benutzte deshalb die erste Gelegenheit, als Goethe einmal das Zimmer plötzlich verlassen mußte, um überall nachzusehen, ob irgendwo ein solches Papier liege. Da keine Spur davon zu entdecken war, mußte er, was er bezweifelt hatte, glauben, daß Goethe das, was er dictire, vollständig, klar und geordnet im Kopfe trage und daß seine Herrschaft über die Sprache und namentlich den Satzbau eine unbeschränkte sei. Er sprach bei Gelegenheit seine Bewunderung darüber gegen Goethe’s Freund, den sogenannten Kunst-Meyer, aus, der indeß in seinem Schweizer-Dialekt entgegnete: „Das isch noch gar nichts. Ich fuhr einmal mit ihm nach Jena und später von da nach Weimar zurück. Da hat er mir im Wagen ‚die Wahlverwandtschaften‘, die noch nicht geschrieben waren, von Anfange an bis zum Ende so vollständig erzählt, daß auch nicht ein Komma d’rin fehlte, als lese er mir die Geschichte aus einem Buche vor.“
Derselbe Secretair bemerkte ferner, daß Goethe, wenn er, wie es sehr häufig, oft aller zehn Minuten geschah, im Dictiren unterbrochen wurde, durch seinen Bedienten, durch den Barbier, durch einen irgend etwas meldenden Schauspieler etc., mit den Leuten freundlich sprach, sich sogar Stadtneuigkeiten erzählen ließ, dann aber den vorher angefangenen Satz unfehlbar richtig vollendete, ohne einmal zu fragen, wo er stehen geblieben sei.
Und noch eine dritte Bemerkung machte der Secretair, der anfangs auch nicht wußte, was er dabei denken sollte. Goethe hielt nämlich im Dictiren bisweilen inne. Er bewegte dann die Hände hin und her, als theile er Befehle aus, und murmelte dabei: „Hm! hm! So, so! Ja, ja!“ Endlich kam der Secretair auf die Vermuthung, der große Dichter weise den Personen, von denen er erzählte und die deutlich vor seinem geistigen Auge standen, die passende Stellung an, wie er den Schauspielern auf der Bühne solche Anweisungen gab.
Der oben erwähnte Kunst-Meyer wurde von Goethe bekanntlich nach Italien gesandt, damit er dort bestimmte Kunststudien mache und die Resultate derselben, zunächst für die ‚Horen‘, niederschreibe. Schiller aber wußte aus Erfahrung, daß Meyer zwar umfassende Kenntnisse besitze, auch richtig zu denken vermöge, aber gut zu schreiben gar nicht verstehe. Er veranlaßte deshalb Goethe, seinen Freund zu vermögen, daß er vor der Reise bei einem Sprachlehrer in Jena eine Zeit lang Unterricht im deutschen Styl nehme. Meyer that, wie ihm empfohlen worden war, und besuchte die Lehrstunden eine ziemliche Zeit lang regelmäßig,
verschiedene: Die Gartenlaube (1866). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1866, Seite 786. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1866)_786.jpg&oldid=- (Version vom 13.12.2020)