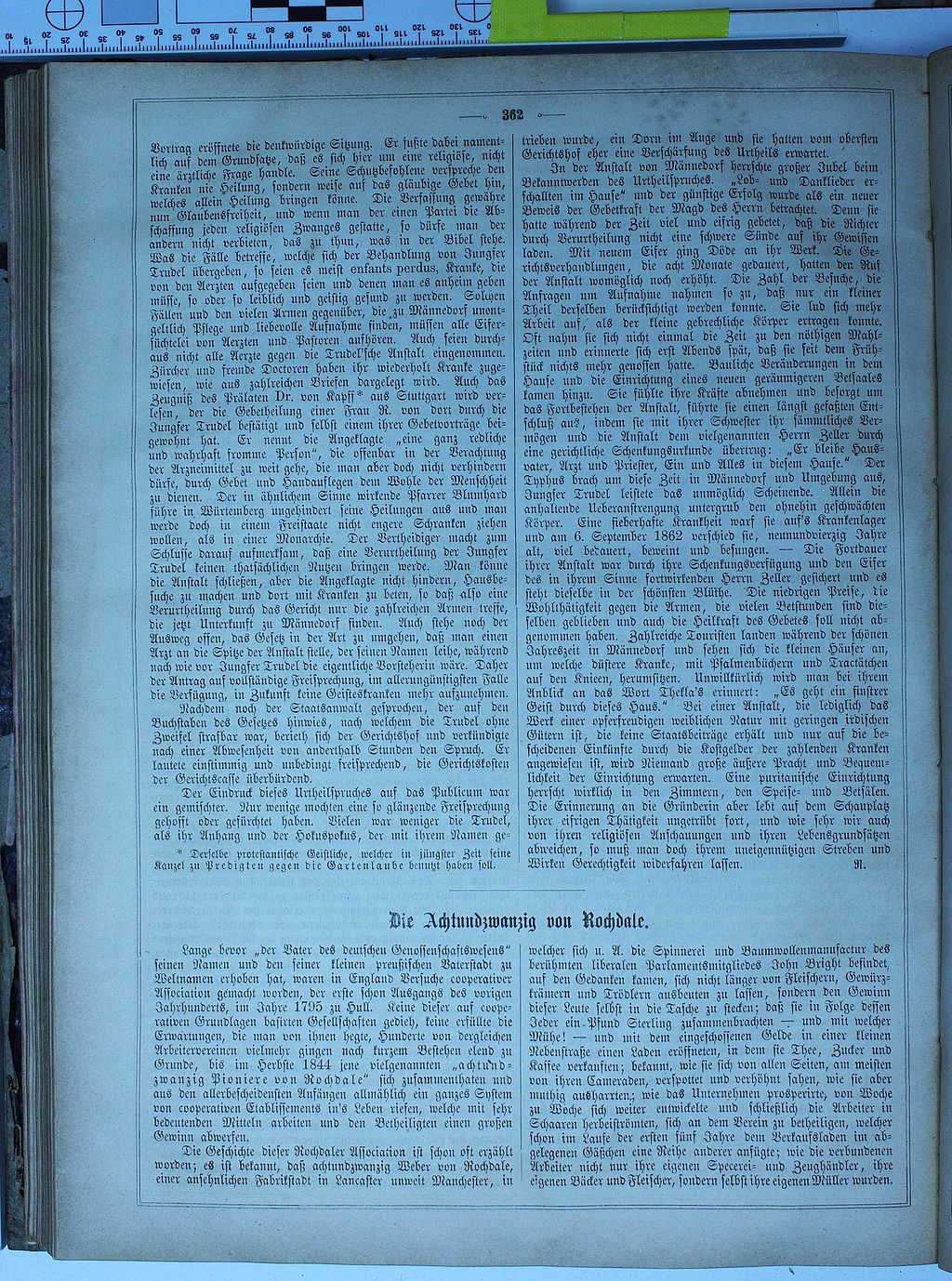| verschiedene: Die Gartenlaube (1868) | |
|
|
Vortrag eröffnete die denkwürdige Sitzung. Er fußte dabei namentlich auf dem Grundsatze, daß es sich hier um eine religiöse, nicht eine ärztliche Frage handle. Seine Schutzbefohlene verspreche den Kranken nie Heilung, sondern weise auf das gläubige Gebet hin, welches allein Heilung bringen könne. Die Verfassung gewähre nun Glaubensfreiheit, und wenn man der einen Partei die Abschaffung jeden religiösen Zwanges gestatte, so dürfe man der andern nicht verbieten, das zu thun, was in der Bibel stehe. Was die Fälle betreffe, welche sich der Behandlung von Jungfer Trudel übergeben, so seien es meist enfants perdus, Kranke, die von den Aerzten aufgegeben seien und denen man es anheim geben müsse, so oder so leiblich und geistig gesund zu werden. Solchen Fällen und den vielen Armen gegenüber, die zu Männedorf unentgeltlich Pflege und liebevolle Aufnahme finden, müssen alle Eifersüchtelei von Aerzten und Pastoren aufhören. Auch seien durchaus nicht alle Aerzte gegen die Trudel’sche Anstalt eingenommen. Zürcher und fremde Doctoren haben ihr wiederholt Kranke zugewiesen, wie aus zahlreichen Briefen dargelegt wird. Auch das Zeugniß des Prälaten Dr. von Kapff[1] aus Stuttgart wird verlesen, der die Gebetheilung einer Frau R. von dort durch die Jungfer Trudel bestätigt und selbst einem ihrer Gebetvorträge beigewohnt hat. Er nennt die Angeklagte „eine ganz redliche und wahrhaft fromme Person“, die offenbar in der Verachtung der Arzneimittel zu weit gehe, die man aber doch nicht verhindern dürfe, durch Gebet und Handauflegen dem Wohle der Menschheit zu dienen. Der in ähnlichem Sinne wirkende Pfarrer Blumhard führe in Würtemberg ungehindert seine Heilungen aus und man werde doch in einem Freistaate nicht engere Schranken ziehen wollen, als in einer Monarchie. Der Vertheidiger macht zum Schlüsse darauf aufmerksam, daß eine Verurtheilung der Jungfer Trudel keinen thatsächlichen Nutzen bringen werde. Man könne die Anstalt schließen, aber die Angeklagte nicht hindern, Hausbesuche zu machen und dort mit Kranken zu beten, so daß also eine Verurtheilung durch das Gericht nur die zahlreichen Armen treffe, die jetzt Unterkunft zu Männedorf finden. Auch stehe noch der Ausweg offen, das Gesetz in der Art zu umgehen, daß man einen Arzt an die Spitze der Anstalt stelle, der seinen Namen leihe, während nach wie vor Jungfer Trudel die eigentliche Vorsteherin wäre. Daher der Antrag auf vollständige Freisprechung, im allerungünstigsten Falle die Verfügung, in Zukunft keine Geisteskranken mehr aufzunehmen.
Nachdem noch der Staatsanwalt gesprochen, der auf den Buchstaben des Gesetzes hinwies, nach welchem die Trudel ohne Zweifel strafbar war, berieth sich der Gerichtshof und verkündigte nach einer Abwesenheit von anderthalb Stunden den Spruch. Er lautete einstimmig und unbedingt freisprechend, die Gerichtskosten der Gerichtscasse überbürdend.
Der Eindruck dieses Urtheilspruches auf das Publicum war ein gemischter. Nur wenige mochten eine so glänzende Freisprechung gehofft oder gefürchtet haben. Vielen war weniger die Trudel, als ihr Anhang und der Hokuspokus, der mit ihrem Namen getrieben wurde, ein Dorn im Auge und sie hatten vom obersten Gerichtshof eher eine Verschärfung des Urtheils erwartet.
In der Anstalt von Männedorf herrschte großer Jubel beim Bekanntwerden des Urtheilspruches. „Lob- und Danklieder erschallten im Hause“ und der günstige Erfolg wurde als ein neuer Beweis der Gebetkraft der Magd des Herrn betrachtet. Denn sie hatte während der Zeit viel und eifrig gebetet, daß die Richter durch Verurtheilung nicht eine schwere Sünde auf ihr Gewissen laden. Mit neuem Eifer ging Döde an ihr Werk. Die Gerichtsverhandlungen, die acht Monate gedauert, hatten den Ruf der Anstalt womöglich noch erhöht. Die Zahl der Besuche, die Anfragen um Aufnahme nahmen so zu, daß nur ein kleiner Theil derselben berücksichtigt werden konnte. Sie lud sich mehr Arbeit auf, als der kleine gebrechliche Körper ertragen konnte. Oft nahm sie sich nicht einmal die Zeit zu den nöthigen Mahlzeiten und erinnerte sich erst Abends spät, daß sie seit dem Frühstück nichts mehr genossen hatte. Bauliche Veränderungen in dem Hause und die Einrichtung eines neuen geräumigeren Betsaales kamen hinzu. Sie fühlte ihre Kräfte abnehmen und besorgt um das Fortbestehen der Anstalt, führte sie einen längst gefaßten Entschluß aus, indem sie mit ihrer Schwester ihr sämmtliches Vermögen und die Anstalt dem vielgenannten Herrn Zeller durch eine gerichtliche Schenkungsurkunde übertrug: „Er bleibe Hausvater, Arzt und Priester, Ein und Alles in diesem Hause.“ Der Typhus brach um diese Zeit in Männedorf und Umgebung aus, Jungfer Trudel leistete das unmöglich Scheinende. Allein die anhaltende Überanstrengung untergrub den ohnehin geschwächten Körper. Eine fieberhafte Krankheit warf sie auf’s Krankenlager und am 6. September 1862 verschied sie, neunundvierzig Jahre alt, viel bedauert, beweint und besungen. – Die Fortdauer ihrer Anstalt war durch ihre Schenkungsverfügung und den Eifer des in ihrem Sinne fortwirkenden Herrn Zeller gesichert und es steht dieselbe in der schönsten Blüthe. Die niedrigen Preise, die Wohlthätigkeit gegen die Armen, die vielen Betstunden sind dieselben geblieben und auch die Heilkraft des Gebetes soll nicht abgenommen haben. Zahlreiche Touristen landen während der schönen Jahreszeit in Männedorf und sehen sich die kleinen Häuser an, um welche düstere Kranke, mit Psalmenbüchern und Tractätchen auf den Knieen, herumsitzen. Unwillkürlich wird man bei ihrem Anblick an das Wort Thekla’s erinnert: „Es geht ein finstrer Geist durch dieses Haus.“ Bei einer Anstalt, die lediglich das Werk einer opferfreudigen weiblichen Natur mit geringen irdischen Gütern ist, die keine Staatsbeiträge erhält und nur auf die bescheidenen Einkünfte durch die Kostgelder der zahlenden Kranken angewiesen ist, wird Niemand große äußere Pracht und Bequemlichkeit der Einrichtung erwarten. Eine puritanische Einrichtung herrscht wirklich in den Zimmern, den Speise. und Betsälen. Die Erinnerung an die Gründerin aber lebt auf dem Schauplatz ihrer eifrigen Thätigkeit ungetrübt fort, und wie sehr wir auch von ihren religiösen Anschauungen und ihren Lebensgrundsätzen abweichen, so muß man doch ihrem uneigennützigen Streben und Wirken Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Die Achtundzwanzig von Rochdale.
Lange bevor „der Vater des deutschen Genossenschaftswesens“ seinen Namen und den seiner kleinen preußischen Vaterstadt zu Weltnamen erhoben hat, waren in England Versuche cooperativer Association gemacht worden, der erste schon Ausgangs des vorigen Jahrhunderts, im Jahre 1795 zu Hull. Keine dieser auf cooperativen Grundlagen basirten Gesellschaften gedieh, keine erfüllte die Erwartungen, die man von ihnen hegte, Hunderte von dergleichen Arbeitervereinen vielmehr gingen nach kurzem Bestehen elend zu Grunde, bis im Herbste 1844 jene vielgenannten „achtundzwanzig Pioniere von Rochdale“ sich zusammenthaten und aus den allerbescheidensten Anfängen allmählich ein ganzes System von cooperativen Etablissements in’s Leben riefen, welche mit sehr bedeutenden Mitteln arbeiten und den Betheiligten einen großen Gewinn abwerfen.
Die Geschichte dieser Rochdaler Association ist schon oft erzählt worden; es ist bekannt, daß achtundzwanzig Weber von Rochdale, einer ansehnlichen Fabrikstadt in Lancaster unweit Manchester, in welcher sich u. A. die Spinnerei und Baumwollenmanufactur des berühmten liberalen Parlamentsmitgliedes John Bright befindet, auf den Gedanken kamen, sich nicht länger von Fleischern, Gewürzkrämern und Trödlern ausbeuten zu lassen, sondern den Gewinn dieser Leute selbst in die Tasche zu stecken; daß sie in Folge dessen Jeder ein Pfund Sterling zusammenbrachten – und mit welcher Mühe! – und mit dem eingeschossenen Gelde in einer kleinen Nebenstraße einen Laden eröffneten, in dem sie Thee, Zucker und Kaffee verkauften; bekannt, wie sie sich von allen Seiten, am meisten von ihren Cameraden, verspottet und verhöhnt sahen, wie sie aber muthig ausharrten; wie das Unternehmen prosperirte von Woche zu Woche sich weiter entwickelte und schließlich die Arbeiter in Schaaren herbeiströmten, sich an dem Verein zu betheiligen, welcher schon im Laufe der ersten fünf Jahre dem Verkaufsladen im abgelegenen Gäßchen eine Reihe anderer anfügte; wie die verbundenen Arbeiter nicht nur ihre eigenen Specerei- und Zeughändler, ihre eigenen Bäcker und Fleischer, sondern selbst ihre eigenen Müller wurden.
- ↑ Derselbe protestantische Geistliche, welcher in jüngster Zeit seine Kanzel zu Predigten gegen die Gartenlaube benutzt haben soll.
verschiedene: Die Gartenlaube (1868). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1868, Seite 362. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1868)_362.jpg&oldid=- (Version vom 20.8.2021)