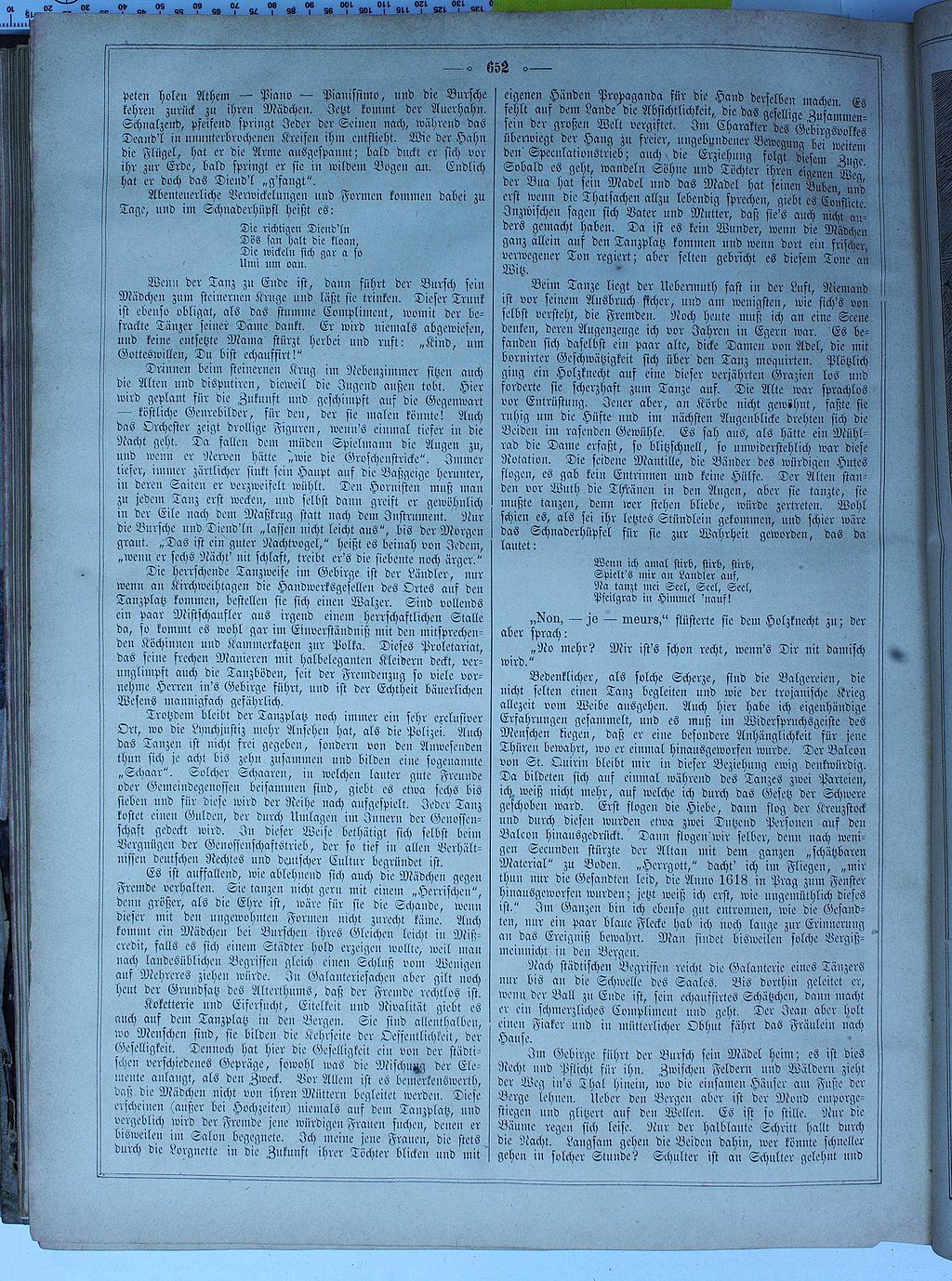| verschiedene: Die Gartenlaube (1868) | |
|
|
holen Athem – Piano – Pianissimo, und die Bursche kehren zurück zu ihren Mädchen. Jetzt kommt der Auerhahn. Schnalzend, pfeifend springt Jeder der Seinen nach, während das Deand’l in ununterbrochenen Kreisen ihm entflieht. Wie der Hahn die Flügel, hat er die Arme ausgespannt; bald duckt er sich vor ihr zur Erde, bald springt er sie in wildem Bogen an. Endlich hat er doch das Diend’l „g’fangt“.
Abenteuerliche Verwickelungen und Formen kommen dabei zu Tage, und im Schnaderhüpfl heißt es:
Die richtigen Diend’ln
Dös sän halt die kloan,
Die wickeln sich gar a so
Umi um oan.
Wenn der Tanz zu Ende ist, dann führt der Bursch sein Mädchen zum steinernen Kruge und läßt sie trinken. Dieser Trunk ist ebenso obligat, als das stumme Compliment, womit der befrackte Tänzer seiner Dame dankt. Er wird niemals abgewiesen, und keine entsetzte Mama stürzt herbei und ruft: „Kind, um Gotteswillen, Du bist echauffirt!“
Drinnen beim steinernen Krug im Nebenzimmer sitzen auch die Alten und disputiren, dieweil die Jugend außen tobt. Hier wird geplant für die Zukunft und geschimpft auf die Gegenwart – köstliche Genrebilder, für den, der sie malen könnte! Auch das Orchester zeigt drollige Figuren, wenn’s einmal tiefer in die Nacht geht. Da fallen dem müden Spielmann die Augen zu, und wenn er Nerven hätte, „wie die Groschenstricke“. Immer tiefer, immer zärtlicher sinkt sein Haupt auf die Baßgeige herunter, in deren Saiten er verzweifelt wühlt. Den Hornisten muß man zu jedem Tanz erst wecken, und selbst dann greift er gewöhnlich in der Eile nach dem Maßkrug statt nach dem Instrument. Nur die Bursche und Diend’ln „lassen nicht leicht aus“, bis der Morgen graut. „Das ist ein guter Nachtvogel,“ heißt es beinah von Jedem, „wenn er sechs Nächt’ nit schlaft, treibt er’s die siebente noch ärger.“
Die herrschende Tanzweise im Gebirge ist der Ländler, nur wenn an Kirchweihtagen die Handwerksgesellen des Ortes auf den Tanzplatz kommen, bestellen sie sich einen Walzer. Sind vollends ein paar Mistschaufler aus irgend einem herrschaftlichen Stalle da, so kommt es wohl gar im Einverständniß mit den mitsprechenden Köchinnen und Kammerkatzen zur Polka. Dieses Proletariat, das seine frechen Manieren mit halbeleganten Kleidern deckt, verunglimpft auch die Tanzböden, seit der Fremdenzug so viele vornehme Herren in’s Gebirge führt, und ist der Echtheit bäuerlichen Wesens mannigfach gefährlich.
Trotzdem bleibt der Tanzplatz noch immer ein sehr exclusiver Ort, wo die Lynchjustiz mehr Ansehen hat, als die Polizei. Auch das Tanzen ist nicht frei gegeben, sondern von den Anwesenden thun sich je acht bis zehn zusammen und bilden eine sogenannte „Schaar“. Solcher Schaaren, in welchen lauter gute Freunde oder Gemeindegenossen beisammen sind, giebt es etwa sechs bis sieben und für diese wird der Reihe nach aufgespielt. Jeder Tanz kostet einen Gulden, der durch Umlagen im Innern der Genossenschaft gedeckt wird. In dieser Weise bethätigt sich selbst beim Vergnügen der Genossenschaftstrieb, der so tief in allen Verhältnissen deutschen Rechtes und deutscher Cultur begründet ist.
Es ist auffallend, wie ablehnend sich auch die Mädchen gegen Fremde verhalten. Sie tanzen nicht gern mit einem „Herrischen“, denn größer, als die Ehre ist, wäre für sie die Schande, wenn dieser mit den ungewohnten Formen nicht zurecht käme. Auch kommt ein Mädchen bei Burschen ihres Gleichen leicht in Mißcredit, falls es sich einem Städter hold erzeigen wollte, weil man nach landesüblichen Begriffen gleich einen Schluß vom Wenigen auf Mehreres ziehen würde. In Galanteriesachen aber gilt noch heut der Grundsatz des Alterthums, daß der Fremde rechtlos ist.
Koketterie und Eifersucht, Eitelkeit und Rivalität giebt es auch auf dem Tanzplatz in den Bergen. Sie sind allenthalben, wo Menschen sind, sie bilden die Kehrseite der Oeffentlichkeit, der Geselligkeit. Dennoch hat hier die Geselligkeit ein von der städtischen verschiedenes Gepräge, sowohl was die Mischung der Elemente anlangt, als den Zweck. Vor Allem ist es bemerkenswerth, daß die Mädchen nicht von ihren Müttern begleitet werden. Diese erscheinen (außer bei Hochzeiten) niemals auf dem Tanzplatz, und vergeblich wird der Fremde jene würdigen Frauen suchen, denen er bisweilen im Salon begegnete. Ich meine jene Frauen, die stets durch die Lorgnette in die Zukunft ihrer Töchter blicken und mit eigenen Händen Propaganda für die Hand derselben machen. Es fehlt auf dem Lande die Absichtlichkeit, die das gesellige Zusammensein der großen Welt vergiftet. Im Charakter des Gebirgsvolkes überwiegt der Hang zu freier, ungebundener Bewegung bei weitem den Speculationstrieb; auch die Erziehung folgt diesem Zuge. Sobald es geht, wandeln Söhne und Töchter ihren eigenen Weg, der Bua hat sein Madel und das Madel hat seinen Buben, und erst wenn die Thatsachen allzu lebendig sprechen, giebt es Conflicte. Inzwischen sagen sich Vater und Mutter, daß sie’s auch nicht anders gemacht haben. Da ist es kein Wunder, wenn die Mädchen ganz allein auf den Tanzplatz kommen und wenn dort ein frischer, verwegener Ton regiert; aber selten gebricht es diesem Tone an Witz.
Beim Tanze liegt der Uebermuth fast in der Luft, Niemand ist vor seinem Ausbruch sicher, und am wenigsten, wie sich’s von selbst versteht, die Fremden. Noch heute muß ich an eine Scene denken, deren Augenzeuge ich vor Jahren in Egern war. Es befanden sich daselbst ein paar alte, dicke Damen von Adel, die mit bornirter Geschwätzigkeit sich über den Tanz moquirten. Plötzlich ging ein Holzknecht auf eine dieser verjährten Grazien los und forderte sie scherzhaft zum Tanze auf. Die Alte war sprachlos vor Entrüstung. Jener aber, an Körbe nicht gewöhnt, faßte sie ruhig um die Hüfte und im nächsten Augenblicke drehten sich die Beiden im rasenden Gewühle. Es sah aus, als hätte ein Mühlrad die Dame erfaßt, so blitzschnell, so unwiderstehlich war diese Rotation. Die seidene Mantille, die Bänder des würdigen Hutes flogen, es gab kein Entrinnen und keine Hülfe. Der Alten standen vor Wuth die Thränen in den Augen, aber sie tanzte, sie mußte tanzen, denn wer stehen bliebe, würde zertreten. Wohl schien es, als sei ihr letztes Stündlein gekommen, und schier wäre das Schnaderhüpfel für sie zur Wahrheit geworden, das da lautet:
Wenn ich amal stirb, stirb, stirb,
Spielt’s mir an Ländler auf,
Na tanzt mei Seel, Seel, Seel,
Pfeilgrad in Himmel ’nauf!
„Non, – je – meurs,“ flüsterte sie dem Holzknecht zu; der aber sprach:
„No mehr? Mir ist’s schon recht, wenn’s Dir nit damisch wird.“
Bedenklicher, als solche Scherze, sind die Balgereien, die nicht selten einen Tanz begleiten und wie der trojanische Krieg allezeit vom Weibe ausgehen. Auch hier habe ich eigenhändige Erfahrungen gesammelt, und es muß im Widerspruchsgeiste des Menschen liegen, daß er eine besondere Anhänglichkeit für jene Thüren bewahrt, wo er einmal hinausgeworfen wurde. Der Balcon von St. Quirin bleibt mir in dieser Beziehung ewig denkwürdig. Da bildeten sich auf einmal während des Tanzes zwei Parteien, ich weiß nicht mehr, auf welche ich durch das Gesetz der Schwere geschoben ward. Erst flogen die Hiebe, dann flog der Kreuzstock und durch diesen wurden etwa zwei Dutzend Personen auf den Balcon hinausgedrückt. Dann flogen wir selber, denn nach wenigen Secunden stürzte der Altan mit dem ganzen „schätzbaren Material“ zu Boden. „Herrgott,“ dacht’ ich im Fliegen, „mir thun nur die Gesandten leid, die Anno 1618 in Prag zum Fenster hinausgeworfen wurden; jetzt weiß ich erst, wie ungemüthlich dieses ist.“ Im Ganzen bin ich ebenso gut entronnen, wie die Gesandten, nur ein paar blaue Flecke hab ich noch lange zur Erinnerung an das Ereigniß bewahrt. Man findet bisweilen solche Vergißmeinnicht in den Bergen.
Nach städtischen Begriffen reicht die Galanterie eines Tänzers nur bis an die Schwelle des Saales. Bis dorthin geleitet er, wenn der Ball zu Ende ist, sein echauffirtes Schätzchen, dann macht er ein schmerzliches Compliment und geht. Der Jean aber holt einen Fiaker und in mütterlicher Obhut fährt das Fräulein nach Hause.
Im Gebirge führt der Bursch sein Mädel heim; es ist dies Recht und Pflicht für ihn. Zwischen Feldern und Wäldern zieht der Weg in’s Thal hinein, wo die einsamen Häuser am Fuße der Berge lehnen. Ueber den Bergen aber ist der Mond emporgestiegen und glitzert auf den Wellen. Es ist so stille. Nur die Bäume regen sich leise. Nur der halblaute Schritt hallt durch die Nacht. Langsam gehen die Beiden dahin, wer könnte schneller gehen in solcher Stunde? Schulter ist an Schulter gelehnt und
verschiedene: Die Gartenlaube (1868). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1868, Seite 652. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1868)_652.jpg&oldid=- (Version vom 15.9.2022)