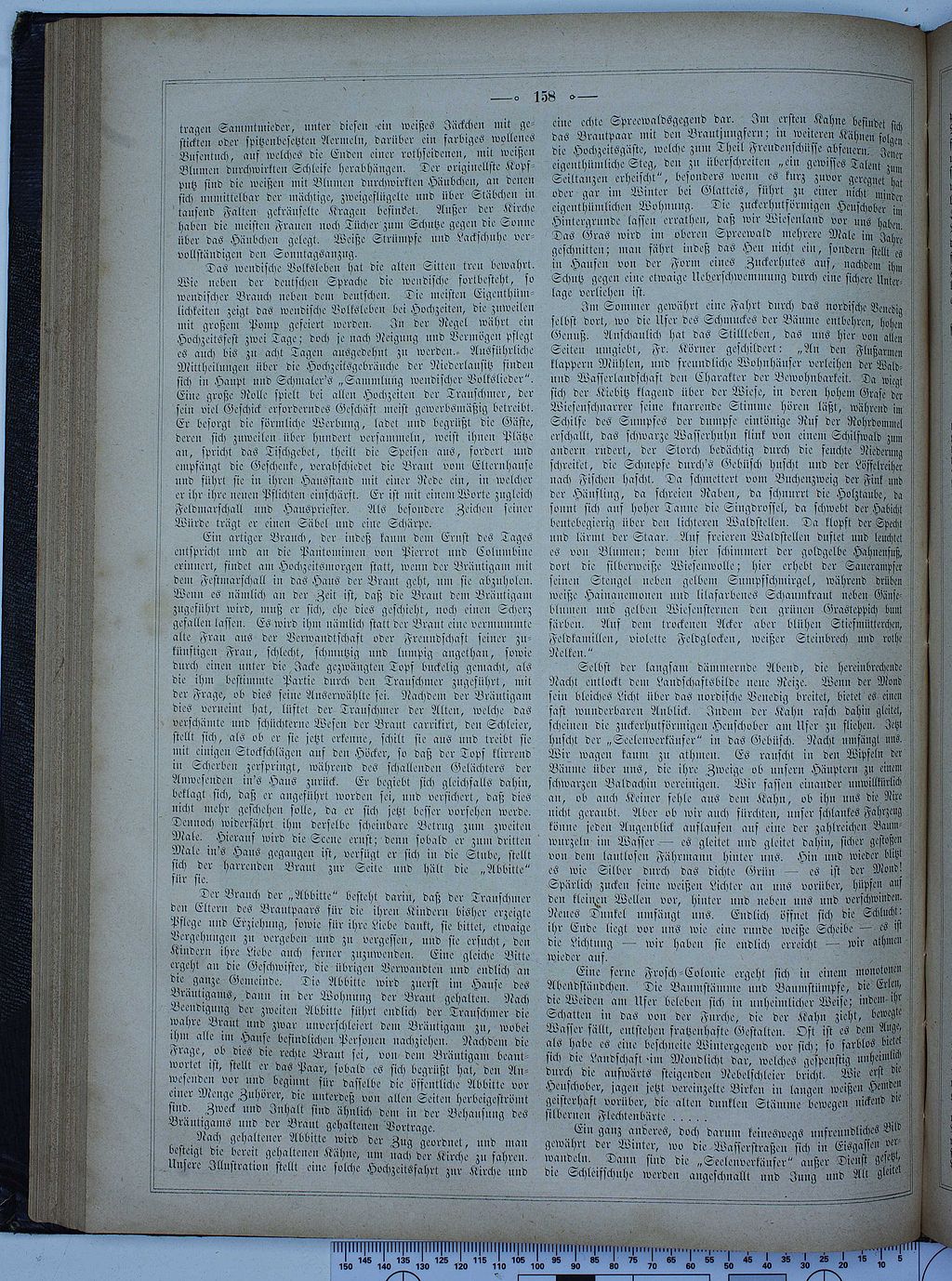| Verschiedene: Die Gartenlaube (1870) | |
|
|
tragen Sammtmieder, unter diesen ein weißes Jäckchen mit gestickten oder spitzenbesetzten Aermeln, darüber ein farbiges wollenes Busentuch, auf welches die Enden einer rothseidenen, mit weißen Blumen durchwirkten Schleife herabhängen. Der originellste Kopfputz sind die weißen mit Blumen durchwirkten Häubchen, an denen sich unmittelbar der mächtige, zweigeflügelte und über Stäbchen in tausend Falten gekräuselte Kragen befindet. Außer der Kirche haben die meisten Frauen noch Tücher zum Schutze gegen die Sonne über das Häubchen gelegt. Weiße Strümpfe und Lackschuhe vervollständigen den Sonntagsanzug.
Das wendische Volksleben hat die alten Sitten treu bewahrt. Wie neben der deutschen Sprache die wendische fortbesteht, so wendischer Brauch neben dem deutschen. Die meisten Eigenthümlichkeiten zeigt das wendische Volksleben bei Hochzeiten, die zuweilen mit großem Pomp gefeiert werden. In der Regel währt ein Hochzeitsfest zwei Tage; doch je nach Neigung und Vermögen pflegt es auch bis zu acht Tagen ausgedehnt zu werden. Ausführliche Mittheilungen über die Hochzeitsgebräuche der Niederlausitz finden sich in Haupt und Schmaler’s „Sammlung wendischer Volkslieder“. Eine große Rolle spielt bei allen Hochzeiten der Trauschmer, der sein viel Geschick erforderndes Geschäft meist gewerbsmäßig betreibt. Er besorgt die förmliche Werbung, ladet und begrüßt die Gäste, deren sich zuweilen über hundert versammeln, weist ihnen Plätze an, spricht das Tischgebet, theilt die Speisen aus, fordert und empfängt die Geschenke, verabschiedet die Braut vom Elternhause und führt sie in ihren Hausstand mit einer Rede ein, in welcher er ihr ihre neuen Pflichten einschärft. Er ist mit einem Worte zugleich Feldmarschall und Hauspriester. Als besondere Zeichen seiner Würde trägt er einen Säbel und eine Schärpe.
Ein artiger Brauch, der indeß kaum dem Ernst des Tages entspricht und an die Pantomimen von Pierrot und Columbine erinnert, findet am Hochzeitsmorgen statt, wenn der Bräutigam mit dem Festmarschall in das Haus der Braut geht, um sie abzuholen. Wenn es nämlich an der Zeit ist, daß die Braut dem Bräutigam zugeführt wird, muß er sich, ehe dies geschieht, noch einen Scherz gefallen lassen. Es wird ihm nämlich statt der Braut eine vermummte alte Frau aus der Verwandtschaft oder Freundschaft seiner zukünftigen Frau, schlecht, schmutzig und lumpig angethan, sowie durch einen unter die Jacke gezwängten Topf buckelig gemacht, als die ihm bestimmte Partie durch den Trauschmer zugeführt, mit der Frage, ob dies seine Auserwählte sei. Nachdem der Bräutigam dies verneint hat, lüftet der Trauschmer der Alten, welche das verschämte und schüchterne Wesen der Braut carrikirt, den Schleier, stellt sich, als ob er sie jetzt erkenne, schilt sie aus und treibt sie mit einigen Stockschlägen auf den Höcker, so daß der Topf klirrend in Scherben zerspringt, während des schallenden Gelächters der Anwesenden in’s Haus zurück. Er begiebt sich gleichfalls dahin, beklagt sich, daß er angeführt worden sei, und versichert, daß dies nicht mehr geschehen solle, da er sich jetzt besser vorsehen werde. Dennoch widerfährt ihm derselbe scheinbare Betrug zum zweiten Male. Hierauf wird die Scene ernst; denn sobald er zum dritten Male in’s Haus gegangen ist, verfügt er sich in die Stube, stellt sich der harrenden Braut zur Seite und hält die „Abbitte“ für sie.
Der Brauch der „Abbitte“ besteht darin, daß der Trauschmer den Eltern des Brautpaars für die ihren Kindern bisher erzeigte Pflege und Erziehung, sowie für ihre Liebe dankt, sie bittet, etwaige Vergehungen zu vergeben und zu vergessen, und sie ersucht, den Kindern ihre Liebe auch ferner zuzuwenden. Eine gleiche Bitte ergeht an die Geschwister, die übrigen Verwandten und endlich an die ganze Gemeinde. Die Abbitte wird zuerst im Hause des Bräutigams, dann in der Wohnung der Braut gehalten. Nach Beendigung der zweiten Abbitte führt endlich der Trauschmer die wahre Braut und zwar unverschleiert dem Bräutigam zu, wobei ihm alle im Hause befindlichen Personen nachziehen. Nachdem die Frage, ob dies die rechte Braut sei, von dem Bräutigam beantwortet ist, stellt er das Paar, sobald es sich begrüßt hat, den Anwesenden vor und beginnt für dasselbe die öffentliche Abbitte vor einer Menge Zuhörer, die unterdeß von allen Seiten herbeigeströmt sind. Zweck und Inhalt sind ähnlich dem in der Behausung des Bräutigams und der Braut gehaltenen Vortrage.
Nach gehaltener Abbitte wird der Zug geordnet, und man besteigt die bereit gehaltenen Kähne, um nach der Kirche zu fahren. Unsere Illustration stellt eine solche Hochzeitsfahrt zur Kirche und eine echte Spreewaldsgegend dar. Im ersten Kahne befindet sich das Brautpaar mit den Brautjungfern; in weiteren Kähnen folgen die Hochzeitsgäste, welche zum Theil Freudenschüsse abfeuern. Jener eigenthümliche Steg, den zu überschreiten „ein gewisses Talent zum Seiltanzen erheischt“, besonders wenn es kurz zuvor geregnet hat oder gar im Winter bei Glatteis, führt zu einer nicht minder eigenthümlichen Wohnung. Die zuckerhutförmigen Heuschober im Hintergrunde lassen errathen, daß wir Wiesenland vor uns haben. Das Gras wird im oberen Spreewald mehrere Male im Jahre geschnitten; man fährt indeß das Heu nicht ein, sondern stellt es in Haufen von der Form eines Zuckerhutes auf, nachdem ihm Schutz gegen eine etwaige Ueberschwemmung durch eine sichere Unterlage verliehen ist.
Im Sommer gewährt eine Fahrt durch das nordische Venedig selbst dort, wo die Ufer des Schmuckes der Bäume entbehren, hohen Genuß. Anschaulich hat das Stillleben, das uns hier von allen Seiten umgiebt, Fr. Körner geschildert: „An den Flußarmen klappern Mühlen, und freundliche Wohnhäuser verleihen der Wald- und Wasserlandschaft den Charakter der Bewohnbarkeit. Da wiegt sich der Kiebitz klagend über der Wiese, in deren hohem Grase der Wiesenschnarrer seine knarrende Stimme hören läßt, während im Schilfe des Sumpfes der dumpfe eintönige Ruf der Rohrdommel erschallt, das schwarze Wasserhuhn flink von einem Schilfwald zum andern rudert, der Storch bedächtig durch die feuchte Niederung schreitet, die Schnepfe durch’s Gebüsch huscht und der Löffelreiher nach Fischen hascht. Da schmettert vom Buchenzweig der Fink und der Hänfling, da schreien Raben, da schnurrt die Holztaube, da sonnt sich auf hoher Tanne die Singdrossel, da schwebt der Habicht beutebegierig über den lichteren Waldstellen. Da klopft der Specht und lärmt der Staar. Auf freieren Waldstellen duftet und leuchtet es von Blumen; denn hier schimmert der goldgelbe Hahnenfuß, dort die silberweiße Wiesenwolle; hier erhebt der Sauerampfer seinen Stengel neben gelbem Sumpfschmirgel, während drüben weiße Hainanemonen und lilafarbenes Schaumkraut neben Gänseblumen und gelben Wiesensternen den grünen Grasteppich bunt färben. Auf dem trockenen Acker aber blühen Stiefmütterchen, Feldkamillen, violette Feldglocken, weißer Steinbrech und rothe Nelken.“
Selbst der langsam dämmernde Abend, die hereinbrechende Nacht entlockt dem Landschaftsbilde neue Reize. Wenn der Mond sein bleiches Licht über das nordische Venedig breitet, bietet es einen fast wunderbaren Anblick. Indem der Kahn rasch dahin gleitet, scheinen die zuckerhutförmigen Heuschober am Ufer zu fliehen. Jetzt huscht der „Seelenverkäufer“ in das Gebüsch. Nacht umfängt uns. Wir wagen kaum zu athmen. Es rauscht in den Wipfeln der Bäume über uns, die ihre Zweige ob unsern Häuptern zu einem schwarzen Baldachin vereinigen. Wir fassen einander unwillkürlich an, ob auch Keiner fehle aus dem Kahn, ob ihn uns die Nixe nicht geraubt. Aber ob wir auch fürchten, unser schlankes Fahrzeug könne jeden Augenblick auflaufen auf eine der zahlreichen Baumwurzeln im Wasser – es gleitet und gleitet dahin, sicher gestoßen von dem lautlosen Fährmann hinter uns. Hin und wieder blitzt es wie Silber durch das dichte Grün – es ist der Mond! Spärlich zucken seine weißen Lichter an uns vorüber, hüpfen auf den kleinen Wellen vor, hinter und neben uns und verschwinden. Neues Dunkel umfängt uns. Endlich öffnet sich die Schlucht: ihr Ende liegt vor uns wie eine runde weiße Scheibe – es ist die Lichtung – wir haben sie endlich erreicht – wir athmen wieder auf.
Eine ferne Frosch-Colonie ergeht sich in einem monotonen Abendständchen. Die Baumstämme und Baumstümpfe, die Erlen, die Weiden am Ufer beleben sich in unheimlicher Weise; indem ihr Schatten in das von der Furche, die der Kahn zieht, bewegte Wasser fällt, entstehen fratzenhafte Gestalten. Oft ist es dem Auge, als habe es eine beschneite Wintergegend vor sich; so farblos bietet sich die Landschaft im Mondlicht dar, welches gespenstig unheimlich durch die aufwärts steigenden Nebelschleier bricht. Wie erst die Heuschober, jagen jetzt vereinzelte Birken in langen weißen Hemden geisterhaft vorüber, die alten dunklen Stämme bewegen nickend die silbernen Flechtenbärte …..
Ein ganz anderes, doch darum keineswegs unfreundliches Bild gewährt der Winter, wo die Wasserstraßen sich in Eisgassen verwandeln. Dann sind die „Seelenverkäufer“ außer Dienst gesetzt, die Schleifschuhe werden angeschnallt und Jung und Alt gleitet
Verschiedene: Die Gartenlaube (1870). Leipzig: Ernst Keil, 1870, Seite 158. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1870)_158.jpg&oldid=- (Version vom 7.1.2019)