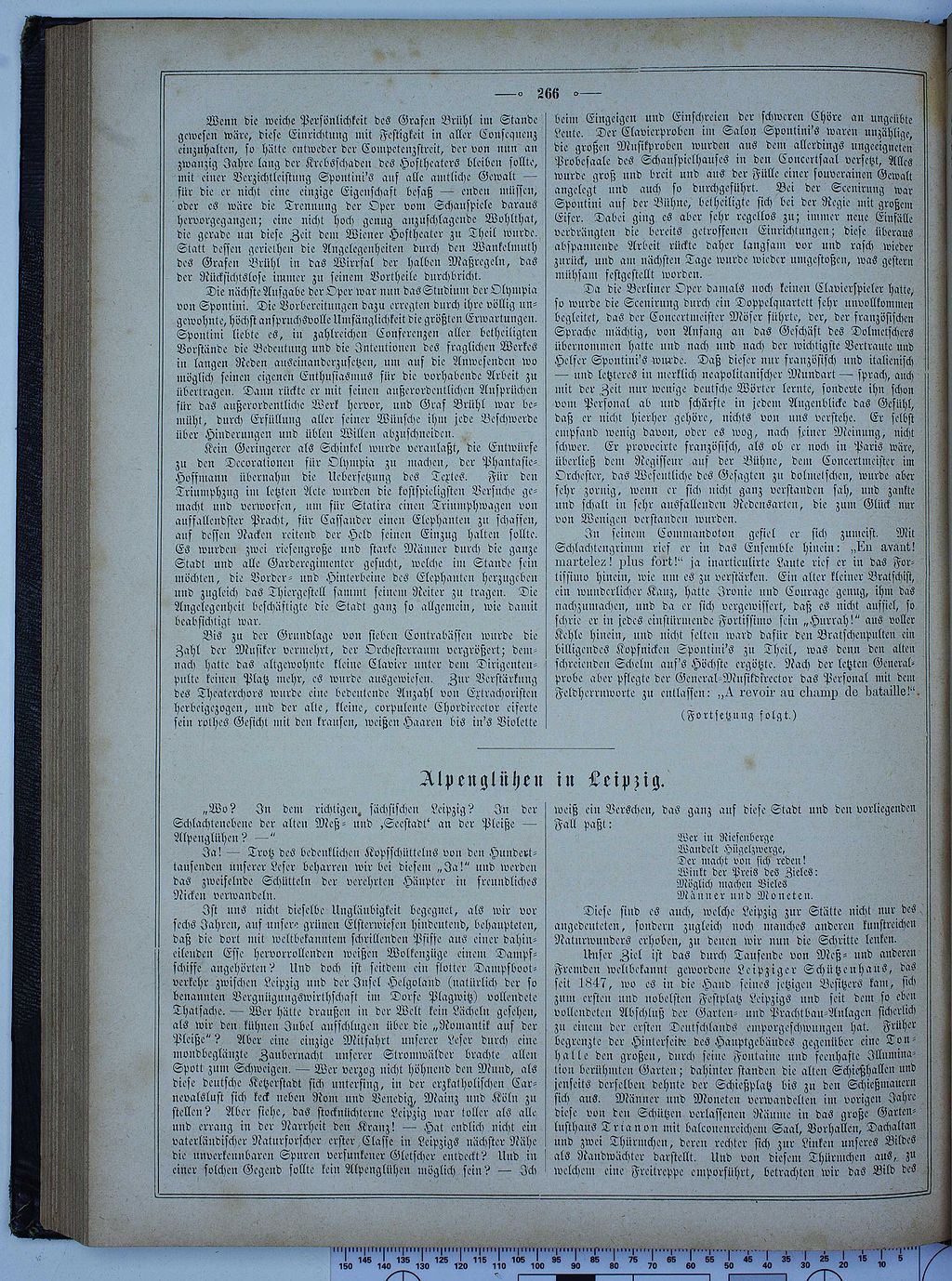| Verschiedene: Die Gartenlaube (1870) | |
|
|
Wenn die weiche Persönlichkeit des Grafen Brühl im Stande gewesen wäre, diese Einrichtung mit Festigkeit in aller Consequenz einzuhalten, so hätte entweder der Competenzstreit, der von nun an zwanzig Jahre lang der Krebsschaden des Hoftheaters bleiben sollte, mit einer Verzichtleistung Spontini’s auf alle amtliche Gewalt – für die er nicht eine einzige Eigenschaft besaß – enden müssen, oder es wäre die Trennung der Oper vom Schauspiele daraus hervorgegangen; eine nicht hoch genug anzuschlagende Wohlthat, die gerade um diese Zeit dem Wiener Hoftheater zu Theil wurde. Statt dessen geriethen die Angelegenheiten durch den Wankelmuth des Grafen Brühl in das Wirrsal der halben Maßregeln, das der Rücksichtslose immer zu seinem Vortheile durchbricht.
Die nächste Aufgabe der Oper war nun das Studium der Olympia von Spontini. Die Vorbereitungen dazu erregten durch ihre völlig ungewohnte, höchst anspruchsvolle Umfänglichkeit die größten Erwartungen. Spontini liebte es, in zahlreichen Conferenzen aller betheiligten Vorstände die Bedeutung und die Intentionen des fraglichen Werkes in langen Reden auseinanderzusetzen, um auf die Anwesenden wo möglich seinen eigenen Enthusiasmus für die vorhabende Arbeit zu übertragen. Dann rückte er mit seinen außerordentlichen Ansprüchen für das außerordentliche Werk hervor, und Graf Brühl war bemüht, durch Erfüllung aller seiner Wünsche ihm jede Beschwerde über Hinderungen und üblen Willen abzuschneiden.
Kein Geringerer als Schinkel wurde veranlaßt, die Entwürfe zu den Decorationen für Olympia zu machen, der Phantasie-Hoffmann übernahm die Uebersetzung des Textes. Für den Triumphzug im letzten Acte wurden die kostspieligsten Versuche gemacht und verworfen, um für Statira einen Triumphwagen von auffallendster Pracht, für Cassander einen Elephanten zu schaffen, auf dessen Nacken reitend der Held seinen Einzug halten sollte. Es wurden zwei riesengroße und starke Männer durch die ganze Stadt und alle Garderegimenter gesucht, welche im Stande sein möchten, die Vorder- und Hinterbeine des Elephanten herzugeben und zugleich das Thiergestell sammt seinem Reiter zu tragen. Die Angelegenheit beschäftigte die Stadt ganz so allgemein, wie damit beabsichtigt war.
Bis zu der Grundlage von sieben Contrabässen wurde die Zahl der Musiker vermehrt, der Orchesterraum vergrößert; demnach hatte das altgewohnte kleine Clavier unter dem Dirigentenpulte keinen Platz mehr, es wurde ausgewiesen. Zur Verstärkung des Theaterchors wurde eine bedeutende Anzahl von Extrachoristen herbeigezogen, und der alte, kleine, corpulente Chordirector eiferte sein rothes Gesicht mit den krausen, weißen Haaren bis in’s Violette beim Eingeigen und Einschreien der schweren Chöre an ungeübte Leute. Der Clavierproben im Salon Spontini’s waren unzählige, die großen Musikproben wurden aus dem allerdings ungeeigneten Probesaale des Schauspielhauses in den Concertsaal versetzt, Alles wurde groß und breit und aus der Fülle einer souverainen Gewalt angelegt und auch so durchgeführt. Bei der Scenirung war Spontini auf der Bühne, betheiligte sich bei der Regie mit großem Eifer. Dabei ging es aber sehr regellos zu; immer neue Einfälle verdrängten die bereits getroffenen Einrichtungen; diese überaus abspannende Arbeit rückte daher langsam vor und rasch wieder zurück, und am nächsten Tage wurde wieder umgestoßen, was gestern mühsam festgestellt worden.
Da die Berliner Oper damals noch keinen Clavierspieler hatte, so wurde die Scenirung durch ein Doppelquartett sehr unvollkommen begleitet, das der Concertmeister Möser führte, der, der französischen Sprache mächtig, von Anfang an das Geschäft des Dolmetschers übernommen hatte und nach und nach der wichtigste Vertraute und Helfer Spontini’s wurde. Daß dieser nur französisch und italienisch – und letzteres in merklich neapolitanischer Mundart – sprach, auch mit der Zeit nur wenige deutsche Wörter lernte, sonderte ihn schon vom Personal ab und schärfte in jedem Augenblicke das Gefühl, daß er nicht hierher gehöre, nichts von uns verstehe. Er selbst empfand wenig davon, oder es wog, nach seiner Meinung, nicht schwer. Er provocirte französisch, als ob er noch in Paris wäre, überließ dem Regisseur auf der Bühne, dem Concertmeister im Orchester, das Wesentliche des Gesagten zu dolmetschen, wurde aber sehr zornig, wenn er sich nicht ganz verstanden sah, und zankte und schalt in sehr ausfallenden Redensarten, die zum Glück nur von Wenigen verstanden wurden.
In seinem Commandoton gefiel er sich zumeist. Mit Schlachtengrimm rief er in das Ensemble hinein: „En avant! martelez! plus fort!“ ja inarticulirte Laute rief er in das Fortissimo hinein, wie um es zu verstärken. Ein alter kleiner Bratschist, ein wunderlicher Kauz, hatte Ironie und Courage genug, ihm das nachzumachen, und da er sich vergewissert, daß es nicht auffiel, so schrie er in jedes einstürmende Fortissimo sein „Hurrah!“ aus voller Kehle hinein, und nicht selten ward dafür den Bratschenpulten ein billigendes Kopfnicken Spontini’s zu Theil, was denn den alten schreienden Schelm auf’s Höchste ergötzte. Nach der letzten Generalprobe aber pflegte der General-Musikdirector das Personal mit dem Feldherrnworte zu entlassen: „A revoir au champ de bataille!“
„Wo? In dem richtigen sächsischen Leipzig? In der Schlachtenebene der alten Meß- und ‚Seestadt‘ an der Pleiße – Alpenglühen? –“
Ja! – Trotz des bedenklichen Kopfschüttelns von den Hunderttausenden unserer Leser beharren wir bei diesem „Ja!“ und werden das zweifelnde Schütteln der verehrten Häupter in freundliches Nicken verwandeln.
Ist uns nicht dieselbe Ungläubigkeit begegnet, als wir vor sechs Jahren, auf unsere grünen Elsterwiesen hindeutend, behaupteten, daß die dort mit weltbekanntem schrillenden Pfiffe aus einer dahineilenden Esse hervorrollenden weißen Wolkenzüge einem Dampfschiffe angehörten? Und doch ist seitdem ein flotter Dampfbootverkehr zwischen Leipzig und der Insel Helgoland (natürlich der so benannten Vergnügungswirthschaft im Dorfe Plagwitz) vollendete Thatsache. – Wer hätte draußen in der Welt kein Lächeln gesehen, als wir den kühnen Jubel aufschlugen über die „Romantik auf der Pleiße“? Aber eine einzige Mitfahrt unserer Leser durch eine mondbeglänzte Zaubernacht unserer Stromwälder brachte allen Spott zum Schweigen. – Wer verzog nicht höhnend den Mund, als diese deutsche Ketzerstadt sich unterfing, in der erzkatholischen Carnevalslust sich keck neben Rom und Venedig, Mainz und Köln zu stellen? Aber siehe, das stocknüchterne Leipzig war toller als alle und errang in der Narrheit den Kranz! – Hat endlich nicht ein vaterländischer Naturforscher erster Classe in Leipzigs nächster Nähe die unverkennbaren Spuren versunkener Gletscher entdeckt? Und in einer solchen Gegend sollte kein Alpenglühen möglich sein? – Ich weiß ein Verschen, das ganz auf diese Stadt und den vorliegenden Fall paßt:
Wer in Riesenberge
Wandelt Hügelzwerge,
Der macht von sich reden!
Winkt der Preis des Zieles:
Möglich machen Vieles
Männer und Moneten.
Diese sind es auch, welche Leipzig zur Stätte nicht nur des angedeuteten, sondern zugleich noch manches anderen kunstreichen Naturwunders erhoben, zu denen wir nun die Schritte lenken.
Unser Ziel ist das durch Tausende von Meß- und anderen Fremden weltbekannt gewordene Leipziger Schützenhaus, das seit 1847, wo es in die Hand seines jetzigen Besitzers kam, sich zum ersten und nobelsten Festplatz Leipzigs und seit dem so eben vollendeten Abschluß der Garten- und Prachtbau-Anlagen sicherlich zu einem der ersten Deutschlands emporgeschwungen hat. Früher begrenzte der Hinterseite des Hauptgebäudes gegenüber eine Tonhalle den großen, durch seine Fontaine und feenhafte Illumination berühmten Garten; dahinter standen die alten Schießhallen und jenseits derselben dehnte der Schießplatz bis zu den Schießmauern sich aus. Männer und Moneten verwandelten im vorigen Jahre diese von den Schützen verlassenen Räume in das große Gartenlusthaus Trianon mit balconenreichem Saal, Vorhallen, Dachaltan und zwei Thürmchen, deren rechter sich zur Linken unseres Bildes als Randwächter darstellt. Und von diesem Thürmchen aus, zu welchem eine Freitreppe emporführt, betrachten wir das Bild des
Verschiedene: Die Gartenlaube (1870). Leipzig: Ernst Keil, 1870, Seite 266. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1870)_266.jpg&oldid=- (Version vom 11.5.2019)