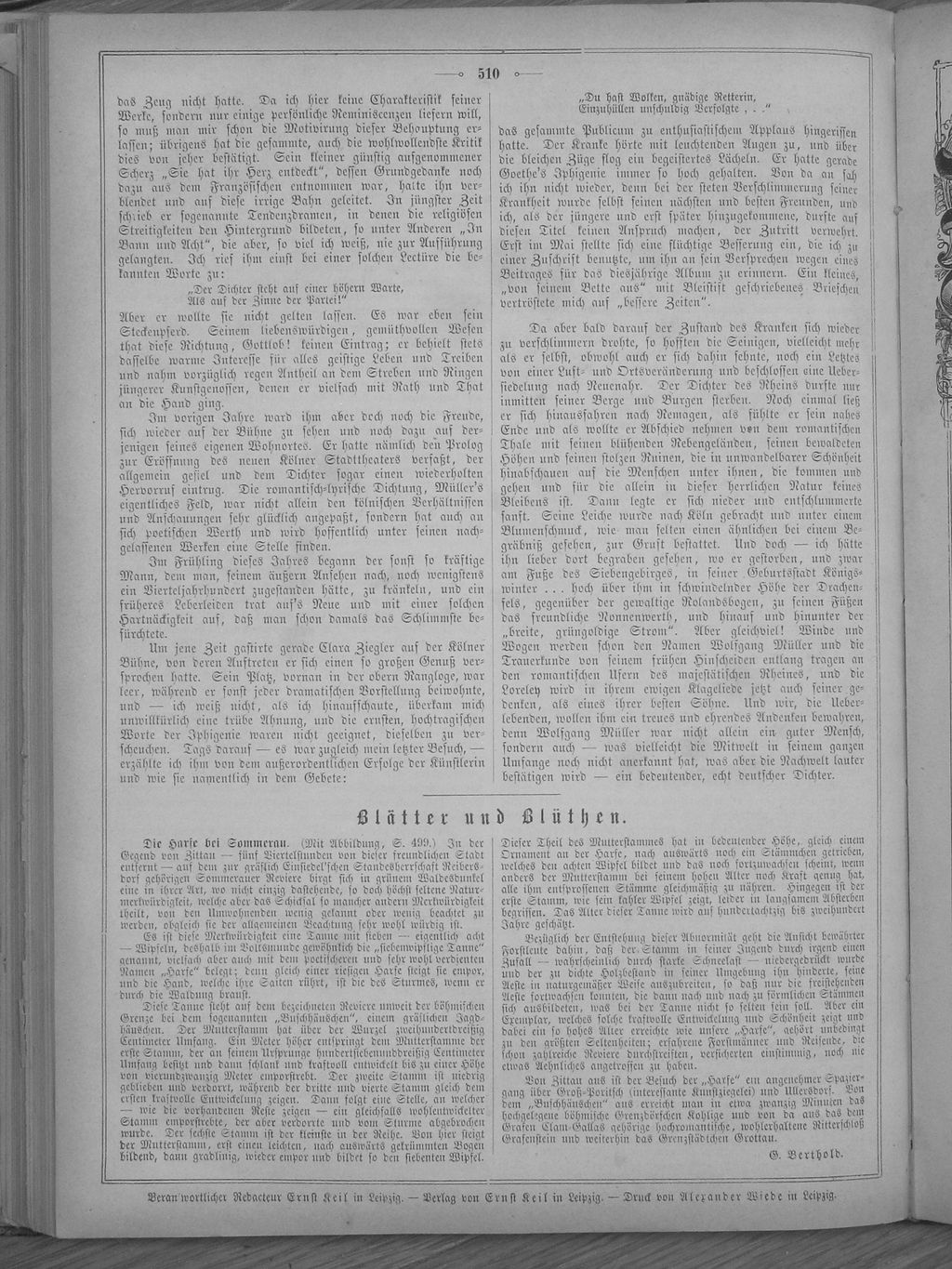| Verschiedene: Die Gartenlaube (1873) | |
|
|
das Zeug nicht hatte. Da ich hier keine Charakteristik seiner Werke, sondern nur einige persönliche Reminiscenzen liefern will, so muß man mir schon die Motivirung dieser Behauptung erlassen; übrigens hat die gesammte, auch die wohlwollendste Kritik dies von jeher bestätigt. Sein kleiner günstig aufgenommener Scherz „Sie hat ihr Herz entdeckt“, dessen Grundgedanke noch dazu aus dem Französischen entnommen war, hatte ihn verblendet und auf diese irrige Bahn geleitet. In jüngster Zeit schrieb er sogenannte Tendenzdramen, in denen die religiösen Streitigkeiten den Hintergrund bildeten, so unter Anderen „In Bann und Acht“, die aber, so viel ich weiß, nie zur Aufführung gelangten. Ich rief ihm einst bei einer solchen Lectüre die bekannten Worte zu:
„Der Dichter steht auf einer höhern Warte,
Als auf der Zinne der Partei!“
Aber er wollte sie nicht gelten lassen. Es war eben sein Steckenpferd. Seinem liebenswürdigen, gemüthvollen Wesen that diese Richtung, Gottlob! keinen Eintrag; er behielt stets dasselbe warme Interesse für alles geistige Leben und Treiben und nahm vorzüglich regen Antheil an dem Streben und Ringen jüngerer Kunstgenossen, denen er vielfach mit Rath und That an die Hand ging.
Im vorigen Jahre ward ihm aber doch noch die Freude, sich wieder auf der Bühne zu sehen und noch dazu auf derjenigen seines eigenen Wohnortes. Er hatte nämlich den Prolog zur Eröffnung des neuen Kölner Stadttheaters verfaßt, der allgemein gefiel und dem Dichter sogar einen wiederholten Hervorruf eintrug. Die romantisch-lyrische Dichtung, Müller’s eigentliches Feld, war nicht allein den kölnischen Verhältnissen und Anschauungen sehr glücklich angepaßt, sondern hat auch an sich poetischen Werth und wird hoffentlich unter seinen nachgelassenen Werken eine Stelle finden.
Im Frühling dieses Jahres begann der sonst so kräftige Mann, dem man, seinem äußern Ansehen nach, noch wenigstens ein Vierteljahrhundert zugestanden hätte, zu kränkeln, und ein früheres Leberleiden trat auf’s Neue und mit einer solchen Hartnäckigkeit auf, daß man schon damals das Schlimmste befürchtete.
Um jene Zeit gastirte gerade Clara Ziegler auf der Kölner Bühne, von deren Auftreten er sich einen so großen Genuß versprochen hatte. Sein Platz, vornan in der obern Rangloge, war leer, während er sonst jeder dramatischen Vorstellung beiwohnte, und – ich weiß nicht, als ich hinaufschaute, überkam mich unwillkürlich eine trübe Ahnung, und die ernsten, hochtragischen Worte der Iphigenie waren nicht geeignet, dieselben zu verscheuchen. Tags darauf – es war zugleich mein letzter Besuch, – erzählte ich ihm von dem außerordentlichen Erfolge der Künstlerin und wie sie namentlich in dem Gebete:
„Du hast Wolken, gnädige Retterin,
Einzuhüllen unschuldig Verfolgte, …“
das gesammte Publicum zu enthusiastischem Applaus hingerissen hatte. Der Kranke hörte mit leuchtenden Augen zu, und über die bleichen Züge flog ein begeistertes Lächeln. Er hatte gerade Goethe’s Iphigenie immer so hoch gehalten. Von da an sah ich ihn nicht wieder, denn bei der steten Verschlimmerung seiner Krankheit wurde selbst seinen nächsten und besten Freunden, und ich, als der jüngere und erst später hinzugekommene, durfte auf diesen Titel keinen Anspruch machen, der Zutritt verwehrt. Erst im Mai stellte sich eine flüchtige Besserung ein, die ich zu einer Zuschrift benutzte, um ihn an sein Versprechen wegen eines Beitrages für das diesjährige Album zu erinnern. Ein kleines, „von seinem Bette aus“ mit Bleistift geschriebenes Briefchen vertröstete mich auf „bessere Zeiten“.
Da aber bald darauf der Zustand des Kranken sich wieder zu verschlimmern drohte, so hofften die Seinigen, vielleicht mehr als er selbst, obwohl auch er sich dahin sehnte, noch ein Letztes von einer Luft- und Ortsveränderung und beschlossen eine Uebersiedelung nach Neuenahr. Der Dichter des Rheins durfte nur inmitten seiner Berge und Burgen sterben. Noch einmal ließ er sich hinausfahren nach Remagen, als fühlte er sein nahes Ende und als wollte er Abschied nehmen von dem romantischen Thale mit seinen blühenden Rebengeländen, seinen bewaldeten Höhen und seinen stolzen Ruinen, die in unwandelbarer Schönheit hinabschauen auf die Menschen unter ihnen, die kommen und gehen und für die allein in dieser herrlichen Natur keines Bleibens ist. Dann legte er sich nieder und entschlummerte sanft. Seine Leiche wurde nach Köln gebracht und unter einem Blumenschmuck, wie man selten einen ähnlichen bei einem Begräbniß gesehen, zur Gruft bestattet. Und doch – ich hätte ihn lieber dort begraben gesehen, wo er gestorben, und zwar am Fuße des Siebengebirges, in seiner Geburtsstadt Königswinter … hoch über ihm in schwindelnder Höhe der Drachenfels, gegenüber der gewaltige Rolandsbogen, zu seinen Füßen das freundliche Nonnenwerth, und hinauf und hinunter der „breite, grüngoldige Strom“. Aber gleichviel! Winde und Wogen werden schon den Namen Wolfgang Müller und die Trauerkunde von seinem frühen Hinscheiden entlang tragen an den romantischen Ufern des majestätischen Rheines, und die Loreley wird in ihrem ewigen Klageliede jetzt auch seiner gedenken, als eines ihrer besten Söhne. Und wir, die Ueberlebenden, wollen ihm ein treues und ehrendes Andenken bewahren, denn Wolfgang Müller war nicht allein ein guter Mensch, sondern auch – was vielleicht die Mitwelt in seinem ganzen Umfange noch nicht anerkannt hat, was aber die Nachwelt lauter bestätigen wird – ein bedeutender, echt deutscher Dichter.
Die Harfe bei Sommerau. (Mit Abbildung, S. 499.) In der Gegend von Zittau – fünf Viertelstunden von dieser freundlichen Stadt entfernt – auf dem zur gräflich Einsiedel’schen Standesherrschaft Reibersdorf gehörigen Sommerauer Reviere birgt sich in grünem Waldesdunkel eine in ihrer Art, wo nicht einzig dastehende, so doch höchst seltene Naturmerkwürdigkeit, welche aber das Schicksal so mancher andern Merkwürdigkeit theilt, von den Umwohnenden wenig gekannt ober wenig beachtet zu werden, obgleich sie der allgemeinen Beachtung sehr wohl würdig ist.
Es ist diese Merkwürdigkeit eine Tanne mit sieben – eigentlich acht – Wipfeln, deshalb im Volksmunde gewöhnlich die „siebenwipflige Tanne“ genannt, vielfach aber auch mit dem poetischeren und sehr wohl verdienten Namen „Harfe“ belegt; denn gleich einer riesigen Harfe steigt sie empor, und die Hand, welche ihre Saiten rührt, ist die des Sturmes, wenn er durch die Waldung braust.
Diese Tanne steht auf dem bezeichneten Reviere unweit der böhmischen Grenze bei dem sogenannten „Buschhäuschen“, einem gräflichen Jagdhäuschen. Der Mutterstamm hat über der Wurzel zweihundertdreißig Centimeter Umfang. Ein Meter höher entspringt dem Mutterstamme der erste Stamm, der an seinem Ursprunge hundertsiebenunddreißig Centimeter Umfang besitzt und dann schlank und kraftvoll entwickelt bis zu einer Höhe von vierundzwanzig Meter emporstrebt. Der zweite Stamm ist niedrig geblieben und verdorrt, während der dritte und vierte Stamm gleich dem ersten kraftvolle Entwickelung zeigen. Dann folgt eine Stelle, an welcher – wie die vorhandenen Reste zeigen – ein gleichfalls wohlentwickelter Stamm emporstrebte, der aber verdorrte und vom Sturme abgebrochen wurde. Der sechste Stamm ist der kleinste in der Reihe. Von hier steigt der Mutterstamm, erst einen leichten, nach aufwärts gekrümmten Bogen bildend, dann gradlinig, wieder empor und bildet so den siebenten Wipfel. Dieser Theil des Mutterstammes hat in bedeutender Höhe, gleich einem Ornament an der Harfe, nach auswärts noch ein Stämmchen getrieben, welches den achten Wipfel bildet und das noch fortzuwachsen scheint, wenn anders der Mutterstamm bei seinem hohen Alter noch Kraft genug hat, alle ihm entsprossenen Stämme gleichmäßig zu nähren. Hingegen ist der erste Stamm, wie sein kahler Wipfel zeigt, leider in langsamem Absterben begriffen. Das Alter dieser Tanne wird auf hundertachtzig bis zweihundert Jahre geschätzt.
Bezüglich der Entstehung dieser Abnormität geht die Ansicht bewährter Forstleute dahin, daß der Stamm in seiner Jugend durch irgend einen Zufall – wahrscheinlich durch starke Schneelast – niedergedrückt wurde und der zu dichte Holzbestand in seiner Umgebung ihn hinderte, seine Aeste in naturgemäßer Weise auszubreiten, so daß nur die freistehenden Aeste fortwachsen konnten, die dann nach und nach zu förmlichen Stämmen sich ausbildeten, was bei der Tanne nicht so selten sein soll. Aber ein Exemplar, welches solche kraftvolle Entwickelung und Schönheit zeigt und dabei ein so hohes Alter erreichte wie unsere „Harfe“, gehört unbedingt zu den größten Seltenheiten; erfahrene Forstmänner und Reisende, die schon zahlreiche Reviere durchstreiften, versicherten einstimmig, noch nie etwas Aehnliches angetroffen zu haben.
Von Zittau aus ist der Besuch der „Harfe“ ein angenehmer Spaziergang über Groß-Poritsch (interessante Kunstziegelei) und Ullersdorf. Von dem „Buschhäuschen“ aus erreicht man in etwa zwanzig Minuten das hochgelegene böhmische Grenzdörfchen Kohlige und von da aus das dem Grafen Clam-Gallas gehörige hochromantische, wohlerhaltene Ritterschloß Grafenstein und weiterhin das Grenzstädtchen Grottau.
Verschiedene: Die Gartenlaube (1873). Leipzig: Ernst Keil, 1873, Seite 510. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1873)_510.JPG&oldid=- (Version vom 3.8.2020)