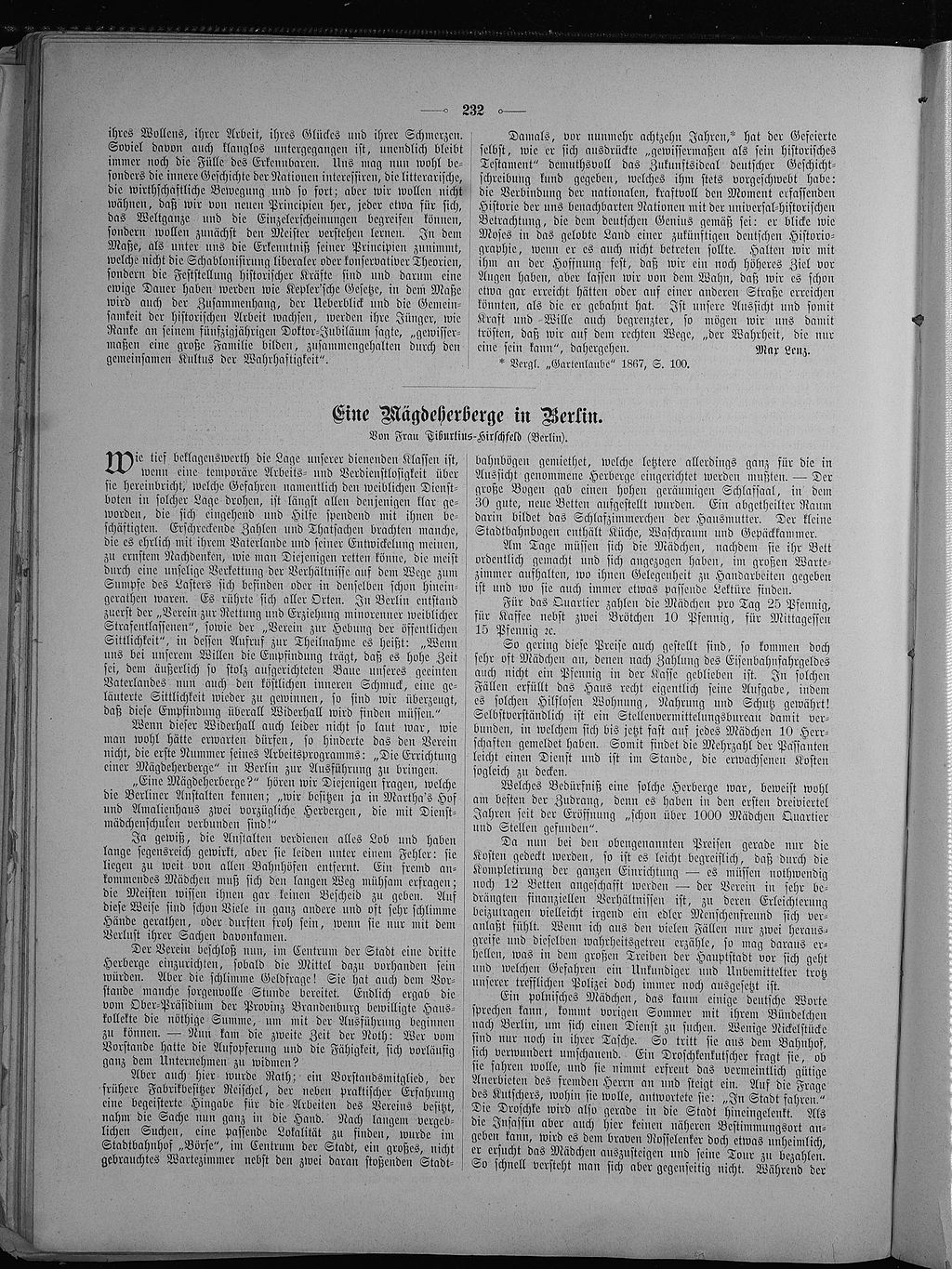| Verschiedene: Die Gartenlaube (1885) | |
|
|
ihres Wollens, ihrer Arbeit, ihres Glückes und ihrer Schmerzen. Soviel davon auch klanglos untergegangen ist, unendlich bleibt immer noch die Fülle des Erkennbaren. Uns mag nun wohl besonders die innere Geschichte der Nationen interessiren, die litterarische, die wirthschaftliche Bewegung und so fort; aber wir wollen nicht wähnen, daß wir von neuen Principien her, jeder etwa für sich, das Weltganze und die Einzelerscheinungen begreifen können, sondern wollen zunächst den Meister verstehen lernen. In dem Maße, als unter uns die Erkenntniß seiner Principien zunimmt, welche nicht die Schablonisirung liberaler oder konservativer Theorien, sondern die Feststellung historischer Kräfte sind und darum eine ewige Dauer haben werden wie Kepler’sche Gesetze, in dem Maße wird auch der Zusammenhang, der Ueberblick und die Gemeinsamkeit der historischen Arbeit wachsen, werden ihre Jünger, wie Ranke an seinem fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum sagte; „gewissermaßen eine große Familie bilden, zusammengehalten durch den gemeinsamen Kultus der Wahrhaftigkeit“.
Damals, vor nunmehr achtzehn Jahren,[1] hat der Gefeierte selbst, wie er sich ausdrückte „gewissermaßen als sein historisches Testament“ demuthsvoll das Zukunftsideal deutscher Geschichtschreibung kund gegeben, welches ihm stets vorgeschwebt habe: die Verbindung der nationalen, kraftvoll den Moment erfassenden Historie der uns benachbarten Nationen mit der universal-historischen Betrachtung, die dem deutschen Genius gemäß sei: er blicke wie Moses in das gelobte Land einer zukünftigen deutschen Historiographie, wenn er es auch nicht betreten sollte. Halten wir mit ihm an der Hoffnung fest, daß wir ein noch höheres Ziel vor Augen haben, aber lassen wir von dem Wahn, daß wir es schon etwa gar erreicht hätten oder auf einer anderen Straße erreichen könnten, als die er gebahnt hat. Ist unsere Aussicht und somit Kraft und Wille auch begrenzter, so mögen wir uns damit trösten, daß wir auf dem rechten Wege, „der Wahrheit, die nur eins sein kann“, dahergehen. Max Lenz.
- ↑ Vergl. „Gartenlaube“ 1867, S. 100.
Eine Mägdeherberge in Berlin.
Wie tief beklagenswerth die Lage unserer dienenden Klassen ist, wenn eine temporäre Arbeits- und Verdienstlosigkeit über sie hereinbricht; welche Gefahren namentlich den weiblichen Dienstboten in solcher Lage drohen, ist längst allen denjenigen klar geworden, die sich eingehend und Hilfe spendend mit ihnen beschäftigten. Erschreckende Zahlen und Thatsachen brachten manche, die es ehrlich mit ihrem Vaterlande und seiner Entwickelung meinen, zu ernstem Nachdenken, wie man Diejenigen retten könne, die meist durch eine unselige Verkettung der Verhältnisse auf dem Wege zum Sumpfe des Lasters sich befinden oder in denselben schon hineingerathen waren. Es rührte sich aller Orten. In Berlin entstand zuerst der „Verein zur Rettung und Erziehung minorenner weiblicher Strafentlassenen“, sowie der „Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit“, in dessen Aufruf zur Theilnahme es heißt: „Wenn uns bei unserem Willen die Empfindung trägt, daß es hohe Zeit sei, dem äußerlich so stolz aufgerichteten Baue unseres geeinten Vaterlandes nun auch den köstlichen inneren Schmuck, eine geläuterte Sittlichkeit wieder zu gewinnen, so sind wir überzeugt, daß diese Empfindung überall Widerhall wird finden müssen.“
Wenn dieser Widerhall auch leider nicht so laut war, wie man wohl hätte erwarten dürfen, so hinderte das den Verein nicht, die erste Nummer seines Arbeitsprogramms: „Die Errichtung einer Mägdeherberge“ in Berlin zur Ausführung zu bringen.
„Eine Mägdeherberge?“ hören wir Diejenigen fragen, welche die Berliner Anstalten kennen; „wir besitzen ja in Martha’s Hof und Amalienhaus zwei vorzügliche Herbergen, die mit Dienstmädchenschulen verbunden sind!“
Ja gewiß, die Anstalten verdienen alles Lob und haben lange segensreich gewirkt, aber sie leiden unter einem Fehler: sie liegen zu weit von allen Bahnhöfen entfernt. Ein fremd ankommendes Mädchen muß sich den langen Weg mühsam erfragen; die Meisten wissen ihnen gar keinen Bescheid zu geben. Auf diese Weise sind schon Viele in ganz andere und oft sehr schlimme Hände gerathen, oder durften froh sein, wenn sie nur mit dem Verlust ihrer Sachen davonkamen.
Der Verein beschloß nun, im Centrum der Stadt eine dritte Herberge einzurichten, sobald die Mittel dazu vorhanden sein würden. Aber die schlimme Geldfrage! Sie hat auch dem Vorstande manche sorgenvolle Stunde bereitet. Endlich ergab die vom Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg bewilligte Hauskollekte die nöthige Summe, um mit der Ausführung beginnen zu können. – Nun kam die zweite Zeit der Noth: Wer vom Vorstande hatte die Aufopferung und die Fähigkeit, sich vorläufig ganz dem Unternehmen zu widmen?
Aber auch hier wurde Rath; ein Vorstandsmitglied, der frühere Fabrikbesitzer Reischel, der neben praktischer Erfahrung eine begeisterte Hingabe für die Arbeiten des Vereins besitzt, nahm die Sache nun ganz in die Hand. Nach langem vergeblichen Suchen, eine passende Lokalität zu finden, wurde im Stadtbahnhof „Börse“, im Centrum der Stadt, ein großes, nicht gebrauchtes Wartezimmer nebst den zwei daran stoßenden Stadtbahnbögen gemiethet, welche letztere allerdings ganz für die in Aussicht genommene Herberge eingerichtet werden mußten. – Der große Bogen gab einen hohen geräumigen Schlafsaal, in dem 30 gute, neue Betten aufgestellt wurden. Ein abgetheilter Raum darin bildet das Schlafzimmerchen der Hausmutter. Der kleine Stadtbahnbogen enthält Küche, Waschraum und Gepäckkammer.
Am Tage müssen sich die Mädchen, nachdem sie ihr Bett ordentlich gemacht und sich angezogen haben, im großen Wartezimmer aufhalten, wo ihnen Gelegenheit zu Handarbeiten gegeben ist und wo sie auch immer etwas passende Lektüre finden.
Für das Quartier zahlen die Mädchen pro Tag 25 Pfennig, für Kaffee nebst zwei Brötchen 10 Pfennig, für Mittagessen 15 Pfennig etc.
So gering diese Preise auch gestellt sind, so kommen doch sehr oft Mädchen an, denen nach Zahlung des Eisenbahnfahrgeldes auch nicht ein Pfennig in der Kasse geblieben ist. In solchen Fällen erfüllt das Haus recht eigentlich seine Aufgabe, indem es solchen Hilflosen Wohnung, Nahrung und Schutz gewährt! Selbstverständlich ist ein Stellenvermittelungsbureau damit verbunden, in welchem sich bis jetzt fast auf jedes Mädchen 10 Herrschaften gemeldet haben. Somit findet die Mehrzahl der Passanten leicht einen Dienst und ist im Stande, die erwachsenen Kosten sogleich zu decken.
Welches Bedürfniß eine solche Herberge war, beweist wohl am besten der Zudrang, denn es haben in den ersten dreiviertel Jahren seit der Eröffnung „schon über 1000 Mädchen Quartier und Stellen gefunden“.
Da nun bei den obengenannten Preisen gerade nur die Kosten gedeckt werden, so ist es leicht begreiflich, daß durch die Kömpletirung der ganzen Einrichtung – es müssen nothwendig noch 12 Betten angeschafft werden – der Verein in sehr bedrängten finanziellen Verhältnissen ist, zu deren Erleichterung beizutragen vielleicht irgend ein edler Menschenfreund sich veranlaßt fühlt. Wenn ich aus den vielen Fällen nur zwei herausgreife und dieselben wahrheitsgetreu erzähle, so mag daraus erhellen, was in dem großen Treiben der Hauptstadt vor sich geht und welchen Gefahren ein Unkundiger und Unbemittelter trotz unserer trefflichen Polizei doch immer noch ausgesetzt ist.
Ein polnisches Mädchen, das kaum einige deutsche Worte sprechen kann, kommt vorigen Sommer mit ihrem Bündelchen nach Berlin, um sich einen Dienst zu suchen. Wenige Nickelstücke sind nur noch in ihrer Tasche. So tritt sie aus dem Bahnhof, sich verwundert umschauend. Ein Droschkenkutscher fragt sie, ob sie fahren wolle, und sie nimmt erfreut das vermeintlich gütige Anerbieten des fremden Herrn an und steigt ein. Auf die Frage des Kutschers, wohin sie wolle, antwortete sie: „In Stadt fahren.“ Die Droschke wird also gerade in die Stadt hineingelenkt. Als die Insassin aber auch hier keinen näheren Bestimmungsort angehen kann, wird es dem braven Rosselenker doch etwas unheimlich, er ersucht das Mädchen auszusteigen und seine Tour zu bezahlen. So schnell versteht man sich aber gegenseitig nicht. Während der
Verschiedene: Die Gartenlaube (1885). Leipzig: Ernst Keil, 1885, Seite 232. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1885)_232.jpg&oldid=- (Version vom 14.3.2024)