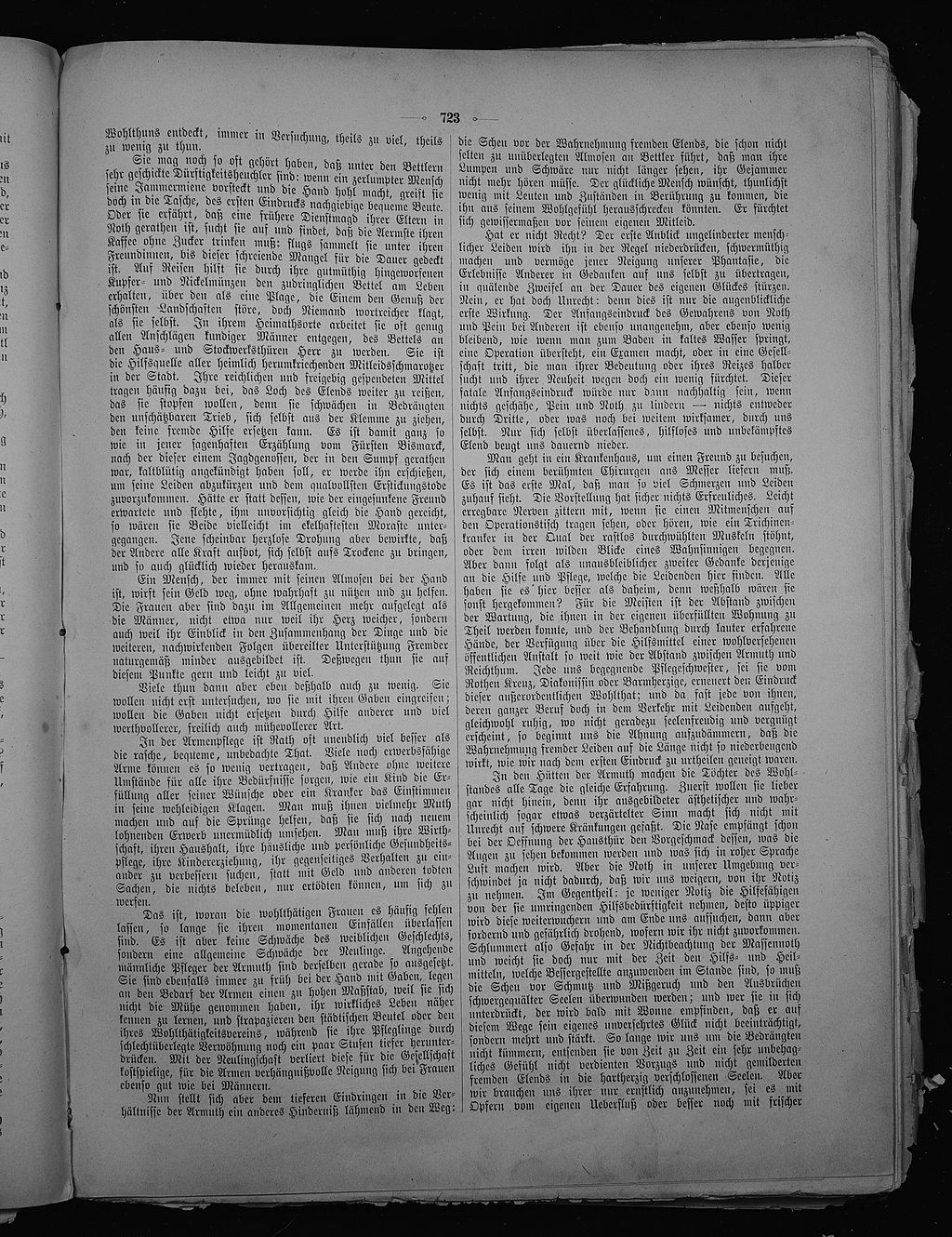| Verschiedene: Die Gartenlaube (1885) | |
|
|
Wohlthuns entdeckt, immer in Versuchung, theils zu viel, theils zu wenig zu thun.
Sie mag noch so oft gehört haben, daß unter den Bettlern sehr geschickte Dürftigkeitsheuchler sind: wenn ein zerlumpter Mensch seine Jammermiene vorsteckt und die Hand hohl macht, greift sie doch in die Tasche, des ersten Eindrucks nachgiebige bequeme Beute. Oder sie erfährt, daß eine frühere Dienstmagd ihrer Eltern in Noth gerathen ist, sucht sie auf und findet, daß die Aermste ihren Kaffee ohne Zucker trinken muß: flugs sammelt sie unter ihren Freundinnen, bis dieser schreiende Mangel für die Dauer gedeckt ist. Auf Reisen hilft sie durch ihre gutmüthig hingeworfenen Kupfer und Nickelmünzen den zudringlichen Bettel am Leben erhalten, über den als eine Plage, die Einem den Genuß der schönsten Landschaften störe, doch Niemand wortreicher klagt, als sie selbst. In ihrem Heimathsorte arbeitet sie oft genug allen Anschlägen kundiger Männer entgegen, des Bettels an den Haus- und Stockwerksthüren Herr zu werden. Sie ist die Hilfsquelle aller heimlich herumkriechenden Mitleidsschmarotzer in der Stadt. Ihre reichlichen und freigebig gespendeten Mittel tragen häufig dazu bei, das Loch des Elends weiter zu reißen, das sie stopfen wollen, denn sie schwächen in Bedrängten den unschätzbaren Trieb, sich selbst aus der Klemme zu ziehen, den keine fremde Hilfe ersetzen kann. Es ist damit ganz so wie in jener sagenhaften Erzählung vom Fürsten Bismarck, nach der dieser einem Jagdgenossen, der in den Sumpf gerathen war, kaltblütig angekündigt haben soll, er werde ihn erschießen, um seine Leiden abzukürzen und dem qualvollsten Erstickungstode zuvorzukommen. Hätte er statt dessen, wie der eingesunkene Freund erwartete und flehte, ihm unvorsichtig gleich die Hand gereicht, so wären sie Beide vielleicht im ekelhaftesten Moraste untergegangen. Jene scheinbar herzlose Drohung aber bewirkte, daß der Andere alle Kraft aufbot, sich selbst aufs Trockene zu bringen, und so auch glücklich wieder herauskam.
Ein Mensch, der immer mit seinen Almosen bei der Hand ist, wirft sein Geld weg, ohne wahrhaft zu nützen und zu helfen. Die Frauen aber sind dazu im Allgemeinen mehr aufgelegt als die Männer, nicht etwa nur weil ihr Herz weicher, sondern auch weil ihr Einblick in den Zusammenhang der Dinge und die weiteren, nachwirkenden Folgen übereilter Unterstützung Fremder naturgemäß minder ausgebildet ist. Deßwegen thun sie auf diesem Punkte gern und leicht zu viel.
Viele thun dann aber eben deßhalb auch zu wenig. Sie wollen nicht erst untersuchen, wo sie mit ihren Gaben eingreifen; wollen die Gaben nicht ersehen durch Hilfe anderer und viel werthvollerer, freilich auch mühevollerer Art.
In der Armenpflege ist Rath oft unendlich viel besser als die rasche, bequeme, unbedachte That. Viele noch erwerbsfähige Arme können es so wenig vertragen, daß Andere ohne weitere Umstände für alle ihre Bedürfnisse sorgen, wie ein Kind die Erfüllung aller seiner Wünsche oder ein Kranker das Einstimmen in seine wehleidigen Klagen. Man muß ihnen vielmehr Muth machen und auf die Sprünge helfen, daß sie sich nach neuem lohnenden Erwerb unermüdlich umsehen. Man muß ihre Wirthschaft, ihren Haushalt, ihre häusliche und persönliche Gesundheitspflege, ihre Kindererziehung, ihr gegenseitiges Verhalten zu einander zu verbessern suchen, statt mit Geld und anderen todten Sachen, die nichts beleben, nur ertödten können, um sich zu werfen.
Das ist, woran die wohlthätigen Frauen es häufig fehlen lassen, so lange sie ihren momentanen Einfällen überlassen sind. Es ist aber keine Schwäche des weiblichen Geschlechts, sondern eine allgemeine Schwäche der Neulinge. Angehende männliche Pfleger der Armuth sind derselben gerade so ausgesetzt. Sie sind ebenfalls immer zu früh bei der Hand mit Gaben, legen an den Bedarf der Armen einen zu hohen Maßstab, weil sie sich nicht die Mühe genommen haben, ihr wirkliches Leben näher kennen zu lernen, und strapazieren den städtischen Beutel oder den ihres Wohlthätigkeitsvereins, während sie ihre Pfleglinge durch schlechtüberlegte Verwöhnung noch ein paar Stufen tiefer herunterdrücken. Mit der Neulingschaft verliert diese für die Gesellschaft kostspielige, für die Armen verhängnißvolle Neigung sich bei Frauen ebenso gut wie bei Männern.
Nun stellt sich aber dem tieferen Eindringen in die Verhältnisse der Armuth ein anderes Hinderniß lähmend in den Weg: die Scheu vor der Wahrnehmung fremden Elends, die schon nicht selten zu unüberlegten Almosen an Bettler führt, daß man ihre Lumpen und Schwäre nur nicht länger sehen, ihr Gejammer nicht mehr hören müsse. Der glückliche Mensch wünscht, thunlichst wenig mit Leuten und Zuständen in Berührung zu kommen, die ihn aus seinem Wohlgefühl herausschrecken könnten. Er fürchtet sich gewissermaßen vor seinem eigenen Mitleid.
Hat er nicht Recht? Der erste Anblick ungelinderter menschlicher Leiden wird ihn in der Regel niederdrücken, schwermüthig machen und vermöge jener Neigung unserer Phantasie, die Erlebnisse Anderer in Gedanken auf uns selbst zu übertragen, in quälende Zweifel an der Dauer des eigenen Glückes stürzen. Nein, er hat doch Unrecht: denn dies ist nur die augenblickliche erste Wirkung. Der Anfangseindruck des Gewahrens von Noth und Pein bei Anderen ist ebenso unangenehm, aber ebenso wenig bleibend, wie wenn man zum Baden in kaltes Wasser springt, eine Operation übersteht, ein Examen macht, oder in eine Gesellschaft tritt, die man ihrer Bedeutung oder ihres Reizes halber sucht und ihrer Neuheit wegen doch ein wenig fürchtet. Dieser fatale Anfangseindruck würde nur dann nachhaltig sein, wenn nichts geschähe, Pein und Noth zu lindern – nichts entweder durch Dritte, oder was noch bei weitem wirksamer, durch uns selbst. Nur sich selbst überlassenes, hilfloses und unbekämpftes Elend beugt uns dauernd nieder.
Man geht in ein Krankenhaus, um einen Freund zu besuchen, der sich einem berühmten Chirurgen ans Messer liefern muß. Es ist das erste Mal, daß man so viel Schmerzen und Leiden zuhauf sieht. Die Vorstellung hat sicher nichts Erfreuliches. Leicht erregbare Nerven zittern mit, wenn sie einen Mitmenschen auf den Operationstisch tragen sehen, oder hören, wie ein Trichinenkranker in der Qual der rastlos durchwühlten Muskeln stöhnt, oder dem irren wilden Blicke eines Wahnsinnigen begegnen. Aber dann folgt als unausbleiblicher zweiter Gedanke derjenige an die Hilfe und Pflege, welche die Leidenden hier finden. Alle haben sie es hier besser als daheim, denn weßhalb wären sie sonst hergekommen? Für die Meisten ist der Abstand zwischen der Wartung, die ihnen in der eigenen überfüllten Wohnung zu Theil werden konnte, und der Behandlung durch lauter erfahrene Hände, der Verfügung über die Hilfsmittel einer wohlversehenen öffentlichen Anstalt so weit wie der Abstand zwischen Armuth und Reichthum. Jede uns begegnende Pflegeschwester, sei sie vom Rothen Kreuz, Diakonissin oder Barmherzige, erneuert den Eindruck dieser außerordentlichen Wohlthat; und da fast jede von ihnen, deren ganzer Beruf doch in dem Verkehr mit Leidenden aufgeht, gleichwohl ruhig, wo nicht geradezu seelenfreudig und vergnügt erscheint, so beginnt uns die Ahnung aufzudämmern, daß die Wahrnehmung fremder Leiden auf die Länge nicht so niederbeugend wirkt, wie wir nach dem ersten Eindruck zu urtheilen geneigt waren.
In den Hütten der Armuth machen die Töchter des Wohlstandes alle Tage die gleiche Erfahrung. Zuerst wollen sie lieber gar nicht hinein, denn ihr ausgebildeter ästhetischer und wahrscheinlich sogar etwas verzärtelter Sinn macht sich nicht mit Unrecht auf schwere Kränkungen gefaßt. Die Nase empfängt schon bei der Deffnung der Hausthür den Vorgeschmack dessen, was die Augen zu sehen bekommen werden und was sich in roher Sprache Luft machen wird. Aber die Noth in unserer Umgebung verschwindet ja nicht dadurch, daß wir uns weigern, von ihr Notiz zu nehmen. Im Gegentheil: je weniger Notiz die Hilfefähigen von der sie umringenden Hilfsbedürftigkeit nehmen, desto üppiger wird diese weiterwuchern und am Ende uns aufsuchen, dann aber fordernd und gefährlich drohend, wofern wir ihr nicht zuvorkommen. Schlummert also Gefahr in der Nichtbeachtung der Massennoth und weicht sie doch nur mit der Zeit den Hilfs- und Heilmitteln, welche Bessergestellte anzuwenden im Stande sind, so muß die Scheu vor Schmutz und Mißgeruch und den Ausbrüchen schwergequälter Seelen überwunden werden; und wer sie in sich unterdrückt, der wird bald mit Wonne empfinden, daß er auf diesem Wege sein eigenes unversehrtes Glück nicht beeinträchtigt, sondern mehrt und stärkt. So lange wir uns um die Bedrängten nicht kümmern, entsenden sie von Zeit zu Zeit ein sehr unbehagliches Gefühl nicht verdienten Vorzugs und nicht gemilderten fremden Elends in die hartherzig verschlossenen Seelen. Aber wir brauchen uns ihrer nur ernstlich anzunehmen, sei es mit Opfern vom eigenen Ueberfluß oder besser noch mit frischer
Verschiedene: Die Gartenlaube (1885). Leipzig: Ernst Keil, 1885, Seite 723. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1885)_723.jpg&oldid=- (Version vom 6.1.2023)