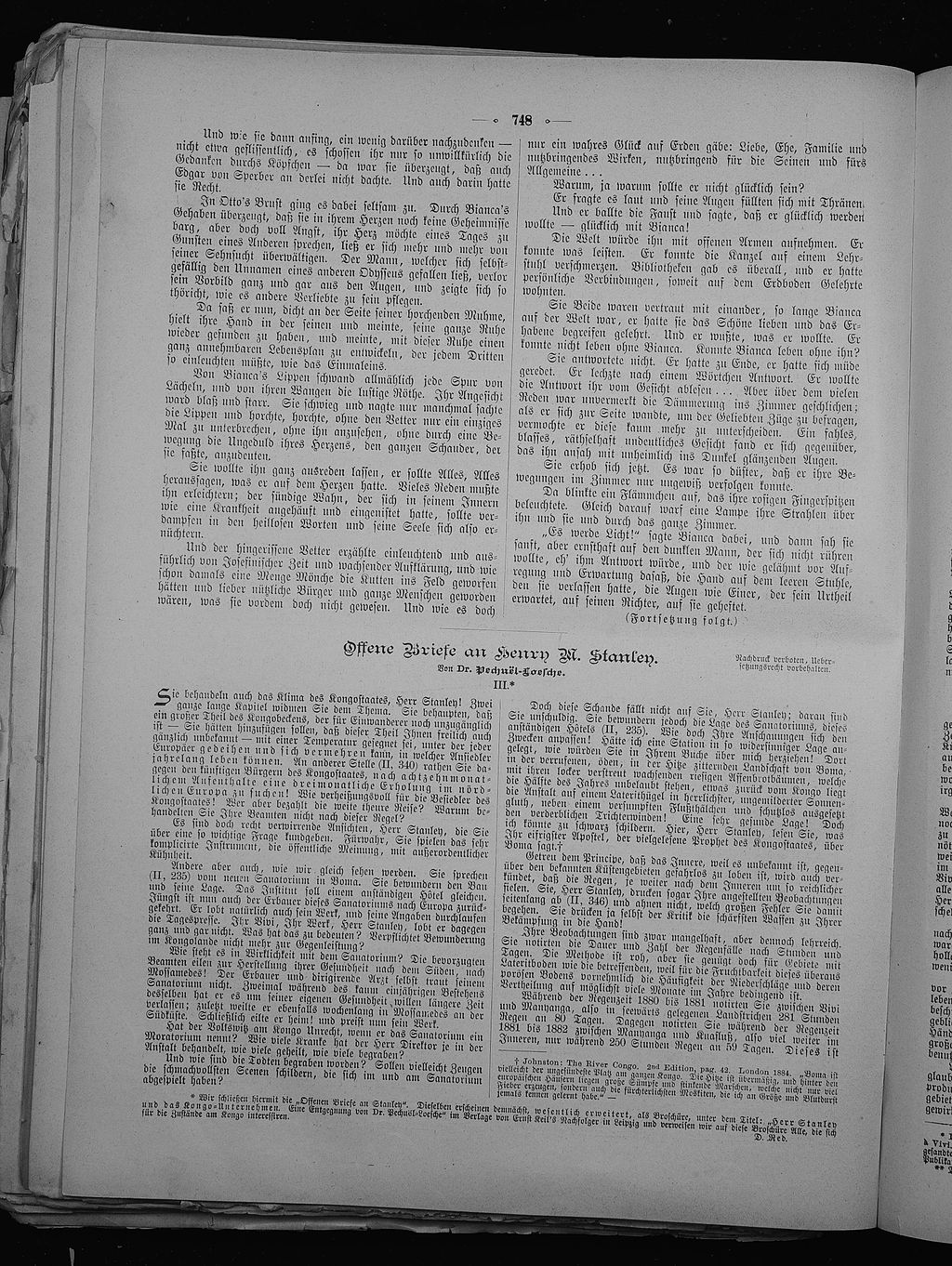| verschiedene: Die Gartenlaube (1885) | |
|
|
Und wie sie dann anfing, ein wenig darüber nachzudenken – nicht etwa geflissentlich, es schössen ihr nur so unwillkürlich die Gedanken durchs Köpfchen – da war sie überzeugt, daß auch Edgar von Sperber an derlei nicht dachte. Und auch darin hatte sie Recht.
In Otto’s Brust ging es dabei seltsam zu. Durch Bianca’s Gehaben überzeugt, daß sie in ihrem Herzen noch keine Geheimnisse barg, aber doch voll Angst, ihr Herz möchte eines Tages zu Gunsten eines Anderen sprechen, ließ er sich mehr und mehr von seiner Sehnsucht überwältigen. Der Mann, welcher sich selbstgefällig den Unnamen eines anderen Odysseus gefallen ließ, verlor sein Vorbild ganz und gar aus den Augen, und zeigte sich so thöricht, wie es andere Verliebte zu sein pflegen.
Da saß er nun, dicht an der Seite seiner horchenden Muhme, hielt ihre Hand in der seinen und meinte, seine ganze Ruhe wieder gefunden zu haben, und meinte, mit dieser Ruhe einen ganz annehmbaren Lebensplan zu entwickeln, der jedem Dritten so einleuchten müßte, wie das Einmaleins.
Von Bianca’s Lippen schwand allmählich jede Spur von Lächeln, und von ihren Wangen die lustige Röthe. Ihr Angesicht ward blaß und starr. Sie schwieg und nagte nur manchmal sachte die Lippen und horchte, horchte, ohne den Vetter nur ein einziges Mal zu unterbrechen, ohne ihn anzusehen, ohne durch eine Bewegung die Ungeduld ihres Herzens, den ganzen Schauder, der sie faßte, anzudeuten.
Sie wollte ihn ganz ausreden lassen, er sollte Alles, Alles heraussagen, was er auf dem Herzen hatte. Vieles Reden mußte ihn erleichtern; der sündige Wahn, der sich in seinem Innern wie eine Krankheit angehäuft und eingenistet hatte, sollte verdampfen in den heillosen Worten und seine Seele sich also ernüchtern.
Und der hingerissene Vetter erzählte einleuchtend und ausführlich von Josefinischer Zeit und wachsender Aufklärung, und wie schon damals eine Menge Mönche die Kutten ins Feld geworfen hätten und lieber nützliche Bürger und ganze Menschen geworden wären, was sie vordem doch nicht gewesen. Und wie es doch nur ein wahres Glück auf Erden gäbe: Liebe, Ehe, Familie und nutzbringendes Wirken, nutzbringend für die Seinen und fürs Allgemeine …
Warum, ja warum sollte er nicht glücklich sein?
Er fragte es laut und seine Augen füllten sich mit Thränen.
Und er ballte die Faust und sagte, daß er glücklich werden wollte – glücklich mit Bianca!
Die Welt würde ihn mit offenen Armen aufnehmen. Er konnte was leisten. Er konnte die Kanzel auf einem Lehrstuhl verschmerzen. Bibliotheken gab es überall, und er hatte persönliche Verbindungen, soweit auf dem Erdboden Gelehrte wohnten.
Sie Beide waren vertraut mit einander, so lange Bianca auf der Welt war, er hatte sie das Schöne lieben und das Erhabene begreifen gelehrt. Und er wußte, was er wollte. Er konnte nicht leben ohne Bianca. Konnte Bianca leben ohne ihn?
Sie antwortete nicht. Er hatte zu Ende, er hatte sich müde geredet. Er lechzte nach einem Wörtchcn Antwort. Er wollte die Antwort ihr vom Gesicht ablesen ... Aber über dem vielen Reden war unvermerkt die Dämmerung ins Zimmer geschlichen; als er sich zur Seite wandte, um der Geliebten Züge zu befragen, vermochte er diese kaum mehr zu unterscheiden. Ein fahles, blasses, räthselhaft undeutliches Gesicht fand er sich gegenüber, das ihn ansah mit unheimlich ins Dunkel glänzenden Augen.
Sie erhob sich jetzt. Es war so düster, daß er ihre Bewegungen im Zimmer nur ungewiß verfolgen konnte.
Da blinkte ein Flämmchen auf, das ihre rosigen Fingerspitzen beleuchtete. Gleich darauf warf eine Lampe ihre Strahlen über ihn und sie und durch das ganze Zimmer.
„Es werde Licht!“ sagte Bianca dabei, und dann sah sie sanft, aber ernsthaft auf den dunklen Mann, der sich nicht rühren wollte, eh’ ihm Antwort würde, und der wie gelähmt vor Aufregung und Erwartung dasaß, die Hand auf dem leeren Stuhle, den sie verlassen hatte, die Augen wie Einer, der sein Urtheil erwartet, auf seinen Richter, auf sie geheftet.
Offene Briefe an Henry M. Stanley.
Sie behandeln auch das Klima des Kongostaates, Herr Stanley! Zwei ganze lange Kapitel widmen Sie dem Thema. Sie behaupten, daß ein großer Theil des Kongobeckens, der für Einwanderer noch unzugänglich ist – Sie hätten hinzufügen sollen, daß dieser Theil Ihnen freilich auch gänzlich unbekannt – mit einer Temperatur gesegnet sei, unter der jeder Europäer gedeihen und sich vermehren kann, in welcher Ansiedler jahrelang leben können. An anderer Stelle (II, 340) rathen Sie dagegen den künftigen Bürgern des Kongostaates, nach achtzehnmonatlichem Aufenthalte eine dreimonatliche Erholung im nördlichen Europa zu suchen! Wie verheißungsvoll für die Besiedler des Kongostaates! Wer aber bezahlt die weite theure Reise? Warum behandelten Sie Ihre Beamten nicht nach dieser Regel?
Es sind doch recht verwirrende Ansichten, Herr Stanley, die Sie über eine so wichtige Frage kundgeben. Fürwahr, Sie spielen das sehr komplicirte Instrument, die öffentliche Meinung, mit außerordentlicher Kühnheit.
Andere aber auch, wie wir gleich sehen werden. Sie sprechen (II, 235) vom neuen Sanatorium in Boma. Sie bewundern den Bau und seine Lage. Das Institut soll einem anständigen Hôtel gleichen. Jüngst ist nun auch der Erbauer dieses Sanatoriums nach Europa zurückgekehrt. Er lobt natürlich auch sein Werk, und seine Angaben durchlaufen die Tagespresse. Ihr Vivi, Ihr Werk, Herr Stanley, lobt er dagegen ganz und gar nicht. Was hat das zu bedeuten? Verpflichtet Bewunderung im Kongolande nicht mehr zur Gegenleistung?
Wie steht es in Wirklichkeit mit dem Sanatorium? Die bevorzugten Beamten eilen zur Herstellung ihrer Gesundheit nach dem Süden, nach Mossamedes! Der Erbauer und dirigirende Arzt selbst traut seinem Sanatorium nicht. Zweimal während des kanm einjährigen Bestehens desselben hat er es um seiner eigenen Gesundheit willen längere Zeit verlassen; zuletzt weilte er ebenfalls wochenlang in Mossamedes an der Südküste. Schließlich eilte er heim! und preist nun sein Werk.
Hat der Volkswitz am Kongo Unrecht, wenn er das Sanatorium ein Moratorium nennt? Wie viele Kranke hat der Herr Direktor je in der Anstalt behandelt, wie viele geheilt, wie viele begraben?
Und wie sind die Todten begraben worden? Sollen vielleicht Zeugen die schmachvollsten Scenen schildern, die sich im und am Sanatorium abgespielt haben?
Doch diese Schande fällt nicht auf Sie, Herr Stanley; daran sind Sie unschuldig. Sie bewundern jedoch die Lage des Sanatoriums, dieses anständigen Hôtels (II, 235). Wie doch Ihre Anschauungen sich den Zwecken anpassen! Hätte ich eine Station in so widersinniger Lage angelegt, wie würden Sie in Ihrem Buche über mich herziehen! Dort in der verrufenen, öden, in der Hitze zitternden Landschaft von Boma, mit ihren locker verstreut wachsenden riesigen Affenbrotbäumen, welche die Hälfte des Jahres unbelaubt stehen, etwas zurück vom Kongo liegt die Anstalt auf einem Laterithügel in herrlichster, ungemilderter Sonnengluth, neben einem versumpften Flußthälchen und schutzlos ausgesetzt den verderblichen Trichterwinden! Eine sehr gesunde Lage! Doch ich könnte zu schwarz schildern. Hier, Herr Stanley, lesen Sie, was Ihr eifrigster Apostel, der vielgelesene Prophet des Kongostaates, über Boma sagt.[2]
Getreu dem Principe, daß das Innere, weil es unbekannt ist, gegenüber den bekannten Küstengebieten gefahrlos zu loben ist, wird auch verkündet, daß die Regen, je weiter nach dem Inneren um so reichlicher fielen. Sie, Herr Stanley, drucken sogar Ihre angestellten Beobachtungen seitenlang ab (II, 346) und ahnen nicht, welch großen Fehler Sie damit begehen. Sie drücken ja selbst der Kritik die schärfsten Waffen zu Ihrer Bekämpfung in die Hand!
Ihre Beobachtungen sind zwar mangelhaft, aber dennoch lehrreich. Sie notirten die Dauer und Zahl der Regenfälle nach Stunden und Tagen. Die Methode ist roh, aber sie genügt doch für Gebiete mit Lateritboden wie die betreffenden, weil für die Fruchtbarkeit dieses überaus porösen Bodens vornehmlich die Häufigkeit der Niederschläge und deren Vertheilung auf möglichst viele Monate im Jahre bedingend ist.
Während der Regenzeit 1880 bis 1881 notirten Sie zwischen Vivi und Manyanga, also in seewärts gelegenen Landstrichen 281 Stunden Regen an 80 Tagen. Dagegen notirten Sie während der Regenzeit 1881 bis 1882 zwischen Manyanga und Kuafluß, also viel weiter im Inneren, nur während 250 Stunden Regen an 59 Tagen. Dieses ist
verschiedene: Die Gartenlaube (1885). Ernst Keil's Nachfolger, Leipzig 1885, Seite 748. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1885)_748.jpg&oldid=- (Version vom 30.3.2024)
- ↑ Wir schließen hiermit die „Offenen Briefe an Stanley“. Dieselben erscheinen demnächst, wesentlich erweitert, als Broschüre, unter dem Titel: „Herr Stanley und das Kongo-Unternehmen. Eine Entgegnung von Dr. Pechuël-Loesche“ im Verlage von Ernst Keil’s Nachfolger in Leipzig und verweisen wir auf diese Broschüre Alle, die sich für die Zustände am Kongo interessiren. Die Red.
- ↑ Johnston: The River Congo. 2nd Edition, pag. 42. London 1884. „Boma ist vielleicht der ungesündeste Platz am ganzen Kongo. Die Hitze ist übermäßig, und hinter den europäischen Häusern liegen große Sümpfe und stinkende Marschen, welche nicht nur viel Fieber erzeugen, sondern auch die fürchterlichsten Moskiten, die ich an Größe und Blutdurst jemals kennen gelernt habe.“ –