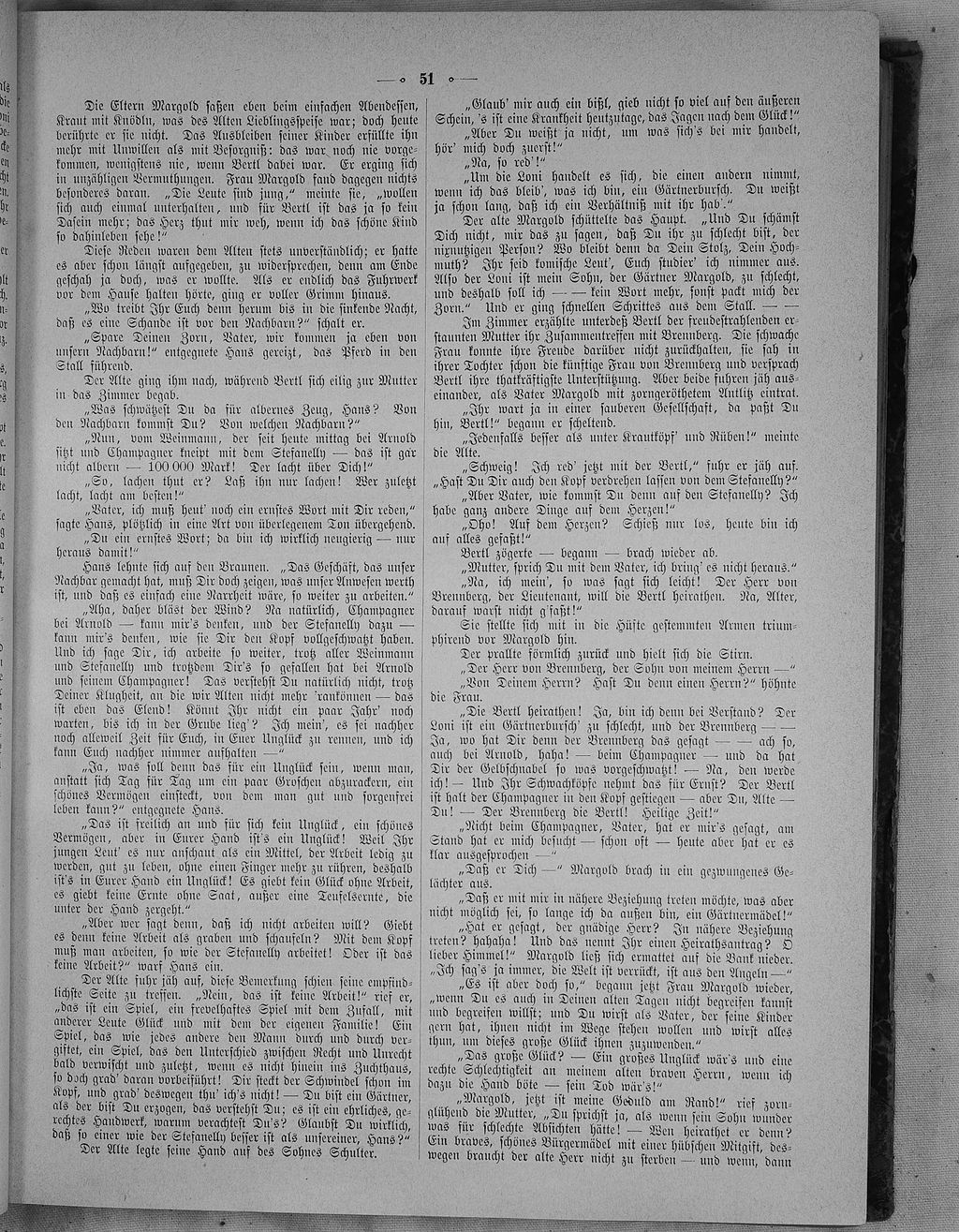| verschiedene: Die Gartenlaube (1891) | |
|
|
Die Eltern Margold saßen eben beim einfachen Abendessen, Kraut mit Knödln, was des Alten Lieblingsspeise war; doch heute berührte er sie nicht. Das Ausbleiben seiner Kinder erfüllte ihn mehr mit Unwillen als mit Besorgniß: das war noch nie vorgekommen, wenigstens nie, wenn Bertl dabei war. Er erging sich in unzähligen Vermuthungen. Frau Margold fand dagegen nichts besonderes daran. „Die Leute sind jung,“ meinte sie, „wollen sich auch einmal unterhalten, und für Bertl ist das ja so kein Dasein mehr; das Herz thut mir weh, wenn ich das schöne Kind so dahinleben sehe!“
Diese Reden waren dem Alten stets unverständlich; er hatte es aber schon längst aufgegeben, zu widersprechen, denn am Ende geschah ja doch, was er wollte. Als er endlich das Fuhrwerk vor dem Hause halten hörte, ging er voller Grimm hinaus.
„Wo treibt Ihr Euch denn herum bis in die sinkende Nacht, daß es eine Schande ist vor den Nachbarn?“ schalt er.
„Spare Deinen Zorn, Vater, wir kommen ja eben von unsern Nachbarn!“ entgegnete Hans gereizt, das Pferd in den Stall führend.
Der Alte ging ihm nach, während Bertl sich eilig zur Mutter in das Zimmer begab.
„Was schwätzest Du da für albernes Zeug, Hans? Von den Nachbarn kommst Du? Von welchen Nachbarn?“
„Nun, vom Weinmann, der seit heute mittag bei Arnold sitzt und Champagner kneipt mit dem Stefanelly – das ist gar nicht albern – 100000 Mark! Der lacht über Dich!“
„So, lachen thut er? Laß ihn nur lachen! Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“
„Vater, ich muß heut’ noch ein ernstes Wort mit Dir reden,“ sagte Hans, plötzlich in eine Art von überlegenem Ton übergehend.
„Du ein ernstes Wort; da bin ich wirklich neugierig – nur heraus damit!“
Hans lehnte sich auf den Braunen. „Das Geschäft, das unser Nachbar gemacht hat, muß Dir doch zeigen, was unser Anwesen werth ist, und daß es einfach eine Narrheit wäre, so weiter zu arbeiten.“
„Aha, daher bläst der Wind? Na natürlich, Champagner bei Arnold – kann mir’s denken, und der Stefanelly dazu – kann mir’s denken, wie sie Dir den Kopf vollgeschwatzt haben. Und ich sage Dir, ich arbeite so weiter, trotz aller Weinmann und Stefanelly und trotzdem Dir’s so gefallen hat bei Arnold und seinem Champagner! Das verstehst Du natürlich nicht, trotz Deiner Klugheit, an die wir Alten nicht mehr ’rankönnen – das ist eben das Elend! Könnt Ihr nicht ein paar Jahr’ noch warten, bis ich in der Grube lieg’? Ich mein, es sei nachher noch alleweil Zeit für Euch, in Euer Unglück zu rennen, und ich kann Euch nachher nimmer aufhalten –“
„Ja, was soll denn das für ein Unglück sein, wenn man, anstatt sich Tag für Tag um ein paar Groschen abzurackern, ein schönes Vermögen einsteckt, von dem man gut und sorgenfrei leben kann?“ entgegnete Hans.
„Das ist freilich an und für sich kein Unglück, ein schönes Vermögen, aber in Eurer Hand ist’s ein Unglück! Weil Ihr jungen Leut’ es nur anschaut als ein Mittel, der Arbeit ledig zu werden, gut zu leben, ohne einen Finger mehr zu rühren, deshalb ist’s in Eurer Hand ein Unglück! Es giebt kein Glück ohne Arbeit, es giebt keine Ernte ohne Saat, außer eine Teufelsernte, die unter der Hand zergeht.“
„Aber wer sagt denn, daß ich nicht arbeiten will? Giebt es denn keine Arbeit als graben und schaufeln? Mit dem Kopf muß man arbeiten, so wie der Stefanelly arbeitet! Oder ist das keine Arbeit?“ warf Hans ein.
Der Alte fuhr jäh auf, diese Bemerkung schien seine empfindlichste Seite zu treffen. „Nein, das ist keine Arbeit!“ rief er, „das ist ein Spiel, ein frevelhaftes Spiel mit dem Zufall, mit anderer Leute Glück und mit dem der eigenen Familie! Ein Spiel, das wie jedes andere den Mann durch und durch vergiftet, ein Spiel, das den Unterschied zwischen Recht und Unrecht bald verwischt und zuletzt, wenn es nicht hinein ins Zuchthaus, so doch grad daran vorbeiführt! Dir steckt der Schwindel schon im Kopf, und grad deswegen thu’ ich’s nicht! – Du bist ein Gärtner, als der bist Du erzogen, das verstehst Du; es ist ein ehrliches, gerechtes Handwerk, warum verachtest Du’s? Glaubst Du wirklich, daß so einer wie der Stefanelly besser ist als unsereiner, Hans?“
Der Alte legte seine Hand auf des Sohnes Schulter.
„Glaub’ mir auch ein bißl, gieb nicht so viel auf den äußeren Schein, ’s ist eine Krankheit heutzutage, das Jagen nach dem Glück!“
„Aber Du weißt ja nicht, um was sich’s bei mir handelt, hör’ mich doch zuerst!“
„Na, so red’!“
„Um die Loni handelt es sich, die einen andern nimmt, wenn ich das bleibe, was ich bin, ein Gärtnerbursch. Du weißt ja schon lang, daß ich ein Verhältniß mit ihr hab’.“
Der alte Margold schüttelte das Haupt. „Und Du schämst Dich nicht, mir das zu sagen, daß Du ihr zu schlecht bist, der nixnutzigen Person? Wo bleibt denn da Dein Stolz, Dein Hochmuth? Ihr seid komische Leut’, Euch studier’ ich nimmer aus. Also der Loni ist mein Sohn, der Gärtner Margold, zu schlecht, und deshalb soll ich – – kein Wort mehr, sonst packt mich der Zorn.“ Und er ging schnellen Schrittes aus dem Stall. – –
Im Zimmer erzählte unterdeß Bertl der freudestrahlenden erstaunten Mutter ihr Zusammentreffen mit Brennberg. Die schwache Frau konnte ihre Freude darüber nicht zurückhalten, sie sah in ihrer Tochter schon die künftige Frau von Brennberg und versprach Bertl ihre thatkräftigste Unterstützung. Aber beide fuhren jäh aus einander, als Vater Margold mit zorngeröthetem Antlitz eintrat.
„Ihr wart ja in einer sauberen Gesellschaft, da paßt Du hin, Bertl!“ begann er scheltend.
„Jedenfalls besser als unter Krautköpf’ und Rüben!“ meinte die Alte.
„Schweig! Ich red’ jetzt mit der Bertl,“ fuhr er jäh auf. „Hast Du Dir auch den Kopf verdrehen lassen von dem Stefanelly?“
„Aber Vater, wie kommst Du denn auf den Stefanelly? Ich habe ganz andere Dinge auf dem Herzen!“
„Oho! Auf dem Herzen? Schieß nur los, heute bin ich auf alles gefaßt!“
Bertl zögerte – begann – brach wieder ab.
„Mutter, sprich Du mit dem Vater, ich bringe es nicht heraus.“
„Na, ich mein, so was sagt sich leicht! Der Herr von Brennberg, der Lieutenant, will die Bertl heirathen. Na, Alter, darauf warst nicht g’faßt!“
Sie stellte sich mit in die Hüfte gestemmten Armen triumphirend vor Margold hin.
Der prallte förmlich zurück und hielt sich die Stirn.
„Der Herr von Brennberg, der Sohn von meinem Herrn -“
„Von Deinem Herrn? Hast Du denn einen Herrn?“ höhnte die Frau.
„Die Bertl heirathen! Ja, bin ich denn bei Verstand? Der Loni ist ein Gärtnerbursch zu schlecht, und der Brennberg – – Ja, wo hat Dir denn der Brennberg das gesagt – – ach so, auch bei Arnold, haha! – beim Champagner – und da hat Dir der Gelbschnabel so was vorgeschwatzt! – Na, den werde ich! – Und Ihr Schwachköpfe nehmt das für Ernst? Der Bertl ist halt der Champagner in den Kopf gestiegen – aber Du, Alte – Du! – Der Brennberg die Bertl! Heilige Zeit!“
„Nicht beim Champagner, Vater, hat er mir’s gesagt, am Stand hat er mich besucht – schon oft – heute aber hat er es klar ausgesprochen –“
„Daß er Dich –“ Margold brach in ein gezwungenes Gelächter aus.
„Daß er mit mir in nähere Beziehung treten möchte, was aber nicht möglich sei, so lange ich da außen bin, ein Gärtnermädel!“
„Hat er gesagt, der gnädige Herr? In nähere Beziehung treten? hahaha! Und das nennt Ihr einen Heirathsantrag? O lieber Himmel!“ Margold ließ sich ermattet auf die Bank nieder. „Ich sag’s ja immer, die Welt ist verrückt, ist aus den Angeln –“
„Es ist aber doch so,“ begann jetzt Frau Margold wieder, „wenn Du es auch in Deinen alten Tagen nicht begreifen kannst und begreifen willst; und Du wirst als Vater, der seine Kinder gern hat, ihnen nicht im Wege stehen wollen und wirst alles thun, um dieses große Glück ihnen zuzuwenden.“
„Das große Glück? – Ein großes Unglück wär’s und eine rechte Schlechtigkeit an meinem alten braven Herrn, wenn ich dazu die Hand böte – sein Tod wär’s!“
„Margold, jetzt ist meine Geduld am Rand!“ rief zornglühend die Mutter, „Du sprichst ja, als wenn sein Sohn wunder was für schlechte Absichten hätte! – Wen heirathet er denn? Ein braves, schönes Bürgermädel mit einer hübschen Mitgift, deswegen braucht der alte Herr nicht zu sterben – und wenn, dann
verschiedene: Die Gartenlaube (1891). Leipzig: Ernst Keil's Nachfolger, 1891, Seite 51. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1891)_051.jpg&oldid=- (Version vom 15.9.2022)