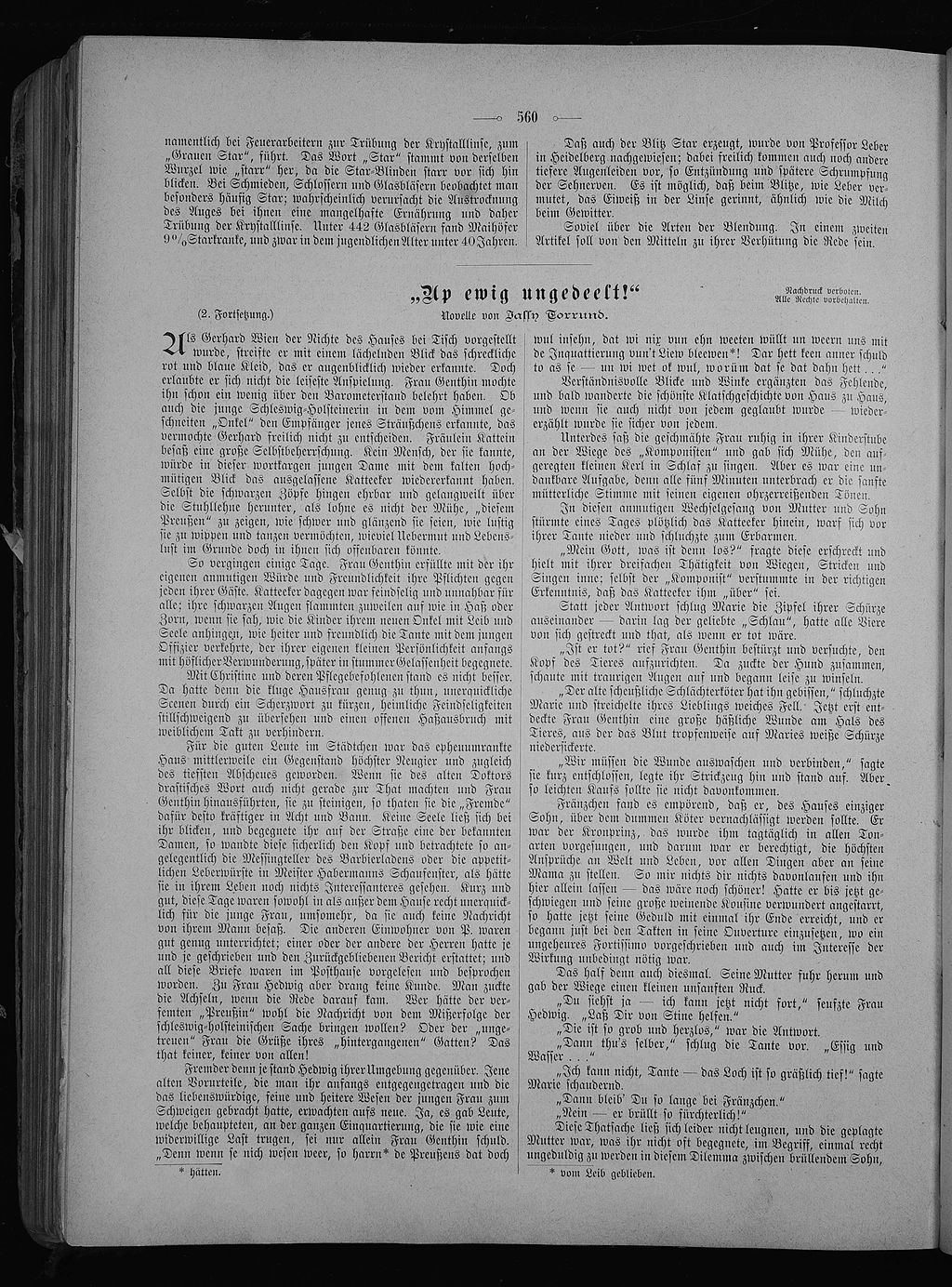| Verschiedene: Die Gartenlaube (1894) | |
|
|
namentlich bei Feuerarbeitern zur Trübung der Krystalllinse, zum „Grauen Star“, führt. Das Wort „Star“ stammt von derselben Wurzel wie „starr“ her, da die Star-Blinden starr vor sich hin blicken. Bei Schmieden, Schlossern und Glasbläsern beonachtet man besonders häufig Star; wahrscheinlich verursacht die Austrocknung des Auges bei ihnen eine mangelhafte Ernährung und daher Trübung der Krystalllinse. Unter 442 Glasbläsern fand Maihöfer 9% Starkranke, und zwar in dem jugendlichen Alter unter 40 Jahren.
Daß auch der Blitz Star erzeugt, wurde von Professor Leber in Heidelberg machgewiesen; dabei freilich kommen auch noch andere tiefere Augenleiden vor, so Entzündung und spätere Schrumpfung der Sehnerven. Es ist möglich, daß beim Blitze, wie Leber vermutet, das Eiweiß in der Linse gerinnt, ähnlich wie die Milch beim Gewitter.
Soviel über die Arten der Blendung. In einem zweiten Artikel soll von den Mitteln zu ihrer Verhütung die Rede sein.
„Up ewig ungedeelt!“
(2. Fortsetzung.)
Als Gerhard Wien der Nichte des Hauses bei Tisch vorgestellt wurde, streifte er mit einem lächelnden Blick das schreckliche rot und blaue Kleid, das er augenblicklich wieder erkannte. Doch erlaubte er sich nicht die leiseste Anspielung. Frau Genthin mochte ihn schon ein wenig über den Barometerstand belehrt haben. Ob auch die junge Schleswig-Holsteinerin in dem vom Himmel geschneiten „Onkel“ den Empfänger jenes Sträußchens erkannte, das vermochte Gerhard freilich nicht zu entscheiden. Fräulein Kattein besaß eine große Selbstbeherrschung. Kein Mensch, der sie kannte, würde in dieser wortkargen jungen Dame mit dem kalten hochmütigen Blick das ausgelassene Katteeker wiedererkannt haben. Selbst die schwarzen Zöpfe hingen ehrbar und gelangweilt über die Stuhllehne herunter, als lohne es nicht der Mühe, „diesem Preußen“ zu zeigen, wie schwer und glänzend sie seien, wie lustig sie zu wippen und tanzen vermochten, wieviel Uebermut und Lebenslust im Grunde doch in ihnen sich offenbaren könnte.
So vergingen einige Tage. Frau Genthin erfüllte mit der ihr eigenen anmutigen Würde und Freundlichkeit ihre Pflichten gegen jeden ihrer Gäste. Katteeker dagegen war feindselig und unnahbar für alle, ihre schwarzen Augen flammten zuweilen auf wie in Haß oder Zorn, wenn sie sah, wie die Kinder ihrem neuen Onkel mit Leib und Seele anhingen, wie heiter und freundlich die Tante mit dem jungen Offizier verkehrte, der ihrer eigenen kleinen Persönlichkeit anfangs mit höflicher Verwunderung, später in stummer Gelassenheit begegnete.
Mit Christine und deren Pflegebefohlenen stand es nicht besser. Da hatte denn die kluge Hausfrau genug zu thun, unerquickliche Scenen durch ein Scherzwort zu kürzen, heimliche Feindseligkeiten stillschweigend zu übersehen und einen offenen Haßausbruch mit weiblichem Takt zu verhindern.
Für die guten Leute im Städtchen war das epheuumrankte Haus mittlerweile ein Gegenstand höchster Neugier und zugleich des tiefsten Abscheues geworden. Wenn sie des alten Doktors drastisches Wort auch nicht gerade zur That machten und Frau Genthin hinausführten, sie zu steinigen, so thaten sie die „Fremde“ dafür desto kräftiger in Acht und Bann. Keine Seele ließ sich bei ihr blicken, und begegnete ihr auf der Straße eine der bekannten Damen, so wandte diese sicherlich den Kopf und betrachtete so angelegentlich die Messingteller des Barbierladens oder die appetitlichen Leberwürste in Meister Habermanns Schaufenster, als hätte sie in ihrem Leben noch nichts Interessanteres gesehen. Kurz und gut, diese Tage waren sowohl in als außer dem Hause recht unerquicklich für die junge Frau, umsomehr, da sie auch keine Nachricht von ihrem Mann besaß. Die anderen Einwohner von P. waren gut genug unterrichtet; einer oder der andere der Herren hatte je und je geschrieben und den Zurückgebliebenen Bericht erstattet; und all diese Briefe waren im Posthause vorgelesen und besprochen worden. Zu Frau Hedwig aber drang keine Kunde. Man zuckte die Achseln, wenn die Rede darauf kam. Wer hätte der verfemten „Preußin“ wohl die Nachricht von dem Mißerfolge der schleswig-holsteinischen Sache bringen wollen? Oder der „ungetreuen“ Frau die Grüße ihres „hintergangenen“ Gatten? Das that keiner, keiner von allen!
Fremder denn je stand Hedwig ihrer Umgebung gegenüber. Jene alten Vorurteile, die man ihr anfangs entgegengetragen und die das liebenswürdige, feine und heitere Wesen der jungen Frau zum Schweigen gebracht hatte, erwachten aufs neue. Ja, es gab Leute, welche behaupteten, an der ganzen Einquartierung, die sie wie eine widerwillige Last trugen, sei nur allein Frau Genthin schuld. „Denn wenn se nich wesen weer, so harrn[1] de Preußens dat doch wul insehn, dat wi nix vun ehn weeten wüllt un weern uns mit de Inquattierung vun’t Liew bleewen[2]! Dar hett keen anner schuld to as se – un wi wet ok wul, worüm dat se dat dahn hett ...“
Verständnisvolle Blicke und Winke ergänzten das Fehlende, und bald wanderte die schönste Klatschgeschichte von Haus zu Haus, und wenn sie auch nicht von jedem geglaubt wurde – wiedererzählt wurde sie sicher von jedem.
Unterdes saß die geschmähte Frau ruhig in ihrer Kinderstube an der Wiege des „Komponisten“ und gab sich Mühe, den aufgeregten kleinen Kerl in Schlaf zu singen. Aber es war eine undankbare Aufgabe, denn alle fünf Minuten unterbrach er die sanfte mütterliche Stimme mit seinen eigenen ohrzerreißenden Tönen.
In diesen anmutigen Wechselgesang von Mutter und Sohn stürmte eines Tages plötzlich das Katteeker hinein, warf sich vor ihrer Tante nieder und schluchzte zum Erbarmen.
„Mein Gott, was ist denn los?“ fragte diese erschreckt und hielt mit ihrer dreifachen Thätigkeit von Wiegen, Stricken und Singen inne, selbst der „Komponist“ verstummte in der richtigen Erkenntnis, daß das Katteeker ihm „über“ sei.
Statt jeder Antwort schlug Marie die Zipfel ihrer Schürze auseinander – darin lag der geliebte „Schlau“, hatte alle Viere von sich gestreckt und that, als wenn er tot wäre.
„Ist er tot?“ rief Frau Genthin bestürzt und versuchte, den Kopf des Tieres aufzurichten. Da zuckte der Hund zusammen, schaute mit traurigen Augen auf und begann leise zu winseln.
„Der alte scheußliche Schlächterköter hat ihn gebissen,“ schluchzte Marie und streichelte ihres Lieblings weiches Fell. Jetzt erst entdeckte Frau Genthin eine große häßliche Wunde am Hals des Tieres, aus der das Blut tropfenweise auf Maries weiße Schürze niedersickerte.
„Wir müssen die Wunde auswaschen und verbinden,“ sagte sie kurz entschlossen, legte ihr Strickzeug hin und stand auf. Aber so leichten Kaufs sollte sie nicht davonkommen.
Fränzchen fand es empörend, daß er, des Hauses einziger Sohn, über dem dummen Köter vernachlässigt werden sollte. Er war der Kronprinz, das wurde ihm tagtäglich in allen Tonarten vorgesungen, und darum war er berechtigt, die höchsten Ansprüche an Welt und Leben, vor allen Dingen aber an seine Mama zu stellen. So mir nichts dir nichts davonlaufen und ihn hier allein lassen – das wäre noch schöner! Hatte er bis jetzt geschwiegen und seine große weinende Kousine verwundert angestarrt, so hatte jetzt seine Geduld mit einmal ihr Ende erreicht, und er begann just bei den Takten in seine Ouverture einzusetzen, wo ein ungeheures Fortissimo vorgeschrieben und auch im Interesse der Wirkung unbedingt nötig war.
Das half denn auch diesmal. Seine Mutter fuhr herum und gab der Wiege einen kleinen unsanften Ruck.
„Du siehst ja – ich kann jetzt nicht fort,“ seufzte Frau Hedwig. „Laß Dir von Stine helfen.“
„Die ist so grob und herzlos,“ war die Antwort.
„Dann thu’s selber,“ schlug die Tante vor. „Essig und Wasser . . .“
„Ich kann nicht, Tante – das Loch ist so gräßlich tief!“ sagte Marie schaudernd.
„Dann bleib’ Du so lange bei Fränzchen.“
„Nein – er brüllt so fürchterlich!“
Diese Thatsache ließ sich leider nicht leugnen, und die geplagte Mutter war, was ihr nicht oft begegnete, im Begriff, einmal recht ungeduldig zu werden in diesem Dilemma zwischen brüllendem Sohn,
Verschiedene: Die Gartenlaube (1894). Leipzig: Ernst Keil, 1894, Seite 560. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1894)_560.jpg&oldid=- (Version vom 17.10.2022)