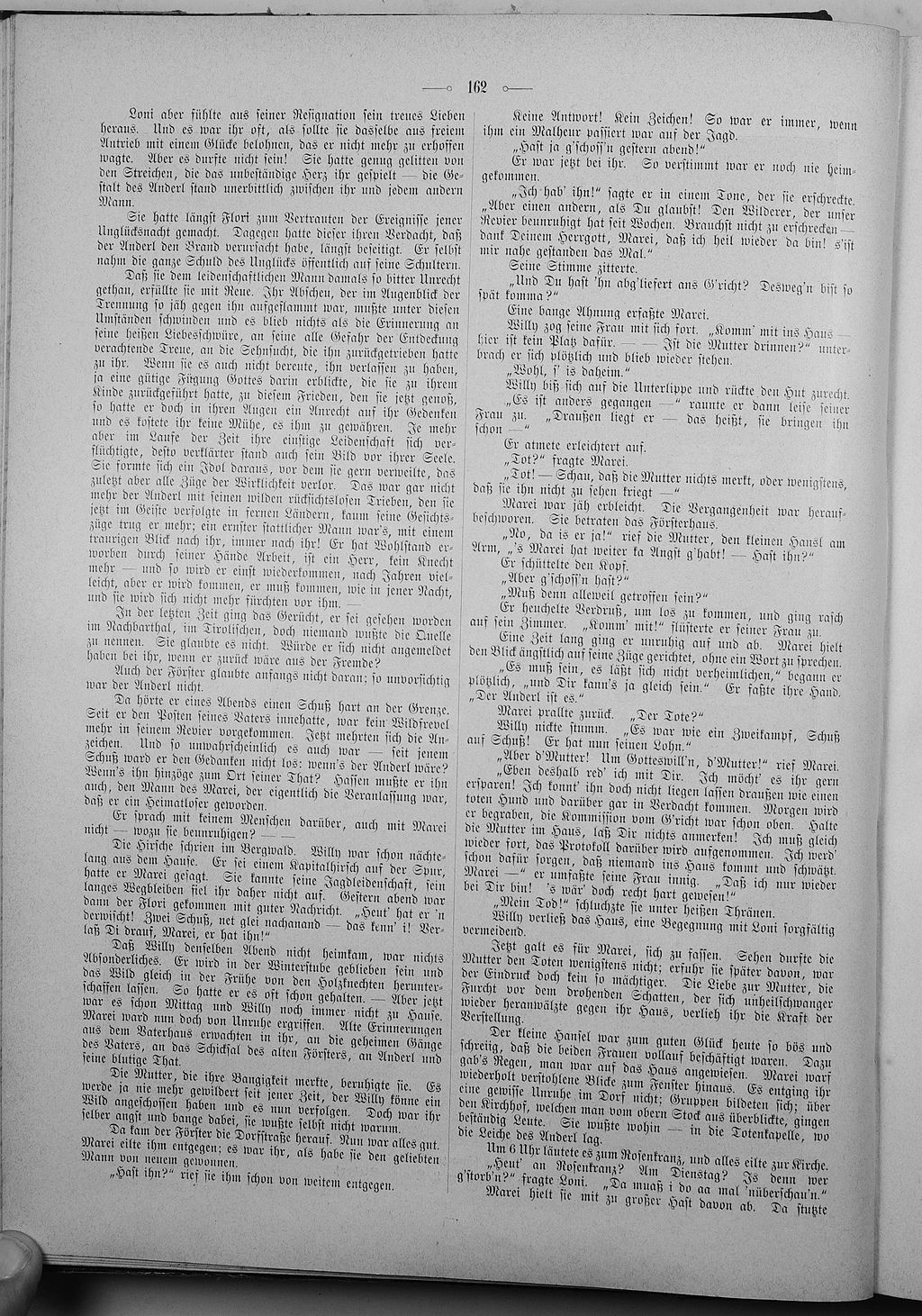| Verschiedene: Die Gartenlaube (1895) | |
|
|
Loni aber fühlte aus seiner Resignation sein treues Lieben heraus. Und es war ihr oft, als sollte sie dasselbe aus freien Antrieb mit einem Glücke belohnen, das er nicht mehr zu erhoffen wagte. Aber es durfte nicht sein! Sie hatte genug gelitten von den Streichen, die das unbeständige Herz ihr gespielt – die Gestalt des Anderl stand unerbittlich zwischen ihr und jedem andern Mann.
Sie hatte längst Flori zum Vertrauten der Ereignisse jener Unglücksnacht gemacht. Dagegen hatte dieser ihren Verdacht, daß der Anderl den Brand verursacht habe, längst beseitigt. Er selbst nahm die ganze Schuld des Unglücks öffentlich auf seine Schultern.
Daß sie dem leidenschaftlichen Mann damals so bitter Unrecht gethan, erfüllte sie mit Reue. Ihr Abscheu, der im Augenblick der Trennung so jäh gegen ihn aufgeflammt war, mußte unter diesen Umständen schwinden und es blieb nichts als die Erinnerung an seine heißen Liebesschwüre, an seine alle Gefahr der Entdeckung verachtende Treue, an die Sehnsucht, die ihn zurückgetrieben hatte zu ihr. Wenn sie es auch nicht bereute, ihn verlassen zu haben, ja eine gütige Fügung Gottes darin erblickte, die sie zu ihrem Kinde zurückgeführt hatte, zu diesem Frieden, den sie jetzt genoß, so hatte er doch in ihren Augen ein Anrecht auf ihr Gedenken und es kostete ihr keine Mühe, es ihm zu gewähren. Je mehr aber im Laufe der Zeit ihre einstige Leidenschaft sich verflüchtigte, desto verklärter stand auch sein Bild vor ihrer Seele. Sie formte sich ein Idol daraus, vor dem sie gern verweilte, das zuletzt aber alle Züge der Wirklichkeit verlor. Das war gar nicht mehr der Anderl mit seinen wilden rücksichtslosen Trieben, den sie jetzt im Geiste verfolgte in fernen Ländern, kaum seine Gesichtszüge trug er mehr; ein ernster stattlicher Mann war’s, mit einem traurigen Blick nach ihr, immer nach ihr! Er hat Wohlstand erworben durch seiner Hände Arbeit, ist ein Herr, kein Knecht mehr – und so wird er einst wiederkommen, nach Jahren vielleicht, aber er wird kommen, er muß kommen, wie in jener Nacht, und sie wird sich nicht mehr fürchten vor ihm. –
In der letzten Zeit ging das Gerücht, er sei gesehen worden im Nachbarthal, im Tirolischen, doch niemand wußte die Quelle zu nennen. Sie glaubte es nicht. Würde er sich nicht angemeldet haben bei ihr, wenn er zurück wäre aus der Fremde?
Auch der Förster glaubte anfangs nicht daran; so unvorsichtig war der Anderl nicht.
Da hörte er eines Abends einen Schuß hart an der Grenze. Seit er den Posten seines Vaters innehatte, war kein Wildfrevel mehr in seinem Revier vorgekommen. Jetzt mehrten sich die Anzeichen. Und so unwahrscheinlich es auch war – seit jenem Schuß ward er den Gedanken nicht los: wenn’s der Anderl wäre? Wenn’s ihn hinzöge zum Ort seiner That? Hassen mußte er ihn auch, den Mann des Marei, der eigentlich die Veranlassung war, daß er ein Heimatloser geworden.
Er sprach mit keinem Menschen darüber, auch mit Marei nicht – wozu sie beunruhigen? – –
Die Hirsche schrien im Bergwald. Willy war schon nächtelang aus dem Hause. Er sei einem Kapitalhirsch auf der Spur, hatte er Marei gesagt. Sie kannte seine Jagdleidenschaft, sein langes Wegbleiben fiel ihr daher nicht auf. Gestern abend war dann der Flori gekommen mit guter Nachricht. „Heut’ hat er ’n derwischt! Zwei Schuß, net glei nachanand – das kenn’ i! Verlaß Di drauf, Marei, er hat ihn!“
Daß Willy denselben Abend nicht heimkam, war nichts Absonderliches. Er wird in der Winterstube geblieben sein und das Wild gleich in der Frühe von den Holzknechten herunterschaffen lassen. So hatte er es oft schon gehalten. – Aber jetzt war es schon Mittag und Willy noch immer nicht zu Hause. Marei ward nun doch von Unruhe ergriffen. Alte Erinnerungen aus dem Vaterhaus erwachten in ihr, an die geheimen Gänge des Vaters, an das Schicksal des alten Försters, an Anderl und seine blutige That.
Die Mutter, die ihre Bangigkeit merkte, beruhigte sie. Es werde ja nie mehr gewildert seit jener Zeit, der Willy könne ein Wild angeschossen haben und es nun verfolgen. Doch war ihr selber angst und bange dabei, sie wußte selbst nicht warum.
Da kam der Förster die Dorfstraße herauf. Nun war alles gut. Marei eilte ihm entgegen; es war ihr, als habe sie den geliebten Mann von neuem gewonnen.
„Hast ihn?“ rief sie ihm schon von weitem entgegen.
Keine Antwort! Kein Zeichen! So war er immer, wenn ihm ein Malheur passiert war auf der Jagd.
„Hast ja g’schoss’n gestern abend!“
Er war jetzt bei ihr. So verstimmt war er noch nie heimgekommen.
„Ich hab’ ihn!“ sagte er in einen Tone, der sie erschreckte. „Aber einen andern, als Du glaubst! Den Wilderer, der unser Revier beunruhigt hat seit Wochen. Brauchst nicht zu erschrecken – dank Deinem Herrgott, Marei, daß ich heil wieder da bin! s’ist mir nahe gestanden das Mal.“
Seine Stimme zitterte.
„Und Du hast ’hn abg’liefert ans G’richt? Desweg’n bist so spät komma?“
Eine bange Ahnung erfaßte Marei.
Willy zog seine Frau mit sich fort. „Komm’ mit ins Haus – hier ist kein Platz dafür. – – Ist die Mutter drinnen?“ unterbrach er sich plötzlich und blieb wieder stehen.
„Wohl, s’ is daheim.“
Willy biß sich auf die Unterlippe und rückte den Hut zurecht.
„Es ist anders gegangen –“ raunte er dann leise seiner Frau zu. „Draußen liegt er – das heißt, sie bringen ihn schon –“
Er atmete erleichtert auf.
„Tot?“ fragte Marei.
„Tot! – Schau, daß die Mutter nichts merkt, oder wenigstens, daß sie ihn nicht zu sehen kriegt –“
Marei war jäh erbleicht. Die Vergangenheit war heraufbeschworen. Sie betraten das Försterhaus.
„No, da is er ja!“ rief die Mutter, den kleinen Hansl am Arm, „’s Marei hat weiter ka Angst g’habt! – Hast ihn?“
Er schüttelte den Kopf.
„Aber g’schoss’n hast?“
„Muß denn alleweil getroffen sein?“
Er heuchelte Verdruß, um los zu kommen, und ging rasch auf sein Zimmer. „Komm’ mit!“ flüsterte er seiner Frau zu.
Eine Zeit lang ging er unruhig auf und ab. Marei hielt den Blick ängstlich auf seine Züge gerichtet, ohne ein Wort zu sprechen.
„Es muß sein, es läßt sich nicht verheimlichen,“ begann er plötzlich, „und Dir kann’s ja gleich sein.“ Er faßte ihre Hand. „Der Anderl ist es.“
Marei prallte zurück. „Der Tote?“
Willy nickte stumm. „Es war wie ein Zweikampf, Schuß auf Schuß! Er hat nun seinen Lohn.“
„Aber d’Mutter! Um Gotteswill’n, d’Mutter!“ rief Marei.
„Eben deshalb red’ ich mit Dir. Ich möcht’ es ihr gern ersparen! Ich konnt’ ihn doch nicht liegen lassen draußen wie einen toten Hund und darüber gar in Verdacht kommen. Morgen wird er begraben, die Kommission vom G’richt war schon oben. Halte die Mutter im Haus, laß Dir nichts anmerken! Ich muß gleich wieder fort, das Protokoll darüber wird aufgenommen. Ich werd’ schon dafür sorgen, daß niemand ins Haus kommt und schwätzt. Marei –“ er umfaßte seine Frau innig. „Daß ich nur wieder bei Dir bin! ’s wär’ doch recht hart gewesen!“
„Mein Tod!“ schluchzte sie unter heißen Thränen.
Willy verließ das Haus, eine Begegnung mit Loni sorgfältig vermeidend.
Jetzt galt es für Marei, sich zu fassen. Sehen durfte die Mutter den Toten wenigstens nicht; erfuhr sie später davon, war der Eindruck doch kein so mächtiger. Die Liebe zur Mutter, die Furcht vor dem drohenden Schatten, der sich unheilschwanger wieder heranwälzte gegen ihr Haus, verlieh ihr die Kraft der Verstellung.
Der kleine Hansel war zum guten Glück heute so bös und schreiig, daß die beiden Frauen vollauf beschäftigt waren. Dazu gab’s Regen, man war auf das Haus angewiesen. Marei warf wiederholt verstohlene Blicke zum Fenster hinaus. Es entging ihr eine gewisse Unruhe im Dorf nicht, Gruppen bildeten sich; über den Kirchhof, welchen man vom obern Stock aus überblickte, gingen beständig Leute. Sie wußte wohin – in die Totenkapelle, wo die Leiche des Anderl lag.
Um 6 Uhr läutete es zum Rosenkranz, und alles eilte zur Kirche.
„Heut’ an Rosenkranz? Am Dienstag? Is denn wer g’storb’n?“ fragte Loni. „Da muaß i do aa mal ’nüberschau’n.“
Marei hielt sie mit zu großer Hast davon ab. Da stutzte
Verschiedene: Die Gartenlaube (1895). Leipzig: Ernst Keil, 1895, Seite 162. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1895)_162.jpg&oldid=- (Version vom 3.8.2020)