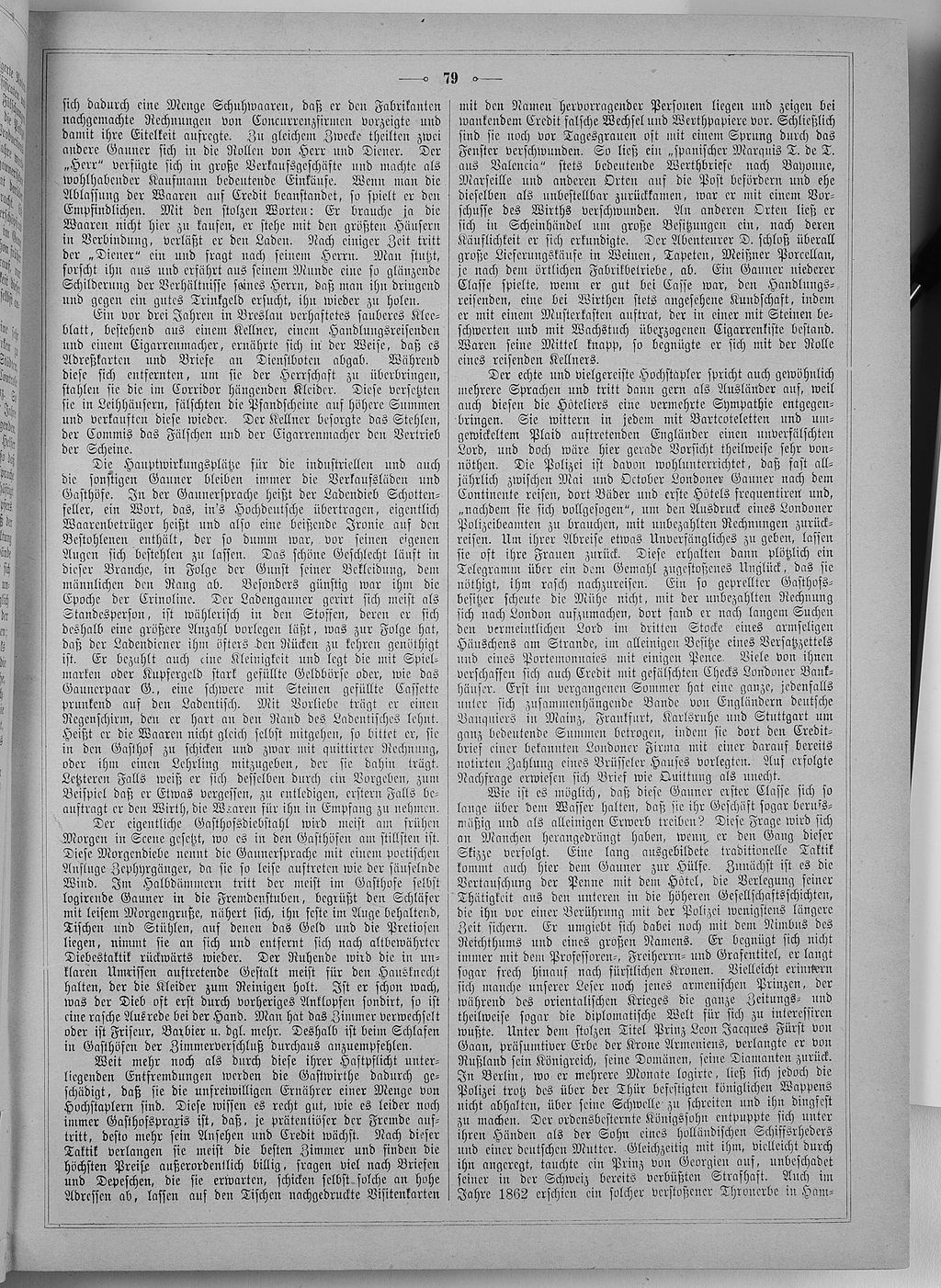| Verschiedene: Die Gartenlaube (1875) | |
|
|
sich dadurch eine Menge Schuhwaaren, daß er den Fabrikanten nachgemachte Rechnungen von Concurrenzfirmen vorzeigte und damit ihre Eitelkeit aufregte. Zu gleichem Zwecke theilten zwei andere Gauner sich in die Rollen von Herr und Diener. Der „Herr“ verfügte sich in große Verkaufsgeschäfte und machte als wohlhabender Kaufmann bedeutende Einkäufe. Wenn man die Ablassung der Waaren auf Credit beanstandet, so spielt er den Empfindlichen. Mit den stolzen Worten: Er brauche ja die Waaren nicht hier zu kaufen, er stehe mit den größten Häusern in Verbindung, verläßt er den Laden. Nach einiger Zeit tritt der „Diener“ ein und fragt nach seinem Herrn. Man stutzt, forscht ihn aus und erfährt aus seinem Munde eine so glänzende Schilderung der Verhältnisse seines Herrn, daß man ihn dringend und gegen ein gutes Trinkgeld ersucht, ihn wieder zu holen.
Ein vor drei Jahren in Breslau verhaftetes sauberes Kleeblatt, bestehend aus einem Kellner, einem Handlungsreisenden und einem Cigarrenmacher, ernährte sich in der Weise, daß es Adreßkarten und Briefe an Dienstboten abgab. Während diese sich entfernten, um sie der Herrschaft zu überbringen, stahlen sie die im Corridor hängenden Kleider. Diese versetzten sie in Leihhäusern, fälschten die Pfandscheine auf höhere Summen und verkauften diese wieder. Der Kellner besorgte das Stehlen, der Commis das Fälschen und der Cigarrenmacher den Vertrieb der Scheine.
Die Hauptwirkungsplätze für die industriellen und auch die sonstigen Gauner bleiben immer die Verkaufsläden und Gasthöfe. In der Gaunersprache heißt der Ladendieb Schottenfeller, ein Wort, das, in’s Hochdeutsche übertragen, eigentlich Waarenbetrüger heißt und also eine beißende Ironie, auf den Bestohlenen enthält, der so dumm war, vor seinen eigenen Augen sich bestehlen zu lassen. Das schöne Geschlecht läuft in dieser Branche, in Folge der Gunst seiner Bekleidung, dem männlichen den Rang ab. Besonders günstig war ihm die Epoche der Crinoline. Der Ladengauner gerirt sich meist als Standesperson, ist wählerisch in den Stoffen, deren er sich deshalb eine größere Anzahl vorlegen läßt, was zur Folge hat, daß der Ladendiener ihm öfters den Rücken zu kehren genöthigt ist. Er bezahlt auch eine Kleinigkeit und legt die mit Spielmarken oder Kupfergeld stark gefüllte Geldbörse oder, wie das Gaunerpaar G., eine schwere mit Steinen gefüllte Cassette prunkend auf den Ladentisch. Mit Vorliebe trägt er einen Regenschirm, den er hart an den Rand des Ladentisches lehnt. Heißt er die Waaren nicht gleich selbst mitgehen, so bittet er, sie in den Gasthof zu schicken und zwar mit quittirter Rechnung, oder ihm einen Lehrling mitzugeben, der sie dahin trägt. Letzteren Falls weiß er sich desselben durch ein Vorgeben, zum Beispiel daß er Etwas vergessen, zu entledigen, erstern Falls beauftragt er den Wirth, die Waaren für ihn in Empfang zu nehmen.
Der eigentliche Gasthofsdiebstahl wird meist am frühen Morgen in Scene gesetzt, wo es in den Gasthöfen am stillsten ist. Diese Morgendiebe nennt die Gaunersprache mit einem poetischen Anfluge Zephyrgänger, da sie so leise auftreten wie der säuselnde Wind. Im Halbdämmern tritt der meist im Gasthofe selbst logirende Gauner in die Fremdenstuben, begrüßt den Schläfer mit leisem Morgengruße, nähert sich, ihn feste im Auge behaltend, Tischen und Stühlen, auf denen das Geld und die Pretiosen liegen, nimmt sie an sich und entfernt sich nach altbewährter Diebestaktik rückwärts wieder. Der Ruhende wird die in unklaren Umrissen auftretende Gestalt meist für den Hausknecht halten, der die Kleider zum Reinigen holt. Ist er schon wach, was der Dieb oft erst durch vorheriges Anklopfen sondirt, so ist eine rasche Ausrede bei der Hand. Man hat das Zimmer verwechselt oder ist Friseur, Balbier u. dgl. mehr. Deshalb ist beim Schlafen in Gasthöfen der Zimmerverschluß durchaus anzuempfehlen.
Weit mehr noch als durch diese ihrer Haftpflicht unterliegenden Entfremdungen werden die Gastwirthe dadurch geschädigt, daß sie die unfreiwilligen Ernährer einer Menge von Hochstaplern sind. Diese wissen es recht gut, wie es leider noch immer Gasthofspraxis ist, daß, je prätentiöser der Fremde auftritt, desto mehr sein Ansehen und Credit wächst. Nach dieser Taktik verlangen sie meist die besten Zimmer und finden die höchsten Preise außerordentlich billig, fragen viel nach Briefen und Depeschen, die sie erwarten, schicken selbst solche an hohe Adressen ab, lassen auf den Tischen nachgedruckte Visitenkarten mit den Namen hervorragender Personen liegen und zeigen bei wankendem Credit falsche Wechsel und Werthpapiere vor. Schließlich sind sie noch vor Tagesgrauen oft mit einem Sprung durch das Fenster verschwunden. So ließ ein „spanischer Marquis T. de T. aus Valencia“ stets bedeutende Werthbriefe nach Bayonne, Marseille und anderen Orten auf die Post befördern und ehe dieselben als unbestellbar zurückkamen, war er mit einem Vorschusse des Wirths verschwunden. An anderen Orten ließ er sich in Scheinhändel um große Besitzungen ein, nach deren Käuflichkeit er sich erkundigte. Der Abenteurer D. schloß überall große Lieferungskäufe in Weinen, Tapeten, Meißner Porcellan, je nach dem örtlichen Fabrikbetriebe, ab. Ein Gauner niederer Classe spielte, wenn er gut bei Casse war, den Handlungsreisenden, eine bei Wirthen stets angesehene Kundschaft, indem er mit einem Musterkasten auftrat, der in einer mit Steinen beschwerten und mit Wachstuch überzogenen Cigarrenkiste bestand. Waren seine Mittel knapp, so begnügte er sich mit der Rolle eines reisenden Kellners.
Der echte und vielgereiste Hochstapler spricht auch gewöhnlich mehrere Sprachen und tritt dann gern als Ausländer auf, weil auch diesen die Hôteliers eine vermehrte Sympathie entgegenbringen. Sie wittern in jedem mit Bartkoteletten und umgewickeltem Plaid auftretenden Engländer einen unverfälschten Lord, und doch wäre hier gerade Vorsicht theilweise sehr vonnöthen. Die Polizei ist davon wohlunterrichtet, daß fast alljährlich zwischen Mai und October Londoner Gauner nach dem Continente reisen, dort Bäder und erste Hôtels frequentiren und, „nachdem, sie sich vollgesogen“, um den Ausdruck eines Londoner Polizeibeamten zu brauchen, mit unbezahlten Rechnungen zurückreisen. Um ihrer Abreise etwas Unverfängliches zu geben, lassen sie oft ihre Frauen zurück. Diese erhalten dann plötzlich ein Telegramm über ein dem Gemahl zugestoßenes Unglück, das sie nöthigt, ihm rasch nachzureisen. Ein so geprellter Gasthofsbesitzer scheute die Mühe nicht, mit der unbezahlten Rechnung sich nach London aufzumachen, dort fand er nach langem Suchen den vermeintlichen Lord im dritten Stocke eines armseligen Häuschens am Strande, im alleinigen Besitze eines Versatzzettels und eines Portemonnaies mit einigen Pence. Viele von ihnen verschaffen sich auch Credit mit gefälschten Checks Londoner Bankhäuser. Erst im vergangenen Sommer hat eine ganze, jedenfalls unter sich zusammenhängende Bande von Engländern deutsche Banquiers in Mainz, Frankfurt, Karlsruhe und Stuttgart um ganz bedeutende Summen betrogen, indem sie dort den Kreditbrief einer bekannten Londoner Firma mit einer darauf bereits notirten Zahlung eines Brüsseler Hauses vorlegten. Auf erfolgte Nachfrage erwiesen sich Brief wie Quittung als unecht.
Wie ist es möglich, daß diese Gauner erster Classe sich so lange über dem Wasser halten, daß sie ihr Geschäft sogar berufsmäßig und als alleinigen Erwerb treiben? Diese Frage wird sich an Manchen herangedrängt haben, wenn er den Gang dieser Skizze verfolgt. Eine lang ausgebildete traditionelle Taktik kommt auch hier dem Gauner zur Hülfe. Zunächst ist es die Vertauschung der Penne mit dem Hôtel, die Verlegung seiner Thätigkeit aus den unteren in die höheren Gesellschaftsschichten, die ihn vor einer Berührung mit der Polizei wenigstens längere Zeit sichern. Er umgiebt sich dabei noch mit dem Nimbus des Reichthums und eines großen Namens. Er begnügt sich nicht immer mit dem Professoren-, Freiherrn- und Grafentitel, er langt sogar frech hinauf nach fürstlichen Kronen. Vielleicht erinnern sich manche unserer Leser noch jenes armenischen Prinzen, der während des orientalischen Krieges die ganze Zeitungs- und theilweise sogar die diplomatische Welt für sich zu interessiren wußte. Unter dem stolzen Titel Prinz Leon Jacques Fürst von Gaan, präsumtiver Erbe der Krone Armeniens, verlangte er von Rußland sein Königreich, seine Domänen, seine Diamanten zurück. In Berlin, wo er mehrere Monate logirte, ließ sich jedoch die Polizei trotz des über der Thür befestigten königlichen Wappens nicht abhalten, über seine Schwelle zu schreiten und ihn dingfest zu machen. Der ordensbesternte Königssohn entpuppte sich unter ihren Händen als der Sohn eines holländischen Schiffsrheders und einer deutschen Mutter. Gleichzeitig mit ihm, vielleicht durch ihn angeregt, tauchte ein Prinz von Georgien auf, unbeschadet seiner in der Schweiz bereits verbüßten Strafhaft. Auch im Jahre 1862 erschien ein solcher verstoßener Thronerbe in Hamburg
Verschiedene: Die Gartenlaube (1875). Leipzig: Ernst Keil, 1875, Seite 79. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1875)_079.jpg&oldid=- (Version vom 9.3.2019)