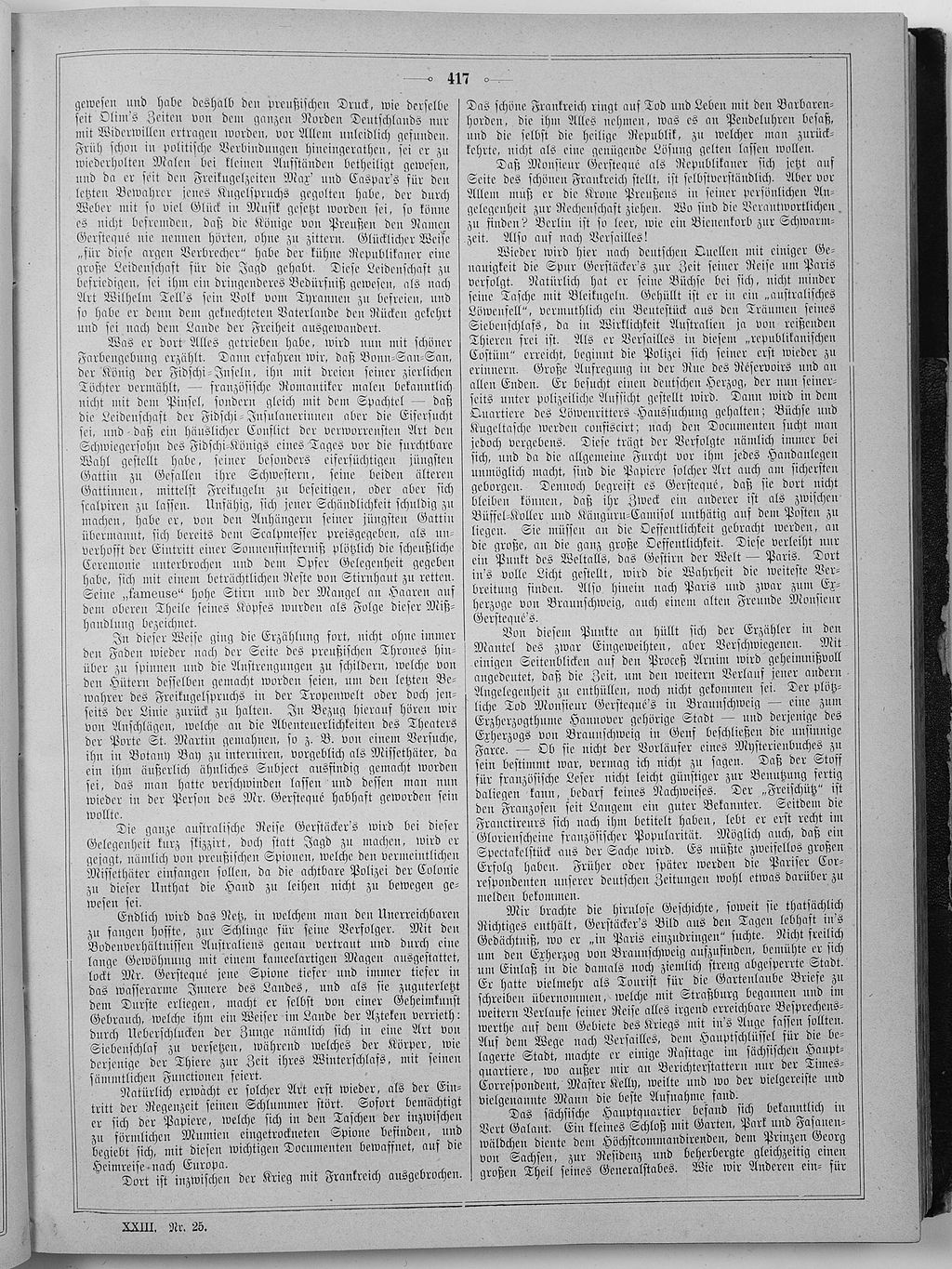| Verschiedene: Die Gartenlaube (1875) | |
|
|
gewesen und habe deshalb den preußischen Druck, wie derselbe seit Olim’s Zeiten von dem ganzen Norden Deutschlands nur mit Widerwillen ertragen worden, vor Allem unleidlich gefunden. Früh schon in politische Verbindungen hineingeraten, sei er zu wiederholten Malen bei kleinen Aufständen betheiligt gewesen, und da er seit den Freikugelzeiten Max’ und Caspar’s für den letzten Bewahrer jenes Kugelspruchs gegolten habe, der durch Weber mit so viel Glück in Musik gesetzt worden sei, so könne es nicht befremden, daß die Könige von Preußen den Namen Gerstequé nie nennen hörten, ohne zu zittern. Glücklicher Weise „für diese argen Verbrecher“ habe der kühne Republikaner eine große Leidenschaft für die Jagd gehabt. Diese Leidenschaft zu befriedigen sei ihm ein dringenderes Bedürfniß gewesen, als nach Art Wilhelm Tell’s sein Volk vom Tyrannen zu befreien und so habe er denn dem geknechteten Vaterlande den Rücken gekehrt und sei nach dem Lande der Freiheit ausgewandert.
Was er dort Alles getrieben habe, wird nun mit schöner Farbengebung erzählt. Dann erfahren wir, daß Bonn-San-San, der König der Fidschi-Inseln, ihn mit dreien seiner zierlichen Töchter vermählt, – französische Romantiker malen bekanntlich nicht mit dem Pinsel, sondern gleich mit dem Spachtel – daß die Leidenschaft der Fidschi-Insulanerinnen aber die Eifersucht sei, und daß ein häuslicher Conflict der verworrensten Art den Schwiegersohn des Fidschi-Königs eines Tages vor die furchtbare Wahl gestellt habe, seiner besonders eifersüchtigen jüngsten Gattin zu Gefallen ihre Schwestern, seine beiden älteren Gattinnen, mittelst Freikugeln zu beseitigen, oder aber sich scalpiren zu lassen. Unfähig, sich jener Schändlichkeit schuldig zu machen, habe er, von den Anhängern seiner jüngsten Gattin übermannt, sich bereits dem Scalpmesser preisgegeben, als unverhofft der Eintritt einer Sonnenfinsterniß plötzlich die scheußliche Ceremonie unterbrochen und dem Opfer Gelegenheit gegeben habe, sich mit einem beträchtlichen Reste von Stirnhaut zu retten. Seine „fameuse“ hohe Stirn und der Mangel an Haaren auf dem oberen Theile seines Kopfes wurden als Folge dieser Mißhandlung bezeichnet.
In dieser Weise ging die Erzählung fort, nicht ohne immer den Faden wieder nach der Seite des preußischer Thrones hinüber zu spinnen und die Anstrengungen zu schildern, welche von den Hütern desselben gemacht worden seien, um den letzten Bewahrer des Freikugelspruchs in der Tropenwelt oder doch jenseits der Linie zurück zu halten. In Bezug hierauf hören wir von Anschlägen, welche an die Abenteuerlichkeiten des Theaters der Porte St. Martin gemahnen, so z. B. von einem Versuche, ihn in Botany Bay zu interniren, vorgeblich als Missethäter, da ein ihm äußerlich ähnliches Subject ausfindig gemacht worden sei, das man hatte verschwinden lassen und dessen man nun wieder in der Person des Mr. Gerstequé habhaft geworden sein wollte.
Die ganze australische Reise Gerstäcker’s wird bei dieser Gelegenheit kurz skizzirt, doch statt Jagd zu machen, wird er gejagt, nämlich von preußischen Spionen, welche den vermeintlichen Missethäter einfangen sollen, da die achtbare Polizei der Colonie zu dieser Unthat die Hand zu leihen nicht zu bewegen gewesen sei.
Endlich wird das Netz, in welchem man den Unerreichbaren zu fangen hoffte, zur Schlinge für seine Verfolger. Mit den Bodenverhältnissen Australiens genau vertraut und durch eine lange Gewöhnung mit einem kameelartigen Magen ausgestattet, lockt Mr. Gerstequé jene Spione tiefer und immer tiefer in das wasserarme Innere des Landes, und als sie zuguterletzt dem Durste erliegen, macht er selbst von einer Geheimkunst Gebrauch, welche ihm ein Weiser im Lande der Azteken verrieth: durch Ueberschlucken der Zunge nämlich sich in eine Art von Siebenschlaf zu versetzen, während welches der Körper, wie derjenige der Thiere zur Zeit ihres Winterschlafs, mit seinen sämmtlichen Functionen feiert.
Natürlich erwacht er solcher Art erst wieder, als der Eintritt der Regenzeit seinen Schlummer stört. Sofort bemächtigt er sich der Papiere, welche sich in den Taschen der inzwischen zu förmlichen Mumien eingetrockneten Spione befinden, und begiebt sich, mit diesen wichtigen Documenten bewaffnet, auf die Heimreise nach Europa.
Dort ist inzwischen der Krieg mit Frankreich ausgebrochen. Das schöne Frankreich ringt auf Tod und Leben mit den Barbarenhorden, die ihm Alles nehmen, was es an Pendeluhren besaß, und die selbst die heilige Republik, zu welcher man zurückkehrte, nicht als eine genügende Lösung gelten lassen wollen.
Daß Monsieur Gerstequé als Republikaner sich jetzt auf Seite des schönen Frankreich stellt, ist selbstverständlich. Aber vor Allem muß er die Krone Preußens in seiner persönlichen Angelegenheit zur Rechenschaft ziehen. Wo sind die Verantwortlichen zu finden? Berlin ist so leer, wie ein Bienenkorb zur Schwarmzeit. Also auf nach Versailles!
Wieder wird hier nach deutschen Quellen mit einiger Genauigkeit die Spur Gerstäcker’s zur Zeit seiner Reise um Paris verfolgt. Natürlich hat er seine Büchse bei sich, nicht minder seine Tasche mit Bleikugeln. Gehüllt ist er in ein „australisches Löwenfell“, vermuthlich ein Beutestück aus den Träumen seines Siebenschlafs, da in Wirklichkeit Australien ja von reißenden Thieren frei ist. Als er Versailles in diesem „republikanischen Costüm“ erreicht, beginnt die Polizei sich seiner erst wieder zu erinnern. Große Aufregung in der Rue des Réservoirs und an allen Enden. Er besucht einen deutschen Herzog, der nun seinerseits unter polizeiliche Aufsicht gestellt wird. Dann wird in dem Quartiere des Löwenritters Haussuchung gehalten; Büchse und Kugeltasche werden conficirt; nach den Documenten sucht man jedoch vergebens. Diese trägt der Verfolgte nämlich immer bei sich, und da die allgemeine Furcht vor ihm jedes Handanlegen unmöglich macht, sind die Papiere solcher Art auch am sichersten geborgen. Dennoch begreift es Gerstequé, daß sie dort nicht bleiben können, daß ihr Zweck ein anderer ist als zwischen Büffel-Koller und Känguru-Camisol unthätig auf dem Posten zu liegen. Sie müssen an die Oeffentlichkeit gebracht werden, an die große, an die ganz große Oeffentlichkeit. Diese verleiht nur ein Punkt des Weltalls, das Gestirn der Welt – Paris. Dort in’s volle Licht gestellt, wird die Wahrheit die weiteste Verbreitung finden. Also hinein nach Paris und zwar zum Exherzoge von Braunschweig, auch einem alten Freunde Monsieur Gerstequé’s.
Von diesen Punkte an hüllt sich der Erzähler in den Mantel des zwar Eingeweihten, aber Verschwiegenen. Mit einigen Seitenblicken auf den Proceß Arnim wird geheimnißvoll angedeutet, daß die Zeit, um den weitern Verlauf jener andern Angelegenheit zu enthüllen, noch nicht gekommen sei. Der plötzliche Tod Monsieur Gerstequé’s in Braunschweig – eine zum Erzherzogthume Hannover gehörige Stadt – und derjenige des Exherzogs von Braunschweig in Genf beschließen die unsinnige Farce. – Ob sie nicht der Vorläufer eines Mysterienbuches zu sein bestimmt war, vermag ich nicht zu sagen. Daß der Stoff für französische Leser nicht leicht günstiger zur Benutzung fertig daliegen kann, bedarf keines Nachweises. Der „Freischütz“ ist den Franzosen seit Langem ein guter Bekannter. Seitdem die Franctireurs sich nach ihm betitelt haben, lebt er erst recht im Glorienscheine französischer Popularität. Möglich auch, daß ein Spectakelstück aus der Sache wird. Es müßte zweifellos großen Erfolg haben. Früher oder später werden die Pariser Correspondenten unserer deutschen Zeitungen wohl etwas darüber zu melden bekommen.
Mir brachte die hirnlose Geschichte, soweit sie thatsächlich Richtiges enthält, Gerstäcker’s Bild aus den Tagen lebhaft in’s Gedächtniß, wo er „in Paris einzudringen“ suchte. Nicht freilich um den Exherzog von Braunschweig aufzufinden, bemühte er sich um Einlaß in die damals noch ziemlich streng abgesperrte Stadt. Er hatte vielmehr als Tourist für die Gartenlaube Briefe zu schreiben übernommen, welche mit Straßburg begannen und im weitern Verlaufe seiner Reise alles irgend erreichbare Besprechenswerthe auf dem Gebiete des Kriegs mit in’s Auge fassen sollten. Auf dem Wege nach Versailles, dem Hauptschlüssel für die belagerte Stadt, machte er einige Rasttage im sächsischen Hauptquartiere, wo außer mir an Berichterstattern nur der Times-Correspondent, Master Kelly, weilte und wo der vielgereiste und vielgenannte Mann die beste Aufnahme fand.
Das sächsische Hauptquartier befand sich bekanntlich in Vert Galant. Ein kleines Schloß mit Garten, Park und Fasanenwäldchen diente dem Höchstcommandirenden, dem Prinzen Georg von Sachsen, zur Residenz und beherbergte gleichzeitig einen großen Theil seines Generalstabes. Wie wir Anderen ein- für
Verschiedene: Die Gartenlaube (1875). Leipzig: Ernst Keil, 1875, Seite 417. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1875)_417.jpg&oldid=- (Version vom 25.6.2019)