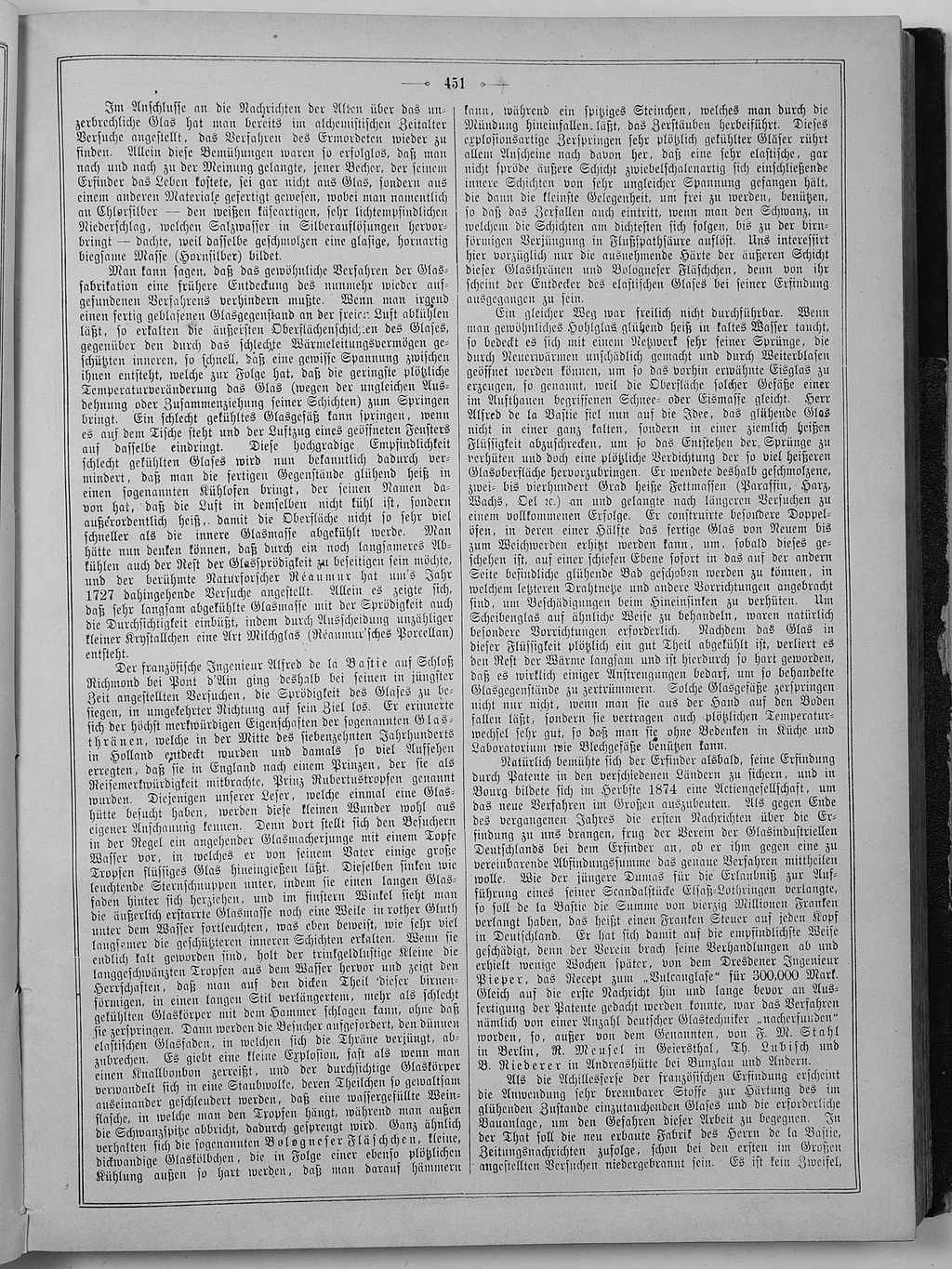| Verschiedene: Die Gartenlaube (1875) | |
|
|
Im Anschlusse an die Nachrichten der Alten über das unzerbrechliche Glas hat man bereits im alchemistischen Zeitalter Versuche angestellt, das Verfahren des Ermordeten wieder zu finden. Allein diese Bemühungen waren so erfolglos, daß man nach und nach zu der Meinung gelangte, jener Becher, der seinem Erfinder das Leben kostete, sei gar nicht aus Glas, sondern aus einem anderen Materiale gefertigt gewesen, wobei man namentlich an Chlorsilber – den weißen käseartigen, sehr lichtempfindlichen Niederschlag, welchen Salzwasser in Silberauflösungen hervorbringt – dachte, weil dasselbe geschmolzen eine glasige, hornartig biegsame Masse (Hornsilber) bildet.
Man kann sagen, daß das gewöhnliche Verfahren der Glasfabrikation eine frühere Entdeckung des nunmehr wieder aufgefundenen Verfahrens verhindern mußte. Wenn man irgend einen fertig geblasenen Glasgegenstand an der freien Luft abkühlen läßt, so erkalten die äußersten Oberflächenschichten des Glases, gegenüber den durch das schlechte Wärmeleitungsvermögen geschützten inneren, so schnell, daß eine gewisse Spannung zwischen ihnen entsteht, welche zur Folge hat, daß die geringste plötzliche Temperaturveränderung das Glas (wegen der ungleichen Ausdehnung oder Zusammenziehung seiner Schichten) zum Springen bringt. Ein schlecht gekühltes Glasgefäß kann springen, wenn es auf dem Tische steht und der Luftzug eines geöffneten Fensters auf dasselbe eindringt. Diese hochgradige Empfindlichkeit schlecht gekühlten Glases wird nun bekanntlich dadurch vermindert, daß man die fertigen Gegenstände glühend heiß in einen sogenannten Kühlofen bringt, der seinen Namen davon hat, daß die Luft in demselben nicht kühl ist, sondern außerordentlich heiß, damit die Oberfläche nicht so sehr viel schneller als die innere Glasmasse abgekühlt werde. Man hätte nun denken können, daß durch ein noch langsameres Abkühlen auch der Rest der Glassprödigkeit zu beseitigen sein möchte, und der berühmte Naturforscher Réaumur hat um’s Jahr 1727 dahingehende Versuche angestellt. Allein es zeigte sich, daß sehr langsam abgekühlte Glasmasse mit der Sprödigkeit auch die Durchsichtigkeit einbüßt, indem durch Ausscheidung unzähliger kleiner Krystallchen eine Art Milchglas (Réaumur’sches Porecellan) entsteht.
Der französische Ingenieur Alfred de la Bastie auf Schloß Richmond bei Pont d’Ain ging deshalb bei seinen in jüngster Zeit angestellten Versuchen, die Sprödigkeit des Glases zu besiegen, in umgekehrter Richtung auf sein Ziel los. Er erinnerte sich der höchst merkwürdigen Eigenschaften der sogenannten Glasthränen, welche in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts in Holland entdeckt wurden und damals so viel Aufsehen erregten, daß sie in England nach einem Prinzen, der sie als Reisemerkwürdigkeit mitbrachte, Prinz Rubertustropfen genannt wurden. Diejenigen unserer Leser, welche einmal eine Glashütte besucht haben, werden diese kleinen Wunder wohl aus eigener Anschauung kennen. Denn dort stellt sich den Besuchern in der Regel ein angehender Glasmacherjunge mit einem Topfe Wasser vor, in welches er von seinem Vater einige große Tropfen flüssiges Glas hineingießen läßt. Dieselben sinken wie leuchtende Sternschnuppen unter, indem sie einen langen Glasfaden hinter sich herziehen, und im finstern Winkel sieht man die äußerlich erstarrte Glasmasse noch eine Weile in rother Gluth unter dem Wasser fortleuchten, was eben beweist, wie sehr viel langsamer die geschützteren inneren Schichten erkalten. Wenn sie endlich kalt geworden sind, holt der trinkgeldlustige Kleine die langgeschwänzten Tropfen aus dem Wasser hervor und zeigt den Herrschaften, daß man auf den dicken Theil dieser birnenförmigen, in einen langen Stil verlängerten, mehr als schlecht gekühlten Glaskörper mit dem Hammer schlagen kann, ohne daß sie zerspringen. Dann werden die Besucher aufgefordert, den dünnen elastischen Glasfaden, in welchen sich die Thräne verjüngt, abzubrechen. Es giebt eine kleine Explosion, fast als wenn man einen Knallbonbon zerreißt, und der durchsichtige Glaskörper verwandelt sich in eine Staubwolke, deren Theilchen so gewaltsam auseinander geschleudert werden, daß eine wassergefüllte Weinflasche, in welche man den Tropfen hängt, während man außen die Schwanzspitze abbricht, dadurch gesprengt wird. Ganz ähnlich verhalten sich die sogenannten Bologneser Fläschchen, kleine, dickwandige Glaskölbchen, die in Folge einer ebenso plötzlichen Kühlung außen so hart werden, daß man darauf hämmern kann, während ein spitziges Steinchen, welches man durch die Mündung hineinfallen läßt, das Zerstäuben herbeiführt. Dieses explosionsartige Zerspringen sehr plötzlich gekühlter Gläser rührt allem Anscheine nach davon her, daß eine sehr elastische, gar nicht spröde äußere Schicht zwiebelschalenartig sich einschließende innere Schichten von sehr ungleicher Spannung gefangen hält, die dann die kleinste Gelegenheit, um frei zu werden, benützen, so daß das Zerfallen auch eintritt, wenn man den Schwanz, in welchem die Schichten am dichtesten sich folgen, bis zu der birnförmigen Verjüngung in Flußspathsäure auflöst. Uns interessirt hier vorzüglich nur die ausnehmende Härte der äußeren Schicht dieser Glasthränen und Bologneser Fläschchen, denn von ihr scheint der Entdecker des elastischen Glases bei seiner Erfindung ausgegangen zu sein.
Ein gleicher Weg war freilich nicht durchführbar. Wenn man gewöhnliches Hohlglas glühend heiß in kaltes Wasser taucht, so bedeckt es sich mit einem Netzwerk sehr feiner Sprünge, die durch Neuerwärmen unschädlich gemacht und durch Weiterblasen geöffnet werden können, um so das vorhin erwähnte Eisglas zu erzeugen, so genannt, weil die Oberfläche solcher Gefäße einer im Aufthauen begriffenen Schnee- oder Eismasse gleicht. Herr Alfred de la Bastie fiel nun auf die Idee, das glühende Glas nicht in einer ganz kalten, sondern in einer ziemlich heißen Flüssigkeit abzuschrecken, um so das Entstehen der Sprünge zu verhüten und doch eine plötzliche Verdichtung der so viel heißeren Glasoberfläche hervorzubringen. Er wendete deshalb geschmolzene, zwei- bis vierhundert Grad heiße Fettmassen (Paraffin, Harz, Wachs, Oel etc.) an und gelangte nach längeren Versuchen zu einem vollkommenen Erfolge. Er construirte besondere Doppelöfen, in deren einer Hälfte das fertige Glas von Neuem bis zum Weichwerden erhitzt werden kann, um, sobald dieses geschehen ist, auf einer schiefen Ebene sofort in das auf der andern Seite befindliche glühende Bad geschoben werden zu können, in welchem letzteren Drahtnetze und andere Vorrichtungen angebracht sind, um Beschädigungen beim Hineinsinken zu verhüten. Um Scheibenglas auf ähnliche Weise zu behandeln, waren natürlich besondere Vorrichtungen erforderlich. Nachdem das Glas in dieser Flüssigkeit plötzlich ein gut Theil abgekühlt ist, verliert es den Rest der Wärme langsam und ist hierdurch so hart geworden, daß es wirklich einiger Anstrengungen bedarf, um so behandelte Glasgegenstände zu zertrümmern. Solche Glasgefäße zerspringen nicht nur nicht, wenn man sie aus der Hand auf den Boden fallen läßt, sondern sie vertragen auch plötzlichen Temperaturwechsel sehr gut, so daß man sie ohne Bedenken in Küche und Laboratorium wie Blechgefäße benützen kann.
Natürlich bemühte sich der Erfinder alsbald, seine Erfindung durch Patente in den verschiedenen Ländern zu sichern, und in Bourg bildete sich im Herbste 1874 eine Actiengesellschaft, um das neue Verfahren im Großen auszubeuten. Als gegen Ende des vergangenen Jahres die ersten Nachrichten über die Erfindung zu uns drangen, frug der Verein der Glasindustriellen Deutschlands bei dem Erfinder an, ob er ihm gegen eine zu vereinbarende Abfindungssumme das genaue Verfahren mittheilen wolle. Wie der jüngere Dumas für die Erlaubniß zur Aufführung eines seiner Scandalstücke Elsaß-Lothringen verlagte, so soll de la Bastie die Summe von vierzig Millionen Franken verlangt haben, das heißt einen Franken Steuer auf jeden Kopf in Deutschland. Er hat sich damit auf die empfindlichste Weise geschädigt, denn der Verein brach seine Verhandlungen ab und erhielt wenige Wochen später, von dem Dresdener Ingenieur Pieper, das Recept zum „Vulcanglase“ für 300,000 Mark. Gleich auf die erste Nachricht hin und lange bevor an Ausfertigung der Patente gedacht werden konnte, war das Verfahren nämlich von einer Anzahl deutscher Glastechniker „nacherfunden“ worden, so, außer von dem Genannten, von F. M. Stahl in Berlin, R. Meusel in Geiersthal, Th. Lubisch und B. Niederer in Andreashütte bei Bunzlau und Andern.
Als die Achillesferse der französischen Erfindung erscheint die Anwendung sehr brennbarer Stoffe zur Härtung des im glühenden Zustande einzutauchenden Glases und die erforderliche Bauanlage, um den Gefahren dieser Arbeit zu begegnen. In der That soll die neu erbaute Fabrik des Herrn de la Bastie, Zeitungsnachrichten zufolge, schon bei den ersten im Großen angestellten Versuche niedergebrannt sein. Es ist kein Zweifel,
Verschiedene: Die Gartenlaube (1875). Leipzig: Ernst Keil, 1875, Seite 451. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1875)_451.jpg&oldid=- (Version vom 9.9.2019)