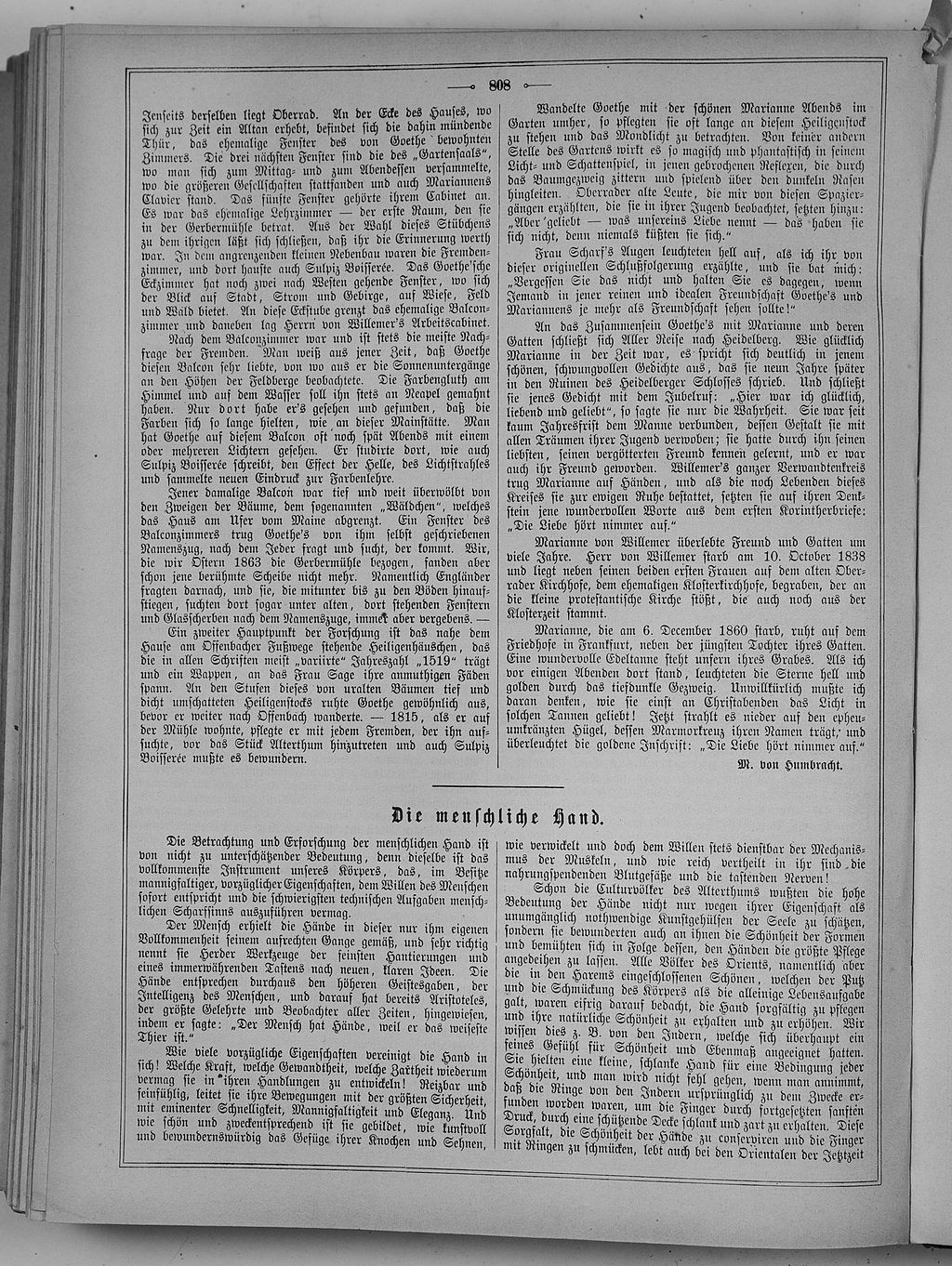| Verschiedene: Die Gartenlaube (1877) | |
|
|
Jenseits derselben liegt Oberrad. An der Ecke des Hauses, wo sich zur Zeit ein Altan erhebt, befindet sich die dahin mündende Thür, das ehemalige Fenster des von Goethe bewohnten Zimmers. Die drei nächsten Fenster sind die des „Gartensaals“, wo man sich zum Mittag- und zum Abendessen versammelte, wo die größeren Gesellschaften stattfanden und auch Mariannens Clavier stand. Das fünfte Fenster gehörte ihrem Cabinet an. Es war das ehemalige Lehrzimmer – der erste Raum, den sie in der Gerbermühle betrat. Aus der Wahl dieses Stübchens zu dem ihrigen läßt sich schließen, daß ihr die Erinnerung werth war. In dem angrenzenden kleinen Nebenbau waren die Fremdenzimmer, und dort hauste auch Sulpiz Boisserée. Das Goethe'sche Eckzimmer hat noch zwei nach Westen gehende Fenster, wo sich der Blick auf Stadt, Strom und Gebirge, auf Wiese, Feld und Wald bietet. An diese Eckstube grenzt das ehemalige Balconzimmer und daneben lag Herrn von Willemer's Arbeitscabinet.
Nach dem Balconzimmer war und ist stets die meiste Nachfrage der Fremden. Man weiß aus jener Zeit, daß Goethe diesen Balcon sehr liebte, von wo aus er die Sonnenuntergänge an den Höhen der Feldberge beobachtete. Die Farbengluth am Himmel und auf dem Wasser soll ihn stets an Neapel gemahnt haben. Nur dort habe er's gesehen und gesunden, daß die Farben sich so lange hielten, wie an dieser Mainstätte. Man hat Goethe auf diesem Balcon oft noch spät Abends mit einem oder mehreren Lichtern gesehen Er studirte dort, wie auch Sulpiz Boisserée schreibt, den Effect der Helle, des Lichtstrahles und sammelte neuen Eindruck zur Farbenlehre.
Jener damalige Balcon war tief und weit überwölbt von den Zweigen der Bäume, dem sogenannten „Wäldchen“, welches das Haus am Ufer vom Maine abgrenzt. Ein Fenster des Balconzimmers trug Goethe's von ihm selbst geschriebenen Namenszug, nach dem Jeder fragt und sucht, der kommt. Wir, die wir Ostern 1863 die Gerbermühle bezogen, fanden aber schon jene berühmte Scheibe nicht mehr. Namentlich Engländer fragten darnach, und sie, die mitunter bis zu den Böden hinaufstiegen, suchten dort sogar unter alten, dort stehenden Fenstern und Glasscherben nach dem Namenszuge, immer aber vergebens. –
Ein zweiter Hauptpunkt der Forschung ist das nahe dem Hause am Offenbacher Fußwege stehende Heiligenhäuschen, das die in allen Schriften meist „variirte“ Jahreszahl „1519“ trägt und ein Wappen, an das Frau Sage ihre anmuthigen Fäden spann. An den Stufen dieses von uralten Bäumen tief und dicht umschatteten Heiligenstocks ruhte Goethe gewöhnlich aus, bevor er weiter nach Offenbach wanderte. – 1815, als er auf der Mühle wohnte, pflegte er mit jedem Fremden, der ihn aufsuchte, vor das Stück Alterthum hinzutreten und auch Sulpiz Boisserée mußte es bewundern.
Wandelte Goethe mit der schönen Marianne Abends im Garten umher, so pflegten sie oft lange an diesem Heiligenstock zu stehen und das Mondlicht zu betrachten. Von keiner andern Stelle des Gartens wirkt es so magisch und phantastisch in seinem Licht- und Schattenspiel, in jenen gebrochenen Reflexen, die durch das Baumgezweig zittern und spielend über den dunkeln Rasen hingleiten. Oberrader alte Leute, die mir von diesen Spaziergängen erzählten, die sie in ihrer Jugend beobachtet, setzten hinzu: „Aber geliebt – was unsereins Liebe nennt – das haben sie sich nicht, denn niemals küßten sie sich.“
Frau Scharf's Augen leuchteten hell auf, als ich ihr von dieser originellen Schlußfolgerung erzählte, und sie bat mich: „Vergessen Sie das nicht und halten Sie es dagegen, wenn Jemand in jener reinen und idealen Freundschaft Goethe's und Mariannens je mehr als Freundschaft sehen sollte!“
An das Zusammensein Goethe's mit Marianne und deren Gatten schließt sich Aller Reise nach Heidelberg. Wie glücklich Marianne in der Zeit war, es spricht sich deutlich in jenem schönen, schwungvollen Gedichte aus, das sie neun Jahre später in den Ruinen des Heidelberger Schlosses schrieb. Und schließt sie jenes Gedicht mit dem Jubelruf: „Hier war ich glücklich, liebend und geliebt“, so sagte sie nur die Wahrheit. Sie war seit kaum Jahresfrist dem Manne verbunden, dessen Gestalt sie mit allen Träumen ihrer Jugend verwoben; sie hatte durch ihn seinen liebsten, seinen vergötterten Freund kennen gelernt, und er war auch ihr Freund geworden. Willemer's ganzer Verwandtenkreis trug Marianne auf Händen, und als die noch Lebenden dieses Kreises sie zur ewigen Ruhe bestattet, setzten sie auf ihren Denkstein jene wundervollen Worte aus dem ersten Korintherbriefe: „Die Liebe hört nimmer auf.“
Marianne von Willemer überlebte Freund und Gatten um viele Jahre. Herr von Willemer starb am 10. October 1838 und liegt neben seinen beiden ersten Frauen auf dem alten Oberrader Kirchhofe, dem ehemaligen Klosterkirchhofe, begraben, der an die kleine protestantische Kirche stößt, die auch noch aus der Klosterzeit stammt.
Marianne, die am 6. December 1860 starb, ruht auf dem Friedhofe in Frankfurt, neben der jüngsten Tochter ihres Gatten. Eine wundervolle Edeltanne steht unfern ihres Grabes. Als ich vor einigen Abenden dort stand, leuchteten die Sterne hell und golden durch das tiefdunkle Gezweig. Unwillkürlich mußte ich daran deuten, wie sie einst an Christabenden das Licht in solchen Tannen geliebt! Jetzt strahlt es nieder auf den epheuumkränzten Hügel, dessen Marmorkreuz ihren Namen trägt, und überleuchtet die goldene Inschrift: „Die Liebe hört nimmer auf.“
Die Betrachtung und Erforschung der menschlichen Hand ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung, denn dieselbe ist das vollkommenste Instrument unseres Körpers, das, im Besitze mannigfaltiger, vorzüglicher Eigenschaften, dem Willen des Menschen sofort entspricht und die schwierigsten technischen Aufgaben menschlichen Scharfsinns auszuführen vermag.
Der Mensch erhielt die Hände in dieser nur ihm eigenen Vollkommenheit seinem aufrechten Gange gemäß, und sehr richtig nennt sie Herder Werkzeuge der feinsten Hantierungen und eines immerwährenden Tastens nach neuen, klaren Ideen. Die Hände entsprechen durchaus den höheren Geistesgaben, der Intelligenz des Menschen, und darauf hat bereits Aristoteles, der größte Gelehrte und Beobachter aller Zeiten, hingewiesen, indem er sagte: „Der Mensch hat Hände, weil er das weiseste Thier ist.“
Wie viele vorzügliche Eigenschaften vereinigt die Hand in sich! Welche Kraft, welche Gewandtheit, welche Zartheit wiederum vermag sie in ihren Handlungen zu entwickeln! Reizbar und feinfühlig, leitet sie ihre Bewegungen mit der größten Sicherheit, mit eminenter Schnelligkeit, Mannigfaltigkeit und Eleganz. Und wie schön und zweckentsprechend ist sie gebildet, wie kunstvoll und bewundernswürdig das Gefüge ihrer Knochen und Sehnen, wie verwickelt und doch dem Willen stets dienstbar der Mechanismus der Muskeln, und wie reich vertheilt in ihr sind die nahrungspendenden Blutgefäße und die tastenden Nerven!
Schon die Culturvölker des Alterthums wußten die hohe Bedeutung der Hände nicht nur wegen ihrer Eigenschaft als unumgänglich nothwendige Kunstgehülfen der Seele zu schätzen, sondern sie bewunderten auch an ihnen die Schönheit der Formen und bemühten sich in Folge dessen, den Händen die größte Pflege angedeihen zu lassen. Alle Völker des Orients, namentlich aber die in den Harems eingeschlossenen Schönen, welchen der Putz und die Schmückung des Körpers als die alleinige Lebensaufgabe galt, waren eifrig darauf bedacht, die Hand sorgfältig zu pflegen und ihre natürliche Schönheit zu erhalten und zu erhöhen. Wir wissen dies z. B. von den Indern, welche sich überhaupt ein feines Gefühl für Schönheit und Ebenmaß angeeignet hatten. Sie hielten eine kleine, schlanke Hand für eine Bedingung jeder Schönheit, und man wird nicht fehl gehen, wenn man annimmt, daß die Ringe von den Indern ursprünglich zu dem Zwecke erfunden worden waren, um die Finger durch fortgesetzten sanften Druck, durch eine schützende Decke schlank und zart zu erhalten. Diese Sorgfalt, die Schönheit der Hände zu conserviren und die Finger mit Ringen zu schmücken, lebt auch bei den Orientalen der Jetztzeit
Verschiedene: Die Gartenlaube (1877). Leipzig: Ernst Keil, 1877, Seite 808. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1877)_808.jpg&oldid=- (Version vom 29.11.2019)