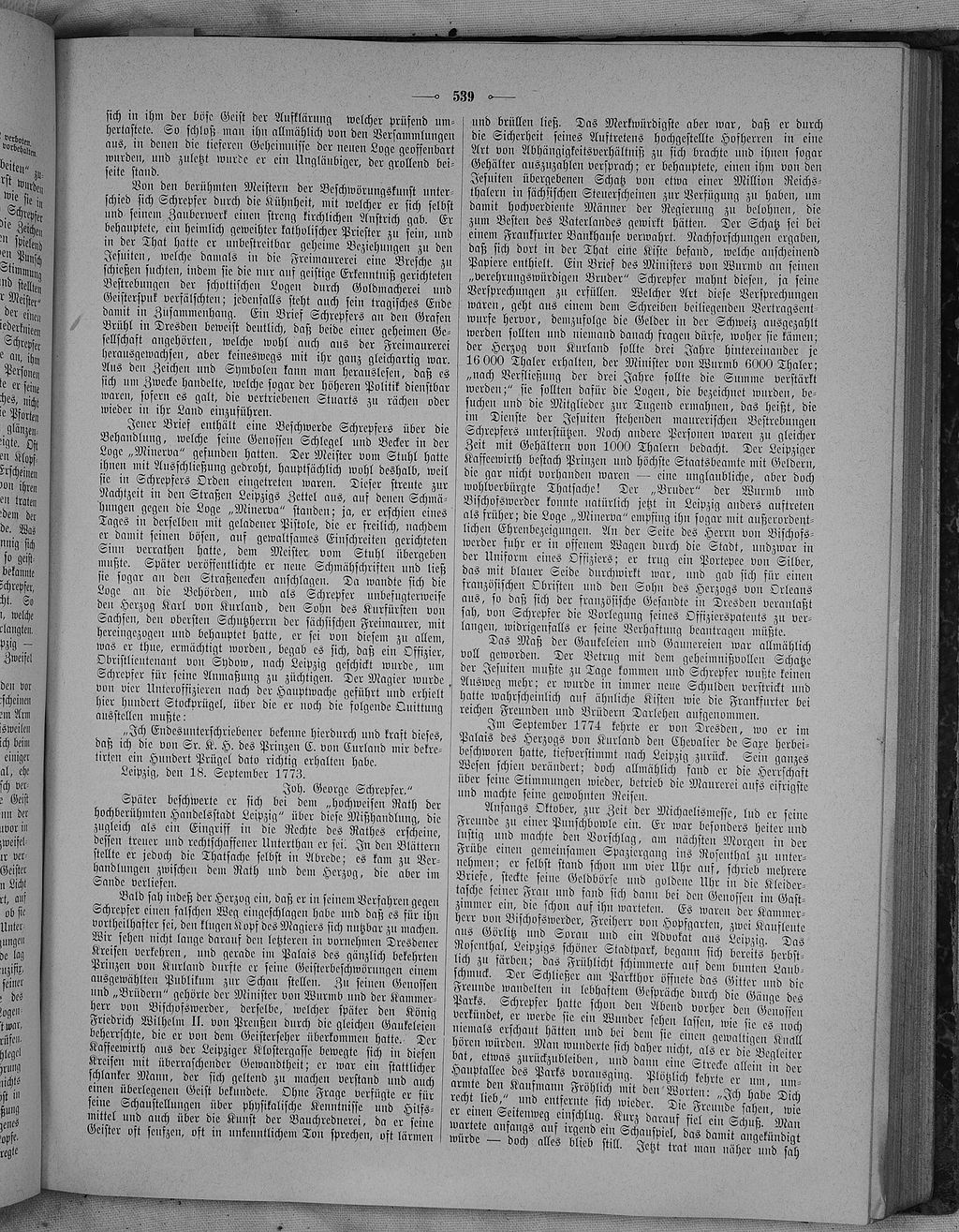| Verschiedene: Die Gartenlaube (1891) | |
|
|
sich in ihm der böse Geist der Aufklärung welcher prüfend umhertastete. So schloß man ihn allmählich von den Versammlungen aus, in denen die tieferen Geheimnisse der neuen Loge geoffenbart wurden, und zuletzt wurde er ein Ungläubiger, der grollend beiseite stand.
Von den berühmten Meistern der Beschwörungskunst unterschied sich Schrepfer durch die Kühnheit, mit welcher er sich selbst und seinem Zauberwerk einen streng kirchlichen Anstrich gab. Er behauptete, ein heimlich geweihter katholischer Priester zu sein, und in der That hatte er unbestreitbar geheime Beziehungen zu den Jesuiten, welche damals in die Freimaurerei eine Bresche zu schießen suchten, indem sie die nur auf geistige Erkenntniß gerichteten Bestrebungen der schottischen Logen durch Goldmacherei und Geisterspuk verfälschten; jedenfalls steht auch sein tragisches Ende damit in Zusammenhang. Ein Brief Schrepfers an den Grafen Brühl in Dresden beweist deutlich, daß beide einer geheimen Gesellschaft angehörten, welche wohl auch aus der Freimaurerei herausgewachsen, aber keineswegs mit ihr ganz gleichartig war. Aus den Zeichen und Symbolen kann man herauslesen, daß es sich um Zwecke handelte, welche sogar der höheren Politik dienstbar waren, sofern es galt, die vertriebenen Stuarts zu rächen oder wieder in ihr Land einzuführen.
Jener Brief enthält eine Beschwerde Schrepfers über die Behandlung, welche seine Genossen Schlegel und Becker in der Loge „Minerva“ gefunden hatten. Der Meister vom Stuhl hatte ihnen mit Ausschließung gedroht, hauptsächlich wohl deshalb, weil sie in Schrepfers Orden eingetreten waren. Dieser streute zur Nachtzeit in den Straßen Leipzigs Zettel aus, auf denen Schmähungen gegen die Loge „Minerva“ standen; ja, er erschien eines Tages in derselben mit geladener Pistole, die er freilich, nachdem er damit seinen bösen, auf gewaltsames Einschreiten gerichteten Sinn verrathen hatte, dem Meister vom Stuhl übergeben mußte. Später veröffentlichte er neue Schmähschriften und ließ sie sogar an den Straßenecken anschlagen. Da wandte sich die Loge an die Behörden, und als Schrepfer unbefugterweise den Herzog Karl von Kurland, den Sohn des Kurfürsten von Sachsen, den obersten Schutzherrn der sächsischen Freimaurer, mit hereingezogen und behauptet hatte, er sei von diesem zu allem, was er thue, ermächtigt worden, begab es sich, daß ein Offizier, Obristlieutenant von Sydow, nach Leipzig geschickt wurde, um Schrepfer für seine Anmaßung zu züchtigen. Der Magier wurde von vier Unteroffizieren nach der Hauptwache geführt und erhielt hier hundert Stockprügel, über die er noch die folgende Quittung ausstellen mußte:
„Ich Endesunterschriebener bekenne hierdurch und kraft dieses, daß ich die von Sr. K. H. des Prinzen C. von Curland mir dekretirten ein Hundert Prügel dato richtig erhalten habe.
Leipzig, den 18. September 1773.
Später beschwerte er sich bei dem „hochweisen Rath der hochberühmten Handelsstadt Leipzig“ über diese Mißhandlung, die zugleich als ein Eingriff in die Rechte des Rathes erscheine, dessen treuer und rechtschaffener Unterthan er sei. In den Blättern stellte er jedoch die Thatsache selbst in Abrede; es kam zu Verhandlangen zwischen dem Rath und dem Herzog, die aber im Sande verliefen.
Bald sah indeß der Herzog ein, daß er in seinem Verfahren gegen Schrepfer einen falschen Weg eingeschlagen habe und daß es für ihn vortheilhafter sei, den klugen Kopf des Magiers sich nutzbar zu machen. Wir sehen nicht lange darauf den letzteren in vornehmen Dresdener Kreisen verkehren, und gerade im Palais des gänzlich bekehrten Prinzen von Kurland durfte er seine Geisterbeschwörungen einem ausgewählten Publikum zur Schau stellen. Zu seinen Genossen und „Brüdern“ gehörte der Minister von Wurmb und der Kammerherr von Bischofswerder, derselbe, welcher später den König Friedrich Wilhelm II. von Preußen durch die gleichen Gaukeleien beherrschte, die er von dem Geisterseher überkommen hatte. Der Kaffeewirth aus der Leipziger Klostergasse bewegte sich in diesen Kreisen mit überraschender Gewandtheit; er war ein stattlicher schlanker Mann, der sich geltend zu machen verstand und auch einen überlegenen Geist bekundete. Ohne Frage verfügte er für seine Schaustellungen über physikalische Kenntnisse und Hilfsmittel und auch über die Kunst der Bauchrednerei, da er seine Geister oft seufzen, oft in unkenntlichem Ton sprechen, oft lärmen und brüllen ließ. Das Merkwürdigste aber war, daß er durch die Sicherheit seines Auftretens hochgestellte Hofherren in eine Art von Abhängigkeitsverhältniß zu sich brachte und ihnen sogar Gehälter auszuzahlen versprach; er behauptete, einen ihm von den Jesuiten übergebenen Schatz von etwa einer Million Reichsthalern in sächsischen Steuerscheinen zur Verfügung zu haben, um damit hochverdiente Männer der Regierung zu belohnen, die zum Besten des Vaterlandes gewirkt hätten. Der Schatz sei bei einem Frankfurter Bankhause verwahrt. Nachforschungen ergaben, daß sich dort in der That eine Kiste befand, welche anscheinend Papiere enthielt. Ein Brief des Ministers von Wurmb an seinen „verehrungswürdigen Bruder“ Schrepfer mahnt diesen, ja seine Versprechungen zu erfüllen. Welcher Art diese Versprechungen waren, geht aus einem dem Schreiben beiliegenden Vertragsentwurfe hervor, demzufolge die Gelder in der Schweiz ausgezahlt werden sollten und niemand danach fragen dürfe, woher sie kämen; der Herzog von Kurland sollte drei Jahre hintereinander je 16 000 Thaler erhalten, der Minister von Wurmb 6000 Thaler; „nach Verfließung der drei Jahre sollte die Summe verstärkt werden;“ sie sollten dafür die Logen, die bezeichnet wurden, besuchen und die Mitglieder zur Tugend ermahnen, das heißt, die im Dienste der Jesuiten stehenden maurerischen Bestrebungen Schrepfers unterstützen. Noch andere Personen waren zu gleicher Zeit mit Gehältern von 1000 Thalern bedacht. Der Leipziger Kaffeewirth bestach Prinzen und höchste Staatsbeamte mit Geldern, die gar nicht vorhanden waren – eine unglaubliche, aber doch wohlverbürgte Thatsache! Der „Bruder“ der Wurmb und Bischofswerder konnte natürlich jetzt in Leipzig anders auftreten als früher; die Loge „Minerva“ empfing ihn sogar mit außerordentlichen Ehrenbezeigungen. An der Seite des Herrn von Bischofswerder fuhr er in offenem Wagen durch die Stadt, und zwar in der Uniform eines Offiziers; er trug ein Portepee von Silber, das mit blauer Seide durchwirkt war, und gab sich für einen französischen Obristen und den Sohn des Herzogs von Orleans aus, so daß sich der französische Gesandte in Dresden veranlaßt sah, von Schrepfer die Vorlegung seines Offizierspatents zu verlangen, widrigenfalls er seine Verhaftung beantragen müßte.
Das Maß der Gaukeleien und Gaunereien war allmählich voll geworden. Der Betrug mit dem geheimnißvollen Schatze der Jesuiten mußte zu Tage kommen und Schrepfer wußte keinen Ausweg mehr; er wurde in immer neue Schulden verstrickt und hatte wahrscheinlich auf ähnliche Kisten wie die Frankfurter bei reichen Freunden und Brüdern Darlehen aufgenommen.
Im September 1774 kehrte er von Dresden, wo er im Palais des Herzogs von Kurland den Chevalier de Saxe herbeibeschworen hatte tiefverstimmt nach Leipzig zurück. Sein ganzes Wesen schien verändert; doch allmählich fand er die Herrschaft über seine Stimmungen wieder, betrieb die Maurerei aufs eifrigste und machte seine gewohnten Reisen.
Anfangs Oktober, zur Zeit der Michaelismesse, lud er seine Freunde zu einer Punschbowle ein. Er war besonders heiter und lustig und machte den Vorschlag, am nächsten Morgen in der Frühe einen gemeinsamen Spaziergang ins Rosenthal zu unternehmen; er selbst stand schon um vier Uhr auf, schrieb mehrere Briefe, steckte seine Geldbörse und goldene Uhr in die Kleidertasche seiner Frau und fand sich dann bei den Genossen im Gastzimmer ein, die schon auf ihn warteten. Es waren der Kammerherr von Bischofswerder, Freiherr von Hopfgarten, zwei Kaufleute aus Görlitz und Sorau und ein Advokat aus Leipzig. Das Rosenthal, Leipzigs schöner Stadtpark, begann sich bereits herbstlich zu färben; das Frühlicht schimmerte auf dem bunten Laubschmuck. Der Schließer am Parkthor öffnete das Gitter und die Freunde wandelten in lebhaftem Gespräche durch die Gänge des Parks. Schrepfer hatte schon den Abend vorher den Genossen verkündet, er werde sie ein Wunder sehen lassen, wie sie es noch niemals erschaut hätten und bei dem sie einen gewaltigen Knall hören würden. Man wunderte sich daher nicht, als er die Begleiter bat, etwas zurückzubleiben, und dann eine Strecke allein in der Hauptallee des Parks vorausging. Plötzlich kehrte er um, umarmte den Kaufmann Fröhlich mit den Worten. „Ich habe Dich recht lieb,“ und entfernte sich wieder. Die Freunde sahen, wie er einen Seitenweg einschlug. Kurz darauf fiel ein Schuß. Man wartete anfangs auf irgend ein Schauspiel, das damit angekündigt würde – doch alles blieb still. Jetzt trat man näher und sah
Verschiedene: Die Gartenlaube (1891).Leipzig: Ernst Keil, 1891, Seite 539. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1891)_539.jpg&oldid=- (Version vom 13.9.2023)