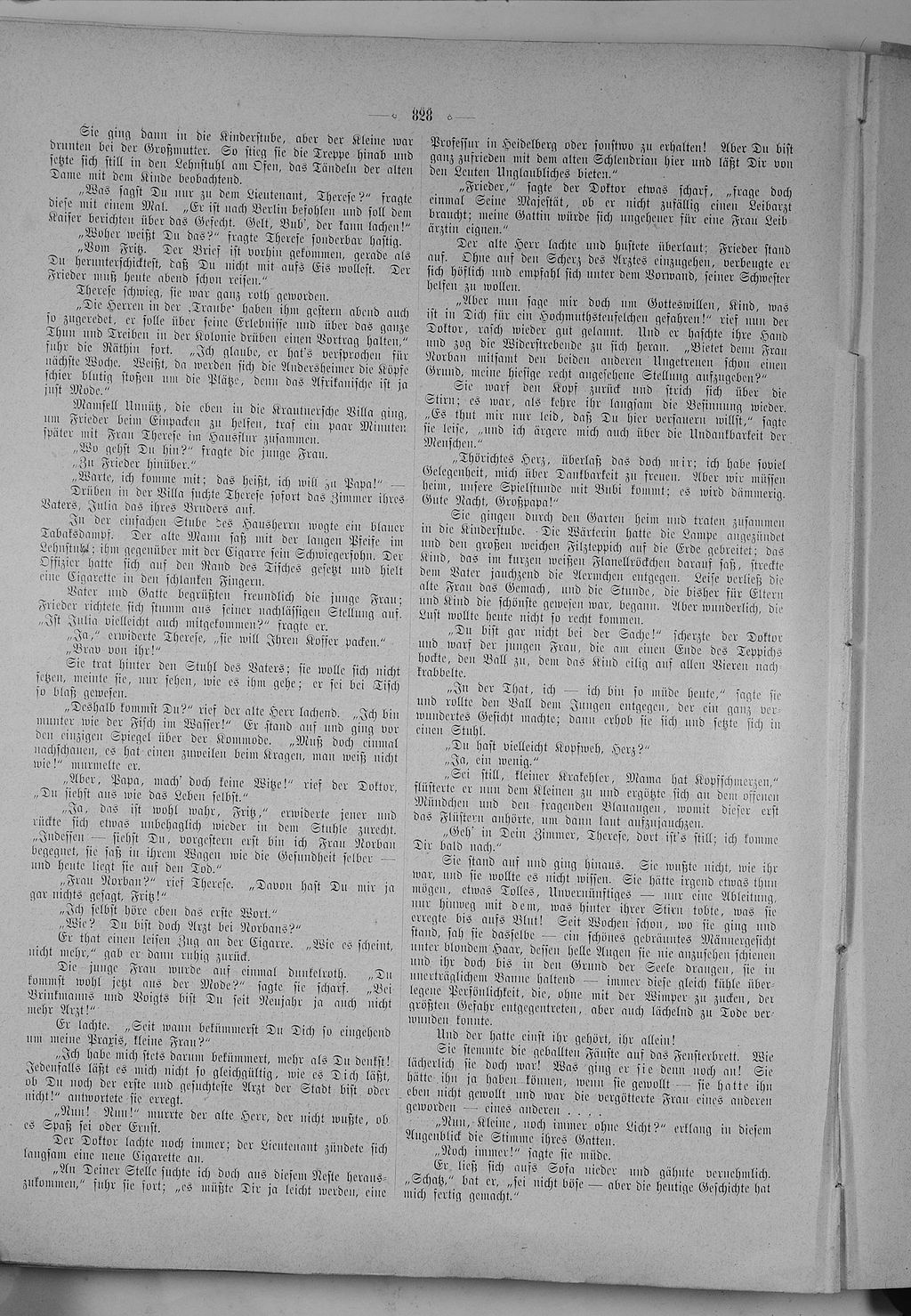| Verschiedene: Die Gartenlaube (1892) | |
|
|
Sie ging dann in die Kinderstube, aber der Kleine war drunten bei der Großmutter. So stieg sie die Treppe hinab und setzte sich still in den Lehnstuhl am Ofen, das Tändeln der alten Dame mit dem Kinde beobachtend.
„Was sagst Du nur zu dem Lieutenant, Therese?“ fragte diese mit einem Mal. „Er ist nach Berlin befohlen und soll dem Kaiser berichten über das Gefecht. Gelt, Bub’, der kann lachen!“
„Woher weißt Du das?“ fragte Therese sonderbar hastig.
„Vom Fritz. Der Brief ist vorhin gekommen, gerade als Du herunterschicktest, daß Du nicht mit aufs Eis wollest. Der Frieder muß heute abend schon reisen.“
Therese schwieg, sie war ganz roth geworden.
„Die Herren in der ‚Traube‘ haben ihm gestern abend auch so zugeredet, er solle über seine Erlebnisse und über das ganze Thun und Treiben in der Kolonie drüben einen Vortrag halten," fuhr die Räthin fort. „Ich glaube, er hat’s versprochen für nächste Woche. Weißt, da werden sich die Andersheimer die Köpfe schier blutig stoßen um die Plätze, denn das Afrikanische ist ja just Mode."
Mamsell Unnütz, die eben in die Krautnersche Villa ging, um Frieder beim Einpacken zu helfen, traf ein paar Minuten später mit Frau Therese im Hausflur zusammen.
„Wo gehst Du hin?“ fragte die junge Frau.
„Zu Frieder hinüber.“
„Warie, ich komme mit; das heißt, ich will zu Papa!“
Drüben in der Villa suchte Therese sofort das Zimmer ihres Vaters, Julia das ihres Bruders auf.
In der einfachen Stube des Hausherrn wogte ein blauer Tabaksdampf. Der alte Mann saß mit der langen Pfeife im Lehnstuhl; ihm gegenüber mit der Cigarre sein Schwiegersohn. Der Offizier hatte sich auf den Rand des Tisches gesetzt und hielt eine Cigarette in den schlanken Fingern.
Vater und Gatte begrüßten freundlich die junge Frau; Frieder richtete sich stumm aus seiner nachlässigen Stellung auf. „Ist Julia vielleicht auch mitgekommen?“ fragte er.
„Ja,“ erwiderte Therese, „sie will Ihren Koffer packen.“
„Brav von ihr!“
Sie trat hinter den Stuhl des Vaters; sie wolle sich nicht setzen, meinte sie, nur sehen, wie es ihm gehe; er sei bei Tisch so blaß gewesen.
„Deshalb kommst Du?“ rief der alte Herr lachend. „Ich bin munter wie der Fisch im Wasser!“ Er stand auf und ging vor den einzigen Spiegel über der Kommode. „Muß doch einmal nachschauen, es hat einen zuweilen beim Kragen, man weiß nicht wie!“ murmelte er.
„Aber, Papa, mach’ doch keine Witze!“ rief der Doktor, „Du siehst aus wie das Leben selbst.“
„Ja, das ist wohl wahr, Fritz,“ erwiderte jener und rückte sich etwas unbehaglich wieder in dem Stuhle zurecht. „Indessen – siehst Du, vorgestern erst bin ich Frau Norban begegnet, sie saß in ihrem Wagen wie die Gesundheit selber – und heute liegt sie auf den Tod.“
„Frau Norban?“ rief Therese. „Davon hast Du mir ja gar nichts gesagt, Fritz!“
„Ich selbst höre eben das erste Wort.“
„Wie? Du bist doch Arzt bei Norbans?“
Er that einen leisen Zug an der Cigarre. „Wie es scheint, nicht mehr,“ gab er dann ruhig zurück.
Die junge Frau wurde auf einmal dunkelroth. „Du kommst wohl jetzt aus der Mode?“ sagte sie scharf. „Bei Brinkmanns und Voigts bist Du seit Neujahr ja auch nicht mehr Arzt!“
Er lachte. „Seit wann bekümmerst Du Dich so eingehend um meine Praxis, kleine Frau?“
„Ich habe mich stets darum bekümmert, mehr als Du denkst! Jedenfalls läßt es mich nicht so gleichgültig, wie es Dich läßt, ob Du noch der erste und gesuchteste Arzt der Stadt bist oder nicht!“ antwortete sie erregt.
„Nun! Nun!“ murrte der alte Herr, der nicht wußte, ob es Spaß sei oder Ernst.
Der Doktor lachte noch immer; der Lieutenant zündete sich langsam eine neue Cigarette an.
„An Deiner Stelle suchte ich doch aus diesem Neste herauszukommen,“ fuhr sie fort; „es müßte Dir ja leicht werden, eine Professur in Heidelberg oder sonstwo zu erchalten. Aber Du bist ganz zufrieden mit dem alten Schlendrian hier und läßt Dir von den Leuten Unglaubliches bieten.“
„Frieder,“ sagte der Doktor etwas scharf, „frage doch einmal Seine Majestät, ob er nicht zufällig einen Leibarzt braucht; meine Gattin würde sich ungeheuer für eine Frau Leibärztin eignen.“
Der alte Herr lachte und hustete überlaut; Frieder stand auf. Ohne auf den Scherz des Arztes einzugehen, verbeugte er sich höflich und empfahl sich unter dem Vorwand, seiner Schwester helfen zu wollen.
„Aber nun sage mir doch um Gotteswillen, Kind, was ist in Dich für ein Hochmuthsteufelchen gefahren!“ rief nun der Doktor, rasch wieder gut gelaunt. Und er haschte ihre Hand und zog die Widerstrebende zu sich heran. „Bietet denn Frau Norban mitsamt den beiden anderen Ungetreuen schon einen Grund, meine hiesige recht angesehene Stellung aufzugeben?“
Sie warf den Kopf zurück und strich sich über die Stirn; es war, als kehre ihr langsam die Besinnung wieder. „Es thut mir nur leid, daß Du hier versauern willst,“ sagte sie leise, „und ich ärgere mich auch über die Undankbarkeit der Menschen.“
„Thörichtes Herz, überlaß das doch mir; ich habe soviel Gelegenheit, mich über Dankbarkeit zu freuen. Aber wir müssen heim, unsere Spielstunde mit Bubi kommt; es wird dämmerig. Gute Nacht, Großpapa!“
Sie gingen durch den Garten heim und traten zusammen in die Kinderstube. Die Wärterin hatte die Lampe angezündet und den großen weichen Filzteppich auf die Erde gebreitet; das Kind, das im kurzen weißen Flanellröckchen darauf saß, streckte dem Vater jauchzend die Aermchen entgegen. Leise verließ die alte Frau das Gemach, und die Stunde, die bisher für Eltern und Kind die schönste gewesen war, begann. Aber wunderlich, die Lust wollte heute nicht so recht kommen.
„Du bist gar nicht bei der Sache!“ scherzte der Doktor und warf der jungen Frau, die am einen Ende des Teppichs hockte, den Ball zu, dem das Kind eilig auf allen Vieren nachkrabbelte.
„In der That, ich – ich bin so müde heute,“ sagte sie und rollte den Ball dem Jungen entgegen, der ein ganz verwundertes Gesicht machte; dann erhob sie sich und setzte sich in einen Stuhl.
„Du hast vielleicht Kopfweh, Herz?“
„Ja, ein wenig.“
„Sei still, kleiner Krakehler, Mama hat Kopfschmerzen,“ flüsterte er nun dem Kleinen zu und ergötzte sich an dem offenen Mündchen und den fragenden Blauaugen, womit dieser erst das Flüstern anhörte, um dann laut aufzujauchzen.
„Geh’ in Dein Zimmer, Therese, dort ist’s still; ich komme Dir bald nach.“
Sie stand auf und ging hinaus. Sie wußte nicht, wie ihr war, und sie wollte es nicht wissen. Sie hätte irgend etwas thun mögen, etwas Tolles, Unvernünftiges – nur eine Ableitung, nur hinweg mit dem, was hinter ihrer Stirn tobte, was sie erregte bis aufs Blut! Seit Wochen schon, wo sie ging und stand, sah sie dasselbe – ein schönes gebräuntes Männergesicht unter blondem Haar, dessen helle Augen sie nie anzusehen schienen und ihr doch bis in den Grnnd der Seele drangen, sie in unerträglichem Banne haltend – immer diese gleich kühle überlegene Persönlichkeit, die, ohne mit der Wimper zu zucken, der größten Gefahr entgegentreten, aber auch lächelnd zu Tode verwunden konnte.
Und der hatte einst ihr gehört, ihr allein!
Sie stemmte die geballten Fäuste auf das Fensterbrett. Wie lächerlich sie doch war! Was ging er sie denn noch an! Sie hätte ihn ja haben können, wenn sie gewollt – sie hatte ihn eben nicht gewollt und war die vergötterte Frau eines anderen geworden – eines anderen ....
„Nun, Kleine, noch immer ohne Licht?“ erklang in diesem Augenblick die Stimme ihres Gatten.
„Noch immer!“ sagte sie müde.
Er ließ sich aufs Sofa nieder und gähnte vernehmlich. „Schatz,“ bat er, „sei nicht böse – aber die heutige Geschichte hat mich fertig gemacht.“
Verschiedene: Die Gartenlaube (1892). Leipzig: Ernst Keil, 1892, Seite 828. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1892)_828.jpg&oldid=- (Version vom 16.8.2022)