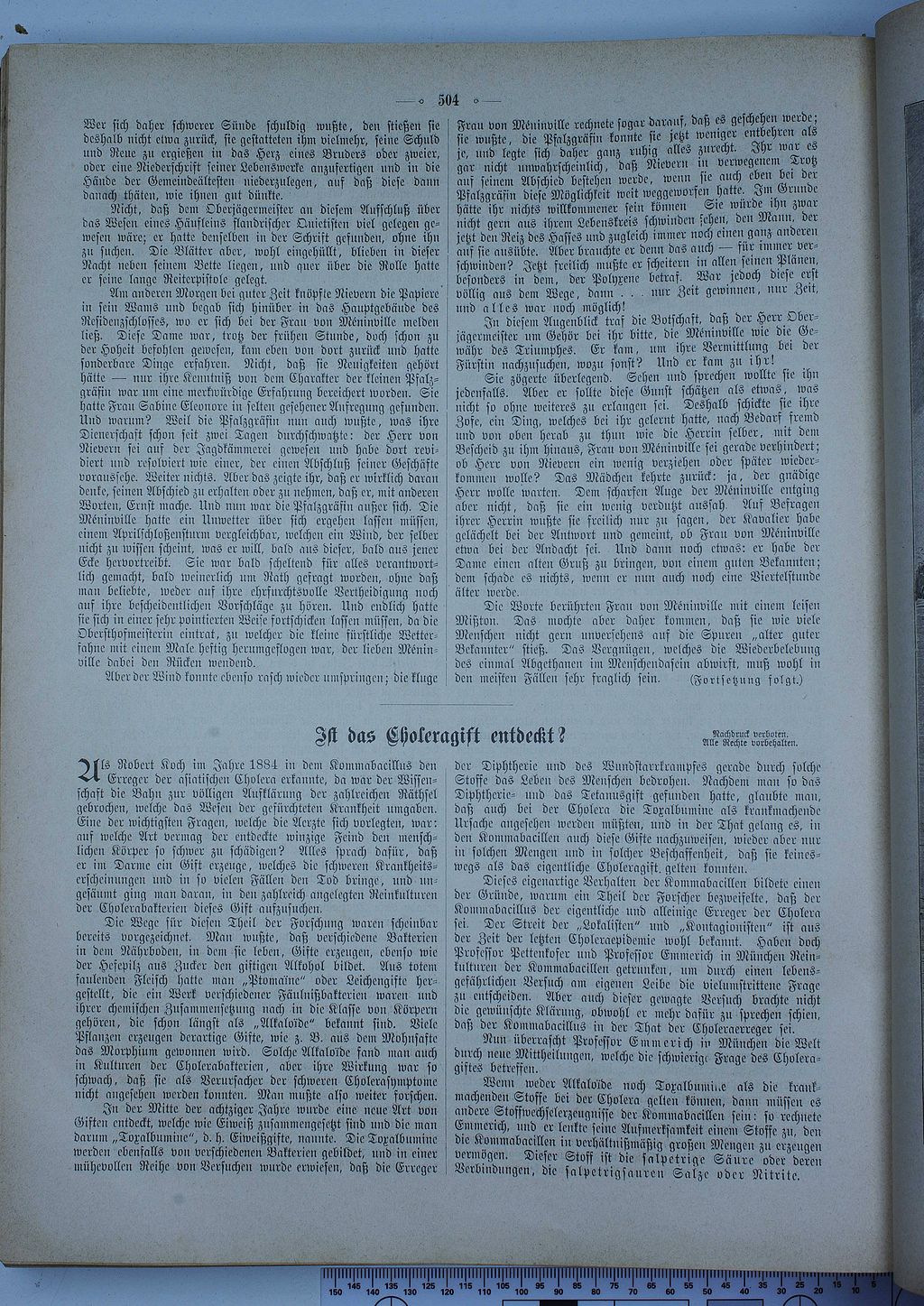| Verschiedene: Die Gartenlaube (1893) | |
|
|
Wer sich daher schwerer Sünde schuldig wußte, den stießen sie deshalb nicht etwa zurück, sie gestatteten ihm vielmehr, seine Schuld und Reue zu ergießen in das Herz eines Bruders oder zweier, oder eine Niederschrift seiner Lebenswerke anzufertigen und in die Hände der Gemeindeältesten niederzulegen, auf daß diese dann danach thäten, wie ihnen gut dünkte.
Nicht, daß dem Oberjägermeister an diesem Aufschluß über das Wesen eines Häufleins flandrischer Quietisten viel gelegen gewesen wäre; er hatte denselben in der Schrift gefunden, ohne ihn zu suchen. Die Blätter aber, wohl eingehüllt, blieben in dieser Nacht neben seinem Bette liegen, und quer über die Rolle hatte er seine lange Reiterpistole gelegt.
Am anderen Morgen bei guter Zeit knöpfte Nievern die Papiere in sein Wams und begab sich hinüber in das Hauptgebäude des Residenzschlosses, wo er sich bei der Frau von Méninville melden ließ. Diese Dame war, trotz der frühen Stunde, doch schon zu der Hoheit befohlen gewesen, kam eben von dort zurück und hatte sonderbare Dinge erfahren. Nicht, daß sie Neuigkeiten gehört hätte – nur ihre Kenntniß von dem Charakter der kleinen Pfalzgräfin war um eine merkwürdige Erfahrung bereichert worden. Sie hatte Frau Sabine Eleonore in selten gesehener Aufregung gefunden. Und warum? Weil die Pfalzgräfin nun auch wußte, was ihre Dienerschaft schon seit zwei Tagen durchschwatzte: der Herr von Nievern sei auf der Jagdkämmerei gewesen und habe dort revidiert und resolviert wie einer, der einen Abschluß seiner Geschäfte voraussehe. Weiter nichts. Aber das zeigte ihr, daß er wirklich daran denke, seinen Abschied zu erhalten oder zu nehmen, daß er, mit anderen Worten, Ernst mache. Und nun war die Pfalzgräfin außer sich. Die Méninville hatte ein Unwetter über sich ergehen lassen müssen, einem Aprilschloßensturm vergleichbar, welchen ein Wind, der selber nicht zu wissen scheint, was er will, bald aus dieser, bald aus jener Ecke hervortreibt. Sie war bald scheltend für alles verantwortlich gemacht, bald weinerlich um Rath gefragt worden, ohne daß man beliebte, weder auf ihre ehrfurchtsvolle Vertheidigung noch auf ihre bescheidentlichen Vorschläge zu hören. Und endlich hatte sie sich in einer sehr pointierten Weise fortschicken lassen müssen, da die Obersthofmeisterin eintrat, zu welcher die kleine fürstliche Wetterfahne mit einem Male heftig herumgeflogen war, der lieben Méninville dabei den Rücken wendend.
Aber der Wind konnte ebenso rasch wieder umspringen; die kluge Frau von Méninville rechnete sogar darauf, daß es geschehen werde; sie wußte, die Pfalzgräfin konnte sie jetzt weniger entbehren als je, und legte sich daher ganz ruhig alles zurecht. Ihr war es gar nicht unwahrscheinlich, daß Nievern in verwegenem Trotz auf seinem Abschied bestehen werde, wenn sie auch eben bei der Pfalzgräfin diese Möglichkeit weit weggeworfen hatte. Im Grunde hätte ihr nichts willkommener sein können. Sie würde ihn zwar nicht gern aus ihrem Lebenskreis schwinden sehen, den Mann, der jetzt den Reiz des Hasses und zugleich immer noch einen ganz anderen auf sie ausübte. Aber brauchte er denn das auch – für immer verschwinden? Jetzt freilich mußte er scheitern in allen seinen Plänen, besonders in dem, der Polyxene betraf. War jedoch diese erst völlig aus dem Wege, dann . . . nur Zeit gewinnen, nur Zeit, und alles war noch möglich!
In diesem Augenblick traf die Botschaft, das der Herr Oberjägermeister um Gehör bei ihr bitte, die Méninville wie die Gewähr des Triumphes. Er kam, um ihre Vermittlung bei der Fürstin nachzusuchen, wozu sonst? Und er kam zu ihr!
Sie zögerte überlegend. Sehen und sprechen wollte sie ihn jedenfalls. Aber er sollte diese Gunst schätzen als etwas, was nicht so ohne weiteres zu erlangen sei. Deshalb schickte sie ihre Zofe, ein Ding, welches bei ihr gelernt hatte, nach Bedarf fremd und von oben herab zu thun wie die Herrin selber, mit dem Bescheid zu ihm hinaus, Frau von Méninville sei gerade verhindert; ob Herr von Nievern ein wenig verziehen oder später wiederkommen wolle? Das Mädchen kehrte zurück: ja, der gnädige Herr wolle warten. Dem scharfen Auge der Méninville entging aber nicht, daß sie ein wenig verdutzt aussah. Auf Befragen ihrer Herrin wußte sie freilich nur zu sagen, der Kavalier habe gelächelt bei der Antwort und gemeint, ob Frau von Méninville etwa bei der Andacht sei. Und dann noch etwas: er habe der Dame einen alten Gruß zu bringen, von einem guten Bekannten; dem schade es nichts, wenn er nun auch noch eine Viertelstunde älter werde.
Die Worte berührten Frau von Méninville mit einem leisen Mißton. Das mochte aber daher kommen, daß sie wie viele Menschen nicht gern unversehens auf die Spuren „alter guter Bekannter“ stieß. Das Vergnügen, welches die Wiederbelebung des einmal Abgethanen im Menschendasein abwirft, muß wohl in den meisten Fällen sehr fraglich sein.
Ist das Choleragift entdeckt?
Als Robert Koch im Jahre 1884 in dem Kommabacillus den Erreger der asiatischen Cholera erkannte, da war der Wissenschaft die Bahn zur völligen Aufklärung der zahlreichen Räthsel gebrochen, welche das Wesen der gefürchteten Krankheit umgaben. Eine der wichtigsten Fragen, welche die Aerzte sich vorlegten, war: auf welche Art vermag der entdeckte winzige Feind den menschlichen Körper so schwer zu schädigen? Alles sprach dafür, daß er im Darme ein Gift erzeuge, welches die schweren Krankheitserscheinungen und in so vielen Fällen den Tod bringe, und ungesäumt ging man daran, in den zahlreich angelegten Reinkulturen der Cholerabakterien dieses Gift aufzusuchen.
Die Wege für diesen Theil der Forschung waren scheinbar bereits vorgezeichnet. Man wußte, daß verschiedene Bakterien in dem Nährboden, in dem sie leben, Gifte erzeugen, ebenso wie der Hefepilz aus Zucker den giftige Alkohol bildet. Aus totem faulenden Fleisch hatte man „Ptomaïne“ oder Leichengifte hergestellt, die ein Werk verschiedener Fäulnißbakterien waren und ihrer chemische Zusammensetzung nach in die Klasse von Körpern gehören, die schon längst als „Alkaloïde“ bekannt sind. Viele Pflanzen erzeugen derartige Gifte, wie z. B. aus dem Mohnsafte das Morphium gewonnen wird. Solche Alkaloïde fand man auch in Kulturen der Cholerabakterien, aber ihre Wirkung war so schwach, daß sie als Verursacher der schweren Cholerasymptome nicht angesehen werden konnten. Man mußte also weiter forschen.
In der Mitte der achtziger Jahre wurde eine neue Art von Giften entdeckt, welche wie Eiweiß zusammengesetzt sind und die man darum „Toxalbumine“, d. h. Eiweißgifte, nannte. Die Toxalbumine werden ebenfalls von verschiedenen Bakterien gebildet, und in einer mühevollen Reihe von Versuchen wurde erwiesen, daß die Erreger der Diphtherie und des Wundstarrkrampfes gerade durch solche Stoffe das Leben des Menschen bedrohen. Nachdem man so das Diphtherie- und das Tetanusgift gefunden hatte, glaubte man, daß auch bei der Cholera die Toxalbumine als krankmachende Ursache angesehen werden müßten, und in der That gelang es, in den Kommabacillen auch diese Gifte nachzuweisen, wieder aber nur in solchen Mengen und in solcher Beschaffenheit, daß sie keineswegs als das eigentliche Choleragift gelten konnten.
Dieses eigenartige Verhalten der Kommabacillen bildete einen der Gründe, warum ein Theil der Forscher bezweifelte, daß der Kommabacillus der eigentliche und alleinige Erreger der Cholera sei. Der Streit der „Lokalisten“ und „Kontagionisten“ ist aus der Zeit der letzten Choleraepidemie wohl bekannt. Haben doch Professor Pettenkofer und Professor Emmerich in München Reinkulturen der Kommabacillen getrunken, um durch einen lebensgefährlichen Versuch am eigenen Leibe die vielumstrittene Frage zu entscheiden. Aber auch dieser gewagte Versuch brachte nicht die gewünschte Klärung, obwohl er mehr dafür zu sprechen schien, daß der Kommabacillus in der That der Choleraerreger sei.
Nun überrascht Professor Emmerich in München die Welt durch neue Mittheilungen, welche die schwierige Frage des Choleragiftes betreffen.
Wenn weder Alkaloïde noch Toxalbumine als die krankmachenden Stoffe bei der Cholera gelten können, dann müssen es andere Stoffwechselerzeugnisse der Kommabacillen sein: so rechnete Emmerich, und er lenkte seine Aufmerksamkeit einem Stoffe zu, den die Kommabacillen in verhältnißmäßig große Mengen zu erzeugen vermögen. Dieser Stoff ist die salpetrige Säure oder deren Verbindungen, die salpetrigsauren Salze oder Nitrite.
Verschiedene: Die Gartenlaube (1893). Leipzig: Ernst Keil, 1893, Seite 504. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1893)_504.jpg&oldid=- (Version vom 21.8.2021)