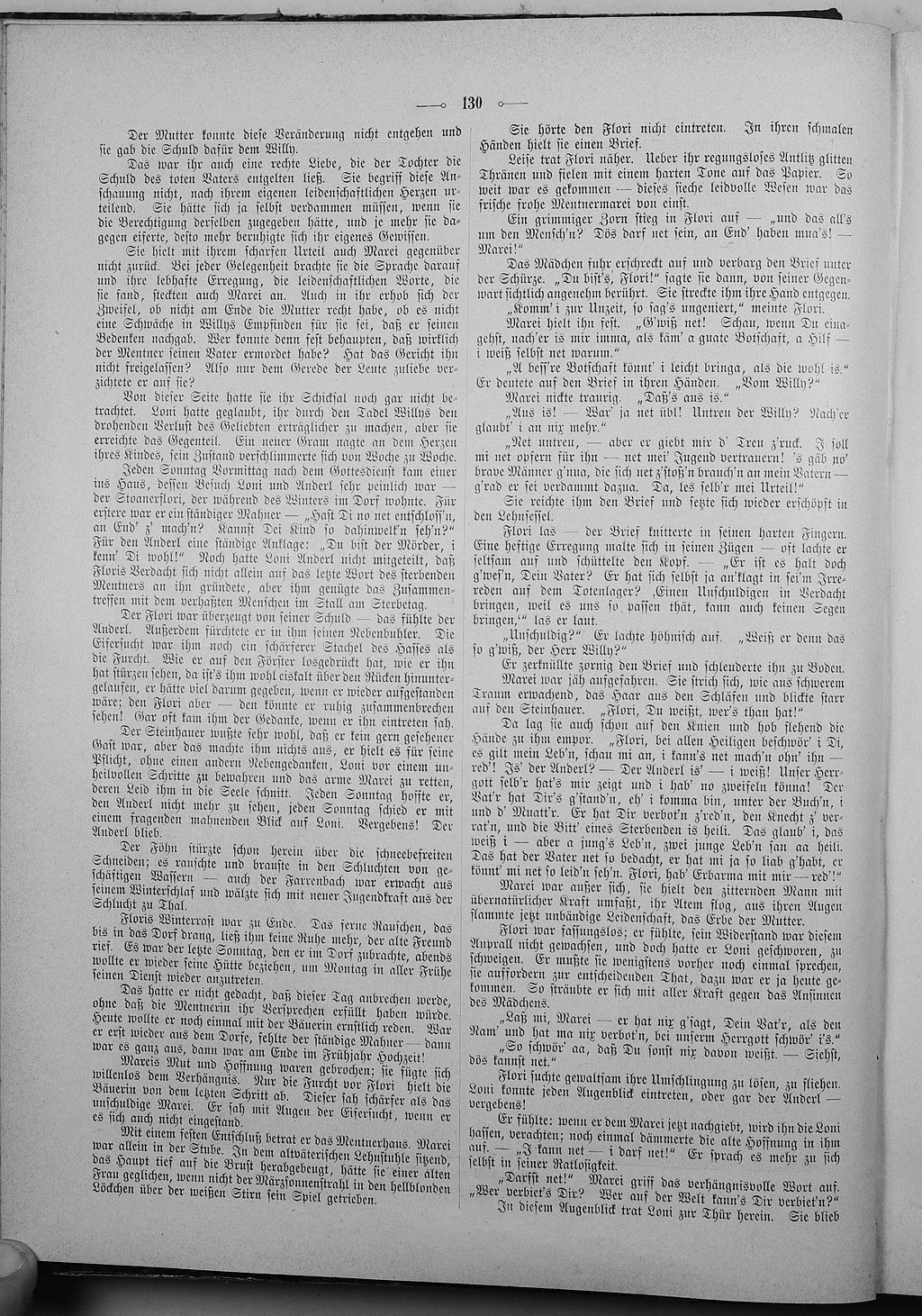| Verschiedene: Die Gartenlaube (1895) | |
|
|
Der Mutter konnte diese Veränderung nicht entgehen und sie gab die Schuld dafür dem Willy.
Das war ihr auch eine rechte Liebe, die der Tochter die Schuld des toten Vaters entgelten ließ. Sie begriff diese Anschauung nicht, nach ihrem eigenen leidenschaftlichen Herzen urteileud. Sie hätte sich ja selbst verdammen müssen, wenn sie die Berechtigung derselben zugegeben hätte, und je mehr sie dagegen eiferte, desto mehr beruhigte sich ihr eigenes Gewissen.
Sie hielt mit ihrem scharfen Urteil auch Marei gegenüber nicht zurück. Bei jeder Gelegenheit brachte sie die Sprache darauf und ihre lebhafte Erregung, die leidenschaftlichen Worte, die sie fand, steckten auch Marei an. Auch in ihr erhob sich der Zweifel, ob nicht am Ende die Mutter recht habe, ob es nicht eine Schwäche in Willys Empfinden für sie sei, daß er seinen Bedenken nachgab. Wer konnte denn fest behaupten, daß wirklich der Mentner seinen Vater ermordet habe? Hat das Gericht ihn nicht freigelassen? Also nur dem Gerede der Leute zuliebe verzichtete er auf sie?
Von dieser Seite hatte sie ihr Schicksal noch gar nicht betrachtet. Loni hatte geglaubt, ihr durch den Tadel Willys den drohenden Verlust des Geliebten erträglicher zu machen, aber sie erreichte das Gegenteil. Ein neuer Gram nagte an dem Herzen ihres Kindes, sein Zustand verschlimmerte sich von Woche zu Woche.
Jeden Sonntag Vormittag nach dem Gottesdienst kam einer ins Haus, dessen Besuch Loni und Anderl sehr peinlich war – der Stoanerflori, der während des Winters im Dorf wohnte. Für erstere war er ein ständiger Mahner – „Hast Di no net entschloss’n, an End’ z’ mach’n? Kannst Dei Kind so dahinwelk’n seh’n?“ Für den Anderl eine ständige Anklage: „Du bist der Mörder, i kenn’ Di wohl!“ Noch hatte Loni Anderl nicht mitgeteilt, daß Floris Verdacht sich nicht allein auf das letzte Wort des sterbenden Mentners an ihn gründete, aber ihm genügte das Zusammentreffen mit dem verhaßten Menschen im Stall am Sterbetag.
Der Flori war überzeugt von seiner Schuld – das fühlte der Anderl. Außerdem fürchtete er in ihm seinen Nebenbuhler. Die Eifersucht war ihm noch ein schärferer Stachel des Hasses als die Furcht. Wie er auf den Förster losgedrückt hat, wie er ihn hat stürzen sehen, da ist’s ihm wohl eiskalt über den Rücken hinuntergelaufen, er hätte viel darum gegeben, wenn er wieder aufgestanden wäre, den Flori aber – den könnte er ruhig zusammenbrechen sehen! Gar oft kam ihm der Gedanke, wenn er ihn eintreten sah.
Der Steinhauer wußte sehr wohl, daß er kein gern gesehener Gast war, aber das machte ihm nichts aus, er hielt es für seine Pflicht, ohne einen andern Nebengedanken, Loni vor einem unheilvollen Schritte zu bewahren und das arme Marei zu retten, deren Leid ihm in die Seele schnitt. Jeden Sonntag hoffte er, den Anderl nicht mehr zu sehen, jeden Sonntag schied er mit einem fragenden mahnenden Blick auf Loni. Vergebens! Der Anderl blieb.
Der Föhn stürzte schon herein über die schneebefreiten Schneiden; es rauschte und brauste in den Schluchten von geschäftigen Wassern – auch der Farrenbach war erwacht aus seinem Winterschlaf und wälzte sich mit neuer Jugendkraft aus der Schlucht zu Thal.
Floris Winterrast war zu Ende. Das ferne Rauschen, das bis in das Dorf drang, ließ ihm keine Ruhe mehr, der alte Freund rief. Es war der letzte Sonntag, den er im Dorf zubrachte, abends wollte er wieder seine Hütte beziehen, um Montag in aller Frühe seinen Dienst wieder anzutreten.
Das hatte er nicht gedacht, daß dieser Tag anbrechen werde, ohne daß die Mentnerin ihr Versprechen erfüllt haben würde. Heute wollte er noch einmal mit der Bäuerin ernstlich reden. War er erst wieder aus dem Dorfe, fehlte der ständige Mahner – dann war es ganz aus, dann war am Ende im Frühjahr Hochzeit!
Mareis Mut und Hoffnung waren gebrochen, sie fügte sich willenlos dem Verhängnis. Nur die Furcht vor Flori hielt die Bäuerin von dem letzten Schritt ab. Dieser sah schärfer als das unschuldige Marei. Er sah mit Augen der Eifersucht, wenn er es sich auch nicht eingestand.
Mit einem festen Entschluß betrat er das Mentnerhaus. Marei war allein in der Stube. In dem altväterischen Lehnstuhle sitzend, das Haupt tief auf die Brust herabgebeugt, hätte sie einer alten Frau geglichen, wenn nicht der Märzsonnenstrahl in den hellblonden Löckchen über der weißen Stirn sein Spiel getrieben.
Sie hörte den Flori nicht eintreten. In ihren schmalen Händen hielt sie einen Brief.
Leise trat Flori näher. Ueber ihr regungsloses Antlitz glitten Thränen und fielen mit einem harten Tone auf das Papier. So weit war es gekommen – dieses sieche leidvolle Wesen war das frische frohe Mentnermarei von einst.
Ein grimmiger Zorn stieg in Flori auf – „und das all’s um den Mensch’n? Dös darf net sein, an End’ haben mua’s! – Marei!“
Das Mädchen fuhr erschreckt auf und verbarg den Brief unter der Schürze. „Du bist’s, Flori!“ sagte sie dann, von seiner Gegenwart sichtlich angenehm berührt. Sie streckte ihm ihre Hand entgegen.
„Komm’ i zur Unzeit, so sag’s ungeniert,“ meinte Flori.
Marei hielt ihn fest. „G’wiß net! Schau, wenn Du einagehst, nach’er is mir imma, als käm’ a guate Botschaft, a Hilf – i weiß selbst net warum.“
„A bess’re Botschaft könnt’ i leicht bringa, als die wohl is.“ Er deutete auf den Brief in ihren Händen. „Vom Willy?“
Marei nickte traurig. „Daß’s aus is.“
„Aus is! –- War’ ja net übl! Untreu der Willy? Nach’er glaubt’ i an nix mehr.“
„Net untreu, – aber er giebt mir d’ Treu z’ruck. I soll mi net opfern für ihn – net mei’ Jugend vertrauern! ’s gäb no’ brave Männer g’nua, die sich net z’stoß’n brauch’n an mein Vatern – g’rad er sei verdammt dazua. Da, les selb’r mei Urteil!“
Sie reichte ihm den Brief und setzte sich wieder erschöpft in den Lehnsessel.
Flora las – der Brief knitterte in seinen harten Fingern. Eine heftige Erregung malte sich in seinen Zügen – oft lachte er seltsam auf und schüttelte den Kopf. – „Er ist es halt doch g’wes’n, Dein Vater? Er hat sich selbst ja anklagt in sei’m Irrereden auf dem Totenlager? ‚Einen Unschuldigen in Verdacht bringen, weil es uns so passen thät, kann auch keinen Segen bringen,‘“ las er laut.
„Unschuldig?“ Er lachte höhnisch auf. „Weiß er denn das so g’wiß, der Herr Willy?“
Er zerknüllte zornig den Brief und schleuderte ihn zu Boden.
Marei war jäh aufgefahren. Sie strich sich, wie aus schwerem Traum erwachend, das Haar aus den Schläfen und blickte starr auf den Steinhauer. „Flori, Du weißt, wer’s than hat!“
Da lag sie auch schon auf den Knien und hob flehend die Hände zu ihm empor. „Flori, bei allen Heiligen beschwör’ i Di, es gilt mein Leb’n, schau mi an, i kann’s net mach’n ohn’ ihn – red’! Is’ der Anderl? – Der Anderl is’ – i weiß! Unser Herrgott selb’r hat’s mir zeigt und i hab’ no zweifeln könna! Der Vat’r hat Dir’s g’stand’n, eh’ i komma bin, unter der Buch’n, i und d’ Muatt’r. Er hat Dir verbot’n z’red’n, den Knecht z’ verrat’n und die Bitt’ eines Sterbenden is heili. Das glaub’ i, das weiß i – aber a jung’s Leb’n, zwei junge Leb’n san aa heili. Das hat der Vater net so bedacht, er hat mi ja so liab g’habt, er könnt’ mi net so leid’n seh’n. Flori, hab’ Erbarma mit mir – red’!“
Marei war außer sich, sie hielt den zitternden Mann mit übernatürlicher Kraft umfaßt, ihr Atem flog, aus ihren Augen flammte jetzt unbändige Leidenschaft, das Erbe der Mutter.
Flori war fassungslos, er fühlte, sein Widerstand war diesem Anprall nicht gewachsen und doch hatte er Loni geschworen, zu schweigen. Er mußte sie wenigsteus vorher noch einmal sprechen, sie auffordern zur entscheidenden That, dazu war er ja heute gekommen. So sträubte er sich mit aller Kraft gegen das Ansinnen des Mädchens.
„Laß mi, Marei – er hat nix g’sagt, Dein Vat’r, als den Nam’ und hat ma nix verbot’n, bei unserm Herrgott schwör’ i’s.“
„So schwör’ aa, daß Du sonst nix davon weißt. – Siehst, dös kannst net.“
Flori suchte gewaltsam ihre Umschlingung zu lösen, zu fliehen. Loni konnte jeden Augenblick eintreten, oder gar der Anderl – vergebens!
Er fühlte: wenn er dem Marei jetzt nachgiebt, wird ihn die Loni hassen, verachten; noch einmal dämmerte die alte Hoffnung in ihm auf. – „I kann net – i darf net!“ Er sprach es mehr zu sich selbst in seiner Ratlosigkeit.
„Darfst net!“ Marei griff das verhängnisvolle Wort auf. „Wer verbiet’s Dir? Wer auf der Welt kann’s Dir verbiet’n?“
In diesem Augenblick trat Loni zur Thür herein. Sie blieb
Verschiedene: Die Gartenlaube (1895). Leipzig: Ernst Keil, 1895, Seite 130. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1895)_130.jpg&oldid=- (Version vom 12.7.2020)