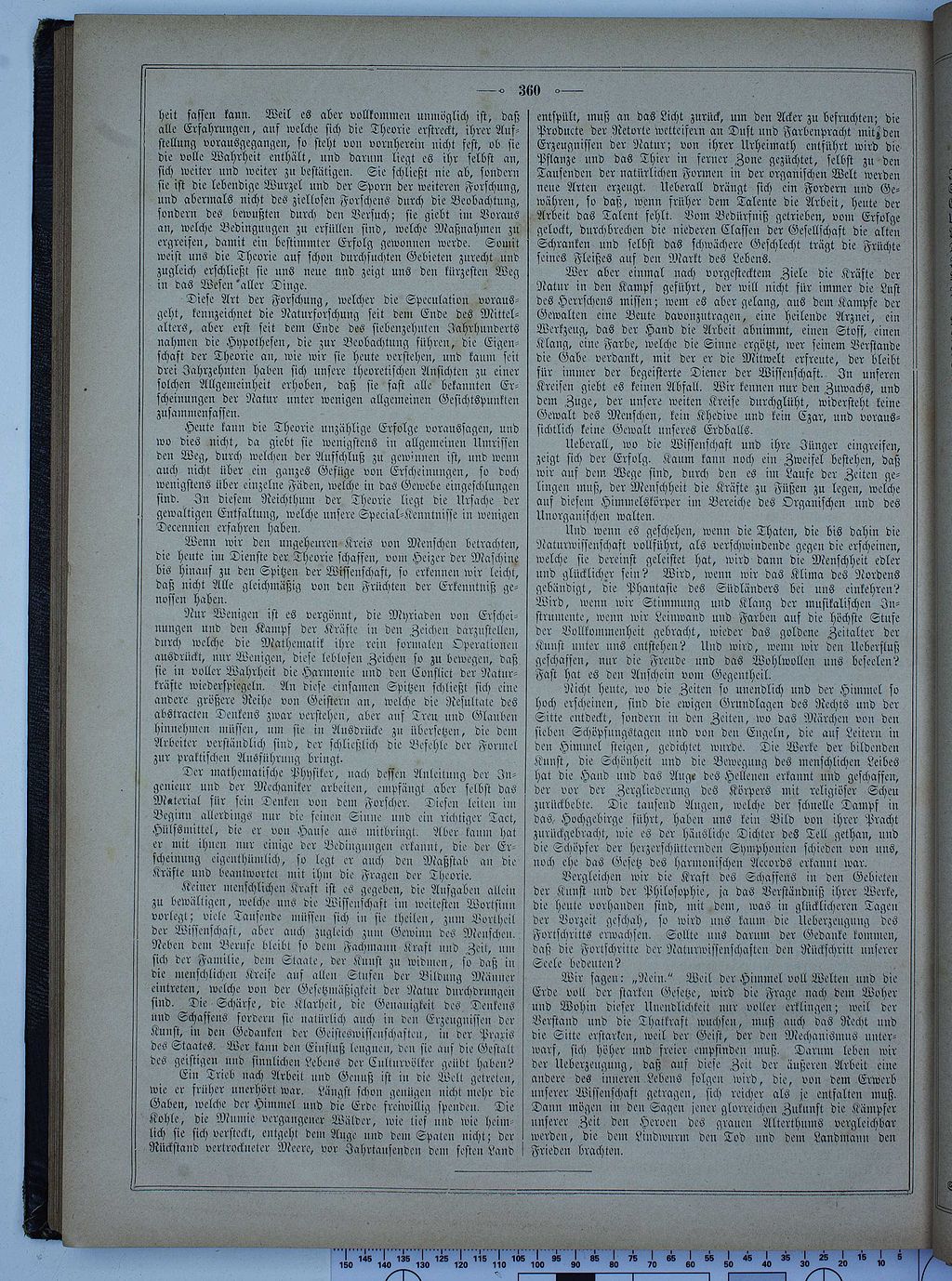| Verschiedene: Die Gartenlaube (1870) | |
|
|
fassen kann. Weil es aber vollkommen unmöglich ist, daß alle Erfahrungen, auf welche sich die Theorie erstreckt, ihrer Aufstellung vorausgegangen, so steht von vornherein nicht fest, ob sie die volle Wahrheit enthält, und darum liegt es ihr selbst an, sich weiter und weiter zu bestätigen. Sie schließt nie ab, sondern sie ist die lebendige Wurzel und der Sporn der weiteren Forschung, und abermals nicht des ziellosen Forschens durch die Beobachtung, sondern des bewußten durch den Versuch; sie giebt im Voraus an, welche Bedingungen zu erfüllen sind, welche Maßnahmen zu ergreifen, damit ein bestimmter Erfolg gewonnen werde. Somit weist uns die Theorie auf schon durchsuchten Gebieten zurecht und zugleich erschließt sie uns neue und zeigt uns den kürzesten Weg in das Wesen aller Dinge.
Diese Art der Forschung, welcher die Speculation vorausgeht, kennzeichnet die Naturforschung seit dem Ende des Mittelalters, aber erst seit dem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts nahmen die Hypothesen, die zur Beobachtung führen, die Eigenschaft der Theorie an, wie wir sie heute verstehen, und kaum seit drei Jahrzehnten haben sich unsere theoretischen Ansichten zu einer solchen Allgemeinheit erhoben, daß sie fast alle bekannten Erscheinungen der Natur unter wenigen allgemeinen Gesichtspunkten zusammenfassen.
Heute kann die Theorie unzählige Erfolge voraussagen, und wo dies nicht, da giebt sie wenigstens in allgemeinen Umrissen den Weg, durch welchen der Aufschluß zu gewinnen ist, und wenn auch nicht über ein ganzes Gefüge von Erscheinungen, so doch wenigstens über einzelne Fäden, welche in das Gewebe eingeschlungen sind. In diesem Reichthum der Theorie liegt die Ursache der gewaltigen Entfaltung, welche unsere Special-Kenntnisse in wenigen Decennien erfahren haben.
Wenn wir den ungeheuren Kreis von Menschen betrachten, die heute im Dienste der Theorie schaffen, vom Heizer der Maschine bis hinauf zu den Spitzen der Wissenschaft, so erkennen wir leicht, daß nicht Alle gleichmäßig von den Früchten der Erkenntniß genossen haben.
Nur Wenigen ist es vergönnt, die Myriaden von Erscheinungen und den Kampf der Kräfte in den Zeichen darzustellen, durch welche die Mathematik ihre rein formalen Operationen ausdrückt, nur Wenigen, diese leblosen Zeichen so zu bewegen, daß sie in voller Wahrheit die Harmonie und den Conflict der Naturkräfte wiederspiegeln. An diese einsamen Spitzen schließt sich eine andere größere Reihe von Geistern an, welche die Resultate des abstracten Denkens zwar verstehen, aber auf Treu und Glauben hinnehmen müssen, um sie in Ausdrücke zu übersetzen, die dem Arbeiter verständlich sind, der schließlich die Befehle der Formel zur praktischen Ausführung bringt.
Der mathematische Physiker, nach dessen Anleitung der Ingenieur und der Mechaniker arbeiten, empfängt aber selbst das Material für sein Denken von dem Forscher. Diesen leiten im Beginn allerdings nur die feinen Sinne und ein richtiger Tact, Hülfsmittel, die er von Hause aus mitbringt. Aber kaum hat er mit ihnen nur einige der Bedingungen erkannt, die der Erscheinung eigenthümlich, so legt er auch den Maßstab an die Kräfte und beantwortet mit ihm die Fragen der Theorie.
Keiner menschlichen Kraft ist es gegeben, die Aufgaben allein zu bewältigen, welche uns die Wissenschaft im weitesten Wortsinn vorlegt; viele Tausende müssen sich in sie theilen, zum Vortheil der Wissenschaft, aber auch zugleich zum Gewinn des Menschen. Neben dem Berufe bleibt so dem Fachmann Kraft und Zeit, um sich der Familie, dem Staate, der Kunst zu widmen, so daß in die menschlichen Kreise auf allen Stufen der Bildung Männer eintreten, welche von der Gesetzmäßigkeit der Natur durchdrungen sind. Die Schärfe, die Klarheit, die Genauigkeit des Denkens und Schaffens fordern sie natürlich auch in den Erzeugnissen der Kunst, in den Gedanken der Geisteswissenschaften, in der Praxis des Staates. Wer kann den Einfluß leugnen, den sie auf die Gestalt des geistigen und sinnlichen Lebens der Culturvölker geübt haben?
Ein Trieb nach Arbeit und Genuß ist in die Welt getreten, wie er früher unerhört war. Längst schon genügen nicht mehr die Gaben, welche der Himmel und die Erde freiwillig spenden. Die Kohle, die Mumie vergangener Wälder, wie tief und wie heimlich sie sich versteckt, entgeht dem Auge und dem Spaten nicht; der Rückstand vertrockneter Meere, vor Jahrtausenden dem festen Land entspült, muß an das Licht zurück, um den Acker zu befruchten; die Producte der Retorte wetteifern an Duft und Farbenpracht mit den Erzeugnissen der Natur; von ihrer Urheimath entführt wird die Pflanze und das Thier in ferner Zone gezüchtet, selbst zu den Tausenden der natürlichen Formen in der organischen Welt werden neue Arten erzeugt. Ueberall drängt sich ein Fordern und Gewähren, so daß, wenn früher dem Talente die Arbeit, heute der Arbeit das Talent fehlt. Vom Bedürfniß getrieben, vom Erfolge gelockt, durchbrechen die niederen Classen der Gesellschaft die alten Schranken und selbst das schwächere Geschlecht trägt die Früchte seines Fleißes auf den Markt des Lebens.
Wer aber einmal nach vorgestecktem Ziele die Kräfte der Natur in den Kampf geführt, der will nicht für immer die Lust des Herrschens missen; wem es aber gelang, aus dem Kampfe der Gewalten eine Beute davonzutragen, eine heilende Arznei, ein Werkzeug, das der Hand die Arbeit abnimmt, einen Stoff, einen Klang, eine Farbe, welche die Sinne ergötzt, wer seinem Verstande die Gabe verdankt, mit der er die Mitwelt erfreute, der bleibt für immer der begeisterte Diener der Wissenschaft. In unseren Kreisen giebt es keinen Abfall. Wir kennen nur den Zuwachs, und dem Zuge, der unsere weiten Kreise durchglüht, widersteht keine Gewalt des Menschen, kein Khedive und kein Czar, und voraussichtlich keine Gewalt unseres Erdballs.
Ueberall, wo die Wissenschaft und ihre Jünger eingreifen, zeigt sich der Erfolg. Kaum kann noch ein Zweifel bestehen, daß wir auf dem Wege sind, durch den es im Laufe der Zeiten gelingen muß, der Menschheit die Kräfte zu Füßen zu legen, welche auf diesem Himmelskörper im Bereiche des Organischen und des Unorganischen walten.
Und wenn es geschehen, wenn die Thaten, die bis dahin die Naturwissenschaft vollführt, als verschwindende gegen die erscheinen, welche sie dereinst geleistet hat, wird dann die Menschheit edler und glücklicher sein? Wird, wenn wir das Klima des Nordens gebändigt, die Phantasie des Südländers bei uns einkehren? Wird, wenn wir Stimmung und Klang der musikalischen Instrumente, wenn wir Leinwand und Farben auf die höchste Stufe der Vollkommenheit gebracht, wieder das goldene Zeitalter der Kunst unter uns entstehen? Und wird, wenn wir den Ueberfluß geschaffen, nur die Freude und das Wohlwollen uns beseelen? Fast hat es den Anschein vom Gegentheil.
Nicht heute, wo die Zeiten so unendlich und der Himmel so hoch erscheinen, sind die ewigen Grundlagen des Rechts und der Sitte entdeckt, sondern in den Zeiten, wo das Märchen von den sieben Schöpfungstagen und von den Engeln, die auf Leitern in den Himmel steigen, gedichtet wurde. Die Werke der bildenden Kunst, die Schönheit und die Bewegung des menschlichen Leibes hat die Hand und das Auge des Hellenen erkannt und geschaffen, der vor der Zergliederung des Körpers mit religiöser Scheu zurückbebte. Die tausend Augen, welche der schnelle Dampf in das Hochgebirge führt, haben uns kein Bild von ihrer Pracht zurückgebracht, wie es der häusliche Dichter des Tell gethan und die Schöpfer der herzerschütternden Symphonien schieden von uns, noch ehe das Gesetz des harmonischen Accords erkannt war.
Vergleichen wir die Kraft des Schaffens in den Gebieten der Kunst und der Philosophie, ja das Verständniß ihrer Werke, die heute vorhanden sind, mit dem, was in glücklicheren Tagen der Vorzeit geschah, so wird uns kaum die Ueberzeugung des Fortschritts erwachsen. Sollte uns darum der Gedanke kommen, daß die Fortschritte der Naturwissenschaften den Rückschritt unserer Seele bedeuten?
Wir sagen: „Nein.“ Weil der Himmel voll Welten und die Erde voll der starken Gesetze, wird die Frage nach dem Woher und Wohin dieser Unendlichkeit nur voller erklingen; weil der Verstand und die Thatkraft wuchsen, muß auch das Recht und die Sitte erstarken, weil der Geist, der den Mechanismus unterwarf, sich höher und freier empfinden muß. Darum leben wir der Ueberzeugung, daß auf diese Zeit der äußeren Arbeit eine andere des inneren Lebens folgen wird, die, von dem Erwerb unserer Wissenschaft getragen, sich reicher als je entfalten muß. Dann mögen in den Sagen jener glorreichen Zukunft die Kämpfer unserer Zeit den Heroen des grauen Alterthums vergleichbar werden, die dem Lindwurm den Tod und dem Landmann den Frieden brachten.
Verschiedene: Die Gartenlaube (1870). Leipzig: Ernst Keil, 1870, Seite 360. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1870)_360.jpg&oldid=- (Version vom 9.9.2019)