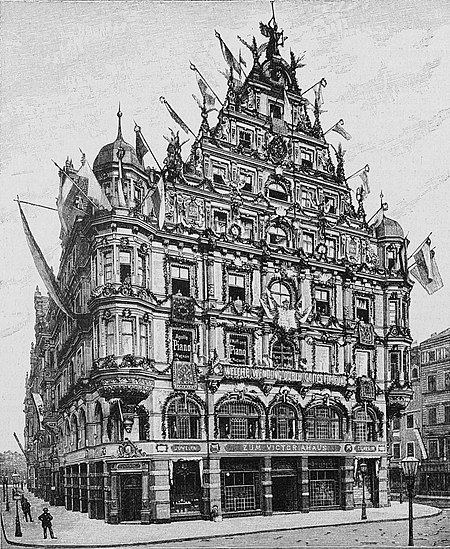Die Gartenlaube (1895)/Heft 41
[689]
| Nr. 41. | 1895. | |
Die Lampe der Psyche.
(1. Fortsetzung.)
Wenn man den Plan der Residenzstadt Leopoldsburg besah, wie er in den Buchhändlerläden aushing, glich er einer grauen Fläche, die von schmalen, weißen Zickzacklinien beinahe verworren durchschossen war. Sie bezeichneten das Durcheinander der Gassen und Gäßchen. Dazwischen lief eine blaue, sanft geschwungene Linie. Das war der Fluß, der die altertümliche Stadt in ungleiche Hälften schnitt. Ein Vorfahr des Herzogs hatte über das bescheidene, flache, in kleinen Wirbeln schnell dahin quirlende Wasser eine sehr anspruchsvolle Brücke bauen lassen. Ihr schwerfälliger Bogen war mit Griechengöttern geschmückt, die ihre runden Muskulaturen recht unverhüllt zeigten. Man sagte, die Herzogin ärgere sich heimlich über diese „Puppen“, wie sie im Volksmund genannt wurden. Allein der Geschmack des Vorfahren mußte respektiert werden und die Herzogin begnügte sich zu sagen, daß die Bildhauer der Rokokozeit „eigenartige“ Künstler gewesen seien. Am nördlichen Ufer des Flüßchens, geradeswegs von der Brücke aus, lag das herzogliche Schloß, ein etwas nüchterner Bau, den des Herzogs Vater ausgeführt. Die prächtigen Anlagen vor dem Schloß, wo ehedem in geradlinigen Reihen Linden gestanden, war eine Schöpfung des Herzogs selbst. Draußen um die Stadt herum zog sich die Ringstraße, eine moderne, boulevardartige Anlage, wo ein Luxuswohnbau neben dem andern inmitten kleiner Gärten lag. An dieser Ringstraße lag auch das Opernhaus, für welches in der Stadt selbst kein Raum gewesen; das frühere, alte Hoftheater war in ein Verwaltungsgebäude verwandelt worden, seine nüchterne Front hatte es ohnedies kaum von den Häusern rechts und links unterschieden. An der Ringstraße wohnte beinahe auch die ganze „Gesellschaft“ von Leopoldsburg, soweit dieselbe nicht Beamtenwohnungen innehatte.
Hinter den Gärten der Ringstraße aber begannen schon die waldigen Vorhügel des nahen Bergzuges, so daß die Residenz von einem hohen, grünen Kranz wie umrahmt war.
Hortense von Eschen besaß ein Palais am Schloßplatz. Es war kein Eschensches Erbe, sie hatte als kinderlose Witwe des ältesten Eschen alle Rechte auf den jüngeren Bruder ihres früheren Gatten übergehen lassen müssen. Der Besitz kam ihr von ihrem Vater und nach ihm behielt es den Namen „das Trachsche Haus“. Das Erdgeschoß hatte sie an den Oberst [690] von Waldheim, den Kommandeur des in Leopoldsburg garnisonierenden Regiments, vermietet, und somit befand sich ein Wachtposten und ein Schilderhaus neben ihrem Hausthor, was ihr sehr wohlgefiel.
Im ersten Stockwerk hatte sie in den großen Sälen und Gemächern alles aufgestapelt, was ihr aus der gräflich Trachschen und der Familie Eschen an Möbeln, Bildern und Silber zugekommen war und was ihr eigenes, nicht geringes Luxusbedürfnis im Lauf der Zeit hinzugetragen. Dies alles, sowie der Besitz des Hauses selbst machte sie sehr ungeduldig. Aber sich von der Last zu befreien, den Ueberfluß zu verkaufen und ein internationales Reiseleben anzufangen, wie sie es ersehnte, dazu war sie wieder nicht energisch genug.
„Es giebt ja Körper von indifferentem Gleichgewicht – ich bin so einer. Wo das Schicksal mich nun ’mal hingelegt hat, bleibe ich liegen,“ sagte sie.
Und so behielten die Leopoldsburger in ihr eine Mitbürgerin, die Geld unter die Leute und Leben unter die Menschen brachte.
Wenn die Saison begann, was in Leopoldsburg mit dem Beginn der Oper nach den Ferien der Fall war, konnte man sicher sein, die Fenster des Trachschen Hauses alsbald vom Lichterglanz der ersten Festlichkeit erhellt zu sehen. Diesmal besann Hortense sich ein wenig.
Die heimliche Verlobung Renés mit Magda Ruhland war ihr eine Art Unbequemlichkeit, in die sie sich hinein verwickelt fühlte. Ihr war es, als trüge sie da eine Verantwortung mit und müßte das Ihrige dazu thun, daß alles sich zum Besten wende. In ihrer regen Phantasie hatte sie schon einen Plan ausgearbeitet: sie wollte Renés Schulden bezahlen – sicher hatte er einige – und Magda eine Aussteuer schenken; die alte Excellenz konnte in eine Anstalt gethan werden, wozu die Pension gerade reichte. Aber sie fürchtete, René würde das nicht annehmen und Magda sich dem letzteren widersetzen. Gern hätte Hortense das arme Kind wenigstens von den äußerlichen Schwierigkeiten befreit. Denn sie sah die Verbindung mit René für Magda als ein sehr unruhvolles Glück an; in der Form der Verlobung vielleicht noch mehr als in der Form der Ehe.
Als Hortense nun die erste Einladungsliste entwarf, fiel ihr ein, daß sie wohl fortan Magda immer mit René zusammen einladen müsse und daß Magda sich dann unfehlbar verraten würde. Sie beschloß, Magda aufzusuchen und ihr zu sagen, daß es wohl gescheiter sei, René und Magda würden, bis eine Veröffentlichung der Verlobung erfolgen könne, ab und zu allein zum Mittagessen kommen.
Während der Heinnreise hatten die beiden Frauen kaum daran gedacht, die kleinen äußerlichen Fragen zu erörtern. René war am Tag nach dem großen Ereignis abgereist, er hatte schon beim Beginn seiner Ferien für den Schluß derselben mit einem Freund eine Reise nach Frankreich verabredet gehabt.
Daß er sie nicht aufgab, daß er das neue jubelnde Glück nicht ausleben wollte, war der erste Schmerz gewesen, den Magda durch ihn erfuhr.
Er hatte ihr gesagt, daß er allein sein müsse, seines Werkes wegen, mit dem er sich trug, daß jenes Freundes Nähe ihm nur alle Reiseunbequemlichkeiten aus dem Wege schaffe, ihn geistig aber einsam lasse, daß hingegen ihre Nähe ihn ganz beschäftige und von seiner Schöpfung abziehe.
Sie erinnerte sich plötzlich deutlich der einsamen Stunden ihrer Mutter. Der Vater hatte im Ministerium zu thun, hieß es dann. So war dies immer und in jedem Beruf dasselbe? Die Frau hat schweigend zurückzutreten?
Ihr Herz faßte aber Hoffnung, daß ihre Nähe René fördern und nicht mehr stören werde, wenn sie sich erst ganz ineinander hineingelebt haben würden.
Und seine Briefe durften ihr den Abglanz seiner Gegenwart bringen!
Er schrieb nur zweimal einige kurze Zeilen, inhaltsvoll zwar durch die ernste, gehaltene Zärtlichkeit, die Magda tiefer beglückte als große und viele Worte. Aber sie hätte aus den Briefen von seinen Gedanken, seiner Arbeit, seinen Reiseeindrücken gern erfahren mögen. Und davon stand nichts darin. Es war, als gehöre Magda nicht in sein Leben, als sei sie etwas außerhalb desselben.
An dem Tage nun, als Hortense sich auf den Weg machte, befand sich Magda in einer namenlosen Aufregung.
Es war der fünfzehnte September. René mußte gestern von seinem Nachurlaub heimgekommen sein, oder gar vorgestern, denn er sollte heute den „Lohengrin“ dirigieren und er mußte doch Proben abhalten. Die ersten vierzehn Tage hatte die Residenz sich mit Schauspielvorstellungen und italienischen Opern unter Herrn Viebigs Leitung begnügt. Für den heutigen Abend war das Theater ausverkauft. Magda hatte sich tagelang vorher einen Platz bestellt und bis zum endlichen Erwerb der Karte eine Aufregung empfunden, als hinge eine Lebensentscheidung daran. Er war da und er war noch nicht zu ihr gekommen!
Sie fiel ihren Schülerinnen durch ihre Hast und Unrast auf und die vier jungen Damen, die je zu zwei an einem Tische saßen, hatten schon gefragt, ob sie krank sei.
Das Atelier befand sich drei Treppen hoch, in einem Prachthause der Ringstraße, das sich eines schönen Treppenhauses mit Oberlicht erfreute. Der Raum lag nach Nordwesten und war eigentlich ein Hinterzimmer der halben Etage, die Ruhlands bewohnten. Es hatte aber einen besonderen Eingang vom Flur. Nebenan, auf der Zwillingsthür stand der Name „Nicolai“, wie auf der ihren „Magda Ruhland“.
Die Ruhlandsche Etagenhälfte bestand aus zwei Vorderzimmern, deren eines die alte Excellenz als Schlafgemach hatte, während das andere der Salon war, an den ein halbdunkles Eßzimmer stieß. In dem einen kleinen Hinterzimmer neben der Küche schlief Magda, das große mit der Thür zum Treppenhaus war eben ihr Atelier. Es hatte zwei große, gardinenlose Fenster. An jedem stand ein länglicher Holztisch, daran zwei Damen nebeneinander saßen, damit sie beide Licht von links bekamen. Zu ihrem Kummer hatten die Schülerinnen von ihren Kolleginnen nur die Rückenansicht, was die Unterhaltung sehr erschwerte. Denn sie verhandelten hier allen Klatsch und alle Ereignnisse ihrer Kreise mit jugendlicher Wichtigkeit. Manchmal gebot Magda Ruhe; aber nur wenn sie zuletzt klagte, es mache ihr Kopfweh, schwiegen die jungen Damen.
Sie waren alle nur hier, um sich Mittwochs und Sonnabends den Vormittag zu vertreiben, und malten für ihre Familienangehörigen Tassen, Fächer, Kästen und Vasen, wobei Magdas nachhelfender Pinsel das Beste that. Die älteste Schülerin zählte dabei nur zwei Jahre weniger als die vierundzwanzigjährige Magda und das ganze Verhältnis ward mehr als ein freundschaftliches angesehen. Magda erhielt auch oft Einladungen in die Familien dieser jungen Damen, aber sie hatte allmählich aufgehört, sie anzunehmen, denn ihrem Feingefühl war es nicht entgangen, daß man Ton und Aufmerksamkeit ein wenig gegen sie herabgestimmt hatte, seit ihr Vater nicht mehr amtierender Minister war.
So unmerklich freilich herabgestimmt, daß eine Natur mit gröberen Organen es gar nicht gespürt haben würde. Magda aber .hatte einen „sechsten Sinn“ für dergleichen.
Im Atelier, nach der Thür zu, hatte Magda einen bescheidenen Versuch gemacht, malerische Behaglichkeit herzustellen. Eine breite Ottomane befand sich in der einen Ecke, ein schöner Ueberwurf war darüber gelegt, aus weißen, blauen und orangefarbenen bunt durchwirkten Streifen zusammengestellt. Und darüber, an der Wand, hingen zwischen Skizzen von Magda und einem Gemälde von Nicolai allerlei orientalische Raritäten. Hortense hatte ein maurisches Tischchen, zwei schöne Stühle und einen Teppich gestiftet, so war die Ecke ganz wohnlich und obendrein durch eine japanische Wand von dem andern Raum abgeteilt.
Ein durchdringender Geruch von Terpentin und Nelkenöl schwebte in dem Raume.
„Ach bitte, Fräulein Ruhland, sehen Sie ’mal, wie scheußlich.“ – „Du, Magda, vorzeichnen mußt Du mir den kleinen Buben, Figuren kann ich und kann ich nicht.“ – „Fräulein Magda, soll ich hier Kasseler Braun nehmen?“ – „Guck ’mal, Magda, mein Edelweiß sieht grad’ aus wie ’n Johanniterstern.“
Nicht so geduldig wie sonst ging sie hin und her und beugte sich über die jungen Schultern.
Er war da! Seit gestern oder vorgestern, und er war nicht zu ihr gekommen!
Während sie das sperrige Edelweiß, das die kleine Sibylle Lenzow auf einen Stein malte, in der Form verbesserte, guckte Sibylle gar nicht zu, sondern sagte, das schwarze Titusköpfchen halb wendend:
„Hans, bist Du auch auf dem Ball bei der Gräfin Wallwitz?“
[691] Johanne von dem Busch erhob keineswegs den Kopf von ihrem Blumenstück, sondern sagte:
„Selbstredend. Was ziehst Du an?“
„Wir sind auch da,“ sagte die dritte junge Dame, die Weinblätter abmalte, welche mit langen Ranken aus einer Vase vor ihr niederhingen. Sie war eine Schwester der vierten Schülerin.
„Die alte Wallwitz giebt ihn wegen der Lilly.“
„Wißt Ihr schon, daß sie den ganzen Winter dableiben soll bei ihrer Großmama?“
„Scharfe Konkurrenz für uns.“
„Sie ist entzückend!“
„Ich finde, sie ist gräßlich.“
„Sieht sie dem Bruder ähnlich?“
„Sehr.“
„Gott! Sibylle! Keine Spur.“
„Sibylle schwärmt für den Lieutenant von Wallwitz.“
„Das ist nicht wahr.“
„Hat der Lieutenant von Wallwitz eine Schwester?“ fragte Magda. Sie kannte ihn flüchtig, von Gesellschaften her, aber sie hatte René und Hortense sehr warm von ihm sprechen hören.
„Ja,“ sagte Sibylle Lenzow, die es als ihre Angelegenheit anzusehen schien, hier Auskunft zu geben. „Weil doch die Wallwitzens auf dem Lande wohnen, soll Lilly hier den Winter mitmachen. Sie kommt frisch aus einer Genfer Pension, wo es einfach himmlisch gewesen sein soll. Lilly hat denn auch ’was riesig Forsches.“
„So,“ meinte Magda, den Pinsel niederlegend. „Zum Kelch kannst Du ein bißchen Neapelgelb nehmen. Aber so wenig, daß Du denkst, es sei zu wenig.“
Eine Minute herrschte Schweigen.
Magda zerbrach sich den Kopf, was sie machen und sagen sollte, wenn René jetzt käme. Die Vorstellung dieser Möglichkeit machte ihre Finger erzittern.
„Gehst Du heut’ in ‚Lohengrin‘, Hans?“ fragte Sibylle Lenzow, sich zurücklegend, denn die Freundin saß am Tisch hinter ihr.
„Denk’ Dir, wie scheußlich, es ist nicht unser Abend,“ antwortete Johanne von dem Busch.
„Pech. Wir gehen.“
Nun redeten die jungen Stimmen wieder durcheinander. Bärwald, der Heldentenor, ward als göttlich gepriesen, als greulich gescholten. Den ganzen Theaterzettel stritten sie durch und endlich und natürlich fiel der Name, der eine! Die Mädchen „schwärmten“ für René. Er solle mit der Kaspari verlobt sein, der Ortrud von heute abend. Die Schwestern wußten es gewiß und Sibylle wußte ganz gewiß, daß es nicht wahr sei. Dann würde sie ein Wort davon bei Wallwitzens gehört haben, denn er sei doch Renés Freund. Dies „er“ trug ihr Neckerei ein und lenkte das gefährliche Gespräch in andere Bahnen.
Das gefährliche Gespräch? War es nicht ein ganz harmloses? Hatten die lustigen und nur mit Vergnügungen beschäftigten Mädchen nicht schon hundertmal so und ähnlich gesprochen? War denn nun alles verändert? Rings nur noch Unfreiheit? War die Heimlichkeit nicht süß, sondern bitter? Magda preßte die Hände zusammen und drückte sie an die Stirn.
Es klopfte. Magda wurde leichenblaß. „Herein!“ riefen die vier jungen Stimmen eigenmächtig, denn hier kam niemand Fremdes und jede Abwechslung war willkommen.
Es war Hortense von Eschen. Sie sah sich sofort von den vier jungen Damen in Malschürzen umringt und wehrte nur ab. Magda stand beiseite und sammelte sich. Sie fühlte sich erleichtert und enttäuscht zugleich.
„Ich denke, es ist schon ein Uhr vorbei,“ sagte Hortense.
„Was, schon Eins?“ riefen die Mädchen.
Die Malschürzen flogen nur so auf den nächstbesten Stuhl. Es galt, keine Minute zu versäumen. Um Eins konnte man in der Ringstraße allerlei interessanten Leuten begegnen, die ihrerseits auch wußten, daß vier gewisse junge Damen dann aus der Malstunde kamen.
Der Lärm vertobte und das Lachen klang die Treppe hinunter.
Magda warf sich an die Brust der mütterlichen Freundin.
„Nun, was ist?“ fragte Hortense.
„Er ist in der Stadt, muß in der Stadt sein und ist nicht gekommen,“ stammelte Magda.
„Er wird eben sehr beschäftigt sein,“ tröstete Hortense. Sie sprach von morgen mittag, ob Magda dann nicht mit René bei ihr speisen wolle und ob das nicht besser sei, als in den großen Gesellschaften zu erscheinen. Sie hatte eigentlich nicht schon morgen das heimliche Brautpaar zu sich laden wollen, aber Magdas schwere Enttäuschung dauerte sie so. Sie wußte ja, wie das Warten auf einen lieben Menschen thut.
Magda fühlte sich sofort freudig getröstet. Es gab nur ein Bedenken: der Vater. Aber wenn Nicolai mit dem Vater essen wollte …
„Frag’ ihn gleich.“
Magda lief auf den Flur und klopfte an Nicolais Thür.
„Sind Sie da? Bitte kommen Sie heraus!“ Und Nicolai kam. Er war ein überlanger schlanker Mensch, mit einem blassen Gesicht von regelmäßigen, fast strengen Zügen, die einen unbewegten Ausdruck hatten. In diesem Gesicht stand ein Paar großer Augen, die stetig blickten, als könnten sie den einmal erfaßten Gegenstand nicht schnell wieder loslassen. Sein blondes Haar deckte nur spärlich das kleine Haupt und an den Wangen zog sich ein dünner Bart steif hin.
Er küßte Hortense die Hand. Er liebte sie, weil sie gut zu Magda war. Er hatte mit ihrer Welterfahrenheit und ihrer Illusionslosigkeit keine Berührungspunkte. Aber seit er einmal gesehen hatte, daß sie sich tief und rein über Kunsteindrücke enthusiasmieren konnte wie ein Kind, seitdem schätzte er sie auch um ihrer selbst willen.
„Was soll ich, Fräulein Magda?“ Dies war seine immer gleiche Frage, wenn sie ihn rief. Es war für ihn so selbstverständlich, ihr zu Diensten zu sein, daß es stets sein erster Gedanke war, obschon sie ihn oft rief, wenn sie ihm eine kleine Freundlichkeit erweisen wollte.
„Morgen mit Papa speisen. Ich soll bei Frau von Eschen zu Tisch sein. Wollen Sie? Papa, wissen Sie, liebt nicht, allein …“
„Aber selbstverständlich. Ich habe Ihnen noch zu danken – Ihre Kathi hat mir heut’ früh wieder den heißen Haferschleim gebracht,“ sagte Nicolai.
„Wir haben Sie gestern husten hören und Kathi ist Ihnen abends spät ohne Paletot begegnet,“ hielt Magda ihm strafend vor.
Er lächelte schmerzlich. Seine Kränklichkeit gewann ihm immer neu ihre fast schwesterliche Fürsorge. Der Gesunde hätte solche nicht empfangen.
Aber der Gesunde hätte vielleicht um eine anders geartete werben dürfen – –
Hortense sah das Bild an, welches über dem Diwan hing und das sie natürlich schon auswendig kannte.
„Es ärgert und fesselt mich immer neu, lieber Nicolai,“ sagte sie.
Das Bild, von einem weißen Rahmen umfaßt, stellte in einer blassen Frühlingslandschaft ätherische, schmalaufgeschossene und steil nebeneinanderstehende Wesen vor, die auf wundersam geformten Instrumenten musizierten. Die Farben ihrer kinderhaften Körper und durchsichtigen Gewänder hoben sich kaum von der Landschaft ab. Vorn lag ein Mann und hörte geschlossenen Auges und verzückter Miene der Musik zu. „Die Stimme des Frühlings“ hieß das Bild.
Ehe noch Nicolai antworten konnte, kam von der Küche her, durch Magdas Schlafzimmerchen, Kathi, die rauhe und wichtige Magd. „Da is ’n Brief,“ sagte sie und hielt Magda ein Schreiben hin, welches vorn am Etageneingang abgegeben war.
Magda nahm es, riß das Couvert ab, das zu Boden fiel, und überflog die wenigen Zeilen.
„Herzensliebste! Vorgestern abend bin ich angekommen, gestern hatte ich zwei Proben zu leiten. Meine Hoffnung, Dich heute sehen zu können, hat sich zerschlagen, denn auf flüchtige Minuten mag ich nicht kommen. Aber ich denke, Du wirst im Theater sein. Voneinander fern, fühlen wir dann doch unsere innerste Zusammengehörigkeit.Nicolai hatte das Couvert aufgenommen, und voll Ueberraschung, die zu jäh war und zu harmlos, als daß er sie hätte unterdrücken können, rief er:
„Das ist ja Flemmings Handschrift.“
Die charakteristischen. Züge, flüchtig hingeworfen und doch in der Eile noch ihre Besonderheit bewahrend, konnte niemand verkennen, der sie einmal gesehen.
„Ich wußte nicht, daß Sie ihn kennen,“ setzte er unsicher
[692][693] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [694] hinzu, denn er begriff, daß er etwas Ungeschicktes gethan: man sieht die Handschrift auf den Briefen anderer Leute nicht.
Magda sah ihn an, er Magda. Ihre Blicke wurzelten ineinander. Magda wurde rot.
„Magda hat Flemming kennengelernt, wir trafen ihn auf der Reise,“ sagte Hortense mit oberflächlichem Ton.
Nicolai ließ seinen Blick nicht von Magdas Gesicht. Er atmete kurz, wie jemand, dem die Luft ausgehen will. Magda faßte sich und ergriff Nicolais Hand.
„Also, Sie werden morgen mit Papa essen,“ sprach sie herzlich. „Ich danke Ihnen.“
Er fühlte, es hieß soviel als: gehen Sie nun, ich bedarf der Einsamkeit. Ueber seine Lippen kam kein Wort mehr, er zog sich mit einer linkischen Verbeugung zurück.
Hortense sah ihm nach. „Armer Teufel,“ murmelte sie.
„René entschuldigt sich – er war zu beschäftigt,“ sagte Magda mit unsicherm Ton.
Ihr war, als müßte Hortense dem Brief von außen ansehen, daß so wenig darin stand, und Magda wollte verbergen, daß sie durch die Kürze enttäuscht war.
Die kluge Freundin fühlte genau, daß Magda ihr etwas verbarg. Und obschon sie wußte, daß die Aermste sich nun vielleicht mit einem Phantom stundenlang herumquälen werde, ließ sie ihr das Schweigen. „Das muß durchgemacht sein,“ sagte sie sich philosophisch und verließ Magda.
Diese nahm den Brief wieder vor und las ihn noch einmal. Warum führte er die Gründe nicht an, die ihn abgehalten hatten? Warum beschrieb er nicht den Inhalt all seiner Stunden seit vorgestern? Fühlte er denn nicht, daß dies allein Magda überzeugen konnte, wie es ihm wirklich unmöglich gewesen, zu kommen? Wußte er denn nicht, daß die flüchtigen Minuten, die er verschmähte, ihr immer noch eine unendliche Freude bereitet hätten, daß sie ihn lieber im Fluge als gar nicht sah? Verstand er denn so gar nicht, was einem Frauenherzen wohl und not thut? Daß man ihm mit einem herzlichen, erklärenden, zärtlichen Wort tausend stille Qualgedanken ersparen kann?
Magda fühlte sich verzweifeln. Aber es lag nicht in ihrer Art, sich dann hinzuwerfen zu weinen und zu toben. Sie stand still und starr und fragte sich, ob sie geliebt sei, so wie sie wünschte und begehrte, von ihm geliebt zu sein, und ob es nicht besser wäre, diese Qual durch einen scharfen Schnitt zu enden.
Davor erschrak sie aber so, daß es ihr schien, ihr jetziges Elend sei ein besserer Zustand als der frühere Friede.
Sie ging all ihren Obliegenheiten mechanisch nach. Bei Tisch sorgte sie wie immer für den Vater. Die alte Excellenz saß, sorgfältig in Schwarz gekleidet, im Fahrstuhl. Ruhland hatte ein Gesicht, dessen feine Züge durch Arbeit und Leiden ins Messerscharfe vertieft waren. Der weiße Backenbart endete in den Mundwinkeln und ließ das Kinn frei. Die Augen unter der hohen Stirne lagen tief und hatten einen seltsamen, glänzenden Blick. Er sprach etwas schwer, wie jemand der mühsam seine Gedanken zusammenhält. Seine Krankheit war in ihren Anfangsstadien und schritt langsam vor. Magdas Freunde wünschten Ruhland einen baldigen Tod, damit der Tochter schlimme Zeiten erspart würden.
Magda teilte ihm nie mit, wenn sie einmal abends ausging. Ihre Absicht würde er begriffen haben und darüber verstimmt sein, während er in der That nur nach ihrer pflegsamen Nähe bei seinen Mahlzeiten verlangte. Und die letzte erhielt er um sechs Uhr.
Als Magda sich in ihrem Zimmer für das Theater ankleidete, wich der Druck von ihr, der seit Mittag auf ihr gelegen. Der Gedanke, René bald, wenigstens von weitem zu sehen, gab ihr schon so viel Freude, daß sie den Brief noch einmal hervorholte und ihn wieder las. Jetzt blieb ihr Auge zumeist auf der Stelle haften: „Voneinander fern, fühlen wir dann doch unsere innerste Zusammengehörigkeit“.
Unterwegs nach dem Opernhaus – sie mußte fast die halbe Ringstraße entlang wandern – dachte sie an Renés Erzählungen, mit denen er sie bei der Table d'hôte manchmal unterhalten: von den unglaublichen Schwierigkeiten der Einstudierung einer Oper, von den tausend unvorhergesehenen Hindernissen, die oft noch am letzten Tage entstehen und durch heiser gewordene Primadonnen, fingerkranke Harfenspieler, launische Tenoristen etc. hervorgerufen werden.
Der Septembertag war so schön gewesen, Magda hatte ihn in den Terpentindünsten ihrer Malstube verbracht. Nun er sank und mit einer letzten, zagenden Dämmerung noch eine friedliche Färbung über Himmel und Erde legte, atmete Magda erquickt seine Reinheit. In der freien Luft war ihr immer besser. Sie kam sich froher und gläubiger vor, frischere Lebensquellen sprangen in ihr auf.
Gleich ihr strebten ganze Scharen dem Opernhaus zu, vor dessen weißem Prachtbau elektrische Lampen Tageshelle verbreiteten. Und endlich saß sie auf ihrem Platze, ganz glücklich, ganz erlöst. Draußen im Korridor war ein Zettel angeschlagen gewesen: man kündigte an, daß nicht Herr Meyer den Heerrufer singe, sondern daß infolge einer plötzlichen Heiserkeit dieses Künstlers Herr Reuter heute morgen die Partie übernommen habe. – Nun wußte sie, daß René den ganzen Morgen noch mit dem Ersatzmann studiert haben mußte.
Seltsamer Mensch! Karg mit Worten, sagte er nur die Thatsachen und forderte offenbar, daß sie immer blind an die Unabänderlichkeit derselben glaube.
Dies war nur eine kleine Sache gewesen und Magda hatte sie sich selbst bald erklären können, freilich nach einigen Zweifelsstunden. Wie schwer, ja zu schwer für ein Frauenherz mußte die Zumutung in großen Dingen sein!
Magda sah sich im vollen Hause um. Sie hatte an der rechten Seite in einer Loge einen Platz in der zweiten Reihe bekommen. Drüben, links, saß Hortense, mit ihrem aschblonden Haar und ihrem Sammetkleid, das ein wenig den Hals frei ließ, anzusehen wie eine Schönheit in voller Blüte. Neben ihr saß die kleine Sibylle von Lenzow, mit dem schwarzen Köpfchen, dem pikanten Gesicht, hübsch im rosa Kleidchen. Sibyllens Vater nahm einen der Hinterplätze ein. Der Rest der Loge war auch besetzt – lauter Abonnenten, daher fand sich in ihr für Magda kein Raum.
Man unterhielt sich sehr lebhaft, es war eine festliche Bewegung im Hause. Vor Magda saß der Lieutenant von Wallwitz, die junge Dame in Weiß neben ihm war vermutlich seine Schwester. Er hatte Magda so förmlich gegrüßt, wie ihre flüchtige Bekanntschaft es forderte. Sie aber sah ihn mit Interesse an, fühlte sich ihm nahe und hätte am liebsten ein Gespräch mit ihm angefangen. War er doch „sein“ guter Freund. Hinter Magda, in der letzten Logenreihe, und neben ihr saßen insgesamt drei Damen, die sich über Theaterangelegenheiten mit der Ungeniertheit unterhielten, welche ständige Besucher sich angewöhnen.
„Nie präcise, wenn Flemming dirigiert,“ sagte die eine, „es ist schon fünf Minnten nach.“
„Er charmiert wohl noch mit seiner Kaspari,“ meinte die zweite.
„Heute wollen wir ’mal tüchtig aufpassen – Ihr sollt sehn, sie kokettiert von der Bühne ’runter zu ihm.“
„Ob's wohl zur Heirat kommt?“
„Keine Idee! Das wird wieder werden wie voriges Jahr mit der Bertens: wenn er es satt hat, heißt es mit einemmal, sie hat keine Stimme mehr, oder sie macht nicht genügend Fortschritte, und dann kommt sie fort.“
Magdas Herz klopfte, daß die Spitzen an ihrem Halse zitterten.
Sie hätte den Weibern ins Gesicht schreien mögen: schweigt mit eurem elenden Klatsch!
Plötzlich verdunkelte sich das Haus. Zugleich trat von links, durch eine kleine Thür, René in den Orchesterraum. Während er sich schnell durch die Stühle und grünbeschirmten Gaslampen wand, die ihm für Fuß und Schultern den Weg versperrten, flog sein dunkles Auge suchend über den ersten Rang.
„Er sucht mich!“ jubelte es in Magda und unwillkürlich reckte sie den Kopf und erhob sich ein wenig, damit er sie sähe, was aber natürlich nicht möglich war.
„Ist er das?“ fragte das Fräulein vor ihr den Lieutenant. Der nickte.
Die junge Dame in Weiß nahm hierauf das Opernglas und sah sich den Kapellmeister genau an, der, sobald er auf seinem Schemel stand, nur noch im Wangenprofil sichtbar war, wenn er sich nicht gelegentlich beim Dirigieren den rechts sitzenden Cellisten, Holzbläsern und Hörnern zuwandte.
Magda hörte nichts vom Vorspiel. Sie sah nur die schlanke Gestalt im schwarzen Frack und sah die herrschenden, ausdrucksvollen Bewegungen seiner Arme und Hände.
Als nach dem Vorspiel rauschender Applaus ertönte, errötete sie, als gelte es ihr mit. Der Vorhang ging auf. Magdas Blick suchte unwillkürlich die Kaspari.
[695] Eine Person von aufdringlicher Schönheit, stattlich, große Züge, flammende Augen, in der roten, entfesselten Haarflut ein Diadem von zwei sich verschlingenden und emporzüngelnden Schlangen. Das grüne Sammetkleid und der orangefarbene Mantel umwallten sie königlich. Magda dachte nicht daran, daß das rote Haar eine stilvolle Perücke, daß die köstlichen Farben Schminke seien.
Sie kam sich plötzlich selbst unbedeutend und prosaisch in ihrer Erscheinung vor. Was war sie und was hatte sie zu geben, ihm, der täglich mit der Schönheit und dem Talent umging?! Sie beobachtete die Kaspari unausgesetzt. Und da – ja – ganz deutlich, die Kaspari sah zu René hinab mit einem lächelnden Blick.
„Die Kaspari sucht förmlich was drin, daß die Leute merken sollen, wie sie mit Flemming steht,“ flüsterte es hinter ihr.
Und plötzlich schämte Magda sich, daß sie die Sängerin beobachtet hatte, und fühlte so, als habe sie damit eine Indiskretion gegen René begangen.
Von nun an wendete sie den ganzen Abend dem Werke ihre gesammelte Aufmerksamkeit zu.
Im Zwischenakt pflegte Hortense im Foyer „Cercle zu halten“, wie ihre Freunde es nannten. Sie war da immer von jungen Damen und Kavalieren umringt, denn sie liebte und verstand die Jugend wie keine. „Ein Eckchen in meinem Herzen bleibt immer achtzehn Jahr alt,“ sagte sie. Auch heute konnte Magda nur mühsam zu ihr dringen. Ebenso strebte der Lieutenant von Wallwitz nach der Gelegenheit, seine Schwester vorzustellen.
Natürlich konnte Magda aus ihrem übervollen Herzen kein vertrauliches Wort hervorbringen. Sie mußte sich noch das ihr so völlig gleichgültige Fräulein von Wallwitz vorstellen lassen.
Als aber ihr Auge dem Blick der jungen Dame begegnete, erging es ihr rätselhaft. Wie ein unerklärlicher Schreck rieselte es ihr durch die Adern und ein starkes Gefühl, in dem eine Art Neugier mächtiger war als aufkeimende Abneigung, nahm Besitz von ihr. Das Gesicht prägte sich ihr unauslöschlich ein.
Lilly von Wallwitz hatte dunkelblonde Haare und bräunliche Augen, in deren Iris gelbe Pünktchen flimmerten. Ihre Farben waren zart, die Nase gerade und fein, zarte Brauen wölbten sich wie gezeichnet über den lebhaften Augen. Der Mund war ein wenig groß und in der schneeweißen Zahnreihe, die er beim Lachen sehen ließ, befand sich eine auffallende Stelle. Der Augenzahn an der linken Seite endete kurz und mit zackigem Rand, als habe er durch Fall oder Stoß seine untere Hälfte verloren.
Diese eine dunkle Stelle in dem lachenden Mund gab dem ganzen Gesicht einen unharmonischen Ausdruck. Sie war es auch, die Magda immer nachher vor sich sah.
Lilly sprach einige Worte, wie sie einer jungen Dame, welche die Formen beherrscht, natürlich waren. Nur ihr fast nervöses Lachen und ihre helle Stimme, sowie das Umhersuchen der Augen fielen auf.
Für den Rest des Abends war es Magda sehr unangenehm, hinter ihr sitzen zu müssen. Lilly von Wallwitz kümmerte sich auch gar nicht um den ganzen „Lohengrin“, sie besah sich unausgesetzt den Dirigenten.
Die Scene im Brautgemach ergriff Magda wie noch niemals. Sie ward ihr zum Spiegelbild persönlicher Empfindungen.
Alle Sage ist schließlich Symbol. Magda sah in Elsas Verlangen, „Nam’ und Art“ des geliebten, geheimnisvollen Ritters zu erfahren, das allgemein weibliche Verlangen, das Wesen des Geliebten ganz zu ergründen. Ihr fiel in einer blitzartigen Ideenverbindung die Psyche in dem schönen Märchen des Altertums ein, die mit ihrer Lampe den schlummernden Amor beleuchtet, den sie bisher nicht sehen durfte und der ihr entfliehen muß, weil sie ihn sah.
Bang fragte Magda sich, ob es denn so gefahrvoll sei, in die Tiefe männliche Wesens zu dringen – ob das Erkennen auch immer ein Verlieren nach sich ziehen müsse?
Sie konnte sich nicht beherrschen: beim Abschied Lohengrins weinte sie und da floß manche Thräne, die sich in den Erregungen der letzten Zeit aufgespeichert hatte und nun wohlthätig löste.
Beim Aufbruch mußte sie sich für ihre roten Augen einen spöttischen Blick von Lilly Wallwitz gefallenen lassen. Um nicht etwa mit dem Geschwisterpaar und einem ganzen Schwarm von Bekannten die Treppe hinunter gehen zu müssen, zögerte Magda sehr mit ihrem Mantel und Kopfshawl.
Sie befand sich endlich unter den letzten, die das Haus verließen, traf die erwartende Kathi und ging wie im Traum dahin.
In ihrem Herzen brannte das Verlangen, jetzt allein und im seligen Schweigen mit dem Geliebten zusammen das Gehörte in sich nach- und ausklingen zu lassen. Wie schwer war es doch, auf die volle Zusammengehörigkeit zu warten. Sie malte sich aus, wie sie als Mann und Weib nach solchen Abenden in ihre trauliche Häuslichkeit einkehren würden. Und er?! Empfand nicht auch er sicherlich jetzt dieselbe Sehnsucht nach lösender Gefühlsstille und nach ihrer lieben Nähe?
Magda hörte hinter sich ein Lachen. Die Stimme kannte sie, den männlichen Wohllaut dieses herzlichen Lachens. Sie übertönte jetzt lautes Sprechen anderer Stimmen. Auf dem Fahrdamm, neben dem Bürgerstieg hergehed, um die vielen langsam schlendernden Menschen zu überholen kamen vier Herren von rückwärts her neben Magda vorbei. Zwei in Civil, zwei in Uniform.
„Kommen Wallwitz und Bohrmann auch noch in den ‚Wilden‘?“ fragte die eine Stimme. Ein anderer antwortete etwas mit dem Namen Bohrmann Zusammenhängendes, das Magda nicht recht verstand, denn sie hörte nur die eine Stimme und sah nur die eine hohe Gestalt im Kragenmantel und weichen Filzhut, die nun schon an ihr vorbei war. Die Antwort, die Magda nicht verstanden hatte, erregte das schallende Gelächter der drei Hörer.
Er ging mit Freunden in ausgelassener Stimmung in den „Wilden“, damit war, wie Magda wohl erriet, das bekannte Weinrestaurant „Zum wilden Mann“ gemeint, wo, nach den Schauergeschichten der jungen Malschülerinnen, die jungen Herren der Residenz oft Nächte hindurch zechen und spielen sollten. Vielleicht war das albernes Geschwätz.
Aber dies eine blieb doch, Magda hatte es mit eigenen Augen gesehen, mit eigene Ohren gehört: René ging mit lustigen Freunden in ein Weinhaus und hatte durch sein Lachen übermütige Fröhlichkeit verraten.
Und sie – sie hatte gewähnt, er sehne sich gleich ihr jetzt nach schweigendem Glück! Wie war es nur möglich, wie war es zu begreifen, daß zwei Menschen, die sich lieben, die ihr ganzes Leben einander angehören wollen, zur selben Stunde, nach den gleichen Eindrücken, so ganz, ganz verschieden empfanden?
Drang die Kraft ihrer Sehnsucht denn nicht geheimnisvoll zu ihm und zwang ihn, zu fühlen wie sie?
Hortense schickte Sonntag früh sowohl zu René als zu Magda, die Herrschaften möchten schon um zwei Uhr zu Tisch kommen, sie sei für den Abend zur Herzogin befohlen. Und wenn Hortense zur Herzogin mußte, stärkte sie sich vorher durch einige Stunden der Ruhe. Die hohe Dame war ein Engel an Güte, jedermann konstatierte es mit Ehrfurcht und auch Hortense bewunderte sie aufrichtig. Aber platonisch, so wie man ein klassisches berühmtes Gemälde bewundern kann, das man aber zu erwerben und täglich zu sehen keine Lust hat.
Hortense hatte so gar kein Interesse für Suppenanstalten, Mägdeheime, Krankenpflege. Die Herzogin sah sie als ein arges Weltkind an, doch von der bestrickenden Persönlichkeit der ungewöhnlichen Frau immer neu angezogen, gab Hoheit die Hoffnung nicht auf, hier eine Bekehrung ins Werk zu setzen.
Da Hortense sonst in vollkommener Freiheit alles zu sagen pflegte, was ihr durch den Sinn kam, so ward die bei der Herzogin nötige Beherrschung ihr immer ein bißchen sauer, denn wehthun und die gute Fürstin verletzen wollte sie auch nicht.
Sie „kalmierte“ sich daher immer erst, ehe sie ins Schloß ging, d. h. sie las ein wenig in irgend einer bezüglichen Broschüre, um die Herzogin durch Kenntnis der Kosten und Erträgnisse der Volksküche in N., der Krankenpflegerinnen-Bildungsanstalt in N. N. zu erfreuen. Dies mußte aber unmittelbar vor dem Beginn des herzoglichen Theeabends geschehen, sonst vergaß Hortense alles wieder.
Und darum wurde das heimliche Brautpaar auf zwei anstatt auf fünf Uhr bestellt.
Magda hatte ihren Tag mit dem Vorsatz begonnen, einen Besuch Renés nicht zu erwarten, denn er würde bei Hortense erst die Form eines solchen mit ihr besprechen wollen.
Aber sie hatte sich ausgedacht, daß er ihr ein Briefchen oder ein paar Blumen schicken werde und ungeduldig anfragen würde, ob sie gestern abend stolz und glücklich gewesen und seiner gedacht habe. Sie malte sich aus, was er ihr wohl schreiben werde.
Als aber dann die Stunden rannen, ohne daß ein Zeichen [696] von ihm kam, nahm sie sich vor, nie mehr etwas zu erwarten. Denn ihre Phantasie bereitete ihr die Enttäuschungen – so viel hatte sie ihn schon kennengelernt, daß er nicht der Mann der steten galanten Zärtlichkeit war.
Nicolai war ganz glücklich, als Kathi ihm meldete, daß das Fräulein schon um zwei Uhr fortging. So kam sie früher wieder und blieb nicht den ganzen Abend fort. Denn die Sonntagabende gehörten ihm. Die verbrachte er bei dem leidenden Mann und dem gütigen Mädchen.
Er klingelte schon um halb zwei vorn an der Etagenthür, denn am Sonntag kam er nie in Magdas Atelier, weil es da still und menschenleer war. Er vermied das Alleinsein mit ihr.
„Ich will nur hören, ob Sie noch besondere Verhaltungsmaßregeln zu hinterlassen haben,“ sagte er, da Magda selbst ihm öffnete.
„Nein, Papa ist sehr wohl heute. Ich denke auch, um fünf Uhr zurückzukommen.“
„Wie schön Sie heute sind.“
Magda lächelte strahlend. Sie hatte ein neues Kleid an, von zarter grauer Farbe, und einen großen Strauß von Herbstveilchen im weißen Gürtel.
Sie fragte Nieolai nicht, wie es ihm gehe, sie sah nicht, daß er heute besonders elend aussah.
Ihr Erröten und Flemmings Brief hatten ihm eine Nacht ohne Schlaf bereitet.
Aber nun wartete er, daß sie ihn frage, wie es ihm ergehe. Sonst war die stete Frage seine Qual. Sie erinnerte ihn daran, daß Ehre und Menschlichkeit ihm verboten, um sie zu werben, nur den Versuch zu machen, ihr Herz zu gewinnen. Weil er sie liebte, durfte er gar nicht wünschen, von ihr geliebt zu sein, denn solche Liebe konnte sie nur elend machen. Aber heute wollte er gefragt sein und den Beweis haben, daß keine neuen, störenden Gedanken die Anteilnahme an den alten Freund niederhielten.
Magda fragte nicht. Sie war ganz Vorfreude, ganz blühende Gesundheit, ganz in Schönheit.
Er sah sie so fortgehen und setzte sich zu der alten Excellenz, froh, wenigstens in ihrem Heim sein zu dürfen. –
René war schon da, als Magda in Hortensens Salon eintrat.
Sie fielen einander um den Hals und küßten sich. René nahm ihr Gesicht zwischen die Hände und sah ihr freudig in die Augen. Daß sie gelitten, gewartet und Enttäuschungen gehabt hatte, war vergessen. Ein namenloses Glück senkte Kinderfröhlichkeit in ihr Herz.
Hortense hatte irgendwo hinter Palmen und einer der spanischen Wände gesessen, durch welche der übergroße Saal in kleine Wohnecken geteilt war. Nun kam sie heran und ließ sich Magdas stürmische Begrüßung gefallen.
Es war ihr so rührend, zu sehen, wie das sonst so gehaltene Wesen jetzt zuweilen im Jubel überschäumte, um immer bald schüchtern wieder zu verstummen, als traue Magda sich nicht, an das freie Recht ihrer Freude zu glauben.
Das Mahl wurde so vergnügt wie jenes am Verlobungstag, nur daß sie sich „Sie“ nennen mußten, was augenblicklich ein reizvolles Vergnügen gewährte.
Wenn der aufwartende Diener nicht zugegen war, beichtete Magda von ihren „thörichten“ Gedanken – jetzt, ihm und seinen leuchtenden Augen gegenüber fand sie sie „thöricht“. Wie sie gestern abend sich nach ihm gesehnt und sich eingebildet, er fühle ebenso, und von der grausamen Entdeckung, daß er riesig fidel in den „Wilden Mann“ gegangen sei.
René lachte und erklärte ihr, daß seine Nerven nach solchen Aufgaben zu erregt seien, um in stiller Häuslichkeit sich bändigen lassen zu können; dann bedürfe er eines lärmenden Austobens oder doch wenigstens einer Gesellschaft von fröhlich beschwingter Stimmung.
Als Gegengewicht zur höchsten geistigen Anspannung sei harmlose Lustigkeit, die auch in reine Albernheit ausarten könne, einfach gesundheitlich nötig, während Gefühlsschwelgerei nachher zu Sentimentalität und Nervosität führe.
Magda nahm die Erklärung hin und war dankbar für dieselbe, ohne sich doch in sein Bedürfnis hineindenken zu können.
„Es wird Dich manchmal später kränken,“ sagte er, „aber Du wirst es verstehen lernen und das Sprichwort beherzigen, daß alles verstehen alles vergeben heißt.“
„Ah,“ rief sie lebhaft, „das Sprichwort ist eine Redensart. So viel habe ich schon begriffen. Im Gegenteil scheint mir Liebespflicht und Frauenlos zu sein, daß man verzeiht was man nicht versteht.“
„Bravo!“ sagte René.
„Sieh da,“ bemerkte Hortense, „das Kind bildet sich schon Theorien.“
„Ja – in Deiner Gegenwart kommen mir vernünftige vertrauende Gedanken – aber wenn Du fern bist – –“ sie vollendete nicht. Ihr Auge ging mit einem flehenden, leidvollen Blick über sein Gesicht.
„O Gott!“ murmelte er und nahm ihre Hand, um sie zärtlich zu streicheln. (Fortsetzung folgt.)
Nachdruck verboten.
Alle Rechte vorbehalten.
Handwerker von Stande.
In „Tausendundeine Nacht“ wird die Geschichte eines Königssohns erzählt, der, im Begriffe, als Gesandter seines Vaters mit kostbaren Geschenken zum Sultan von Indien zu gehen, unterwegs von Beduinen angefallen, seiner Leute und Kamele beraubt und beinahe totgeschlagen wird. Er kommt gerade noch mit dem Leben davon, aber sieht sich nun auf einmal in dem wildfremden Lande blutarm und verlassen wie ein Bettler. Er gelangt in eine Stadt und macht hier die Bekanntschaft eines Schneiders, dessen Teilnahme er erregt und der ihn in sein Haus nimmt. Nachdem drei Tage um sind, fragt unser Meister den Prinzen, ob er kein Handwerk erlernt habe, mit dem er sich ernähren könne. Der junge Mann antwortet, er habe schön schreiben, dichten, musizieren gelernt, er besitze Sprach- und Litteraturkenntnisse, er sei ziemlich unterrichtet. Alles das, meint der Schneider, wird hier zu Lande wenig gesucht; das sind brotlose Künste, mit denen man keinen Hund vom Ofen lockt. „So nimm eine Axt, geh’ in den Wald und werde ein Holzmacher; damit kannst Du Dir Deinen Lebensunterhalt verdienen.“
Das ist die Geschichte manches Knaben, der in einer goldenen Wiege gelegen hat; denn es wird keinem an der Wiege gesungen, was künftig aus ihm wird. Das Schicksal würfelt die Lose durcheinander und spielt mit den Menschen wie mit Damensteinen; es erniedrigt und erhöht. Ach, es kommt wohl vor, daß ein Prinz Packträger oder Pferdebahnkutscher werden muß, wie der Marquis von Ailesbury – daß ein Graf Thürsteher an dem Palaste ist, den seine Vorfahren erbauten – daß ein Papst wie Johann XXIII. als Stallknecht seine Rettung sucht und daß ein Pastor aus Köpenick am Brandenburger Thore in Berlin Zeitungen verkauft. Aller Art Menschen kommen herunter, sie gelangen dann gleichsam ins große Arbeitshaus der Welt, in dem die Armen alle sitzen, weil sie sich kümmerlich von ihrer Hände Arbeit nähren; sie müssen Holz hacken wie der arabische Königssohn.
Es verlohnt sich, einmal über seinen Fall und die Entscheidung des Schneiders nachzudenken. In Bezug auf die schöngeistigen Anlagen des Prinzen und seine litterarischen Neigungen würde das Urteil des wackeren Mannes unter unseren Verhältnissen kaum so vernichtend lauten. Dergleichen wird allerdings gesucht und unter Umständen auch bezahlt. Das ist nichts Seltenes, daß ein Prinz auf Grund seiner guten Erziehung und sorgfältigen Ausbildung als Lehrer oder Künstler sein Brot gefunden hat. Zwar dem unglücklichen deutschen Kaiser Heinrich IV. ist auch dieses nicht geglückt. Nach unendlich viel Demütigungen und bitteren Erfahrungen von seinem eigenen Sohne zur Abdankung gedrängt, seiner Insignien entkleidet, auf sich selbst angewiesen, in der äußersten Not kam er zum Bischof von Speier und bat um eine kleine Pfründe. Er sagte ihm, er könne singen, er hätte studiert, er könne die Stelle eines Lektors oder Subkantors versehen. Seine Familie hatte den Dom von Speier gegründet, er selbst ihn bereichert. Und als ihm der Bischof die Anstellung verweigerte, soll er sich umgewandt und vor Schmerz aufgeschrieen haben. Das war im Jahre 1105.
Aber ein König von Frankreich, der Bürgerkönig, hat es
[697][698] durchgesetzt! Ludwig Philipp von Orleans war etwa so vorbereitet wie unser Märchenprinz, als er sich in mißlicher Lage, zwanzig Jahre alt, im Jahre 1793 nach der Schweiz begab. Nachdem sein Geld alle geworden war, legte er das höhere Schulexamen ab und ward unter dem Namen Chabaud Latour Lehrer der Geographie und Mathematik an der Erziehungsanstalt im Schlosse Reichenau bei Chur. Nach einer andern Angabe hat der junge Herzog von Chartres als Lehrer der französischen Sprache und Litteratur gewirkt. Die Thatsache steht fest; die Leitung der Anstalt lag in den Händen Zschokkes; das Schloß ist jetzt im Besitz der Familie von Planta. Ludwig Philipp konnte sich auf einen Vorgänger im klassischen Altertum berufen, der bereits in den Fünfzigen und bereits Maöhthdber von Syrakus gewesen, nicht so gut erzogen, aber auf seine alten Tage auch noch Schulmeister war: auf Dionysius den Jüngeren. Er wurde im Jahre 343 v. Chr. von Timoleon nach Korinth deportiert, wo er sein Leben durch Unterrichtgeben und Musikstunden gefristet haben soll.
Der Großfürst Wladimir würde wahrscheinlich eine Professur der Orientalischen Sprachen, der Erzherzog Josef eine Professur des Zigeuneridioms erhalten – der Landgraf von Hessen-Darmstadt, Ludwig IX., gab weiland in seiner Residenz Pirmasens den geschicktesten Trommelschläger ab, Friedrich der Große spielte bei den Konzerten in Sanssouci die Flöte – der Prinz Eugen von Schweden könnte sich sofort als Maler niederlassen. Er erzielt sogar sehr hohe Preise, von denen er nichts abläßt, weil er das Geld für die Armen zu bestimmen pflegt. Ob die unzähligen gekrönten Häupter und regierenden Häusern angehörigen Prinzen und Prinzessinnen, die in unserer Zeit als Schriftsteller aufgetreten sind, alle imstande sein würden, sich mit der Feder zu ernähren, will ich dahingestellt sein lassen, da das selbst für Berufsschriftsteller mitunter eine mißliche Sache ist. Gewiß ist, daß das Prachtwerk des Erzherzogs Ludwig Salvator von Toskana über die Balearen überall einen Verleger gefunden hätte; daß Madame Reyer, unter welchem Namen die Königin von Belgien, Marie Henriette, ihre Zeitschrift Jeune Fille leitet, die von ihr gezeichneten Artikel so gut liefert wie ein Berufsjournalist und für Kunst und Litteratur an der Prinzessin Clementine, die als Marthe d’Orey zeichnet, eine geschätzte Mitarbeiterin besitzt; daß ferner der König Milan von Serbien durchaus das Zeug hat, sich nötigenfalls als Graf von Takova im Dienste der Presse durchs Leben zu schlagen.
Der schönschreibende Prinz des arabischen Märchens brauchte also in Europa noch nicht gleich zu verzweifeln; anderseits ist es heutzutage, unter unseren Verhältnissen, durchaus nicht mehr so sicher, daß die mechanischen Arbeiten ihren Mann ernähren. Das Handwerk hat bekanntlich keinen goldenen Boden mehr, seitdem der Wettbewerb so sehr verschärft wurde.
Früher war das anders.
Es gab einst eine Zeit, in der ein Handwerk den Menschen vom Schicksal unabhängig machte und ihn gleichsam über das wetterwendische Glück erhob; eine Zeit, wo die gelernte Kunst ein Bauerngut aufwog, weil sie niemals entrissen werden konnte; wo das Sprichwort galt: eine gute Kunst und gelehrte Hand passieret frei durch alle Land. Daher denn fürstliche Familien die Prinzen gern ein Handwerk erlernen ließen, um ihnen etwas Sicheres fürs Leben mitzugeben. Im Mittelalter hätte man das für unanständig gehalten, und der erste Stephanus, der Gründer des berühmten Buchdruckergeschlechtes, wurde von seinen Eltern, provençalischen Edelleuten, enterbt, weil er sich der Buchdruckerkunst widmete; aber in der Revolutionszeit, die so viele reiche Leute zwang, ihr Vaterland zu verlassen, wurde diese pädagogische Maßregel beliebt. Rousseau, der seinen Emil zum Zimmermann bestimmte, erhob sich zum Fürsprecher dieser Idee, doch war sie eigentlich nicht neu. Bei Königskindern erscheint das Handwerk freilich nur wie eine Art Spielerei, die einen praktischen Nutzen selten haben dürfte. Die Absicht, sie dadurch gegen einen Schicksalswechsel zu sichern und zu wappnen, ist eine hübsche Illusion der Eltern, die kaum ernst genommen wird. Sie wurde auch nicht immer erstrebt. Der Prinz sollte aus anderen, erzieherischen Gründen ein Handwerk lernen. Durch diese Beschäftigung wurde ja die Hand des Kindes geübt, wurden die Sinne geschärft. Der einstige Thronerbe trat auch durch seine Thätigkeit dem Anschauungskreise der arbeitenden Klassen näher, für deren Wohl er später sorgen sollte, und er gewann Achtung vor jeder scheinbar unbedeutenden Handarbeit.
Die bayrischen Prinzen Ludwig und Otto, die Söhne König Maximilians II. Joseph, die späteren Könige, hätten, überhaupt sehr einfach erzogen, dem arabischen Schneider, wenn er sie nach einem Handwerk gefragt hätte, wirklich dienen können. Der Kronprinz Ludwig, der frühe an der Baukunst Geschmack gefunden hatte, erlernte das Maurerhandwerk; sein Bruder Otto lernte drechseln. Wochenlang arbeitete der junge Ludwig alle Tage zwei Stunden mit den Maurern an einem neuen Wagenschuppen für das Lustschloß Nymphenburg. Nach Ablauf derselben kam er zu seiner königlichen Mutter und sagte, er hätte ausgelernt. Er könnte nun die Mauersteine so zierlich aufeinanderlegen wie irgend ein Gesell. „Könntest Du Dein Brot damit verdienen?“ fragte die Königin Maria. „Ich könnte mein Glück damit machen und das des Maurermeisters dazu,“ versetzte der Kronprinz lachend, denn er vermochte den Zweck dieser Beschäftigung nicht recht einzusehen. „Jeder Meister würde mich nämlich mit Vergnügen beschäftigen, um meines Namens willen. Da ist auch noch einer, der darauf wartet, daß die Welt auf dem Kopfe steht,“ meinte er, indem er auf den Prinzen Otto zeigte, der das Rad einer Drehbank mit seinem Füßchen trat. „Wenn die Prinzen drechseln, so mag der Zimmermann regieren.“ Ein „Zimmermann“ regierte ja einst das Zarenreich.
Die Drechselkunst hat unter den Fürsten immer besonders viele Liebhaber gefunden; Peter der Große verstand unter andern Handwerken auch dieses. Daß er, schon Zar, auf den Schiffswerften von Zaardam als einfacher Schiffszimmermann den Schiffbau lernte, daß er eigenhändig einen aus zwei Stücken zusammengesetzten Fockmast fertigte, daß er sich den Titel eines Schiffszimmermeisters oder eines holländischen Zimmerbaas erwarb, ist weltbekannt – er baute sich eine Bettstelle wie der König Odysseus und machte sogar Badewannen, die eigentlich Böttcherarbeit sind. Aber er arbeitete auch in den Schmieden und schmiedete während seines Aufenthaltes in Oesterreich 18 Pud Stangeneisen, womit er sich ein Paar Schuhe verdiente, die er mit Stolz trug. Der Tausendkünstler hatte sich auch auf die kleine Chirurgie geworfen: er besuchte in Leyden das Anatomische Theater und den berühmten Boerhaave, sezierte, schröpfte und ließ zur Ader, fühlte aber einen besonderen Beruf zum Zahnarzt. Die Zahnarzneikunde trieb er mit wahrer Leidenschaft: in Rußland zog er seinem ganzen Hofstaate und vielen anderen Unterthanen, wenn sie Zahnschmerzen hatten, sogar wenn sie keine hatten, die Zähne aus. „Geißfüße“ und Zahnzangen führte er beständig bei sich.
Peter der Große läßt sich jedoch mit den Königskindern, die nach Art von Rousseaus Emil zur Arbeit angehalten werden, nicht recht wohl vergleichen. Er erzog sich gewissermaßen selbst, und zwar in der ihm zusagenden Weise; wenn er sich in der Folge verschiedene Künste und Fertigkeiten aneignete, so geschah das aus Instinkt: das Handwerk war für ihn eine Art Sport, ein nützlicher Zeitvertreib. Gar oft greifen Fürsten noch in reiferen Jahren aus reiner Passion zu einer mechanischen Arbeit, in der sie es weit bringen und mit der sie sich allerdings würden ernähren können, falls das überhaupt in Frage käme; diese Arbeit verhilft ihnen, wenn sie nicht auf die Jagd gehen, zu der notwendigen Bewegung und ersetzt ihnen das Turnen und das Fechten. Auch der verstorbene Zar Alexander III. hatte dergleichen Passionen: er fällte Bäume wie Gladstone, spaltete Holz wie unser Prinz in „Tausendundeine Nacht“, schor den Rasen seines Gartens, schaufelte Schnee: er half auch zuweilen, wie erzählt wird, den Handwerkern, die im Palaste beschäftigt waren, mit Vorliebe den Tischlern und den Tapezierern.
Stark ist die Liebe zum Handwerk von jeher bei den Bourbonen hervorgetreten. Sie haben an den Ambosen geschwitzt wie die Schmiede, Bücher gebunden und gedruckt. Das Einbinden, das Kleistern und das Pappen macht, wie das Drechseln, den höheren Ständen besonderes Vergnügen – auch der verstorbene Kaiser Friedrich III. soll gelernter Buchbinder, nebenbei gelernter Tischler gewesen sein. Ein von ihm verfertigter Stuhl wird in Schloß Babelsberg gezeigt. Man muß allerdings die Gönner der Buchbinderkunst von den Buchbinderdilettanten unterscheiden; viele vornehme Herren sind bloß durch die geschmackvollen Einbände, die sie herstellen ließen, berühmt geworden. Weder Heinrich III. von Valois, dessen Bücher an den Totenköpfen und ähnlichen Symbolen kenntlich sind, noch Jean Grolier, dessen braune Kalbslederbände mit der schönen Goldpressung auf Auktionen mit Tausenden [699] von Mark bezahlt werden, hat selbst gebunden. Heinrich IV. von Frankreich dagegen und die Geistlichkeit, in deren Händen die Herstellung von Büchern so lange gewesen ist, hat die Buchbinderei fort und fort und auch dann noch gepflegt, als dieselbe längst ein bürgerliches Gewerbe geworden war. Der Abbé du Seuil betrieb diese edle Kunst unter Ludwig XIV. als Liebhaber. Ludwig XV. dagegen war Setzer: er band keine Bücher, las keine Bücher, schrieb keine Bücher, druckte aber Bücher. Er verstand sich auch auf die Zubereitung von Ragouts und Saucen und setzte seinen Ehrgeiz darein, für den ersten Koch Frankreichs und, da die französische Kochkunst damals auf ihrer Höhe stand, für den ersten Koch der Welt zu gelten. Diesen Geschmack haben manche Fürsten mit ihm geteilt.
Sein Enkel, Ludwig XVI., war ebenfalls ein Setzer. Schon als Prinz hatte er in Versailles eine eigene Buchdruckerei, aus welcher im Jahre 1766 die „Maximes morales et politiques, tirées de Télémaque“, eine Auswahl von Sprüchen aus Fenelons „Telemach“, in einer Auflage von 25 Exemplaren hervorgingen. Er zählte damals 12 Jahre. Bei ihm trat der Handwerkergeist besonders deutlich hervor; er spielte nicht mit Szepter, Krone und Stern, er spielte mit Hammer und Feile, denn die Schlosserei ward später seine Lieblingsbeschäftigung. Und er hätte am Ende die Schlosserei wirklich brauchen können. Wer weiß, ob er nicht zum Handwerk gegriffen hätte, wenn die Flucht in der Juninacht des Jahres 1791 gelungen wäre. Dafür kam er im nächsten Jahre selbst hinter Schloß und Riegel, in den finstern Turm des Temple, den er mit aller seiner Geschicklichkeit nicht sprengen konnte.
Die Familie der Bourbonen scheint sich nachgerade in eine Familie von Handwerkern aufzulösen. Bekaantlich ist in den dreißiger Jahren ein Deutscher, Karl Wilhelm Naundorff, als der Sohn Ludwigs XVI. und der Königin Marie Antoinette und somit als der wahre echte Ludwig XVII. aufgetreten. Dieser Mann war Uhrmacher in Spandau, später in Brandenburg, zuletzt in Crossen, Vater einer zahlreichen Familie, unter aaderm einer Tochter, die mit Marie Antoinette wirkliche Aehnlichkeit besaß. Er hatte auch einen Sohn Ludwig Karl, der augenblicklich als „König Karl XI.“ in den Niederlanden, in der Nähe von Delft lebt. In Delft liegt sein Vater, der Uhrmacher, begraben. Er ist ein ältlicher korpulenter Herr mit weißem Haar und Schnurrbart, ein unverkennbares Bourbonengesicht. Er spricht von der Profession seines Vaters als von etwas Selbstverständlichem: sie kann die Ansprüche seiner Familie nur unterstützen und glaubhaft machen. Sein Vater war eben Uhrmacher, wie sein Großvater Schlosser war, und wie er selbst, er, Louis Charles de Bourbon, Herzog der Normandie, Holzschnitzer ist. Das Handwerk kennzeichnet die Könige von Frankreich und Navarra. Ehrt andere Könige nur die Würde, ehret sie der Hände Fleiß.
Nun, jede redliche Arbeit ehrt den Mann: das Wort den Redner, die Feder den Schriftsteller, der Besen den Straßenkehrer. Das ist der hohe Standpnnkt der mächtigen Republik der Vereinigken Staaten; das mag den Königssohn trösten, der nicht mehr bloß zum Spaße ein Handwerk treibt. Er mag an den Schwager Ludwigs XVI., an den menschenfreundlichen Kaiser Joseph denken, der aus Ueberzeugung das Schuhmacherhandwerk erlernte, die Gesellen um sich versammeln und ihnen die Abzeichen ihres Gewerkes in Silber überreichte, ein Ereignis, zu dessen Andenken noch gegenwärtig in Prag alle Ostern das Schusterfest, die sogenannte Fidlowatschka gefeiert wird. Fidlowatschka ist auf böhmisch der Name des Holzes, mit dem die Absätze, Ränder und Sohlen der Schuhe geglättet werden. Er denke an den Grafen Leo Nikolajewitsch Tolstoi, der so weit geht, die Handarbeit gleichsam für die Moral selbst zu erklären, der die Ausübung eines Handwerks wie eine Pflicht von jedem freien Manne fordert und der ebenfalls das Schusterhandwerk gewählt hat. Er arbeitet tagtäglich vier Stunden mit dem Knieriemen. Als er zu dieser Ueberzeugung gelangt war, ließ er einen Schuhmachermeister zu sich aufs Schloß kommen; derselbe mußte ihm zeigen, wie man eine Sohlennaht näht, mit der Ahle einen Stich durchs Leder macht und die mit Schweinsborsten verdrehten Spitzen eines Fadens durchsteckt. Alles Notwendige hatte er angeschafft. Zwei Wochen lang nahm der Graf in seinem Schlosse täglich von Mittags bis 5 Uhr nachmittags Unterricht bei dem Meister, ängstlich um dessen Zufriedenheit bemüht und begierig, Fortschritte zu machen. Und dabei ist der Graf schon alt, gegenwärtig bald ein Siebziger, sein Augenlicht schwach, seine Hand zitterig. Uebrigens arbeitet er nur für sich und seine Tochter, der er ein Paar Knöpfstiefel aus Glacéleder mit russischem Kalbslederbesatz und Kappe gemacht hat.
Ueber den Nutzen solcher Beschäftigung nicht für den Lebenserwerb sind die Ansichten verschieden. Sie hat aber zweifellos einen hohen erzieherischen Wert. Die gründliche Kenntnis eines Handwerks schärft unsere Sinne und macht uns zu Meistern über die größte Gehilfin des Menschen, die Hand. Darum lernen heute nicht nur Prinzen nebenbei ein Handwerk. Ueber die meisten Kulturländer hat sich der Handfertigkeitsunterricht verbreitet und in wohlgeleiteten Schulen werden Tausende und Abertausende von Knaben aller Stände mit den Anfangsgründen irgend eines Handwerks vertraut gemacht. Ob aus der Schar der Dilettanten einige Meister hervorgehen werden? Wer weiß es! Jedenfalls werden unter diesen Umständen in Zukunft „Handwerker von Stande“ nicht mehr so selten sein wie bisher.
Nachdruck verboten.
Alle Rechte vorbehalten.
Sturm im Wasserglase.
(7. Fortsetzung)
Sobald der Rittmeister sporenklirrend auf der Schwelle erschien, ertönte ein Schrei. Bärbchen Marei, die der Thür zunächst stand, erkannte den kecken Kriegsmann, der sie attackiert hatte, und flüchtete. Die anderen Mädchen folgten ihr, in der fernsten Ecke der Stube drängten sie sich ängstlich zusammen.
Und er war doch so schön in der ganzen Pracht seiner Ausrüstung: mit dem rotea goldbetroddelten Dollmann, dem Säbel und der gestickten Säbeltasche, den bequasteten und bespornten Reiterstiefeln.
„Pardon! o Pardon!“ rief er, halb lachend, halb bestürzt über den Erfolg seines Sturmlaufes. „Meine Intention ist nur, sabmissest der Demoiselle Braut meine Gratulation zu Füßen zu legen.“
Seine Augen musterten den Knäuel junger Mädchen. Verdammt! da war auch die kleine Kantorin. Und das Schätzchen des riesenhaften Grobians. Aber welche mochte die Braut seines Hauswirtes sein? Sie waren alle bildhübsch.
Die Mädchen sahen ihn wieder an, aber nur mißirauisch, höchstens neugierig. Alle die kleinen Festungen hinter den Fischbeinleibchen waren ja schon besetzt; der Subkonrektor hatte sich sogar in zweien derselben verschanzt. Unglaublich für einen roten Husaren!
Aus dem Nebenkabinett, wo die Dreifußterrine stand, drang ein Wispern.
Herr Struve war durch eine Seitenthür dort eingetreten und obgleich er sich innerlich empörte über den Husarenstreich, war doch in seiner Zusprache ebenfalls von guter Miene die Rede.
Die Rehaugen seiner Braut sahen klagend zu ihm auf. Sie war entrüstet, daß sie sich so zur Schau stellen sollte. Dann kam ein Zug von unbeugsamer Entschlossenheit in ihr Gesicht.
Sie ergriff mit der ihr eigenen Zierlichkeit den Zinnteller, auf den ihre Mutter ein hohes Glas voll schäumenden Glühweines stellte, und ging kerzengerade in die Visitenstube auf den Gast zu, der bereits etwas betroffen auf die junge Mädchenschar blickte.
„Die Braut bittet, ein Glas auf ihr Wohl zu trinken,“ sagte die Hausfrau, ihre Tochter vorstellend. Bei dem Aufleuchten der schwarzen Augen des Fremden flog ein Lächeln befriedigter Muttereitelkeit über ihre immer gefaßten Züge.
Mit Staunen haftete der Blick des jungen Mannes auf der reizenden Gestalt im hellgleißenden halbseidenen Kleid, dessen eingewebte Mohnblüten nicht träumerischer aussahen als das unbewegte Gesichtchen, nicht röter waren als der süße Mund. Und diesen kleinen Mund durfte der trockene korrekte Sekretarius küssen, wann und so viel er wollte? Mille tonnerres!
[700]
[702] Hol’ ihn dieser und jener! dachte Struve, an den nun auch die Reihe kam, eifersüchtig zu sein. Hatte er sich noch nicht satt gesehen?
Nein; noch lange nicht. Aber sein Mundwerk kam wieder in Gang. Das Glas mit zartem Finger ergreifend, sprach er, galant sich verneigend: „Wolle die Demoiselle mich exküsieren wegen meines Einfalles in die bräutliche Festivität. Das bringt der Krieg so mit sich. Und da Hochehrwürden seinem Herzen Luft gemacht hat, so hoffe ich, die Affaire wird demselben keinen Schaden thun.“
Er harrte eines höflichen Wortes; aber Magdalena blieb stumm.
„Ich bin hoffentlich nicht zu früh gekommen,“ fuhr er eifrig fort, „habe die Demoiselles nicht derangiert in Ihrem Geheimbunde? Sonst müßte ich mich sofort entfernen.“
Sie schwieg und begann langsam rückwärts zu gehen.
Eine Röte stieg in sein Gesicht. Das Glas hebend, sagte er: „Will die Demoiselle mir die Ehre erzeigen, einmal mit mir anzuklingen auf Ihr zukünftiges Wohlbefinden?“ Er wollte ein Ende machen, trinken und gehen. Er hatte genug von der schönen Braut.
Ohne einen Laut von sich zu geben, mit steifem Knix zog sie sich zurück.
Die Mutter zupfte sie verstohlen an der Spitzenmanschette, ihr Bräutigam räusperte sich, leise mahnend – ohne Erfolg.
Der Husar strich sich über die Stirn.
Da rauschte plötzlich ein schweres Seidenkleid durch die Gruppe der atemlos lauschenden Mädchen. Kiliane, die bis jetzt hinter ihnen auf dem krummbeinigen Kanapeechen gesessen und vor unterdrücktem Lachen eine Rose zerbissen hatte, chassierte hervor.
„Monsieur verlangt zu viel,“ sagte sie mit mutwillig sprühendem Blick. „Die Demoiselle Braut ist viel zu sittsam, als daß sie sans façon mit einem fremden Kavalier an das Glas klingen würde. Da meine Wenigkeit aber, außer der Dienstbarkeit als Hoffräulein bei der Frau Fürstin, frei ist wie der Falter, der durchaus die Flügel an der Kerze dort sich verbrennen will, so biete ich mich als Ersatz.“
Aufatmend wandte sich der aus der Klemme befreite Husar ihr zu.
Welch reizende Blondine, und welch feines Benehmen! Dieser Knix, bei dem sie den Fächer an beiden Enden faßte und hoch hob, als könnte er sonst in der Flut des blauen Damastkleides versinken!
Hofleute erkennen sich an solchen geheimen Zeichen wie die Rosenkreuzer.
Während sie mit dem Glas, das ihr Struve eiligst präsentiert hatte, an das des Offiziers stieß, neckte sie: „Hält das weimarische Heer die Augustenburg keiner Eroberung wert? Wir haben noch keinen der feindlichen Helden zu sehen bekommen.“
„Bisher hat es Ihrer Durchlaucht nicht gefallen, uns zu empfangen. Aber heute nachmittag haben wir die Nachricht bekommen, daß wir morgen unsere Aufwartung machen dürfen. Also wird nunmehr die Belagerung beginnen. Und wir werden nicht eher ruhen,“ erklärte er feurig, „bis sich die Burg auf Gnade und Ungnade ergeben hat.“
„Giebt es kein Lösegeld, das uns frei machen könnte, wenigstens von der Ungnade?“ lachte sie übermütig.
„Was würde die schöne Besatzung bieten?“ fragte er unternehmend und strich den Bart in die Höhe.
Kiliane lächelte und lugte unter ihrem Fächer hervor ihn an. Dann küßte sie die Spitze desselben und warf ihm mit einem schmachtenden Blick gleichsam den Hauch zu.
Ein dunkles Rot schoß ihm in die Stirn; die schwarzen Augen blitzten sie fast wild an.
Die jungen Mädchen saßen erstarrt über dieses Kunststück. Da ging einem ja der Atem aus. Das war etwas anderes, als wenn der Ratskämmerer um ein Küßchen in Ehren bettelte und dann schmatzte, daß es durch die ganze Stube knallte.
Bärbchen Marei warf einen schelmischen Blick auf ihn. Das sollte ein Kuß sein? Das geschah ihm recht.
Den Rittmeister machte es ganz toll.
Er ward so beredt, daß die bei der Bewirtung der Gäste helfende Fieke sich sagte: so hängt also die Schwadron und der Schwadroneur zusammen. Und er pokulierte, daß die Hausfrau meinte, der unerschöpfliche Krug von der Hochzeit zu Kana würde heute bei ihr sehr am Platze sein.
Sie atmete auf, als sie melden konnte, die Portechaise harre wieder draußen auf das Fräulein.
Kiliane verstand, lachte und erhob sich.
Fieke, die dem tollen Treiben Kilianes mit weit aufgerissenen Augen zugeschaut hatte, flüsterte, ihr das schleppende Gewand nachtragend: „Aber Fräulein! Sie hat sich doch ein Eichhörnchen gegossen!“
Kiliane lachte, fast schrill klang es. „Ich kann doch nicht in einem hohlen Eichbaum wohnen, und Deinem Eichhörnchen wird nicht viel mehr bleiben, Schneiderchen. Lustig leben! Zum Sterben, ob selig oder unselig, wird mir schon Zeit und Gelegenheit werden.“
Unter Geplauder entfernten sich auch die andern jugendlichen Beistände des Abends.
Struves Hand strich über Magdalenes feine Brauen. „Warum ist mein Herzenstrost so ernst?“
„Herr Sekretarius,“ zwitscherte der Bachin Stimmchen dazwischen, „kann Er mir und meinem Bastel nicht die Erlaubnis verschaffen, daß wir in Dornheim bei unserem alten Gevatter Pastor getraut werden dürfen? Da braucht’s keinen großen Staat und Schmaus.“
„Ich will thun, was ich vermag,“ verhieß eilig Struve. „Bekomme ich keinen rechtschaffenen Kuß zum Abschied?“ fragte er zärtlich Magdalene.
„Darf ich von der Demoiselle Braut mich konzedieren?“ klirrte der Rittmeister dazwischen, immer die Augen auf Kiliane gerichtet.
Magdalene spendete einen letzten stummen Knix.
„Nun, mein geliebtes Herz?“ flüsterte Struve.
Sie lehnte das Haupt an seine Brust.
„Herr Sekretarius,“ rief Kiliane, mit dem Husaren davon gehend, „darf ich Seine Ritterdienste in Anspruch nehmen?“
Da stampfte Struve mit dem Fuß auf, küßte Lenchen schnell und herzhaft und folgte dem Hoffräulein.
Ein Diener mit der Stablaterne voraus, das Verdeck der Portechaise zurückgeschlagen, daß das gepuderte Haupt des Hoffräuleins Platz hatte, so setzte sich der Zug in Bewegung.
Nebenher schritt Krainsberg, eifrig zu dem auf den goldgelben Kissen sich wiegenden Fräulein hinein redend; ihr lachendes Antlitz, der weiße Hals, die runden Arme leuchteten aus der Dämmerung, umschwebt von dem Duft welkender Rosen.
Struve, Hut und Stock in der Hand, folgte ihnen in gemessener Entfernung, in träumerisches Gedenken an den letzten Kuß versunken.
Da vertrat ein einsamer Nachtwandler, der auf den kurzen Gräsern des Pfarrhofes lautlos auf und ab spaziert war, den Dahinziehenden den Weg.
Sie hielten an. Der Kammerjunker von Eichfeld stand mit gezogenem Hut an der anderen Seite der Portechaise.
Kiliane bog sich mit hochfahrendem Aufwerfen des Köpfchens heraus. „Woher so spät?“
Das Wort versagte ihm. Seine Augen starrten den Husaren an. „Ich kam, das Fräulein von Heymbrot durch die jetzt feindlich besetzte Stadt zu geleiten,“ sagte er endlich in heiserem Tone.
„Wenn das Fräulein vom Rittmeister von Krainsberg geleitet wird, ist es geschützt genug,“ rief scharf der Husar, indem er nachlässig grüßte.
Auch der andere schwenkte nur leicht seinen Dreispitz und erwiderte ebenso schroff: „Aber der Kammerjunker von Eichfeld ist dazu berufen.“
Sie neigte sich gegen beide. „Mein Heimweg wird um so plaisanter sein.“
Der kleine Zug ging weiter.
„Wo werde ich morgen dem Fräulein meine Aufwartung machen dürfen?“ fragte Krainsberg.
„Morgen mit dem Frühesten wird das Fräulein auf die Augustenburg zurückkehren müssen,“ entgegnete Konrad mit bebenden Lippen. „Ihre Durchlaucht wünschen, daß der Hofstaat vollzählig sei für die Assemblee, die bei uns bevorsteht.“
Krainsberg verbeugte sich spöttisch. „Der Herr Kammerjunker bringt willkommene Botschaft. Die Assemblee findet uns zu Ehren statt.“
[703] „Wir werden also den Feind mit Lustbarkeiten besiegen,“ sprach Kiliane kokett zu Krainsberg.
Krainsberg lachte ausgelassen. „Wenn wir nur nicht auch mit Puppen spielen sollen! Es wird uns erzählt, Ihre Fürstin bossiere Wachspuppen, und sogar Männer müßten ihr dabei helfen. Dafür würden wir uns meiner Treu unterthänigst bedanken.“
„Ohne Sorge!“ erwiderte sie spöttisch. „Die Mühewaltung für die Wachsfiguren bleibt unseren Kavalieren vorbehalten. Als Ritter ohne Furcht und Tadel werden sie Wache stehen, daß der gefährliche Husar die Puppen nicht versehrt.“
„Kiliane!“ rief Konrad. Es war ein Ton in seiner Stimme, den sie noch nie gehört hatte, vor dem sie bis ins Herz erbebte.
Auch Krainsberg horchte auf. So vertraut und so wild? Tant mieux! Der Spaß war um so größer!
Jetzt hielt die Portechaise vor der Hauspforte des Kanzlers, und beide Herren streckten die Arme hinein, um das Fräulein heraus zu heben, zuversichtlich der Rittmeister, totenblaß Konrad.
Sie gab jedem eine Hand und ließ sich von beiden bis an die Thür führen.
Dann knixte sie, vor dem Rittmeister mit verheißungsvoller Süßigkeit, und mit grausamem Lächeln vor dem Junker, während die Diamantnadel auf ihrem Toupet mit flirrendem Blitz dem zuckenden Wetterschein antwortete.
Als aber Struve herantrat, erwiderte sie seine gemessene Verbeugung mit fast furchtsamer Scheu und flog schnell wie ein schillernder Ballon ins Haus hinein.
Mit grellem Geläut schloß sich das Thor.
Schadenfroh lachend funkelte Krainsbergs Blick in das Gesicht des Junkers. Der Verteidiger der Wachspuppen!
Da war es, als erstarrten die beweglichen Züge Konrads; sie schienen plötzlich von Eisen zu sein. Die grauen Augen bohrten sich fest und kalt in die seines Gegenübers, daß diesem das Lachen verging und statt dessen eine zornige Röte in das Gesicht stieg.
Struve trat dazwischen und sagte trocken: „Das Thor der Neidecke, wo der Herr Kammerjunker nächtigt, wird sogleich geschlossen werden. Und in meinem Hause findet der Herr Rittmeister auch niemand mehr wach, wenn ich zu Bett gegangen bin. Ueberdies wird das Gewitter bald losbrechen.“
Stumm und förmlich grüßten alle Drei und gingen nach ihren Wohnungen.
Noch war es heller Tag, als von allen Seiten der Zuzug zu dem Rokokoschlößchen der Fürstin begann.
Zuerst erschienen die Mitglieder der Hofkapelle, die aufgeboten worden waren, um die Assemblee zu verherrlichen: die Hofprofessionisten, denen es als Nebenamt auferlegt war, ein Instrument zu spielen, der Stadtpfeifer aus der Residenz mit seiner Zinke und den Lehrjungen, die Kantoren von nah’ und fern, die Geige unter dem Arm oder die Baßviola auf dem Rücken.
Natürlich zu Fuß; denn Reisevergütung wurde nicht gezahlt. Die Korn- und Küchenschreiber des Hofhaltes vervollständigten die Musik mit Laute und Gambe, die Leibjäger mit Trompeten.
Auf Feldwegen nahten Staatskarossen mit den Familien des Landadels; aus der Stadt her wankten knarrende Kutschen mit den Honoratioren, die den Ratstitel führten.
Im Festsaal unter dem Thronhimmel stand in Hermelinmantel und Diadem die Fürstin, vor welcher die weimarischen Offiziere defilierten. Fernher schien das Komplimento zu tönen, welches die Musikanten anhoben, die in Heiduckenlivree die Galerie füllten unter Führung ihres Kapellmeisters, der zugleich der Kammerdiener der Fürstin war.
Mit ihren Gedanken weitab von dem festlichen Treiben stand Kiliane unter den Festgästen. Beim Durchschreiten der Korridore auf dem Wege zum Saal war ihr Severin begegnet und sein unheimlicher Blick hatte sie verstört.
Eine dreiste Stimme schreckte sie auf. „Endlich wird mir das Glück zu teil, meine Huldgöttin wieder zu sehen.“ Krainsberg stand vor ihr. In seinem Blick war nichts von der Unterwürfigkeit einer Göttin gegenüber zu lesen, sondern die Erinnerung an den Fächerkuß. „Ich habe auf dieses Zusammentreffen gehofft wie auf meine Seligkeit.“
„O, auch bei uns giebt es manche, die nichts sehnlicher wünschen als ein Zusammentreffen mit den Herren Feinden,“ rief eine erregte Stimme. Es war Eichfeld, der aus dem Kreis der Hofherren dem Rittmeister entgegentrat.
„Und das wird uns sicherlich noch oft bevorstehen,“ bog Kiliane süß lächelnd dem Wort die Spitze ab.
Krainsberg, der auf Eichfelds Rede seinen Bart herausfordernd in die Höhe gedreht hatte, wandte sich wieder zu ihr. „Wer weiß!“ sagte er. „Schnell wie wir kamen, sind wir vielleicht wieder fort. Es liegt etwas in der Luft. Aber wir nehmen Geiseln mit. Und ich werde vorschlagen, statt eines gelehrten Rates, der die hiesigen Gesetze kennt, lieber ein schönes Fräulein zu entführen.“
Zornrot fuhr Eichfeld auf.
„Will der Herr Kammerjunker eine kleine Erfrischung besorgen?“ befahl sie über die Schulter.
Eichfeld ging zögernd.
„Geiseln?“ wendete Kiliane sich rasch an Krainsberg. „Wie meint der Herr das?“
„Ich will es dem Fräulein erklären, wenn Sie mir morgen vormittag die Ehre gewähren wollen, mich zu empfangen,“ wisperte Krainsberg ihr ins Ohr.
„Ich habe Dienst,“ wehrte sie ab.
„Leere Ausrede! Die Frau Fürstin schläft aus.“
Kiliane würdigte ihn keiner Antwort. Hinter ihr fragte der fremde Major den ersten Kammerherrn: „Also der Sekretarius Struve ist die Seele der hiesigen – Pardon! – aufstutzigen Regierung?“
Der Kammerherr wurde zur Linie; der goldne Schlüssel schwebte obenauf.
„Ein aller juristischen Finessen kundiger Mann, der den Herren in Weimar gute Dienste leisten wird, wenn man ihn dort zum Reden bringen kann,“ sagte er höhnisch lachend. „Schade, daß man nicht“ – er machte die Bewegung des Ansetzens der Daumenschrauben.
Kiliane zuckte zusammen und lugte von der Seite nach der Gruppe hinüber. War das nicht Verachtung in den alten Soldatenaugen?
Geisel – Entführung – Struve – reihten ihre Gedanken aneinander. Welcher Sinn lag in den Andeutungen? Sie vermochte ihn nicht zu erraten; aber so viel stand fest: ihrem Jugendfreund drohte eine Gefahr und gerade jetzt, da er Hochzeit halten wollte.
Eichfeld kehrte zurück, gefolgt von einem Lakaien, der auf einem Kredenzteller kleine vergoldete Gläser mit nach Ambra duftendem Wein und kühlende Himbeerlimonade darbot.
„Mir nicht, aber hier,“ sagte sie mit zerstreutem Lächeln, auf den Rittmeister deutend, und entschlüpfte.
Die beiden jungen Männer standen sich gegenüber. Ein leises Auftreten des Fußes – ein unterdrückter Fluch – dann sahen sich beide mit den Kehrseiten ihrer Perücken an.
Kiliane wand sich durch die plaudernden Gäste. War keiner darunter, den sie mit einer Warnung für Struve betrauen konnte? Das war jetzt ihr einziger Gedanke.
Nein; die Räte waren alle gefügige Werkzeuge ihrer Herrschaft.
Rastlos weiter schweifte ihr Blick – hinauf zur Galerie, von der sich jetzt die Musik zurückzog.
Da verließ auch der junge Kantor Bach sein Cembalo. Kilianes Augen hafteten an dem starkkantigen Gesicht, dessen mürrischer Ausdruck sich ebensowohl dem Kleid der Dienstbarkeit als den vergoldeten Schnörkeln und anmutigen Amoretten der Balustraden widersetzte. Und ihre Gedanken spannen einen Faden zu der Braut des Kantors, die so zutraulich beim Fest in der Superintendentur mit Struve geplaudert und irgend eine Bitte an ihn gehabt hatte. Dann schlug sie die Reifen übereinander, nahm das weite Kleid zusammen und eilte die Hintertreppe hinab.
Bach hatte in der jetzt leeren Stube im Unterstock sein Heiduckenhabit als Hofmusikant mit dem ehrbaren Kantorenrock vertauscht.
Da huschte Kiliane zur Thür herein. Hastig sagte sie: „Kennt Er den Sekretarius Struve?“
[704] „Zu dienen,“ erwiderte Bach. „Er ist ein Herr von großen Meriten; ich bin ihm zu Danke verpflichtet.“
„Dann wird Er ihm wohl gern einen Dienst erweisen,“ sprach sie rasch weiter. „Hat Er ein Papier bei sich? Einen Griffel? Er ist doch ein Stück Schulmeister.“
Bach suchte in seinen Taschen; ein beschriebenes Notenpapier kam zum Vorschein.
„Ein Stückchen Chaconne; es fiel mir auf dem Herweg ein. Vielleicht könnte das Fräulein zwischen die Notenlinien schreiben.“ Er zögerte doch.
Sie nahm es rasch weg und schrieb eilig: „Sei der Herr Sekretarius auf Seiner Hut. Es drohen Ihm Gefahren. Unternehme Er morgen nach der Hochzeit eine kleine Lustfahrt mit Seiner jungen Frau. Nur über die Grenze.“
Wunderlich standen über dem Warnungsruf auf- und abjagende Zweiunddreißigstel und zitternde Arpeggien.
„Uebergebe Er den Zettel noch heut’ dem Sekretarius, und wenn dieser selbst wegen des Polterabends abwesend ist, einem seiner Leute. In dem Hause sind alle treu.“
Bach steckte das Papier ein.
„Vergesse Er es nicht!“ mahnte sie.
Sebastian schüttelte lächelnd den Kopf. „Ich denke schon an meine Chaconne.“
Sie schlich wieder davon.
Als sie nach der Hintertreppe einbog, prallte sie zurück; der schmale, schwarze Schatten, der jetzt immer ihren Weg kreuzte, stand an den Pfeiler geschmiegt.
Sie eilte der Haupttreppe zu.
Dort klirrte es ihr entgegen. „Endlich treffe ich Sie allein,“ flüsterte es heiß in dem dämmerigen Aufgang, und der Husar streckte den Arm nach ihr.
Sie bog aus. „Fort! fort! Sein Major sucht Ihn.“
Im nächsten Augenblick stand Eichfeld neben ihr, faßte sie an der Hand und riß sie mit sich fort.
Sie hörte seinen keuchenden Atem. Sie wollte sich losmachen; wie Eisenklammerm hielten sie seine Finger.
Droben waren alle Korridore, alle Gemächer voll Menschen, voll gesellschaftlichen Treibens. Von der Eingangsrotunde führte eine Thür auf den Balkon.
Er stieß sie hinaus und warf die Thür hinter sich zu.
Sie wollte sich widersetzen, wollte ihn wie gewöhnlich zur Seite schieben – sie vermochte es nicht.
Hochaufgerichtet stand er. Selbst in der dämmerigen Nacht sah sie seine großen grauen Augen blitzen. Mit klingender Stimme sprach er:
„Das Fränlein kann sogleich gehen, wohin Ihm beliebt. Aber vorher will ich einmal sagen, was mir auf dem Herzen liegt. – Ich habe Sie geliebt, bis zur lächerlichen Blindheit hat meine Seele an Kiliane von Heymbrot gehangen. Meines altväterischen Hauses habe ich mich geschämt – und das Haus hätte sich Ihrer schämea müssen; denn kein leichtfertiger Frauenfuß ist je über die Schwelle geschritten. Verkaufen wollte ich meinen Hof, wo selbst die Tiere treue Herzen haben, verkaufen um eines Frauenzimmers willen, das mit jedem karessiert!
Aber die Augen sind mir aufgethan worden, Gott weiß allein, unter welchen Schmerzen. Ich schüttle den Staub von meinen Füßen und gehe heim unter mein Dach, das ich sträflich in meinem Wahnsinn mit Schulden beladen habe. Durch meiner Hände Arbeit will ich gut zu machen suchen, was meine Thorheit verbrochen hat. Ich will gern die Sense selbst schwingen, damit meine Hände rein werden davon, daß sie Ihnen die Schleppe nachgetragen haben, ich will mit Frost und Hitze, mit Sturm und Regen kämpfen, auf daß der ekle Duft von Ihrem parfümierten Puder aus meinem Atem weicht. Gott sei gelobt, daß es noch eine Sühne für mich giebt.“
Er wollte gehen, aber ihre Finger krampften sich in seinen seidnen Rock.
Die zornige Glut auf ihren Wangen war einer Totenblässe gewichen.
„Nun höre der Junker auch mich,“ kam es tonlos von ihren Lippen.
„Sollte ich den Mann ehren, der sein Vaterhaus verleugnete, sich seiner schämte bis auf den alten Schlüssel herab? Ein Vaterhaus! Ich habe es verloren, als ich kaum denken konnte. Aber die Erinnerung ist mir geblieben, heiliger als die Kirchen, ehrfurchtgebietender als Eure Schlösser. Hätte ich ein solches vom Himmel zugeteilt bekommen, die Hände hätte ich blutig arbeiten wollen; mit dem ärmsten Dach wäre ich zufrieden gewesen. Hinaus bin ich gestoßen worden, uud wenn etwas mich bewahrt hat davor, die Verworfene zu werden, für die der Junker mich hält, dann war es das letzte Bild aus meinem Vaterhaus: meine Mutter am Spinnrad. Ich habe es dem Herrn ja gesagt, aber er war weit entfernt davon, das Rätsel zu erraten, daß das Fräulein von Heymbrot nichts weiter ersehnt als ein ehrliches Heim und das tägliche Brot.
Den Weg, auf dem ich jetzt war, bin ich gegangen, um einen braven Mann zu warnen. Den einzigen Mann, der mir in meinem elenden Leben seit meines Vaters Tode begegnet ist.“
Sie hielt inne. Ein leises Klopfen tönte heraus. „Hört der Junker? Das Klopfen des Hofmarschallstabes; ich bin darauf dressiert, wie der Hund mit dem Stachelhalsband.“
Sie eilte hinein.
Er lehnte totenblaß, wie geblendet von der Offenbarung, die ihm geworden war, an der Karyatide, die das verschnörkelte Thürsims trug.
Kiliane kam schwankenden Schrittes in den Saal.
Sie bemerkte den ernsten Blick der Oberhofmeisterin nicht. Schon stand alles im Kreis.
Der Husar klirrte mit der Sicherheit des siegreichen Eroberers an sie heran. „Das Fräulein hat mich ohne Antwort gelassen. Also morgen früh werde ich meine Aufwartung machen.“
Ehe sie „Nein“ sagen konnte, war er fort. –
| * | * | |||
| * |
Die Assemblee war zu Ende. Kiliane hatte, mit Mühe ihre Aufregung bemeisternd, ihr Zimmerchen erreicht. Dort sank sie zusammen.
Fieke, die am Morgen mit dem Küchenwagen herausgekommen war, um dem Fräulein ein Staatskleid aufzufrischen, lief erachrocken herzu.
Vergeblich trug sie Wasser herbei, besprengte das Fräulein mit Eau de Lavande.
Kiliane blieb auf den Knieen liegen, laut weinend, die Hände ringend. Mit Mühe brachte das Schneiderchen sie aus dem Hofkleid in ihr Nachtgewand.
„Jammert Sie um den Husaren?“ fragte Fieke.
„O Thorheit!“
„Hat der Junker Ihr etwas gethan?“
„Der geht fort und wird ein braver Mann auf dem Erbe seiner Väter.“
Weitere Auskunft gab die Schluchzende nicht und nun weinte Fieke mit ihr, da sie nichts anderes thun konnte. Sie betete auch und schlief endlich auf einem Bündel abgelegter Kleider, die blauseidnen Pantöffelchen als Kopfpolster, ein, während Kiliane mit verzweifelten Augen in die Nacht hineinstarrte.
Das war nun das Ende von ihrem gepriesenen Maskenspiel. O wie sie es bereute! Spöttisch, kokett, gefühllos hatte sie sich gezeigt, weil das die Waffen waren, die das schutzlose Mädchen bewahrten vor der Geringschätzung, vor dem demütigenden Mitleid, das sie nicht ertragen konnte.
O, wie falsch war ihr Stolz gewesen!
Um von ein paar Hofleuten, diesen vergoldeten hohlen Nüssen, nicht hochmütig angesehen zu werden, hatte sie ihr wahres Gesicht verborgen, ihr Glück damit verscherzt.
Struve hatte recht gehabt mit seiner Warnung. Jetzt sah sie es: ihre Larve hatte Eichfeld dahin gebracht, sich anders zu zeigen, als er war.
Und wie immer das Böse sich des Menschen bemächtigt, ihn fortreißt, da er noch meint, es beherrschen zu können, so hatte sie ihn zuletzt zur Verzweiflung gebracht mit ihrem Spiel, das sie, selbst verzweifelnd, getrieben.
Und dann fielen ihr die letzten Worte des Husaren ein; jetzt erst wurde ihr der Sinn derselben klar. Eine neue Schlinge, die sie sich selbst geknüpft hatte, zog sich zusammen. Sie stöhnte auf.
Da huschte es draußen fort, leise gleitend.
(Fortsetzung folgt.)
[705]
Ein Herbstmorgen am Rhein.
Am Tag, getaucht in Gold und Blau,
Wie schön in grünen Lauben!
Frühnebel sank als Morgentau
Hernieder auf die Trauben.
Dem leisen Sang der Vöglein lausch’
Ich halb in Traum versunken –
Die haben einen Sonnenrausch
Sich heute angetrunken!
Ein Traum vom duft’gen Maientag
Lockt sie zu Girr’n und pfeifen –
Und Weh’n aus Maienstunden mag
Auch meine Brust ergreifen! – –
Da zieht ein Schiff. Ich kenn’s genau,
Und muß der Zeit gedenken,
Wo von dem Bord mich, holde Frau,
Gegrüßt dein Tücherschwenken.
Und als uns gab ein gut’ Geschick
Am Abend in den Weiden
Ein Heim bei Nachtigallmusik –
Wie selig war’s uns beiden!
Zwar sorgsam sprach dein alter Ohm –
Wir flüsterten verstohlen! –
Am Abend könn’ man leicht am Strom
Sich die Erkältung holen!
Wir aber hatten drum nicht Not
Und setzten fort die Sitzung –
Ach Gott, wenn etwas uns gedroht,
So war es die Erhitzung!
Von unsrer Liebe Ewigkeit
Ein Flüstern unter Thränen! –
Ein Tag war uns genug der Zeit
Für solches süßes Wähnen! –
Nach Norden du, nach Westen ich,
Weit über Strom und Hügel –
Und selten die Erinnrung strich
Vorbei auf flinkem Flügel.
Jetzt aber, wie den Dampfer hier
Ich setz’ die Flut durchrauschen,
Wird mir zu Mut, als müßten wir
Noch einmal Grüße tauschen! –
Umsonst, umsonst! Kein Tüchlein winkt,
Von schöner Hand geschwungen.
Der süße Maientraum versinkt,
Versinkt – verweht, verklungen!
Aßmannshausen am Rhein, 16. September 1895.
Emil Rittershaus.
Zwei Ehrentage eines deutschen Reiterregiments.
Das 2. westfälische Husarenregiment Nr. 11 hat im Laufe seines jetzt 88jährigen Bestehens viele Wandlungen erfahren, in denen sich der herrliche Aufschwung, den unsere Nation in demselben Zeitraum genommen, bezeichnend spiegelt.
Formiert wurde es zur Zeit von Deutschlands tiefster Erniedrigung durch Napoleons Schwager Murat, den neuen Beherrscher des ehemaligen Herzogtums Berg, das Napoleons allmächtige Gunst kurz zuvor zum Großherzogtum erhoben hatte. Murat, der sofort nach seinem Regierungsantritt in dem schwer bedrängten Ländchen ausgedehnte Truppenaushebungen vornahm, bildete es als bergisches Chevauxlegerregiment; bald darauf wurde es in ein Chasseur-, dann in ein Lanzierregiment verwandelt. 1810–1813 machte das Regiment, „der Not gehorchend, nicht dem eignen Trieb“, die napoleonischen Feldzüge mit. Die braven bergischen Lanziers verspritzten wie unzählige andre deutsche Krieger auf den durchglühten Hochflächen Spaniens, in den eisigen Schneewüsten Rußlands ihr Blut zu Ehren der französischen Gloire. Erst seit 1814, nachdem Berg durch den Wiener Kongreß an Preußen gefallen, war es dem Regiment vergönnt, neben altpreußischen Regimentern im Dienste des Vaterlands zu kämpfen und den Ruhm der einst so bewunderungswürdigen Friedericianischen Armee zu vermehren, in der die Kavallerie durch den Geist des großen Königs unter Mitwirkung eines Seydlitz und Zieten zur höchsten Entwicklung gelangt war. In jenem Jahre als westfälisches Husarenregiment neu gebildet, gehörte es 1815 dem 2. Armeekorps des niederrheinischen Kriegsheeres unter Blücher, im deutsch-französischen Kriege 1870 im Verbande des 10. Armeekorps der 2. Armee unter Prinz Friedrich Karl von Preußen an.
Zu seinen vielen Ehrentagen zählten der 16. Juni 1815 und der 16. August 1870. Unsere Bilder auf S. 700 und 701 stellen aus den gewaltigen Schlachten von Ligny und Vionville zwei Kampfesscenen dar, in denen sich die 11er Husaren durch glänzende Bravour ausgezeichnet haben. Beide sind von E. Hünten in Düsseldorf, woselbst das Regiment in Garnison steht, neuerdings für dieses gemalt worden; sie bilden den Wandschmuck des dortigen Husaren-Offiziers-Kasinos, das eine gestiftet von den Reserveoffizieren, das andere von den früheren aktiven Offizieren des Regiments.
Betrachten wir zunächst die Episode aus der Schlacht bei Ligny an der Hand der authentischen Schilderung in der dem Regimente gewidmeten Schrift des Freiherrn v. Ardenne. Gegen 3 Uhr nachmittags war auf der ganzen Linie St. Amand-Ligny die Schlacht in ungeheurer Wut entbrannt. Weithin erzitterte von der schrecklichen Kanonade die Erde. St. Amand, dicht in Rauch und Dampf gehüllt, entzog sich den Blicken. Während unten im Thale der Kampf tobte, hielt oben an der Windmühle von Bry unbeweglich das 11. Husarenregiment. Es hatte die Aufgabe, die große 12pfündige Batterie des 3. Korps zu decken, die bis jetzt alle Versuche des Feindes, aus St. Amand auszubrechen, durch ihr sprühendes [706] Feuer vereitelt hatte. Abends gegen 6 Uhr erreichte die Schlacht ihren Höhepunkt, obwohl noch immer neue preußische und französische Truppen in die Dörfer, wo der Kampf am heftigsten wütete, einrückten. Zweimal hatte die 3. Infanteriebrigade trotz tapferster Gegenwehr das Dorf St. Amand aufgeben müssen; der rechte Flügel des Blücherschen Korps war in ernster Gefahr, von dem linken Flügel des Feindes umwickelt zu werden, das Schlachtenglück neigte bedenklich zu gunsten der Franzosen. Aber Blücher gab die Hoffnung auf den Sieg nicht auf: wenn es ihm gelang, der drohenden Umarmung seines rechten Flügels zu begegnen, konnte er den linken feindlichen Flügel schlagen und Napoleons Centrum in die Flanke fallen. Daher mußte zunächst der Sturm auf St. Amand nochmals aufgenommen werden. Zum Vorgehen wurde diesmal die 5. Infanteriebrigade bestimmt. Das 11. Husarenregiment sowie die schlesischen Ulanen erhielten den Befehl, die Bewegungen oder den etwaigen Rückzug dieser Brigade zu decken. Beide Regimenter, unter Führung des ritterlichen Obersten von Thümen, brannten vor Begierde, an den Feind zu kommen. Als sie sich in Bewegung setzten, wurden sie von den feindlichen Batterien, die auf dem jenseitigen Thalrande standen, mit einem rollenden Flankenfeuer begrüßt. Die Vollkugeln schlugen vor und hinter den Regimentern ein, rissen lange Furchen in den weichen Ackerboden und überschütteten die Eskadronen mit einem Regen von Steinen und Schlamm. Endlich waren die Bataillone erreicht, in deren Gemeinschaft es jetzt zu kämpfen galt. Das 11. Husarenregiment erhielt seine Aufstellung hinter dem 1. Pommerschen Infanterieregiment Nr. 2, das sich eben unter seinem heldenmütigen Kommandeur Major von Witzleben zum Sturm auf St. Amand anschickte. In diesem Augenblicke kam Blücher vor die Front des 1. Bataillons angejagt, parierte sein schäumendes Pferd, daß es auf die Hinterbeine stieg, und rief den Grenadieren zu: „Kinder! haltet Euch brav! Laßt diese Nation nicht wieder Herr über Euch werden; vorwärts, vorwärts in Gottes Namen!“
Nur noch ein lautes, weithin schallendes Hurra erfolgte als Antwort, und die braven Infanteriekolonnen hatten sich mit jähem Ungestüm in den dicken, zähen Pulverdampf gestürzt, der vor dem einzunehmenden Dorfe, den Blicken undurchdringlich, über der Erde lagerte. Nur 300 bis 400 Schritte von der Dorfgrenze entfernt hielten die kampfbegierigen Eskadronen der 11er Husaren. Den Säbel in der Faust blickten die Wackern mit heißem Verlangen erwartungsvoll in die Dampfwolken, ob Freund oder Feind aus ihnen hervorbrechen werde. Oberst von Thümen, der sich weit vor die Front begeben hatte, um den richtigen Augenblick zum Angriff nicht zu versäumen, wurde mitsamt dem Pferde von einer Paßkugel niedergerissen. Oberstlieutenant v. Schmiedeberg mußte die Führung der Brigade übernehmen. Feindliche Batterien, die mit Recht hinter den Angriffskolonnen starke Reserven vermuteten, sandten über den ganzen Raum nördlich des Dorfes hinweg ein mörderisches Kreuzfeuer. Bald schlugen immer mehr Kugeln vor dem Regiment ein oder prallten in hohen Bogen darüber hinweg. Die Verluste mehrten sich empfindlich. Auch die zum Sturm vorgegangene Infanterie war nicht glücklich. Viermal hintereinander nahm sie St. Amand und verlor es wieder, immer von neuem setzte sie an, verbiß sich in den Feind und hielt aus, aber gegen 7 Uhr abends, als sie von einer frischen feindlichen Kolonne wie eine Woge zurückgespült wurde, ging das Dorf endgültig verloren. Gleichwohl hielt die Infanterie den Abschnitt unmittelbar nördlich des Dorfes noch immer mit heroischem Mute fest. Doch es dauerte nicht lange, da lief bei den 11er Husaren, die jetzt unmittelbar hinter dem Füsilierbataillon des zweiten Regiments standen, eine neue schlimme Meldung ein. Dieses Regiment hatte sich fast ganz verschossen.
Jetzt konnte sich Major Romberg, der schon mehrmals in fieberhafter Ungeduld, an den Feind zu kommen, mit einzelnen Eskadrons bis an das Dorf vorgedrungen war, nicht mehr enthalten, in den Kampf selbstthätig mit einzugreifen. Mit verhängtem Zügel sprengte er mit seinen Husaren in die vorderste Feuerlinie und gab seinen Leuten Befehl, ihre eigene Munition und solche, die sich von den Toten und Verwundeten auflesen ließ, den Füsilieren zu bringen. Die braven Soldaten des 11. Husarenregiments ritten scharenweise an die Tirailleurs der Infanterie heran und verteilten an sie, wenn ihr Feuer zu ermatten begann, die eigenen Patronen. Viele der Wackern fielen bei diesem Akte der Großmut als Opfer ihrer Hingebung. Diesen Vorgang vergegenwärtigt das Hüntensche Bild.
Als endlich der rechte preußische Flügel zurückgehen mußte und das Schicksal des Tages nicht mehr zu wenden war, half das Regiment den Rückzug decken, der in vollkommener Ordnung erfolgte. Die Schlacht bei Ligny war zwar verloren, aber die für die Kavallerie so schwierige Aufgabe, bewegungslos stundenlang in einem wirkungsvollen Kanonenfeuer halten zu bleiben, hatte sie trefflich gelöst.
Anders verlief der Tag von Vionville für das Regiment. In dieser gewaltigen Schlacht hatte gerade ein französisches Kürassierregiment einen wildverwegenen Angriff auf einige Compagnien des 52. Infanterieregiments gemacht, die sich östlich von Flavigny gegen die Chaussee Vionville-Rezonville vorbewegte. Als der Feind mit großem Verluste abgewiesen worden war, die Reste der Kürrassiere in wilder Flucht zurückjagten, auch die sichtbaren französischen Infanteriegruppen in deutliches Schwanken gerieten, hielt es General Redern, der mit seiner Kavalleriebrigade die Verbindung zwischen der 5. und 6. preußischen Infanteriebrigade zu sichern hatte, an der Zeit, einen Gegenstoß zu thun. Oberstlieutenant v. Rauch, Kommandeur des 17. (braunschweigischen) Husarenregiments, hatte, in der Meinung, daß sich französische Kavallerie in unmittelbarer Nähe befände und die eigene Infanterie zu decken sei, bereits sein Regiment in rascher Gangart entwickelt und aufmarschieren lassen; der Brigadegeneral setzte sich daher an die Spitze des 11. Husarenregiments, das als zweites Echelon folgte. Es war ein begeisternder Schlachtenaugenblick. Soweit das Auge reichte, wogte der Kampf. Ein immerwährendes Rauschen und Rollen des Infanteriefeuers ging die endlosen Linien auf und nieder. Die dumpfen Schläge der Artillerie waren einzeln nicht mehr zu unterscheiden und erkrachten in ganzen Salven. Der Rauch der brennenden Gehöfte hatte sich mit dem Pulverdampf verschwistert uud kroch in schweren Wolken am Boden, von der brennenden Mittagsonne niedergehalten. Ringsherum erscholl betäubender Lärm, überall drohte Schrecken und Vernichtung. In diesen Krater von Gefahren stürzten sich die Schwadronen ohne ein deutlich erkennbares Ziel, da der Pulverdampf den Feind verhüllte. Schon waren hier und dort auftauchende Gruppen feindlicher Infanterie niedergehauen und überritten worden, ebenso einige versprengte Kavallerieschwärme – da inmitten des Kampfgewühles bemerkte Rittmeister v. Vaerst, der seiner Eskadron vorausgeritten war, um den Angriffspunkt des Regiments genau zu erkennen, auf einer Anhöhe angelangt, eine in weiter Ferne südlich von Rezonville postierte feindliche Batterie. Er erkannte deutlich, daß sich dieselbe anschickte, die attackierende diesseitige Kavallerie unter Feuer zu nehmen. Sofort war aber auch sein Entschluß gefaßt, ihr durch einen Angriff zuvorzukommen. Da es bei der Entfernung und dem bedeutenden Schlachtenlärm schwer war, sich der Schwadron verständlich zu machen, winkte er nur mit dem Säbel, die Schwadron solle ihm folgen. Als er sah, daß diese ihn verstanden und vorrückten, setzte er sein Pferd in die schärfste Carriere. Der vierte Zug folgte ihm zuerst, dann ein Teil des dritten. Auch Oberstlieutenant v. Rauch, dessen scharfem Blick gleichfalls die feindliche Batterie nicht entgangen war, kam mit seinen Braunschweigern herbeigeeilt. Nun wurde von beiden Truppenteilen, v. Rauch und v. Vaerst an der Spitze, in die Batterie hineingeritten. Die Geschütze des Flügels, den die Braunschweiger attackierten, gaben noch eine volle Lage auf die Angreifenden, wodurch mehrere Husaren niedergerissen wurden, v. Vaerst aber und den ihm folgenden 11er Husaren gelang es, ohne einen Schuß zu erhalten, die Batterie zu erreichen. Im letzten Augenblicke versuchte noch ein feindlicher Offizier selbst Hand anzulegen und das zweite Geschütz des den Husaren zugekehrten Flügels gegen sie abzufeuern. v. Vaerst erreichte ihn indes früher, hieb auf ihn ein, schlug ihm durch die Parade einen Hieb übers Gesicht; er selbst empfing nur einen flachen Hieb über das Handgelenk. Nachdem v. Vaerst den feindlichen Offizier entwaffnet, wollte er den Tapfern schonen. Er rief den Husaren, die ihm folgten, zu: genug für ihn; in demselben Augenblicke erhielt jedoch der Offizier zwei Hiebe, die ihn niederstreckten. Auch die Bedienungsmannschaft, die sich tapfer mit Wischkolben wehrte, wurde bei ihren Geschützen niedergemacht. Nach Rittmeister v. Vaerst drangen noch einige Unteroffiziere, Einjährige und Soldaten in die Batterie ein. Zwei Husaren wurden verwundet. Als der Rest der Eskadron in aufgelösten Schwärmen anlangte, war die Arbeit bereits gethan. Leider gelang es der Bespannung der [707] Geschütze zu entkommen, so daß die Kanonen nicht rasch rückwärts fortgeschafft werden konnten. In die Flucht der feindlichen Artilleristen wurde sogar der französische Obergeneral Bazaine mit fortgerissen und wäre beinahe von den nachjagenden Husaren gefangen genommen worden. Da aber der Brigade keine noch unversehrte Reserve folgte, stürzte sich die Kavalleriebedeckung des Marschalls Bazaine auf die Husaren, die in wirrem Knäuel um die Geschütze wirbelten und in schwachen Schwärmen gegen Rezonville noch weiter vorprellten, und nötigte so diese, den Rückzug nach dem Wiesengrunde von Flavigny anzutreten. So geschah es bedauerlicherweise auch, daß die so glänzend genommene Batterie wieder in die Hände des Feindes fiel. Dagegen erwies sich der Verlust an Toten und Verwundeten, als sich endlich das brave Regiment an der Kirchhofshöhe von Flavigny wieder sammelte, nur als gering.
Die beiden Schlachtengemälde E. Hüntens zeigen alle Vorzüge seines Pinsels: große Naturwahrheit, treffliche Zeichnung, klare lebendige Färbung, sorgfältige Durchbildung. E. Dörffel.
Blätter und Blüthen.
Unser Aufsatz „Der Seemannsberuf“, den wir in Nr. 16 des laufenden Jahrgangs in der Aufsatzfolge „Vor der Berufswahl“ veröffentlicht haben, hat ein so allgemeines Interesse erregt, daß wir gern auf verschiedene Anfragen, die um nähere Ausführung einzelner Angaben baten, hier im Zusammenhang Auskunft erteilen. Die Einstellung der Schiffsjungen in die deutsche Marine erfolgt nach geschehener Anmeldung seitens der Bezirkskommandos, in deren Bezirk die Betreffenden in ihrem Civilleben stehen, bei der Schiffsjungenabteilung in Friedrichsort nur einmal im Jahre, und zwar im April. Die Jungen werden dort eingekleidet und kommen dann sofort nach 10 bis 14 Tagen an Bord eines der 3 Schiffsjungenschulschiffe, von denen je zwei immer im Dienst sind. Je ein Jahrgang kommt auf ein Schiff. So sind in diesem Jahre die neueingestellten Schiffsjungen an Bord S. M. S. „Moltke“ gekommen, und zwar in der Stärke von 250 Köpfen. Da der Etat in diesem Jahre um 100 Jungen vermehrt ist, so sind je 50 Jungen zum erstenmal auch auf die beiden Kadettenschulschiffe „Stosch“ und „Stein“ gekommen. Also auf dem eigentlichen Schiffsjungenschulschiff sind nie mehr als 250 Jungen. An Bord erhalten die Jungen ihre seemännisch-militärische Erziehung und Ausbildung; daneben wird ihnen vom Schiffspfarrer und einem Deckoffizier theoretischer Unterricht erteilt. Die Schiffsjungenschulschiffe bleiben 2 Jahre ununterbrochen im Dienst, die Ausbildungszeit der Schiffsjungen umfaßt volle 2 Jahre. Im Sommer bleiben die Schulschiffe in heimischen Gewässern und treten im Herbst ihre erste Auslandsreise an, die im ersten Jahre das Mittelmeer zum Ziele hat. Im Frühjahr kommen die Schiffe wieder zurück, um während des Sommers wieder in heimischen Gewässern zu bleiben. Im Herbst des zweiten Jahres treten die Schiffe ihre Reise nach Westindien an, von der sie im Frühjahr des nächsten Jahres heimkehren. Die Schiffsjungen werden dann Matrosen, werden vereidigt und den verschiedenen Marineteilen überwiesen, nachdem sie bei den 2 Seebataillonen infanteristisch durchgebildet sind.
Das Schiffsjungen-Institut hat den Zweck, tüchtige Unteroffiziere für unsere Marine heranzubilden. Aus den besten Unteroffizieren rekrutieren sich die Deckoffiziere, eine Charge, die sich mit irgend einer in der Armee kaum vergleichen läßt; es ist eine Charge, die zwischen Feldwebel und Offizier rangiert. Die Deckoffiziere, die sich der Feuerwerkercarriere zugewandt hatten, können Feuerwerks- und Zeugoffiziere werden; diejenigen, welche aus der Torpedo-Abteilung hervorgehen, können Torpedooffiziere werden. Dagegen ist die Zahlmeisterlaufbahn den Unteroffizieren bezw. Deckoffizieren der Marine, welche aus der Schiffsjungenabteilung hervorgegangen sind, verschlossen. Zu den Eintrittsbedingungen für diese Laufbahn gehört vielmehr das Reifezeugnis eines Gymnasiums, Realgymnasiums oder einer Oberrealschule. Junge Leute, die Zahlmeister werden wollen, treten in der kaiserlichen Marine als Einjährig-Freiwillige ein und erhalten dann ihre besondere Vorbildung für ihre spätere Stellung.
Mehr deutsch – bitte! Betrachtet man eine der großen eleganten Papierauslagen unserer Hauptstädte mit ihren geschmackvoll aufgebauten Gegenständen: den matt glänzenden langen und viereckigen Kästchen, deren zartfarbiger Inhalt fein gebändert und verführerisch aus den offenen Deckeln schaut, so muß man sich über die großen Fortschritte unserer Industrie freuen. Tritt man aber näher und mustert die Goldaufschriften der verschlossenen Kasten: Pine Paper, Papier crèole, Papier surfin, The Mary Mill rose note paper, Papier Mazarin etc., findet man bei genauerer Umschau, daß kaum da und dort eine deutsche Aufschrift diese zweifellos alle aus deutschen Fabriken stammenden eleganten Packungen schmückt, obgleich doch wahrhaftig kein Mangel an hübschen und geschmackvollen deutschen Bezeichnungen sein könnte, so muß man sich fragen: was bedeutet diese seltsame Ausländerei im Deutschen Reiche? Sollte nicht unsere Papierindustrie auf ihre großen Fortschritte stolz sein, statt durch heuchlerische fremdländische Ueberschriften die traurigen Zeiten zu verewigen, wo ein deutscher Briefbogen ohne den Stempel „Bath“ keine Abnehmer fand? Damals, in früheren Jahrzehnten, war das englische Briefpapier besser als das deutsche, und die Falschbezeichnung hatte einen Sinn, der ihr heute abgeht, wo das deutsche Fabrikat ebenbürtig geworden ist. Möchten doch unsere Fabrikanten etwas mehr vaterländischen Stolz gewinnen und das Publikum mit ihnen! – Freilich, so lange in deutschen Straßen immer noch zu lesen ist: Grand Restaurant français, Hôtel d’Angleterre etc., so lange jeder halbwüchsige Schusterjunge noch unter die bezahlte Rechnung ein unorthographisches: „pur aquit“ malt, so lange sind wir weit entfernt von dem freudigen Stolz, der sich ohne Ueberhebung des eigenen Wertes bewußt ist und das Einheimische vor dem Fremden liebt und schätzt. In einzelnen Zweigen der Industrie ist die Aufschrift „Deutsches Fabrikat“ bereits zum Ehrenzeichen geworden, möchte es doch in allen ohne Ausnahme ebenso sein! Bn.
Puppentheater am Hofe Margaretens von Oesterreich. (Zu dem Bilde S. 692 und 693.) Allerunterthänigst haben die fahrenden Puppenspieler darum nachgesucht, im Palast zu Mecheln eine Vorstellung geben zu dürfen, und Margarete, die von ihrem Vater Maximilian I. eingesetzte Regentin der Niederlande und Vormünderin der Kinder ihres frühverstorbenen Bruders Philipps des Schönen, hat die Erlaubnis gern erteilt, um dem jungen Völkchen eine Freude zu machen. Dies scheint auch vortrefflich geglückt: die Augen der jungen Gesellschaft richten sich voll Spannung auf den geheimnisvollen Wandschirm und die dahinter auftauchenden Figuren. Die kleinste Prinzessin, Katharine, klatscht seelenvergnügt mit den kleinen Händchen und auch ihre im Vordergrund sitzende ältere Schwester Eleonore scheint ganz hingenommen von dem seltenen Kunstgenuß. Der künftige Herrscher zweier Welten aber, der nachmalige Karl V., lehnt gleichgültig auf seinem Sitz zurück, mit halboffenem Munde und verträumten Blicken das Schauspiel anstarrend, schon steht er nahe dem Alter, da man ihn – es geschah 1515 an seinem 15. Geburtstag – für großjährig erklärte. Die neben ihm sitzende Tante-Regentin wendet vollends das Haupt ab im leisen Gespräch mit einem ihrer Räte, auf ihr, der noch jugendlichen Frau, liegt eine ungeheuere Last von Sorgen und Verantwortung jeder Art. Margarete von Oesterreich war früh in der harten Schule des Schicksals erzogen worden, sie gehörte zu der nicht geringen Zahl von Hochgebornen, welche ihre fürstliche Stellung mit dem Verzicht auf jedes volle Menschenglück bezahlen müssen. Kaum zweijährig wurde sie 1482 von ihrem Vater Maximilian aus Gründen der Staatsraison dem König Karl VIII. von Frankreich verlobt und mit Amme und Erzieherin nach Paris gesandt. Elf Jahre später hatte sich Karl anders besonnen und schickte die Braut ihrem Vater wieder heim, welcher damals nicht in der Lage war, die angethane Schmach zu rächen. 1496 wurde Margaretens Hand neu an den Prinzen von Asturien, Johann, vergeben, aber noch in demselben Jahr starb dieser edle Sohn Ferdinands und Isabellens von Spanien. Eine zweite, im Jahre 1501 mit Philibert von Savoyen eingegangene sehr glückliche Ehe sollte auch nur von kurzer Dauer sein: im Jahre 1504 kehrte Margarete, zum zweitenmal Witwe, zu ihrem Vater zurück, um die Verwaltung der Niederlande bis zur Großjährigkeit ihres Neffen Karl zu übernehmen, sowie seine und seiner Schwestern Erziehung zu überwachen und zu leiten. Für beide Aufgaben hätte Kaiser Maximilian keine glücklichere Wahl treffen können: alle Geschichtschreiber der Zeit berichten einstimmig von der hohen Klugheit und ruhigen Kraft dieser seltenen Frau, welche, den begabtesten Staatsmännern ebenbürtig, in friedlichen wie in kriegerischen Zeiten auf den Gang der Ereignisse bestimmend einwirkte und nebenbei noch Zeit fand, den anvertrauten Kindern eine treuliebende und sorgende Mutter zu sein. An dem Glanz Karls V. durfte sie sich noch durch Jahrzehnte erfreuen, wie sie auch an seinen politischen Sorgen stets den lebhaftesten Anteil nahm. Sie starb 1530 in Mecheln, ihrer Residenz, wo ihr die dankbaren Niederländer im Jahre 1850 ein Denkmal errichtet haben. Es ist das schöne Vorrecht der Kunst, das Gedächtnis der Verstorbenen lebhafter zu erwecken, als das bloße Wort es vermag. So wird man auch hier im Bild mit besonderer Teilnahme die anmutvolle Frau betrachten, welche von ihren Zeitgenossen und der Nachwelt den Ausgezeichnetsten ihres Geschlechtes zugezählt wird. R. A.
Ein Verein für Hausbeamtinnen ist vor kurzem in Berlin gegründet worden mit der wichtigen Aufgabe, durch eine gediegene Fachbildung den ganzen Stand zu heben und dadurch für die oft gehörten Klagen über Untüchtigkeit der Wirtschafterinnen, „Stützen“, Stellvertreterinnen der Hausfrau etc. Abhilfe zu schaffen, wozu auch eine gewissenhafte Stellenvermittlung beitragen wird. Weiterhin sucht er die materielle Lage derselben zu bessern und durch Gründung von Hilfskassen, Heimstätten und Altersrenten besonders für die alten, nicht mehr arbeitsfähigen Hausbeamtinnen zu sorgen, deren Alter nach lebenslangem Dienst für andere manchmal recht trübe ist. Des vorzüglichen Zweckes wegen ist der Jahresbeitrag nur auf eine Mark festgesetzt, um denjenigen, die durch viele Vereine schon in Anspruch genommen sind, und den Hausbeamtinnen selbst die Teilnahme zu erleichtern. Besondere Bedeutung wird die Stellenvermittlung des Vereins erhalten. Anfragen betreffs derselben sind an Frau Eva Bloedt, Berlin W, Hohenstaufenstraße 17, unter Beifügung der Mitgliedskarte zu richten. Kassiererin ist Fräulein Meta Langerhanns, [708] Berlin SW, Hallesche Str. 20. III. Den Vorstand des Vereins bildet außer Frau Mathilde Weber in Tübingen und Frau Schepeler-Lette in Berlin eine Reihe hochangesehener Frauen und Männer, welche die Notwendigkeck einsehen, den außerhalb der Dienstbotenversicherung stehenden häuslichen Arbeitskräften einen Zusammenschluß zur Sicherung ihrer Zukunft zu ermöglichen und anderseits den Hausfrauen eine Gelegenheit zu schaffen, um gut empfohlene, tüchtige und solide Leute zu bekommen. Bis jetzt ist die Mitgliedschaft vorwiegend von solchen in Anspruch genommen worden und die Hausfrauen haben sich erst in geringer Zahl gemeldet, so daß vorderhand mehr Angebot als Nachfrage ist. Dies wird sich ändern, wenn der Verein bekannter wird und wenn, wie es in Bonn und Tübingen bereits geschehen ist, die Frauen der einzelnen Städte zu Lokalvereinen zusammentreten.
Ausführliches über Ziele und Zwecke des neuen Vereins ist zu finden in einem vortrefflichen Schriftchen von Mathilde Weber: „Unsere Hausbeamtinnen“ (Berlin, Oehmigke), in welchem mit der der Verfasserin eigenen klugen und gemütvollen Darstellung die großen Schäden und Mängel des bisherigen Zustandes, sowie die sichere Abhilfe im Fall recht allgemeiner Beteiligung, nachgewiesen werden. Wir hoffen, durch diesen Hinweis der Ausbreitung des Vereins zu dienen, dessen grosser Nutzen für alle Beteiligten wohl außer Zweifel steht. Bn.
Kunst auf der Straße. Der Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs in Dresden hat sich im Laufe dieses Jahres bedeutend erweitert und sich weitere Ziele gesteckt als bisher. Er hat unter anderm einen Kunstausschuß gebildet, dem eine Anzahl kunstgebildeter Herren angehört. Dieser Ausschuß hat außer zahlreichen anderen Plänen auch den gefaßt, von Zeit zu Zeit Wettbewerbe für die „Kunst auf der Straße“ zu veranstalten. Er hat damit zum erstenmal am diesjährigen Sedantage begonnen, indem er die Hausbesitzer Dresdens aufforderte, an diesem Tage ihre Häuser festlich zu schmücken, und die Veranstalter der hervorragendsten künstlerischen Hausausschmückung durch metallene Ehrentäfelchen auszuzeichnen versprach. Der Kunstausschuß des genannten Vereins wollte durch dieses Preisausschreiben im Verein mit einem zweiten in doppelter Hinsicht kunstfördernd wirken, indem er einmal die landläufige Hausausschmückung auf eine höhere künstlerische Stufe heben, anderseits für Dresden zur Wiedererweckung der Medailleurkunst beitragen wollte. Bekanntlich steht die Medailleurkunst in Deutschland gegenwärtig auf sehr tiefer Stufe, während sie in Frankreich durch Roty, Charpentier u. a. zu hoher Blüte gekommen ist. Dresden war am verflossenen Sedantage in umfassender Weise geschmückt, an dem Wettbewerb des „Fremdenvereines“ hatten sich 19 Haus- und Ladenbesitzer beteiligt. Der Kunstausschuß beschloß, die Dekorationen des Viktorienhauses (Hofjuwelier Mau), des Hotels zu den vier Jahreszeiten (Wilhelm Heinze) und der vier Schaufenster des Band- und Seidenhauses von Carl Schneider durch Ehrentäfelchen auszuzeichnen, dem Hotel Deutscher Herold und der Möbel- und Dekorationsfirma Hartmann und Ebert (Vertreter der Möbelfabrik von Schöttle in Stuttgart) je eine ehrenvolle Erwähnung zu gewähren. Wir geben eine Abbildung des Viktoriahauses in seinem Festschmuck. Dieses Haus ist eines der schönsten neueren Bauwerke Dresdens in deutscher Renaissance; es wurde auf Wunsch des kunstsinnigen Besitzers von den Architekten Lossow und Viehweger nach dem Gewandhause zu Braunschweig und zwar durchweg bis aufs kleinste nur in echtem Material erbaut und seine Giebelschauseite war am Sedantage nach einheitlichem künstlerischen Plane von unten bis oben mit Fahnen, Ranken, Palmwedeln etc. geschmückt, ganz besonders prachtvoll aber am Abende mit Tausenden von Gasflämmchen erleuchtet. – Der Kunstausschuß des Dresdener „Fremdenvereins“ wird seine Wettbewerbe für die Kunst auf der Straße fortsetzen und zunächst solche für Schaufensterdekoration, wozu nur die Ware des betreffenden Hauses verwendet werden darf, eröffnen.P. Sch.
Verdaulichkeit der Fette. Das Fett zählt zu den unentbehrlichen Nahrungsstoffen des Menschen; aber nicht jedes Fett ist uns gleich bekömmlich. Das eine Fett ist leichter, das andere schwerer verdaulich, und verschiedene Fettspeisen können den Magen gründlich verderben. Einige Regeln über die Bekömmlichkeit der verschiedenen in unserer Küche verwendeten Fette dürfte somit vielen willkommen sein. Zuvörderst ist der Grundsatz aufzustellen, daß tierische Fette leichter zu verdauen sind als pflanzliche. Unter den tierischen steht obenan die frische Butter, sie wird von dem Magen am leichtesten bewältigt und am besten vom Körper ausgenutzt. Nächst ihr ist eine gut bereitete Margarine zu nennen. Für die anderen tierischen Fette gilt die Regel, daß sie um so leichter verdaulich sind, je leichter sie beim Erwärmen flüssig werden. Fette, die bei der Bluttemperatur fest bleiben, wie Stearin, sind völlig unverdaulich. Die Verdaulichkeit aller Fette wird durch Erhitzen beeinträchtigt, denn alsdann bilden sich allerlei brenzlige Stoffe, welche die Verdauung erschweren und den Magen reizen. Noch schlimmer beeinflussen den Magen ranzig gewordene Fette, die vielfach geradezu gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, und es ist dabei zu beachten, daß pflanzliche Fette leichter verderben als tierische. Daraus folgt, daß man nicht immer die gewünschte Rechnung findet, wenn man bekömmliche tierische Fette durch schwer verdauliche Pflanzenfette und -Oele ersetzt. Die gemachte Ersparnis muß oft der Magen mit schweren Leiden bezahlen. *
Ein Sträußchen! (Zu dem Bilde S. 689.) Hundertmal schon hat man über die verwünschte Bettelei gewettert, die einen nirgends zur Ruhe kommen läßt, hundertmal dargethan, welcher wirtschaftliche und moralische Verderb aus diesem Herumlungern der jungen Mädels entsteht, und ebenso oft auseinandergesetzt, wie man es macht, um sie gründlich abzuschrecken. Und wenn dann plötzlich so ein kleines Ding vor einem steht, das mit hübschen bittenden Augen und einem lachenden Mund sein Sträußchen hinhält – da greift man eben doch in die Tasche und holt, durchdrungen von der Verwerflichkeit einer solchen Handlung, sein Nickelstück heraus. Bis die Veilchen aber im Knopfloch befestigt sind, hat man das so notwendige „Abschrecken“ auch noch versäumt, denn nun ist die Kleine fort und nur von fernher tönt es noch: „Ein Sträußchen, ein Sträußchen!“ Br.
Danke schön! (Zu dem Bilde S. 697.) Was zuviel ist, ist zuviel! Zwei große Tassen hat das Roserl, das mit der Mutter auf Besuch zur „Döte“, der Patin, kam, sich herrlich schmecken lassen und zwei dicke Stücken Kuchen dazu. Es könnte, wenn’s gerade drauf ankäme, noch ganz gut eine dritte zwingen, aber nein! … auch auf dem Dorf giebt es eine Etikette, und die Mutter hat ihr Töchterlein frühzeitig darin unterwiesen. Deshalb kann sie jetzt ruhig dabei sitzen und braucht kein Wörtlein zu sagen, das Roserl wehrt sich, trotz allen dringenden Zuredens der guten Döte, aus Leibeskräften und wird in diesem Wettkampf der Höflichkeit Sieger bleiben. Es ist ein hübsches Stückchen Dorfleben, das hier der Künstler dem Betrachter vor Augen stellt, anheimelnd durch die Sauberkeit des einfachen Stübchens und glücklich in der Charakteristik dieser kleinen Kaffeegesellschaft, die nach der Wochenarbeit hier am sauber gedeckten Tisch so vergnügt beisammen sitzt. Bn.
Inhalt: Die Lampe der Psyche. Roman von Ida Boy-Ed (1. Fortsetzung). S. 689. – Ein Sträußchen! Bild. S. 689. – Puppentheater am Hofe Margaretens von Oesterreich. Bild. S. 692 und 693. – Handwerker von Stande. Von Rudolf Kleinpaul. S. 696. – Danke schön! Bild. S. 697. – Sturm im Wasserglase. Roman aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Von Stefanie Keyser (7. Fortsetzung). S. 699. – Ein Herbstmorgen am Rhein. Gedicht von Emil Rittershaus. S. 705. – Zwei Ehrentage eines deutschen Reiterregiments. Die 11er Husaren bey Ligny und Vionville. Von E. Dörffel. S. 705. (Mit den Bildern S. 700 und 701.) – Blätter und Blüten: Unser Aufsatz „Der Seemannsberuf“. S. 707. – Mehr deutsch – bitte! S. 707. – Puppentheater am Hofe Margaretens von Oesterreich. S. 707. (Zu dem Bilde S. 692 und 693.) – Ein Verein für Hausbeamtinnen. S. 707. – Kunst auf der Straße. Mit Abbildung. S. 708. – Verdaulichkeit der Fette. S. 708. – Ein Sträußchen! S. 708. (Zu dem Bilde S. 689. – Danke schön! S. 708. (Zu dem Bilde S. 697.)