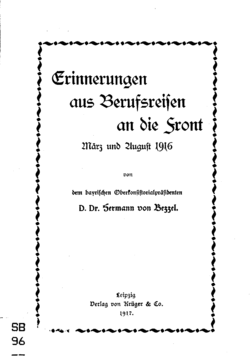| Erinnerungen
aus Berufsreisen
an die Front
März und August 1916
von
dem bayrischen Oberkonsistorialpräsidenten
D. Dr. Hermann von Bezzel.
Leipzig
Verlag von Krüger & Co.
1917.
| Vergänglich ist nur, was nie
volle Wirklichkeit gehabt hat.
Ernst Curtius. 27. Januar 1889.
Am ersten Geburtstage, den Wilhelm
II. als deutscher Kaiser und König von Preußen erlebte, hat der treue Lehrer und Erzieher seines Vaters, der ihm mehr gewesen war als dem Alexander von Makedonien sein Aristoteles, den Segen einer durch Jahrhunderte festgefügten Monarchie gepriesen, weil sie die Bürgschaft gebe, daß auch bei dem zähesten und tiefstgreifenden Wechsel der Dinge ein Bruch mit der Vergangenheit ganz unmöglich sei. Hineingestellt in eine klar bewahrte Tradition, die nicht veralten kann, weil sie an den jeweiligen Pflegern sich verjüngt, und andererseits wehrt, daß das Neue, das Unerprobte und Unbewährte rein um des Reizes der Neuheit willen sich eindränge, trägt der Monarch, dem die Geschichte des Volks an den einzelnen Persönlichkeiten sich orientiert, die Pflicht in sich, das Ererbte zu erleben und das Erlebte von sich zu lösen und als statutarisches Erbe dem Nächsten zu überkommen, lernt er an den Niederlagen der Väter die Kunst, zu siegen und den Sieg zu nützen, und aus den Siegen, wie leicht sich in Niederlagen wandelt, was nicht nach der Schlacht den Harnisch fester anlegen heißt. Der Monarch lernt es in sich verkörpern, was als unfaßbare Idee, jedem nahe und keinem ganz durchsichtig, das Volk beherrscht und die Zeit bestimmt und wie durch ein göttliches Geheimnis, eine Theopneustie, die von oben gewirkt, weil von den Umständen drängend erfordert wird, dem
| Wert zu verleihen, was die Volksseele erfüllt und doch nicht Gestalt werden kann. Diesen tiefinneren Rapport zwischen dem Zeitgeist und der Volksstimme und dem Eigendenken wird der in Eitelkeit des Sinns und der Selbstsucht befangene Autokrat nie kennen; weil er vom Volke nichts zu empfangen weiß, vermag er ihm nichts zu geben.
Ludwig XIV. schaute sein Bild in jedem Franzosen, seine Nationalfehler fand dieses Volk in seinem König zur Unüberbietbarkeit gesteigert, ihres fehlsamen Charakters im Sonnenglanze der Majestät entkleidet. Illusionen waren in ihm Wirklichkeiten, darum ward ihm die Wahrheit zur Illusion. Er schien zu geben und ließ verarmen, zu heben und hieß versinken. – Die Schilderung des französischen Charakters aus der Feder Alexis de Tokqueville, der Fürst Bülow in seiner „Deutschen Politik“ Aufnahme gegönnt hat, paßt sie nicht Wort um Wort auf den Abgott der Nation und ihre Selbstbespiegelung, gegen die nach Leopold Rankes unsterblichem Wort vom November 1870 Deutschland den Krieg zu führen nie ablassen darf? „Mehr geleitet von Stimmungen als von Grundsätzen, zu allem geschickt, aber doch nur im Krieg sich auszeichnend, Anbeter des Erfolgs, den Zufall oder Gewalt verschafft, des geräuschvollen Ruhms, des flackernden Glanzes, auch wenn er unecht ist. Fähig zu einer Art von Heldentum, aber nicht zu wirklicher Leistung.“
Wer Frankreich durchwandert, muß immer wieder sich zurufen: Ob Ludwig
XIV., Napoleon
I. oder Felix Boulanger – das Volk will von seinen Führern nicht das ihm noch nicht zur Klarheit Gekommene gedeutet und die Lehre der Geschichte in Prüfung und Vergleichung des Einst und Jetzt ans Herz gelegt sehen, sondern sich an seinen Führern berauschen; es will lieber betört als geleitet, lieber geschmeichelt als belehrt sein.
Ruere in servitium nennt solche Stimmungen der große Geschichtsschreiber. Die Angebeteten
| werden Tyrannen und die Tyrannen werden angebetet, bis sie an sich sterben.
Le boulange c’est fini hieß es vor fünfundzwanzig Jahren. – Wo aber in Frankreich Herrscher auftraten, die das edelste Vorrecht ihrer Würde wahren und des Volkes Gewissen sein wollten, da ward ihnen das „Geheimnis der Langweile“ nie verziehen.
.
Es war am Anfang des April 1916, als ich, von dem Besuche der bayrischen Truppen meines Bekenntnisses heimkehrend, über St. Quentin ins Große Hauptquartier kam. Juni 1558, der Sieg der Spanier über die Franzosen, und die Vermählung des finsteren Philipp
II. mit Elisabeth, der Tochter Heinrichs von Frankreich, dem „Olivenblatt und der Fürstin des Friedens“, seine Tücke gegen den edlen Lamoral von Egmont kamen als düstere Bilder herauf, dort in der prächtigen Kathedrale, deren Äußeres, von Anfang an Konstruktionsfehlern leidend und auseinander klaffend, langsam dem Verfall entgegensiecht. Die wunderbaren Glasgemälde, von tiefer heißer Glut der Farbe, an die Bilder der
Sainte chapelle in Paris erinnernd, sind jetzt durch französische Geschosse meist zerstört. Aber wie ein lichtes, verheißungsreiches Bild drängt die schweren, schwarzen Bilder zurück: der 19. Januar 1871, der Faidherbe durch den „General mit der Brille“ besiegte und Paris trotz der hochtönenden Phrasen des „Gouverneurs, der sich niemals ergeben werde“ dem Fall nahe brachte. Wie lag alles als wüster, wirrer Traum hinter mir, als ich in später Nacht im Hauptquartier ankam, von dem bayrischen Militärbevollmächtigten, seinem Adjutanten und dem vielgenannten Oberpfarrer des Westheeres
D. Göns freundlich und gütig empfangen. Die Eindrücke, die der Mann des Friedens von dem ganzen militärischen Hofstaat empfing, waren zu nachhaltige; es ist nie leicht, so unmittelbar dem Gange der Weltgeschichte nahe zu kommen. Die Maßstäbe fehlen, denn die man bereit hat, kann man nicht gebrauchen,
| und die man anwenden müßte, sind nicht bereitet. Aber die stille Selbstverständlichkeit des Vertrauens auf endliches Gelingen, die ruhige Heiterkeit des guten Gewissens, das in allen Lagen und Wechselfällen sich in dem Rechte einer wohlbewährten Sache verankert weiß, hatte etwas Erhebendes und Stärkendes. Und der Kaiser, dessen Leibwache eben aufgezogen war, und soweit sie Bayern in sich schloß, von mir begrüßt werden konnte, schien in der stillen Abgeschiedenheit seiner einfachen Wohnung, deren treffliche Kupferstiche aus dem achtzehnten Jahrhundert mit dem Stilleben edel harmonierten, von aller guten und würdigen Gelassenheit und der Innerlichkeit des reinen Gewissens am meisten erfüllt, ja ihr Ursprung zu sein, von dem aus die Stimmung sich weiterhin mitteilte. Es war das dritte Mal, daß ich vor ihm stehen und ihm ins klare, ernste Auge blicken durfte, das die Befangenheit nicht vermehrt, sondern benimmt: man fühlt sich geborgen. Am 16. Juni 1913 überbrachten der Präsident des preußischen Oberkirchenrats, der des sächsischen ev.-luth. Landeskonsistoriums und ich im Namen der deutschen evangelischen Kirchenregierungen dem Kaiser die Glückwünsche zum fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläum. Da war er ganz Majestät, der Ernst der Rückschau und der Vorschau seinem Antlitze aufgeprägt. Dann war es der 25. August 1913, der Namenstag unseres bayrischen Königs Ludwig
III., der dem herrlichen Gedanken, die Einigung der deutschen Stämme am hundertjährigen Gedächtnistage der Freiheitskriege durch die feierliche Zusammenkunft ihrer Fürsten und Führer darzustellen und der neidischen Umwelt das feste Bollwerk deutscher Treue und fürstlichen Wortes zu zeigen, solch glänzende Ausgestaltung zu geben wußte. Es waren Augenblicke weltgeschichtlichen Erlebnisses, als unter Fanfarenklängen und dem Geläute der Glocken von der Kuppel des hehren Baus der Befreiungshalle
| hoch oben auf dem Berge bei Kelheim die deutschen Fürsten in die Versammlung Einzug hielten, die ihrer ehrfürchtig und stolz, getrost zumal wartete. An der Spitze ging der damalige Regent der bayrischen Lande und der Kaiser. – Und in der Rotunde auf erhöhten Plätzen standen alle Fürsten um den Kaiser geschart, der mit ehernem Ernste die festliche Rede anhörte, die Bayerns Herrscher, der Enkel des deutschen Königs Ludwig
I. verlas. Während der nur wenigen Ehrengästen eröffneten Feier im Innern der machtvoll emporstrebenden Halle hatte draußen die Sonne über alles Gewölke und die ringenden und sinkenden Nebel den Sieg gewonnen und ergoß ein Meer von Gold und Licht auf die herbstlichen Höhen, die den Donaustrom umgrenzen und beherrschen. Der Kaiser – man sah es deutlich – war von dem wunderherrlichen Anblick wie geblendet. Es war doch ein freundliches, sonniges Anzeichen für Deutschlands fernere Tage. Nebel und Finsternis liegen auf der Zukunft seines Volks, Parteihader und Undank, Kritiksucht und Meisterlosigkeit drinnen, offene trotzige Feindschaft und unter der Maske gleißender Freundlichkeit und Lobeserhebung bittrer Neid und Gegensatz draußen, Verkleinerungssucht gegen alles Echte und Edle und die Begierde, das Scheinwesen zu pflegen und zu heben, damit an ihm Kern und Wesen Vergehe und verschwinde – aber sieghaft dringt doch die Sonne der Wahrheit durch, die auch in scheinbaren Niederlagen den Sieg beleuchtet und über Sturm und Wetter umso mehr triumphiert, je stärker beide sich gegen sie verschwören. Höfische Feste haben leicht durch die Abgemessenheit von Rede und Gegenrede, durch die bestimmten Ordnungen von Gruß und Dank etwas Fremdartiges: man vermißt dann die innere Zustimmung des Gemütes, das Ja und Amen des nicht berechnenden und darum unbestimmbaren Pathos. Bei dieser Feier durfte der äußere Glanz die Unmittelbarkeit göttlicher Wunderzeichen,
| die das Licht aus der Finsternis so hervorscheinen ließen, nicht verdrängen, nur dankbar umrahmen und dienstbar sich einordnen. Und als bei der Tafel der Kaiser das Glas auf das Wohl des alten Hauses Wittelsbach, auf des Prinzregenten und seines Hauses Heil, auf das „liebe schöne“ Bayern erhob, da hatte er aus aller Herzen und Neigung gesprochen. „Wenn ein Glied wird ehrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder.“
Was der kaiserliche Herr dann mit mir sprach, bewegte sich mehr auf kirchlich-theologischem Gebiete, etwa in der Richtung eines Buches, das vor Jahrzehnten soviel Aufsehen gemacht hatte: Was würde Jesus hier tun? Die Gedanken dieses englischen Werkes sind mir nie näher gekommen. Denn Konjekturen sind nicht Tatsachen und geistreiche und geistliche Improvisierungen geben nicht Kraft, kaum Anregung.
In jenen Stunden des 7. April 1916 sprach der Kaiser in hohen, frohen Worten aus vergangenen Zeiten, von den Nordlandsreisen und ihren Begegnungen. Es waren Erinnerungen, die den schweren Ernst der Gegenwart zurücktreten, nicht vergessen ließen, wie man im Sturm des Herbstes immer gern das Bild des Frühlings vor die Seele stellt, nicht damit sie den Traum genieße, sondern für die Wirklichkeit sich stärke.
„Apud viros meminisse“ sagt Tacitus. – Vom Kriege sprach der Kaiser nicht, nur von den Fahrten ließ er sich kurz berichten, von Nürnberg und Bamberg sprach er warm und dankbar. Mir schien, als weile er geflissentlich gerne in vergangenen Tagen, deren starker Glanz ihm die Trübheit der Gegenwart erhellen sollte, in besseren Zeiten, die nicht unwiederbringlich dahin sind, sondern waren, um sein zu können. Ludwig Wiese rühmt in seinen Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen (
II S. 75) den Geschichtssinn und das Gedächtnis für geschichtliche Dinge an dem Casseler Gymnasiasten von
| 1875: ich durfte diese Gabe rascher Orientierung und das treue Gedächtnis bewundern, ob nun der Kaiser nach dem Grunde fragte, warum der letzte Sachsenkaiser in Bamberg begraben sei oder ob er von den Gemälden in der Kirche zu Notre Dame zu Douai und deren Schenkung durch Maximilian
I. an Maria von Brabant sich erzählen ließ. Als er aber auf die Frage nach meiner Landsmannschaft „Franke“ hörte, sprach er mit Lebhaftigkeit: Ich bin auch Franke. Und alsbald stand die Gestalt der ersten „Zolren“ und des „schlichten Amtsmanns Gottes am Fürstentum“, des ersten Kurfürsten Friedrich vor Augen, der am 21. September 1441 auf der Kadolzburg in Franken gestorben ist und in der Münsterkirche des nahen Zisterzienserklosters Heilsbronn seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Unfern dem Vater ruht sein großer Sohn, der größte wohl der Hohenzollern auf Jahrhunderte hinaus, Albrecht Achilles († 1486), dessen Grundgesetz von 1473 der Grundstein für die Größe seines Hauses geworden ist und es vor unheilvollen Teilungen und der Zersplitterung der Kräfte behütet hat. Nürnberg und Kadolzburg, Heilsbronn und Erlbach, Himmelkron und Himmelthron mit dem Grabmal der Kunigunde von Orlamünde stehen auf, wenn ein Hohenzoller sagt: Ich bin auch Franke. Ansbach, Bayreuth, Kulmbach und Erlangen bleiben nicht dahinten. –
.
Unser Kaiser gehört zu den Menschen, über die man reflektieren
muß. Weil er mit vielem beschäftigt ist, beschäftigt er viele. Man kann die Formel nicht finden, mit der man restlos die Würdigung dieses vielseitigen und vielfältigen Herrschers erfassen könnte und dürfte, Wenn man die Ähnlichkeit mit Friedrich Wilhelm
IV. sich nachgewiesen zu haben glaubt, treten wieder andere jenem genialen Fürsten nicht verwandte Züge entgegen. Und wo man nach Jakob Grimms sinniger Deutung des Wortes Enkel (
aen - i kel, der wieder auflebende Ahne) im Kaiser
| das Bild des teuren Wilhelm
I. mit verjüngten, lebhafteren und frischeren Farben sieht, die Pflichttreue, die sich zügelnde Mäßigung, da wollen andere Züge, die dem Charakter des ersten Wilhelm nicht eignen, untergebracht sein. Soviel ist gewiß, daß unser Kaiser ähnlich seinem großen Ahnen, dem ersten Friedrich Wilhelm, dessen Charakterbild Schmoller (Charakterbilder 1913, S. 1–17) in besonders anziehender und sinniger Weise gezeichnet hat, ein Mensch der Geschichte und darum ein im tiefsten Grund der Seele
einfacher Mensch ist, der auf Eines sieht und darum nichts übersieht, daß er aber auch zur Schwermut geneigt sein muß, gleichwie jener, nicht aber zur tatenlos seufzenden, wie jener Atlas, der ein ganze Welt von Schmerzen tragen zu müssen beklagt, sondern zur mutig überwindenden, die sich nicht Raum gibt, daß die Traurigkeit den Willen lähme, sondern lernt, daß Leid stählt, stärkt und siegt.
.
Mit der Ehrerbietung vor all der Verantwortung, die seine Schultern tragen und dem männlichen Mitleid mit dem Herrscher, dessen Herz so viele leidensvolle Fragen durchziehen, schied ich von dem Hauptquartier. Sedan lag nicht ferne. Das Schlößlein oben auf dem Hügel zur linken Seite der Straße, das arme Weberhaus zur Rechten predigen von dem Sturz alles Erdenwesens, das auf Schein und Schaum gründet, von dem uralten Geheimnis der
ἄτη, von der die griechischen Geschichtsschreiber beim Blick auf die Perserkriege mit heiligem Schauer zu reden wissen. In dem bedeutsamen Fremdenbuch, dem größten Schmuck des kleinen Zimmers, in dem eine Welt zertrümmert, eine andere auferbaut war, steht, mit Stolz von der Besitzerin, die als junges Mädchen den Sieger von Sedan gekannt hatte, dem Beschauer gezeigt:
Guillaume empereur. Wollte unser Kaiser an dieser Stätte zeigen, wozu ein anderer sich, ihn die geschichtliche Fügung gemacht hat? Wollte er selbst den dem französischen Volke verhaßten Namen in demütigem
| Stolze mit dem, „durch Gottes Gnade bin, was ich bin“ zieren? Jedenfalls umrauschen hier die Geister der Geschichte den nachdenksamen Betrachter: ein Kaisertum, ein Herrschertum sinkt nach kurzem, wildem Aufstieg, der über Gräber und Trümmer geht, jählings in sich zusammen, ein dämonisches Meteor, ein wild leuchtender Spuk zerrinnt. Aber die Wahrheit siegt letzten Grundes auch im Leben der Staaten, die nur durch sie bestehen können. –
Es sei verstattet, die Erinnerungen an die beiden anderen Audienzen anzufügen, welche mir im März des Jahres nahe den jetzt so kampfreichen Stätten des nordwestlichen Frankreichs der bayrische Kronprinz Rupprecht und im August der deutsche Kronprinz in Französisch-Lothringen gewährten.
Von schwerem Leide gebeugt, so beglückt er einst war, der fürstlichen Gemahlin, deren Liebreiz etwas Überwältigendes hatte – ich werde nie vergessen, welchen Eindruck ihr ungeahntes Erscheinen auf einem Hoffeste 1911 machte – und des Erbprinzen, eines hoffnungsvollen, reich angelegten Knaben während des Krieges beraubt, trägt der Erbe der alten Wittelsbacher Krone, der kunstsinnige Fürst von feinster Beobachtung und vielerprobte Führer seiner Truppen die Einsamkeit mit dem Ernste, den das strenge Gebot der befehlenden und bestimmenden Stunde denen verleiht, die ihr den Willen lassen. Die dem Kronprinzen nahe stehen, rühmen die seltene Kenntnis der Kunst, die er durch mühereiche Wanderungen in Italien fast von Dorf zu Dorf sich angeeignet und vertieft hat, die rasche und doch besinnliche Art des Urteils, das in seinen Reisetagebüchern zutage tritt. Die Tafelrunde war belebt, zwanglos, aber auch lehrreich und bildend. Denn was hier gesprochen ward, das ging aus der Tiefe: jeder gab sein Bestes: der fürstliche Gastherr verstand es eben, anzuregen, und Urteile herauszufordern bald durch Frage, bald durch Widerspruch
| und das eigene Urteil mit gewinnender Güte nicht als abschließend aufzureden, sondern der Überzeugtheit als entscheidend anzuempfehlen. Machte es bloß die Ähnlichkeit des Saales, daß ich an die Tafelrunde von Sanssouci erinnert ward? Oder hat nicht Kronprinz Rupprecht Ähnlichkeit mit dem großen Schloßherrn, der vor ein und einhalb Jahrhundert die Welt in Staunen, seine Umgebung im Bann seiner Persönlichkeit erhielt? Aber nichts, was irgend an Nachahmung erinnern könnte. Edle Natürlichkeit und frische Ursprünglichkeit lassen keinen Gedanken an derartiges aufkommen.
In den Augusttagen endlich wurde ich nach den Kämpfen bei Fleury von dem deutschen Kronprinzen empfangen. Einst hatte er, von Ansbach kommend, an der Grabkirche zu Kloster Heilsbronn gestanden, um die Gruft seiner Ahnen zu besuchen, begrüßt durch einen telegraphischen Gruß des kaiserlichen Vaters. Er stand in Schillingsfürst am Grabe des alten Reichskanzlers, des Fürsten Chlodwig von Hohenlohe. Seine Leutseligkeit und Freundlichkeit hatten ihm die Herzen des fränkischen Landvolkes gewonnen. Nun durfte ich in das frische, freimütige Auge des Kaisererben blicken, der mit manchem Worte sein Interesse an den Fragen bekundete, die, wie er wissen konnte, den Mann der Kirche beschäftigen. Es war nicht möglich, in kurzen Umrissen Lage und Pflicht der Kirche zu zeichnen, manches konnte nur angedeutet werden. Aber die Gewißheit, daß warme Liebe zum Evangelium nach Gestaltung und Wesen ringt, konnte mit Dank gewonnen werden. Wie klein mag den Großen der Erde manche Sorge erscheinen, die an ihnen vorübergeführt wird, während die in den Niederungen des Marktes Stehenden schwer an ihnen tragen! Aber freilich ausgleichende Gerechtigkeit läßt manche der Niederung entschwindende Wolke schwer über den Häuptern des Hochgebirges lasten. –
| Monarchischer Gedanke, mit der Fülle anvertrauten Gutes ausgestattet, von einem Kapitale größter und lebenskräftigster Werte getragen, in jedem seiner Träger eine Neugeburt erlebend, nicht erstarrend, sondern erstarkend an ihm – das ist es, was Deutschland vor all seinen Feinden voraus hat. Das Königtum Englands ist dekorativ. Seit Jahrhunderten ist kein englischer Herrscher in den Krieg gezogen, es ist kaum die Stellung eines „gekrönten Präsidenten“. Italiens Königtum ist nicht von großen, aus der Sache selbst herausgewachsenen und sie rechtfertigenden Ideen getragen: Generalnenner für eine Menge verschiedenzahliger Brüche sein ist noch nicht eine überragende Einheit: die Geschichte Italiens ist nicht aus sich selbst zur Wiedergeburt gelangt, wie es Cavour wollte, sondern aus fremdländischen Einflüssen und Unterstützungen. Frankreich aber sucht die Hände, die es recht leiten sollen, und findet sie nicht. Die Sehnsucht in den besseren Kreisen der Bevölkerung nach dem Roy ist mehr platonisch, mehr Ausdruck des Mißvergnügens mit der bestehenden Korruption als wirkliche und gesunde Arbeit für ein ihrer wertes Ziel. Was aber das Zarentum bedeutet, ist nur die rohe Übergewalt der Quantität und die plumpe Überfülle von äußeren Machtmitteln, die weder das Verlangen nach wirklicher Herrschaft noch die Kraft zu ihr in sich tragen.
Vier Wochen im Frühjahr und im Hochsommer bin ich immer mit dem gleichen Zweck an die Westfront gegangen, unseren evangelischen Truppen der bayrischen Lande, deren seelsorgerliche Pflege nicht von dem Feldprobst der Armee, sondern von dem Oberkonsistorium in München geregelt und beaufsichtigt wird, einen Besuch zu machen, ihnen in Ansprache und Anrede den Gruß der heimatlichen Kirche und ihren Seelsorgern ein Zeichen der inneren Gemeinschaft zu bringen. Denn nicht um Visitation
| konnte es sich nur handeln, – sie wird im Frieden und im Heimatlande ohnehin geübt, manche meinen, zu reichlich – sondern um den schlichten Dienst der Gemeinschaft und zu ihr. Es ist leicht, derartige Besuche zu unterschätzen – überschätzt werden sie bei der nüchternen und demokratisierenden Anschauungsweise des Protestantismus ohnehin nicht – aber so gering der einzelne – Bayern ging meines Wissens hier mit dem Beispiel voran – von dem Zwecke seines Besuchs denken mag, er knüpft doch neue Verbindungen, bewahrt die alten und macht, worauf heutzutage viel ankommt, den Gedanken der Kirche populär, als der nicht ein rein dogmatischer Begriff des Katechismus ist, mit dem man keine praktischen Gedanken verbinden kann, noch eine althergebrachte kurze Bezeichnung für einen im übrigen ganz losen Zweckverband. Die Leute merkten, daß die Oberen der heimatlichen Kirche und diese selbst sich um sie annehmen, an sie denken. Von selbst wären wir kaum auf den Gedanken des Besuchs gekommen, da er aber nicht nur von etlichen Geistlichen draußen und in der Heimat, sondern auch von Soldaten im Felde und deren Angehörigen begehrt wurde, ward er unternommen, nicht in beschaulicher, aber in mühevoller und arbeitsreicher Ausführung. Es sollte ein Opfer des Dankes sein und ein Zeugnis der liebenden Teilnahme, die dem Kriegsmann in die Ferne nicht nur, sondern in seinen Aufenthalt in den Kasernen, in den Lagern, in den Schützengräben und Lazaretten nachfolgt, und das Grab in fremder Erde zu finden weiß, um in die Heimat Kunde von dem Raume gelangen zu lassen, da ein geliebter Sohn und Gatte gebettet ist. In diesem beziehungsreichen Wechselverkehr zwischen den heimischen und den im Felde stehenden Kirchengliedern habe ich den Hauptwert der Besuche gefunden. Und wenn dem Katholiken gegenüber, der, auf den Bischof seiner Kirche stolz, dem „lutherischen“ Kameraden zurief, daß er so etwas nicht
| habe, dieser nach der Einkehr seines heimatlichen Geistlichen die Freude über die Ansprache und die Gemeinschaftspflege (Hebr. 13, 16) zum Ausdruck brachte, so war das auch kein Schaden. Die Kirche darf und muß mehr konkretisieren, mehr Gestalt gewinnen und annehmen, die Leiter und Führer müssen mehr persönliche Fühlung fassen und dürfen nicht in unerreichbarer Ferne als „Begrifflichkeiten“ schweben, mit denen sich wenig anfangen läßt und allzuwenig angefangen wird.
In einzelnen Bildern, die nie den Anspruch genauer Abgestimmtheit erheben, möchten die Eindrücke dieser bescheidenen Reise niedergelegt werden.
Land und Leute.
Während die Gegend von Lille und Douay bis nach Peronne und in die jetzt schwer umkämpften Gebiete wenig reizvoll ist, die Wälder öde und ungepflegt, die Flora kümmerlich und dürftig und nur eine reiche Zahl von Vögeln das Land bevölkert, die Felder aber, gut bebaut, fruchtbar und mit Obstbäumen ringsum eingefriedet sind, ist das französische Lothringen reich an weiten, mächtig sich hindehnenden, ob auch nicht gut gehaltenen Eichen- und Buchenbeständen, in denen Farrenkräuter, wohl auch der Adlerfarren, von tropischer Größe und viele Feldblumen wuchern. Es ist ein echt deutscher Gedanke, den Wald in seiner Pracht stehen zu lassen wie dort nahe der
Côte Lorraine oder bei den Besitzungen, die einst Stanislaus Leszinsky sein eigen genannt hatte. Freilich sind die Felder von Lothringen, in seinem französischen wie im deutschen Teile lange nicht so gut gehalten als dort, wo in längerer Ruhezeit deutscher Ernst und Fleiß sie bestellt hat. Das Land gibt zu viel freiwillig her als daß man es zu größerem Ertrage durch treuere Arbeit anhalten wollte. Die Weingelände an den Hängen hin, die üppigen Getreidefelder
| stehen in sommerlicher Pracht mehr aus der Unmittelbarkeit der starken Fruchtbarkeit als daß sie den Ertrag der Tätigkeit auswiesen. Wenn im Frankenlande die Leute zur Sommerszeit von Feld und Wiese heimkehren, geht der lothringische Bauer verschlafen und verdrossen hinaus, um bald wieder heimzukehren. Andererseits erscheint der Nordosten Frankreichs reicher an alten Städten und schmuckvollen Kirchen als der an die Reichslande angrenzende Teil. Es ist unbestreitbar, daß unter der eingesessenen Bevölkerung jener Gegenden noch germanischer Einschlag, mehr Bodenbeständigkeit und Seßhaftigkeit sich findet als im Südosten. Ob nicht auch die Arbeitstreue der Hugenotten, die kalvinistische Pflichtstrenge, die hundert Jahre lang den Norden Frankreichs beherrschte und durchgeistigte, bis die einst unter ihr aufgewachsene Maintenon zur Vertreibung des intelligentesten Volksteils reizte und bestimmte, ob nicht das
„numquam otiosus“ jener starren und doch so lebensbewußten Hugenotten noch nachwirkt, kann gefragt werden. Wie unter der Erde bei der Anlegung von Laufgräben und Schanzwerken Spuren einfacher Kapellen gefunden wurden, die vor Jahrhunderten, den Katakomben der Urchristenheit gleich, Versammlungsstätten der Reformierten waren, so scheinen noch Spuren der alten ernsten Arbeit durch die Städte zu gehen, denen in den farbenfreudigen Domen und leuchtenden Kirchen der zu reicher Entfaltung des äußeren frohen Glanzes, des Triumphes der Kirchenwahrheit neigende Katholizismus sein Gepräge jetzt gegeben hat. Aber allenthalben stößt der Blick auf unvermittelte Gegensätze. Neben den dürftigsten Hütten, deren elende Wände Windfänge sind, deren Dächer allein durch das auf ihnen in Grüngold schimmernde Moos und das wetterfarbene Stroh mit dem traurigen Eindruck versöhnen, stehen Paläste, die mit allem Komfort ausgestattet sind, wie im alten Rom neben den Gütern der
coloni die
| Prachtbauten ihrer Dränger und Treiber. An die Boulevards, die im Prunke sich blähen, enge, finstere, schmutzige Gäßchen mit unbetretbarem Pflaster, der Reinlichkeit wie mit bewußter Willensredlichkeit absagend. Die Kathedrale mit herrlichen Grisaille-Malereien zartester Abtönung, mit wunderbar über Erdenleid- und -not sich hebenden Wölbungen und himmelanstrebenden Bögen, deren Schwingungen in stolzer, leichter Weite das allzu Irdische vergessen lassen, birgt doch Monumente ohne jeden künstlerischen Wert. Wer Fenelon, den größten aller Cambraier Bischöfe liebt und ehrt, kann nur mit Wehmut an sein Grabmal denken, das eher auf das Grab Ernest Renans im Pantheon sich schickte. Lediglich der nach Ruhm und Beifall aussehende Schriftsteller, der Verfasser der
aventures de Telémaque scheint zur Darstellung gebracht zu sein. Nur die kleinen Reliefs an den Sockelflächen deuten auf den Hirten und Seelsorger seiner Diözese. Wo aber die Bedeutung des Priesters hervorgehoben werden soll, da liebt es die Kunst augenscheinlich in massiger Vergrößerung zu symbolisieren, Quantitäten anstelle der qualitativen Wertung darzubieten. – Die Umgebung des Domes, seine äußere Bewahrung steht im Gegensatze zu seiner Bedeutung, die armseligen Vortüren mit den zerschlissenen Füllungen, die abbröckelnden Mauern, die aus dem Gefüge weichenden Steine sind doch nicht nur auf Rechnung der Gesetze Combes’ zu stellen, der, selbst einst Priester, die Trennung von Kirche und Staat durchgesetzt hat und die Erhaltung der Kultstätten den
fondations réligieuses und den freien Vereinigungen überließ. Peinlich wirken auch die Gegensätze, wenn mitten in die edelste Kunst etwa der Kölner Meister, von deren Wirksamkeit nicht wenige Bilder zeigen, ein handwerksmäßiges Bild der Jeanne d’Arc, mitten in den schönen Gestaltungen des Übergangs des romanischen in den frühgothischen Stil ihre Gipsstatuette zu finden ist.
.
| Wie viele Denkmale auch ins Auge fallen, selten erfaßt und ergreift ihrer eines, kommt es daher, weil sie nie selbstlos und rein den Gedanken zum Ausdruck bringen, der in dem Helden selbst lebte, sondern zumeist einer ganz bestimmten Tendenz, die ihnen – ich finde keinen besseren Ausdruck – aufetikettiert ist? Das an sich frische, lebensvolle, fast zu kecke Reiterbild der Jungfrau in Lille kann erfreuen, aber was „hineingeheimnist“ ist, muß verstimmen, nicht um der Sache willen, sondern wegen der Unvermitteltheit. Das vorstürmende Bild Neys auf dem Metzer Glacis ist durch das Standbild des gütigen Kaisers Wilhelm
I. glücklich, weil von innen heraus überwunden: allein stehend würde es mit seiner aufdringlichen Absichtlichkeit verstimmen.
Die Kirchen auf dem Lande sind selten wirklich bedeutend. Viel Fabrikware, wenig Kunst! Und doch bergen sie oft unerkannte und ungehobene Schätze, deren Entdeckung und Bewertung erst der deutschen Gründlichkeit beschieden ist. Um Stenay liegen etliche kleine Kapellen von künstlerischem Schmuck, in Wich erhebt sich eine Kirche von hervorragender Schönheit mit bedeutsamen Skulpturen, in der Templerkapelle zu Metz finden sich Pietás, Darstellungen auf Predellen, Figuren von rührender Innigkeit und Feinheit aus zerstörten Kirchen aufbewahrt. Douai birgt Schätze von hohem Werte aus alten Gotteshäusern und Hauskapellen. – Aber nichts ist recht geordnet und gepflegt; für den Franzosen, diesen Menschen der eiligsten Gegenwart scheint die Vergangenheit nur vorhanden, um an ihr sich zu berauschen.
Daher auch der nimmer müde, das Lebenselement der letzten vierzig Jahre, doch wahrlich nicht nur dieser kurzen Zeit bildende Gedanke an Revanche. Ihm dienen die Bilder in den Schulen – in einer wohl zwanzig mal das Bild der Johanna! –, die Darstellungen der Greueltaten bayrischer Kürassiere, die Kinder in den
| Brunnen werfen, alte Frauen mit Kolben niederschlagen, in den Häusern, da das trauernde Frankreich, von einem preußischen Feldwebel mit gezücktem Dolche genötigt, von der Brutalität Bismarcks und Moltkes bedrängt, angesichts der auf der Erde röchelnden Kinder Elsaß und Lothringen und umgeben von Räubern, die seine Kleinodien fortschleppen, mit zögernder Feder den Frankfurter Frieden unterschreibt. Dem Rachegedanken dienen selbst die
ossuaires wie dort in Bazeilles, da die Gebeine der in den Kämpfen des September 1870 Gefallenen, in Zellen aufgeschichtet, von verschiedenfarbigem Lichte grell beleuchtet sind. Wenn in der Kirche zu Mars la Tour für einen Verwandten des Mädchens von Dom Remy eine eigne Kapellennische errichtet ist, obgleich dieser Verwandte kaum lückenlos seinen Stammbaum durch die Jahrhunderte wird zurückführen können und eine wenig belangliche Äußerung, daß er seine Pflicht für das Vaterland tun werde wie seine große Verwandte sie erfüllt hat, in Erz gegraben zu werden gewürdigt ward, so ist das ebenso im Dienste des Einen Gedankens gegen den
cauchemar Prussien wie das an sich geschmackvolle Denkmal am Wegrand dort auf dem Schlachtfeld. Das verbreitetste und beste Geschichtsbuch in der Volksschulen (von Ernest Lavisse) redet von der Pflicht, Elsaß und Lothringen wieder zu gewinnen, denn es sei Ehrensache, diese verlorenen Kinder wieder zu holen. Zwischen Frankreich und Deutschland sei
litteralement dit un abime si profond, daß er nie sich schließen werde. Und leider ist der Gedanke der Rache durch eine „
nostalgie“ vergrößert und scheinbar begründet, die in den Reichslanden nur zu offen auftritt. Was Wiese in seinen oben zitierten Amtserinnerungen (
I, S. 318 ff.) über den Besuch der reichsländischen Schüler vor fünfundvierzig Jahren ausführt als Kennzeichnung der Stimmung, das mag leider noch durchweg gelten. Die Erinnerung an Frankreich verklärt
| sentimental das Gute, das man von dort einst empfangen hat und verdeckt und entschuldigt unbillig wie in hysterisch befangenem Eigensinn die Unbilden und die Unordnung, die Frankreich über die deutschen Lande gebracht hat. Jener Metzer Geistliche gab die Vortrefflichkeit unserer Schulen und Schulordnungen zu, den Ernst der Schulzucht und der konzentrierten Bildung. Aber wie prophetisch sprach er:
il vous faudra des siècles pour en venir à bout, Nationalisierung der Schule, Erziehung ihrer Jugend in deutschem Geist, Erhebung zur Liebe für das alte Vaterland.
Sind die fünfundvierzig Jahre, die Metz mit neuem Glanze schmückten, seinen prächtigen Dom würdig und weihevoll erneuerten, seine Umgebung bebauten, die aus Straßburg in treuer Bewahrung des Alten, in verständnisvoller Anfügung des Neuen die wunderschöne Stadt wieder in vollem Glanze erstehen ließen, Jahre der Milde und Güte, in der die militärischen Statthalter ihre Vorgänger und Nachfolger aus dem Diplomatenstande noch übertrafen, ganz vergessen? Es liegt dem Freunde deutschen Wesens, der durch die lieblichen, bald großartigen, bald still abgeschiedenen Vogesentäler zieht, den reichen Kranz der Erinnerungen beschaut, die von der Güte und Treue der Geschichte um das Elsaß gelegt sind, schwer auf, daß Gottfried von Straßburg und Sebastian Brant, Tauler und Geiler von Kaisersberg, Jakob Sturm und Spener, die an der deutschen Innerlichkeit, Lauterkeit und frommer Innigkeit ihre Umwelt wollten genesen lassen, sogar vergessen und verklungen sein sollten. –
Aber der Augenschein, der freilich trügt, der erste Eindruck, der nicht immer richtig sein muß, die Brandruinen von Dörfern, die um ihres Verrates willen von uns niedergeschossen werden mußten, scheinen denen Recht geben zu wollen, die in den Reichslanden, deren Verfassung von Anfang an Verurteilung erfahren mußte,
| allzuwenig Sympathien finden wollen für das alte Stammland, das, wenn ihm nicht Liebe geschenkt wird, doch Gerechtigkeit beanspruchen könnte. In der vorzüglichen Kaiserrede des Kirchenhistorikers
D. Gustav Anrich an der Kaiser Wilhelms-Universität Straßburg (27. Januar 1916), die besonders durch ihre mit genauestem Fleiße zusammengetragenen Literaturnachweise wirkt und Beachtung verdient, ist nachgewiesen, wie trotz der Gegenarbeit evangelischer Beharrlichkeit, die das Deutschtum durchretten wollte, das Ziel des
françiser la population alsacienne (Präfekt Chanal 1849), des
conquerir l’Alsace à la langue francaise – la langue nationale (Delkassé 1899), erreicht ward. Das Urteil des Literarhistorikers Taillandier 1857 scheint richtig:
L’Alsace allemande par les habitudes de l’ésprit, elle est profondement française par coeur. In den einfachen Fragen eines elsässischen Volksfreundes meint zwar Adolf Stöber, das System der Entdeutschung sei ein verfehltes gewesen. Das tiefste Herz sei doch bei Deutschland, ihm sei die Liebe stets geblieben. Aber noch ist die Sprache der Kinder, auch der einfacheren Kreise französisch, die Frauen des gebildeten Mittelstandes, weil sie weder in ihrem Dialektdeutsch noch in dem schulmäßig gelernten und wie fremdartig gebrauchten hochdeutsch sich offen bewegen mögen –
nous cesserons de plaire! – sprechen gerne die fremde Sprache; die Institute über der Grenze werden bevorzugt, die Vermählungen französischer Nobilität mit den Töchtern des Landes gesucht und begehrt, man hört da, in den französischen Schulen werde „mehr gelernt“, weil der Schein und das Scheinwesen, die Gewandtheit und Einprägung fertiger Ergebnisse gefördert wird, man vernimmt dort, daß den alten Gerechtsamen in Kirche und Gemeinde vor der französischen Zeit zartere und verständnisvollere Rücksicht erwiesen worden sei. Das Bedürfnis nach Anlehnung in den Reichslanden
| begegnet dem stürmischen Verlangen unsrer Feinde, zurückzugewinnen, was „zu Unrecht“ genommen ward.
Vor 75 Jahren hielt auf dem Congrès scientifique de France zu Straßburg Professor Boersch eine Rede, die, wie mir scheint, auch 1916 noch hätte gehalten werden können. Er spricht von der bonne et vieille affection dans notre Alsace pour l’Allemagne. Maîs ce ne sont pas les regards de regret de l’enfant arraché à la maison paternelle, c’est plutôt le regard d’affection dont la jeune épouse salue encore le toit de sa mère, heureuse, du toit nouveau qui l’abrite et du nom de son époux qu’elle porte avec orgueil. So stand es einst, so steht es noch heute, wenn ich klar gesehen und deutlich gehört habe. Daß die ernsten und treuen Bestrebungen der altdeutschen Kreise, der Schriftsteller und Dichter, der rechten und echten Vaterlandsfreunde trotzdem nicht vergeblich waren, wird die spätere Geschichte und die Entwickelung der Verhältnisse noch erweisen. Es bedarf – das muß die Betrachtung der Dinge immer wieder lehren – doch längerer Zeit als die verflossene, um Jahrhunderte lange eingebürgerte und eingewurzelte Verbindungen, Verbrüderungen und Verpflichtungen, so wenig haltbar sie waren, verschwinden zu lassen, auch wenn und obwohl das Eingetauschte das Größere und Reichere ist, ja vielleicht gerade dann.
Wenn aber durch die derzeitige Tage der Dinge, die der Eitelkeit Frankreichs nur zu sehr schmeichelt, der Rachegedanke gesteigert und das Verlangen, für 1870 Genugtuung zu erlangen, wächst, so wird die Enttäuschung durch die Tatsachen erweisen, daß in den letzten fünfzig Jahren Frankreich viel zu sehr entartet und um große Momente ärmer geworden ist, als daß es noch anderes bieten könnte, denn ein Maß von unbrauchbarer Freiheit und unnützen Gewährungen, deren Unkraft so bald sich erweist, als sie praktisch genützt werden sollen.
| Nicht zu verkennen ist, daß so wenig nur der Revanchegedanke die mächtige, prunkvolle und doch erkältende Kirche auf dem Montmartre ein die Erscheinung gerufen hat, zu der immerhin religiöse Impulse mitwirkten, in Frankreich das religiöse Leben, zunächst in der Gestalt des Devotionalismus, in aufsteigender Bewegung begriffen ist. Die vollen Kirchen in den großen Städten Douai, Lille, Cambrai und Valenciennes mit vielen gottesdienstlichen Feiern, an denen sich auch die Männerwelt beteiligt, die Sühneandachten und von Priestern nicht geleiteten Vereinigungen des dritten Ordens des Franziskus in den Landkirchen, die
prières communes, die einzelne Frauen mit den um sie gesammelten Kindern leiten, beweisen, daß trotz oder vermöge der Verbannung des religiösen Unterrichts aus der Schulen und trotz ihrer bis zur Lächerlichkeit „gottlosen“ Lehrbücher das religiöse Moment und zwar in der ganz bestimmten royalistischen Färbung, wenn so gesagt werden darf, hervordringt. Man erbittet doch wohl Rückkehr des alten Regimes, als welches weder Republik noch das allzu kurzlebige Kaisertum der Napoleons angesprochen wird, sondern nur
le royaume des lis, man erhofft von diesem die Wiedereinsetzung Frankreichs in seine frühere Würde als „älteste Tochter der Kirche“ und man erwartet von dieser Erneuerung Wiederaufleben der alten Gerechtsame und Privilegien, der kirchlichen Obermacht im Orient, des Patronats über die katholischen Missionen, kurz die Zeiten der gesegneten Restauration und ihrer Ideale eines Xavier de Maistre.
.
In mancher Besprechung aber durfte ich doch auch wahrnehmen, daß tiefinnerliche Gedanken über verborgene Zusammenhänge von Schuld und Strafe, von Verhängnis und Bereitung die Gemüter bewegten. Man darf und kann nicht vergessen, daß Frankreich nicht nur Renan, sondern auch Lakordaire und Dupanloup, nicht nur Voltaire und
| de la Mettrie, sondern auch Pascal hervorgebracht hat: das Land der Extreme birgt alle Klänge und Töne in sich.
Ein kurzes Wort über das Volk im allgemeinen soll diese Rückblicke beschließen, die zwar nur eiliger Berührung mit Land und Leuten sich verdanken, aber eben in ihrer Unmittelbarkeit vielleicht den Wert der Ursprünglichkeit haben. Durch das Unglück nicht getroffen, nur erregt, durch das Leid nicht gebeugt, nur erbittert, von sich alles erwartend und doch sich selbst nicht kennend, zu den größten Anstrengungen bereit und willig geschickt, dem Augenblicke aber, der die gleichmäßige Pflichterfüllung beansprucht, stets sich versagend und entziehend, voll Sinn für das Schöne und doch das Unschöne pflegend, immer über sich hinaus strebend und nicht die Umwelt und die Pflicht an sie bemessend, verbindlich, aber nicht verlässig, am Werktage im Festkleide, weil französische Flieger über ihre Stadt Bomben gestreut haben, von denen etliche Deutsche getötet und verwundet wurden, obwohl die Behörden dann in beträchtliche Strafen genommen wurden, und dann am Sonntage im Arbeitskleide verdrossen und mißgestimmt! Das ist Frankreich, dessen Vorzüge in Einzelzügen sich verflachen, dessen ungute Seiten zur Eigenart verstarren.
II. Unsere Leute.
Was Tacitus einmal von der
robur ac constantia rühmt, die mehr erreiche als
ardor et alacritas, das weist der Krieg aus. Wenn in den ersten Kriegstagen die helle, heiße Begeisterung aus den Augen leuchtete und der fortwirkende Funke durch die Reihen der ausziehenden Kriegsleute sprang, also daß die Gesänge wie ein Protest gegen Ungebühr und Unglimpf lauteten und die große schwere Aufgabe fast wie ein Waffenspiel sich darstellte, so ist in den 25 Monaten heißer und furchtbarer Not, da jeder Nerv angestrengt und jede patriotische Regung auf ihren tiefsten
| Kern und Gehalt geprüft wurde, diese Unmittelbarkeit des Kampfmutes verschwunden. Aber die beiden größten Grundkräfte deutschen Gemütes sind geblieben, die ausdauernde, kernechte Kraft des stillgefaßten Entschlusses und die an Hindernissen nicht hinschwindende, sondern erstarkende Gewalt der Ausdauer. Solange der Stimmung die Eindrücke von außen zu statten kommen und in den Dienst sich stellen, ist sie reine Natur; die angeborene Anlage gibt sich zu erkennen, läßt sich in ihrer ganzen Art gehen. Wenn aber die Hindernisse da am meisten erwachsen, wo sie am wenigsten erwartet wurden und so sich einstellen, wie sie nicht vermutet waren, statt der freien fröhlichen Feldschlacht der zäh sich hinschleppende Stellungskrieg einsetzt, der Dank der Heimat schweigsamer und schwächer wird, der wie ein Hochstrom auf die ersten großen Siege hinaus zu den Truppen flutete, sie zu stärken und zu erheben, dann setzt es der ringenden, der Ursprünglichkeit und Kraft sich bewußten Volksseele hart zu: sie, die andere an ihre Kraft und stolze Stärke glauben zu lehren, glauben zu lassen gewohnt war, muß nun an sich selbst glauben lernen, von sichtbaren, greifbaren, leuchtenden und Licht verbreitenden Erfolgen absehen und sich auf sich selbst und die stärksten Kräfte der Innerlichkeit zurückziehen lernen und in Gefaßtheit der Stunden warten, wo sie wieder emporsteigen darf.
.
Soweit die Geschichte deutscher Kriegsführung zurückreicht, ist ihr die rasche Tat, die zu ihr ausreifende Bereitung, die Konzentrierung auf den entscheidenden Schlag am ehesten gelegen. Alles einzusetzen und alles zu gewinnen ist deutsche Art, die selbst Niederlagen weniger scheut als die Aussichtslosigkeit eines unfruchtbaren Belagerungskrieges. Die offene Feldschlacht, als rasch die Aufgabe erledigende, von Druck und Drang entledigende Tat ward dem Manneswesen eigen, das alles auf eines setzte, auch in Gefahr zu verlieren. – Das nun ist in diesem Kriege anders geworden.
| Die Feinde haben den Plan gefaßt, zu ermüden, wo Großzügigkeit und schneller Entschluß ihnen gebrach, durch lange vorbereitete ermüdende Kleinarbeit dem an beiden so reicheren Gegner den Atem zu benehmen, als ob nicht auch die Geduld ein kraftvoller Atem wäre, und durch fortgesetzte Anforderungen an die innersten Seelenkräfte, an Beharrlichkeit, Selbstlosigkeit, Zufriedenheit die Erreichung des Zieles in Frage zu stellen, das der Kraft und Gewalt des deutschen Ansturms winkte. Aber der Krieg, der nicht Neues schafft, sondern das Alte erneuert, und das in Volksseele und Einzelwesen ihnen selbst unbewußt Ruhende herausstellt, ganz wie es ist, weil Maske und Täuschung gefallen und hemmende Schranken verflogen sind, hat die beste Kraft des deutschen Charakters herausgerufen; „charaktervoll sein und deutsch sein ist doch gleichbedeutend,“ meint Fichte, ja hat gezeigt, daß das eigentliche Gepräge eines Volkes, besser noch die Volksgeprägtheit, die Persönlichkeit, die nicht aus Aggregaten von Personen, nicht einmal von Charakteren sich zusammensetzt, gerade aus den schwersten Proben, die das Temperament belasten, langsam, bedächtig, nicht ohne Schwankungen, aber sieghaft und stark heraustritt. Diese zähe Beharrlichkeit, die nichts von Erfolg zu schauen, nichts von Zufall zu genießen begehrt, diese Kraft, die in metaphysischem Sinne Glaube heißt, nicht fragt, ob das zu Tuende annehmlich, erträglich, ertragvoll, sondern nur, ob es zu tun sei, ist in dem harten Frondienst dieses Krieges hervorgetreten, nicht wie die gewappnete Kraft aus plötzlichen Entschlüssen, aufglänzend, blendend, berückend. Sondern aus schweren mächtigen Kämpfen tiefethischer Art mit einer Welt der Niedertracht, der Verkleinerungs- und Begeiferungssucht, der Schnödigkeit des Undanks und der feigen Art der Kondottiere, tiefstgetroffen von dem, was deutscher Ehrlichkeit unausdenkbar, deutscher Ernstlichkeit wie höhnender Spuk galt, verlassen, vergessen,
| verstoßen rang sich das Gebilde empor, Treue bis in den Tod zu halten und das Recht der Treue vor ewigen Zeugen zu wahren, wenn irdische versagen oder die Treue belächeln als altväterischen Hausrat, der für den modernen Krieg nur aufhalte und störe.
.
Was so als deutscher Persönlichkeit bestes Gut erwachte und erstarkte, die
robur ac constantia, die weiß und wissen läßt, es handle sich nicht um Glück, sondern um Ehre, das hat durch das geheimnisvolle Band, das in Zeiten der Not fester umschlingt als lächelnde Zeiten glauben und fühlen lassen, den einzelnen Mann erfaßt und stark genommen: er will des Ganzen nicht unwert sein. Ob ich durch zerschossene Städte im Morgengrauen des Vorfrühlings ging oder im Frührot des Augustmorgens durch die schweigenden Wälder, immer begegneten mir die einzelnen Leute, oft mit Staub und Schmutz überdeckt, die Schaufel geschultert, von den Gräben heimkehrend in die oft so armseligen Quartiere oder in die Stellungen vorgehend, mit dem Gleichmut der Selbstverständlichkeit, die nichts anderes weiß als das Pflichtgebot der Stunde, dies aber ganz. Es war nicht selten eine mühsame Wanderung dem Einerlei entgegen, aus dem grauen unförmigen und einförmigen Dienste heraus. „Aber weil es sein muß, so soll’s auch gern sein“ – hat ein Soldat gerufen und viele ihrer ihm nach. Darum war auch die Arbeit in den Gräben so solid und gründlich, so für Jahrzehnte angelegt, sauber und fest, während die der Franzosen schlampig und ungut war, wie für den Augenblick entstanden, der sie bedurfte. Dabei fehlte der Humor nicht, einer ernsten Arbeit guter Begleiter, der in den Benennungen der Gräben und Grabenwege, in den Namen der einzelnen Abschnitte sein unschuldiges Spiel trieb, das aus hohem Ernst geboren war. Wo von Humor auf französischer Seite zu spüren war, da war es galliger und unfeiner, der nicht befreite. Die rohen Zeichnungen
| an den Seitenwänden der Unterstände, die zuweilen trotz der Primitivität wahre Kunstwerke waren, mußten auch dem Feinde, wenn und wo er sie sah, ein behagliches Lächeln ablocken: denn Schwächen sind nicht schonungslos ausgebeutet, sondern mit Witz getroffen. Mehr aber noch als der Humor erquickten die Anzeichen des tiefen Heimatssinnes, der die Schießscharten und Beobachtungsöffnungen und -luken mit den Pflanzen des heimatlichen altbayrischen, fränkischen Bauerngärtleins ausschmücken und die Unterstände mit Notizen aus dem Lokalblättlein des heimischen Städtchens, mit den farbenbunten Bildern der Lieben bedecken ließ. Ein Volk, das mitten im erschütternden Ernste der Heimat gedenkt, – wie oft habe ich das den Leuten in kirchlichen Ansprachen und seelsorgerlichen Einzelunterredungen sagen dürfen – und den Tod vor Augen das bewahrt, was Leben atmet und verbürgt, kann nicht untergehen. „Deutschland ist noch immer da, und seine unsichtbare Kraft ist ungeschwächt,“ hat Schleiermacher 1807 gesagt. Diese unsichtbare Kraft des deutschen Gemütes, das Napoleon
I. ironisch und doch tiefblickend
l’ésprit allemand hieß, rüstet durch die liebende Pflege der wenig beachteten Kleinheiten des Lebens, durch treues Ausruhen in einer von Sieg und Leid sich auf sich selbst zurückziehenden Welt der Innerlichkeit Mut und Willen für die größten Aufgaben, die beide beanspruchen.
.
Mochte man zu Zeiten einen müden, fast verdrossenen Zug gewahren, der am ehesten eintrat, wenn die Ruhe des Lazaretts an die herbe und harte Arbeit draußen nicht denken wollte, konnte auch manches schwere und rauhe Wort vernommen werden, das den Frieden um jeden Preis einem preiswürdigen Kampfe vorziehen zu wollen schien – sobald wieder ein frischer Luftzug über dieses starre, bleierne Meer der Alltäglichkeit hinzog, etwa die Glocken aus den deutschen Dörfern hinüber nach Frankreich klangen, um
| den Fall rumänischer Städte oder irgend einen Fortschritt in West und Ost zu verkünden, war alles Leid verschwunden. Die Müdigkeit und Sorglichkeit, die sich einredet und noch lieber einreden läßt, war einer getrosten und zuversichtlichen Stimmung gewichen, es mußte wieder aufwärts gehen. Sittliche Grundkräfte sind doch am wirksamsten wie am deutlichsten da und dann, wenn Hemmungen entgegentreten, nicht augenblickliche, die den Widerstand hervorrufen und die Lust zur Abwehr in ihr selbst steigern, sondern wenn langsam hinzehrende das Gewohnheitsmäßige als lähmendes Kraft herausstellende Hinderungen nicht weichen wollen, längst gehegte Hoffnungen ebenso wenig sich verwirklichen als langaussichtige Befürchtungen und die sich hindehnenden Wochen durch die rein quantitative Gewalt erreichen wollen, was stets eingreifenden Ereignissen gelingt. Hier bricht langsam und bei jeder Berührung neu gestärkt die
ὑπομονή hervor, dieser regelmäßige Atemzug und Pulsschlag des Charakters, dem ein apostolisches Wort den Ruhm der Abgeklärtheit und Ausgereiftheit zuspricht, diese stille Stärke, die in der Geschlossenheit von Wunsch und Wille jeder auch der peinvollsten Aufgabe gegenüber sich bewährt, habe ich bewundern können, wenn der Bauersmann im Soldatengewand die fremden Felder bestellte, sorglich, treulich, besinnlich als wäre es das eigene Gelände oder neidlos nach Hause meldet, wie gut sich die Ernte draußen anlasse, so schwer ihm die Erinnerung an das fallen mußte, was er gelassen hatte und ließ. Sein Feld ward mager bestellt, seiner Garben konnte er sich nicht freuen, aber er freute sich
der Ernte, weil sie ihn hoffen ließ, auch wenn er nichts vom Eignen sah.
.
Wenn in den oft eigenartigen Kasernen, so dort in der Kahnkaserne auf einem der zahlreichen Kanäle, die Nordfrankreich durchziehen, in den bescheidenen Wohnräumen in dem lothringischen Parke, nahe an Gräbern von
| Freund und Feind, in den Fabrikräumen bei Lille die Leute sich durch Erzählungen aus der Heimat den Mut für die Fremde stärkten und in den durch ärztliche Treue oder die werbende Liebe der Feldgeistlichen hergerichteten Lese- und Schreibzimmern die Grüße hinausgingen, die trotz unleugbarer Schatten und Schäden den Ernst der Treue bezeugten, so wußte der Beschauer, der sein Volk liebt und für seine Zukunft hofft, daß die echte rechte Treue doch die Oberhand behält und die unschönen Züge des Gemeinen und Lüsternen, des schnöden Tandes und Flitters sie nicht verdrängen, und verbergen können.
Wenn nach dem Kriege – etwa Jahrzehnte danach – Briefe aus allerlei Volk und Bildungsstufe werden veröffentlicht werden, soll man auch aus den vertraulichsten, für die Öffentlichkeit nicht bestimmten Zeugnissen ermessen, wie recht jener General hatte, der meinte, mit diesen Leuten lasse sich alles leisten.
Dem tiefer Blickenden ist es auch ganz gewiß, daß diese Eigenart des Krieges kommen und andauern mußte, um Züge, die dem Volkscharakter innewohnen, aber im Laufe der Zeiten weniger hervortraten, als die eigentlich bestimmenden und beherrschenden zur Geltung kommen zu lassen. Denn gemeiniglich sind nicht die dem ersten Eindrucke sich darstellenden Temperamentsstücke die wesentlichen, sondern die ihnen entgegengesetzten. –
Hier nun mag der Anlaß sein, über
die Seelsorge im Heere, wie sie ein eilig Vorüberziehender wahrlich nicht vorbildlich, aber vielleicht doch in nicht ganz unbeachtlicher Weise geübt hat, etliches zu sagen. Wesen dieser speziellen Seelsorge ist der tiefe nie erschütterte Respekt vor der Einzelseele, ihrem Verlangen und Bedürfnis, die zarte Scheu, nicht aufdringlich, daneben das ernste Verlangen eindringlich zu hören. Es schreckt ab, wenn der Soldat einer förmlichen, amtlich veranlaßten und so sich gebenden „Seelsorge“
| begegnet, die weder Zeit noch Kraft hat, sich in Leid und Leben des anderen einzudenken, einzuleben und einzuleiden. Und es tut nicht gut, wenn man mit Voraussetzungen an den Menschen herantritt, die man bei sich selbst ablehnt. „Redet mit Jerusalem freundlich!“ Das muß der Grundzug der werbenden, aufschließenden Bemühung sein, die das Menschenherz wieder in Beziehungen zu dem setzen will, der es zu sich hin geschaffen hat. Das einfachste Wort, wie es die Stunde gibt, der schlichteste Ton, wie er in und von ihr geprägt wird, wirkt am meisten. Von den äußeren Vorgängen, den jüngsten Erlebnissen, von Heimatsgedanken geht die Rede und der Segen aus. Ich habe es mir immer vorgenommen, selbst auf die Gefahr hin, Ungereimtes und Ungeeignetes einmal hören zu müssen, ganz aus dem Natürlichen und seiner Umwelt mich an die Leute zu wenden. „Nicht das Wort tut es, sondern sein Ton.“ Der schlichten Erinnerung an die alte Dorfkirche in der fränkischen Heimat, an die moosbewachsenen, eingesunkenen Grabhügel, unter denen Vater und Mutter schlafen, an den Kirchenweg hinter den Hecken, an den Kirchhofpfad hinter den Wiesen, an die Menge der kleinen Denkzeichen, die das Kind des Dorfes mit in seine Welt hineinnimmt, verschließt sich selten das Herz, wie denn die in ungewußter und ungewollter Verschönerung auch die Tage einer schweren Jugend verklärt. An diese einfachste Zusprache rein menschlicher Art kann dann die religiöse besser anknüpfen: der Einsegnungsspruch vom Konfirmationstag, der Hochzeitstext bei den Landwehrleuten, die Aufschrift über dem Kirchtor leitet dann zu den größten Fragen über: „wie töricht ist es, nur mit einem goldnen Schlüssel öffnen zu wollen, wo doch der eiserne paßt,“ sagt ein alter Vater (Heinrich Müller). Und Balthasar Schuppius, der im Oktober 1648 die Friedenspredigt über den 126. Psalm gehalten hat, weist darauf hin:
sapiamus| cum sapientibus, loquamur cum vulgo. – Aus der also geübten Seelsorge im einzelnen erwächst die
Gesamtseelsorge in der Kultrede, die kurz, prägnant, „merksam“ sein muß. Kurz soll die Ansprache im Gottesdienste wie dieser selbst sein. Lange noch so gut ausgearbeitete Predigten tun es in einer Zeit nicht, die jeden Nerv in Schwingung setzt und jede Stunde Neues, Unerwartetes bringen läßt. Diese Kürze soll nicht, wie es leicht Gefahr ist, den militärisch gewohnten Ton nachahmen, sondern dem Worte und der Weise dessen nachfolgen, der in wenigen Worten das Beste und Tiefste gab. Wo aber Kürze geboten ist, da wird der Prediger sich mühen, in wenig Worte viel zu legen. Das aber kann man nur, wenn man von bestimmten, kurzen Textesworten ausgeht. Etwa wie Wilhelm Walther in Rostock oder vor ihm Tholuck in seinen Stunden der Andacht die Perikopen in einzelne Teile zerlegt und behandelt. Diese Textesworte mögen dann mit den bestimmten Vorgängen, aus denen sie erwachsen sind, in Zusammenhang gebracht und prägnant an die Hörer gebracht werden, inhaltsvoll und zum Weiterdenken anregend. Ich durfte es merken, daß die kurzen Betrachtungen über Jes. 40, 1. 31; Ps. 25, 1; Ps. 25, 21; Ps. 130, die einzelnen Verse Matth. 11, 28 mit seinem zur Entscheidung drängenden Ernste, Offbg. 2, 13 mit dem tiefgreifenden Trostwort eines Herrn, der auch um kleinstes sich sorgt, Offbg. 21, 7 länger in dem Gemüt hafteten. Briefe in die Heimat haben es bewiesen, daß die auf die Verhältnisse ohne Zwang und Künstelei angewendeten Gottesworte in ihrer treffenden und belebenden Gedankenfülle wirkten. Die Prägnanz besteht wahrlich nicht darinnen, daß man geistreiche Zitate aneinander reiht, Bild auf Bild häuft, die möglichst aus dem Kriegsleben gewonnen sind, damit der Kriegsmann doch merken kann, wie viel vom Waffenhandwerk sein Seelsorger sich angeeignet hat, mehr
| Offizier als Geistlicher, der ja nicht aus dem Gedankenkreise herausfällt, in den der Krieg ihn gezwungen hat. Sie besteht auch nicht in einer Popularität, die
nur herabsteigt, nicht aber hinaufhebt, sondern in der schlichten Textanwendung auf Grund des einfältigen und festgestellten Glaubens an die Zeit und Umstände überdauernde und doch verstehende Gewalt des Gotteswortes. Lautre und klare Textanwendung gibt merksame Gedanken. Die Leute sollen nicht bewundern, noch loben, sondern mit heimnehmen. – Darum wird es gut sein, aus dem Leben bedeutender Männer, aus der Geschichte der Kirche, aus dem kernhaften Sprüchworte zum Schluß etwas beizubringen, das mehr wirkt als noch so feurige Appelle. Was haften bleibt, geht der Seele nach, legt sich wie Wall und Mauer um sie, umringt und schützt sie.
.
Unsere Kirche hat ja in ihren Feldgottesdiensten nur geringe Mittel, ein kurzes Lied – ich verstehe die Klage der Feldgeistlichen über den allzukargen eisernen Bestand von Liedern im Feldgesangbuch, aber ich teile sie nicht: weniger ist hier mehr. Der alte General von der Goltz, der im 66er und 70er Krieg durch Mut und Kühnheit viel zur Entscheidung beitrug, der Freund
D. Friedrich von Bodelschwinghs hat das Lied „Ach bleib mit deiner Gnade“ in guten und bösen Tagen lernen und singen lassen, sich und vielen zum Troste nur dieses Lied. Und in den Augusttagen dieses Jahres hat ein bayrischer General, da die Leute ihr Gesangbüchlein vergessen hatten, sie auf dieses „in der Schulzeit gelernte“ Lied hingewiesen. – Die alten Kernlieder immer wieder „eingehämmert“, eingeprägt, lassen die Menge von Kraft und Stärke ausströmen, die durch Jahrhunderte von ihnen ausging und als Dank wieder zu ihnen kehrte. Unsre Kirche hat neben
ihren Liedern, die durch das „Großer Gott, wir loben dich,“ und „Wir treten zum Beten“ weder ergänzt noch gar verdrängt werden
| sollen, neben dem einfachen Gebete, wie es die übelgescholtene und doch treuverdiente Zeit des dreißigjährigen Krieges herausgeboren hat, dem Gebete eben der Kirche, das nicht durch subjektive Ergüsse ersetzt werden kann, eben nur die
Ansprache. Alle Kriegspredigten in Ehren, ob sie in Sturm geboren heißen oder sind, alle eisernen Worte und Klänge in ihren Würden, aber wirklich trösten kann doch nur die biblische, nicht die allgemein ethische oder gar die patriotische Rede. Ich fürchte, spätere Zeiten werden über die Predigtliteratur des Kriegs ein hartes Urteil fällen; etliche religiöse „Gedanken“, keine wahrhaften Werte, etliche Reflexionen, keine starken, festen Lebensworte, – viel Allgemeines, aber nicht das Eine, was nottut, in der Beleuchtung, die es aus der furchtbaren Gegenwart empfängt. Das Ewige in den Rahmen des zeitlichen, das Unvergängliche in die Feuerprobe der Gegenwartsdinge gegeben – das ist Kriegspredigt, wie es recht ist.
Die katholischen Kirchen Frankreichs, weniger die des Elsaß und Lothringens, öffneten gastlich einer Predigt die Tore, die sie nicht entweihen konnte, durch manche Kirchen und Hallen war die Zerstörung gegangen, so daß der Prediger wie auf Ruinen stand. In Unterständen draußen im Walde, in einer Lichtung, die von oben vor Fliegerangriffen gesichert war, in Gärten und Parken, auf Straßen und an Zäunen, an Mauern und Rainen konnte der kurze Gottesdienst gehalten werden, der gerne mit dem vollen Segen geschlossen ward: „Du sollst meinen Namen auf mein Volk legen, daß ich es segne“ (4. Mose 6, 27).
In der großen Kirche zu Valenciennes, die dem Nikolaus von Myra, dem Patrone der Seefahrer und der Kinder geweiht ist, habe ich das heilige Abendmahl verwaltet: wohl etliche hundert Landwehrleute wurden mit dem Worte des Evangeliums vom Lätaresonntag getröstet „das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, die ist unser aller Mutter“
| und mit den sakramentlichen Gaben erquickt, mit ihnen auch etliche Diakonissen, die aus Bayern in die Lazarette gesandt waren. Ach, gewiß war die Macht der Gewohnheit auch hier zu spüren. Aber ob nicht Gewohnheit oder besser Gewöhnung, so wenig sie das Höchste ist, noch bedeutsamer und wertvoller ist als die nicht erkämpfte, sondern willkürlich angenommene Freiheit, der die Sitte nichts mehr bedeutet? Aus der großen und edlen Begierde nach Echtem heraus unterschätzt man jetzt in der Kirche die erziehlichen Momente des Herkommens und verwirft Ordnungen ohne anderes dafür zu bieten, läßt das Bessere den Feind des Guten werden. Es ist sehr richtig zu sagen, daß man lieber das Gebet unterlassen als gewohnheitsmäßig pflegen solle und doch vergißt man dabei, daß im Beten das Gebet gelernt wird. In dem Kriege würden viele Worte ganz verschüttet sein, wenn nicht die Gewohnheit zunächst ihren Gebrauch, dann ihren Gehalt näherbrächte. –
.
Unsere
Feldgeistlichen haben gewiß in großer Zahl
ihr Bestes geboten, ob es bei der öfter sich zeigenden Betonung des Subjektiven und dem Bestreben, modern zu predigen immer
das Beste war, steht dahin. Sie haben die mannigfachen eigenartigen Gefahren, die durch den ausschließlichen Verkehr mit Gesellschaftskreisen, mit denen ihre heimatliche Arbeit sie nur zu selten in Berührung bringt, wohl beachtet, den Verpflichtungen, die Höflichkeit und Sitte mit sich bringen, Genüge getan, ohne sich zu binden und daran festzuhalten. Daß sie nicht für den und jenen Kreis, sondern für die ganze Gemeinde berufen sind, durch gute Gerüchte, die ihr Tun bis in den Himmel erhoben und aus selbstverständlicher Arbeit ein Heldentum und eine Großtat hervorkommen sahen, wie durch böse Gerüchte, die sie im Schützengraben vermissen, zu viel in höheren, zu wenig in den einfachen Kreisen finden, die den öden Vergleich zwischen katholischem Eifer und evangelischer Lauheit und
| Lässigkeit belieben, gehen sie hindurch, sich prüfend, ob sie den Tadel verdienen, gewiß, daß nur die Treue verlangt und gesucht wird. Die Einrichtung, welche Bayern getroffen hat, das möglichst allen Lazaretten einen Geistlichen zuspricht, hat ein reiches, für die heimatliche Kirche kaum mehr zu leistendes Maß von Geistlichen angefordert. So mußte, was der außerbayrische Geistliche, der etat- oder außeretatmäßige Divisionsgeistliche ist, ohnehin hatte, Stellung, Gehalt, Einreihung, für die
Lazarett geistlichen und Lazarettzuggeistlichen mühsam erst erkämpft werden und vom 1. Dezember 1914 bis 23. Juli 1916 war mancher Schritt und manches Schriftwerk nötig, die gerade diesen Geistlichen das sicherten, was sie zur Ausrichtung ihres Berufes brauchten und brauchen. Wenn einmal die Geschichte der Militärseelsorge in Bayern geschrieben werden wird, soll man sehen, wie schwer hier die Verhältnisse waren, die in Preußen seit Friedrich Wilhelm
I. und hundert Jahre später seit seinem Urenkel Friedrich Wilhelm
III. (1832) geordnet sind. –
.
In den drei Konferenzen (4. April zu Douai, 7. und 14. August zu Konflans und Straßburg), die eine nicht unerhebliche Zahl von Geistlichen um mich sammelten, konnte auf Grund von Joh. 16, 33, Röm. 1, 11 und
II. Kor. 4, 6 das ganze Gebiet der Pflichten und das weite Feld der Mitteldinge betrachtet und übersehen werden. Es waren anregende und – mehr als das – ernste Stunden, in denen wir um die Ehre unseres Amtes, um das was es ehrt und was von ihm geehrt werden soll, uns mühten. Manch bedeutsames Wort fand hier seine gute Stätte. Und mit dem Troste schieden wir, daß aus jeder Finsternis Gott sein Licht hervorleuchten lassen will. Es ist hier nicht der Ort, die vielumstrittene Frage über das Verhältnis von Kirchenregiment und Geistlichen zu erörtern. Aber die schlechtesten wie die besten Theorien können durch die Praxis
| überholt werden, da einer des andern Last trägt. Das
Mitleiden und die ernste Bemühung, in das Amtsleben des Bruders
liebend einzudringen, gibt das rechte Wort und läßt hören, wo andere überhören. Nicht Synoden, noch Konferenzen, nicht weitschichtige Visitationen, die von lange her vorausgesagt und vorbereitet sind, bringen den Segen, den die schlichte
διακονία bringt, da einer des andern Gebrechlichkeit tragen und nicht Gefallen an sich selber haben will.
.
Große Unterstützung in ihrem amtlichen Wirken finden die Geistlichen weniger an den Heeren von Pflegerinnen, obgleich unter ihnen gewiß treffliche, ernste, echt weibliche Charaktere sind, die nichts anderes wollen, als dienen und helfen, als an den treuen Diakonissen, deren im Ernste und in der Einfachheit der Mutterhauserziehung erworbene Ausbildung ihnen trefflich zu statten kommt. – Einheitlich geschlossen, um den Geistlichen ihres Klosters geschart oder doch rasch von ihm zu erreichen stehen die katholischen Orden da, die möglichst klar und bestimmt ihre Arbeitsgebiete von einander abgrenzen. Nur selten fand ich, so in einem großen Typhuslazarette die Pflege dem einen, den Haushalt dem anderen Orden zugewiesen, scharf ziehen sie sich von den Angehörigen französischer Kongregationen zurück, die aus ihrer antideutschen Gesinnung kein Hehl machen. Nur in einem Lazarett fand ich zwei Schwestern vom Orden der
filles de la sagesse (gegründet 1719 von Ludwig Maria de Grignon in Poitiers) – gewandte, unterrichtete Persönlichkeiten, deren eine auf meine Frage
la sagesse divine ou humaine? sehr bestimmt antwortete:
naturellement et toujours divine. – Die bayrischen katholischen Schwestern sahen in dem Manne, der ihre Oberpfälzische Heimat kannte, freundlich den Landsmann, über den sie den „akatholischen Religionsdiener“ übersahen. Der Bildungsgrad war offenbar bescheiden, die Arbeitsleistung aber der Ehre wert. – Bedauern
| mußte ich und ließ es auch nicht unausgesprochen, daß in den meisten Lazaretten so viele Diakonissen unter ein ander gemengt waren. Das
scheint nur gut zu sein. Wer aber weiß, wie enge die einzelne Diakonisse dem Hausbrauche verbunden ist, nach dem ihr die Diakonie erstmals entgegentrat und immer wieder sich erbietet, und wer bedenkt, wie das weibliche Gemüt in der Pflege des Nebensächlichen und scheinbar Untergeordneten seine ganze Treue betätigt, weil es in und mit der Form die Sache bewahrt, wird meine Ausstellungen berechtigt finden müssen. Selbst in dem Lazarette, in dem ich mit wahrer Erquickung die höhere Einheit, die über Hausbrauch und Hausgrenze hinüber und hinan reicht, wahrnahm, spürte ich den tiefen seinen Antagonismus, der die eine Diakonisse die Treue gegen das Eigne hauptsächlich in Bekämpfung des Sondergutes der andern üben ließ. Das ist ja an sich weder zu verurteilen noch zu beklagen, aber es schafft Reibungsflächen und beansprucht Kräfte, die besser und zu Besserem verwendet werden könnten. Davon abgesehen kann ich nur mit Dank der treuen, verständnisvollen und nüchternen Arbeit gedenken, die an Kranken und Gesunden geleistet wurde, der feinen zarten Hilfe mich erinnern, die der verordneten Seelsorge ergänzend, oft auch vertiefend zur Seite trat. Die intuitive, weniger nach klar erkannten und zur inneren Selbstverantwortung gebrachten Kennzeichen geübte Beobachtung, die dem Manne abgeht, läßt die Frau ahnen, was jener kaum merkt und bewahren, was er bald vergißt. Das Warum des Urteils zu finden, oder auch nur finden zu wollen, liegt ihr ferne. Aber das Was steht ihr fest. Der wortlose Wandel dieses aus den Freiheitskriegen geborenen, in Zeiten der Dürre erstarkten und jetzt zu großer Blüte gelangten Diakonissendienstes hat in diesem Kriege wohl die schwerste Probe bestanden. Es wird in der Geschichte des deutschen Volkes der Wetteifer des Ernstes und der Liebe, die nicht das Ihre
| sucht, der Wille wortloser Arbeit, geduldiger Mühe, die Selbstverständlichkeit der Pflichtleistung, die auch den Tod nicht scheut, ein besonderes Blatt beschreiben. „Sie haben getan, was sie konnten.“
.
Möge allen Pflegekräften, die in Ernst und Zucht, in Hingabe und Opfer nicht das Ihre suchen, der reiche Lohn in der Erkenntnis beschieden sein, die König Ludwig
I. in das Wort auf dem Obelisken zu München (zu Ehren der in Rußland 1812 gebliebenen Bayern) gefaßt hat: „Auch sie lebten und starben für des Vaterlandes Befreiung.“ In dem Heldentum der Stille, in den Tröstungen des linden Wortes und der stillen, frommen, reinen Güte und Leutseligkeit haben manche Kriegsleute eine neue Kraft gefunden, die sie zum weiteren Kampf stärkte. Es war und ist sehr dankenswert, wenn Exzellenz
D. Dryander die Pflegeschwestern um sich sammelte und in ihrem ernsten Berufe sie stärkte und erquickte. Ich habe nur zu den Diakonissen der heimatlichen Kirche, also zu denen von Neuendettelsau, wo ich achtzehn Jahre (1891–1909) arbeiten durfte, und den Schwestern von Augsburg, auch Speyer gesprochen; norddeutsche Schwestern, Johanniterinnen wohnten den einfachen Andachten bei über Matth. 20, 4. „Ich weiß, daß ich von dir berufen bin und Tag und Nacht sinne ich nach unter Wachen und Beten, wie ich auch zu den Auserwählten gehören möge.“ Die andere Andacht, auch in dem Lazarett zu Jarny, handelte von dem „dienen, nicht sich dienen lassen“, Matth. 20, 28. Jenes stolze Wort des blinden Königs „Ich diene“ ward auch den Dienerinnen zugerufen. Dankbar begrüßt muß jede Bemühung der Geistlichen werden, die den Schwestern eigene „Kapitel“ halten, sei es, daß sie fortlaufende Lektüre biblischer Bücher pflegen, sei es, daß sie die Bücher erfahrener Seelsorger (Disselhoff, Meyer, Hoffmann) mit ihnen lesen oder, was ich für besonders gut halte, Kirchen- und Weltgeschichte mit
| ihnen treiben. Wie eindrucksvoll ist der Unterricht in der Geschichte, wenn Ort und Zeit ihn so wirksam unterstützen, wie es in diesem Kriege sonderlich geschieht! Es mag auch hier die Gelegenheit sein, wo von Tagebuchblättern im Kriege zu sprechen ist. Daß die Geistlichen in oft trefflichen und beweglichen Berichten der heimatlichen Kirchenbehörde Einblick in ihre Aufzeichnungen gönnen, soll gerühmt werden, denn es sind mehr als flüchtige Leistungen. Wenn die Diakonissen ihre Tagebücher schlicht und ohne viel Reflexion führen, und vor allem auch ihre Kranken in den Lazaretten dazu anhalten, anspruchslose Erinnerungen niederzuschreiben, kann das für spätere Zeiten von hohem Werte sein. Es wird ja eine Flut von Erinnerungen hervorbrechen, die manches Unbewährte und subjektiv Gefärbte hervorbringen wird, aber das wirklich Gute wird bald den Sieg gewinnen. Möge man nur allenthalben von den Grundsätzen des Generalisierens sich enthalten! – Aus solchen Erinnerungen wird dann auch der eigentliche „Volksgeist“ wie im Querschnitte der Beobachtungen sich ergeben. Das Tiefste, Originellste, die Eigenart des in seinen Wurzeln noch kerngesunden deutschen Charakters wird aus solchen von offiziellen Rücksichten und Erwägungen freigehaltenen Tagebüchern heraus sich stellen. Wie wir jetzt schon aus Soldatenbriefen Einblick in die Volkspsyche zu tun Gelegenheit haben, die sich am liebsten von Leuten aus dem Volke beeinflussen und leiten läßt. So war es nicht wenig bedeutsam, daß ein einfacher Soldat von seinem Kameraden rühmt, welche Kraft der Heiligung von ihm ausgehe, „und doch sei er in der Schlacht immer vornedran“. Das Volk zu verstehen, ist meist nur der ganz fähig, der hundert Jahre mit ihm gelebt hat, sein Fühlen und Empfinden teilt und kennt. Volkslyrik wie die des 30 jährigen, des 7 jährigen Krieges, die aus den Freiheitskriegen geboren, die dem 70 er Krieg entstammt, scheint in diesem furchtbarsten
| Kriege nicht aufzukommen. „Unsere Harfen hingen wir an die Weiden.“ „Man tut zu viel, um sinnen und singen zu können.“
.
Mit kurzem Blicke auf die Lazarette und Gottesäcker seien diese anspruchslosen Reiseerinnerungen geschlossen. In mächtigen Sälen, wie dort in Valenciennes, in den Schulsälen, deren einer ein großes Gemälde zu Ehren des dort geborenen Hof- und Theatermalers Watteau, ganz nach seinem dekorative Wirkungen liebenden Geschmack trägt, in Lehrzimmern, welche die Kunst der Kranken mit feinen Kreidezeichnungen – Christus nach Carlo Dolce oder Van Dyk – geschmückt, mit Bibelsprüchen geziert hat, in anderen Gelassen, wie in dem Lycée des Fenelon in Cambrai, wo griechische, lateinische und französische Sprüche, eine Sammlung „geflügelter Worte“ die Wände bedecken, in den unschönen und düsteren Krankenzimmern der alten französischen Spitäler, wiederum in Wellblechbaracken, in Holzbauten und Fabrikräumen, in ganz aus Eisenkonstruktion bestehenden Gebäuden liegen die vielen Tausende von Kranken, die ich besuchen konnte, alle ohne eine andere Scheidung als sie Krankheitsgrad und -art bedingte. Der Prinzenerzieher lag neben dem schlichten Flößer, mit dem einen konnte man über den Philosophen Seneka, mit dem andern mußte man über die Holzpreise reden. Der Philosoph, der eben über Nietzsche, den er mehr als Dichter denn als Denker anerkannte, arbeitet, lag neben dem Bauernknecht, der Rechtspraktikant, der Rechtsanwalt standen neben einfachen Fabrikarbeitern. Aber die heldenmäßige Geduld, die wortlose Hingabe des Willens an das Leiden einigte alle. Man tröstet sich mit der Gemeinsamkeit des Leids und freute sich der kleinen Fortschritte in der Genesung, half einander und teilte einander mit, was Lesbares und Eßbares gegeben ward. Das Lesbare war und ist ja nicht immer probehaltig: man kann nur wünschen, daß
| Erbauliches in gesunder, kraftvoller Weise nicht in süßlichem Traktatenstil, nicht in der Art der rasche Bekehrungen unwahr dichtenden Geschichtchen, hinauskomme und viel Beschauliches, Bilder aus der Geschichte, kurze Ansprachen, gute Sonntagsblätter, die vieles bringen. Am meisten vermißte ich – was sollen unsere Klassiker in den Händen der Knechte und Tagelöhner, Tasso und Iphigenie von einem Altmühlbauern gelesen! – Geschichtsbilder, etwa wie sie einst bei Klein in Barmen erschienen, populäre gute Reisebeschreibungen. Am meisten aber beanstandete ich die sinn- und kraftlosen Liebesgeschichten, die, ohne gewöhnlich und lüstern zu sein, verweichlichen und in Verhältnisse versetzen, mit denen die gegenwärtigen und künftigen in Widerspruch stehen. Wie viel trotz aller hochachtungswerten Bemühungen um gute Bücher für das Feld noch geschehen kann, leuchtet ein.
Schwer ist in den Sälen der Leichtverwundeten die Seelsorge. Die wiederkehrende Lust zum Leben, die kraftvoller werdenden Tage verdrängen leicht die ernsteren Gedanken nicht bloß an Leiden und Tod, sondern auch an Dank gegen Gott und Menschen, an den Ernst der neuen Pflicht. Und doch will dieses natürliche Kraftgefühl in seiner Berechtigtheit erkannt und gewürdigt werden. Hier bedarf es menschlicher Klugheit und göttlicher Weisheit des Seelsorgers, daß er nicht zu viel sage noch zu wenig handle, nicht zu viel voraussetze und wiederum zu wenig fordere. Ich habe selten ein geradehin religiöses Wort gesprochen, sondern am Ausgang des Saales kurz die Eindrücke zusammengefaßt und mit einem Appell an Willen und Ehre geschlossen. Mit diesen Kranken zu beten schien mir nicht statthaft: dazu kannte ich sie zu wenig. Und es ist besser, wenn beim Schweigen das Gebet vermißt wird als wenn im Überdrusse es überhört wird.
Anders war es in den Räumen, in denen Schwerverwundete
| oder Kriegsblinde lagen. Hier konnte die kurze, am besten um einen Liedervers sich rankende Andacht, das Gebet mit den Kranken und für sie wirken. Ich werde den Saal mit den Herz- und Nierenkranken, das Lazarett mit den Typhuskranken und die Zimmer der Erblindeten nicht vergessen. Rein menschliches Mitgefühl trifft immer das Herz und findet das Wort dessen, der aller Dinge seinen Brüdern gleich werden mußte, um barmherzig zu werden.
.
In den Einzelzimmern, wo etwa Sterbende lagen, konnte wohl auch ein besonders inniges Wort und aus den Passions- und Sterbeliedern der Kirche das Beste dargereicht werden, etwa so, daß der Kranke und ich wechselweise beteten. Der Segen des treuen Religionsunterrichtes ging dann auf, der vielgescholtene Gedächtnisstoff, für den doch auch ein Paulsen verteidigende und gutheißende Worte fand, trägt Frucht. Noch ist unser Volk mit tausend ihm selbst unerkannten und unerkennbaren Fäden an die Kirche gebunden, noch weiß es sich von der großen Kraft getragen, die in Gottes Wort und Gebet liegt. Gerade die Lazarettseelsorge, die mit Menschen handelt, welche besonders genommen sind, muß ihr Hauptaugenmerk auf die Pflege des Zusammenhangs mit den Medien richten, durch welche die innersten Geheimnisse dargeboten werden. Die Seelsorge bei den Kranken ist die beste Vorarbeit für die gesunden Tage und ihre Arbeit zu Nutz und Dienst von Vaterland und Kirche. Es wird gesagt werden dürfen, daß die Seelsorge in und an den Lazaretten, unterstützt durch die verständnisvolle Mitarbeit der meisten Pflegekräfte – auch die männlichen in den Feldlazaretten sollen nicht ausgenommen sein – bei den Ärzten Würdigung findet, die zugeben, daß der Mensch nicht durch die Kunst allein geheilt wird. Und es wird andererseits gesagt werden müssen, daß diese Kunst und Sorgsamkeit, wie sie den chirurgisch Kranken, den an Nervenchoks Leidenden in wirksamerer
| und sichtbarer Weise noch zukommt als den internen, Großes erreicht. Die Geduld und Nachsicht, die unermüdbare und erfindsame Liebe, die den einzelnen nachgeht – ich denke an die Sprachübungen im Lazarette zu Douai, an große Operationen in Lille und Montigny – werden ihres Eindrucks nie verfehlen. Wenn etwa von sechzehnhundert Kranken nur siebenzehn sterben, so ist das ein glänzendes Ergebnis gesegneter Kunst und Tätigkeit.
.
Ein eignes, dunkles Kapitel bedeuten die Geschlechtskranken, denen auch die Fremde nicht noch oft die Rücksicht auf Weib und Kind daheim, geschweige denn Ehre und Liebe zum Vaterland Heiligung des Willens auflegen konnte, und die Opfer ihrer Zügellosigkeit, oft auch der Trunkenheit geworden sind. Ich habe grundsätzlich sie nicht besucht, nur einmal in einem Lazarette nahe bei Haubourdin einen getroffen, der mich zuerst falsch berichtet und dann sich selbst der Unwahrheit angeklagt hatte. Was sollte ich diesen Kranken bringen? Den Gruß der Heimat, den Willkomm der heimatlichen Kirche, den Dank der Ihren? All das konnte und durfte ich nicht und ihnen zu sagen, was ich denke, war ich in der vorübergehenden Mission nicht berufen. So lange ich geordnete Seelsorge hatte, versäumte ich es nie, den Ernst dieser entnervenden und entwürdigenden Sünde darzustellen und habe nur einmal die freche Gegenrede erfahren, ob ich einen
Augenleidenden auch so anreden würde, ein Leiden sei wie das andere, der eine leide eben an diesem, der andere an einem anderen Körperteile. Es bedarf eines gefestigten und gereinigten Willens, diesen Kranken entgegen zu treten, sie zu strafen und doch nicht zu verachten, sie auszurichten und doch nicht zu schnell aus der Zucht zu lassen. Daß die Seelsorge an Männern immerhin leichter ist als an Frauen mit solchen entwürdigenden Leiden, soll angemerkt werden. Man wird, ohne daß man mit allen Aufstellungen und Maßnahmen der Sittlichkeitsvereine,
| mit all den humanitären und charitativen Bestrebungen nach dieser Hinsicht sich einverstanden erklären muß, alle Veranstaltungen begrüßen dürfen, die vom Besuche der
estaminets und
buvettes und
cabarets fernehalten, die schon durch ihre Namen abschrecken könnten. Die alkoholfreien Soldatenheime, ob auch mit dem schwer vermeidbaren Kartenspiele, die Vortragsabende, die guten und trefflichen Lesehallen sollen alle Unterstützung empfangen. Daß das gute Beispiel zuchtvollen Willens, das von oben her gegeben wird, der sittliche Ernst des Führers, für den auch ein Verkommener Achtung und Ehrerbietung hat, am meisten wirkt und in dem großen und gewaltigen Ringen der Völker der Einzelne nicht gezählt, sondern gewogen wird,
vir non homo, ist nicht zu vergessen. Auch die kurze Ansprache kann hier manches wirken, die sich nicht scheut, Sünde und Schande in allen Kreisen zu strafen und mit dem rechten Namen zu brandmarken, ohne doch in ekle Schilderungen sich zu verlieren.
.
Wenn aber die Lazarette und Krankenstuben ihren ganzen Ernst zeigen müssen, dann hebt auch im Feindeslande die Totenglocke ihre ernsten, oft so schrillen Töne an, die Särge in den Vorhallen dort zu Carvin werden mir vor Augen bleiben. Dem Ärmsten, der eben aus der pfälzischen Heimat in den Schützengraben gekommen ist, um gleich von der letzten Kugel erreicht zu werden wie dem reichen Erben neben ihm bereiten französische Arbeiter die letzte Ruhestätte, wohl immer mit der Redensart
„oh ce pauvre garcon“. Und wenn das Grab sich geschlossen hat, geht es an die Herstellung eines neuen. In der Ecke steht das Denkmal der Opfer von Courieres, unter dessen Schatten wohl zwölfhundert deutsche Gräber sich hindehnen, schlicht gehalten, sorglich behütet, mitten unter ihnen das Grab eines Engländers oder eines Franzosen, zum Schutze. So manchen Gottesäckern sind bereits Ehrendenkmale gesetzt,
| so in Douai von der Hand eines jungen Münchner Künstlers, Theodor Dombart, in Montigny von Meister Friedrich von Thiersch, ein gar sinniges und würdiges auf dem so kalten und in seinen Steinsarkophagen starren zu Tourkang. Anderwärts ziehen sich drei große Felder hin; unter jedem liegen dreihundert Deutsche. Bibelspruch und Liedervers verklären die Stätte des Todes zu einem Felde des grünen Landes. Während die französischen Kirchhöfe toten kalten Prunk in den Eisengerüsten und wüsten Eisenkasten mit den geschmacklosen Kränzen aufweisen, Erzgräber ohne Sinn und Würde und kaum ein Wort des Trostes, sind die an sie grenzenden deutschen Anlagen voll freudigen Lebens, bepflanzt und bestanden. Pietät und Dank brauchen und haben nicht viel Worte. Aber das wenige ist echt. Wie heben sich die großen Soldatenfriedhöfe in Straßburg und Metz von denen in Kolmar und Valenciennes ab, wie sind die Gräber an den Straßen, am Waldesrand, auf den Hügeln der Vogesen, in ihrer lauten eindringlichen Predigt so vernehmlich und reden von Treue bis in den Tod! Riehl wollte von den Türmen herab das Leben, in den Gottesäckern das Gemüt eines Volkes erkennen. Wahrlich, das deutsche Gemüt hat seine Geschichte durch die Jahrhunderte: Die Treue der Treue Dank! –
So habe ich die Wochen in der Fremde mit reichem Gewinn für mein Amt und hoffentlich auch für mein Leben hinterlegt. Der hochgemute Gedanke, ein Deutscher zu sein, dringt immer wieder hervor, wenn manche Zeichen und Zeiten das Herz schwer machen wollen: Nubecolae transibunt, sol dominatur. Die Fülle unverbrauchter Kräfte muß nur entbunden und verwertet, der deutsche Wille nur recht geleitet werden.
Ein Volk, dem Gott die Niederlagen der Jahrhunderte immer wieder zu Anlässen der heiligsten Siege hat werden
| lassen, eingeengt und doch frei, kärglich bedacht und reich machend, wenig geliebt und doch aller Töne und Klänge kundig, die das Menschenherz bewegen, ein Volk, das denkt und dichtet, so daß fremde Völker Jahrhunderte brauchen, um den Bau der Könige kennen zu lernen und seine Schmuckstücke nicht nur, sondern die tragenden Säulen nachzuahmen, hat noch eine bedeutsame Zukunft.
Ihm ward das Christentum in die Wiege gelegt, als das Volk ward, seiner selbst gedenk und mächtig, mit ihm hat es gerungen, an ihm gelernt. Wo Christentum und deutsche Art einander immer verstanden, haben beide in den Tagen der Reformation den Bund auf Selbsterkenntnis, auf Heiligung und Vertiefung geschlossen, so daß eines am andern genas.
Es sind Zeiten gekommen, in denen das Schlichte nimmer als echt und das Gekünstelte als Kraft galt, im Volksleben wie in der Tiefe seiner Seele. Der Fortlauf dieser Zeiten hätte gegen Entwertung des Echten und Rechten mit trüben Gründen und mit Untreue gegen das Erbe des Ewigen gezeugt, Bestes gewollt, Gutes verhindert, Ungutes gefördert.
Da hat der Krieg den Ruf nach dem alten Gott, dessen Wort blanke Wehr und gute Waffe, dessen menschgestaltige Offenbarung in Jesu Christo weltverneuende Tat ist, laut und feierlich, klar und fest erhoben. Und die ihn vernahmen, haben ihn weiter gegeben. Komm, ja komm, Herr Jesu, ein Volksbefreier, ein Verneurer der Welt, der Du zerbrichst, daß keine Säule trägt, der Du aufrichtest, daß niemand es wehren kann.
Näher dem Ziele des Werdens auf Grund seines Bildes von Sein und Seinsollen führt Gott durch den Weltkrieg alle, die durch Kampf und Not um ihn sich scharen, weil in der Neugestaltung aus ewig wirksamem Alten die Vollendung anhebt und ausreift.
|
Druck von W. Hoppe, Borsdorf-Leipzig.