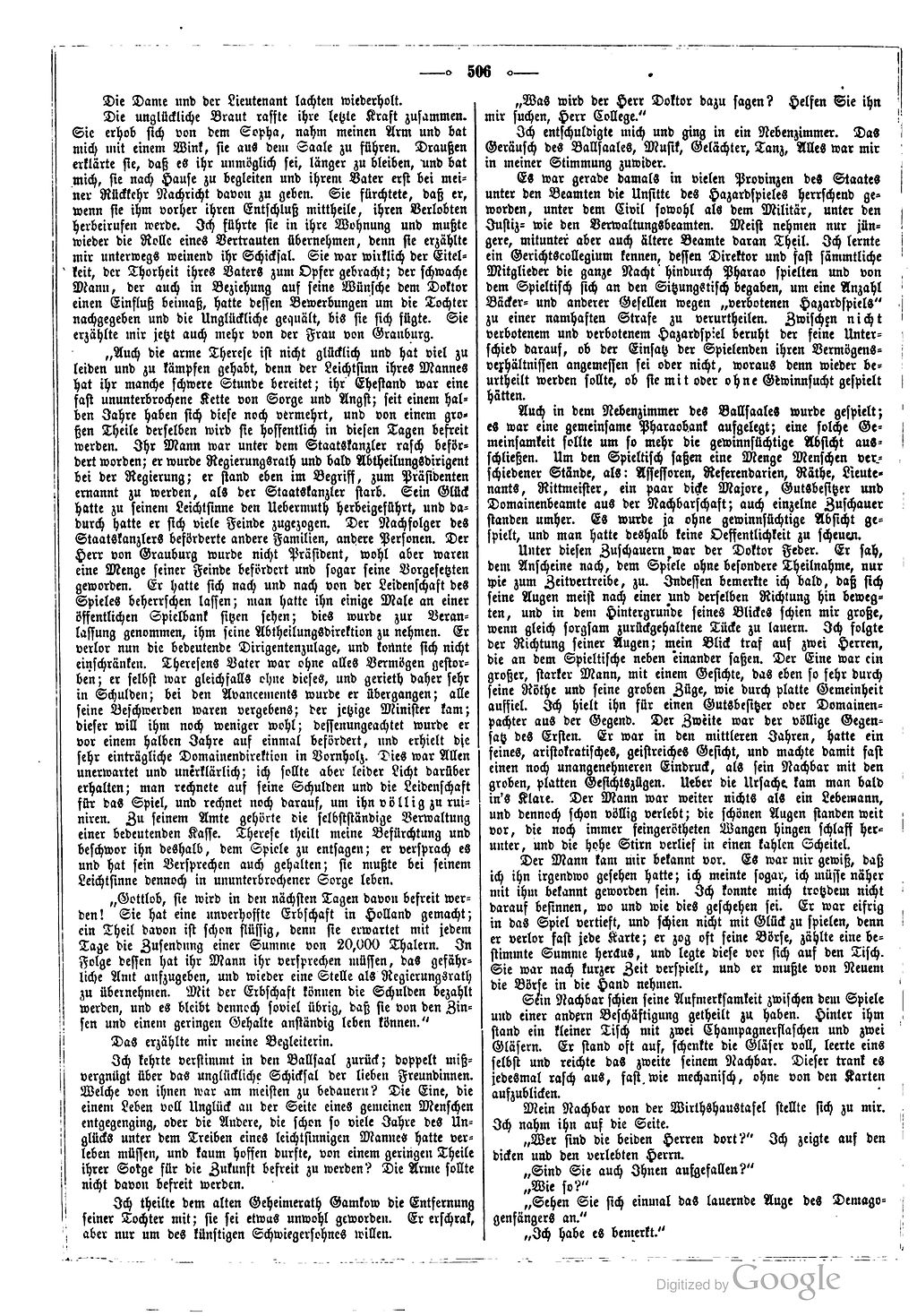| verschiedene: Die Gartenlaube (1856) | |
|
|
Die Dame und der Lieutenant lachten wiederholt.
Die unglückliche Braut raffte ihre letzte Kraft zusammen. Sie erhob sich von dem Sopha, nahm meinen Arm und bat mich mit einem Wink, sie aus dem Saale zu führen. Draußen erklärte sie, daß es ihr unmöglich sei, länger zu bleiben, und bat mich, sie nach Hause zu begleiten und ihrem Vater erst bei meiner Rückkehr Nachricht davon zu geben. Sie fürchtete, daß er, wenn sie ihm vorher ihren Entschluß mittheile, ihren Verlobten herbeirufen werde. Ich führte sie in ihre Wohnung und mußte wieder die Rolle eines Vertrauten übernehmen, denn sie erzählte mir unterwegs weinend ihr Schicksal. Sie war wirklich der Eitelkeit, der Thorheit ihres Vaters zum Opfer gebracht; der schwache Mann, der auch in Beziehung auf seine Wünsche dem Doktor einen Einfluß beimaß, hatte dessen Bewerbungen um die Tochter nachgegeben und die Unglückliche gequält, bis sie sich fügte. Sie erzählte mir jetzt auch mehr von der Frau von Granburg.
„Auch die arme Therese ist nicht glücklich und hat viel zu leiden und zu kämpfen gehabt, denn der Leichtsinn ihres Mannes hat ihr manche schwere Stunde bereitet; ihr Ehestand war eine fast ununterbrochene Kette von Sorge und Angst; seit einem halben Jahre haben sich diese noch vermehrt, und von einem großen Theile derselben wird sie hoffentlich in diesen Tagen befreit werden. Ihr Mann war unter dem Staatskanzler rasch befördert worden; er wurde Regierungsrath und bald Abtheilungsdirigent bei der Regierung; er stand eben im Begriff, zum Präsidenten ernannt zu werden, als der Staatskanzler starb. Sein Glück hatte zu seinem Leichtsinne den Uebermuth herbeigeführt, und dadurch hatte er sich viele Feinde zugezogen. Der Nachfolger des Staatskanzlers beförderte andere Familien, andere Personen. Der Herr von Grauburg wurde nicht Präsident, wohl aber waren eine Menge seiner Feinde befördert und sogar seine Vorgesetzten geworden. Er hatte sich nach und nach von der Leidenschaft des Spieles beherrschen lassen; man hatte ihn einige Male an einer öffentlichen Spielbank sitzen sehen; dies wurde zur Veranlassung genommen, ihm seine Abtheilungsdirektion zu nehmen. Er verlor nun die bedeutende Dirigentenzulage, und konnte sich nicht einschränken. Theresens Vater war ohne alles Vermögen gestorben; er selbst war gleichfalls ohne dieses, und gerieth daher sehr in Schulden; bei den Avancements wurde er übergangen; alle seine Beschwerden waren vergebens; der jetzige Minister kam; dieser will ihm noch weniger wohl; dessenungeachtet wurde er vor einem halben Jahre auf einmal befördert, und erhielt die sehr einträgliche Domainendirektion in Vornholz. Dies war Allen unerwartet und unerklärlich; ich sollte aber leider Licht darüber erhalten; man rechnete auf seine Schulden und die Leidenschaft für das Spiel, und rechnet noch darauf, um ihn völlig zu ruiniren. Zu seinem Amte gehörte die selbstständige Verwaltung einer bedeutenden Kasse. Therese theilt meine Befürchtung und beschwor ihn deshalb, dem Spiele zu entsagen; er versprach es und hat sein Versprechen auch gehalten; sie mußte bei seinem Leichtsinne dennoch in ununterbrochener Sorge leben.
„Gottlob, sie wird in den nächsten Tagen davon befreit werden! Sie hat eine unverhoffte Erbschaft in Holland gemacht; ein Theil davon ist schon flüssig, denn sie erwartet mit jedem Tage die Zusendung einer Summe von 20,000 Thalern. In Folge dessen hat ihr Mann ihr versprechen müssen, das gefährliche Amt aufzugeben, und wieder eine Stelle als Regierungsrath zu übernehmen. Mit der Erbschaft können die Schulden bezahlt werden, und es bleibt dennoch soviel übrig, daß sie von den Zinsen und einem geringen Gehalte anständig leben können.“
Das erzählte mir meine Begleiterin.
Ich kehrte verstimmt in den Ballsaal zurück; doppelt mißvergnügt über das unglückliche Schicksal der lieben Freundinnen. Welche von ihnen war am meisten zu bedauern? Die Eine, die einem Leben voll Unglück an der Seite eines gemeinen Menschen entgegenging, oder die Andere, die schon so viele Jahre des Unglücks unter dem Treiben eines leichtsinnigen Mannes hatte verleben müssen, und kaum hoffen durfte, von einem geringen Theile ihrer Sorge für die Zukunft befreit zu werden? Die Arme sollte nicht davon befreit werden.
Ich theilte dem alten Geheimerath Gamkow die Entfernung seiner Tochter mit; sie sei etwas unwohl geworden. Er erschrak, aber nur um des künftigen Schwiegersohnes willen.
„Was wird der Herr Doktor dazu sagen? Helfen Sie ihn mir suchen, Herr College.“
Ich entschuldigte mich und ging in ein Nebenzimmer. Das Geräusch des Ballsaales, Musik, Gelächter, Tanz, Alles war mir in meiner Stimmung zuwider.
Es war gerade damals in vielen Provinzen des Staates unter den Beamten die Unsitte des Hazardspieles herrschend geworden, unter dem Civil sowohl als dem Militär, unter den Justiz- wie den Verwaltungsbeamten. Meist nehmen nur jüngere, mitunter aber auch ältere Beamte daran Theil. Ich lernte ein Gerichtscollegium kennen, dessen Direktor und fast sämmtliche Mitglieder die ganze Nacht hindurch Pharao spielten und von dem Spieltisch sich an den Sitzungstisch begaben, um eine Anzahl Bäcker- und anderer Gesellen wegen „verbotenen Hazardspiels“ zu einer namhaften Strafe zu verurtheilen. Zwischen nicht verbotenem und verbotenem Hazardspiel beruht der feine Unterschied darauf, ob der Einsatz der Spielenden ihren Vermögensverhältnissen angemessen sei oder nicht, woraus denn wieder beurtheilt werden sollte, ob sie mit oder ohne Gewinnsucht gespielt hätten.
Auch in dem Nebenzimmer des Ballsaales wurde gespielt; es war eine gemeinsame Pharaobank aufgelegt; eine solche Gemeinsamkeit sollte um so mehr die gewinnsüchtige Absicht ausschließen. Um den Spieltisch saßen eine Menge Menschen verschiedener Stände, als: Assessoren, Referendarien, Räthe, Lieutenants, Rittmeister, ein paar dicke Majore, Gutsbesitzer und Domainenbeamte aus der Nachbarschaft; auch einzelne Zuschauer standen umher. Es wurde ja ohne gewinnsüchtige Absicht gespielt, und man hatte deshalb keine Oeffentlichkeit zu scheuen.
Unter diesen Zuschauern war der Doktor Feder. Er sah, dem Anscheine nach, dem Spiele ohne besondere Theilnahme, nur wie zum Zeitvertreibe, zu. Indessen bemerkte ich bald, daß sich seine Augen meist nach einer und derselben Richtung hin bewegten, und in dem Hintergrunde seines Blickes schien mir große, wenn gleich sorgsam zurückgehaltene Tücke zu lauern. Ich folgte der Richtung seiner Augen; mein Blick traf auf zwei Herren, die an dem Spieltische neben einander saßen. Der Eine war ein großer, starker Mann, mit einem Gesichte, das eben so sehr durch seine Nöthe und seine groben Züge, wie durch platte Gemeinheit auffiel. Ich hielt ihn für einen Gutsbesitzer oder Domainenpächter aus der Gegend. Der Zweite war der völlige Gegensatz des Ersten. Er war in den mittleren Jahren, hatte ein feines, aristokratisches, geistreiches Gesicht, und machte damit fast einen noch unangenehmeren Eindruck, als sein Nachbar mit den groben, platten Gesichtszügen. Ueber die Ursache, kam man bald in’s Klare. Der Mann war weiter nichts als ein Lebemann, und dennoch schon völlig verlebt; die schönen Augen standen weit vor, die noch immer feingerötheten Wangen hingen schlaff herunter, und die hohe Stirn verlief in einen kahlen Scheitel.
Der Mann kam mir bekannt vor. Es war mir gewiß, daß ich ihn irgendwo gesehen hatte; ich meinte sogar, ich müsse näher mit ihm bekannt geworden sein. Ich konnte mich trotzdem nicht darauf besinnen, wo und wie dies geschehen sei. Er war eifrig in das Spiel vertieft, und schien nicht mit Glück zu spielen, denn er verlor fast jede Karte; er zog oft seine Börse, zählte eine bestimmte Summe heraus, und legte diese vor sich auf den Tisch. Sie war nach kurzer Zeit verspielt, und er mußte von Neuem die Börse in die Hand nehmen.
Sein Nachbar schien seine Aufmerksamkeit zwischen dem Spiele und einer andern Beschäftigung getheilt zu haben. Hinter ihm stand ein kleiner Tisch mit zwei Champagnerflaschen und zwei Gläsern. Er stand oft auf, schenkte die Gläser voll, leerte eins selbst und reichte das zweite seinem Nachbar. Dieser trank es jedesmal rasch aus, fast wie mechanisch, ohne von den Karten aufzublicken.
Mein Nachbar von der Wirthshaustafel stellte sich zu mir. Ich nahm ihn auf die Seite.
„Wer sind die beiden Herren dort?“ Ich zeigte auf den dicken und den verlebten Herrn.
„Sind Sie auch Ihnen aufgefallen?“
„Wie so?“
„Sehen Sie sich einmal das lauernde Auge des Demagogenfängers an.“
„Ich habe es bemerkt.“
verschiedene: Die Gartenlaube (1856). Ernst Keil, Leipzig 1856, Seite 506. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1856)_506.jpg&oldid=- (Version vom 14.9.2022)