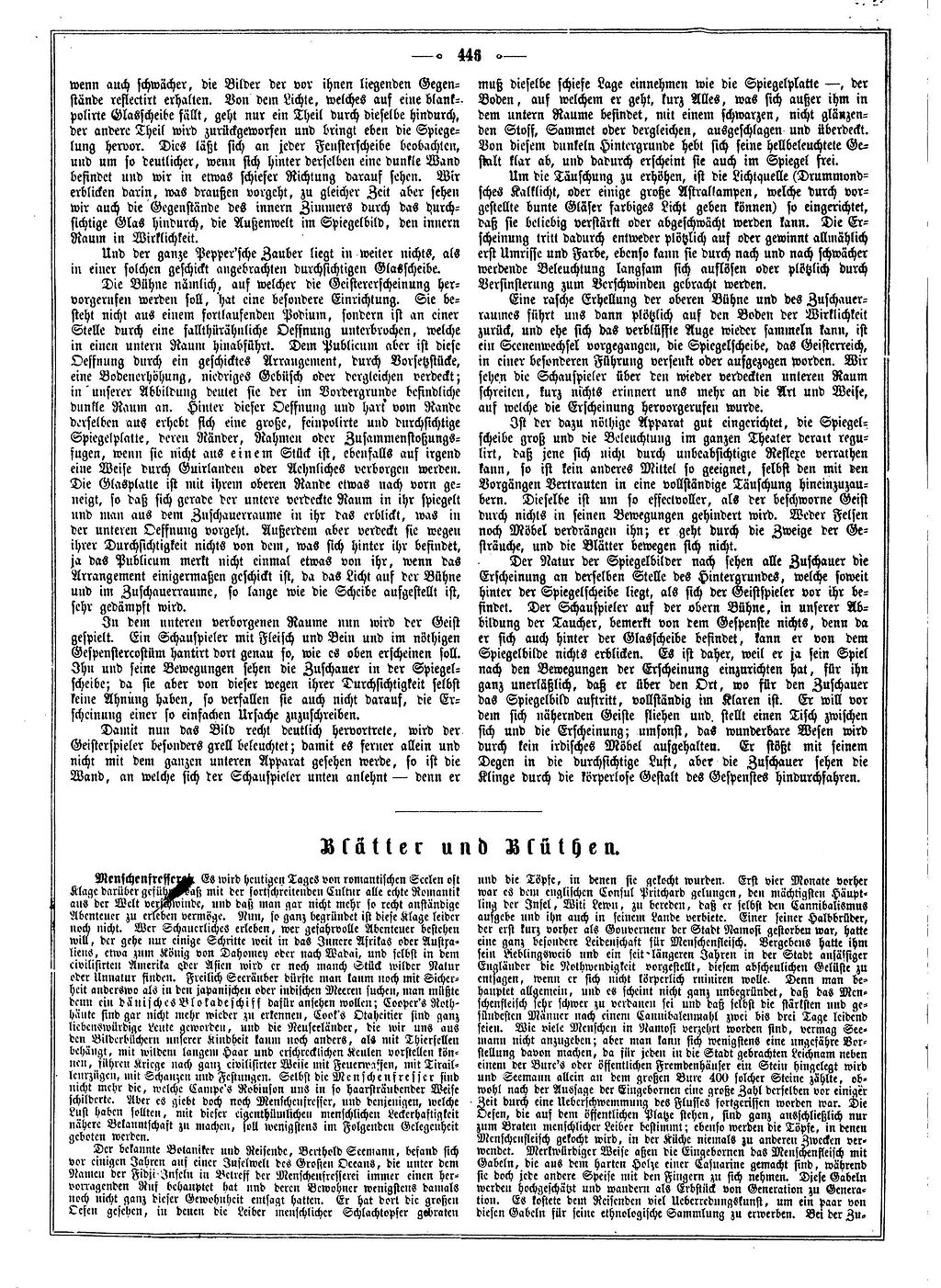| verschiedene: Die Gartenlaube (1864) | |
|
|
wenn auch schwächer, die Bilder der vor ihnen liegenden Gegenstände reflectirt erhalten. Von dem Lichte, welches auf eine blank-polirte Glasscheibe fällt, geht nur ein Theil durch dieselbe hindurch, der andere Theil wird zurückgeworfen und bringt eben die Spiegelung hervor. Dies läßt sich an jeder Fensterscheibe beobachten, und um so deutlicher, wenn sich hinter derselben eine dunkle Wand befindet und wir in etwas schiefer Richtung darauf sehen. Wir erblicken darin, was draußen vorgeht, zu gleicher Zeit aber sehen wir auch die Gegenstände des innern Zimmers durch das Durchsichtige Glas hindurch, die Außenwelt im Spiegelbild, den innern Raum in Wirklichkeit.
Und der ganze Pepper’sche Zauber liegt in weiter nichts, als in einer solchen geschickt angebrachten durchsichtigen Glasscheibe.
Die Bühne nämlich, auf welcher die Geistererscheinung hervorgerufen werden soll, hat eine besondere Einrichtung. Sie besteht nicht aus einem fortlaufenden Podium, sondern ist an einer Stelle durch eine fallthürähnliche Oeffnung unterbrochen, welche in einen untern Raum hinabführt. Dem Publicum aber ist diese Oeffnung durch ein geschicktes Arrangement, durch Vorsetzstücke, eine Bodenerhöhung, niedriges Gebüsch oder dergleichen verdeckt; in unserer Abbildung deutet sie der im Vordergründe befindliche dunkle Raum an. Hinter dieser Oeffnung und hart vom Rande derselben aus erhebt sich eine große, feinpolirte und durchsichtige Spiegelplatte, deren Ränder, Rahmen oder Zusammenstoßungsfugen, wenn sie nicht aus einem Stück ist, ebenfalls auf irgend eine Weise durch Guirlanden oder Aehnliches verborgen werden. Die Glasplatte ist mit ihrem oberen Rande etwas nach vorn geneigt, so daß sich gerade der untere verdeckte Raum in ihr spiegelt und man aus dem Zuschauerraume in ihr das erblickt, was in der unteren Oeffnung vorgeht. Außerdem aber verdeckt sie wegen ihrer Durchsichtigkeit nichts von dem, was sich hinter ihr befindet, ja das Publicum merkt nicht einmal etwas von ihr, wenn das Arrangement einigermaßen geschickt ist, da das Licht auf der Bühne und im Zuschauerraume, so lange wie die Scheibe aufgestellt ist, sehr gedämpft wird.
In dem unteren verborgenen Rauine nun wird der Geist gespielt. Ein Schauspieler mit Fleisch und Bein und im nöthigen Gespenstercostüm hantirt dort genau so, wie es oben erscheinen soll. Ihn und seine Bewegungen sehen die Zuschauer in der Spiegelscheibe; da sie aber von dieser wegen ihrer Durchsichtigkeit selbst keine Ahnung haben, so verfallen sie auch nicht darauf, die Erscheinung einer so einfachen Ursache zuzuschreiben.
Damit nun das Bild recht deutlich hervortrete, wird der Geisterspieler besonders grell beleuchtet; damit es ferner allein und nicht mit dem ganzen unteren Apparat gesehen werde, so ist die Wand, an welche sich der Schauspieler unten anlehnt – denn er muß dieselbe schiefe Lage einnehmen wie die Spiegelplatte –, der Boden, auf welchem er geht, kurz Alles, was sich außer ihm in dem untern Raume befindet, mit einem schwarzen, nicht glänzenden Stoff, Sammet oder dergleichen, ausgeschlagen und überdeckt. Von diesem dunkeln Hintergrunde hebt sich seine hellbeleuchtete Gestalt klar ab, und dadurch erscheint sie auch im Spiegel frei.
Um die Täuschung zu erhöhen, ist die Lichtquelle (Drummondsches Kalklicht, oder einige große Astrallampen, welche durch vorgestellte bunte Gläser farbiges Licht geben können) so eingerichtet, daß sie beliebig verstärkt oder abgeschwächt werden kann. Die Erscheinung tritt dadurch entweder plötzlich auf oder gewinnt allmählich erst Umrisse und Farbe, ebenso kann sie durch nach und nach schwächer werdende Beleuchtung langsam sich auflösen oder plötzlich durch Verfinsterung zum Verschwinden gebracht werden.
Eine rasche Erhellung der oberen Bühne und des Zuschauerraumes führt uns dann plötzlich auf den Boden der Wirklichkeit zurück, und ehe sich das verblüffte Auge wieder sammeln kann, ist ein Scenenwechsel vorgegangen, die Spiegelscheibe, das Geisterreich, in einer besonderen Führung versenkt oder aufgezogen worden. Wir sehen die Schauspieler über den wieder verdeckten unteren Raum schreiten, kurz nichts erinnert uns mehr an die Art und Weise, auf welche die Erscheinung hervorgerufen wurde.
Ist der dazu nöthige Apparat gut eingerichtet, die Spiegelscheibe groß und die Beleuchtung im ganzen Theater derart regulirt, daß jene sich nicht durch unbeabsichtigte Reflexe verrathen kann, so ist kein anderes Mittel so geeignet, selbst den mit den Vorgängen Vertrauten in eine vollständige Täuschung hineinzuzaubern. Dieselbe ist um so effectvoller, als der beschworne Geist durch nichts in seinen Bewegungen gehindert wird. Weder Felsen noch Möbel verdrängen ihn; er geht durch die Zweige der Gesträuche, und die Blätter bewegen sich nicht.
Der Natur der Spiegelbilder nach sehen alle Zuschauer die Erscheinung an derselben Stelle des Hintergrundes, welche soweit hinter der Spiegelscheibe liegt, als sich der Geistspieler vor ihr befindet. Der Schauspieler auf der obern Bühne, in unserer Abbildung der Taucher, bemerkt von dem Gespenste nichts, denn da er sich auch hinter der Glasscheibe befindet, kann er von dem Spiegelbilde nichts erblicken. Es ist daher, weil er ja sein Spiel nach den Bewegungen der Erscheinung einzurichten hat, für ihn ganz unerläßlich, daß er über den Ort, wo für den Zuschauer das Spiegelbild auftritt, vollständig im Klaren ist. Er will vor dem sich nähernden Geiste fliehen und, stellt einen Tisch zwischen sich und die Erscheinung; umsonst, das wunderbare Wesen wird durch kein irdisches Möbel aufgehalten. Er stößt mit seinem Degen in die durchsichtige Luft, aber die Zuschauer sehen die Klinge durch die körperlose Gestalt des Gespenstes hindurchfahren.
Menschenfresserei. Es wird heutigen Tages von romantischen Seelen oft Klage darüber geführt, daß mit der fortschreitenden Cultur alle echte Romantik aus der Welt verschwinde, und daß man gar nicht mehr so recht anständige Abenteuer zu erleben vermöge. Nun, so ganz begründet ist diese Klage leider noch nicht. Wer Schauerliches erleben, wer gefahrvolle Abenteuer bestehen will, der gehe nur einige Schritte weit in das Innere Afrikas oder Australiens, etwa zum König von Dahomey oder nach Wadai, und selbst in dem civilisirten Amerika oder Asien wird er noch manch Stück wilder Natur oder Unnatur finden. Freilich Seeräuber dürfte man kaum noch mit Sicherheit anderswo als in den japanischen oder indischen Meeren suchen, man müßte denn ein dänisches Blokadeschiff dafür ansehen wollen; Cooper’s Rothhäute sind gar nicht mehr wieder zu erkennen, Cook’s Otaheitier sind ganz liebenswürdige Leute geworden, und die Neuseeländer, die wir uns aus den Bilderbüchern unserer Kindheit kaum noch anders, als mit Thierfellen behängt, mit wildem langem Haar und erschrecklichen Keulen vorstellen können, führen Kriege nach ganz civilisirter Weise mit Feuerwaffen, mit Tirailleurzügen, mit Schanzen und Festungen. Selbst die Menschenfresser sind nicht mehr die, welche Campe’s Robinson uns in so haarsträubender Weise schilderte. Aber es giebt doch noch Menschenfresser, und denjenigen, welche Lust haben sollten, mit dieser eigenthümlichen menschlichen Leckerhaftigkeit nähere Bekanntschaft zu machen, soll wenigstens im Folgenden Gelegenheit geboten werden.
Der bekannte Botaniker und Reisende, Berthold Seemann, befand sich vor einigen Jahren auf einer Inselwelt des Großen Oceans, die unter dem Namen der Fidji-Inseln in Betreff der Menschenfresserei immer einen hervorragenden Ruf behauptet hat und deren Bewohner wenigstens damals noch nicht ganz dieser Gewohnheit entsagt hatten. Er hat dort die großen Oefen gesehen, in denen die Leiber menschlicher Schlachtopfer gebraten und die Töpfe, in denen sie gekocht wurden. Erst vier Monate vorher war es dem englischen Consul Pritchard gelungen, den mächtigsten Häuptling der Insel, Witi Lewu, zu bereden, daß er selbst den Kannibalismus aufgebe und ihn auch in seinem Lande verbiete. Einer seiner Halbbrüder, der erst kurz vorher als Gouverneur der Stadt Namosi gestorben war, hatte eine ganz besondere Leidenschaft für Menschenfleisch. Vergebens hatte ihm sein Lieblingsweib und ein seit längeren Jahren in der Stadt ansässiger Engländer die Nothwendigkeit vorgestellt, diesem abscheulichen Gelüste zu entsagen, wenn er sich nicht körperlich ruiniren wolle. Denn man behauptet allgemein, und es scheint nicht ganz unbegründet, daß das Menschenfleisch sehr schwer zu verdauen sei und daß selbst die stärksten und gesündesten Männer nach einem Cannibalenmahl zwei bis drei Tage leidend seien. Wie viele Menschen in Namosi verzehrt worden sind, vermag Seemann nicht anzugeben; aber man kann sich wenigstens eine ungefähre Vorstellung davon machen, da für jeden in die Stadt gebrachten Leichnam neben einem der Burc’s oder öffentlichen Fremdenhäuser ein Stein hingelegt wird und Seemann allein an dem großen Burc 400 solcher Steine zählte, obwohl nach der Aussage der Eingebornen eine große Zahl derselben vor einiger Zeit durch eine Ueberschwemmung des Flusses fortgerissen worden war. Die Oefen, die auf dem öffentlichen Platze stehen, sind ganz ausschließlich nur zum Braten menschlicher Leiber bestimmt; ebenso werden die Töpfe, in denen Menschenfleisch gekocht wird, in der Küche niemals zu anderen Zwecken verwendet. Merkwürdiger Weise aßen die Eingebornen das Menschenfleisch mit Gabeln, die aus dem harten Holze einer Kasuarine gemacht sind, während sie doch jede andere Speise mit den Fingern zu sich nehmen. Diese Gabeln werden hochgeschätzt und wandern als Erbstück von Generation zu Generation. Es kostete dem Reisenden viel Ueberredungskunst, um ein paar von diesen Gabeln für seine ethnologische Sammlung zu erwerben. Bei der Zubereitung
verschiedene: Die Gartenlaube (1864). Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig 1864, Seite 446. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1864)_446.jpg&oldid=- (Version vom 20.8.2021)