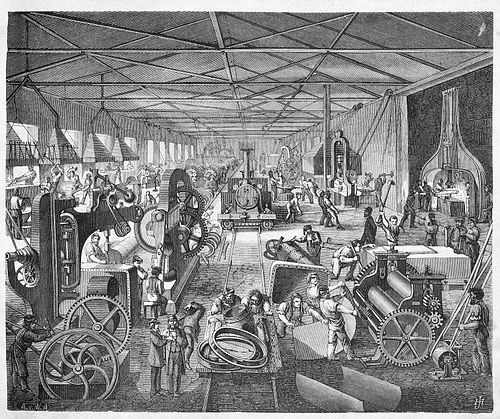Die Gartenlaube (1863)/Heft 9
Der Angeklagte wollte dem Gerichtsdiener folgen, aber er wurde noch einen Augenblick aufgehalten. Hinten im Zuhörerraume, unmittelbar neben der Thür war ein Geräusch entstanden. Der Angeklagte warf schnell den Blick dahin. Sein vor Zorn und Stolz glühendes Gesicht erbleichte plötzlich wieder. Ein Ausruf wollte über seine Lippen gleiten. Er hielt ihn zurück, aber seine unruhigen Augen suchten die Menge zu durchbohren, die sich an der Thür angesammelt hatte. Er mußte dem Gerichtsdiener aus dem Saale folgen. Ein Gensd’arm folgte ihm. Er warf noch im Gehen einen schnellen Blick nach der Thür des Zuschauerraums hin; eine peinliche Unruhe spiegelte sich in seinen Augen. So verließ er den Saal. An der Thür mußte das blasse Mädchen noch stehen. Ich weiß nicht, ob Viele im Saale seinen Blicken und Bewegungen gefolgt waren, verstanden waren sie wohl nur von Zweien, dem Vertheidiger und mir.
In den Zügen des Vertheidigers zeigte sich wieder Angst. Er suchte sie zu verbergen und die Aufmerksamkeit des Saales auf etwas Anderes zu lenken.
„Herr Präsident,“ sprach er mit erhöhter Stimme, die von Allen gehört sein wollte, „ich muß feierlich gegen die Hinausführung des Angeklagten aus dem Saale protestiren. Sie hatten sie ihm allerdings mit Recht für den ausgesprochenen Fall angedroht. Aber der Fall ist nicht eingetreten; Sie mußten ihn abwarten; Sie durften vorher Ihre Drohung nicht ausführen.“
Aber ich mußte wissen, was an der Thür geschehen war. Daß der Präsident, von dem fremden Advocaten schon einmal compromittirt und, wie es mir mehr und mehr schien, absichtlich gereizt, nicht nachgeben werde, auch wenn er sich im Unrechte befand, war mir klar; da war der Streit mir gleichgültig. Ich hatte meinen Platz im Zuschauerraume zwar ziemlich nahe vorn, aber auf der Seite. Die Eingangsthür des Saales war hinten in der Mitte der Wand. In dem Augenblicke, als jenes Geräusch entstanden war, hatte ich nur ein Zusammeneilen der Menschen an der Thür sehen können. Die Leute standen noch so beisammen; ich drängte mich hin. Um irgend einen Gegenstand hatte sich ein dichter Kreis gebildet. Nach dem Kerne hin waren es nur Frauen, welche still mit etwas beschäftigt waren.
„Was giebt es da?“ fragte ich.
„Ein junges Mädchen ist ohnmächtig geworden,“ war die Antwort.
Ich konnte nur an das blasse Kind denken. „Wer ist sie?“ fragte ich.
„Man kennt sie nicht,“ antwortete mir eine Frau.
Ein Mädchen aus den unteren Ständen trat herzu. Sie hatte meine Frage gehört.
„Die Tochter des Gefangenwärters,“ sagte sie.
Die Tochter des Gefangenwärters! Ich rief es nicht, aber in meinem Innern hatte ich keinen andern Gedanken mehr, als an die Tochter des Gefangenwärters und an den angeklagten Freiherrn, der drei Monate Gefangener gewesen war, und wie das Kind so schüchtern vorhin in den Saal hereingeschlichen war, und wie sie so ängstlich nach dem Angeklagten hingesehen und wie bei ihrem Erscheinen den Vertheidiger eine so stechende Angst gefaßt, und wie aus dem Gesichte des stolzen Freiherrn bei ihrem Anblicke auf einmal aller Stolz entflohen und er mit so inniger Wehmuth nach ihr geblickt, wie zuletzt auf einmal die peinliche Unruhe ihn ergriffen hatte.
„Was war die Veranlassung ihrer Ohnmacht?“ fragte ich die Frauen.
„Es kam auf einmal. Gerade, als der Angeklagte sprach. Die große Hitze im Saale mußte es thun. Und die Stärkste ist sie auch nicht; man sieht es ihr an.“
Der Kreis der Frauen öffnete sich. Man hatte der Ohnmächtigen, damit der Athem ihr zurückkehre, das Mieder geöffnet. So hatte man sie nicht den Blicken der Männer zeigen können. Darum war sie nicht sogleich aus dem heißen Saale gebracht worden. Jetzt war ihre Brust mit einem Shawl zugedeckt. Zwei Frauen trugen sie hinaus; sie war noch ohnmächtig. Aber das feine, schneeweiße Gesicht war auch in dem Schlafe, der dem Tode glich, schön wie ein Engelsgesicht, und der Schmerz, den man um die geschlossenen Lippen zucken zu sehen glaubte, verlieh ihm einen wunderbar wehmüthigen Reiz. Und sie war ohnmächtig geworden, gerade da der Angeklagte von seiner Ehre und von der Treue und Liebe seiner edlen Frau gesprochen hatte; gerade da war die Hitze des Saales an sie herangetreten! Und der Vertheidiger hatte nicht gewagt, sein erschrockenes Auge zu ihr zu wenden!
Ich mußte dem Zeugnisse des alten Kammerdieners Bartholomäus folgen und kehrte auf meinen Platz zurück. Der alte Mann hatte sich wieder erhoben. Er stand neben dem Stuhle, auf dem er sich hatte niederlassen müssen. Aber er stand gebeugt. Sein Blick war noch scheu; so sah er nach dem leeren Platze, den sein Herr auf der Anklagebank eingenommen hatte. Die Entfernung des Angeklagten schien ihn noch mehr zu drücken, als vorhin dessen Anwesenheit.
„Sie wollten erzählen,“ sagte der Präsident zu ihm, „wie der Graf Hochhausen seinen Freund betrogen habe!“
[130] „Ja, Herr Präsident,“ erwiderte der Zeuge, „ich muß hier die Wahrheit sagen, und sollte ich auch auf Erden keine ruhige Stunde mehr haben. Ich habe einen Eid geschworen. – Es war gleich nach Ostern in diesem Jahre, und Ostern war noch im Monat März. Da merkte ich es wieder. Ich hatte seit dem Winter die Beiden nicht aus den Augen gelassen. Es war eine große Jagd in der Gutsforst. Die Herrschaften zogen am Morgen vom Schlosse aus. Auch der Graf Hochhausen war dabei. Sie hatten vorher gefrühstückt. Gegen den Schluß des Frühstücks hatte ich auf einmal den Grafen vermißt. Er mußte sich unbemerkt fortgeschlichen haben. Es fiel mir auf, und ich ging in den Corridor, an welchem die Gemächer der Herrin lagen, und versteckte mich dort. Nach einer Minute öffnete sich leise die Thür des Zimmers der gnädigen Frau. Der Graf kam heraus. „„Zum Abend!““ flüsterte er im Heraustreten zurück. Dann schlich er schnell fort und ein paar Minuten darauf ging es zur Jagd. Ich blieb im Schlosse zurück und beobachtete die Herrin. Sie war in einer sonderbaren Unruhe und Ungeduld. Sie konnte den Abend nicht erwarten. Oder fürchtete sie ihn auch? Ich hoffte das Letztere. Die Jäger sollten um sieben Uhr Abends von der Jagd zurückkehren, und ein großes Souper sollte den Tag beschließen. Um sechs Uhr sah ich die Herrin das Schloß verlassen. Sie war allein und ging in den Garten hinter dem Schlosse, einfach, in Hut und Shawl, wie um einen Spaziergang zu machen. Ich folgte ihr nach, ohne daß sie mich gewahrte. Hinten im Garten, in einem Bosket, war ein Pavillon, der verschlossen werden konnte. Zu ihm ging sie, schloß ihn auf und war darin verschwunden. Ich hatte mich in dem Bosket verborgen. Nach kaum einer Minute kam von einer anderen Seite der Graf. Er ging gerades Weges auf den Pavillon zu, klopfte an die Thür, welche ihm von innen geöffnet wurde, und verschwand ebenfalls darin. Ich wußte genug. Drei Tage lang ging ich mit mir herum, ob ich es dem Herrn sagen solle oder nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden, denn ich wußte, was folgen werde, wenn ich es ihm sagte. Am dritten Tage sah ich wieder jene Unruhe und Ungeduld an der Herrin und paßte ihr wieder auf. Am Abend schlich sie wieder in den Pavillon. Der Graf wartete schon auf sie. Der Herr war nicht zu Hause; er war zur Stadt verreist. Mein Entschluß stand jetzt fest, er mußte wissen, was ich wußte. Als er am späten Abend zurückkam, theilte ich ihm Alles mit, was ich gehört und gesehen hatte. Er hörte mir ganz ruhig zu. Als ich fertig war, fragte er mich:
„Hast Du mit irgend Jemandem über die Sache gesprochen?“
„Nein,“ mußte ich ihm antworten.
„Hat irgend ein Anderer von dem etwas gesehen, was Du mir sagtest?“
„Kein Mensch.“
„Weiß Niemand im Schlosse sonst etwas von den Beiden?“
„Keiner. Ich allein weiß nur etwas, weil ich den strengsten Aufpasser machte. Keiner von den Anderen hat nur eine Ahnung. Ich habe sie genau beobachtet, von Tag zu Tag, und hätte es gewahr werden müssen, wenn sie nur das Geringste gewußt oder gemerkt hätten.“
Dann sagte er zu mir, und er war ganz so ruhig, wie er mir zugehört hatte:
„Du hattest Dich geirrt, Freund Bartholomäus. Meine Frau kann keine Untreue gegen mich begehen, und mein Freund keinen Verrath. Ich feiere in drei Wochen meinen Geburtstag; da wollen die Beiden mich mit irgend etwas überraschen. Das ist Alles. Darin hat Deine Liebe zu mir etwas Anderes gesehen. Beruhige Dich nun. Sprich zu keinem Menschen ein Wort von dem, was Du zu mir gesagt hast, damit nicht der falsche Verdacht weiter greift, und verfolge auch nicht ferner mit Deinen argwöhnischen Augen meine Frau und meinen braven Freund.“
Damit verließ er mich. Ich schüttelte den Kopf; aber ich that, wie er mir befohlen hatte. Da geschah das Unglück.“
„Wie faßten Sie die Worte des Freiherrn auf?“ fragte der Präsident. „Glaubten Sie, daß er seine Ueberzeugung gegen Sie aussprach, oder daß er sich gegen Sie verstellte?“
„Ich wußte es nicht. Ich dachte an das Eine und an das Andere und mußte nur den Kopf schütteln.“
„Und welcher Meinung sind Sie jetzt?“
„Jetzt kann ich wohl nicht mehr zweifeln, daß er sich gegen mich verstellte.“
„Und warum glauben Sie das?“
„Weil doch das Unglück darauf folgte.“
„Wie viele Zeit vor dem Tode des Grafen geschah jene Mittheilung?“
„Es war am zweiten Sonnabend vorher.“
„Also am 31. März, gerade elf Tage vor der That?“
„So wird es sein.“
„Haben Sie in dieser Zwischenzeit irgend etwas Ungewöhnliches an dem Freiheren bemerkt?“
„Gar nichts. Ich mußte ihn oft genug ansehen. Aber ich sah nichts an ihm. Es war mir wie ein plötzlicher Donnerschlag, als ich in der Nacht die beiden Schüsse hörte. Ich mußte sogleich an ihn denken, und da ich ihn sah, wußte ich Alles.“
„Auch Sie erkannten in jener Nacht den Freiherrn?“
„Unzweifelhaft. Er war nur wenige Schritte von mir.“
Der Präsident schloß das Verhör des Zeugen.
„Hat der Herr Staatsanwalt noch Fragen an den Zeugen zu richten?“ fragte er.
„Nein,“ antwortete der Staatsanwalt.
„Auch der Herr Vertheidiger nicht?“
„Nein,“ antwortete der Vertheidiger, eben so kalt und ruhig, wie der Staatsanwalt. Vom ihm schien man eine andere Antwort erwartet zu haben.
„Wie?“ las ich auf manchem Gesichte im Saale. „Er hat keinen Vorhalt, keine Erinnerung zu der Aussage, die den Angeklagten vernichtet? Ah, er kann nur seine Sache verloren geben.“
Aber der fremde Advocat sah so gelassen, so gleichgültig drein – ich mußte den Kopf schütteln, wie der alte Kammerdiener gethan hatte. Der Präsident ließ den Angeklagten wieder herein führen und theilte ihm, wie das Gesetz es vorschrieb, ausführlich die Aussage des vernommenen Zeugen mit. Der Angeklagte hatte seine volle frühere Ruhe und Theilnahmlosigkeit wieder gewonnen. Er hörte die Mittheilung an, als wenn ihm wildfremde Dinge erzählt würden.
Die Zeugenvernehmungen waren beendigt. Die gerichtsärztlichen Protokolle über Verletzungen und Tod des Grafen Hochhausen wurden noch verlesen. Die beiden Wunden waren, jede für sich, unbedingt tödtlich gewesen. Die in der Brust war zuerst zugefügt; die zweite, die den Hirnschädel zerschmettert hatte, war aber nach so kurzem Zwischenraume gefolgt, daß die Aerzte nicht mit Bestimmtheit erklären konnten, ob bei ihrer Zufügung in Folge der ersten Wunde der Tod schon eingetreten gewesen sei oder nicht. Es kam nicht darauf an. Gericht, Staatsanwaltschaft und Vertheidigung hatten keine Erinnerung gegen die Protokolle. Einer weiteren Befragung der Gerichtsärzte bedurfte es daher nicht.
Der Präsident erklärte die Beweisführung für geschlossen und forderte den Staatsanwalt auf, die Anklage zu begründen. Ich sah den Vertheidiger unruhig. Ich hatte ihn eine Zeitlang aus den Augen gelassen. Er blickte mit einer gewissen Ungeduld bald in den Zuschauerraum, bald nach den verschiedenen Thüren, die in den Saal führten.
Der Staatsanwalt begann seine Rede. Er habe leichte Mühe, sagte er, und er hatte sie. Er konnte aus den Zeugenaussagen vollständig jede Behauptung der Anklage nachweisen. Von besonderer Wichtigkeit waren die Bekundungen des Nachtwächters und des Kammerdieners. Es wurden durch sie namentlich zwei Punkte festgestellt, die entscheidend waren. Nach der Aussage des Kammerdieners, dieses treuesten aller Diener, dessen Zeugniß fast mehr durch seine Thränen, als durch seinen Eid befestigt wurde, war der Angeklagte von der Untreue seiner Gattin unzweifelhaft überzeugt gewesen; er hatte es, zumal bei seinem leidenschaftlichen, aufbrausenden Charakter, nothwendig sein müssen. Hatten sein Benehmen und seine Worte gegen den Diener etwas Anderes zu erkennen geben wollen, so war dies eine Verstellung, die nur um so mehr auf die Intensität seiner Rachegedanken schließen ließ. Der Mord des Grafen, des Räubers seiner Ehre, war von dem Augenblicke an in seinem Innern beschlossen. Er suchte nur noch nach einem günstigen Momente zur Ausführung. Er unternahm die Reise nach H. Es war eine Geschäftsreise, die gemacht werden mußte, und es war schon tagelang vorher von ihr gesprochen. Da konnte er seiner Sache sicher sein. Der Graf fiel in seine Hände. Er erschoß ihn. Es war ein Mord, ein zehn bis elf volle Tage lang bedachter, planmäßig angelegter und planmäßig ausgeführter Mord. Die bevorstehende Reise nach H. hatte er acht Tage vorher bekannt gemacht, um den Grafen ganz sicher heranzulocken. [131] Zu der Reise, oder vielmehr für die Rückkehr, hatte er sich mit zwei geladenen Pistolen versehen; die beiden schnell hinter einander gefallenen Schüsse ließen keinen Zweifel darüber. Seine frühere Rückkehr von H., seine Ankunft auf der Eisenbahnstation, die Wegnahme des Pferdes aus dem Stalle, sein Abreiten, alles das hatte er auf eine Weise zu verbergen und zu verheimlichen gewußt, die das unwiderlegliche Zeugniß von der Festigkeit und von der wohldurchdachten Ausführung seines Mordgedankens und Mordplans ablegte. Daß der Entschluß zum Tödten erst nach seiner Rückkehr zum Schlosse, als er im Garten des Grafen ansichtig wurde, entstanden und gefaßt sei, daran konnte, gegenüber jenen Thatsachen, ein vernünftiger Mensch gar nicht mehr denken. Und dazu nun die Aussage des Nachtwächters! Der Angeklagte hatte diesen in das Schloß zu dem Zimmer seiner Gattin geschickt, um sie von seiner Rückkehr zu benachrichtigen. Durch die Thür des Zimmers, durch den Corridor, in dem der Wächter stand, konnte der Graf nicht mehr entkommen. Es blieb ihm nur das Fenster, das Spalier, der Garten. Und im Garten, unter dem Fenster, an dem Spalier, stand, mit seiner doppelten Mordwaffe, ruhig, lauernd der Angeklagte, ließ gemächlich den nichts ahnenden jungen Officier bis auf vier Schritte an sich herankommen und schoß ihn meuchlerisch nieder. Er hatte damit noch nicht genug. Dem tödtlich in die Brust Getroffenen, dem Sterbenden, zerschmetterte er noch mit einer zweiten Kugel das Gehirn. Und das muß in unmittelbarer Nähe geschehen sein; die Zeugen sahen Hände und Mantel blutig. Zu dem meuchlerischen Morde fügte er die rohe Mißhandlung hinzu. „Oder,“ schloß der Staatsanwalt, „will etwa auch der Herr Vertheidiger wagen, zu leugnen, daß der Mörder und der Angeklagte eine und dieselbe Person gewesen sei? Will auch er alle diese Zeugen, die treuen, aber auch eidestreuen Diener ihres Herrn, als Lügner hinstellen und allein jenem blöden Kretin Glauben beimessen? Mag er es, aber verlange er es von den Herren Geschworenen nicht.“
Die kurze, ruhige, aber desto klarere Rede hatte einen überwältigenden Eindruck im Saale hervorgebracht. An der Schuld des Angeklagten und an dem Morde zweifelte Niemand mehr, konnte Keiner mehr zweifeln. Es war nur noch die Spannung der Neugierde, was der berühmte Advocat aus der Residenz gegen solche schlagende Argumente werde vorzubringen vermögen, die Aller Augen auf den Vertheidiger richtete, als der Präsident diesem das Wort zur Erwiderung ertheilte.
Der Vertheidiger hatte seine volle Ruhe wieder gewonnen. Ich hatte ihn fortwährend beobachtet. Er war für mich vielleicht mehr, als für alle Andere, ein Gegenstand der Neugierde geworden, freilich wohl aus einem ganz verschiedenen Grunde. Da hatte ich denn gesehen, wie sein unruhig im Saale herumsuchender Blick auf einmal ein anderer geworden war. Er mußte plötzlich etwas gesehen haben, das ihm alle Unruhe, allen Zweifel, alle Sorge nahm. Es war während der Rede des Staatsanwalts. Was es war, konnte ich nicht ermitteln, nicht errathen. Seine Augen waren bis dahin nach allen Seiten hin und her geschweift. Es schien mir, als wenn er wieder hinten in dem Zuschauerraum irgend eine Entdeckung gemacht habe. Aber welche? Die Thüre dort war mehrere Male auf- und zugemacht worden, aber leise, ohne Geräusch, damit der Redner nicht gestört werde. Daher hatte ich auch um so weniger meinen Platz verlassen dürfen, um nach dem zu suchen, was den Vertheidiger so ruhig, so sicher, so sorglos gemacht haben könne. So war er und so begann er seine Vertheidigungsrede.
„Ich habe keine so leichte Mühe, wie der Herr Staatsanwalt.“ sagte er. „Ich glaube im Gegentheile, daß ein Vertheidiger, der Gewissen und Einsicht hat, selten in einer schwierigeren Lage sich befand. Ich muß den klarsten, den übereinstimmendsten und überzeugendsten Beweisen gegenüber dennoch die Unschuld des Angeklagten behaupten. Aber ich muß es, meine Herren Geschworenen; ich muß es, nach meiner, nach meiner innersten, heiligsten Ueberzeugung von der Unschuld des Angeklagten; ich muß es auf die Gefahr hin, daß Sie mich, den Fremden, den Ihnen völlig Unbekannten, für einen jener gewöhnlichen Advocaten halten, die durch Wort-, Satz- und Rechtsverdrehungen, durch Verkehren von Schwarz in Weiß und von Weiß in Schwarz, den klarsten Thatsachen gegenüber die Unschuld ihres Clienten nachzuweisen suchen und ihn dadurch erst recht als schuldig hinstellen. Ja, meine Herren Geschworenen, der Angeklagte ist unschuldig; er ist kein Mörder und hat den Mord nicht begangen, dessen Thatbestand hier vor Ihnen entrollt ist. Denn das gebe ich der Anklage vollkommen zu, wenn wirklich der Angeklagte der Thäter war, dann liegt hier ein Mord vor, wie er kaum vorbedachter und planmäßiger ersonnen und meuchlerischer, selbst mit jenen Mißhandlungen, die der Herr Staatsanwalt hervorgehoben hat, ausgeführt werden konnte. Aber der Angeklagte war nicht der Thäter; ein Anderer war es, ein Anderer muß es gewesen sein. Die Zeugen haben sich geirrt. Nur Einer ist frei von dem entsetzlichen Irrthume geblieben, jener arme schwachsinnige Bursche, den der Herr Staatsanwalt Ihnen als einen Kretin bezeichnet hat. Der Herr Staatsanwalt hatte Recht hierin. Der Mensch ist ein Kretin, und gerade weil er es ist, sah er richtig; gerade weil er allein unter allen den anderen Dienstboten des Schlosses des klaren Lichtes der Vernunft beraubt war, war er unter ihnen allen der einzige, der nur mit seinen leiblichen Augen und nicht mit seiner Phantasie sah, und der daher die Wirklichkeit erkannte und das Falsche von dem Wahren schied, wo die Anderen das, was sie sahen, mit dem, was sie zu sehen sich einbildeten, vermengten und vermischten. Der Graf Hochhausen war oft zum Schlosse gekommen; man hatte ihn viel in der Gesellschaft der Freifrau gesehen, auch mit ihr allein; da waren die Leute schnell fertig mit einem Urtheile gewesen, das der Mensch um so schneller und fertiger bei der Hand hat, je mehr es ihm selbst an geistiger und sittlicher Bildung fehlt. Sie hatten wohl unter sich davon gesprochen; um desto fester war das Urtheil, die Ueberzeugung in ihnen geworden. An diese Ueberzeugung knüpfte ihre Phantasie weiter an: sie sahen geheime Zusammenkünfte zwischen dem Grafen und der Freifrau, den Grafen betrogen; sie sahen den betrogenen Gatten seine Schande entdecken, seine beleidigte Ehre rächen. Das mußte nach ihrer Meinung einmal kommen.
Da hörten sie in jener Nacht zwei Schüsse; die Schüsse sind unter den Fenstern der Freifrau gefallen. Der Freiherr unvermuthet zurückgekehrt! Der Graf von ihm überrascht! Das waren ihre ersten, ihre einzigen Gedanken. Mit diesen Gedanken eilen sie in den Garten, sehen sie einen Mann fliehen, der Aehnlichkeit mit dem Freiherrn hat, vielleicht sie nicht einmal hat. Das kann ihnen nur der Freiherr sein; die Nacht, das zweifelhafte Mondlicht kommt ihrer Phantasie zu Hülfe; sie sehen den Grafen in seinem Blute unter den Fenstern der Freifrau liegen. Sie haben gar keinen Zweifel mehr und sterben darauf, daß sie nur den Freiherrn gesehen, daß sie ihn auf das Allerbestimmteste erkannt haben. Nur Einer unter ihnen sah anders. Der Blödsinnige hatte von allen jenen Thatsachen, Gerüchten und Gereden nichts erfahren, er war ihnen unzugänglich gewesen, und so hatte er sich auch jenes Urtheil nicht bilden können; sein schwacher Verstand hätte es ohnehin wohl nicht vermocht. So sah er auch nicht mit seiner Phantasie, sondern nur mit seinen leiblichen Augen, und sie sahen klar und scharf, und sie erkannten wohl einen Mann, der dem Freiherrn ähnlich sah, sie erkannten aber auch wohl, daß es der Freiherr nicht war. Der Mensch war größer, als der Herr, und er hatte andere Augen, hat er Ihnen gesagt, und dabei ist er verblieben, und darin hat er sich durch nichts beirren lassen, und wollen Sie noch zweifeln, daß er Ihnen auch die thatsächliche, objective Wahrheit gesagt hat? Nur zwei der anderen Zeugenaussagen könnten Sie irre machen, die des Nachtwächters und des alten Kammerdieners. Und sodann hätten Sie die wichtigste Frage an mich zu stellen, wer denn der Mörder gewesen sei. Allein wenn ich Ihnen in Beziehung auf die letztere Frage schon jetzt erkläre, daß alle Nachforschungen über die eigentliche Person des Thäters ohne jegliches Ergebniß geblieben sind, und daß ich Ihnen nachher kaum einige entfernte Vermuthungen darüber werde aufstellen können, so vertraue ich doch zu Ihrer Gewissenhaftigkeit, meine Herren Geschworenen, daß dieser Umstand Sie nicht hindern wird, den übrigen, wirklich ermittelten Umständen ferner Ihre volle Aufmerksamkeit und gerechte Würdigung zu Theil werden zu lassen. Ich wende mich zuerst zu der Aussage des Nachtwächters des Schlosses. Er war der Einzige, der in der Nacht des Verbrechens mit dem Mörder gesprochen hatte. Er hatte sich wohl auch schon vorher sein Urtheil gebildet, wie die Anderen. Dennoch –“
Der Redner wurde unterbrochen. Ein Gerichtsbeamter war während seines Vortrags in den Saal getreten. Der Mann schien eilig zu sein, war aufgeregt und nahete sich dem Stuhle des Präsidenten. Im Gehen warf er einen verwunderten, forschenden Blick auf den Angeklagten. Dann sprach er einige rasche, leise Worte [132] zu dem Präsidenten. Der Präsident fuhr plötzlich überrascht auf, warf ebenfalls einen forschenden, aber zugleich zweifelnden Blick auf den Angeklagten, wandte sich zu dem Beamten zurück, der hinter seinem Stuhle stehen geblieben war, und sprach leise mit ihm. Er schien ihm die Zweifel mitzutheilen, die man in seinen Augen las. Der Beamte schien bei dem zu bleiben, was er gesagt hatte. Der Präsident gab ihm einen Befehl. Der Beamte entfernte sich.
Die beisitzenden Richter hatten neugierig zugehorcht. Sie hatten wohl nur einzelne Worte verstanden. Sie waren desto neugieriger geworden. Der Präsident schien ihre Neugierde zu befriedigen. Auch sie fuhren auf, sahen verwundert den Angeklagten an, schüttelten ungläubig die Köpfe. Erwartungsvoll blieben sie Alle. Auch das Publicum, dem der Zwischenfall nicht hatte entgehen können, war neugierig geworden. Nur der Vertheidiger hatte ruhig in seinem Vortrage fortgefahren. Er durfte sich ja auch nicht unterbrechen, bis der Präsident ihn unterbrach. Dies geschah bald.
Der Beamte des Gerichts, der dem Präsidenten die geheimnißvolle und überraschende Mittheilung gemacht hatte, trat durch die Thür, die in den Zeugenraum führte, wieder in den Saal. Zwei Personen folgten ihm, ein Mann und eine Frau. Die beiden Leute waren in einer Kleidung, die zeigte, daß sie unmittelbar von der Reise kamen. Sie sahen verstört aus. Es schienen wohlhabende Landleute zu sein. Der Beamte führte sie in den Raum, gerade der Bank des Angeklagten gegenüber und sprach dann zwei leise Worte zu ihnen und zeigte auf den Angeklagten. Sie blickten nach diesem. Das lebhafteste Erstaunen malte sich in ihren Gesichtern. Sie sahen den Angeklagten mit Scheu an.
„Ja?“ fragte der Beamte sie leise.
„Ja!“ antworteten sie bestimmt.
Der Beamte nickte mit dem Kopfe nach dem Präsidenten hin. Der Präsident erhob seine Stimme:
„Ich bitte den Herrn Vertheidiger, seinen Vortrag zu unterbrechen. Es ist ein Umstand eingetreten, der eine sofortige Berathung des Gerichts erfordert.“
Der Vertheidiger schwieg. Das Gericht verließ den Saal. Der Beamte hatte die beiden fremden Personen unterdeß schon hinausgeführt. Was für ein Umstand war eingetreten, der eine so dringende Berathung des Gerichts erforderte? Der ganze Saal fragte es sich. Auch der Vertheidiger fragte es. Niemand hatte eine Antwort. Aber die beiden Personen, die der Beamte in den Saal geführt hatte, waren nicht allen Anwesenden fremd gewesen. Die vernommenen Zeugen waren im Saale geblieben; auch sie hatten die beiden Leute gesehen, und einige von ihnen hatten sich über ihre Erscheinung nicht minder verwundert, als die Zwei bei dem Anblick des Angeklagten erstaunt gewesen waren. Die sich so verwunderten, waren der Aufwärter und der Stallknecht von der Eisenbahnstation Wiekel, die über die Anwesenheit des Angeklagten auf der Station in der Nacht des Verbrechens vernommen waren. Sie haben ihre Herrschaft erkannt, hieß es bald durch den Saal. Der Mann und die Frau waren die Wirthsleute von der Station. Aber was mit ihnen geschehen war, zu welchem Zweck sie hier waren, was der Grund ihrer Verwunderung, ihrer Scheu gewesen war, das wußte dennoch Niemand, wenn man auch wußte, wer sie waren.
Der Angekagte allein war ruhig geblieben, unzweifelhaft er der Einzige im Saale. Er hatte aufgeblickt, als die beiden Personen ihm gerade gegenüber aufgestellt wurden. Er schien sie ebenfalls erkannt zu haben, aber er hatte in demselben Moment keine Notiz weiter von ihnen genommen; sie schienen ihm völlig gleichgültige Menschen zu sein, die er wohl früher gesehen hatte, die ihn aber sonst in der Welt nichts angingen, auch hier nicht. So war er in seine kalte, vornehme Theilnahmlosigkeit zurückgefallen.
Das Gericht kehrte in den Saal zurück.
„Die Sitzung wird für eine Stunde aufgehoben,“ verkündete der Präsident. „Ein Umstand, der für die Verhandlung von großer Wichtigkeit zu sein scheint, bedarf, um in sie hineingezogen werden zu können, einiger Vorbereitungen.“
Wie ein vom Sturm getriebener Strom ergoß es sich aus allen Thüren des Saales. Was ist geschehen? Welcher Umstand kann noch für die Verhandlung von großer Wichtigkeit sein? Draußen mußte man es erfahren.
Der langsam und unwiderstehlich, gleich einer Naturkraft wirkende Einfluß der Eisenbahnen, der Alles von seiner Stelle rückt, aus Einöden Marktplätze und aus bevölkerten Thälern Einöden macht, Dörfer in Städte und Städte in Dörfer umwandelt, macht sich auch in der Schweiz fühlbar. Gestatten Sie mir, diesen bereits trivial gewordenen Satz durch ein Beispiel aus Hunderten zu erläutern.
Olten, am Südfuße des Jura und an der Aar gelegen, war vor einem Jahrzehnt nicht mehr noch weniger als ein kleines Landstädtchen. Zwar zählte es sich schon damals keineswegs zu den geringsten in Israel, nicht sowohl deshalb, weil es schon zur Römerzeit bestanden hatte, wo es Ultinum hieß, sondern vielmehr wegen des stets bewährten freisinnigen, vielleicht sogar etwas revolutionären Geistes seiner Einwohnerschaft, und dann weil es einige Namen von gutem Klang, den schweizerischen Bundespräsidenten Munzinger, den genialen Maler Disteli, zu seinen Bürgern zählte. Dennoch war Olten mit seinen 1600 Einwohnern nichts Anderes als ein Landstädtchen, wo jedes Jahr ein paar besuchte Jahrmärkte abgehalten wurden und täglich einige Postwagen die Pferde wechselten.
Da kamen die Eisenbahnen. Der Bau des Hauensteintunnels, schauerlichen Angedenkens, wurde begonnen und zu Ende geführt. Durch die innersten Eingeweide des Jura rasselten die Locomotiven und verbanden Basel mit der innern Schweiz. Von Olten, welches an die Ausmündung des Tunnels zu stehen kam, breiteten sich die Schienenwege fächerförmig aus: östlich nach Zürich, St. Gallen und den Bodensee, südlich nach Luzern und den Vierwaldstättersee, westlich nach der Bundesstadt Bern, nach Biel und den Seen von Neuchatel und Genf. Das Landstädtchen war zu einem Eisenbahnknotenpunkt geworden. Als nächste Folge entstand ein weitläufiger Bahnhof, in welchem stündlich lange Wagenzüge ein- und ausfahren, – lange und breite Hallen von Ein- und Aussteigenden wimmelnd, endlich eine geräumige Eisenbahnwirthschaft, wo hungrige und durstige Reisende in ungeduldiger Hast die Bedürfnisse ihres Magens und Gaumens befriedigen. Dahin kommen nun Tag für Tag die alten Bürger von Olten und lassen die Passagiere aus aller Herren Länder, die hier zum Wagenwechsel gezwungen sind, Musterung passiren, lauschen der babylonischen Sprachverwirrung, vergleichen das Einst und Jetzt und freuen sich, daß republikanische [133] Tugend doch einmal ihren Lohn erhalten und der glückliche Zufall gerade sie betroffen habe.
So viel steht fest, daß so ziemlich Alles, was die Schweiz bereist, durch den Bahnhof von Olten passiren und dort aussteigen muß. Mögen die Touristen vom Leman zum Bodensee, vom Gotthard zum Rhein, vom Rigi zum Weißenstein reisen, mögen sie von Paris oder München oder London herkommen – den Bahnhof von Olten müssen sie mindestens einmal berühren. Da ist’s dann in Wahrheit kein schlechter Spaß, all’ die Leute, die sich auf den Trottoirs und in den Erfrischungssälen drängen, gleich den Bildern einer laterna magica an sich vorbeiziehen zu lassen. Auch fehlt es nicht an Gelegenheit, hie und da eine interessante Persönlichkeit und europäische Berühmtheit von Angesicht zu Angesicht zu sehen, wie z. B. den Grafen Chambord, da er an den Legitimistencongreß nach Luzern fuhr, oder die arme Königin von Neapel, als sie ihrem Gatten aus Rom entflohen. … Als Eisenbahnknotenpunkt ist Olten dann auch zum natürlichen Stelldichein und Zusammenkunftsort schweizerischer Vereine und Versammlungen geworden. Universitätsprofessoren und Zündhölzchenfabrikanten, Thierärzte und Blechmusiker, Sänger, Landwirthe, Naturforscher, Pfarrer, Apotheker und Schullehrer halten hier ihre Berathungen und Bankete. Genaue statistische Notizen, wie viel in Olten für’s Vaterland gegessen, getrunken und gesprochen wird, würden wahrscheinlich die Welt in Erstaunen setzen.
Die Eisenbahn als freundliches Christkindlein hat aber den Oltnern nebst ihrem wimmelnden Bahnhof noch eine zweite Gabe bescheert, eine Maschinenfabrik oder „Centralreparaturwerkstätte“. Es ist dies eine Heilanstalt für sämmtliche unpäßlich gewordene Locomotiven, ein Lazareth für alle im Dienst beschädigten und verletzten Waggons der schweizerischen Centralbahn; es werden darin auch außerdem neue Locomotiven in die Welt gesetzt, eiserne Brücken geschmiedet, Drehscheiben construirt, kurz alles dasjenige verfertigt, was – aus Metall oder Holz bestehend – zum Betrieb einer Eisenbahn gehört. Diese mechanische Werkstätte beschäftigt heute schon nahe an 400 Arbeiter, durch welche die Bevölkerung des Städtchens um ein ganzes Fünftheil vermehrt wurde. Die nächste Folge der Errichtung dieser industriellen Anstalt gab sich eigenthümlicher Weise auf kirchlichem Boden kund. Da viele Arbeiter der reformirten Confession angehören, so wurde aus lauter freiwilligen Beiträgen im katholischen Olten eine protestantische Kirche erbaut, und heute functionirt daselbst in bester Eintracht mit dem katholischen Pfarrer und dem nahen Kapuzinerkloster ein protestantischer Geistlicher.
Die dicht am Bahnhof liegende „Centralreparaturwerkstätte“ ist ein eigentlicher Bienenkorb, in welchem die Hobelmaschinen, die Bohrmaschinen, die Sägemaschinen, von Dampfkraft getrieben, in ununterbrochener Thätigkeit surren und schwirren. Die Werkstätte steht unter der vortrefflichen Leitung des Directors Riggenbach, der für die Arbeitercolonie mehr Vater als Meister ist. Jedes Jahr erhält die ganze Mannschaft einen Tag Ferien, an welchem sie auf Kosten der Centralbahngesellschaft und unter Anführung des Directors eine Lustfahrt macht. Es ist eine wahre Freude, die kräftigen Gestalten der Schmiede und Holzarbeiter an diesem Feiertag zu beobachten, wie sie sauber herausgeputzt in anständiger Lust sich bewegen. – Für Tage der Noth sorgt eine Kranken- und Hülfscasse, welche zum Theil aus den Beiträgen der Arbeiter, zum [134] Theil aus den Zuschüssen der Gesellschaft gebildet ist. Dies nennen wir Socialismus der rechten Art. – Die Maschinenwerkstätte, schon jetzt in schönster Blüthe, scheint einer noch bedeutendern Zukunft entgegen zu gehen. Schon dehnt sie ihre Wirksamkeit über die Bedürfnisse der Centralbahn aus; sie construirt schon jetzt für andere Bahngesellschaften eiserne Brücken und lieferte kürzlich unter anderm für die Eidgenossenschaft 36 eiserne Lafetten nach der eigenen Erfindung des Directors Riggenbach, deren Modell an der Londoner Weltausstellung die Aufmerksamkeit und den Beifall der Sachkenner aus sich zog.
Der Eisenbahntourist, der von Basel herkommend nicht ohne einigen leisen Schauder den langen Tunnel passirt hat, wird über der prachtvollen Fernsicht auf das Aarthal und die Alpen, die sich unversehens wie durch Zauber vor ihm öffnet, die langen Reihen von Gebäuden mit den rothen Ziegel- und grauen Schieferdächern, die zu seinen Füßen liegen, kaum beachten. Aber kommt er vielleicht mit einem Abendzug daher und sieht die hundert Gasflammen tief unter sich und fragt, was das wohl sei, so wird er die Antwort erhalten: „Das ist der Bahnhof von Olten mit der Maschinenwerkstätte.“ Die freundlichen neuen Häuser ringsherum und das neue Kirchlein in der Nähe, das Alles ist Neu-Ultinum, der Eisenbahnknotenpunkt.
Alle Vorbereitungsmaßregeln zur Flucht waren getroffen. Der noch fehlende Nachschlüssel zu der Stube für die Inspectoren der Anstalt, der sogenanten Revierstube, in welcher die Schlüssel zu der Zelle Kinkel’s sich befanden, war glücklich herbeigeschafft. Man hatte von dem Schlüssel zu jener Sube, der am Tage im Schlosse steckte, einen Abdruck in Thon gemacht und danach einen Schlüssel anfertigen lassen. Ein zweiter Gefangenwärter, nach der Anklageacte des Oberstaatsanwalts der Aufseher Beyer, war gewonnen und hatte sich bereit erklärt, Kinkel durch das Thor der Anstalt herauszulassen, sobald er den Nachtpförtnerdienst hätte. Die Stunde der Entscheidung nahte.
In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1850 sollte Beyer die Nachtwache am Thore haben. Kinkel ward benachrichtigt, daß er sich am Abende zwischen 8 und 9 Uhr bereit halten möge. Beyer hatte wirklich den Nachtpförtnerdienst an jenem Abend, Brune die Nachtwache im Corridor. Die Freunde waren den empfangenen Ordres gemäß auf ihren Posten. Carl Schurz war am Thore der Anstalt zum Empfange Kinkel’s bereit. Der Gutsbesitzer X. hielt mit seinem Wagen in der Nähe des Zuchthauses. Relais waren in Entfernungen von einigen Meilen bis nach Teterow in Mecklenburg-Schwerin aufgestellt. Die auf den verschiedenen Stationen wartenden Freunde hatten die Ordre, so lange zu warten, bis der Wagen mit den Flüchtlingen ankäme, um sie dann bei sich aufzunehmen und in Carrière bis zum nächsten Posten weiter zu befördern. Um Mißverständnisse zu vermeiden, waren bestimmte Erkennungszeichen, welche im Dunkel der Nacht mit Feuerstein und Stahl gegeben werden sollten, verabredet. Alles war so wohl vorbereitet, daß man den glücklichen Erfolg nicht bezweifelte.
Aber vergebens wartete Kinkel auf seine Erlösung.
„O, es war eine furchtbare Nacht, die ich erlebte,“ äußerte er zu mir, bei Erzählung seiner Flucht, „ich schaudere, wenn ich an sie zurückdenke, die Erinnerung daran wird mich noch auf meinem Todbette verfolgen. Als meine Zelle am Abend 7 Uhr vorschriftsmäßig visitirt und verschlossen war, erhob ich mich wieder von meinem Lager und zog mich an. Um mich herrschte tiefe Dunkelheit; bei der Visitation war mir wie gewöhnlich die Lampe weggenommen worden. Von 8 Uhr an horchte ich, mit dem Ohr an die hölzerne Gitterthüre meiner Zelle gelehnt, mit athemloser Spannung auf Alles, was draußen vorging. Der Gehörssinn schärft sich im Isolirgefängnisse, nichts entging meinem Ohr, in dem sich alle Sinne concentrirt zu haben schienen. Jeder Laut, jedes Geräusch, jeder Schritt, jeder Tritt verkündigte mir den Befreier. Ich war so sicher, daß er kommen müßte. Aber die Stunden schwanden bleiern dahin, und unzählig waren die getäuschten Hoffnungen. Ich hatte die Uhr 11 schlagen hören und immer noch lauschte ich an meiner Gitterthür. Mein Blut war in fieberhafter Wallung, mein Kopf glühte, der Angstschweiß perlte von meiner Stirne, meine Adern waren zum Zerspringen angeschwollen und alle meine Nerven bis zur höchsten Höhe angespannt. Ich hörte es noch 12 schlagen. Da durchzuckte mich der Gedanke an Verrath. Ich verlor die Hoffnung, und der Wahnsinn packte mich. „Lebenslänglich begraben!“ schrie ich wiederholt. „Begraben!“ echote ein Chor von teuflischen Dämonen mit höllischem Hohnlachen. Ich brach endlich zusammen und fiel bewußtlos auf die harte Diele meiner Zelle. Als ich am andern Morgen früh erwachte, fühlte ich mich an allen Gliedern wie gerädert und schüttelte vor Frost, mühsam schleppte ich mich auf mein Strohlager.“
Der Zufall hatte sein unglückliches Spiel getrieben. Brune öffnete zur verabredeten Zeit die Revierstube mit dem Nachschlüssel, begab sich nach der dort befindlichen Spinde, in welcher die Schlüssel zu den Zellen aufbewahrt wurden, nahm den auf der Spinde liegenden Schlüssel zu derselben, schloß die Spinde damit auf und suchte die Schlüssel zu der Kinkel’schen Zelle. Aber er suchte vergeblich. Der Polizeiinspector Semmler hatte zufällig gerade an diesem Abend die Schlüssel zu dieser Zelle mit nach Hause genommen.
Brune setzte Beyer und dieser den draußen wartenden Carl Schurz von dem unglücklichen Zufall in Kenntniß. Es ward noch versucht, den Aufseher Michaelis, der in der folgenden Nacht den Pförtnerdienst hatte, zu gewinnen. Jedoch ohne Erfolg. Deshalb beschloß man, die Flucht auf vier Wochen, wo Beyer wieder den Nachtpförtnerdienst haben würde, zu verschieben.
Aber als man am andern Morgen die Chancen näher erwog, kam man zu einem andern Resultat. Ein Aufschub bot allerdings große Vortheile. Kinkel konnte, wenn Beyer wieder die Nachtwache am Thore hatte, ungehindert und ohne Gefahr durch dasselbe hindurch auf die Straße passiren. Die Relais, welche voraussichtlich nach vergeblichem Warten bis Tagesanbruch der empfangenen Instruction gemäß davon gefahren waren, konnten bei einem längeren Aufschub wieder zur Stelle sein. Dagegen hatte eine Verzögerung die große Gefahr, daß von dem Plane etwas ruchbar werden würde. Bei der Menge von Personen, welche in das Geheimniß gezogen wurden, konnte innerhalb vier Wochen sehr leicht ein unbestimmtes Gerücht von der beabsichtigten Flucht aufkommen. Ein solches war begreiflich schon sehr gefährlich. In diesem Falle würde man die Sicherheitsmaßregeln verstärkt oder die Versetzung Kinkel’s nach einem anderen Zuchthause vorgenommen haben. Es konnte auch der schlimmste Fall eintreten, daß das Vorhaben verrathen werden würde. Wollte man aber auch dies Alles nicht als wahrscheinlich annehmen, wer bürgte dafür, daß um vier Wochen nicht wiederum derselbe oder ein anderer unglücklicher Zufall eintreten würde? Man beschloß daher, die Flucht sobald irgend möglich zu bewerkstelligen.
Am Mittage hatte Carl Schurz eine Zusammenkunft mit Brune.
„Können Sie ohne weitere Mithülfe Kinkel aus dem Zuchthause befördern?“ fragte er Brune.
„Ja, wenn Kinkel Muth hat!“
„Wie?“
„Durch’s Dachfenster und von da mittelst eines Taues auf die Potsdamerstraße.“
„Wann?“
„Wenn’s sein muß, diese Nacht.“
„Sind Sie bereit dazu?“
„Ja.“
„Nun wohl, diese Nacht.“
Die weiteren Arrangements wurden getroffen. Kinkel hatte Muth. Jeder Weg, der aus der Schreckensanstalt führte, war ihm recht. Zwischen 11 und 12 Uhr sollte das Werk beginnen.
Am Mittwoch, den 6. November 1850, Abends, wurde Kinkel, [135] wie früher stets, durch den Oberaufseher Zerbst in seiner Zelle eingeschlossen, und zwar in der nach der Jüdenstraße belegenen zweiten Abtheilung der Zelle, in welcher sich seine Schlafstätte befand. Die hölzerne Lade am Fenster nach der Jüdenstraße, die hölzerne Gitterthüre, die beiden Eingangsthüren zu der Zelle wurden von ihm vorschriftsmäßig verschlossen. Die in zwei Exemplaren vorhandenen Schlüssel lieferte der Oberaufseher Zerbst der erhaltenen Anweisung gemäß ab, das eine Exemplar an den Director Jeserich, welcher es während der Nachtzeit in seiner Stube verwahrte, das andere Exemplar an den diensthabenden Polizeiinspector Schäffer, welcher es in die in der Revierstube stehende Spinde verschloß, den Spindeschlüssel auf die Spinde legte, demnächst auch die Revierstube verschloß und den Schlüssel zur Revierstube an den Portier Marquardt abgab. Die Beamten hatten pünktlich ihre Pflicht erfüllt.
An dem nämlichen 6. November Abends saß ein großer Theil der Beamten der Anstalt in fröhlichster Stimmung und nichts Arges ahnend im Krüger’schen Gasthause bei einer Bowle Punsch, mit welcher der Geburtstag eines der Anwesenden gefeiert ward. Ein Witz jagte den anderen, und die Unterhaltung war so interessant und so belebt, daß sie sich erst lange nach Mitternacht von der Gesellschaft zu trennen vermochten.
Am dem nämlichen 6. November Nachts 11½ Uhr öffnete der Gefangenwärter Brune, der wiedernm, wie am Abende vorher, die Nachtwache im Corridor hatte, mit dem Nachschlüssel die wohlverschlossene Revierstube, holte den auf die Spinde gelegten Schlüssel zu derselben herunter, schloß damit die Spinde auf, nahm die von dem diensthabenden Polizeiinspector Schäffer einige Stunden vorher hineingelegten, an einem Ringe befindlichen drei Schlüssel zur Kinkel’schen Zelle aus der Spinde und schloß die Revierstube vorsichtig wieder zu.
Zu derselben Zeit war ungeheuere Heiterkeit im Krüger’schen Gasthause; einer der Theilnehmer an der Bowle hatte einen Berliner Witz zum Besten gegeben.
Der Gefangenwärter Brune ging mit seinen Schlüsseln zu der Zelle Kinkel’s und schloß mit dem einen Schlüssel die erste Eingangsthür zu derselben, mit dem andern die zweite Eingangsthür auf.
Ein Hoch auf das Geburtstagskind im Krüger’schen Gasthause!
Auch im Zuchthause zu Spandau sollte Jemand zu neuem Leben erwachen. Von draußen fiel ein schwacher Lichtstrahl in die Zelle Kinkel’s, und dieser stand hinter dem hölzernen Gitter in der zweiten Abtheilung seiner Zelle, sehnsüchtig und voll Todesangst seiner Befreiung aus schauerlicher Einsamhaft entgegensehend. Der Gefangenwärter Brune erschien ihm wie ein rettender Engel. Wie lange schon hatte er in qualvoller Ungewißheit, wie ein Verurtheilter, welcher auf dem Schaffot nur noch die Hoffnung auf Gnade hat, auf ihn gewartet! Nur noch ein Hinderniß, das hölzerne Gitter, sperrte den Ausgang aus der Zelle.
„So, Herr Professor, nun ist es Zeit, nun treten Sie heraus,“ sagte Brune zu Kinkel, indem er mit dem dritten Schlüssel die hölzerne Gitterthür zu öffnen versuchte.
Aber es war noch nicht Zeit. Brune versuchte vergebens, mit dem dritten Schlüssel die Gitterthür aufzuschließen.
„Können Sie nicht öffnen?“ fragte Kinkel unruhig.
„Verdammt! Der Schlüssel paßt nicht,“ erwiderte Brune erschrocken. „Sie werden absichtlich einen verkehrten Schlüssel an dem Ringe befestigt haben, um für den äußersten Fall die Aufschließung der Gitterthür zu verhindern. Was nun?“
Er hatte zu fein gerechnet und die Schlauheit der Inspection zu hoch taxirt. Der kleine Schlüssel, mit welchem Brune die Gitterthür öffnen wollte, gehörte zu der hölzernen Lade an dem nach der Jüdenstraße belegenen Fenster. Bei kaltem Blute und ruhiger Ueberlegung würde er wenigstens versucht haben, das Schloß der Gitterthür mit einem der Schlüssel zu den Eingangsthüren zu öffnen. Der Schlüssel zu der äußern Eingangsthür schloß in der That auch die Gitterthür. Unglücklicher Weise verfiel darauf weder Brune noch Kinkel.
Beide standen sprach- und rathlos sich gegenüber. Kinkel hielt die starken hölzernen Latten krampfhaft umfaßt. Es war ein verzweiflungsvoller Augenblick. Ein paar armselige Latten von Holz widersetzten sich erfolgreich der Flucht und sperrten die Spanne Weges vom Tode zum Leben. Der rechte Schlüssel war in ihrer Hand, aber sie wußten es nicht. An wie schwachen Fäden hängt oft Glück und Unglück der Menschen!
Aber nur wenige Augenblicke dauerte ihre Unschlüssigkeit, sie war nur der Anlauf zu verdoppelter Energie. Kinkel kämpfte ja für sein Leben, und Brune war zu dem Aeußersten entschlossen, um sein Wort zu lösen.
Brune zog seinen Säbel und versuchte auf alle mögliche Weise, den starken Riegel des Schlosses zurückzuschieben oder das Schloß selbst abzubrechen. Kinkel bemühte sich gleichzeitig mit einem kleinen Messer, welches er im Besitz hatte, die nächste Latte neben der Thüre links vom Eingange aus zu durchschneiden. Nachdem er aber die Fruchtlosigkeit seines Beginnens eingesehen hatte, drängte und stieß er gegen die untere Querleiste des Gitters, um deren äußere Bekleidung zu lösen.
Fast eine Viertelstunde erschöpften sie sich vergeblich in diesen Anstrengungen. Das Schloß und das Gitter waren zu stark für ihre Kräfte.
Da ging Brune, sich zu einem verzweiflungsvollen Entschlusse ermannend, aus der Zelle.
Während seiner Abwesenheit rüttelte Kinkel mit der äußersten Kraft an dem Gitter, wie der wutherregte Löwe, der die Eisenstäbe seines Käfigs zu zerbrechen versucht. Alles vergebens.
Nach kurzer Zeit sah er Brune mit einer Axt zurückkehren. Der Augenblick war gekommen, wo um Freiheit und Leben va banque gespielt werden mußte.
Brune schwang die Art hoch empor und führte mit aller Kraft verschiedene Schläge gegen das Gitter. Das ganze Gewölbe erdröhnte. Die Gefangenen in den Zellen erwachten. Erwachte auch der Director Jeserich? Er schlummerte sorglos weiter, hatte er ja doch das zweite Exemplar der Schlüssel zur Kinkel’schen Zelle unter seinem Kopfkissen verborgen.
Im Krüger’schen Gasthofe ertönte ein lustiger Rundgesang.
Kinkel und Brune lauschten athemlos, ob Jemand sich nähere. Alles still. Durch die furchtbaren Axtschläge hatte sich die Leiste am Fußboden und der untere Querriegel von den beiden Latten neben der Thüre links vollständig gelöst. Mit der Riesenkraft, welche die Verzweiflung verleiht, stemmte nun Kinkel sich gegen die beiden Latten, und es gelang ihm, dieselben von innen heraus loszubrechen. An dem oberen Querriegel war die eine Latte dergestalt eingebrochen, daß man ihr unteres Ende mit der Hand über einen Fuß weit von der Leiste am Fußboden losbiegen konnte. Die Latte daneben war gleichfalls von dieser Leiste und von dem unteren Querriegel gelöst, ließ sich aber sehr wenig zurückbiegen, weil sie an dem oberen Querriegel nicht eingebrochen war. Durch das Zurückbiegen der beiden Latten entstand unter dem unteren Querriegel ein offener Raum, durch welchen sich ein nicht zu starker Mann durchzwängen konnte.
Schon seit längerer Zeit hatte Kinkel in prophetischer Voraussicht der kommenden Dinge an seiner Gitterthüre gymnastische Uebungen zu dem Zwecke angestellt, um seinen großen breitschultrigen Körper durch eine möglichst enge Oeffnung hindurchzubringen. Diese kamen ihm jetzt trefflich zu statten. Mit Hülfe Brune’s gelang es ihm, sich durch den erwähnten offenen Raum glücklich hindurchzuzwängen. Das letzte Hinderniß, welches ihm den Ausgang aus der Zelle verwehrte, war damit beseitigt.
Beide verließen darauf die Zelle, deren äußere Eingangsthür Brune wieder verschloß. Sie stiegen leise die Treppe hinunter auf den Hof und durch die nächste Hofthür links wieder in das zweite Stockwerk hinauf. Hierauf gingen sie durch die Säle und Gänge, zu welchen Brune als Nachtaufseher den Schlüssel hatte, immer im zweiten Stockwerke, und kamen endlich in die Wollkämmerei, welche ungefähr gerade unter jenem nach der Potsdamer Straße führenden Dachfenster lag, durch welches die Flucht bewerkstelligt werden sollte.
In der Wollkämmerei warteten sie, bis der bei jenem Fenster postirte Nachtaufseher Knöfel sich nach dem zweiten Hofe begeben würde, wie er dies jeden Abend um diese Zeit zu thun gewohnt war. Alle glücklich beseitigten Gefahren waren umsonst, wenn ihre Berechnung fehlschlug und der nicht in’s Geheimniß gezogene Knöfel in dieser Nacht von seiner Gewohnheit abwich. Aber nachdem sie etwa eine Viertelstunde in ängstlicher Spannung gewartet hatten, kam Knöfel wirklich die Treppe herunter. Sie schlichen darauf dieselbe Treppe hinauf, auf welcher jener herunter gegangen war, nach dem dritten Stockwerk, und gelangten zu dem Raum zwischen dem Dachfenster und den Schlafsälen.
Brune öffnete ein vor dem Dachfenster befindliches Lattengitter mittelst des dazu gehörigen Schlüssels. Darauf krochen Beide in [136] den Raum zwischen dem Dachfenster und dem Lattengitter und blickten bei schwachem Mondlicht in die schwindelerregende Tiefe. Unten in der Potsdamer Straße warteten Carl Schurz und Falkenthal, und der Gutsbesitzer X. hielt dort mit seinem Fuhrwerk, auf dem Bocke sitzend und die Zügel in der Hand haltend, um in jedem Augenblick davon jagen zu können.
Der Abrede gemäß warf Brune ein Stückchen Holz an einem langen Bindfaden auf die Straße, zog es, als er fühlte, daß unten etwas angebunden war, herauf und bekam nach etwa fünf Minuten ein etwa fingerstarkes Tau in die Hand, welches Beide sofort an einer Latte des dem Fenster gegenüberliegenden Gitters befestigten. Sodann stieg Kinkel mit einem Fuß auf die Latten und kroch mit dem Kopfe zuerst durch die Dachluke hinaus, um sich an dem Tau auf die Straße hinunterzulassen.
„Es war ein grausiger Anblick,“ erzählte mir später der Gutsbesitzer X., ein Anblick, welcher mir noch augenblicklich, wenn ich ihn mir in Erinnerung rufe, das Blut in den Adern erfrieren macht. Nachdem wir längere Zeit in ängstlicher Spannung das Dachfenster beobachtet hatten, ward der Bindfaden aus demselben heruntergelassen. Es war dies ein sicheres Zeichen, daß bis dahin Alles glücklich abgegangen war. Aber nun kam das gefährliche Experiment, von dem der Tod oder die Freiheit Kinkel’s abhing. Das eine Ende des Taues wurde von Schurz und Falkenthal an dem Bindfaden befestigt, und darauf ward es an letzterem in die Höhe gezogen. Nun mußte Kinkel jeden Augenblick aus dem Dachfenster hervorkommen. Unverwandten Blickes schauten wir hinauf. Endlich sahen wir den Kopf eines Menschen, der Körper folgte nach. Einen Augenblick später hing Kinkel dicht unter dem Dachfenster am Tau und fing an, sich herabzulassen. Aber gerade in diesem Moment entstand ein Geräusch in der benachbarten Straße. Ein jäher Schreck erfaßte mich, ich glaubte uns entdeckt. Auch Kinkel hatte das Geräusch gehört. Er hielt an. Ich sah ihn mit seiner im blassen, schwachen Mondlicht gespensterhaft erscheinenden langen Gestalt dort oben zwischen Himmel und Erde eine Zeitlang unbeweglich hängen, wie wenn er unschlüssig gewesen wäre, ob er wieder in die Höhe oder ob er herabklettern sollte. Der Schreck konnte ihm die Besinnung rauben, oder die Kraft konnte ihm versagen. Wäre er herabgefallen, so wäre er auf das Straßenpflaster gestürzt und unfehlbar auf der Stelle ein Mann des Todes gewesen. Aber das Geräusch ging glücklich vorüber, es schien durch einen zufällig vorüberfahrenden Wagen veranlaßt zu sein. Wenige Secunden später lag Kinkel in den Armen seines Freundes Carl Schurz.
In höchstens einer Minute nach dem Verschwinden Kinkel’s aus der Dachluke fühlte Brune, daß das Tau leicht wurde, und er band es los, worauf es sammt dem Bindfaden auf die Straße hinuntergezogen wurde. Dann entfernte er sich eiligst und begab sich wieder auf seinen Posten.
Im Krüger’schen Gasthofe war noch die lustige Punschgesellschaft versammelt. Die Mitternachtstunde hatte noch nicht geschlagen. Einer der Festgenossen – nach einem Schreiben des Staatsanwalts Nörner an das Bützower Criminalcollegium vom 21. Febr. 1855 war es der Gastwirth Krüger selbst – füllte einige Gläser, indem er zu den Gästen lächelnd sagte: „Sie erlauben wohl, meine Herren, es sind ein paar lustige Berliner Vögel da,“ und ging darauf mit den gefüllten Gläsern nach einem einfenstrigen Nebenzimmer. Kinkel hatte sich inzwischen mit Carl Schurz und Falkenthal in das Krüger’sche Gasthaus begeben, um sich dort umzukleiden. Er wechselte in dem Nebenzimmer, in welches Krüger mit den gefüllten Gläsern eintrat, die graue Züchtlingskleidung mit einem schwarzen Anzuge von Tuch. Den eleganten Pelzrock, welchen er überzog, hatte seine Frau ihm von Bonn geschickt, um sich desselben bei der Flucht zu bedienen. „Jetzt, Herr Professor,“ sagte Krüger zu Kinkel, indem er ihm eins der gefüllten Gläser präsentirte, „sollen Sie einmal mit Ihren Beamten, die da nebenan zechen, aus einer Bowle trinken.“ Dieser Scherz erweckte trotz der Gefahr des Augenblicks große Heiterkeit. Man stieß leise an auf Kinkel’s Wohl und den ferneren glücklichen Erfolg des Unternehmens. Kinkel und Schurz, begleitet von den Segenswünschen ihrer zurückbleibenden Freunde, begaben sich darauf zu dem in der Nähe befindlichen Wagen, auf welchem der Gutsbesitzer X. ihrer harrte, und stiegen hinein.
Sie fuhren in rasender Eile durch das Potsdamer Thor, welches dem Oranienburger Thor entgegengesetzt liegt. Als sie eine Zeit die Chaussee nach Nauen entlang, einem Städtchen an der Berlin-Hamburger Eisenbahn, gejagt waren, bogen sie rechts ab in einen Nebenweg. Dies Manoeuvre führte demnächst, wie beabsichtigt, ihre Verfolger irre. Als diese am andern Tage von den Thorwächtern erfuhren, daß in der Nacht durch das Oranienburger Thor Niemand, wohl aber, daß nach Mitternacht ein Wagen durch das Potsdamer Thor in sausendem Galopp gefahren sei, glaubten sie, daß die Flüchtlinge entweder nach Nauen oder auch nach Potsdam geflohen wären, und setzten ihnen in diesen Richtungen nach.
Der Gutsbesitzer X. hatte seine stärksten und schnellfüßigsten Pferde ausgewählt. Ueber Stock und Stein ftogen sie davon. Sie passirten Hohenfelde, Nieder-Neuendorf, Henningsdorf und erreichten beim Sandkruge die Berlin-Strelitzer Chaussée. Ohne Rast und Aufenthalt ging’s vorwärts über Oranienburg, Teschendorf, Löwenberg bis nach dem acht Meilen von Spandau entfernten Städtchen Gransee. Die Flüchtlinge wollten ohne Unterbrechung weiter, um die nur noch eine Meile entfernte Mecklenburg-Strelitzsche Grenze zu erreichen. Aber es ging nicht. Die armen ausgehungerten und abgejagten Pferde, denen der Schaum vor dem Maule stand und der Schweiß stromweis heruntertroff, hätten todt niederstürzen können, wenn man ihnen nicht eine kurze Erholung gegönnt hätte. Deshalb ward in Gransee stillgehalten und gefüttert, aber ohne auszuspannen. Nach einer halben Stunde erfolgte der Aufbruch. Die braven Thiere waren durch die kurze Ruhe und die erhaltene Nahrung neu gekräftigt. Wiederum gings en pleine chasse vorwärts, bis die Flüchtlinge die Strelitzsche Grenze bei Dannenwalde erreichten. Sie athmeten hoch auf, als sie das mecklenburgische Wappen erblickten. Die dringendste Gefahr war überstanden. In Dannenwalde machten sie kurze Rast. Der Gastwirth daselbst hat später gerichtlich ausgesagt, daß am 7. November Morgens 8 Uhr zwei Fremde in einer Chaise mit zwei dunklen abgetriebenen Pferden bei ihm angekommen wären. Ihr Kutscher (es war der Gutsbesitzer X.) hätte einen großen schwarzen Bart gehabt. Das eine Pferd sei so krank gewesen, daß derselbe es mit warmem Wasser gewaschen hätte. Es wäre ihm aufgefallen, daß die Fremden mit ihrem Kutscher wie mit ihres Gleichen verkehrt hätten. Von Dannenwalde fuhren die Flüchtlinge in langsamerem Tempo nach der Strelitzschen Stadt Fürstenberg, wo sie anhalten und ausspannen mußten, weil die Pferde keinen Schritt mehr vorwärts konnten. Erst nach einem längern Aufenthalt ging die Fahrt weiter nach Strelitz, wo sie etwa um 1 Uhr Mittags bei dem Stadtrichter Petermann eintrafen. Die Pferde hatten also fast in einer Tour einen Weg von 13 Meilen zurückgelegt.
Im gastlichen Hause von Petermann ward ein solides Mittagsmahl genommen. Der Gutsbesitzer X. blieb in Strelitz zurück, um, sobald seine erschöpften Pferde es vermochten, wieder zurückzufahren. Kinkel und Schurz dagegen fuhren um 3 Uhr Nachmittags, nachdem sie sich von X. in tiefer Rührung und mit dem innigsten Dank verabschiedet hatten, in Begleitung Petermann’s weiter, der es bereitwilligst übernommen hatte, sie schleunigst nach Rostock zu expediren. Beim Tannenkruge vor Neubrandenburg wollten sie die Pferde wechseln, aber sie konnten dort keine erhalten. Sie mußten daher nach Neubrandenburg hineinfahren, wo sie sich, ohne aus dem Wagen zu steigen, frische Pferde zu verschaffen wußten. Diese brachten sie über Stavenhagen und Malchin nach Teterow. Sie kamen hier in der Nacht an und klopften den mit Petermann befreundeten Zimmermeister Zingelmann aus dem Schlaf. Derselbe zündete Licht an, öffnete die Thür und hieß sie herzlich bei sich willkommen. Von der rauhen Nachtluft durchkältet, erwärmten sie sich an der angeschürten lodernden Flamme und erquickten sich an dem ihnen vorgesetzten warmen Kaffee. Inzwischen hatte Zingelmann frische Pferde bestellt. Sie fuhren mit denselben in einer Tour über Lage nach Rostock, wo sie am 8. November Morgens zwischen 7 und 8 Uhr im „Weißen Kreuz“ anlangten.
Die Flüchtlinge fanden eine prächtige Aufnahme im Brockelmann’schen Hause. Sie wohnten zwei Treppen hoch in einem großen Salon nebst einem geräumigen Schlafzimmer. An ersteren stieß das Entréezimmer mit Balcon. Die Wohnung gewährte eine hübsche Aussicht auf den Bahnhof und das Warnowthal. Die liebenswürdigen Damen des Hauses, die Frau und die [137] erwachsene älteste Tochter, welche damals mit ihrem jetzigen Gemahl, dem Kaufmann Schwarz[1], verlobt war, wetteiferten in Aufmerksamkeiten gegen ihre Gäste. Mit mütterlicher Liebe sorgte die treffliche Frau für dieselben. Sie selbst nahm die Wunde Kinkel’s, die sich sehr verschlimmert hatte, in ärztliche Behandlung, nachdem sie von dem Hausarzt unter irgend einem Vorwande sich Auskunft über die anzuwendenden Mittel verschafft hatte. Jeden Morgen und Abend legte sie eigenhändig den Verband an. Kinkel und Schurz fühlten sich nicht wie Fremde, sondern wie Angehörige des Familienkreises. Die gesunde und kräftige mecklenburgische Kost äußerte auf den Körper Kinkel’s sehr bald ihre wohlthätige Wirkung. Sein Aussehen ward gesunder und kräftiger. Das traute Familienleben, dem Kinkel so lange entfremdet war, erfrischte auch seinen Geist. Der Uneingeweihte, welcher uns gesehen hätte, wie wir, am gemüthlichen Theetisch sitzend, mit einander lachten und scherzten, und wie der „Große“ und der „Kleine“ sich einander neckten, hätte schwerlich vermuthet, daß ein entsprungener Zuchthaussträfling und ein badischer Insurgent, auf welche die preußische Polizei mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln fahndete, an unserem heiteren Kreise Theil nähmen.
Bei allem Humor, welcher Kinkel zu Gebote stand, konnte er doch die Unruhe und Beklommenheit seines Herzens nicht ganz verbergen. Noch war der letzte Berg nicht überstiegen. Welch schreckliches Loos stand ihm bevor, wenn man seiner wieder habhaft ward! Auch der Gedanke quälte ihn, daß seine Johanna über sein Geschick im Dunkeln schwebte. Zwar hatte sie Nachrichten von der glücklichen Entweichung ihres Mannes aus dem Zuchthause erhalten. Aber sie kannte weder die von ihm eingeschlagene Route, welche nicht im anfänglichen Plane lag, noch seinen augenblicklichen Aufenthaltsort. „Welche Unruhe und Angst mag sie haben, da jede Minute ihr die schreckliche Nachricht von dem Mißlingen meiner Flucht bringen kann!“ sagte Kinkel zu mir mit tiefbekümmertem Herzen. Und dennoch mußte ich entschieden davon abrathen, ihr eher einen Brief zu senden, als bis Kinkel den deutschen Boden verlassen haben würde. Sie mußte auch die grauenvolle Ungewißheit über das Schicksal ihres Mannes noch einstweilen ertragen, da bei dem bekanntlich in Deutschland nicht gewährleisteten Postgeheimniß die Absendung eines Briefes an sie zu gefährlich war.
Kinkel hatte seine Frau seit seiner Gefangennehmung am 21. Juni 1849 zum ersten Male im Mai 1850 in Köln, wo der zu lebenswierigem Zuchthause Begnadigte noch einmal auf der Anklagebank saß, wiedergesehen und dann nicht mehr. Nachdem sie die Nachricht von seiner Gefangennehmung erhalten, hatte sie sich eilends nach Rastadt begeben, wo Kinkel in den Kasematten saß. Trotz ihrer unausgesetzten Bemühungen ward ihr der Zutritt zu ihm verweigert. Erst in Köln ward ihr die Erlaubniß, ihren Gatten wiederzusehen. Aber unter welchen Umständen! Der Staatsanwalt hatte „wegen Aufreizung zur Bewaffnung bei den Aufständen in Düsseldorf und Elberfeld“ die Strafe des Fallbeils gegen ihn beantragt. Johanna wohnte persönlich, verborgen vor den Augen ihres Mannes, den Gerichtsverhandlungen bei und war Zeugin seiner herrlichen Vertheidigungsrede, welche seine Freisprechung erwirkte. Der Eindruck dieser Rede war so mächtig, daß Alle, Richter, Geschworene, Zuhörer, Wachen, in Thränen zerflossen. „Nach dem Schlusse der Verhandlungen,“ so erzählte mir Kinkel, „bahnte meine Frau sich den Eingang zu dem Gerichtssaal. Ich sah sie auf mich zueilen, um mich zu umfassen. Die Gensd’armen traten unwillkürlich zurück. Der Oberprocurator John aber stellte sich zwischen uns und befahl ihnen, die letzte Umarmung zu hindern. Ein drohender Blick, in welchem sich mein ganzer empörter Stolz ausgedrückt haben mag, und eine gebietende Handbewegung hieß ihn bei Seite gehen. „„Johanna,““ rief ich, „„komm zu mir, hier ist Dein Platz, es soll Dir Niemand wehren, mich zu umarmen!““ Der Oberprocurator wich scheu zurück. Die Gensd’armen blieben an ihrem Platze wie gebannt, anstatt ihrem Vorgesetzten zu gehorchen. Johanna stürzte in meine Arme. Wir hielten uns Minuten lang fest umschlungen. Sprechen konnten wir nicht. Aber in jenen wenigen Minuten concentrirten sich unsere Gedanken und Gefühle während einer langen Trennungszeit. Ich entriß mich zuerst der stummen Umarmung. O, welchen Schmerz und welches Glück enthielten diese kurzen Augenblicke!“
Verschiedene entschlossene Freunde Kinkel’s hatten den Plan gefaßt, ihn in der Nähe Kölns bei seiner Abführung nach Spandau gewaltsam zu befreien. Alles war für die Ausführung dieses Plans bereit, seine Freunde standen im Hinterhalt auf dem Wege, den Kinkel ihrer Meinung nach passiren mußte. Aber der Eindruck, den er in Köln hinterlassen hatte, war so groß, daß die Behörde Befreiungsversuche befürchtete und aus Vorsicht kurz vor seiner Abführung beschloß, ihn auf einem anderen Wege, als dem anfänglich beabsichtigten, transportiren zu lassen. Wegen dieses unvorhergesehenen Umstandes mißglückte das kühne Unternehmen. Ein Fluchtversuch, den Kinkel selbst nachher auf dem Wege nach Spandau unternahm, war gleichfalls ohne Erfolg. Er machte mir darüber interessante Mittheilungen „Zwei Gensd’armen,“ so erzählte er, „begleiteten mich in einem verschlossenen Wagen. Es fing schon an zu dämmern, als wir in dem Wirthshause eines Dorfes in Westphalen Rast machten. Der eine von meinen Wächtern war hinausgegangen, der andere war mit mir allein im Gastzimmer und saß an einem Tische bei der zugemachten, aber nicht verschlossenen Thüre. Der Gedanke, die Flucht zu wagen, tauchte plötzlich in mir auf. Ich ging mit gekreuzten Armen, wie in tiefen Gedanken verloren, im Zimmer auf und nieder, den Gensd’armen fest im Auge haltend. Sobald ich sah, daß er den Blick von mir wandte und zum Fenster hinausguckte, sprang ich mit einem Satze auf die Thüre, öffnete sie, schlug sie wieder zu und verschloß sie mit dem draußen im Schlosse steckenden Schlüssel. Alles war das Werk eines Moments. Darauf schoß ich wie ein Pfeil aus der Hausthüre und lief in Windeseile querfeldein. Als ich etwa eine Viertelstunde gelaufen war, hielt ich an, um Athem zu schöpfen und neue Kraft zu gewinnen. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden. Ich glaubte in der Entfernung Stimmen zu hören, und sah verschiedene Lichter sich hin und her bewegen. Ich fing wieder zu laufen an. Die Stimmen schienen immer näher zu kommen. Immer rasender stürzte ich vorwärts. Ich erinnere mich noch, daß ich in einen Feldweg einlenkte und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand rannte. Darauf verlor ich das Bewußtsein und kam erst wieder zu mir, als sich eine Gestalt über mich beugte, mit vorgestreckter Laterne mein Gesicht beleuchtete und ausrief: „Aha, da haben wir ja wohl den Vogel!“ Kaum hatte er dies gesagt, so fing er an, laut um Hülfe zu rufen. Es dauerte auch nicht lange, daß seine Helfershelfer ankamen. Ein tiefer Schmerz durchzuckte mich, als ich das Mißlingen meiner Flucht erkannte. Der von mir eingesperrte Gensd’arm war sofort aufgesprungen, um mir nachzusetzen. Da die verschlossene Thür ihm den Ausgang wehrte, so hatte er versucht, das Fenster zu öffnen. In der Hast und Aufregung war ihm dies nicht schnell genug gelungen, und er hatte das Fenster eingeschlagen und Hülfe herbeigerufen. Eine ausgelobte Belohnung von hundert Thalern hatte auch einen zufällig dort anwesenden preußischen Postillon vermocht, mir nachzusetzen. Wegen der einbrechenden Dunkelheit hatten die Verfolger sich mit Laternen versehen. Alles dies hatte einen längeren Zeitraum erfordert und mir einen ziemlichen Vorsprung verschafft. Zu meinem Unglück war aber an der Stelle, wo ich in den erwähnten Feldweg einbog, ein aufgestapelter Haufen Holz, wovon ein Scheit etwas hervorgeragt hatte. Gegen dieses war ich in der Dunkelheit gerade mit der Stirn angelaufen. Der Stoß hatte mich zu Boden gefällt. Nachdem ich eine Zeitlang bewußtlos dagelegen hatte, ward ich von dem Menschen mit der Laterne entdeckt.“
Durch nichts konnte man Kinkel mehr erfreuen, als durch Musik. Erst jetzt begreife ich, wie mächtig ihr Eindruck sein muß, wenn nach langer, stiller Einsamkeit zum ersten Male wieder diese Zaubersprache das Ohr berührt. Wie mächtig ergriffen ward ich, als etwa ein Jahr nach meiner Verhaftung die Stille meines Gefängnisses plötzlich durch von der Straße her erschallende harmonische Accorde unterbrochen ward! Eine Musikbande, wie ich später hörte, aus Sülz, welche sehr schön und rein verschiedene Stücke auf Blasinstrumenten vortrug, hatte sich in unsere Nähe verirrt. Neue Lust und Liebe zum Leben erfaßte mich, alte theuere Erinnerungen tauchten wieder in mir auf. Die Musikanten haben es vielleicht büßen müssen, daß sie unvorsichtiger Weise den Gefangenen einen solchen Genuß bereitet haben. Ich aber habe die Erinnerung daran nicht verloren. Mit Ausnahme der Orgelklänge und des Kirchengesanges der Zuchthaussträflinge, welche ich zwangsweise genieße, habe ich seitdem nie wieder Musik gehört. Manche Entbehrungen habe ich in den letzten vier Jahren ertragen müssen, aber nichts habe ich bitterer empfunden, als die Vorenthaltung musikalischer [138] Genüsse. Im Anfange meiner Verhaftung suchte ich mir ein Surrogat zu verschaffen, indem ich einmal auf einem mit feinem Papier belegten Kamm blies und meiner Ansicht nach wundervoll phantasirte. Aber das Vergnügen ward sehr bald durch die Worte des herbeigeeilten Gefangenwärters unterbrochen: „Ich bitte Sie, Herr Advocat, was machen Sie da für einen Lärm? Hören Sie doch auf, das kann man ja in allen Zellen hören!“ Dabei fiel mir zu meinem Troste ein, wie Recht mein alter Lehrer Thibaut hatte, als er uns in Heidelberg vom Katheder docirte, daß die Rechtsregel: cessante ratione legis, cessat lex ipsa, ganz falsch sei, und daß, wenn z. B. ein Polizeiverbot wider das Singen in den Straßen zur Nachtzeit existirt, selbst eine Catalani sich nicht ungestraft über jenes Verbot hinwegsetzen dürfe. Ich war der Erste, welcher Kinkel wieder durch Musik erfreute. Der Eindruck war um so größer, als sie ihm seine Frau, bekanntlich eine Meisterin in der Kunst, mit verdoppelter Macht in Erinnerung rufen mochte. Wir waren bei Frau Brockelmann in ihrem Wohnzimmer, in welchem ein Piano stand, zum Thee versammelt. Ich setzte mich ans Instrument und phantasirte. Als ich geendet hatte, legte Jemand seine Hände auf meine Schulter und drückte mich sanft an sich. Ich drehte mich um und sah Kinkel, der sich über mich gebeugt hatte und mich liebevoll anblickte. „Haben Sie mir auch dies noch zu Liebe gethan?“ fagte er bewegt. Eine Thräne perlte ihm die Backe hinunter.
Eine Ueberraschung ähnlicher Art ward Kinkel durch den Werkführer Brockelmann’s, Namens Iben, bereitet. Es ist eine alte Rostocker Sitte, daß unser Stadmusikus am 10. November, dem Geburtstage Martin Luther’s, und den darauf folgenden Tagen mit seinen Leuten in der Stadt umherzieht und in jedem einzelnen Hause gratulirt, wofür die Bewohner durch Zahlung einer beliebigen kleinen Geldsumme ihren Dank ausdrücken. Gegen eine Extra-Remuneration werden auch einige Musikstücke zum Besten gegeben. Auch zu Ernst Brockelmann kam an einem jener Tage der damalige Stadtmusikdirector Schulz mit seinem Musikcorps. Iben hatte zufällig Kinkel am Fenster gesehen. Die Aehnlichkeit desselben mit einem früher gesehenen Portrait Kinkel’s hatte ihn frappirt und auf die stille Vermuthung gebracht, der Fremde möchte Kinkel selbst sein. Um demselben eine Freude zu bereiten und zugleich seine politischen Sympathien auszudrücken, bestellte er die Marseillaise, die denn auch auf der Diele des Brockelmann’schen Hauses von dem Schulz’schen Musikcorps mit gewohnter Meisterschaft executirt ward. Man denke sich die Ueberraschung der Flüchtlinge, als plötzlich die Marseillaise zu ihnen heraufschmetterte. Welch’ schroffer Uebergang! Aus der Stille und dem Zwange des Zuchtauslebens plötzlich hinein versetzt in die jubelnde, Freiheit athmende Welt! Das mächtige Freiheitslied war ihnen der Herold einer besseren Zeit. Als ich bald darauf zu ihnen kam, waren sie noch tief ergriffen und begeistert von dem Eindruck der Scene.
Die St. Elmsfeuer im Januar 1863.[2]
Am Nachmittag des 20. Januar hatte ich in Geschäften meine 3 Meilen unterhalb Hamburg, nicht weit von der Elbe belegene Fabrik verlassen und wurde in dem benachbarten Orte von einem heftigen Gewitter überrascht, dessen hart auf den Blitz folgender Donner seine Nähe bezeichnete und mich veranlaßte, voll Besorgniß vor Unglücksfällen nach Hause zu eilen. Unterwegs überfiel mich ein so rasender Sturm mit Graupeln, daß ich kaum vorwärts kommen konnte und mehrmals in Gefahr war, in die breiten Marschgräben zu stürzen. Endlich erreichte ich meine Fabrik, deren Anblick mir bis kurz vor dem Eintritt in den Hof durch einen hohen Marschdeich entzogen wird. Als ich den Hof betrat, sah ich voll Schrecken meine Besorgniß vor dem Einschlagen des Blitzes zur Wahrheit geworden: die Windmühle brannte an den drei oberen Flügeln. Während ich nach dem ersten Schreck näher gehend noch mit mir überlegte, welche Maßregeln gegen das Feuer bei dem rasenden Sturme zu ergreifen seien, gewahrte ich deutlicher, daß die Flammen nicht züngelten, sondern mehr wie eine Garbe emporstanden und durch das dichte Schneegestöber ungestört an demselben Platze beharrten. Freudig bewegt von der schönen Erscheinung, welche zu sehen lange mein Wunsch gewesen war, rief ich alle Hausgenossen hervor, um den Anblick zu theilen, und etwa eine Viertelstunde (6½ Uhr), konnten wir uns dem Genusse hingeben, da erlosch das Feuer plötzlich nach einem heftigen Blitzschlage mit augenblicklich folgendem Donner. Anderen Morgens vernahm ich, eine benachbarte Windmühle habe gebrannt, es seien die Spritzen und die Löschmannschaften hingeholt. Als aber nähere authentische Nachricht eingeholt wurde, ergab sich, daß der Feuerlärm nur durch die gleiche Erscheinung entstanden sei, denn habe man einen Flügel herumgedreht, um den brennenden zu fassen, so sei der untere von selbst ausgelöscht und der oben kommende sofort in Flammen ausgebrochen, auch habe man an den zugänglichen Flügeln dann weder Kohle noch Erwärmung wahrgenommen, so daß man sich endlich beruhigt und, wie das bei solchen Gelegenheiten üblich, sich lieber dem Löschen des Durstes hingegeben habe.
Der Branddirector des Districtes theilte mir an demselben Tage mit, daß in einem benachbarten Kirchspiel, Rellingen, ein großer Zulauf von Menschen stattgefunden habe, weil die Kirche in Brand gestanden, man habe den spitzen, mit Schindeln gedeckten Thurm bis ziemlich tief herunter eine geraume Zeit in lichtem Feuer gesehen, die Spritzen seien requirirt, die Archive aus den benachbarten Predigerhäusern ausgeräumt, Alles sei auf den Beinen gewesen, nachher habe man das Feuer nicht wieder finden können, aber die Nacht hindurch doch eine Wachmannschaft von 50 Köpfen bei den Spritzen postirt gehalten.
Aehnliche Vorgänge waren zu Wedel an der Elbe geschehen, und weil daher die Erscheinung ungewöhnlich große Dimensionen gehabt zu haben schienen, theilte ich meine Kunde davon in einem Localblatte mit, indem ich zugleich um weitere Nachrichten aus dem Innern des Landes bat.
Briefe aus den verschiedensten Gegenden und mündliche Mittheilungen von meinen Collegen in der wenige Tage darauf zusammentretenden holsteinischen Ständeversammlung setzen mich in den Stand, jetzt ausführlicher zu berichten.
Wenn ich bei der Aufzählung der Thatsachen von der Gegend, wo ich selbst die erste Beobachtung gemacht, also der Nachbarschaft Hamburgs, ausgehend die Nordseeküste nach Norden hin verfolge und dann im Osten wieder nach Hamburg zurückkehre, so entsteht ein geschlossener Kreis, dessen Inneres jedenfalls als Gebiet der Erscheinung betrachtet werden kann, da man keinen Grund hat anzunehmen, daß eine lineare Verbreitung einer in sich zurückkehrenden Curve eine richtigere Vorstellung des Sachverhaltes sei.
In der Nähe von Rellingen, bei dem Dorfe Egenbüttel, ist nach mündlicher Mittheilung eines Ständeabgeordneten ein kleines Tannengehölz von lichten Flämmchen so übersäet gewesen, als wäre es aus lauter brennenden Weihnachtsbäumen aufgebaut. – Aus mündlichen Mittheilungen eines anderen Abgeordneten geht hervor, daß die Mühle zu Steinburg und der Kirchthurm zu Hohenfelde, etwa drei Meilen gegen Nordwesten, dieselbe Erscheinung gezeigt haben, wie die zuerst erwähnten Mühlen und Kirchen. Beide Orte liegen ebenso wie Uetersen und Wedel am Abhange der hohen Geest gegen die Marsch, während Rellingen und Egenbüttel mitten auf der Geest belegen sind.
Herr Mühlenbesitzer J. Kahlke aus Brockdorf, zwei Meilen westlich von Steinburg, inmitten der Marsch und hart an der Elbe wohnhaft, schreibt, daß auch an seiner Windmühle die Flammen des St. Elmsfeuers beobachtet worden sind. Das Kreuz der Mühle war gerade in schnellem Gange, und das Feuer erschien an den niedergehenden Flügeln in stärkerem Glanze als [139] an den aufsteigenden. Gleich nach der Erscheinung wechselten Regen, Hagel und Schnee mit einander ab, begleitet von einem orkanähnlichen Sturme und den heftigsten Blitz- und Donnerschlagen.
Herr Theodor Dyrssen, Landmann aus Strübbel in Norderditmarschen, schreibt, daß er an dem in Rede stehenden Tage Abends mit einem Freunde, beide beritten, von dem neuen Wesselburener Koog (etwa 7–8 Meilen nordwestlich von Brockdorf) zurückgekehrt sei, dem äußersten Marschlande, welches erst im vorigen Jahre der Nordsee in der Eidermündung durch Eindeichen abgewonnen ist und gleich die furchtbaren Sturmfluthen dieses Winters zu bestehen hat. Der Nordwestwind, schreibt er, welcher schon einige Zeit dauerte, nahm gegen Abend an Heftigkeit zu und war begleitet von Regen, Schnee und Hagelschauern, auch Blitzen, aber ohne vernehmbaren Donner. Plötzlich sahen beide Reiter an den Ohren ihrer Pferde und auf ihren eigenen Köpfen Feuerflammen, ebenso an der Mündung einer geladenen Flinte, die der Eine auf dem Rücken hängen hatte. Eine freilich unbegründete, aber bei der unheimlichen Natur der seltenen Erscheiuung sehr erklärliche Furcht vor Entladung, welche dadurch gesteigert wurde, daß Beide ein Knistern der Flammen wie von einem wirklichen Brennen vernahmen, veranlaßte denselben, das Gewehr von sich zu werfen, und die große Unruhe der Pferde nöthigte Beide abzusteigen, bis nach etwa 10 Minuten mit dem Unwetter auch die Lichterscheinung verschwand.
Aus Lunden, einem kleinen Flecken abermals 1½ Meilen nördlicher belegen auf einem langgestreckten niedrigen Geestrücken inmitten der horizontalen Marsch-, und Moorfläche, schreibt Herr J. H. Arnold, welcher dem Kirchthurme gegenüber wohnt und an dessen Spitze schon zu verschiedenen Malen während gelegentlicher Sommergewitter solche Feuer gesehen hat, daß am 20. Januar der Sturm mit Regen, Hagel und finsteren, ohne eigentlichen Blitz doch aufleuchtenden Wolken längere Zeit geweht habe. Um 6½ Uhr endlich sei eine Wolke ohne Regen grade über den Kirchthurm hingezogen, und sofort sei die Thurmspitze in starkes Leuchten gerathen, welches von ihm und seinen sämmtlichen Hausgenossen längere Zeit beobachtet worden.
Der Zimmermeister Johann Christian Johannsen aus Garding in der schleswigschen Landschaft Eiderstedt, etwa 2 Meilen westlich von Lunden und ebenso wie dieses auf einem Geestrücken inmitten der Marsch belegen, befand sich zwischen 7 und 8 Uhr des genannten Tages aus dem Wege zwischen Hülkenbüll und Garding und schreibt mir, wie folgt: „Es wehte ein heftiger Sturm aus Südwest begleitet von einem starken Hagelschauer, dann und wann mit furchtbaren Blitzen und Donnerschlägen. Endlich ward der Sturm zum Orkan, so daß ich mich kaum aufrecht erhalten konnte. Auf einmal gewahrte ich an den Fingerspitzen meiner Handschuhe Feuer, und zwar so, daß bei dem Reiben der Hände es förmlich herabzurollen schien. Auch mein wollenes Tuch, das ich der Kälte wegen ziemlich dicht vor den Mund gezogen, hatte, leuchtete auf, so daß ich anfangs glaubte, Tuch und Handschuhe seien mit dem Phosphor von Zündhölzern in Berührung gewesen. Als ich aber auch meinen Speichel wie flüssiges Feuer leuchten sah und nach etwa zehn Minuten die ganze Erscheinung ohne jede Spur von Wiederkehr verschwunden war, da hatte ich sofort die Ueberzeugung, daß ich eine elektrische Erscheinung gesehen.“ –
Im mittleren Holstein ist Nortorf, an der Rendsburg-Neumünsterschen Bahn belegen, der nördlichste Punkt, von wo mir Nachricht geworden. Sehr interessant namentlich in Betreff der Intensität und der Localisirung des Leuchtens ist, was Herr Dr. Dose von da beobachtete.
„Es wird Sie interessiren,“ schreibt der genannte Arzt, „daß die am 20. dieses Monats Abends zwischen 6 und 7 von Ihnen wahrgenommene elektrische Erscheinung auch in hiesiger Gegend nicht unbemerkt geblieben ist. Großartiger und prächtiger noch sah ich das St. Elmsfeuer einige Stunden später auf einer Tour nach Böken. Auffallend war es, daß gerade während eines Schneegestöbers das Leuchten am deutlichsten erschien. Auch sah man gleichzeitig solche Gegenstände, auf welchen der Hagel vorzugsweise haftete, besonders stark phosphoresciren. So schienen der Rock meines Kutschers, die Mähne und der Schweif der Pferde eine Flamme zu sein, während Gegenstände, von denen der Hagel abprallte, z. B. das Pferdegeschirr, der Wagen u. s. w., nicht im Mindesten leuchteten.
Streifte man die Hagelkörner von der Kleidung ab, so leuchtete die Hand so lange, bis der Hagel geschmolzen war; fuhr man mit der Peitsche durch die Luft, so sah man ähnlich phosphorescirende Streifen, wie man sie auf dem vom Schiffskiel durchschnittenen Wasserspiegel des Kieler Hafens im Frühling und Herbste bemerkt. Die Beobachtung dauerte ungefähr ¼ Stunde bis gegen 10 Uhr.“
Der Großherzoglich Oldenburgische Wegeinspector des Fürstenthums Lübeck, Herr Bruhns, in Eutin schreibt mir die Mittheilung eines Postillons, den er gleich nach dem Gewitter befragt hatte, wie es ihm während desselben ergangen sei. Zusammengehalten mit den Erzählungen eines vorurtheilsfreien und aufmerksamen Arztes, welche ich eben geben konnte und welche unbedingten Glauben verdient, wird die Schilderung des Postillons, welche, wenn man sie zuerst liest, unter dem Einflusse einer aufgeregten Phantasie entstanden zu sein scheint, zum nüchternen Berichte der Wirklichkeit.
„Am 20. dieses Monats,“ so erzählte der Postillon, „fuhr ich von Eutin nach Waltersmühle. Gegen 7 Uhr Abends wurde ich auf der Höhe des Sandweges zwischen der Ottersbrücke und dem Pepersee von einem heftigen Graupelschauer überrascht, so daß ich buchstäblich keine Hand vor Augen sehen konnte. Gleichzeitig brach ein Sturm los, wie ich ihn nie zuvor erlebte. Im Kampfe mit Sturm und Hagel wendete ich mein Gesicht nach der Windseite und erschrak nicht wenig, als ich plötzlich alle Spitzen des mir zur Rechten liegenden Knicks in hellen Funken glänzen sah, die etwa die Größe von kleinen Wachsstocklichtern hatten. Einzelne derselben hoben sich von dem Knick ab und zogen mit dem Winde quer über den Weg; diese hatten eine birnenförmige Gestalt und die Spitze war nach unten gekehrt. Die Erscheinung begleitete mich auf einer Wegestrecke von etwa 100 Ruthen Länge, da aber hatte mich Wind und Wetter mit meinem Fuhrwerk in den Befriedigungsgraben geworfen. Ich suchte im Innern des geschlossenen Wagens die Laternen, welche der Sturm gleich Anfangs ausgelöscht hatte, wieder anzuzünden und das Fuhrwerk auf den Weg zu bringen; als mir beides endlich gelungen war, hatte das Wetter sich aufgeklärt, und von der Erscheinung war keine Spur mehr zu sehen.“
Herr Wegeinspector Bruhns, ein höchst aufmerksamer Naturforscher, schreibt ferner, daß um 3½ Uhr in Eutin während eines heftigen Sturmes mit Graupeln sich ein Blitz und ein Donnerschlag gleichzeitig aus der dunkeln Wolke wahrnehmen ließen. Von mehreren glaubwürdigen Zeugen wurde dabei beobachtet, daß der Blitz vom Thurme hinuntergegangen und am untern Dache nach einer Theilung erloschen sei, während weder am Blitzableiter selbst noch an dem Thurme nachträgliche Spuren des Ereignisses hatten wahrgenommen werden können. In einem späteren Briefe schreibt aber Herr Bruhns: „Fast glaube ich jetzt annehmen zu müssen, daß der Blitz, der unseren Thurm getroffen haben soll, auch St. Elmsfeuer gewesen,“ und daraus würde dann hervorgehen, daß, wie Dr. Dose um 10 Uhr, Herr Bruhns um 3 Uhr, der Eine vor, der Andere nach dem Hauptereigniß, durch vereinzelte Wolken mit entsprechenden Windbahnen veranlaßt, die Spuren der beginnenden und erlöschenden Spannung gesehen haben, während sonst die Gleichzeitigkeit des Ereignisses auf so ausgedehnten Flächen wie das ganze Herzogthum Holstein sammt einem Theile von Schleswig im hohen Grade merkwürdig ist.
Niemand bezweifelt bei dem jetzigen Stande der Meteorologie, daß die Ursache eines solchen Gewitters das Einfallen des Nordstromes in den herrschenden Südstrom oder des Südstromes in den herrschenden Nordstrom sei; niemand bezweifelt, daß entweder direct vorhandene verschiedene elektrische Spannungen oder dergleichen hervorgerufen durch die zusammenstoßenden Wärmeunterschiede und differenten Dampfspannungen alle elektrischen Meteore hervorrufen können, welche überhaupt bereits durch Ueberlieferung bekannt sind; aber fast ganz anschaulich wird es in diesem Falle, wie der jetzt in den oberen Regionen herrschende Nordstrom in den seit so langer Zeit wehenden warmen Südstrom vor und nach dem Hauptereigniß sich an vereinzelten Stellen ein Loch bis auf die Erdoberfläche herabgebohrt hat und dann zwischen 6 und 7 Uhr auf einer sehr großen Fläche gleichzeitig, also nicht von der Stätte des ersten Herabkommens weiter vordringend, sondern auf der ganzen Fläche senkrecht von oben herunter eingebrochen ist, um sofort wieder zu verschwinden, so daß der Südweststurm nur eine kleine Drehung nach Nordwest annehmen konnte, ohne Norden und Osten zu erreichen, und dann gleich wieder in seine alte Bahn zurückfiel, die Möglichkeit einer baldigen Wiederholung des Phänomens eröffnend.
[140] Aus dem mittleren Holstein schreibt mir noch ferner ein Landmann, Herr Ernst Glismann von Klein-Kummerfeld, die nachfolgende Notiz:
„An dem 20. d. M. Abends zwischen 6 und 7 Uhr passirte ich in Begleitung eines Herrn aus Altona zu Wagen die Segeberg-Neumünstersche Landstraße und zwar auf der Strecke zwischen Kummerfeld und Gadeland. Bald nachdem wir ersteres Dorf verlassen, verfinsterte durch aufsteigende, augenscheinlich von Schnee oder Hagel erfüllte Wolken der Himmel sich dermaßen, daß mein Begleiter und ich, obgleich wir Seite an Seite auf einem gewöhnlichen Wagenstuhl saßen, uns nicht durch das Gesicht, sondern nur durch das Gehör von unserer beiderseitigen Gegenwart überzeugen konnten. Indem wir noch hierüber unsere Bemerkungen austauschten, sahen wir zu unserem Erstaunen aus den Bäumen, womit hier die Landstraße an beiden Seiten bepflanzt ist, sowie auf den Pfählen und dem Draht der ebenfalls hier befindlichen Telegraphenlinien unzählige kleine Flämmchen erscheinen, so daß das Ganze, weil die Landstraße sehr weit zu übersehen und sonstige Bäume nicht vorhanden, einer über alle Maßen großartigen Illumination zu vergleichen war, nur mit dem Unterschiede, daß die in Rede stehenden Flammen, obgleich sehr glänzend und der Zahl nach Legion, nicht die geringste Helligkeit verbreiteten. Während dessen hatten die schwarzen Wolken bereits begonnen sich ihres Inhaltes mit einer furchtbaren Wucht zu entladen, was die Flämmchen aber nicht im Mindesten zu stören schien. Ueber die Dauer der Erscheinung und namentlich darüber, ob, wie bei Ihnen, die Flammen in Folge eines Blitzes verschwanden, kann ich leider nichts sagen, weil meine Pferde, sehr beunruhigt bei der herrschenden Dunkelheit, eine Zeit lang unser Beider ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, und die Erscheinung verschwunden war, als wir uns ihr wieder zuwenden wollten.“
Aus diesen verschiedenen eben so klaren als reichhaltigen Schilderungen gewinnt man ein so deutliches und anschauliches Bild des ganzen Phänomens und des St. Elmsfeuers überhaupt, wie es vorher noch nicht zu haben war, und was die Verbreitung anlangt, so ist von ganz Holstein nur die östlichste Ecke ausgenommen, denn den Anschluß der zuletzt genannten Localitäten an unseren Ausgangspunkt, in der Nähe von Hamburg, kann ich durch die mündlichen Mittheilungen zweier Ständeabgeordneten vollenden. Bei Oldesloe, südlich von Segeberg, hat der Dampfmaschinenschornstein der Sonder’schen Papierfabrik oben so geleuchtet, daß man allgemein geglaubt hatte, er brenne aus, und in der Nähe des sogenannten Ochsenzolles der holsteinischen Zollgrenze im Norden von Hamburg sind noch die mit Lichtern bestreuten Hecken wahrgenommen worden.
Auffallend bleibt mir, daß aus Hamburg und Altona gar keine Nachrichten mitgetheilt worden, obgleich doch dort die höchsten Thurmspitzen dieser Gegend vorhanden sind, und obgleich der Natur der Sache nach selbst auf den durch Sturm und Schneegestöber verödeten Straßen doch immer noch mehr Augen offen sind, als in den theilweis höchst einsamen Landschaften, die genannt wurden.
Da nun aus den öffentlichen Blättern hervorgeht, daß an demselbigen Tage ein von Stürmen begleitetes Gewitter ganz Deutschland heimsuchte, ein Gewitter, das von unseren Nordseeküsten bis an den Fuß der Alpen reichte, und da gemeldet wird, daß während dieser Zeit die Telegraphendienste größtentheils unterbrochen gewesen sind, so bleibt kein Zweifel, daß auch in Mitteldeutschland ähnliche elektrische Spannungen obgewaltet haben.
Es war mir daher auffallend, daß ich in den hier gelesenen Zeitungen von St. Elmsfeuern nichts finden konnte, und ich kam daher zu der Vermuthung, daß das Elbthal, welches außer dem eigentlichen Flusse in gegenwärtiger regnerischer Zeit durch Auffüllung aller Gräben und Niederungen in den horizontalen Marsch- und Moordistricten eine nasse Fläche von 5 bis 6 und mehr Meilen Breite darstellt, wie es im Munde des Volkes stets als Wetterscheide gilt, auch in diesem Falle eine Scheide, wenigstens für das abnorme elektrische Phänomen, geworden sei. Nun aber theilt mir Herr Carl von Wehrs, Gutsbesitzer von Alt-Böternhöfen im mittleren Holstein, auch noch positive Nachrichten über eine weitere Ausdehnung des St. Elmsfeuers mit.
„Diese Dimensionen,“ schreibt derselbe, „gewinnen durch einen mir zugegangenen Bericht aus Hannover noch bedeutend. Man hat nämlich am 20. Januar zu Jork im Altenlande, am jenseitigen Ufer der Elbe und ungefähr Wedel gegenüber belegen, anfänglich geglaubt, der Kirchthurm brenne, sich dann aber bald überzeugt, daß es ein mehrere Minuten anhaltendes St. Elmsfeuer gewesen. Dann schreibt man mir weiter, dieselbe Erscheinung habe sich zu der nämlichen Zeit an den Bäumen der Chaussée, die von Hildesheim nach Osterode führt, gezeigt, also noch anderthalb Breitengrade weiter nach Süden.“
Diese Nachricht und die überraschende Thatsache, daß auch hier noch die Gleichzeitigkeit stattfand, bestätigt, daß wir ein höchst ungewöhnliches und bedeutendes meteorologisches Ereigniß erlebt haben, und das veranlaßt mich, diese Mittheilung gerade in der Gartenlaube, welche jetzt das beliebteste Volksblatt in Deutschland ist, mitzutheilen, um dadurch vielleicht Anlaß zu weiteren Nachrichten zu geben und einem Meteorologen von Fach für die strengere Beurtheilung der Sache Material von solcher Reichhaltigkeit zuzuführen, wie es weder durch Hülfe der streng wissenschaftlichen Journale, noch durch die meteorologischen Observatorien geliefert werden kann, deren Aufzeichnungen über die gleichzeitigen Stände und Bewegungen der meteorologischen Instrumente vollständig genug sein werden, um ohne Beobachtungslücken ein vollständiges Gemälde des Ereignisses den meteorologischen Annalen zu überliefern.
Horch auf! Die Ladung! Du verschrie’ner Strich,
Land meiner Väter, ich berufe Dich!
Keck vor dem Stuhle laß Dein Banner strahlen!
Wie Forst und Strom und frischgepflügtes Land
Dreifarbig schimmern lassen Dein Gewand,
Grün, weiß und schwarz – so stelle Dich Westphalen!
Freiligrath.
Zur „rothen Erde“ will ich den Leser führen, zu einem der verschrieensten Striche Deutschlands, zum Lande der Schinken, des Pumpernickels und – des horribelsten Dialekts. Durch die Porta westphalica über die schimmernden Bleichplätze Bielefelds, durch die wogenden Kornfelder des Hellweges will ich Euch hinabführen in die schwarzen Schlünde der Kohlenwerke; ich will Euch führen zu den dampfenden glühenden Hochöfen, zu den pochenden Hämmern, in die rußigen Werkstätten der Metallarbeiter; durch die belebten, grünen Thäler geleite ich Euch auf die kahlen Höhen von Winterberg, wo erst die Junisonne den Schnee zu schmelzen vermag, wo fast jede Vegatation erstorben ist und nur der helle Ruf des Hirsches, der unheimliche Schrei des Uhu die Todtenstille der starren Natur unterbricht.
Indem wir zuerst die Industrie betrachten, müssen wir die Worte eines deutschen Dichters citiren. „Ist’s, wo der Märker Eisen reckt?“ singt Arndt in seinem Liede vom deutschen Vaterland, und Mancher wird diesen Punkt vergebens auf den Karten Deutschlands gesucht, Viele, besonders Süd-Deutsche, ihn mit der Mark Brandenburg für identisch gehalten und diese „Streusandbüchse des heiligen römischen Reichs“ mit der Grafschaft Mark in Westphalen, einer der schönsten Perlen in Preußens Krone, einer Gegend, überreich sowohl an landschaftlicher Schönheit, als auch an Schätzen des Bodens, an Erzeugnissen der Industrie, verwechselt haben. Wer auf der Kölner-Mindener, aus der Ruhr-Sieg-Bahn das Land durchfliegt, berührt die Grafschaft so ziemlich in ihren äußeren Grenzen. Belohnend ist ein Blick in diese gesegneten Gegenden, ein Aufenthalt in den unzähligen Werken und Etablissements, welche der unermüdliche, rege Geist der Bewohner hier errichtet.
Denn woher stammen die Näh- und Stricknadeln, von den schlanken, goldumränderten in den Händen zarter Damen bis herab zur starken, kräftigen Nähnadel des Schneiders? Woher die köstlichen Bronze- und Messingarbeiten, woher die Knopf- und Neusilber-, [141] die Weißblech- und Blechwaaren, woher der Telegraphendraht, die unzähligen Sorten von Eisen- und Messingdraht und Drahtnägeln; woher all’ die Pfannen, Töpfe, Sensen etc., die in keiner Haushaltung der Welt fehlen dürfen; woher die Sporen, von den feinsten Stutzersorten bis zu den groß gezahnten, scharfen und schweren der Gauchos und Maulthiertreiber Südamerikas; woher endlich der Gußstahl, der durch seine Glocken, Achsen, Stangen, durch seine prachtvollen Geschützrohre der Metallindustrie ganz neue Bahnen geöffnet und die Gegend von Bochum, wenn sie anders noch nicht zu einer weltberühmten geworden, durch die Anlage eines riesigen Walzwerkes zur Herstellung von Platten für Panzerschiffe, mit Walzen von 5 Fuß im Durchmesser, getrieben durch eine Maschine von 2000 Pferdekraft in dem Namen des „Eisenkönigs“ Krupp, zu einer weltberühmten machen wird!?
Die Grafschaft Mark ist die Wiege aller dieser Erzeugnisse, und rechnen wir hierzu noch die benachbarten großartigen Ravensberger Spinnereien und Bielefeld’s Leinwandproduction, so möchte schwerlich eine zweite Gegend Deutschlands, ja der Welt aufzuweisen sein, welche auf so engem Raume so großartige industrielle Erfolge erzielt.
Zur besseren Uebersicht dieser Industrie folgt eine genaue Aufstellung der Production der Berg- und Hüttenwerke im westphälischen Hauptbergdistricte vom Jahre 1860, wobei wir bemerken, daß nur die männlichen Arbeiter aufgeführt, Frauen und Kinder aber, beinahe ein Drittel der Arbeitskräfte, nicht mit eingerechnet sind.
| Steinkohlen: | Werth: | Arbeiter: | ||
| 21,829,172 | Tonnen | 9,351,674 | Thaler | 29,320 |
| Eisenerze: | ||||
| 871,392 | „ | 585,814 | „ | 2354 |
| Zink-, Blei-, Kupfer-, Vitriolerze: | ||||
| 208,503 | Centner | 102,470 | „ | 387 |
| Gußeisen: | |||||||
| a. | Roheisen in Gänzen | ╮ | |||||
| b. | Gußstücke | ╿ | Werth: | Arbeiter: | |||
| c. | Rohstahleisen | ╿ | 3,043,545 | Centner. | 4,669,870 | Thaler. | 4106 |
| d. | Eisengußwaaren | ╯ | |||||
| Schmiedeeisen: | |||||||
| a. | Stabeisen | ╮ | 2,493,184 | „ | 9,789,976 | „ | 7920 |
| b. | Schwarzblech | ╿ | |||||
| c. | Weißblech | ╿ | |||||
| d. | Eisendraht | ╯ | |||||
| Stahl: | |||||||
| a. | Rohstahleisen | ╮ | 343,861 | „ | 3,018,879 | „ | 7403 |
| b. | Gußstahl | ╿ | |||||
| c. | Raffinirter Stahl | ╯ | |||||
| Zink: | |||||||
| a. | Rohzink | ╮ | 237,104 | „ | 1,455,424 | „ | 981 |
| b. | Zinkweiß | ╿ | |||||
| c. | Zinkblech | ╯ | |||||
[142] Die große Ravensberger Spinnerei beschäftigte im Jahre 1858 10,760 Spindeln mit 600 Arbeitern. Die Spinnerei Vorwärts 8000 Spindeln mit 485 Arbeitern. Im Jahre 1857 wurden auf den Bielefelder Bleichen 91,407 Stück Leinen gebleicht.
Während in der Ebene des Landes die unzähligen Kohlenwerke, die meisten Puddlings- und Gußstahlfabriken liegen, beginnt mit der Gebirgslandschaft die Fabrication all’ der unzähligen Metallwaaren. Eine ameisenartige Thätigkeit lebt in jedem Winkel, jedem Abhange dieses schönen, pikoresken Berglandes. Da ist kein Fluß, kein Bach, der nicht von den emsigen Bewohnern zu ihrem Dienste gezwungen wäre. Lagert sich der Wanderer an einen Waldeshang, so leuchten ihm aus dem dunklen Grün die Ziegeldächer der Arbeiterwohnungen bis vom höchsten Bergesgipfel entgegen. Das stampft, das pocht, das prasselt, das rollt von fern und nah: hier das schillernde Brillantfeuer der Schmelzhütten, dort das Glühen der Hochöfen in dem dunklen Waldesgrün; dazu das helle Klappern der kleinen Drahtrollen und Hämmer, das Klingen des Ambos unter den taktmäßigen Schlägen der Kettenschmiede – eine Musik, die sich weit hinauf durch die unzähligen Thäler zieht, bis sie in dem rauhen Gebirgsstock, der sich in dem kahlen Astenberge gipfelt, nach und nach verstummt. Und auch hier, wo der steinige Boden nur eine kärgliche Haferfrucht gedeihen läßt, verleugnet sich nicht der industrielle Sinn der Bewohner. Was der unfruchtbare Heimathsboden auf Höhen von 2000 Fuß nicht zu liefern vermag, wird ersetzt durch den uralten Hausirhandel mit allerlei Holzwaaren, als Löffel, Mulden, Butter-, Salz- und Kaffeedosen, Butterstecher, Apothekerbüchsen, Krahnen etc. Hierzu kommen Wetzsteine zum Schärfen der Sensen und Sicheln. Jung und Alt beschäftigt sich mit dem Fabrikat dieser Gegenstände, die dann auf dem Rücken in sogenannten „Kiepen“ glücklicheren und fruchtbareren Gegenden zugetragen werden. Gestrickte wollene Waaren, Sensen, Futterklingen ergänzen unterwegs den Waarenvorrath; in ven fernsten Gegenden Deutschlands erblickt man diese wandernden Industriellen, und wenn der Volkswitz schon Columbus in Amerika einen Winterberger mit Sensen antreffen läßt, so bezeichnet dies treffend den vor keiner Entfernung zurückschreckenden Unternehmungsgeist des saarländischen Hausirers.
Die Industrie, der Handel Westphalens ist uralt. Iserlohn, gegenwärtig wohl die gewerblichste Stadt des Landes, hatte im Mittelalter eine Panzermacherzunft, welche künstlich gewebte und geflochtene Panzerhemden weithin versandte. Ob schon damals die Sucht und Notwendigkeit geherrscht, inländische Fabrikate mit ausländischem Stempel und Wappen zu versehen, wissen wir nicht; unwahrscheinlich aber dürfte es nicht sein, daß schon damals diese Hintenansetzung deutschen Gewerbfleißes an der Tagesordnung gewesen, und so mag denn auch manches Iserlohner Panzerhemde als echt mailändisches auf den Märkten von Brügge und Antwerpen, Nürnberg und Augsburg verkauft worden sein. Dortmund und Soest, beides enge Glieder der Hansa, finden wir schon im 12. and 13. Jahrhundert auf den großen Handelsplätzen des Nordens, Wisby und Nowgorod, vertreten. Jede der Städte besitzt einen von den vier Schlüsseln zur Geldlade der „gemeinen Deutschen aus allen Städten“ aus Wisby. Das ganze deutsche Binnenland wird hier somit durch westphälische Männer vertreten, und unsere Achtung vor dem Einfluß dieser soliden Emporien steigt, wenn wir eine Deputation aus Kurland im Jahr 1275 Statuten und Verfassung Dortmunds zur Gründung der neuen Stadt Dörpt (Dorpat) nachsuchen sehen. Mit dem Verfall der Hansa beginnen auch die westphälischen Städte zu sinken, und wie der 30jährige Krieg die Blüthe deutscher Nation geknickt, so auch die letzten Reste dieses kräftigen Bürgerthums. Die stolzen Thore und Thürme verfallen, der Schlüssel im rothen Felde verschwindet immer mehr aus den Flaggen der meerdurchkreuzenden Gallonen; statt 40,000 freiheitsliebender Bürger zählt zu Anfang dieses Jahrhundert Dortmund nur noch 4000 und Soest kaum noch 6000 Bewohner, von denen erstere ihren Unabhängigkeitssinn nur dadurch zu bethätigen wissen, daß sie mit aller Macht der Anlage einer Landstraße durch ihr Gebiet sich widersetzen. Sie sinken zu schmutzigen Ackerstädten herab, bis es endlich unserer Zeit vorbehalten blieb, sie zu neuem Wachsthum, neuem Leben erwachen zu sehen.
Die Literatur- und Kunstepoche des Landes datirt ebenfalls aus den ältesten Zeiten. Das Benedictinerkloster Corvei (Corbeia aurea) glänzte schon zu Anfang des 11. Jahrhunderts durch seine weltberühmte Schule, und hier in einem ihrer Scriptorien, in denen der Tacitus jährlich zehn Mal abgeschrieben werden mußte, fand man 1514 die verloren gegangenen fünf ersten Bücher der Annalen des Tacitus, deren Manuscript, wenn ich nicht irre, sich gegenwärtig in Florenz befindet, wieder auf. Daß Westphalen eingreifend gewesen in die Poesie des Mittelalters, beweist uns ein Codex des Nibelungenliedes. Nach demselben haben Männer von Soest und Münster dieses Lied nach dem Rhein gebracht; an einer anderen Stelle des Gedichts wird des Thors zu Soest, wodurch Hagen gekommen, des Gartens, durch den die Nibelungen eingedrungen, sowie des Schlangenthurms, in welchem Günther enthauptet, erwähnt.
Der Glanzpunkt der westphälischen Malerschule datirt von dem sogenannten Liesborner Meister, einem Mönche der Benedictiner-Abtei Liesborn im Münsterlande. Seine an Gold und Farbenpracht reichen Gemälde entstanden um die Mitte des 15. Jahrhunderts, sind gänzlich frei von dem Einfluß anderer Meister und Schulen und übertreffen an correcter Zeichnung, reichem Colorit und idealer Conception die meisten Werke seiner Zeitgenossen. Gleich wichtig für die Kunst ist der Name des Soester Goldschmieds, Malers und Kupferstechers Heinrich Aldegrever. Ein Schüler Albrecht Dürer’s, nennt er sich auf seinen Reisen Albert von Westphalen, weshalb man fälschlich zwei Aldegrever angenommen.
Als eigenthümlich zu Westphalen gehörend ist das Gericht der Vehme, und wir wollen diese Skizze nicht schließen, ohne dieses merkwürdigen mittelalterlichen Rechtsinstituts mit einigen erläuternden Worten erwähnt zu haben.
Manche falsche Tradition wäre dabei zu berichtigen. Hier nur so viel, daß die Vehme nur auf rother Erde, d. h. in Westphalen, bestand und nie und nirgends anders als bei hellem Sonnenlichte unter freiem Himmel gehalten wurde. Den Beinamen des „heimlichen Gerichts“ erhielt sie durch die geheim gehaltene und bis auf den heutigen Tag noch nicht gedeutete Losung der Wissenden. Der Hauptstuhl der Vehme war zu Dortmund und stand seit 1545 im Stadtgraben vor dem Burgthore. Dicht am Bahnhofe der Köln-Mindener Eisenbahn unter einer alten Linde steht noch jetzt der derbe Steintisch, an dem die Schöffen saßen und Recht sprachen. Der Tisch zeigt in grobem, verwittertem Relief den alten, einköpfigen Reichsadler als Symbol des höchsten, kaiserlichen Gerichts. Mit der Einführung des Reichskammergerichtes verlor die Vehme immer mehr an Macht und Ansehen, und dem Dortmunder Freigrafen, deren letzter, Zacharias Löbbecke, ein Glied eines alten, noch heute in Westphalen kräftig fortblühenden Patriziergeschlechts, am Dienstag nach Heil. Drei Könige 1803 zum letzten Male hier „des Königs Bank geschlossen“, lag zuletzt nur noch die Schlichtung Dortmunder Communalhändel ob.
Während der Zeit ihrer höchsten Macht fanden die Urtheile der Vehme eine prompte und energische Erfüllung durch die Weidenschlinge der über ganz Deutschland verbreiteten 100,000 Wissenden. Hatte der Stuhl zu Dortmund gesprochen, so war jede Appellation vergebens, und selbst die Kaiser, von denen mehrere, unter ihnen der galante Sigismund, im Jahre 1429 sich am Stuhle zu Dortmund als Wissende aufnehmen ließen, vermochten nicht, der einmal erfolgten Aechtung Einhalt zu thun. Als der Graf von Wernigerode, ein mächtiger Dynast, im Jahre 1383 vernehmt wurde, half alles Protestiren Wenzel’s nicht. Man hing den gräflichen Leib ohne Weiteres an einen derben westphälischen Eichenast, und für Wenzel, der die Losung verrathen, verfielen diejenigen, durch welche er sie erfahren, ebenfalls unnachsichtlich der rächenden Schlinge.
Aus einem späteren Vehmprocesse, der uns in ziemlich erhaltenen Actenstücken vorliegt, sehen wir übrigens, daß der Stuhl doch auch oft den Umständen Rechnung trug, zu friedlichen Vergleichen sich bequemte und die Wissenden nicht immer gleich unerschrockene Männer gewesen.
Ein Vasall des Grafen von der Mark, C. von Mallinkrodt auf Burg Wetter an der Ruhr (statt der Zwingthürme des Raubnestes recken jetzt, das Zeichen einer glücklicheren und bessern Zeit, hohe Schornsteine eines Eisenwerks ihre Häupter aus den Ruinen empor), wirft ohne vorherige Absage einen Dortmunder Bürger auf offener Heerstraße nieder und beraubt ihn. Ein Freund des Beraubten, [143] zugleich Wissender des Stuhls, bringt vor dem „Königsstuhl im Graben“ die Klage an, und Mallinkrodt soll vorgeladen werden. Derselbe aber, das alte „procul a Jove, procul a fulmine“ beherzigend, flüchtet nach Unna und lebt in dieser seinem Lehnsherrn zugehörigen Stadt in gemüthlicher Sicherheit, bis ihm in seiner Herberge von zwei Schöffen die Ladung der Vehme überbracht wird. Mallinkrodt, weit entfernt dieselbe mit angstvollem Respect aufzunehmen, erlaubt sich die kräftigsten Ausfälle gegen den Stuhl und bedroht schließlich dessen beide Sendboten mit derben Prügeln, wenn sie sich nochmals zu ähnlicher Ladung verstehen würden. Die Drohnug versetzt, wie aus dem Protokoll deutlich zu ersehen, die beiden Wissenden in nicht geringe Angst, und da jetzt nach dem Herkommen die Ladung zum zweiten Male dem Verklagten und zwar diesmal durch vier Schöffen überbracht werden muß, eine zweite persönliche Begegnung mit solch verwegenem Gesellen aber Leib und Seele in Gefahr bringen dürfte, so werden die vier Schöffen ermächtigt, den Brief zur Vermeidung aller Thätlichkeiten an den Grendel (Thorgatter) von Wetter zu heften. Aber wie unentdeckt hingelangen zu dem hoch und sicher gelegenen Raubneste des Verklagten? Wahrlich, sauer genug lassen sie es sich werden, diese unermüdlichen Priester der Themis. Im Dunkel der Nacht, mit Mühe und Gefahren aller Art betreten sie das gefährliche Gebiet der Burg; in dem zu den Acten gegebenen Protokolle sehen wir die wackern, wenn auch furchtsamen Männer sich an Abhängen verkriechen, hinter Gebüschen verstecken und im Schweiße ihres Angesichts Felsen erklettern, bis sie endlich glücklich und unentdeckt zu dem Burgthore gelangen und an dasselbe die Ladung befestigen.
Mallinkrodt aber, weit entfernt, der Ladung Folge zu geben, steckt sich hinter seinen Lehnsherrn, und nach langem Hin- und Herschreiben vermittelt dieser durch seinen mächtigen Einfluß einen Vergleich, nach welchem Ehren-Mallinkrodt ungestraft davon geht, in die Dienste der Stadt Dortmund tritt und gegen guten Gehalt fortan die wackern Reichsstädter ungeschoren läßt.
In unserem nächsten Artikel werden wir mehr auf einige merkwürdige Specialitäten Westphalens eingehen.
Blätter und Blüthen.
Ein Charakterbild aus dem Fürstenleben. Die durch Geist und Gemüth sieh auszeichnende Herzogin von X. feierte ihren Geburtstag in ihrem freundlichen Palais, einer kleinen deutschen Residenz, wo sie ihren Wittwensitz genommen hatte und als eine Wohlthäterin der Armen und als eine Mutter der Bedrängten so segensreich wirkte, daß ein geistreicher englischer Lord von ihr sagen konnte: „Mildthätigkeit ist ihr Synonym!“
Die Gratulationscour war eben beendet. Ermüdet von dieser ebenso langweiligen als lästigen Ceremonie hatte sich die edle Fürstin aus dem Empfangssaal in ihr Boudoir zurückgezogen. Da hörte sie leichte, eilige Schritte die Treppe heraufkommen.
„Ah ha,“ sagte sie, „das sind meine glückwünschenden Enkel!“ und so war es. Zwei frisch und munter „aufquellende“ Knaben von 10 und 11 Jahren traten ein, die wir mit den Namen Ernst und Albert bezeichnen wollen. Ehrerbietig die Hand küssend nahete sich zuerst Ernst und sprach die geflügelten Worte: „Ich gratulire Dir recht schön zu Deinem Geburtstage und wünsche Dir viel Glück! Der liebe Gott erhalte Dich recht gesund und behalte Du uns nur immer recht lieb, gutes Großmütterchen.“
„Nun,“ erwiderte die Herzogin, „das wird hauptsächlich von Euch abhängen. Wenn Ihr recht gut und fromm und freundlich und gehorsam seid, so werde ich Euch auch immer recht lieb behalten. Wie ist es denn damit gewesen, seitdem Ihr mir im vorigen Jahre an diesem Tage Glück gewünscht habt? Seid Ihr auch immer recht fleißig und gut gewesen?“
„Gewiß, liebe Großmutter,“ erwiderte Ernst und fing an aufzuzählen, was er Alles seitdem gelernt habe, während Albert bescheiden schwieg.
„Gut, gut,“ sagte die Herzogin, „aber besser als das Alles ist ein guter, frommer Sinn, den Euch Gott bewahren möge. Wie steht es denn aber mit Eurer Casse? Wie habt Ihr den Zuschuß, den ich Euch im vorigen Jahre gab, angewendet?“
Ernst zählte sogleich genau auf, was er dafür angeschafft hatte. Albert stockte dabei etwas. Aber die Herzogin schien seine Verlegenheit nicht zu merken, sondern gab jedem der beiden Enkel die gewöhnliche Festgabe von 10 Friedrichsd’or und entließ sie mit folgender Ermahnung:
„Es war einmal ein Kaiser in Rom, der pflegte zu sagen, Niemand müsse von der Unterredung mit einem Fürsten traurig hinweggehen. Er war unermüdet thätig, Gutes zu thun und für das Wohl seines Landes zu sorgen, und als er eines Abends bei der Hauptmahlzeit zu seinem Schrecken sich erinnerte, daß er an dem zu Ende gehenden Tage noch Niemandem eine Wohlthat erwiesen habe, rief er mit wehmüthigem Gefühle aus: Freunde, diesen Tag habe ich rein verloren! – Nehmt Euch diesen Kaiser zum Vorbild und lebt fürstlich wie er.“
Munter und seelenvergnügt sprangen die Knaben die Treppe hinab. Als sie am Portal angekommen waren, trat ihnen ein von Sorgen und Mühen zusammenkrümmtes Mütterchen entgegen.
„Ach meine lieben jungen gnädigen Herren,“ redete sie die Alte an, „wollen Sie nicht einer armen alten Frau eine kleine Gabe mittheilen? Mein Häuschen soll Schulden halber verkauft werden, und ich weiß dann nicht, wo ich mein Haupt hinlegen soll. Dazu ist mir noch heute Morgen, weil ich die Steuern nicht bezahlen konnte, mein Hauptnahrungsquell, meine Ziege, abgepfändet worden. Nun weiß ich gar nicht mehr, wovon ich leben soll. Sein Sie so barmherzig.“
Ernst versicherte ihr, daß er keine kleine Münze bei sich habe, und eilte von dannen. Alberten waren bei den rührenden Worten der Alten Thränen in die Augen getreten. Er schien einen Augenblick zu schwanken, dann aber griff er, nachdem er sich an die schöne Kaisergeschichte der Grosmutter erinnert hatte, rasch in die Tasche, drückte dem alten Mütterchen die zehn Friedrichsd’or in die Hand und lief, quasi re bene gesta, fröhlich davon.
Als die Alte die Hand öffnete und die Goldstücke blinken sah, war sie zum Tod erschrocken. Sie ging sogleich zum Portier, um ihm den Vorfall zu erzählen. Dieser rief den Kammerdiener. Der Kammerdiener nahm, nachdem das Mütterchen seine Erzählung wiederholt hatte, die Goldstücke und brachte sie mit den nöthigen Erläuterungen der Herzogin. Diese ließ die Alte zu sich kommen, sich deren hülflose Lage noch genauer schildern, lobte ihre Ehrlichkeit und gab ihr zu den 10 noch 2 Goldstücke. Unter hellen Freudenthränen darüber, daß sie nun ihr Häuschen frei machen und ihre Ziege wieder einlösen könne, verließ die Alte die gerührte Fürstin mit einem herzinnig dankenden „Vergelt’s Gott!“
Ein Jahr war rasch vorübergegangen; die Herzogin feierte wieder ihren Geburtstag. Wiederum war die Cour vorüber, und die beiden Enkelkinder stürmten zur kleinen Gratulationscour heran.
„Nun,“ sagte die Herzogin, nachdem die Knaben ihre Herzenswünsche, Jeder in seiner Weise, dargebracht hatten, „wie habt Ihr denn Euere vorjährige Geburtstagsgabe angewendet?“
Ernst war wieder gleich bei der Hand aufzuzählen, was er Alles davon gekauft habe. Obenan stand ein kleines Puppentheater und eine das Orchester vorstellende Ziehharmonika. Dann folgte eine Drehorgel für kleine Concerte und eine Armbrust für kleine Schützenfeste.
„Und Du,“ sagte die Herzogin zu Albert, als er verlegen schwieg, „wo bist Du mit Deinem Gelde hingekommen?“
„Ich habe – ich hin – ich –“ stotterte Albert; weiter konnte er nichts hervorbringen.
„Ich weiß schon,“ fiel die Herzogin ein, „Du bist nicht ein so gewissenhaft rechnungführender Haushalter, als Dein Bruder, und weißt daher nicht, wie er, so genaue Rechenschaft und Auskanft zu geben; aber an irgend Etwas wirst Du Dich doch noch erinnern, was Du Dir für das Geld angeschafft hast. Besinne Dich – sonst müßte ich Dir heute die gewohnte Gabe versagen.“
Albert schlug, über und über roth werdend, den Blick zur Erde nieder, rieb sich immer verlegener werdend die Hände und küßte endlich, wie wegen einer Schuld um Verzeihung bittend, der Großmutter Hand, während ihm Thränen in die Augen traten.
„Nun, nun, beruhige Dich nur, mein lieber Albert,“ sagte die Herzogin, und auch ihr waren die Thränen in die Augen getreten. „Ich weiß schon seit einem Jahre, wo Du mit dem Gelde hingekommen bist. Du hast es sehr gut, viel besser als Dein Bruder angewendet, in echt fürstlicher Weise angewendet, indem Du Thränen des Elendes damit getrocknet hast. Dein heutiges Benehmen giebt Deiner Liebesthat erst den rechten Werth. Die Linke soll nie wissen, was die Rechte thut, hat der große Menschen- und Kinderfreund im Evangelium gesagt, und seinem Wort gemäß hast Du getreulich gehandelt. Dafür sollst Du heute 20 Friedrichsd’or bekommen. Du aber, Ernst, erhältst heute nichts, komme aber morgen früh um diese Stunde wieder zu mir, da will ich Dir die Geschichte von dem römischen Kaiser noch einmal ausführlich erzählen, die ich Euch im vorigen Jahre mittheilte. Albert bedarf das nicht, denn er hat schon getreulich darnach gehandelt.“
Und so geschah es. Die Herzogin erzählte dem Enkel die Geschichte von Kaiser Titus ausführlich mit den nöthigen Nutzanwendungen und Ermahnungen, und zwar mit solchem Erfolg, daß derselbe beim nächsten Geburtstag für würdig befunden wurde, ebenfalls 20 Friedrichsd’or zu erhalten, und ein recht mildthätiger Fürst geworden ist und ein echt deutscher dazu. Exempla optime docent.
Jean Paul in Coburg. Am 21. März dieses Jahres feiert ganz Deutschland das hundertjährige Geburtstagsfest eines seiner größten Dichter und Schriftsteller, Jean Paul Friedrich Richter’s. Wird die Dankbarkeit der Nation diese Feier überall hervorrufen, wo der Geist des unsterblichen Mannes seine Saat ausstreute, so werden zu einer ganz besondern Festlichkeit sich diejenigen Orte berufen fühlen, in welchen der Gefeierte selbst geweilt, und wo sich noch eine Erinnerungsstätte an ihn erhalten hat. Zu diesen Orten gehört auch Coburg.
Jean Paul siedelte im Frühjahr 1803 von Meiningen und Hildburghausen, dessen Herzog ihm den Legationsraths-Titel ertheilt hatte, nach Coburg über. Hier verlebte er einen so schönen und glücklichen Sommer [144] und Herbst, daß seine edle Gattin und er sich noch in späteren Jahren gern dieses Aufenthalts erinnerten, und für diese ganze Zeit hat ein freundliches Geschick mir den treusten Berichterstatter gegeben – in meiner Mutter. Sie war, damals funfzehn Jahre alt, von Jean Paul’s Gattin als Dienstmädchen in’s Haus genommen worden, und sie blieb bei der Familie bis zu deren Abreise nach Baireuth.
Einem Jean Paul gegenüber ist die Bemerkung wohl kaum erlaubt, daß seine Persönlichkeit und sein ganzes ungewöhnliches Wesen auch der einfachsten Auffassung als etwas Besonderes erscheinen mußte, das bis in’s Einzelne sich zu unvergeßlichen Erinnerungen einprägte. So erging es auch meiner Mutter. Kein Ereigniß ihrer Jugend regte sie noch in den spätesten Jahren so freudig auf, als wenn sie von „Jean Pauls” erzählte und von den mancherlei „Wunderlichkeiten des guten Herrn”. Vermochte sie auch nie die eigentliche wahre Größe des Mannes zu würdigen, da ihrem Lebensgang, wie dem so vieler Millionen im armen Volke, der Blick zu den geistigen Schätzen des Lebens verschlossen blieb, so galt ihr doch der Mann als „etwas gar Seltsames unter den Menschen”, und was sie von ihm erzählte, zeugt ebenso für ihre richtige Auffassung und ihr rein natürliches Gefühl für das Große und selbst für das Dichterische, wie es auch Jean Paul’s vollkommen würdig ist. Davon möge nun hier nur das Folgende, als dem vorliegenden Zweck entsprechend, seine Stelle finden.
Jean Paul wohnte in Coburg in dem später sogenannten Prätorius’schen Hause in der Gymnasiumsgasse. Wie er aber stets für sein geistiges Schaffen während der schönen Jahreszeit auf eine freundliche Stätte in der freien Natur bedacht war, so hatte er mit seinem feinen Naturkennerauge bald auch in der reizenden Umgebung Coburgs das rechte Fleckchen für sich herausgefunden: das Gartenhaus auf der vordern Koppe des sogenannten Adamiberges. Wie später von Baireuth aus in die Rollwenzelei, so pilgerte er jeden Morgen von Coburg aus zu dieser Höhe. Im grauen Rock, eine Blume im Knopfloch, eine Mappe unterm Arm, den Stock in der Hand, auf dem Haupt die Mütze mit dem großen Schild, so sah man ihn den regelmäßigen Gang am Morgen dahin wandeln. Eine größere Mappe, einige Bücher und das Frühstück trug ihm, stets etwas später, meine Mutter nach. Bisweilen ließ er sich Mittags auch das Essen auf seinen Berg bringen. Erst gegen Abend stellte sich die Familie ein. Dann begann die Lust mit den Kindern, dann flossen ebenso schöne Lehren und Geschichten von seinen Lippen, als er in Scherz und Neckerei übersprudelte, da war er ein frommer sorglicher Vater und ein fröhlicher Mensch zugleich und glücklich in der herrlichen Fülle seines Herzens.
Als eines Morgens meine Mutter mit der vollen Mappe zu ihm in’s Gartenhaus trat, wo er an seinem Schreibtische saß, rief er ihr entgegen: „Liesle! (bekanntlich unsere fränkische Abkürzung des Namens Elisabeth) Weißt Du, was Du jetzt unterm Arm getragen hast?” – Nein, Herr Legationsrath! – „Siehst Du, wenn Du’s gewußt hättest, wärst Du am End’ davor erschrocken.” – I gar! Warum denn? – „Nu merk’ auf (Er öffnete die Mappe, in welcher viele große und kleine beschriebene Blätter und Papierschnitzel zum Vorschein kamen.) „Du hast ein ganzes Gewitter unterm Arm getragen. Siehst Du, die kleinen Blättle, das sind lauter Blitze, und die großen, das ist lauter Donner. Nu merk’ auf! Wenn Du die Mappe einmal fallen lassen solltest und der Wind jagt Dir die Blätter fort, so springe nur ja nach den kleinen, die raffe nur alle zusammen, die großen kannst Du fliegen lassen. Denn, siehst Du, den Donner, den mach’ ich selber und den kann ich immer machen, aber die Blitze kommen vom Himmel, und die kommen nicht wieder, wenn sie einmal fort sind!”
Das Gewitter, welches meine Mutter unterm Arm getragen, hat später mächtig über Deutschland gedonnert und in vielen Herzen eingeschlagen: es war das Manuscript zu den „Flegeljahren”, das Jean Paul zum größten Theil in dem Gartenhäuschen auf dem Adamiberg vollendet hat.
Noch heute steht das alte Gartenhaus unterm Schatten seiner nachbarlichen Bäume. Es wäre schön, wenn es erhalten würde und wenn der 21. März dieses Jahres Veranlassung böte, auch auf dieser Stätte des großen deutschen Geistes zu gedenken, der sie für alle Zeit geweiht hat. Eine Gedenktafel würde diese Geburtsstätte der „Flegeljahre“ am besten vor der Vernichtung schützen und sie zu einem lieben deutschen Wallfahrtsorte erheben, wie ein solcher aus so manchem einst unansehnlichen und stillen Dichterasyl geworden ist.
Erklärung. In dem zum Theil launig gehaltenen Artikel über den zoologischen Garten in Dresden (siehe Gartenl. 1862, Nr. 44) heißt es unter Anderm: daß sich das Kameel dadurch von dem Baier unterscheide, weil es größern Durst als dieser zu ertragen vermöge. Dieser ebenso wohlfeile, wie harmlose Scherz hat bei einigen baierischen Staatsbürgern eine so hohe Entrüstung hervorgerufen, daß man sich gemüßigt gesehen, derselben in öffentlichen Blättern Ausdruck zu geben. Hierauf ist zu erwidern: daß kein einsichtsvoller Patriot sein Volk für beleidigt erachten wird, sobald eine Schwäche desselben – und eine Tugend kann man die große baierische Bierliebe doch wohl kaum nennen – gegeißelt wird, zumal wenn es auf so harmlose Weise geschieht, wie in dem betreffenden Artikel. Ja es ist sogar eine Pflicht der Presse, ein Volk auf seine Schwächen und Leidenschaften aufmerksam zu machen, geschehe dies nun in ernsterer oder scherzhafter Form. Bei den Münchner „Fliegenden Blättern“ z. B. ist die harmlose Geißelung der baierischen Bierseligkeit, so zu sagen, zum stehenden Artikel geworden. Wer entsinnt sich nicht der zahlreichen dicken Bäuche, die alle jene übergroße Bierliebhaberei versinnbildlichen. Selbst in politischen Dingen, wenn Baiernland ein Wort mit redet, wie oft findet man als charakteristisches Merkmal das Biertöpfchen auf seinem Haupte! aber kein Verständiger wird hierin eine Beleidigung des so trefflichen baierischen Volksstammes erkennen, der auf der andern Seite auch wieder manchen Vorzug darbietet, auf welchen andere deutsche Bruderstämme verzichten müssen. Es handelt sich, wie gesagt, lediglich um eine Schattenseite, die ihrer Natur nach Scherz und Satire von selbst herausfordert.
Duncker’s Geschichte der deutschen Freiheitskriege in Bildern von Bleibtreu und Pietsch, die wir bereits früher zwei Mal unsern Lesern avisierten, ist nunmehr in der ersten Lieferung erschienen und enthält zwei größere Holzschnitte: „Unterredung der Königin Louise mit Napoleon“ und „Andreas Hofer’s Gebet nach dem Treffen am Berge Isel“ – beide, besonders der letztere, sehr charakteristisch und gut ausgeführt. Das Werk wird, wie wir hören, aus 10 Lieferungen, à 15 Sgr., bestehen und mit Text eines unserer tüchtigsten Historiker begleitet sein. Die Schilderung der Unterredung der Königin mit Napoleon, auf die wir hiermit aufmerksam machen, zeigt schon die kundige Feder.
Jede Blume ist ein Ton
In dem Frühlingslied, dem holden,
Jede Blume ist ein Stern,
Uns den Frühling zu vergolden.
Sorglich durch die Blätter lauschet,
Jedes Bächlein, das im Moos
Silbern über Kiesel rauschet;
Jede Lerche, die im Grau
Jedes Mädchen, das uns hold
Blaue Veilchenkränze windet;
Jeder Schmetterling, der leis
Aus der Blume Nektar trinket,
Hinter grünem Wald versinket;
Jede weiche Maiennacht,
Wo wir lauschen mit Entzücken,
Wie der warme Tropfen fällt,
Jeder Demant und Rubin,
Den der Morgen wirft auf Rosen –
Alles sind nur Melodien
In dem Frühlingslied, dem großen.
Wie kein schönres je gewesen –
Doch das Schönste bleibt ein Herz,
Das darin versteht zu lesen.
Den „Freunden der Gartenlaube“ in Moskau zur Nachricht, daß die „Deutschen Blätter“ allerdings besonders bestellt werden müssen, wenn das Postamt sich dieselben aber bezahlen läßt, es auch zur Lieferung verpflichtet ist. Wahrscheinlich hat der betreffende Beamte es unterlassen, das Beiblatt in Deutschland besonders zu bestellen; machen Sie ihn gefälligst darauf aufmerksam, daß dies nöthig sei, um es zugeschickt zu erhalten.
- ↑ WS: s. a. Berichtigung (Die Gartenlaube 1863/24)
- ↑ Es ist als bekannte Erfahrung in den Lehrbüchern der Meteorologie mitgetheilt, daß die St. Elmsfeuer (kleine, bisweilen von einem zischenden Geräusche begleitete Flämmchen, welche sich namentlich an hochliegenden, besonders spitzen Körpern bei starker Gewitterluft zeigen) bei Wintergewittern hervorzutreten pflegen. Die großartigste Erscheinung dieser Art, welche bisher in den Annalen der Meteorologie erzählt wurde, ist die vom 17. Januar 1817, wo sich in vielen Gegenden der östlichen Küste der Vereinigten Staaten Gewitter mit Regen, Schnee, Blitzen und seltenen Donnern entluden.D. Red.