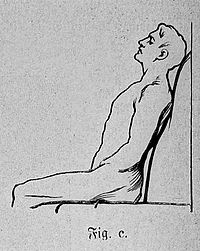Die Gartenlaube (1884)/Heft 1
[1]
| No. 1. | 1884. | |
Illustrirtes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Neujahres-Gruß.
Ein neues Jahr geht durch die Gauen,
Noch ist’s verschleiert, was es schafft,
Wir aber grüßen’s im Vertrauen
Auf Gottes Hort und eig’ne Kraft!
Den alten, treuen Gruß in’s Land,
Sie hielten aus durch alle Wetter;
Es war ein Werk von deutscher Hand.
Dem Volke sollen sie gehören,
Bis an der Berge letzte Föhren
Sein stilles treues Tagwerk thut.
Ihm sollen sie den Abend lichten,
Dem Volk – aus dessen ew’gem Grün
Die sproßenden Gedanken blühn.
Und wenn sie in gewalt’gen Bildern
Der Ferne schönen Wunderglanz,
Des Lebens heißen Ringkampf schildern –
Wir wollen scharfen Auges sehen
Weit in die weite Welt hinaus
Und dann erst mögen wir’s gestehen:
Gesegnet sei das deutsche Haus!
Und trotzig ist der deutsche Mann;
Drum muß die Liebe uns erhalten,
Was uns die Noth dereinst gewann.
Und daß sich solche Liebe stähle,
Denn leuchtend steht uns vor der Seele,
Was Alle eint – das Vaterland!
Karl Stieler.
Ein armes Mädchen.
Leise wurden beide Fenster geöffnet, und nun zog
schmeichelnd feuchtwarme Frühlingsluft in das Gemach
und spielte um ein blutjunges Frauenantlitz, das
seltsam blaß und still in den weißen Kissen des Lagers
ruhte; der Luftzug hob wie gespenstisch die volle
blonde Haarlocke auf der bleichen Stirn und bewegte die Vorhänge
einer blau verhangenen Wiege, die man, als sei sie überall im
Wege, in den hintersten Winkel des Zimmers geschoben hatte.
„Stehen Sie auf, Hegebach,“ sagte eine tiefe Frauenstimme, „Gott kann geben und nehmen, und wir müssen es geduldig tragen.“
Es war eine hohe volle Frauengestalt in den vierziger Jahren, die mit diesen Worten zu dem Manne trat, der bewegungslos vor dem Bette lag und seine Arme wie in wildem Schmerz über die Todte geworfen hatte. Er rührte sich auch jetzt nicht, und die Sprecherin wischte sich hastig ein paar Thränen aus den hellen klugen Augen.
„Hegebach, es geht nicht, Sie dürfen nicht den ganzen Tag hier liegen ohne Speise und Trank! Kommen Sie,“ fuhr sie fort, aus dem ermahnenden Tone in ein halb ersticktes Schluchzen übergehend, „kommen Sie, Hegebach, Sie haben noch Pflichten, denken Sie an das Kind!“
Er stöhnte dumpf auf und erhob sich. Er war kein junger Mann mehr, und der Schmerz ließ das bärtige Gesicht mit dem unverkennbar militärischen Haarschnitt noch viel älter erscheinen; fast unheimlich starr blickten die Augen auf das friedliche süße Antlitz, das dort so ruhig schlummerte. Dann sich jäh umwendend, verließ er sporenklirrend das Zimmer, nicht mehr ein Trauernder, sondern wie ein zürnender, ein schwer Beleidigter. – Die zurückbleibende zog still die Falten des weißen Tuches zurecht über der Todten und strich wie liebkosend über das kindliche Gesichtchen, dann holte sie die Wiege aus dem Winkel und trug sie hinaus.
Im gegenüber liegenden Zimmer schrie Etwas; sie öffnete hastig die Thür und trat in ein kleines einfensteriges Gemach, offenbar das der Verstorbenen; unendlich zierlich, wenngleich fast zu einfach für eine Dame von Stand, mit feinen weißen Vorhängen und dem Nähtisch am Fenster, durch welches man im Garten draußen die jungen zartgrünen Zweige der Linde im Frühlingswehen schwanken sah. Niemand hier innen, nur auf dem Sopha ein weißes Bündelchen, daraus ein paar winzige rothe Händchen sich reckten und ein schier hülfloses Weinen erklang.
Die große stattliche Frau lag plötzlich auf den Knieen vor dem Sopha und barg, aufweinend, ihr Gesicht in den kleinen Kissen. „Ja, ja,“ flüsterte sie, „Dir lacht’s nicht in der Welt, Du armes Ding! Keine Mutter, keine Mutter! Und Dein Vater thut, als hätte ihn Gott schwer beleidigt, daß er Dich eine arme Deern werden ließ. Warum bist Du dummes kleines Gör nicht ein Junge? Und Alles fort, natürlich! Sie lassen Dich hier schreien, und hungrig bist Du auch.“
Sie schwieg und sah einen Moment wie überlegend auf das kleine rothe Gesichtchen, das sich, kaum beruhigt, eben wieder zum Weinen verzog. „Wart nur, wart,“ sagte sie, rasch das Kind emporhebend, „ich nehme Dich mit auf die Burg; was soll er auch mit so einem Wickelkind!“
Zwei Tage später ward die junge Frau Rittmeisterin von Hegebach begraben. Ihr kurzer Lebenslauf war das Tagesgespräch im ganzen Städtchen, und wer ihn noch nicht kannte, der erfuhr gar bald, daß sie ein blutarmes Fräulein gewesen und den viel älteren, ebenfalls unbemittelten Mann nur genommen, um versorgt zu sein. Von ihm hatte Niemand mehr geglaubt, daß er noch freien würde, war er ja doch schon ein alter Knabe, und mürrisch und verdrießlich dazu. Nun war es just ein Jahr, daß er sich diesen Sonnenstrahl in sein Haus geholt – welch ein kurzes Glück!
„Wenn es überhaupt eins gewesen,“ sagten auch Manche. Der Rittmeister von Selchow versicherte indessen einigen jüngeren Cameraden auf dem Wege zum Trauerhause, er wisse aus authentischer Quelle, Hegebach’s Verheirathung sei ein coup de désespoir gewesen. Er, Hegebach, habe nämlich vor ohngefähr fünfviertel Jahren von seinem alten Erbonkel, dem Bennewitzer, einen Brief bekommen, der ihm kurz und bündig erklärte, der Onkel verspüre keine Lust, sein Vermögen einem Paar alter Junggesellen, wie seine beiden Neffen ja leider seien, zu vermachen, er wolle wissen, für Wen er gespart und gesorgt haoe. Wer von den beiden Herren ihm zuerst die Geburt eines legitimen Sohnes melde, sei der Bevorzugte. Töchter würden nicht in Frage kommen. – Hegebach’s Vetter, der von den fünften Dragonern, habe nicht geantwortet auf dies Schreiben, man munkelte von einem Verhältniß, das er nicht sogleich lösen könne. „Unser Rittmeister antwortete aber acht Tage später sehr präcise mit einer Verlobungskarte. Voilà tout! Das Weitere wissen die Herren; wir wohnen heute dem traurigen Schlusse dieser Angelegenheit bei. – War ein reizendes Weib, die kleine Hegebach; – jammervoll!“ schloß er pathetisch.
Frau von Ratenow aus der Burg hatte die junge Mutter gepflegt und auch die Honneurs im Trauerhause gemacht; es war eine entfernte Verwandtschaft zwischen ihnen. Eltern hatte die Verstorbene nicht mehr gehabt, aber der Vormund war heute früh zur Beerdigung gekommen, die Cameraden waren erschienen und die Spitzen der Behörden, und die Regimentscapelle schritt vor dem blumengeschmückten Sarge durch die winkeligen Gassen und spielte „Jesus meine Zuversicht“. Im vollsten Waffenschmuck folgte der Wittwer dem Leichenwagen; es lag auf seinem starren Gesicht nichts von Trauer, wohl aber ein Ausdruck von Weltverachtung; es war, als schürzten sich die Lippen unter dem bereits grau melirten Vollbart zu fast hohnvollem Lächeln.
Dann war auch das vorbei. Die Leute waren gegangen; auf dem Kirchhofe wölbte sich ein frischer Hügel mehr und die Straße vor dem Trauerhause lag wieder einsam; nur ein einziger Wagen hielt noch vor der Thür mit ein paar prächtigen Rappen, reicher Leute Fuhrwerk.
Im Zimmer der Verstorbenen schaukelte leise die kleine Korbwiege mit dem schlummernden Kinde; ein altes Dienstmädchen, die Hände im Schooß, saß mit rothgeweinten Augen daneben. Sie hatte vorhin die einfachen Möbel mit Tüchern verhängt; die zierlichen Deckchen, die Blumen am Fenster waren verschwunden, die Vorhänge und Teppiche verwahrt; nun sah es aus, als hätte die Bewohnerin eine weite, weite Reise angetreten, unwohnlich und verlassen.
Frau von Ratenow war in das finstere ungemüthliche Wohnzimmer des Rittmeisters getreten; sie trug schon Hut und Tuch. „Adieu, Hegebach!“ sagte sie, „ich muß nun heim, eben haben sie nach mir geschickt, der Moritz ist gekommen; und drüber und drunter ist’s gegangen zu Hause in den letzten acht Tagen. Daß das kleine Gör es gut haben wird, brauche ich wohl nicht zu versichern!“
Er hatte am Fenster gestanden und hinausgeschaut auf die enge Gasse, jetzt fuhr er herum und sah wie erstaunt zu der resoluten, noch immer schönen Frau hinüber.
„Nun ja,“ fuhr sie fort, „da ist’s nun einmal, Hegebach, und braucht Wartung und Pflege; in Ihrer verräucherten Butike hier kann doch kein Wiegenkindchen gedeihen. Ich thue es seiner Mutter zu Liebe, denn kleine Kinder bin ich just auch nicht mehr gewöhnt; der Moritz ist Zwanzig gewesen.“
„Ich danke Ihnen, gnädige Frau,“ murmelte er; „in der That – ich wüßte nicht –“
„O, keine Ursache, lieber Hegebach; wollte Ihnen nur sagen, ich bitte mir’s aus, daß Sie dem Würmchen nicht gram sind, weil Sie die Sandbüchse, das Bennewitz, nicht bekommen. Der Mensch denkt, Gott lenkt; wer weiß, wozu es gut ist!“
„Mein Vetter heirathet nächsten Monat, gnädige Frau.“
„Nun, so lassen Sie ihn doch heirathen,“ war die Antwort. „Bekommt er den erwünschten Sohn, ist das Nest und die Erbschaft sein, das wissen wir Alle längst.“
„Und das Kind!“ rief er, in das erste wilde Schmerzenswort ausbrechend und die Uniform heftig aufreißend. „Wär’ ich es nicht, die Lisa lebte noch; wär’ ich es nicht, so hätte ein Sohn in der Wiege geschrieen! Wer hieß mich auch, die Hand nach einem Glücke ausstrecken!“
„Hegebach!“ sagte Frau von Ratenow vorwurfsvoll.
„Ein armes Mädchen,“ murmelte er mit unendlicher Bitterkeit; „was das heißt in unserem Stande, heutzutage – Sie wissen es so gut wie ich.“
[3] „Schlimm genug, freilich! Wird sich aber wohl durchschlagen wie andere arme Mädchen auch, muß arbeiten lernen, hat zwei gesunde, liebe Händchen und zwei helle Augen. Wie soll’s denn heißen?“ vollendete sie ruhig. „Soll es den Namen der Mutter, Elisabeth –?“
Er nickte und wandte sich wieder zum Fenster.
„Adieu, Hegebach – wollen Sie das kleine Gör nicht wenigstens einmal ansehen?“
Er preßte die Stirn an die Scheiben und winkte hastig abwehrend mit der Hand.
„Nun, dann wünsche ich, daß dieses Kind noch einmal ein Gottessegen für Sie werde, Hegebach – daß Sie auf den Knieen für den Trost danken, den Ihnen der Herr in Ihren alten Tagen geschickt. Das möge Ihre Vergeltung sein!“
Sie ging, die Röthe der Erregung auf dem Antlitz, in das Zimmer der Verstorbenen.
„Nehmen Sie das Kind, Siethmannin, wir fahren jetzt!“
Und gefolgt von der Alten, die das sorglich in blaue Schleier gehüllte Wickelkindchen trug, stieg sie in den Wagen.
Sie hatte keinen weiten Weg zu machen; die Gasse hinunter, am alten Rathhause vorüber, welches an seinen Mauern noch die Spuren des dreißigjährigen Krieges trug in Gestalt eiserner Kanonenkugeln, durch ein paar winkelige Straßen und ein uraltes Thor, dann längs der Stadtmauer hin, über welche die Wipfel blühender Obstbäume hinweg ragten, eine prächtige Lindenallee entlang und schnurgerade auf ein gastlich geöffnetes Gitterthor zu, das die Front eines hohen massiven Gebäudes sichtbar werden ließ mit kolossalem spitzem Ziegeldach, bemoost und altersgrau. Und über dies mächtige Backsteinhaus, dessen ungefüge Mauern wie hineingebettet lagen in den Schooß knorriger Linden und Ellern, die sich auch jetzt wieder einen lichtgrünen Blätterschleier um die ehrwürdigen Häupter geworfen hatten, floß just in diesem Augenblick, als das Gefährt in den Hof rollte, ein goldiger Sonnenglanz, als wolle er das Wochenkindchen begrüßen beim Eintritt in das Haus, das ihm aus Barmherzigkeit und Mitleid eine Stätte der Kindheit werden sollte.
Mit einem Ruck hielt der Wagen vor der stattlichen Hausthür und ein junger, auffallend großer Mann, offenbar noch im Reiseanzuge, sprang die Stufen der Freitreppe hinunter, riß ungestüm den Wagenschlag auf und küßte beide Hände der Aussteigenden.
„Mutter, hätte ich das geahnt,“ sagte er, „aber in diesem Habit konnte ich doch unmöglich zum Begräbniß – Ah, Barmherziger! Was ist denn das?“ unterbrach er sich und deutete auf die Frau, die nun mit dem Kinde ausgestiegen war.
„Lisa ihr Kindchen, Moritz. – Um Gotteswillen, Du wirst es fallen lassen!“
Aber der junge Mann mit dem ehrlichen, hübschen Gesicht hatte schon das Bündelchen in den Arm genommen und trug es in das Haus, gefolgt von den beiden Frauen.
„O Gottchen, Gottchen!“ rief er drinnen im behaglichen Wohnzimmer, wie eine echte Ziehmutter, so zärtlich das winzige Gesichtchen betrachtend. „Wie das aussieht, Mutter, so klein und quappelig – meine arme, gute Lisa!“ Und er wandte sich rasch nach dem Fenster um, als wolle er nicht sehen lassen, daß die Augen ihm feucht geworden. „Da haben wir es nun, Mutter,“ fuhr er fort, „hättest Du doch der Lisa nicht zugeredet, als der griesgrämige Rittmeister um sie anhielt; sie lebte noch!“
„Moritz, Du bist ein Ungethüm!“ erwiderte Frau von Ratenow und nahm ihm das Kind aus den Armen. „Schäme Dich! Auf wen sollte das Mädchen warten? Thränen hat der große Junge in den Augen – ich kann’s nicht leiden, Moritz, wenn hinterher lamentirt wird mit Wenn und Aber. Lisa hat ihre Bestimmung als Weib erfüllt; laß sie ruhen.“
„Und die Kleine bleibt bei uns?“
„Freilich, Moritz,“ erwiderte die Mutter; „wo soll sie auch hin?“
„Das ist wieder so gut von Dir,“ sagte er und schlang seinen Arm um die stattliche Frau; „so gut, wie Du nur sein kannst!“
„Keinen Unsinn, Moritz; Du weißt, zu den Sentimentalen gehöre ich nicht,“ wehrte sie ruhig ab. „Dein Vater hatte Anlage dazu, und Du hast sie geerbt. Wie? – Du hast doch wieder einmal das theure Postgeld ausgegeben, um Deine Mutter und Deine Heimath zu begrüßen, Du kleiner Junge, Du?“
Sie gab sich Mühe, dabei geringschätzig auszusehen, aber es gelang ihr nicht; die Mutterliebe brach zu allgewaltig aus den Augen, mit denen sie den einzigen schmucken Jungen anschaute.
„Hast’s getroffen, Mutter, und Zeit hatte ich auch gerade, und daß Du nicht böse sein würdest, wußte ich ja.“
„Diese Zuversicht,“ sagte sie lächelnd; „wie gut Du mich kennst! Aber nun wollen wir die Kleine unterbringen. Was meinst Du, Moritz, ich beauftrage Tante Lott mit der Erziehung?“
„Was?“ rief er erstaunt und dennoch belustigt. „Da muß ich dabei sein! Gieb her das kleine Fräulein, ich trag’s hinauf – das muß ich sehen!“
Tante Lott war eine Pflegeschwester und Cousine der Frau von Ratenow und Stiftsdame zu Z., aber sie lebte, mit Ausnahme der vorschriftsmäßigen acht Wochen, die sie alljährlich zu Z. verbringen mußte, wollte sie ihrer Stelle nicht verlustig gehen, beständig auf der Burg. Sie war ein stilles, nicht allzu intelligentes Geschöpf, zart, blaß und ein wenig schöngeistig, und somit ganz das Gegentheil von Frau von Ratenow, obwohl die Beiden seit der zartesten Kindheit zusammen aufgewachsen waren. Tante Lott faßte alle Dinge unendlich schwärmerisch auf, sie lebte und webte in der Poesie, in höheren Sphären, „hoch über allem Erdenstaub“. Sie las Alles, was sie gerade in die Hände bekam, und je rührender und herzbrechender die Geschichte, desto schöner war sie. Sie konnte „Die bezauberte Rose“ auswendig, vom Anfang bis zum Ende, und wenn sie den letzten Vers anhub, war ihre Rührung auf das Höchste gestiegen:
„Und mir ist nichts aus jener Zeit geblieben,
Als nur dies Lied, mein Leiden und mein Lieben!“
Das war nur noch so geseufzt, nicht gesprochen.
Ja, das Schicksal hatte ihr auch einmal ein weißes Loos gezeigt, und sie zog ein schwarzes; sie hatte „ein Grab“ in ihrem Herzen, wie sie zu versichern pflegte.
Aber trotzdem, die Beiden waren immer gut mit einander ausgekommen. Als die praktische Cousine den Herrn von Ratenow freite, war Lott bei den vereinsamten Eltern geblieben, und nach deren Ableben fand sie auf der Burg ein paar freundliche Zimmer im oberen Stock des geräumigen Hauses, in denen es so altjüngferllch sauber war, daß man sich schier fürchtete, auf das glänzend gebohnte Parquet zu treten.
Eine schnurrende Mieze saß auf der Fensterbank hinter blüthenweißen Gardinen, am Kachelofen blitzten die Messingthüren wie eitel Gold, ein Spinnrädchen stand in der Sopha-Ecke mit prächtigen Schleifen verziert, und der Glasschrank war vollgestopft mit allerhand Nippes aus verflossener Zeit, das Hauptstück darin ein Chinese von Meißner Porcellan, der stundenlang mit dem Kopf wackeln konnte. Ungeheuer werthvoll sollte er sein, wie Tante Lott Jedem versicherte, der ihn bewunderte. Sie saß gerade am Fenster und las einen Psalm; sie trug ein schwarzes Kleid und ein ebensolches Taftschürzchen, denn sie hatte die so jung Verstorbene aufrichtig lieb gehabt. In eben diesem schmucken Zimmerchen war es ja gewesen, wo vor kaum einem Jahre das Mädchen weinend und verängstigt ihre Hand in die des ältlichen Bräutigams legte, den sie bei einem Besuche in der Burg, wie das große Rittergut der Ratenow’s hieß, kennen gelernt. Sie hatten Whist mit einander gespielt, und er war unartig geworden, als sie einen Fehler machte. Acht Tage darauf rasselte sein Schleppsäbel über die Treppe der Burg, er war „en grande tenue“ gekommen – um zu freien. Zwei Stunden hatte er unten im Staatszimmer gesessen in Hangen und Bangen, bis Frau von Ratenow gesagt: „Warten Sie, Hegebach, ich will dem kleinen Mädchen einmal den Kopf zurecht setzen.“ Und sie war hinaufgegangen in Tante Lott’s Stube, wo die Kleine verweint und zitternd auf der Estrade hockte und Tante Lott vergeblich mit kölnischem Wasser und Baldriantropfen gegen die aufgeregten Nerven der Begehrten zu Felde zog, welche die Werbung wie ein Blitz aus heiterm Himmel getroffen hatte.
Nach einer weiteren Stunde war sie verlobt; man hatte vorher die sonore Stimme der Hausfrau fast bis in das untere Gestock vernommen; wenigstens behauptete Moritz, der gerade zum Besuch anwesend, er habe deutlich Schlagworte wie: „anständige Partie“, – „Ansprüche“, – „worauf noch warten?“ – herausgehört. In das Stübchen nun, wo die Mutter gekämpft und gerungen, trug Moritz von Ratenow das Töchterlein und legte es ohne Weiteres in Tante Lott’s Schooß.
[4]
[5] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [6] „So, Tanting, da hast Du was, auf das die Mieze eifersüchtig sein kann.“
„Grundgütiger Himmel!“ schrie sie auf, und ihre Augen irrten von dem Kinde durch das blitzende Zimmerchen und blieben an dem blassen ernsten Antlitz der Frau von Ratenow hängen.
„Du hast am besten Zeit, Lott, nimm Dich des Kindes an; seine Wärterin, die alte Siethmann, habe ich mitgebracht, viel Last sollst Du nicht haben. Bei ihm konnte es nicht bleiben, denn Cigarren raucht’s noch nicht, und ich, Du weißt’s, kann mich nicht darum bekümmern bei der großen Wirtschaft.“
Die zarten Hände der alten Jungfer hatten sich schon während des Sprechens um das Bündelchen gelegt. Sie sagte nichts, sie vermochte es nicht, aber sie nickte mit ihrem zum Weinen verzogenen Gesicht so zustimmend und energisch, und wischte sich so inbrünstig die Augen, daß dies als vollständig genügende Antwort angesehen werden konnte. Und so rückte denn Moritz auf Vorschlag der Mutter den Schrank zur Seite, der eine Thür verdeckte, und als diese geöffnet war, zeigte sich ein freundliches blau tapeziertes Stübchen, das, sonst für Logirbesuch bestimmt, nun zur Kinderstube avancirte. Die Wiege trug Moritz hinauf, und als es dunkel geworden, saß Tante Lott mit dem Strickstrumpf und neben ihr der junge Herr von Ratenow beim Schein des Nachtlichtes an dem leise schaukelnden Bettchen, sie auf dem Stuhle und er auf der Fußbank, und sie erzählten sich flüsternd von der Verstorbenen, so eifrig, daß sie es gar nicht gewahrten, wie der Kopf der Frau von Ratenow zur Thür hereinlugte und das seltsame Paar dort betrachtete. Die graue Mieze war vorn auf die Wiege gesprungen und leckte sich die Pfötchen.
„Ein sonderbarer Jung’,“ murmelte die Mutter, die Treppe hinunterschreitend, „ein Mann mit einem Kinderherzen – ganz der Vater, natürlich – von mir hat er es nicht.“ Und sie nahm das Schlüsselbund so energisch aus dem Gürtel, daß das Klirren die Mädchen in der Küche, die sich eifrig von dem kleinen Zuwachs im Hause erzählten, eilig an die Arbeit jagte, denn die Gnädige verstand keinen Spaß.
Die Scrophulose, eine sociale Krankheit.
Die Kinderpoliklinik, deren ärztliche Leitung mir obliegt, war, wie gewöhnlich, von armen Frauen, welche die kleinen Patienten in Kinderwagen oder auf dem Arme oft stundenweit vom Lande herein brachten, fast überfüllt. Dreißig bis vierzig Mütter wollten in dieser einen öffentlichen Berathungsstunde wieder einmal Rath und Hülfe für ihre kranken Kinder einholen. Obgleich dreimal wöchentlich die Pforten unserer Anstalt sich zu gleichem Zwecke öffnen, vermögen doch wir Aerzte und die jüngern Mediciner, welche zum Studium der Kinderkrankheiten hier erscheinen, kaum die Krankenzahl zu bewältigen. Auch heute war der Zuspruch, trotzdem Schnee, Regen und ein scharfer Wind draußen um die Herrschaft stritten, ganz bedeutend. Und welche Gestalten zuweilen! Neben der sauber gekleideten verschämten Armuth, neben solchen, welche sicher bis vor Kurzem bessere Tage gesehen, welche traurige Gestalten, die, zuweilen mit zwei Kindern, ein kleineres in ein dürftiges Tuch geschlagen, ein größeres an der Hand, um ärztliche Hülfe baten.
Ein auswärtiger College, welcher bei uns als Gast verweilte, verfolgte den Verlauf der Ordinationsstunde mit einer Theilnahme, die wohl ebenso sehr aus Mitleid für die Besucher, wie aus Interesse für die sich darbietenden Krankheitsformen bestehen mochte. Insbesondere fiel es ihm auf, daß ein großer Theil der Leiden, so verschieden sie sich äußerten, von mir in den kurzen Auseinandersetzungen, die ich für die Studirenden an die Vorzeigung des Falles knüpfte, auf ein Grundübel, die ungenügende und unpassende Ernährung zurückgeführt und demgemäß vorwiegend mit hygienisch- diätetischen Vorschriften, in zweiter Linie erst mit Arzeneien behandelt wurde.
Daß solche Belehrungen den Müttern gedruckt mitgegeben wurden, daß wir, so weit dies möglich war, auch Nähr- und Stärkungsmittel verabreichten, schien unserem Gaste ebenfalls neu. Er interpellirte mich – angeregt durch dieses vielgestaltige Uebel – über mein Betonen der Scrophulose hinsichtlich ihrer Verbreitung, Tragweite und Bekämpfung. „Glauben Sie,“ so schloß er seine Anfrage, „daß die Scrophulose für den Einzelnen wirklich so wichtig ist, daß sie so sehr von socialer Noth abhängt und so energisch behandelt werden muß?“
Die Frage verlangte eine sofortige und ebenso offene Antwort. „Ich glaube es, bin seit Jahren fest davon überzeugt und bitte Sie, dies Leiden, wie es sich uns in jeder Stunde unter mannigfacher Gestalt darbietet, mit mir aufmerksam zu verfolgen. Sie werden sich überzeugen, daß wir diese Krankheit weder für den Einzelnen, noch für die Gesammtheit unterschätzen dürfen. Es ist, wie ich betonen möchte, eine sociale Krankheit.“
Wenn ein Staatsmann sich gern über eine Frage gegenüber der Volksvertretung äußern möchte, so läßt er sich am liebsten aus den Reihen der „gesinnungsvollen Opposition“ darüber „interpelliren“ oder von einem Berichterstatter „interviewen“. Wir Aerzte kommen täglich in die Lage, unerwartet interpellirt zu werden; auch in diesem Falle war die Interpellation nicht vorher abgekartet, mir aber nicht weniger willkommen. Die Veranlassung, über etwas, das man auf dem Herzen oder auf der Zunge hat, sich aussprechen zu können, ist nicht unangenehm. Das lange im Innern in immer klarer werdenden Vorstellungen und immer mehr gefestigter Ueberzeugung Erwogene nimmt Ausdruck und Form an.
Eine Frau mit einem Säugling trat in diesem Augenblicke in das Zimmer und präsentirte das Kind wegen eines leichten Katarrhs. Auf dem Kopfe, zwischen den Haaren, zeigten sich gelegentlich der Untersuchung zahlreiche, trockene Schuppen von Hauttalg. „Das habe ich schon gesehen,“ bemerkte uns die Frau, „aber eine Bekannte sagte mir, das dürfe man nicht ablösen, es komme vom Zahnen und vergehe von selbst wieder.“ Die Mutter beachtet die „Kleinigkeit“ gar nicht, oder läßt der Sache ihren Verlauf.
Wir jedoch gewahren ein fast unbeachtetes, unscheinbares Leiden, das von sehr verhängnißvollen Folgen sein kann. Diese Hauttalgkrustchen erregen einen Entzündungsreiz auf der Kopfhaut; unter ihnen sammelt sich Flüssigkeit an, die schließlich zu einem chronischen nässenden Kopfausschlage führt, einem der häufigsten Ausgangspunkte der Scrophulose. Denn überall, wo größere Hautflächen nässende Absonderungen zeigen, bilden sich im Gebiete dieses Hautbezirks, durch Aufsaugung der krankhaften Stoffe, Lymphgefäß- und Lymphdrüsenanschwellungen, in diesem Falle also unter der Kopfhaut und am Halse.
Gleich das nächste Kind zeigt am Kopfe und zum Theil auch im Gesicht in größerer Ausdehnung solche mit reichlicher Flüssigkeitsabsonderung verbundene Ausschläge und natürlich wieder jene stark geschwollenen Nacken-Lymphdrüsen. Auf die Frage: „Wie lange besteht dies?“ erhalten wir von der Mutter, einer handfesten Bäuerin, den Bescheid: „Seit mehreren Wochen.“ Und auf die Frage: „Warum haben Sie nicht früher dazu gethan?“ wird uns die Auskunft zu Theil: „Bei uns heißt es, daß das gerade gesund ist. Da kommt alles Schlechte aus dem Körper heraus, und wir wollten es nicht durch eine Cur wieder hineintreiben.“
Und mit solchen unsinnigen Anschauungen muß man täglich kämpfen, ohne Aussicht, sie gründlich besiegen zu können. Wenn es auch in einem Falle gelingt, den Drachenkopf des Aberglaubens, des althergebrachten, gedankenlosen Vorurtheils, mit dem scharfen Schwerte der Ueberzeugung abzuschlagen – an hundert anderen Stellen wächst genau so schnell und gewaltig ein neuer. Diese Hydra ist eben unausrottbar.
In unserem Falle ist die Unkenntniß von der Tragweite dieser schon wochenlang bestehenden Drüsenanschwellungen nach einem derartigen Kopfausschlage für das Kind sehr ernst. Schon ziehen sich Drüsenknoten, äußerlich fühlbar, bis an das Schlüsselbein, innen jedoch – unserem Finger nicht mehr zugänglich – bis in den Brustraum hinab. Schon sind einzelne Drüsen in einer höchst gefährlichen Umwandelung, die man „Verkäsung“ nennt und die ein Uebergang zur Tuberculose ist, begriffen. Andere sind zu eitrigen Abscessen geworden, die im günstigsten Falle bleibende, entstellende Narben hinterlassen. Die Gefahr einer Selbstansteckung des Körpers, von diesen erkrankten Drüsen aus, [7] droht bereits schwer, aber ahnungslos läßt man die Quelle dieser Gefahr, den ersten Anfang des Uebels, bestehen.
„Sehen Sie sich das nächste Kind an! Es ist ein ‚Ziehkind‘, dürftig, mager, blaß. Zahlreiche Furunkel bedecken seine Haut, die Mundhöhle ist erfüllt von den sogenannten ‚Schwämmchen‘, jenen Pilzwucherungen, welche durch ungenügende Reinigung der Mundhöhle, zumal durch die unglückseligen Gummihütchen, die Nachfolger des einstmaligen ‚Zulp‘, zu entstehen pflegen. Die Krankheit der Mundschleimhaut und die zahlreichen kleinen Abscesse der Kopfhaut haben auch hier bereits zu Drüsenverdickung am Halse geführt. Schon sind diese Depots krankhafter Stoffe, vergrößert und entzündlich gereizt, deutlich, aber ihre Gefahr scheint der ‚Ziehmutter‘, die das Kind natürlich, wie immer, ‚gleich so bekommen hat‘ und ‚alles Mögliche an dasselbe wendet‘, unbekannt zu sein. Das bedauernswerthe kleine Wesen zählt sein Dasein nur noch nach Tagen; wäre frühzeitig sein Leiden erkannt und beachtet worden, so konnte es noch erhalten werden. Nunmehr ist bereits die Drüsenscrophulose in vollem Gange und vollzieht ihren traurigen Weg durch ihre verschiedenen Grade.“
Mehrere Kinder mit Husten und Darmstörungen folgen jetzt. Anscheinend haben sie wenig mit Scrophulose zu thun; und dennoch ist es der Fall.
Das Eine leidet bereits mit größter Wahrscheinlichkeit (und die Section wird es wohl bestätigen) an Drüsenschwellungen in der Nähe der Hauptäste des Luftröhrensystems; ein steter Reiz zum Husten legt den ersten Keim zur Erkrankung der noch so zarten Lungen. Das Andere, das mit Kaffee, Mehltrank und Semmel aufgepäppelte Kind eines leider schon seit Wochen beschäftigungslosen Handarbeiters, hat in Folge dieser ungeeigneten Kost bereits eine Scrophulose der Darmdrüsen. Sein Darmkatarrh, sein angetriebener Leib, seine abgezehrten Arme und Beine, sein elendes Aussehen, das einen seltsamen Contrast zu dem auffallenden Heißhunger bildet – Alles das vereinigt sich zu einem Gesammtbilde sogenannter „Cachexie“, einem Siechthum, welches meist durch Uebergang in Tuberculose oder durch Entkräftung zum Tode führt.
„Liebe Frau!“ ermahnen wir. „Sie dürfen dem Kinde, wenn es erhalten bleiben soll, die bisherige Kost nicht mehr geben, müssen mehlhaltige Nahrung meiden und vorwiegend gute Milch, wohl auch Griessuppen von Fleischbrühe, oder Eiwasser geben.“ Mit diesem schönen Rath und ganz speciellen gedruckten Anweisungen über das gesammte Verhalten, über Bäder und Luftgenuß etc. glauben wir unsere Pflicht erfüllt zu haben. Und zum Ueberfluß geben wir noch einige geeignete Nährmittel, wenigstens für die nächsten Tage genügend, mit. Und doch ist Alles dies, so segensreich schon dieser Fortschritt gegen sonst ist, nur eine flüchtige Wohlthat, nicht bedeutender als ein Tropfen im Meere. Denn die abgehärmte Frau entgegnet uns einfach:
„Das Alles können wir nicht erschwingen und nicht geben! Mein Mann verdient gar nichts.“
Dieses „Non possumus“, dieses starre, eiserne „Unmöglich“ verurtheilt das Kind fortdauernd zu einer ganz unzureichenden und unpassenden Nahrung und damit zu der Abzehrung, die an die Darmdrüsen-Scrophulose sich anschließt.
Der nächste kleine Patient, ein größerer Knabe, wird uns von der Großmutter zugeführt. Sein gedunsenes Gesicht, seine kolbige Nase und wulstige Oberlippe, die gerötheten Augenlider zeigen uns, schon ehe wir die angeschwollenen Drüsen fühlen, den sogenannten „scrophulösen Habitus“. Die kinderreiche Familie, Groß und Klein, Gesunde und Kranke, bewohnen ein einziges Zimmer in einer des Lichtes und der Luft entbehrenden Hofwohnung. Fast alle Kinder der betreffenden Familie sind blaß und leidend, der Knabe am meisten. Hautleiden und Katarrhe der Athmungsorgane lösen sich bei ihm ab; die fortdauernde Neigung dazu liegt wieder in der Erkrankung der Lymphgefäße und -drüsen, die in den Weichen und der Achselhöhle, zu kleinen „Paketen“ vergrößert, sich bemerkbar machen.
Ein zweites Opfer trauriger Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse schließt sich an: ein dreijähriges hübsches blondes Mädchen, dessen blasses, aber anscheinend wohlgenährtes Gesicht kaum eine schwerere Krankheit ahnen läßt. Und doch ist dem so. Einzelne Fingerglieder sind wohl um das Dreifache verdickt, aufgetrieben und geröthet; ebenso das Gelenk eines Fußes, und an dem Schienbein des Unterschenkels befindet sich ein von monatelangem Knochenleiden herrührender Fistelgang. Diese örtlichen Leiden sind theils durch Entfernung kranker Knochentheile bereits in Heilung begriffen, theils steht der chirurgische Eingriff, welcher sicher zur Besserung führt, noch bevor. Das Grundübel – die Scrophulose – bleibt leider, und damit die Schwierigkeit vollkommener Genesung.
Ein kleines, möglichst aufgeputztes Tragekindchen ist der nächste Patient. Obwohl erst ein halbes Jahr alt, mußten ihm doch schon Ohrlöcher gestochen werden, denn es ist ja einmal so Sitte, und es hatte ja Ohrringe (noch dazu unechte) geschenkt bekommen. Sofort hat sich daran, wie bei allen Hautverletzungen von Kindern, die bis dahin noch keine sichtbare Scrophulose darboten, das Auftreten eines Ausschlags der Ohrmuschel und Drüsenverdickung am Halse geschlossen. Gegenwärtig sind die schönen Ohrringe kaum sichtbar in der entstellenden Umgebung. Die redselige Mutter schiebt es natürlich auf das „Impfen“. „Gleich nach dem Impfen bekam das Kind auch auf dem Arme Hautausschläge und die Achseldrüsen schwollen.“ Daß hier nicht das Impfen und der Impfstoff die Schuld tragen, sondern die Körperbeschaffenheit des Kindes, die auf jede, wenn auch kleine Hautwunde mit offenem Auftreten der wohl schon angeborenen Scrophulose antwortet, das sieht natürlich die Frau nicht ein.
Den Schluß unserer poliklinischen Sprechstunde bildet heute ein blutarmes, schmächtiges Schulmädchen von durchsichtiger Haut und flacher Brust. Sein kurzer, trockener Husten, an dem wir es schon wochenlang vergeblich behandeln, beruht auf Lungentuberculose. Die Mutter war als Kind drüsenleidend, der Vater ist im Hospital an Schwindsucht gestorben, und an zwei Kindern aus derselben Familie haben wir bereits die tödtlich verlaufende Miliar-Tuberculose des Gehirns und vieler anderer Organe, die sich an scheinbar ganz geringe Drüsenleiden anschloß, beobachtet. Auch dies zarte Mädchen hat noch deutliche Nackendrüsen; sein Erbtheil, die Scrophulose und die aus ihr hervorgegangene Tuberculose, werden, unseren Bemühungen zum Trotz, das Kind dahinraffen; wir haben es auf die Liste der nächsten Feriencolonie notirt, wenn es dann noch am Leben und hierfür geeignet ist.
Das Stündchen in der Kinderpoliklinik schloß damit ziemlich ernst ab.
„Sie haben sehr Recht,“ äußerte mein Gastfreund. „Ich sehe dieses Leiden doch jetzt von anderem Gesichtspunkte an. Ihre Gallexie verschiedener Scrophuloseformen zeigt wirklich, daß wir hier keine unbedeutenden Krankheiten Einzelner, sondern eine Art Volkskrankheit vor uns haben. Aber als ‚praktischer‘ Arzt möchte ich fragen: Was ist zu thun?“
„Diese Frage rein ärztlich zu beantworten, ist nicht leicht. Wir haben, wie Sie sehen, zunächst allerdings ein Leiden vor uns, das in den verschiedensten Formen, oft scheinbar nur örtlich und unbedeutend, das einzelne Kind betrifft. Allein es ist meist nicht örtlich, sondern ein Allgemeinleiden des Körpers, das nur örtlich zum Ausdruck gelangt. Das Wesentliche bei der Scrophulose ist, daß sie, selbst wenn sie bei dem einzelnen Kinde noch nicht durch Ererbung vorhanden ist, sich aus den unscheinbarsten äußeren Leiden, aus Verdauungsstörungen, ungünstigen Ernährungs- und Wohnungsverhältnissen entwickelt, daß aber die ausgebildeten Drüsenleiden nur die Brücke für Abzehrung oder für Tuberculose bilden. In ununterbrochener Kette schließen sich an einen scheinbar ganz harmlosen Kopfausschlag Furunkel, Drüsenanschwellungen, Entartungen der Drüsen, allgemeiner Körperverfall, Tuberculose an. Unmerklich wird von einer kleinen Körperstelle aus die Gesammtheit des Körpers ergriffen und das Individuum ist verloren. Es ist also, wie schon die wenigen Fälle, die heute zu unserer Beobachtung kamen, zeigen, wenn man sie im Zusammenhange beobachtet, gar nicht ausschließlich ein persönliches Leiden. Ganze Familien, ganze Generationen sind davon befallen. Die Ehen Solcher, die als Kinder ausgesprochen scrophulös waren oder später Tuberculose zeigten, sind nicht nur ein Leichtsinn, sondern ein Verbrechen an der Menschheit. Die Sprößlinge solcher Ehen tragen das Kainszeichen der ererbten Scrophulose und vererben es auf die Enkel. Ganze Geschlechter entarten, wenn nicht sehr günstige Lebensverhältnisse und gesunde Ehen der Nachkommen diese Spuren wieder vertilgen.“
„Also aus diesem Grunde halten Sie es für eine sociale Krankheit?“
[8] „Nicht nur deshalb, sondern auch weil die Ursachen und die Folgen sociale Bedeutung haben. Die Ursachen fallen, in letzter Linie, wie immer mit der Geldfrage zusammen. Nachlässigkeit, Mangel an Einsicht oder Kenntniß ließen sich schließlich durch Belehrung beseitigen. Aber die thatsächliche Unmöglichkeit, die trefflichsten Rathschläge zu befolgen, beruht nur in der Armuth. Noth und Sorge sind die Eingangspforten für die Scrophulose; über die Schwelle des Hauses Reicher oder selbst gut Situirter wagt sie sich nur verstohlen. In solchem Hause wird sie rasch entdeckt und energisch daraus vertrieben. Desto hartnäckiger setzt sie sich da fest, wo das große sociale Leiden, die Erwerbs- und Mittellosigkeit, hausen. Sociale Gegensätze sind es, die hier die Hauptrolle spielen und dem Streben des Arztes, wenigstens in seinem engeren Kreise zu helfen, fast unübersteigliche Hindernisse bieten. Social ist aber nicht blos die Entstehung, sondern auch die Tragweite der Krankheit, welche jährlich, ganz in aller Stille und ohne das lärmende Aufsehen von Epidemien, Tausende von jugendlichen Individuen vorzeitig dem Gemeinwesen entzieht, Tausende, als hülfsbedürftig und halbinvalid, seiner Unterstützung aufbürdet. Verringerung der Zahl und des Werthes an Arbeits- und Wehrkräften, directe Kosten für den Staat – Alles dies sind die letzten Consequenzen einer derartigen Krankheit, nach welcher die Kinder, wenn sie ihr nicht frühzeitig erliegen, zu untüchtigen, hülfebedürftigen Menschen heranwachsen und Familiengeschlechter entarten.“
„Wird auch gegen dieses mehr schleichende Uebel nicht der ganze Landsturm der öffentlichen Gesundheitspflege aufgeboten, wie bei Cholera, Typhus oder Diphtherie, seine verheerende Wirkung, die sich lautloser vollzieht, verdient trotzdem die vollste Beachtung. Sociale Massenleiden beseitigen, die Armuth aus der Welt schaffen zu wollen, wäre ein thörichtes Beginnen. So lange Menschen auf Erden im ‚Kampfe um’s Dasein‘ ringen, werden solche Gegensätze nicht zu heilen sein. Der Hebel kann nur bei dem Einzelnen, bei dem Individuum, bei der Familie angesetzt werden. Belehrung, Aufklärung und Hülfe im nächsten Kreise, Erkennen und Beseitigen des Uebels in seinem Beginne – das sind nicht nur für jeden Arzt, sondern für jeden gebildeteren Menschenfreund schöne und, in bescheidenen Grenzen, auch lohnende Aufgaben. Mit jedem Kinde, das man bei Zeiten und energisch vor der Scrophulose schützt oder von ihr befreit, erweist man nicht nur diesem, sondern dem Gemeinwesen und den eventuellen Nachkommen eine Wohlthat. Die kleinsten Anfänge ernst zu nehmen, kräftig einzuschreiten und möglichst mit Wort und That belehrend zu wirken, ist bei einer solchen Volkskrankheit das einzig Richtige und das läßt sich nur durch volksthümliche Auseinandersetzung und praktische Hülfe mit geeigneten Nährmitteln anstreben.“
„Sie sehen“ – so schloß ich meine Erörterungen – „daß unsere ‚Kinderpoliklinik‘ mit ihren Grundsätzen und Einrichtungen, wenn auch nur im Kreise ihrer unmittelbaren Umgebung, manches Gute stiften kann, und daß es nur zu wünschen wäre, wenn diese blos durch milde Beiträge erhaltene Anstalt von begüterten Kinderfreunden thatkräftiger unterstützt würde, um durchgreifender nützen zu können. Unsere auf lose Blätter gedruckten ‚Hygienisch-diätetischen Belehrungen‘, die wir den Müttern gratis mitgeben, unsere Nährmittel, die wir vertheilen, alles Dies könnte so viel Gutes stiften; aber auch unsere Anstalt leidet an dem ‚socialen Uebel‘. Unsere Mittel erlauben uns nicht, so zu helfen, wie wir es für gut und nöthig halten.“ – –
Daß es wünschenswerth und lohnend ist, die Bestrebungen des Kampfes gegen die Scrophulose zu unterstützen und das, weß das Herz voll ist, angesichts von Thatsachen auszusprechen, bedurfte wohl keiner Rechtfertigung. Gerade diese Seite der Kinderhygiene liegt sehr im Interesse Aller und verdient bei dem jetzt wissenschaftlich feststehenden Zusammenhange der Tuberculose mit der Scrophulose die vollste Beachtung.
Diejenigen aber, welche dies gelesen und damit im Geiste
einer öffentlichen Berathungsstunde unserer Kinderpoliklinik beigewohnt haben, werden gewiß dem Streben dieser und ähnlicher
Anstalten dadurch mit erhöhter Theilnahme folgen. Unsere Grundsätze
verdienen in weitere Kreise getragen zu werden. Es ist aber
nicht genug, ihre Wahrheit zu erkennen. Man muß selbst Hand
und Herz offen halten und sie fördern; dann löst man auch eine
„sociale Frage“. Dr. L. Fürst (Leipzig).
Ditta’s Zopf.
Ditta Ceprano saß vor der Thür ihres grauen dickwandigen Steinhäuschens im Dorfe Palenella am Fuße der waldig finsteren Abruzzen und schälte und spaltete Weidenruthen zur Ausbesserung eines sehr schadhaften großen Korbes, der neben ihr stand.
Es war ein warmer Aprilnachmittag, und heiße Sonne lag auf den Wäldern und dem Marmorfelsen, an welchen die kleine Häuserreihe des Dorfes sich lehnte und in dessen Ritzen Aloes ihre blaugrünen spitzen Blätter entfalteten und wilde Rosen oft einen wahrhaften kleinen Regen von rosa Blüthen und Blumen herabsendeten bis zu den flachen Dächern der dürftigen Wohnstätten, auf welchen Maiskörner und Getreide ausgebreitet lagen.
Die steinige Dorfstraße war leer und still, nur einige Hühner spazierten im Sonnenschein, und in den staubigen Löchern des Weges lagen hier und da kleine schwarze Schweine, alle Viere von sich gestreckt, und schliefen. Ganz Palenella war nach dem Städtchen Palene gegangen, um an einer Procession sich zu betheiligen – nur Ditta Ceprano war zu Hause geblieben.
Das wunderte keinen Menschen, denn dies Mädchen galt für „toll“. Ditta hatte die Hand der reichsten und „vornehmsten“ jungen Männer des ganzen Bezirkes ausgeschlagen, sie besaß Vermögen und arbeitete wie die Armen, sie tanzte nicht Tarantella, sie war nicht lustig, sie wollte keinen Geliebten haben, sie schlug ihren Maulesel nicht, auch wenn er störrig war – jede einzelne dieser Ungeheuerlichkeiten genügte, um in dem einsamen, verödeten, weltabgelegenen, in der Cultur um fünf Jahrhunderte zurückgebliebenen Dorfe den Ruf der Verrücktheit einzutragen. Zu alledem war dies Mädchen noch schön und zwar von einem Aeußeren, das von all dem, was man in der ganzen Provinz bis Neapel zu sehen gewohnt war, das gerade Gegentheil bildete.
Die Frauen hier waren klein, behende, zierlich, mit niedlichen, tiefbraunen Gesichtern, kleinen, scharfen Nasen, aufgeworfenen Lippen, niedrigen, von wildem Kraushaar bis an die Augen umwirrten Stirnen. Stets lustigen Wesens schwatzten und lachten sie den ganzen Tag, und ihr Charakter setzte sich zusammen aus [9] einer seltsamen Mischung von Leichtsinn und Berechnung, von Leidenschaft, Schlauheit und Beschränktheit – Ditta dagegen hatte eine große volle Gestalt, ein längliches Gesicht, glatte schwarze Haare und ganz sonderbar ruhige, tiefbraune Augen, die nachdenklich auf allen Dingen hafteten, und einen wohlgeformten vollen, jedoch fest geschlossenen Mund; ihre Bewegungen waren langsam, ihr Gang edel und gemessen, sie war das ungeselligste Mädchen im Dorfe und sprach nie mehr, als sie nothwendig sprechen mußte.
Natürlich hatte dieser Gegensatz zuerst, als das Mädchen sich entwickelte, allen Burschen zehn Stunden im Umkreis die Köpfe verdreht, und Ditta bekam Anträge, so viel es Sonntage im Jahre gab. Denn die jungen Männer wurden nicht allein durch des Mädchens Schönheit angezogen – Jedermann wußte auch, daß Ditta zehntausend Lire auf der Banca Nazionale in Rom besaß – außer dem ziemlich großen Anwesen hier, das schuldenfrei ihr gehörte – ein für die Verhältnisse in jener Gegend gewaltiger Reichthum! Aber Ditta ließ die jungen Leute ruhig aussprechen, dann sah sie die Freier mit ihren mächtigen, stillen, durchdringenden Augen eine Secunde lang fest an und erklärte, daß sie überhaupt nicht heirathen wolle. So ging das von Ditta’s fünfzehntem bis zum zwanzigsten Jahre – alle Sonn- und Feiertage einen Antrag und alle Sonn- und Feiertage einen Korb, bis Ditta gar keine Antworten mehr gab, sondern nur noch eine verächtliche Handbewegung für die Bewerbungen hatte.
Das verdroß nun endlich auch die „Buben“ – sie erklärten Ditta für toll, und seit einem Jahre hatte sie Ruhe. Nur einer, der Sohn eines reichen Gutspächters weiter oben in den Bergen, ließ sich durchaus nicht abschrecken und verfolgte das Mädchen mit wilder Beharrlichkeit. Bei allen Festen und Processionen, in der Messe und auf dem Markte in Palene lauerte er ihr auf und schmeichelte, bat, drohte, bis Ditta zu keiner Feierlichkeit mehr ging und selbst die Kirche nur Abends spät verstohlen besuchte. In der Befürchtung, den aufdringlichen und ihr wegen seiner ungebändigten, wilden, rohen Natur besonders verhaßten Bewerber auch heute in Palene zu treffen, hatte sie vorgezogen, zu Hause zu bleiben und ihre Mutter für sich beten zu lassen.
Jetzt ertönte Stimmengewirr aus der Tiefe, Lachen, Schwatzen klang den Felsweg herauf, der zu der Ansiedlung führte, und ein ganzer Schwärm lustiger Menschen, untermischt mit Kindern, Ziegen, Hühnern und den hier nie fehlenden kleinen Schweinen, betrat die Dorfgasse, um sich zwischen den hier und dort an den Felsen geklebten Häusern zu verlieren.
Ditta hatte sich bei der Annäherung der Leute in das Haus begeben und daran gemacht, die Polenta für die Mutter zu wärmen. Sie stand in der großen steinernen, schwarz geräucherten Wohnstube, die zugleich Küche war, und die flackernden Spähne beleuchteten ihr ernstes, großes Madonnengesicht.
Die Mutter war eingetreten. Die grauhaarige, verwitterte alte Frau mit den kleinen, scharfen Glühaugen warf einen fast wilden Zornblick auf das Mädchen.
„O die Schande!“ rief sie aus, das rothseidene Brusttuch ablegend und einen strohgeflochtenen Stuhl heftig mit dem Fuße fortschleudernd. „Ich allein werde eine unverheirathete Tochter im Hause haben – Alles zeigt mit Fingern auf mich. Ich bin die Mutter der ‚Verrückten‘,“ fuhr Frau Ceprano fort. „Ich darf mich schon nirgends mehr sehen lassen.“
„Bah!“ machte Ditta, ohne vom Feuer aufzusehen. „Vor wem Dich nicht mehr sehen lassen –?“
„Vor unsern Nachbarn, vor der ganzen Gemeinde, vor allen Leuten weit und breit,“ gab die Alte heftig zurück.
„Kümmere Dich nicht um das Gerede der Leute, Mutter, und zwinge mich nicht zu einer Heirath! Ich kann keinen von den Burschen hier nehmen!“ sagte Ditta ruhig.
„Schließlich wird man Dich zwingen,“ warf die Mutter dagegen ein. „Es wird Dir Einer das Haar abschneiden, und Du mußt ihn dann heirathen,“ fügte sie jammernd hinzu.
„Schande über diese Männer hier!“ erwiderte Ditta, und ihre Augen flammten. „Schande über Männer, die ein Weib zwingen durch solche Mittel – ihr auflauern, ihr die Haare abschneiden, sie im Dorfe zeigen und dadurch die Arme so weit bringen, daß sie Den, der ihr das Haar geraubt, heirathen muß, um der Schmach zu entgehen, in der sie nun für immer steht, weil sie jetzt nie einen anderen Mann bekommen wird! – Pfui über diese Männer, die ihr Weib so erringen!“
„Und sind doch manche Widerspänstige so schon kirre gemacht und ganz glückliche Frauen geworden! Denke an die Emilia Mantori und die Teresina,“ versetzte die Mutter; „zwei Jahre haben sie sich gesträubt und schließlich war der Zopf weg, sie kamen mit kurzem Haar von den Feldern, die Buben auf der Gasse liefen ihnen nach, und drei Wochen später war lustige Hochzeit, und sie sind’s nun zufrieden.“
„Mir geschähe das nicht, Mutter,“ entgegnete jetzt Ditta, „mir nie!“ Und ihre braune Hand mit den wohlgeformten länglichen Fingern krümmte sich eigenthümlich zusammen, und ihr an und für sich schon ungewöhnlich fest geschlossener Mund wurde blutlos. „Das ist Banditenart, und da darf man sich auch wehren wie gegen Banditen. Der mag sich hüten, Mutter, der mir die Hand auf mein Haar legt! Das wissen unsere Räuber hier wohl, und sie halten sich hübsch fern von mir.“
„Unsere Burschen sind keine Räuber,“ erwiderte darauf Frau Ceprano. „Sie sind wild; aber es giebt auch gute darunter.“
„Ich kenne keinen,“ entgegnete Ditta, „und will Keines Weib hier werden. Wenn ich je heirathe, so ist das sicher kein Mann, der mich seinem Maulesel gleichstellt, mir Arbeit aufbürdet und mich schlägt wie einen solchen, und Männer, die anders sind, giebt es hier in den Abruzzen nicht. Das weißt Du, Mutter, weshalb kommst Du mir immer mit Deinen Vorwürfen und Klagen? Du bringst es durch Dein Schelten und Drängen noch so weit, daß ich nach Rom gehe und ein kleines Geschäft anfange –“
„Und Deine Mutter läßt Du hier in Armuth und Elend!“
„Ihr seid nicht arm, Mutter, denn so lange Ihr lebt, könnt Ihr hier auf dem Gütchen wohnen, das Euch bei geringer Arbeit reichlich nährt. Und dann – ich will ja gerne bei Euch bleiben, wenn Ihr mich nicht zu einer verhaßten Heirath zwingen wollt!“
„Nun gut! Ich will Dich nicht zwingen,“ lenkte die Alte ein, „bleib wie Du bist, Du mußt es ja haben!“
Die Sonne neigte sich zum Untergang und goß rotgoldene Gluth durch die offene Thür in das Zimmer; draußen lagen die Berge alle in violetten Duft getaucht und mischten Rosen, Geranium und Lavendel fast berauschend ihre Wohlgerüche in die stille, warme, goldigklare Abendluft.
Die Beiden hatten stumm ihr Abendbrod verzehrt und Ditta war eben aufgestanden, um das Geschirr fortzuräumen, als ein Schatten zwischen die Sonnengluth draußen und den Hauseingang trat. Das Mädchen blickte auf. Ein keckes „Guten Abend, Signorina!“ tönte ihr entgegen.
[10] In dem Thüreingang stand ein schöngewachsener junger Mann in blauer Sammetjacke und spitzem Hut, um den Leib einen großen rothen Wollshawl. Er hatte den Abendgruß gesprochen und schaute Ditta mit den scharfen, pechschwarzen Augen leidenschaftlich an.
„Wollt Ihr zu der Mutter?“ frug Ditta wenig einladend den Ankömmling.
Der junge Mann nahm den Hut ab. „Nein, zu Euch will ich, Signorina,“ erwiderte er geschmeidig, höflich.
„Wenn Ihr kommt, Pieteranton, mir dasselbe wie früher zu sagen, so könnt Ihr Euch die Mühe sparen,“ klang es klar und bestimmt von Ditta’s Lippen.
„Ihr verweigert mir also den Eintritt in Euer Haus, Ditta Ceprano?“ frug jetzt der junge Mann, und sein schmallippiger Mund zog sich zusammen und seine stechenden Augen bekamen etwas von dem Ausdruck eines gereizten Tigers.
„Das Haus steht ja offen, tretet nur ein.“ erwiderte Ditta ruhig, „da seht Ihr meine Mutter,“ und nach diesen Worten schritt das Mädchen zur Hinterthür des Gemaches hinaus in den kleinen mit Aloegebüsch umfriedeten Garten.
Pieteranton trat in das Zimmer, warf den Hut auf den Tisch und setzte sich auf einen Sessel der Frau Ceprano gegenüber.
„Ihr scheint nicht besonders weit mit ihr gekommen zu sein, Mutter Ceprano,“ nahm er zu der Alten gewendet das Wort.
„Ihr seht, wie weit,“ gab die Alte mit unterdrückter Stimme zurück.
„Dann wird sie wohl bald nach Rom gehen und Ihr müßt arbeiten wie die Anderen, Mutter Ceprano,“ warf der Bursche scheinbar ganz harmlos hin, „denn ihr gehört ja hier Alles. Es ist Vatergut und so geschrieben worden.“
„Sie wird mir das Gütchen lassen,“ sagte die Alte kleinlaut.
„Aber nicht alle Arbeit mehr für Euch thun, Mutter Ceprano, denn sie schafft für Zwei, und den Zins wird sie in Rom allein brauchen,“ fuhr der junge Mann mit einem kurzen, scharfen Seitenblick auf die Alte fort. „Euer bequemes Leben hat dann ein Ende, Mutter. – Oder will sie Euch etwa mit nach Rom nehmen?“ erkundigte sich Pieteranton theilnehmenden Tones.
„Ich weiß es nicht,“ fuhr die Alte zornig heraus. „Sie hat nur heute wieder gesagt, daß sie von hier fort geht. Ich glaube, sie thut es bald.“
„So,“ sagte der junge Mann und seine Lippen zuckten von verhaltener Leidenschaft, „dann schafft Euch nur zwei tüchtige Arbeiterinnen für das Feld an, Mutter Ceprano,“ setzte er spöttisch hinzu.
„Das trägt der Acker nicht. Er ernährt so viel nicht, das wißt Ihr wohl,“ versetzte darauf zornig die Mutter.
„So haltet das Mädchen hier!“ warf Pieteranton leicht hin und streckte seine beiden mit gelben Gamaschen bekleideten Beine scheinbar sehr behaglich weit aus.
„Haltet! ja haltet!“ stöhnte die Alte. „Könnt Ihr sie etwa halten, Pietro?“
„Ja, ich kann’s, wenn Ihr mir helft,“ sprach der junge Mann, sich aufrecht setzend, leise. Dann erhob er sich, ging zur Hinterthür, spähte in den Garten hinaus, und als er wahrnahm, daß Ditta, wie er vermuthete, diesen auch verlassen hatte, um nicht mehr mit ihm zusammenzutreten, zog er die Thür zu, setzte sich näher zu der Alten und sprach leise: „Ich kann sie zwingen, hier zu bleiben, Mutter. Sie wäre die Erste nicht, die hat denjenigen heirathen müssen, der sie wollte. Ihr wißt ja, auf welche Weise. Es wäre freilich schade um die schönen Haare!“
„Und wenn sie Euch niedersticht, Pietro? Ihr kennt sie nicht!“ warf die Alte, den unruhigen Blick zur Erde gesenkt, ein.
„Dafür sollt Ihr eben sorgen, Mutter Ceprano, daß sie das nicht kann. Nehmt ihr das Messer weg, wenn sie schläft, verbergt mich im Garten und laßt mich ein, wenn alles sicher ist. Ehe sie erwacht, ist ihr Haar mein – und alles ist in Ordnung.“
„Sie wird mich aus dem Hause jagen, wenn sie erfährt, wie es zugegangen; sie wird mich von sich stoßen wie ein giftiges Thier, und es wird für mich alles noch schlimmer werden,“ entgegnete ihm die Alte sorgenvoll.
„Bin ich denn nicht da?“ erwiderte Pieteranton, „und geschieht nicht alles zu ihrem Glück? Bin ich nicht der reichste junge Mann in der Landschaft? Ist Eine im ganzen Bezirk, die meine Hand ausschlüge? Sagt, könnte ein Mädchen eine bessere Heirath machen? Es ist ja nur eine Laune, ein Eigensinn von Eurer Tochter, der sie noch zur alten Jungfer und Euch zu einer gewöhnlichen Arbeiterin macht! So steht’s, Mutter Ceprano.“
„Da habt Ihr Recht,“ stimmte die Alte zu. „Es wäre ein Glück, wenn sie Euch nähme, für sie selbst, für Euch, für mich – aber Ihr kennt sie nicht, Pieteranton. Es giebt ein Unglück, sag ich Euch!“
„Bah! Redensarten – ein Frauenzimmer – das wäre neu!“ lachte verächtlich Pieteranton. „Ich werde sie schon zähmen. Die Stolzesten und Wildesten sind später die Zahmsten und Sanftesten. Wenn ich ihren Zopf durch die Gassen trage, und ich würde das thun, falls sie sich noch weiter sperrte, so würde sie mir folgen wie ein Lamm dem Schäfer – das würdet Ihr sehen, Mutter. Es hat noch kein Mädchen hier gegeben, das diese Schmach ertragen und den nicht gern genommen hätte, der einzig und allein ihr die Ehre wiedergeben konnte.“
„Sie ist anders, als alle übrigen hier,“ wandte besorgt die Alte ein. „Ihr seid zwar stark und klug und angesehen und der Mächtigste weit und breit, – aber was hilft dies Alles, wenn sie Euch haßt, Euch etwas anthut und mich von sich jagt?“
„Sie haßt mich nicht, es ist ja nur kindischer Stolz von ihr – ich kenne das – darüber mache ich mir keine Sorge,“ versetzte Pietro. „Ihr wißt, ich habe Euch eine Jahresrente verschrieben, wenn sie mein Weib wird, ich werde Euch dafür stehen, daß Ihr hier auf dem Gute bleibt und eine Magd halten könnt. Also macht’s kurz, Mutter: wollt Ihr oder wollt Ihr nicht?“
„Ich kann’s nicht – ich wag’s nicht.“
„So werdet arm wie die Aermsten hier! Arbeit ist ja gesund, wer lange arbeitet, der lebt lange. Addio, Mutter Ceprano!“ höhnte der junge Mann, erhob sich und wandte sich zur Thür.
„Bleibt!“ rief die Alte mit heiserer Stimme. „Ich will es thun.“
„Wann?“ frug der junge Mann, in der Thür stehen bleibend.
„Ich werde Euch einen Boten schicken, wenn ich glaube, daß es geschehen kann. Der soll nur bestellen, ich möchte Euch sprechen, und dann kommt Nachts elf Uhr.“
„Ich verlaß mich darauf,“ sprach der junge Mann. „Seid klug, verschwatzt nichts und haltet Wort!“
„Ich werde Wort halten,“ sagte Mutter Ceprano mit finsterer Miene und geleitete Pieteranton vor das Haus. Dann kehrte sie in die inzwischen ganz finster gewordene Küche zurück.
„Sie kann keine bessere Heirath machen,“ murmelte sie, „er ist reich, sehr reich, angesehen, schön und gehört nicht zu den Schlimmsten. Sie wird sich darein finden. Er hat Recht, es ist nur eine Laune.“
Und die Alte ergriff ihren Rosenkranz, ging, immer vor sich hinmurmelnd, auf die Straße, verschloß das Haus und schlug den Weg zur Kirche ein, um die Abendmesse nicht zu versäumen.
Am nächsten Morgen in aller Frühe, bevor die Mutter noch aufgestanden, war Ditta schon auf dem Hofe beschäftigt; nun zog sie den Maulesel aus dem Stalle, belud ihn mit zwei großen flachen, muldenartigen Körben voll Zwiebeln, schwang sich auf das Thier und trabte nach Palene hinüber.
Das rothseidene Tuch fest um den Kopf geschlungen, das gelbe Brusttuch mit den Zipfeln auf dem Rücken befestigt, im grünen Wollenrock, unterschied sie sich, ihre Größe ausgenommen, in nichts von den übrigen Frauen des Dorfes, nur trug sie einen ledernen Gürtel um den Leib mit einer Metallscheide, in welcher ein großes Gartenmesser steckte. Ihre Hand ruhte fast immer auf dem großen Beingriff des Messers, was ihr etwas Wildes, Amazonenhaftes gab, dem das edle, ruhige Madonnengesicht mit den glatt gescheitelten Haaren seltsam widersprach. Der Esel trabte durch die frische Morgenluft, und Ditta schaute in das flimmernde Sonnengold des Morgens, das auf den Felsen hier oben und auf den Feldern unten lieblich spielte.
„Sollte man es glauben, daß die Menschen so böse wären,“ sprach sie halblaut vor sich hin, „wenn man sieht, wie schön und friedlich und glücklich und still alles hier ist? Das merken sie aber nicht, denn sie sind noch Thiere, sie leben wie reißende Thiere dahin. In den Städten ist es anders, es ist schon in Palene besser; wie viel anders muß es nicht erst in Rom, in Florenz, in Neapel sein! Dort, das habe ich gelesen, giebt es gute, sanfte Menschen, die verzeihen und vergeben, die nicht lieben wie die Wölfe und hassen wie die Tiger. Ich kenne auch Einen, der so ist, aber er ist ein Fremder, und sie schlügen ihn todt, [11] wenn ich ihn heirathete! Könnten wir aber nicht nach Rom fliehen?“ sann das Mädchen weiter und ließ den Kopf nachdenklich sinken. „Nein, sie würden ihn auch in Rom finden, und eines Tages wäre er todt, und ich hätte ihm den Tod gebracht!“
Der Maulesel, welcher merkte, daß seine Leiterin nicht Acht auf ihn gab, stand still und bog den Kopf herab, um einige Gräser zu rupfen. Das erweckte die Träumerin aus ihren Gedanken, sie ergriff die Zügel, und mit einem lauten „Aia“ setzte sie das Reitthier in schnellere Gangart, sodaß sie nach wenigen Minuten das Ziel ihrer Reise, Palene, vor sich hatte.
Das Oertchen besteht aus drei engen Gassen, einem kleinen Marktplatze, einem wappengeschmückten Municipalgebäude und einer ziemlich großen, hübschen Kirche. Auf dem Marktplatze stehen ein paar bessere Gebäude, rosa und blau angemalt, mit hellgrünen Jalousien, und in einem solchen befindet sich ein Laden, der die werkwürdige Inschrift trägt: „Lugeno, Handel für Alles“ – dann auf Papptafeln sauber aufgemalt: „Barbiere, Café, Taverna“. Vor dem Laden stehen ein Tisch und vier Stühle, außen an dem Eingange Körbe mit Gemüsen und Früchten, und über der Thür ist ein halbes Dutzend Vogelbauer befestigt, in welchen Canarienvögel schmettern.
Der Inhaber dieses Geschäftes, Herr Ernano Lugeno, stand, als Ditta auf ihrem Maulesel angeritten kam, gerade vor der Thür und schaute gemächlich hinaus in das herrliche Frühlingswetter, indem er aus einer großen, kurzen Meerschaumpfeife behaglich schmauchte. War diese Art zu rauchen hier schon etwas Fremdes, so erschien noch fremdartiger an diesem Orte das Aeußere des Mannes, welches als eine vollkommene Verkörperung des Nordens gelten konnte. Er war groß und breitschultrig von Gestalt, seinen gewaltigen Kopf umgab strohgelbes Haar, und ein rosig frisches Gesicht faßte ein goldheller krauser Bart ein. Die Augen des Mannes waren licht und tiefblau und sein Mund sehr voll und weich. Das war nun Alles eigentlich sehr natürlich, denn Herr Lugeno war ein Pommer, Hermann Lütgens mit Namen, den ein Zufall als Knabe nach Neapel verschlagen und der schließlich hier „hängen“ geblieben, wie er sich ausdrückte. Seit zehn Jahren betrieb der jetzt dreißigjährige Herr Lugeno das Barbiergeschäft, den Handel mit Gemüsen und mit Singvögeln, und außerdem hielt er noch ein Café und eine Weinstube. Für die letzteren beiden Geschäfte genügten zwei Tische und acht Stühle, ein Tisch im hinteren Zimmer, wo der Besitzer auch schlief, und ein Tisch, wie wir erwähnt, im Freien nebst einem halben Dutzend Tassen und zwei Glasballons Wein. Trotz dieser vielfachen Geschäfte ging es Herrn Lugeno nicht besonders gut, er ernährte sich mit knapper Noth. An dieser dürftigen Lage trug wohl die einzige Leidenschaft dieses Mannes die Schuld: die Jagd. Sie verführte ihn dazu, daß er oft zwei bis drei Tage verschwand, sein Geschäft und seine Barbierkunden vollständig vergaß, um schließlich mit einem magern Hasen, einem kleinen Marder oder einer elenden Wachtel ganz verwildert und zerzaust heim zu kommen. Herr Lugeno würde auch längst verhungert sein, wenn er nicht in Allem, was Handarbeit hieß, so außerordentlich geschickt gewesen wäre. Er reparirte Uhren, flickte Tische und Stühle, setzte Fensterscheiben ein und malte hübsche Schilde. Er war deshalb ein unentbehrlicher Helfer in der Noth und beliebt bei Allen durch seine Heiterkeit und nicht zum Mindesten durch die Billigkeit seiner Forderungen.
Die Frauen und Mädchen des ganzen Ortes, alt und jung, schwärmten besonders für Don Ernano (es wurden hier alle Leute beim Vornamen genannt) und Il bello Biondo – der schöne Blonde – hätte schon manche gute Partie machen können, die ihn aus seiner Dürftigkeit mit einem Schlage in großen Wohlstand versetzt haben würde, wenn der große Mann nicht stets das Benehmen eines Weiberfeindes gezeigt hätte, was ihm wieder die Freundschaft aller Männer des Ortes eintrug. Auch Ditta hatte seit langem schon eine stille Neigung für den italienischen Pommer, mit dem sie seit ihrer Kindheit in Geschäftsverbindung stand, denn er bezog sein Gemüse fast ausschließlich von dem Gütchen Ceprano. Heute nun führte sie ihr Weg wieder zu ihm.
Das Mauleselchen hielt vor dem Laden und beschnoberte den Tisch, auf welchem einige Brosamen lagen. Ditta sprang gewandt herab.
„Guten Morgen, Signorina!“ rief Herr Lugeno und trat etwas langsam, aber doch galant mit freundlichem Gesicht näher, um dem Mädchen die schweren Körbe abladen zu helfen.
„Sind Sie gesund, Don Ernano?“ erkundigte sich, den Gruß erwidernd, Ditta und schaute mit ihren tiefbraunen Augen dem Blonden zärtlich in seine treuherzigen blauen. Dabei wurde Herr Lugeno roth, worüber Ditta mit feinem, lieblichen Ausdruck lächelte. „Hier sind die Zwiebeln, große, schöne; können Sie alle gebrauchen?“ frug sie.
Herr Lugeno kraute sich etwas verlegen hinter den Ohren.
„Könnt’ ich schon, Signorina, habe aber augenblicklich keine große Casse.“
„Weiß schon,“ sagte Ditta, „wahrscheinlich sind der Herr wieder auf der Jagd gewesen?“
„Das wissen Signorina?“ fragte Herr Lugeno, verwundert das schöne Mädchen ansehend.
„Ja. Ich habe nachgedacht, weshalb der Herr nicht reich werden. Er versteht doch Alles, ist so klug und geschickt, trinkt nicht und spielt nicht, er könnte der Erste in der Stadt sein und kommt doch nicht weiter! Ich habe herausgebracht, daß nur die Jagd daran schuld sein kann.“
Herr Lugeno sah noch aufmerksamer die Sprecherin an, aus ihrem Gesichte leuchtete eine freundliche Theilnahme, die ihm tief zu Herzen ging. Er kraute sich abermals hinter den Ohren und wiegte den großen Kopf. „Signorina möchten Recht haben,“ erwiderte er darauf, „aber was soll ich anfangen? Ich habe kein Vergnügen sonst auf der Welt. Es ist so öde in meinem Hause, und die Langeweile packt mich oft wie der Teufel.“
„Sie sollten eine Frau nehmen, Don Ernano, dann haben Sie eine Heimath und wissen, zu wem Sie gehören, für wen Sie schaffen,“ erwiderte Ditta. Sie hatte die Augen, indeß sie sprach, zur Erde gerichtet, und Herr Lugeno sah in ihr klassisches Gesicht, das trotz der braunen Farbe jetzt plötzlich mit tiefem Rosenlichte übergossen war.
„Ja, eine Frau nehmen,“ wiederholte der große Blonde, „das ist leicht gesagt – wer würde mich aber nehmen, den Habenichts, den Fremden? Ich habe wohl manchmal daran gedacht, jedoch unser einer bekommt schwer eine gute Frau.“
„Das kann ich mir gar nicht denken, Don Ernano,“ meinte darauf nachdenklich Ditta und schlug einen Moment die großen schwarzen Sterne zu dem Händler auf. „Ein so guter und kluger Mann wie Ihr! Ihr habt wahrscheinlich nur nicht gewollt, Euch ist Eure Freiheit lieber.“
„Das könnte wohl sein, mein Fräulein. Es kann aber auch sein, daß die Rechte noch nicht gekommen ist,“ antwortete Herr Lugeno mit einem Male ganz ernst und nachdenklich.
„Wie müßte denn diese sein?“ erkundigte sich, beharrlich zu Boden schauend, Ditta.
„Wie, ja wie?“ frug Herr Lugeno, mit der großen weichen Hand wieder hinter die Ohren fahrend. „Nun, etwa wie Ihr, Fräuleinchen!“
Ditta ward von Neuem mit verrätherischem Rosenlichte übergossen.
„Ihr macht Spaß, Don Ernano,“ sprach sie darauf, sich zu einem Lachen zwingend. „Ich bin ja nur eine Bäuerin.“
„Mein Vater war noch weniger als ein Bauer,“ erwiderte darauf Herr Lugeno. „Er kam mit den Eisenarbeiten erst nach Oesterreich und dann nach Italien. Im Stande steht Ihr sogar eigentlich über mir, seht Ihr!“ lachte Herr Lugeno. „Eine Frau wie Ihr könnte mir schon gefallen,“ fügte er mit eigentümlichem Ausdruck hinzu.
„Don Ernano, könnt Ihr die Zwiebeln brauchen?“ brach jetzt plötzlich Ditta wie erschreckt ab, den Blick nicht von der Erde erhebend.
„Natürlich kann ich’s, Signorina, wenn Sie mir das Zeug lassen können – die Zahlung Ende Monats.“
„Ich traue Ihnen,“ sagte darauf Ditta, „gute Geschäfte!“ Und dann, nachdem sie ihre Körbe fast hastig in andere geleert, schwang sie sich auf ihr Reitthier und trabte mit dem eilfertigen Gruße: „Auf Wiedersehen, Signore!“ die Straße, auf welcher sie gekommen, nach Palenella zurück.
Die irrende Justiz und ihre Sühne.
Wenn man einmal tiefer hineinblickt in die Blätter, auf denen die Geschichte der Menschheit verzeichnet steht, so findet man darin genugsam Thaten, von denen es den Anschein gewinnt, als ob die Gottheit sie den Menschen nur habe begehen lassen, um ihn von Zeit zu Zeit an seine Ohnmacht zu mahnen und ihm den Traum seiner Gottähnlichkeit, den er nur zu gerne träumt, grausam zu zerstören. Unter diesen Thaten des im Wollen so großen und im Können so kleinen Menschen, welche dem Dunkel seiner Unfehlbarkeit eine schmähliche Niederlage bereiteten, bilden die Opferungen der irrenden Justiz einen wesentlichen Bestandtheil. Die große Ziffer derselben würde eine noch größere werden, wenn die Gräber reden und ihr verschlossenes Geheimniß offenbaren könnten.
In den Zeiten großer religiöser und politischer Umwälzungen erfahren die Justizmorde eine ungewöhnliche Häufung; sie werden da oft zu einer furchtbaren Seuche. Hier ist es dann nicht der Einzelne, der irrt, hier ist es der Irrthum einer ganzen Zeit, unter dessen Banne Ankläger wie Richter stehen. Weinend verhüllt dann der Genius der Gerechtigkeit sein Haupt. Aber auch in friedvollen Zeiten trifft die irrende Hand des Richters oft vernichtend ein schuldloses Einzelleben, und die geschichtliche Ueberlieferung ist leider nicht arm an solchen Documenten menschlichen Irrthums.
Schon im Mittelalter waren vielerlei Erzählungen von den Qualen der leidenden Unschuld im Schwange. Die Priester erhitzten die Phantasie der gläubigen Menge mit den Legenden der christlichen Märtyrer, und fahrende Sänger und weise Frauen erzählten wohl von dem Schicksale der armen Pfalzgräfin Genoveva.
In jener Zeit war überhaupt das Gefühl menschlicher Ohnmacht besonders stark entwickelt. Man war noch mehr gewöhnt, seinen Willen dem der Gottheit unterzuordnen. Aus diesem Gefühle heraus entstanden die gerichtlichen Gottesurtheile, bei welchen man die Entscheidung der Schuldfrage dem Himmel und seinem Wunder überließ. Ging der Angeschuldigte mit bloßen Füßen ungebrannt über glühende Pflugscharen oder zog er die Hand unversehrt aus dem Kessel mit kochendem Wasser, so galt dies als ein Freispruch des Himmels. Das war freilich eine bequeme Art, die Verantwortung von sich selbst abzuwälzen und dem Himmel aufzubürden. Oder man ließ den Angeschuldigten durch Leistung eines Reinigungseides sich gleichsam selber freisprechen. Als sich das Verfahren dann änderte und man einen ordentlichen Beweis der Schuld begehrte, da hatte man die richtige Erkenntniß, daß alle Zeugen und Indicien nicht vor Irrthum schützten, wenn nicht das Geständniß des Thäters hinzuträte. Man legte daher allen Nachdruck darauf, ein solches zu gewinnen, und schuf dazu die Folter. Das Mittel versagte nur selten. Das Geständniß war da, aber es war fast ausnahmslos ein falsches. Das Gewissen des Richters war fortan salvirt, aber die Gerechtigkeit lag in Knebeln. So wurde die Folter die Mutter einer Unzahl von Justizmorden. Ohne sie wären die Hexenprocesse, dieser Schandfleck in der deutschen Justiz, entweder nie entstanden oder doch nie zu einem solchen Umfange gediehen.
Friedrich der Große, der Freund Voltaire’s, war es, der in [13] seinen Staaten zuerst die Folter abschaffte. Die Veranlassung gab wieder ein der Vollendung naher Justizmord. In Berlin hatte man eine Witwe erdrosselt gefunden, die Besitzerin des „Stelzenkrugs“. Bei ihr wohnte ein armer Candidat, der sich kümmerlich von Elementarunterricht nährte. Er war Tags vorher bei einem Landprediger zum Besuche gewesen, hatte im Dunkel der Nacht den Heimweg nicht finden können und war auf freiem Felde übernachtet. In Folge dessen vermochte er nicht nachzuweisen, wo er in der Mordnacht gewesen war. Man setzt ihn gefangen, foltert ihn, und er bekennt sich als Mörder der Wittwe. Friedrich der Große läßt, ehe er das Todesurtheil bestätigt, die Sache erst durch seinen Großkanzler Cocceji, einen berühmten Juristen, untersuchen. Dieser entdeckt Mängel im Verfahren und ordnet die Wiederausgrabung der Leiche an. Der damit beauftragte Scharfrichter findet, daß die Erdrosselung durch einen kunstgerechten Knoten bewirkt ist, wie er als ein Geheimniß der Scharfrichterkunst gilt. Man forscht weiter und findet die wahren Mörder in ein paar Scharfrichtergehülfen. – Etwa dreißig Jahre früher war ebenfalls in Berlin ein Justizmord erfolgt, der im Volksmunde als der „Mord in der Brüderstraße“ lebte. Dem Kaufmann Lampert, der in jener Straße wohnte, war eine größere Summe Geld, französische Pistolen und holländische Ducaten, aus seiner Schlafkammer gestohlen worden. In diese Kammer hatte außer den Lampert’schen Eheleuten nur die Dienstmagd Marie Keller Zutritt, wenn sie die Betten machte. Auf sie fiel der nächste Verdacht. Er erhielt durch den Umstand wesentliche Nahrung, daß in der Tasche eines ihrer Kleider ein holländischer Ducaten gefunden wurde. Lampert zeigte den Diebstahl bei Gericht an, obwohl seine Frau fast flehend bat, die Anzeige zu unterlassen. Der Verdacht gegen das Mädchen wurde noch verstärkt, als ihre Mutter, um die Tochter zu retten, die falsche Angabe machte, diese habe den bei ihr gefundenen Ducaten als Pathengeschenk bei ihrer Taufe erhalten, und sich nachher ergab, daß die Jahreszahl des Ducaten eine weit spätere war, als die von Mariens Geburt. Nachdem ihr durch die Folter noch ohnedies ein Geständniß erpreßt war, wurde Marie Keller am 24. Juni 1731 durch den Strang hingerichtet.
Wenige Zeit darauf fand man Mariens Dienstfrau auf dem Boden ihres Hauses erhängt. Sie hatte sich selbst gerichtet, nachdem sie in einem an die Richter gesandten Schreiben Mariens Unschuld und ihre eigene Schuld bekannt hatte. Sie war es gewesen, welche zur Befriedigung eitler Bedürfnisse das Geld aus dem Koffer des Mannes entwendet und zur Ablenkung des Verdachtes den Ducaten in die Kleidertasche der Magd gesteckt hatte. Die Furcht, selbst dem Henker zu verfallen, hatte ihr den Mund verschlossen, aber die Qual des Gewissens trieb sie in den sühnenden Tod.
Ein großes Aufsehen erregender und durch die Einmischung Voltaire’s bekannt gewordener Justizmord aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist die Hinrichtung des Jean Calas in Toulouse. Dort hatte sich die früher reformirte Bevölkerung meist wieder zum Katholicismus bekehrt. Jean Calas, ein wohlhabender Kattunhändler, war Hugenott geblieben; nur einer seiner zahlreichen Söhne war Katholik geworden und in die Congregation der weißen Brüder übergetreten; ein anderer Sohn, Marc-Antoine, der die Rechtswissenschaft studirt hatte, sah sich dadurch, daß er Hugenott war, von der Zulassung zum Staatsexamen ausgeschlossen. Das hatte ihn unzufrieden und zerstreuungssüchtig gemacht. Eines Abends im October des Jahres 1761, als die
WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [14] Familie mit einem Gaste, einem jungen Kaufmanne aus Bordeaux, länger als sonst zusammensitzt, hat sich Marc-Antoine heimlich vom Tische entfernt, und als der Fremde und ein Sohn Calas’ zur Nachtruhe gehen wollen, finden sie ihn in dem Thüreingange zum Waarenmagazin erhängt. Um sich und dem Unglücklichen das damals besonders entehrende Begräbniß und den schmachvollen Nachruf eines Selbsmörders zu ersparen, verheimlicht die Familie dem hinzugerufenen Chirurgen die Ursache des Todes. Der Chirurg aber findet die Strangulationsmarke am Halse des Todten und ruft mit lautem Schrei: „Der ist erdrosselt!“ Der Ruf wird auf der Straße vernommen und weiter verbreitet. Der Bürgermeister erscheint mit Mannschaft. Der fanatisirte Pöbel sammelt sich vor dem Hause. Marc-Antoine, der Sohn, so formt sich des Volkes Urtheil, sei vom Vater ermordet worden, weil er seinen Glauben habe abschwören wollen wie sein anderer Bruder.
Der Bürgermeister verhaftet den Vater Jean Calas und seine Familie mit dem fremden Gaste. Marc-Antoine, der Selbstmörder, wird mit allen Ehren begraben. Die weißen Brüder nehmen ihn als einen der Ihrigem in Beschlag und halten ihm ein feierliches Hochamt. Der peinliche Proceß beginnt. Dabei wird durch Zeugen unter Anderem festgestellt, daß Marc-Antoine an seinem Todestage einen nicht unbedeutenden Verlust im Spiele gehabt hatte. Aber die acht Richter des Consistoriums erklären bis auf einen Jean Calas für des Mordes schuldig und verurtheilen ihn zuerst zur Folter, dann zum Tode durch’s Rad. Man hofft, ihm durch die Folter ein Geständniß zu entlocken, das sollte denn auch die Schuld der anderen Gefangenen begründen helfen. Aber Jean Calas, ein vierundsechszigjähriger Greis, hält alle Marter der Folter aus, ohne seine Unschuld zu verleugnen.
Man schreitet nun zur Hinrichtung. Noch zwei Stunden lebt der zerschlagene Körper auf dem Rade, auf das man ihn flicht, ohne daß ein Fluch des Zornes oder der Rache wider seine Richter auf die Lippen des Sterbenden tritt: „Mein Gott,“ ruft er aus, „verzeih meinen Richtern, denn sie wurden durch falsche Zeugen zum Irrthum geführt!“
Dieser christliche, ergebungsvolle Tod bringt einen jähen Umschwung in die Meinung des Volkes. Die Richter haben jetzt nicht mehr den Muth, über die anderen Gefangenen das gleiche Schicksal zu verhängen. Sie sprechen die Wittwe Calas und Lavaisse, den fremden Gast, ganz frei und verhängen über die Anderen nur die Strafe lebenslänglicher Verbannung.. Aber die Familie Calas war moralisch, gesellschaftlich und finanziell vernichtet.
Da stand ihr ein Rächer auf in Voltaire. Kaum hatte er von dem entsetzlichen Processe gehört, als er auch mit dem starken Eifer und der fieberhaften Erregung, mit denen er für jede ihn begeisternde, der Humanität und Aufklärung dienende Sache eintrat, auf die Genugthuung der tief gekränkten Familie drängte. Er bot seinen ganzen Einfluß bei Vornehmen und Mächtigen auf, schrieb nach allen Richtungen hin zahllose Briefe zur Sammlung neuen Beweismaterials und veröffentlichte Denkschriften, welche den Fall mit der ihm eigenthümlichen Schärfe und vernichtendem Sarkasmus beleuchteten. Endlich nach drei Jahren rastlosen Ringens hatte er erreicht, daß der Urtheilsspruch der Richter von Toulouse durch das Obergericht für nichtig und der Hingerichtete sammt seiner Familie für unschuldig erklärt wurde.
Hier hatte die Folter ihre Wirkung versagt, aber sie war in einer anderen Weise zur Anwendung gekommen, als ein in dem Hirn des Untersuchungsrichters festsitzendes Vorurtheil, als eine vorgefaßte und dann mit zäher Consequenz festgehaltene Annahme der Schuld des Angeklagten. Und ebenso wie der Bürgermeister von Toulouse handelten unzählige andere Inquisitionsrichter, indem sie eifrig bemüht waren, nicht die Wahrheit, sondern die Schuld zu finden und den einmal verdächtig Gewordenen zu überführen.
Daß aber selbst die überführenden Aussagen unverdächtiger Zeugen nicht immer vor Begehung eines Justizmordes schützen, dafür liefert der Fall Lesurques ein erschütterndes Zeugniß. Lesurques, ein nach Paris gezogener Rentier, wurde von einer Anzahl Zeugen bestimmt als einer der Räuber erkannt, welche die von Paris nach Lyon gehende Courierpost Nachts geplündert und den Courier ermordet hatten. Zwar vermochte er durch Gegenzeugen sein Alibi nachzuweisen, namentlich bekundete einer seiner Landsleute, der Juwelier Legrand, daß der Angeklagte am frühen Morgen in seinem Geschäfte war und füglich nicht wohl an dem viele Meilen entfernten Schauplatze des Verbrechens gewesen sein konnte, aber der Zeuge hatte im falschen Eifer für die gute Sache das Datum eines Juwelenverkaufs in seinem Geschäftsbuche radirt, um sich auf dasselbe berufen zu können. Die Rasur wurde bemerkt, der ganze Entlastungsbeweis erschien in Folge dessen als abgekartet und wurde nur zu einem Moment verstärkter Belastung. Die nun erfolgende Verurtheilung erschien sonach durchaus gerechtfertigt. Da meldet sich ein junges Mädchen, um zu bezeugen, daß ihr entflohener Geliebter der Mörder sei, und ein verurtheilter Mitangeklagter Lesurques’ bekennt Angesichts des Todes, daß er schuldig, aber Lesurques unschuldig sei.
Nun geschah aber das Unglaubliche! Es gab damals keine Cassationsinstanz und nach Abschaffung des Königthums – der Proceß spielte im Jahre 1796 – nicht einmal das Recht der Begnadigung. Das Urtheil war gefällt und konnte, obwohl sein Unrecht klar zu Tage lag, nicht wieder beseitigt werden. Der „gesetzgebende Körper“ erklärte sich gesetzlich außer Stande, die Vollziehung des Urtheils zu hemmen. Lesurques wurde enthauptet und sein Vermögen eingezogen. So wurde der Mensch durch die Tyrannei seines eigenen Gesetzes zum Verbrecher! Den wahren Schuldigen fand man bald hierauf. Es war in der That der Geliebte jenes Mädchens, in deren Seele die Wahrheit den Sieg über die Liebe gewonnen hatte. Eine rothe Perrücke, die er bei dem Raube aufgesetzt, hatte seine Aehnlichkeit mit Lesurques herbeigeführt, und jetzt erkannten auch die Zeugen ihren Irrthum. Die Wittwe des unschuldig Gerichteten suchte nun um gerichtliche Herstellung seiner Unschuld nach. Sie hatte von ihrem Manne nichts geerbt als eine Locke seines Hauptes; sie will auch nichts wieder haben von dem alten Reichthume, nur die geraubte Ehre verlangt sie zurück. Auch dem steht das Recht entgegen. Sie wiederholt das Gesuch bei jeder neuen Regierung; Direktorium, Kaiserreich, Restauration, alle versagen es ihr. Sie stirbt, ohne das Ziel ihres Lebens erreicht zu haben, und hinterläßt es als teures Vermächtniß ihren Kindern. Vergebens! Weder Louis Philipp noch Napoleon III. vermögen dem Verlangen des natürlichen Rechts zu genügen. Nur das Vermögen erhalten die Nachkommen im Jahre 1859 zurück.
Daß aber auch selbst das freiwillige Geständniß eines Angeklagten nicht vor einem falschen Richterspruche schützt, das beweist mehr als ein Fall; bald drängt sich Jemand in die Schuld eines Anderen, um diesen zu retten, bald stehen hinter dem Geständnisse die Furcht oder andere zwingende Motive.
So lebt und herrscht der Irrthum nach allen Seiten und der richtende Mensch bleibt ihm unerbittlich verfallen, so lange er noch unter den Geboten dieser Erde steht. Keine Institution wird ihn jemals verbannen, nicht der Fortschritt des Wissens, nicht die Klärung des Denkens, noch die Verfeinerung des Gefühls. Denn zuletzt stehn alle wieder unter den irdischen Gesetzen. Diese an sich schon schwere Erkenntniß wird aber dadurch noch belastender, daß sie mit der weiteren verknüpft ist, daß das, was einmal auf Erden durch Menschenschuld geschehen ist, niemals durch Menschenmacht wieder ungeschehen gemacht werden kann. So bleibt nichts weiter als der Ausgleich der schädlichen Folgen menschlichen Irrens durch einen äußeren Ersatz.
Es ist nun eigenthümlich, wie der moderne Staat sich dieser ehrlichen Pflicht des Ausgleichs für die Nachtheile der verurteilten Unschuld beständig entzogen hat. Er fand in dem Bekenntnisse des Irrthums der in seinem Namen richtenden Organe eine Schädigung der eignen Autorität und meinte wohl, der Einzelne müsse diesem höhern Gesichtspunkte leidend sich unterordnen. Lange Zeit entzog sich der Staat der Verantwortung dadurch, daß er die Bestrafung des Verbrechers dem Verletzten und seinen Freunden überließ, und selbst nach der größern Erstarkung des Staatsgedankens blieb in Deutschland noch lange die Einleitung des Strafverfahrens von dem Auftreten eines Privatanklägers abhängig. Erst vom sechszehnten Jahrhundert an nahm der Staat die Verfolgung des Verbrechers in eigne Hände, aber ohne die Verantwortung des Anklägers mit zu übernehmen.
[15] Im Gegensatz dazu hatte der mittelalterliche Staat immerhin einige Einrichtungen zur Verhütung und Sühne falschen Gerichts getroffen. So zwang er den Ankläger, Bürgschaft für die Redlichkeit seiner Anklage zu leisten, und falls er dies nicht konnte, steckte er bis zur Ueberführung des Angeklagten auch den Ankläger selbst in’s Gefängniß. Eine solche unredliche Anklage wurde mit derselben Strafe belegt wie das bezichtende Verbrechen. Nach friesischem Rechte sollte einem pflichtvergessenen Richter das Dach seines Hauses abgetragen oder das Haus gar niedergebrannt werden. Der Sachsenspiegel, ein Gesetzbuch des dreizehnten Jahrhunderts, erhielt eine durch die spätere Praxis noch erweiterte Bestimmung, wonach Demjenigen, der durch die Schuld sei es der Obrigkeit oder einer Privatperson widerrechtlich in gefänglicher Haft gehalten worden ist, für jeden Tag und jede Nacht vierzig Groschen als Entschädigung (sogenannte Sachsenbuße) gewährt werden soll.
Aber es fehlte auch nicht an Beispielen, wo die Obrigkeit, dem Richter in ihrem Herzen folgend, freiwillig sich entschloß, das einem Unschuldigen angethane Unrecht frei und vor aller Welt zu sühnen. Einen solchen Fall richterlicher Sühne behandelt das unserer heutigen Nummer beigegebene Bild des talentvollen Antwerpener Malers van der Ouderaa aus der Geschichte seiner Vaterstadt. Der reiche Handelsherr Jan von Breuseghem war – die Handlung spielte im Jahre 1593 – der Verbindung mit den Rebellen angeklagt, eingekerkert und gefoltert worden. Als endlich seine Unschuld an den Tag kommt, beschließt der Magistrat, dem armen Opfer einer mangelhaften und allzu raschen Justiz feierlich Abbitte zu thun und ihm das Ehrengeleite bis zu seiner Wohnung zu geben. Als der Freigelassene, gebrochen und unterstützt von Sohn und Tochter, aus der Pforte seines Kerkers heraustritt in die enge Straße vor dem „Steen“, empfängt ihn der versammelte Magistrat, Wachskerzen in den Händen (ein Symbol der Wahrheit und des Lichtes), und sein Richter tritt ihm mit der Frage entgegen, welche Sühne er für das unschuldig erlittene Unrecht begehre. Voll milder Würde antwortet ihm der gebrochene Greis: er sei reich, Gesundheit und Ruhe habe man ihm unwiederbringlich geraubt, so begehre er keine andere Sühne, als daß jene Folterinstrumente, mit denen man ihn gequält habe, zum ewigen Gedächtnisse an diese Stunde in seinem Kerker angekettet würden. Also geschah es denn auch. Erst im Jahre 1794 wurden die Folterwerkzeuge von den Franzosen entfernt.
Für die Opfer des politischen und religiösen Fanatismus übernimmt die Sühne vielfach die Geschichte. Sie trägt ihre Namen mit ehernem Griffel in ihre Tafeln ein und feiert sie als Helden und Heilige. Ruhigere Zeiten und die Geschlechter aufgeklärter Nachkommen setzten ihnen wohl noch Denksteine und Gedächtnißsäulen.
Die Wittwe des Jean Calas erhielt von dem Könige eine Entschädigung von 12,000 Franken, deren Söhne und Töchter geringere Summen. Da aber die Kosten des Processes noch weit mehr betrugen, so eröffnete man eine öffentliche Subscription durch Verkauf eines die Familie darstellenden Kupferstichs. Einzelne Vermögende zahlten bis zu fünfzig Louisd’ors für ein Exemplar.
Auch an Victorine Salmon, welche des Giftmordes fälschlich verdächtigt fünf Jahre Isolirhaft erlitt, zahlte das Volk von Paris die Entschädigung, während in dem Falle „Grebe“ der Kurfürst von Hessen den Angeklagten und seinen Genossen mit je 6000 Thalern entschädigte, dem übereifrigen Richter und seinem Diener aber den Proceß wegen Amtsmißbrauchs machte.
So fand die Nothwendigkeit eines Schadenersatzes bereits vielfach ihre thatsächliche Anerkennung. Aber noch immer fehlte die Regulirung im Wege des Gesetzes. Auch für diese begann alsbald die agitatorische Bewegung in Fluß zu kommen. So setzte im Jahre 1781 die Akademie zu Chalons einen Preis aus für die beste Beantwortung der Frage, wie für den unschuldig erkannten Bürger die ihm nach natürlichem Rechte gebührende Entschädigung zu verschaffen sei? Die Verfasser der beiden gekrönten Preisschriften, de la Madeleine und Brissot, verlangen neben der Geldentschädigung noch besondere Bevorzugungen des für schuldlos Erkannten wie Decorationen, Freistellen für seine Kinder u. dergl.
In einem der französischen Nationalversammlung im Jahre 1790 vorgelegten Entwurfe handelte ein Artikel von dieser Entschädigung. Dieselbe wurde von dem Berichterstatter als eine „Schuld der Gesellschaft“ bezeichnet, welche sie tilgen müsse, denn auch die Gesammtheit aller Menschen sei der Pflicht, gerecht zu sein, nicht mehr entbunden, als der einzelne Mensch. Auch im englischen Parlamente wurde im Jahre 1808 eine darauf zielende Bill eingebracht, aber dann wieder zurückgezogen. Die erste gesetzliche Sanction erhielt die Frage in dem Criminalgesetzbuche von Toscana (1786). Auch die Mehrzahl der Schweizer Cantone nahm eine derartige Bestimmung an, und die württembergische Strafproceßordnung vom Jahre 1868 enthielt gleichfalls eine solche. Die italienische und französische Literatur haben die Frage nicht schlummern lassen, und in Deutschland empfing sie neue Anregung durch die Schrift vom Heinze (1868), besonders aber durch den deutschen Juristentag, der dieselbe mehrere Jahre lang auf seinem Programm führte und sich zuletzt ebenfalls mit ganz überwiegender Mehrheit für die Entschädigung unschuldig Verurtheilter aussprach.
Aber es bedurfte erst einer Anzahl neuer mahnend an das Herz der Gegenwart klopfender „Beweisfälle“, um die Frage vor den deutschen Reichstag zu bringen. Gerade in den letzten Jahren haben diese Fälle der Verurtheilung Unschuldiger eine seltene Häufung erlebt.
Wir können nur flüchtig an einzelne erinnern. So verurtheilte das Schwurgericht zu Bromberg 1879 den Müller Stephan Kolozkowski wegen Brandlegung seiner Mühle zu drei Jahren Zuchthaus. Nach Verbüßung der Strafe ergaben sich die Zeugenaussagen als unwahr und Kolozkowski wurde von einem zweiten Schwurgerichte freigesprochen, nachdem sich herausgestellt, daß ein paar inzwischen verschwundene Müllergesellen die That verübten. So der schwere Fall der Katharina Steiner zu Wien, welche wegen Mordes erst zum Tode, dann in zweiter Instanz zu sechs Jahren schweren Kerkers verurtheilt worden war, und erst nachdem sie bereits vier Jahre davon verbüßt hatte, durch die Selbstangabe des wahren Mörders wieder frei wurde. So der Harbauer’sche Fall, in welchem ein Vater in Folge des irrigen Gutachtens der Aerzte wegen der Vergiftung des eigenen Kindes durch Schwefelsäure verurtheilt wurde. So die Verurtheilung des Grundeigners Joseph Kumberger in Steiermark wegen Theilnahme an dem Morde seiner Gattin auf Grund der lügenhaften Angabe des wirklichem Thäters. Auch hier war zum Glücke die Todesstrafe durch landesherrliche Gnade in Kerkerhaft umgewandelt worden. Nach achtzehnmonatlicher Haft und mehrmonatlicher Todesangst wurde Kumberger, physisch und finanziell ruinirt, in Freiheit gesetzt. So der ganz neue Fall der Frau Destillateur Steigerwald in Berlin , welche (1880) wegen schwerer Mißhandlung eines angenommenen Kindes zu drei Jahren Gefängniß verurtheilt und nach Wiederaufnahme des Processes am 6. Juni 1883 nach Aufhebung des früheren Urtheils freigesprochen wurde, da sich die beschworenen Aussagen der Belastungszeugen als falsch erwiesen.
Ein aus Zeitungsnachrichten zusammengestelltes Verzeichniß in dem „Juristischen Wochenblatte“ weist für die letzten beiden Jahre nicht weniger als zweiundzwanzig Fälle nach, in welchen nach Wiederaufnahme des Verfahrens Freisprechungen erfolgten, während die betroffenen Angeschuldigten vorher zu größtentheils schweren, vielfach schon verbüßten Strafen verurtheilt waren.
Wo Thatsachen reden wie diese, da hören alle theoretischen
Gründe und rechtlichen Spitzfindigkeiten auf. An ihrem mächtigen
Worte wird sich auch der Widerstand der Regierungen brechen!
Jedem Jahrhunderte fällt eine Anzahl Aufgaben zu, welche die
Geschichte ihm aufgiebt zu erfüllen. Unter ihnen ist es nicht die
schlechteste, welche eine gesetzliche Anerkennung der Rechte der ungerecht
Angeklagten und unschuldig Verurtheilten verlangt. Hoffen
wir mit einem der wärmsten Vertheidiger dieser Rechte, daß das
deutsche Reich in baldigster Erfüllung jener Aufgabe von Neuem
beweist, daß es seinen besten Ruhm darin findet, ein Reich der
Gerechtigkeit zu sein! Fr. Helbig.
[16] [17]
Blätter und Blüthen.
Armin’s Triuphzug. (Mit Illustration Seite 4 und 5.) Wie
oft auch die Heldengestalten aus dem ersten deutschen Befreiungskrieg
dargestellt worden sind, wie eifrig und glücklich Dichter, Maler und Bildhauer
sich der Verherrlichung einer Zeit gewidmet, die, noch halb vom
Schleier der Sage verhüllt, der Phantasie um so reicheren Spielraum gönnt,
so werden eben deshalb Armin und die Teutoburger Schlacht auch ferner
mit ihrem mächtigen Reiz auf dichtende und bildende Künstler wirken und
sie anregen, für die Augen jeder Generation das alte Bild zu erneuen.
Unsere heutige Illustration ist ein Werk Paul Thumann’s. Er zeigt uns den Sieger Armin, wie er aus der furchtbaren Schlacht seine Völker mit der Beute und den Gefangenen an den frohlockenden Frauen und Greisen vorüber führt. Die Darstellung ist so einfach und klar, daß sie keiner Erklärung bedarf. Der Künstler hat alle Betheiligten an dem großen Ereigniß in wenigen Gruppen vollzählig vertreten lassen und das Tieftragische und Volksheitere, Schmach und Ehre, Jammer und Jubel bis zur erhabenen Begeisterung mit so viel historischer Treue, als diesem Theile unserer Geschichte gegenüber möglich ist, zur Anschauung gebracht.
Die Hauptgestalt ist der Triumphator auf seinem weißen Streitroß. Armin, der Held der Geschichte, bietet unseren Künstlern die Aufgabe einer Ideal-Darstellung ebenso gut, wie die Germania. Jeder schafft sie nach seinem Geiste. Für ewige Dauer berechnet stehen beide vor der deutschen Nation auf dem Teutoburger Wald und auf dem Niederwald. Dennoch wird schwerlich ein schaffender Künstler in beiden die Vollendung des Ideals anerkennen, und so hat auch Thumann uns einen neuen Armin geschaffen, der mit dem Teutoburger Vorbild keine Verwandtschaft zeigt. Dennoch freuen wir uns auch dieser Heldengestalt, denn sie läßt uns erkennen, was wir von einem Armin-Bilde erwarten: geistige Würde und männliche Kraft.
Steht doch auch dem Geschichtsschreiber für die Schilderung jenes großen Kampfes nur unsicheres Matertal zu Gebote. Heinrich Luden,[1] der warme und muthige Patriot in Deutschlands schlimmsten Tagen, hat in seiner „Geschichte des deutschen Volks“ (Gotha, 1825 bis 1835, 10 Bände), das leider diesem „deutschen Volke“ unbekannt geblieben ist, darüber eine Belehrung ertheilt, von welcher das Wesentlichste hier erwähnt werden muß. Er sagt (Bd. I, S. 223) unter Anderem: „Unglücklicher Weise kennen wir jene große Begebenheit nur höchst unvollkommen. Die Ehre des deutschen Volkes und der Ruhm der einzelnen Männer, welche mit ihrem Geist die Massen beherrschten, war den Römern gleichgültig; ja sie haben, um die eigene Schmach vor sich selbst und vor der Nachwelt zu verbergen, absichtlich entstellt und die Herrlichkeit der Deutschen zu schmälern und zu beflecken gesucht. Unwissenheit, Stolz, Menschenverachtung und eine ganz andere Ansicht vom Leben und von den Verhältnissen des Lebens, von Ehre und von Tugend haben nicht minder eingewirkt. Diese Zeit hat keinen Geschichtsschreiber (er führt sie alle auf: Vellejus Paterculus, Strabo, Florus, Dio Cassius), der nur einigermaßen den Willen gehabt hätte, das Ereigniß mit einiger Ausführlichkeit treu und wahr darzustellen; von einer gerechten Würdigung der Ereignisse in Deutschland findet sich bei ihnen keine Spur. – Nur die große Seele des erhabenen Tacitus ist tief ergriffen worden. Tacitus hat in Gerechtigkeit, ja in Liebe geredet. Aber selbst ein solcher Mann ist nicht frei, weder von der Schule noch vom Leben seiner Zeit. Er hat seinen Blick mehr auf den einen großen Mann (Armin) gewandt, als auf dieses Volk selbst. Desto reiner und schöner ist das Zeugniß, das er ablegt; aber die Thatsachen sind von ihm kaum berührt. Wie ganz anders also möchte die Begebenheit sich vor unser Auge stellen, wenn wir deutsche Berichte hätten, ausgehend von deutschem Volksgefühl, enthaltend der Deutschen Mißhandlung, Duldung, That, darstellend, wie Alles gewesen und gekommen! - So aber müssen wir uns, und zwar mit Dankbarkeit, begnügen mit Dem, was Tacitus über die Entscheidung im Teutoburger Walde sagt. Er drängt sein Urtheil in die wenigen Worte zusammen: ‚Varus fiel durch das Schicksal und durch die Macht Armin’s.‘“
Die heiligen drei Könige mit ihrem Stern. (Mit Illustration S. 16) Ein köstliches Genrebild bietet uns Alois Gabl, Professor an der Münchener Akademie, welcher mit Franz Defregger und Mathias Schmid das berühmte Tiroler Genremalerkleeblatt ausmacht. Zu der um den Tisch des Tiroler Bauernhauses vereinigten Familie treten die als „heilige drei Könige“ herausstaffirten drei Bauernbuben, welche nach alter Sitte den Heiland suchen, um ihm ihre Gaben zu überreichen.
„Königlich“ benehmen sie sich dabei allerdings nicht, da sie selbst Geschenke empfangen wollen. Aber man darf nicht bezweifeln, daß sie sich die kleinen Gaben, von Haus zu Haus ziehend, redlich verdienen wollen.
Die Wirkung des vermuthlich nicht sehr melodischen, aber desto kräftigeren Gesangs ist auch entschieden eine heitere, da die kleinen Majestäten offenbar das nicht halten können, was sie versprechen. Doch die Heiterkeit macht die Hand der Hörer freigebig und darum tönt unverdrossen aus den jungen Kehlen das alte Volkslied:
„Heisa! Heisa!
Heischa! Heischa! die heiligen drei Kinig san da.
Kaspar Melchior Baldhäuser bin ich genannt,
Aus Morgenland bin ich herausgekommen;
Hab Geld und Weihrauch mitgenommen,
Um dem kleinen Kind zu präsentiren,
Was einem König thut gebühren.
Die heiligen drei Kinig sind hochgeborn,
Sie reiten daher mit Stief’l und Sporn,
Sie reiten vorbei vor’m Herodes sein Haus,
Herodes schaut eben zum Fenster heraus:
Herein, herein, meine lieben Gäst’,
Ich will Euch geben das Allerbest’,
Ich will Euch geben Alles frei,
Wenn Ihr mir sagt, wo Christus sei.“
[18]
Die Sitze in den Eisenbahnwagen.
Ich fahre ganz allein in einem Eisenbahn-Coupé zweiter Classe, blicke müßig und müde auf die Dinge, welche mich umgeben, und spinne einen langen Erinnerungsfaden. Ich schaukele wieder wie vor dreißig Jahren in der Postkutsche. Mancher gedenkt wohl noch jener an den Fensterseiten innerhalb des Wagens angebrachten Ledergurten, in welchen während der Fahrt und zumal während der Nachtfahrt vier müde Eckpassagiere zu baumeln pflegten. Damals war ein Eckplatz begehrt und beneidet. Die Nr. 5 und 6, gurtenlos, wie sie waren, sahen sich zu einem kerzengeraden Sitz verurtheilt, wenn sie nicht, von Schlummer übermannt, gleich abgebrochenen Bleisoldaten auf ihre Nachbarn fallen wollten.
Die Eisenbahn ist eine Erlösung für die fahrende Menschheit und würde es noch vollständiger sein, wenn die constructiv technische Seite dieser großen Erfindung nicht fast ausschließlich die Phantasie der Erbauer in Anspruch genommen hätte. In der That ist von Anfang an für die innere Einrichtung der Wagen kaum ein schöpferischer Gedanke zu Tage getreten, vielmehr lediglich das alte Postkutschensystem herübergenommen worden. Man kann behaupten, daß wir, namentlich was die Bequemlichkeit des Sitzens betrifft, keine wesentlichen Fortschritte gemacht haben. In meinem Wagen hängen sogar noch jene historischen Gurten, wahrscheinlich kaum mehr bemerkt oder benutzt, aber doch pietätvoll bewahrt als ehrwürdige Reste aus dem abgestorbenen Kutschenzeitalter.
Es herrscht noch heute auf den Bahnen der ererbte Postverpackungs-Modus: reihenweises, ermüdend einförmiges Gegenübersitzen und bei weiten Reisen die Qual einer ungenügenden, ja grundverkehrten Körperstütze.
Ich fühle, hier angelangt, eine gewisse Beklemmung. Denn ich stehe im Begriff, der höchst verdienstvollen Tapezierer-Innung eine Vorlesung über die Gesetze der Polsterei zu halten. Das wird mir schwer bei dem großen Respect, den ich im Allgemeinen vor den Leistungen dieses Handwerks habe, und bei der Erwägung, daß dasselbe wesentlich mitgewirkt hat, um unser Zeitalter auf die Civilisationsstufe der sitzenden Lebensweise zu erheben. Ist es nicht wahrscheinlich, daß wir heutzutage ohne den Segen der Sessel noch unstät in den Wäldern umherlaufen würden? Ja, diese humanen Polsterkünstler sind es, die uns bei den Pferdehaaren zur Cultur herangezogen haben!
Auch muß ich mir sagen, daß die bisher üblichen Grundsätze der Polsterung dieselben sind, auf welchen die größten Weisen aller Zeiten mit Erfolg geruht haben. Selbst von den verwöhntesten Tyrannen ist nicht bekannt, daß einer derselben einen Tapezierer wegen unbequemen Sitzens je habe köpfen lassen. Kopflose Tapezierer sind geschichtlich nicht nachzuweisen.
Durch Vorauschickung dieser Bemerkungen glaubte ich mich einigermaßen salviren zu müssen, denn, daß Praktiker empfindlich sind und sich ungern ein Dreinreden von Theoretikern gefallen lassen, ist eine wohl bekannte Thatsache. –
Der Satz ist wohl unanfechtbar, daß, wer mit der Außenseite des menschlichen Körpers zu thun hat, diesen kennen muß: der Schuhmacher das Knochengerüst des Fußes, der Sesselmacher das des ganzen Körpers. Und doch ist es erst in der Neuzeit und erst theilweise gelungen, z. B. das ehrenwerthe Schuhmachergewerbe zur Anerkennung dieses Satzes und zur Reform einer traditionell geübten widersinnigen Fußbekleidung zu veranlassen. (Vergl. „Gartenlaube“ Jahrgang 1877, S. 333 [WS 1] und Jahrgang 1883, S. 55.)
Bei den Tapezierern ist noch heute eine derartige Kenntniß durchschnittlich nicht vorhanden, und insbesondere wird sie auf den Bänken der Eisenbahnwagen hartnäckig verleugnet. Dieses dem reisenden Leser nachzuweisen – und welcher Leser wäre heutzutage nicht ein reisender! – ist nicht schwer; möglicher Weise gelingt mir auch, seine Geduld, mit welcher er Jahr für Jahr unbequem zu reisen pflegt, zu erschüttern. Aber darum hoffe ich doch kaum, daß meine kleine Predigt zu einer Besserung auf diesem Gebiete verhelfen könne. Denn der Nachweis einer Verkehrtheit und deren Beseitigung liegen manchmal ein Jahrhundert auseinander.
Wenn der Mensch sich setzt, so übernimmt statt der unteren Extremitäten das Becken die alleinige Function, den Oberkörper zu tragen. In das Becken ist die Wirbelsäule eingesenkt, und zwar nicht wie ein gerader Stock, sondern in einer ≀förmigen Linie (vergl. Skizze a.) Der Schwung dieser Linie erhöht die Bewegungsfähigkeit unseres Rumpfes, nöthigt denselben aber zugleich zu einer fortwährenden Balance, denn der Schwerpunkt wechselt, je nachdem der Brustkorb mit seinen Anhängseln und der Kopf hierhin oder dorthin lasten.
Die Balance ist eine Thätigkeit und jede Thätigkeit Anstrengung. Soll der Oberkörper wirklich der Ruhe genießen, so bedarf er der Stützpunkte für Rücken, Schultern und Kopf, und werden ihm diese auf die Dauer nicht gewährt, hält ihn zugleich die Willenskraft nicht länger aufgerichtet, so sinkt er allmählich nach vorn, was bis zu dem Grade geschehen kann, daß die Stirn auf den Knieen aufzuliegen kommt. Hier ist also der Sitzende, wenn er nach hinterwärts und seitwärts keinen Halt fand, auf die Hülfsmittel angewiesen, welche ihm der Mechanismus seines eigenen Körpers gewährt.
Anders und günstiger wird das Verhältniß beim Vorhandensein einer Lehne. Der Oberkörper „lehnt sich an“, das heißt die Rückenwirbel, die Schulterblätter, womöglich auch der Kopf finden Stützpunkte. Je entschiedener die Rückwärtsneigung, je stumpfer der Winkel zwischen Oberschenkel und Rumpf, um so entschiedener die Ruhebefriedigung. Die modernen Sessel, sogenannte Faulenzer, Schlummerstühle etc. sind in diesem Sinne vorzügliche Leistungen. Eine derartige Bequemlichkeit kann nun freilich aus räumlichen und wohl auch aus Anstandsgründen den Eisenbahnreisenden nicht gewährt werden. Aber es erscheint deshalb nicht geboten, denselben bei ihrem einförmig aufrechten Sitz die Wohlthat einer geeigneten Rücken- und Schulterstütze vorzuenthalten.
Zur Erläuterung des Gesagten diene der Umriß eines bequem sitzenden, angelehnten Menschen. Das Rückenkissen unterstützt ihn insbesondere unter dem Schulterblatt, wölbt ihm den Brustkasten und bringt den Oberkörper in eine freie gesunde Lage. (Vergl. Abbildung b.)
Skizze c zeigt dieselbe Person mit rückwärts geneigtem Kopfe. Die Stellung beider Figuren entspricht genau dem Polsterprofil. Es ist dasjenige, welches mir für die Eisenbahncoupés geeignet scheint.
Dagegen habe ich in Skizze d das in unsern heutigen Coupés zweiter Classe übliche Profil gezeichnet. Dasselbe nöthigt, wie Figura zeigt, zu einer durchaus gezwungenen, unschönen und weniger gesunden Stellung.
In Skizze e wird ersichtlich, in welch steifer Lage der Kopf verharren muß, wenn er angelehnt wird.
Skizze f endlich wiederholt die zweckmäßig angelehnte Figur c und giebt zugleich das heutzutage übliche Normalprofil des Rückenpolsters. Bei Vergleichung beider Profile, des unserer Figur und des Polsters, ergeben sich für letzteres folgende Mängel:
1) Die Lehne ist zu senkrecht;
2) sie läßt zwischen den Lendenwirbeln und dem untern Rande der Schulterblätter - genau an der Stelle, wo man, wie der Ausdruck heißt, ein Kissen „in den Rücken“ zu legen pflegt - einen hohlen Raum bestehen; 3) sie ist mindestens um etwa 1/2 Fuß zu hoch (sie pflegt die Scheitelhöhe einer aufrecht sitzenden Person mittlerer Größe zu haben) und macht dadurch dem Kopfe jede, auch die geringste Rückwärtsneigung unmöglich.
Bei so beschaffenen Sitzverhältnissen pflegt dann der Reisende, wenn er schlummert, alsbald zu einem Häufchen Elend zusammen zu sinken. Er wird nach und nach so weit hinunter rutschen, bis der untere Rand seiner Schulterblätter - da wo die Unterstützung am erwünschtesten - die größte Kissenausladung gefunden hat, und diese findet in unsern Waggons gerade an der unnöthigsten Stelle, in der Beckengegend statt. Der Kopf endlich wird nach vorn oder gar zur Seite pendeln, sofern es ihm nicht gelingt, sich in die Weste einzugraben (vergl. Skizze g).
Ich erblicke auf meiner einsamen Fahrt vor mir die leere Sitzfaçade. Unzählige Reisende haben an dieser selben Stelle gesessen, stundenlang
[19] das ungeheuerliche Polsterwerk vor Augen gehabt und wahrscheinlich – nichts gesehen! Die Einsamkeit wird wohl meine Betrachtung geschärft haben. Hier das gezeichnete Resultat derselben. Wir sehen das Wandpolster gegenüber in der Mitte getheilt und zwar in Kopfhöhe durch eine Art von überzogenem Prellstein, welcher für die Wange je eines Passagiers bestimmt ist.[2] Man sollte meinen, der Erbauer dieses Werkes müßte sich erinnert haben, daß die Wange nur ruhen kann, wenn auch die Schulter ruht, müßte also vor Allem für eine Schulterstütze gesorgt haben.Aber nein, für die Schulter ist der leere Raum unter dem Prellsteine bestimmt. Dafür aber hat die Phantasie des Schöpfers weiter unten – etwa eine Handbreite über dem Sitze – eine Art von Pilz tellerartig aus der Wand herauswachsen lassen, auf welchem von jeder Seite ein Ellbogen oder vielmehr ein halber aufliegen soll (vergl. Skizze h und i). Es giebt kaum ein ergiebigeres Feld für „Anrempelung“, als dieses, und es gewährt mir eine belustigende Vorstellung, wenn ich mir zwei neben einander reisende Minister oder Gesandte, einen deutschen und einen französischen, vergegenwärtige, welche auf diesem Berührungsfelde eine Grenzstreitigkeit in Scene setzen und sich brüskiren könnten.
|
|
An der Fensterseite ist für die Schulter wieder nichts da, als die senkrecht ansteigende Seitenwand, eventuell das Fenster.
Hier ist noch hinzuzufügen, daß das in der zweiten Classe übliche unangemessene Polsterprofil in den beiden andern Classen seine Ergänzung findet, weniger erkennbar allerdings bei den weichen Sammetpolstern der ersten Classe und in der dritten Classe durch eine fast senkrechte Holzwand ersetzt, welche wohl geeignet scheint, um daran ein Placat, nicht aber einen Menschen festzunageln.
Was nun die ästhetische Seite der vor mir aufgebauten Façade betrifft, so seien mir auch darüber ein paar Worte erlaubt.
Die Zeit ist nachgerade vorüber, wo man die Wohlgefälligkeit einer Form als den Tod von deren Zweckmäßigkeit anzusehen pflegte. Tritt doch der Staat jetzt durch entsprechende Anstalten für künstlerische Schulung des Handwerks ein. Kann angesichts dessen ein Grund bestehen, um innerhalb der Tausende von Eisenbahnwagen, welche ununterbrochen durch unser Vaterland rollen, den Ungeschmack – ich möchte sagen – schulmäßig zu pflegen? Würden nicht wenigstens auf den Staatsbahnen Versuche mit einer verständigeren und wohlgefälligeren Tapezierung anzustellen sein? –
Während ich in dieser Weise innerlich raisonnirte, war es ganz dunkel geworden und die Lampe noch nicht in die Decke eingelassen. Da sah ich plötzlich einen Schatten mir gegenüber sitzen und erkannte deutlich den guten alten Schlendrian, genau wie ihn die „Wespen“ gezeichnet. Er trug Zipfelmütze und Tabaksdose und nickte mir schelmisch zu.- ↑ Vergl. „Gartenlaube“ Jahrg. 1880, S. 245: „Ein Vorkämpfer für Kaiser und Reich“
- ↑ Ein künstlerisch geschulter Decorateur hätte an dieser Stelle die Anwendung der Voluten-Form nicht umgehen können.
Hauswirthschaftliches.
Nachdem man erkannt hatte, daß durch das Athmen wie durch den Verbrennungsproceß Sauerstoff verbraucht, dagegen Kohlensäure und Wasser erzeugt wird, lag die Vorstellung nahe, in der Verminderung des Sauerstoffs und der Vermehrung der Kohlensäure sei die gewöhnliche Ursache der Luftverschlechterung in bewohnten Räumen zu suchen. Das ist aber ein Irrthum, welcher oft sogar in neuesten Vorträgen und Schriften wiedergegeben wird. Noch unlängst ist es auch in einer Gesellschaft von Technikern vorgekommen, daß Jemand ein Fenster öffnete mit den Worten: „Laßt Sauerstoff herein“, wozu ein anderer ergänzte: „und Kohlensäure hinaus!“
Lange bevor die Veränderungen der Sauerstoff- und Kohlensäureremengen bis zu einem Besorgniß erregenden oder nur belästigenden Grade anwachsen können, was in unseren undichten Wohnräumen kaum jemals möglich ist, wird die Zimmerluft durch die Anhäufung organischer Ausdünstungsstoffe zur weiteren Benützung als Lungenspeise untauglich.
Die Natur dieser gesundheitsschädlichen organischen Stoffe in der ausgeathmeten Luft zu bestimmen, ist bis jetzt nicht möglich gewesen. Man nimmt aber an, daß sie sich im gewissen Verhältniß zu der Kohlensäure in der Luft bewohnter Räume ansammeln, und hat darum den Kohlensäuregehalt der Zimmerluft als Maßstab für deren gesundheitswidrige Zusammensetzung beibehalten. Mit der Verbreitung der Kenntniß dieser Thatsache ist jedoch nicht viel geholfen.
Damit die Ueberzeugung von dem häufigen Vorhandensein schädlicher Luft in bewohnten Räumen, also auch von der Nothwendigkeit der Luftverbesserung, in den weitesten Kreisen bis zu den unteren Volksschichten Wurzel faßt, damit ferner die Wirkungen der Luftverbesserungsmittel oft und leicht erprobt und verglichen werden können, ist es noch nothwendig, jedem Arzte, Techniker, Lehrer, ja jeder Person die Ausführung von Luftprüfungen zu ermöglichen.
Für diesen Zweck bedarf es keiner sehr genauen Messung der Kohlensäure, es genügt eine annähernde Bestimmung mit geringem Aufwand an Mitteln, Zeit und Mühe.
Professor Dr. Lunge in Zürich hat 1877 in einer kleinen Schrift über Ventilation einen Apparat empfohlen, welcher nach seiner Vermuthung zuerst von Angus Smith vorgeschlagen worden ist. Dieser „minimetrische“ Apparat zur Bestimmung der Luftverunreinigung ist nicht in wünschenswerther Weise handlich und zuverlässig, hat daher wenig Verbreitung gefunden. Ueberdies braucht man dazu Barytwasser, ein Gift. Die Anwendung solchen Giftes bei einem Apparate, welcher für so vielseitige Benutzung, namentlich auch in der Volksschule und Kinderstube, bestimmt ist, muß selbstverständlich Bedenken erregen.
Mein Bestreben, den erwähnten Apparat zu vervollkommnen, hat nun einen neuen minimetrischen Luftprüfer geschaffen, welcher für Ventilationszwecke vollkommen hinreichen dürfte.
Erste Bedingung war mir die Anwendung von Kalkwasser. Dieses ist nicht giftig und verhält sich gegen die Kohlensäure wie Barytwasser; eine gewisse Menge Kalkhydrat ist in Wasser löslich, und durch Hinzukommen von Kohlensäure wird das Kalkwasser trübe, dann entsteht in demselben ein Niederschlag von kohlensaurem Calcium. Kalkwasser kann sich Jeder selbst bereiten, auch sehr billig in einer Apotheke kaufen.
Die wesentlichen Theile des Luftprüfers sind ein cylindrisches Glasgefäß und ein kleiner Gummiballon mit einem Glasröhrchen. Das Cylindergefäß von 12 Centimeter Länge und 12 Millimeter Weite hat in der Höhe, welche dem Inhalte von 3 Cubikcentimetern entspricht, einen wagrechten Strich als Füllzeichen, und am Boden die Zahl 1882 schwarz auf weißem Grunde als Visirzeichen. Bis an den Strich wird klares Kalkwasser eingefüllt, dann wird mit dem Gummiballon so lange Luft in das Kalkwasser gedrückt, bis in Folge der entstandenen Trübung das Visirzeichen nicht mehr zu erkennen ist.
Welchen Kohlensäuregehalt die zu prüfende Luft hat, ergiebt sich aus der Anzahl der Ballonfüllungen, welche durch das Kalkwasser gedrückt werden mußten, um die maßgebende Trübung hervorzubringen. Sie entsteht schon bei einer Füllung, wenn die Luft zwei Raumprocent Kohlensäure enthält. Dieses Verhältniß bildet die Grundlage einer Tabelle, welche man in beliebiger Ausdehnung dadurch berechnet, daß man mit den Zahlen der Füllungen in zwei Procent dividirt. So entsprechen beispielsweise
| 2 | Ballonfüllungen | 1 | Procent Kohlensäure, |
| 4 | „ | 0,5 | „ „ |
| 10 | „ | 0,2 | „ „ |
| 20 | „ | 0,1 | „ „ |
Wenn man mit weniger als zehn Füllungen schon die maßgebende Trübung erreicht, ist die Luft entschieden zu unrein, als daß man sie ohne Nachtheil athmen könnte. Bei zehn bis zwanzig Füllungen ist auf einige Zeit der Aufenthalt in solcher Luft zulässig. Entsteht die Trübung [20] erst bei mehr als zwanzig Füllungen, dann ist für gewöhnliche Verhältnisse die Luft als gut zu bezeichnen. In Krankenzimmern aber soll gewöhnlich erst mit etwa dreißig, bei ansteckenden Krankheiten mit vierzig bis fünfzig Füllungen die vollständige Trübung des Kalkwassers eintreten.
Der für solche Luftprüfungen nöthige Zeitaufwand ist um so größer, je reiner die Luft ist; doch sind einige Minuten immer ausreichend.
Kaiserslautern. Prof. Dr. H. Wolpert.
Wiederum eine neue Kaffeemaschine. Bei der Zubereitung unseres „täglichen Getränkes“ ist im Allgemeinen nur sein Wohlgeschmack maßgebend. Ob diese Zubereitung gesundheitsgemäß oder gesundheitsschädlich sein kann, daran denken nur selten unsere Frauen, obwohl hervorragende Aerzte diese Frage längst beantwortet haben. So hat unter Anderen Professor J. Wiel, der bekannte Verfasser des weit verbreiteten Buches „Tisch für Magenkranke“ nachgewiesen, daß das Kochen des gemahlenen Kaffees zu verwerfen sei und daß nur der Aufguß von kochendem Wasser auf den gemahlenen Kaffee und die Extraction des letzteren bis zu einer bestimmten Grenze einen gesundheitsgemäßen Kaffee liefern könne. Er selbst sagt darüber:
„Solcher Kaffee wird nicht nur gut vertragen, sondern fördert auch die Verdauung, indem er theils als Verdünnungsmittel des Speisebreies, theils als Reizmittel für den Magen dient. Die sonst in vielen Häusern und Gegenden mehr übliche Form der Abkochung ist für Magenkranke nicht geeignet, da solcher Kaffee einen großen Tanningehalt bekommt und dadurch die Verdauung stört.“
Auf diesem Princip des Aufgusses beruhen bekanntlich die meisten von der „Gartenlaube“ schon früher empfohlenen Kaffeemaschinen und nach ihm ist auch die neueste, welche wir heute unsern Lesern vorführen, hergestellt. Als Maschine für täglichen häuslichen Gebrauch hat sie aber einen nicht zu unterschätzenden Vorzug, nämlich den der sehr einfachen Construction. Ihr Boden besteht aus einem feinen Drahtsiebe, auf welches der gemahlene Kaffee geschüttet wird, darauf wird nun das Einsatzsieb gesetzt und durch eine Drehung nach rechts festgeschraubt. Jetzt stellt man die Maschine auf eine beliebige Kaffeekanne und gießt so viel kochendes Wasser auf einmal auf, bis die Maschine gefüllt ist, sodaß man noch den Deckel aufsetzen kann. Nach etwa zehn Minuten ist die Filtration beendet und der Kaffee fertig. Davon, daß hierdurch der Kaffee vollständig ausgenutzt wurde, kann sich Jeder leicht überzeugen, denn wenn jetzt auf den Kaffeesatz nochmals kochendes Wasser gegossen wird, so erhält man ein Product voll heller Farbe, das bitter und widerlich schmeckt und nicht die Spur von Aroma besitzt. Wem der zuerst durchgelaufene Kaffee zu stark ist, der muß ihn durch heißes Wasser verdünnen, da ein wiederholter Aufguß aus dem angegebenen Grunde zu vermeiden ist.
Diese Kaffeemaschine, welche von der Firma Gebr. Arndt in Quedlinburg fabricirt wird und in den meisten Detailhandlungen vorräthig sein dürfte, zeichnet sich außerdem durch ihre Billigkeit aus, da eine solche Kaffee-Aufgußmaschine für zwei Tassen 1 Mark 60 Pfennig, für 4 Tassen 2 Mark und für 6 Tassen 2 Mark 25 Pfennig kostet. Die größte für 20 Tassen bestimmte ist für den Preis von 4 Mark 50 Pfennig zu beziehen.
Luftdichter Fensterverschluß. Das trauliche Plätzchen am Zimmerfenster, das wir während des Sommers so gern aufsuchen, ist während der Wintermonate ein für alle Familienmitglieder verpönter
Ort, denn fast sämmtliche Fenster unserer Wohnungen gestatten durch ihre Fugen der kalten Luft von außen den freiesten Zutritt, und sind so die Quelle des vollendetsten Luftzuges. Gegen dieses verstohlene und unerwünschte Eindringen des Winters in unsere Wohnräume hat man schon die verschiedensten Mittel angewandt, man verstopft z. B. die Fensterfugen mit Moos, Tuchflicken, Filz etc. Für kurze Zeit schaffen diese Hausmittel die gewünschte Abhülfe, nur sind sie leider nicht dauerhaft und verderben auch gelegentlich den Fensterrahmen, indem sie die Feuchtigkeit annehmen und das Faulen des Holzes beschleunigen. In dieser Hinsicht bietet ein von W. Dreßler in Zeitz eingeführtes Verfahren wesentliche Vortheile. Die Dichtung wird bei demselben durch Einlegung von Gummischläuchen in die Falze erzielt. In den Fensterrahmen wird zu diesem Zwecke eine unter sich greifende Hohlkehle (A) angebracht, in welche der Gummischlauch (C) so eingelegt wird, daß er etwa zwei Millimeter über dem Holze vorsteht. Vermöge seiner Elasticität schließt er die Fuge (BZ) vollständig luft- und wasserdicht ab.
Um jedoch die Ventilation der Zimmerluft durch die Fensterfugen nicht gänzlich aufzugeben, muß man nur die untersten Fugen mit einer ähnlichen Vorrichtung versehen, die oberen dagegen freilassen. Selbstverständlich kann man auch bei schlecht schließenden Thüren mit größeren Gummiröhren denselben Erfolg erzielen.
W. Dreßler versieht noch die Fenster am Wasserschenkel mit einer einfach construirten Zinkklappe, welche das Eindringen von Regenwasser in die Fugen verhindern soll. Das Anbringen dieser Vorrichtung an neuen Fenstern ist nur mit geringen Kosten verbunden.
Zweisilbige Charade.
Der Sonne Pracht, des Himmels Blau,
Des Waldes Grün, der Lerche Lieder,
Des Mondes Glanz, der Blüthen Thau
Sind uns die Erste immer wieder.
In jeder Zweiten schmücken sie
Mit holdem Zauber uns’re Erde,
Und jedes Herz entzücken sie,
Seitdem der Schöpfer sprach sein „Werde!“.
Und wenn die Zweite ist geschieden,
Erscheint die Zweite auf der Stelle.
Wir wünschen Segen, Glück und Frieden
Zum Ganzen an der Zweiten Schwelle.
Domino-Aufgabe. Von 4 Spielern, welche eine Domino-Partie beginnen, hat jeder 7 Steine zu nehmen. Der erste Spieler erhält folgende Steine:
Wie müssen nun die übrigen 21 Steine unter die 3 anderen Spieler vertheilt werden, damit der erste den höchsten Gewinn von 120 Augen erzielen kann?
Die obigen Zahlen sind durch Buchstaben so zu ersetzen, daß man Wörter mit einem gleichen Endlaute erhält. Die Anfangsbuchstaben nennen unseren Lesern eine gute Bekannte.
I. Göttin der Römer. II. Deutsche Universitätsstadt. III. Pflanze. IV. Stadt in Mittel-Deutschland. V. Stadt in Italien. VI. Stadt im nordöstlichen Europa. VII. Kopfbedeckung. VIII. Eine der Hauptrollen in einer Oper von Richard Wagner. IX. Stadt am Mittelländischen Meere. X. Stadt in Süd-Amerika. XI. Nebenfluß der Donau. XII. Feldherr. XIII. Hochland in Afrika. XIV. Altnordische Sammlung.
[Inhaltsverzeichnis dieses Heftes, hier nicht übernommen.]
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Vorlage: 33