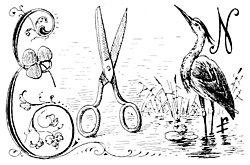Die Gartenlaube (1892)/Heft 10
Der Klosterjäger.
Seit zwei Tagen hauste Haymo wieder einsam in der Röth’. Spät abends hatte er am „Grünen Donnerstag“ die Jagdhütte erreicht. Walti, den er in der Nähe der Kreuzhöhe getroffen, hatte den Jäger in der Dämmerung für einen Raubschützen angesehen und nicht übel Lust gezeigt, die Armbrust auf ihn abzuschießen. Dann gab es freilich ein lachendes Erkennen. Während des ganzen Heimwegs hatte der Bub zu erzählen; für ihn war jeder Schritt ein Abenteuer gewesen.
Als sie zur Hütte kamen, fanden sie den Frater Severin schnarchend auf dem Heubett. Sie weckten ihn, und da meinte der Frater, es ginge zur Mette.
„Ui jei!“ sagte er lachend, als er sich die Augen gerieben
[294] hatte. Aber aus dem Lachen gerieth er gleich wieder in flammende Entrüstung. Haymo, so meinte er, hätte wohl auf den guten Einfall kommen können, einen Krug voll „Güte Gottes“ oder ein Fläschlein mit „des Hilnmels höchster Huld“ aus dem Kloster mit herauf zu bringen. Haymo sah ein, daß seine Sünde groß war, zwar nicht vor Gott, aber wohl vor einem seiner „Knechte“. Nun mußte sich der arme Frater Severin nach dem fetten Sterz, den es zum Nachtmahl gab, mit einem Trunk Wasser schlafen legen. Brrr! Er liebte das Wasser nicht einmal in den Schuhen, viel weniger im Magen.
Das „himmelschreiende Unglück“ schien ihm aber doch den Schlaf nicht zu verkümmern. Er schnarchte gewaltiger als je.
Haymo und Walti hatten wieder auf dem Herd ihr Nachtquartier aufgeschlagen, die glimmenden Kohlen zwischen sich. Draußen das dumpfe Rauschell des Föhns.
„Walti?“ fragte Haymo nach langem Schweigen mit leiser Stimme. „Schlafst schon?“
Der Bub richtete sich auf.
„Walti, ich möchte Dir ’was schenken, eh’ Du fortgehst. Was willst denn haben?“
„Die Feder von Eurer Kappe!“ platzte der Bub heraus.
„Sollst sie haben, nimm sie Dir nur morgen früh! Mußt mir aber auch einen Gefallen thun.“
„Redet nur, was?“
„Weißt Du, wo die Gittli haust?“
„Die Müllerdirn’?“
„Nein, die Schwester des Sudmanns.“
„Ach, die! Ja … warum?“
„Dann geh’ zu ihr, morgen, und frag’ sie, warum sie geweint hat in der Vogtstube.“
„Was soll ich sie fragen?“ wiederholte Walti, dem die Sache etwas dunkel vorkam.
„Du sollst sie fragen, warum sie geweint hat heute, wie sie bei Herrn Schluttemann in der Stube war. Sag’ ihr nur, daß ich es wissen will! Und wenn ich am Ostersonntag hinunterkomm’, dann sag’ es mir wieder! Verstehst Du?“
„Wohl, wohl!“ nickte Walti. „Aber ich kann mir schon denken, warum sie geweint hat. Der Herr Vogt wird halt giftig gewesen sein und hat sie bei den Ohren genommen. Ja, das thut er gern, das weiß ich!“ Gähnend streckte er das kluge Haupt auf die zum Kissen geballte Lodenkutte. Aber nach kurzer Weile schon richtete er sich wieder auf.
„Haymo?“
„Ja?“
„Jetzt weiß ich, was für eine Gittli die richtige ist!“
„So?“ lächelte Haymo.
„Wohl, wohl!“ Und kichernd legte sich der Bub wieder aufs Ohr.
Bald darauf schliefen sie alle beide.
Am andern Morgen, eh’ der Tag noch graute, verließ Haymo die Hütte, um seinen Hegergang anzutreten. Er hätte seinen Gästen gern ein Wort zum Abschied gesagt; aber die beiden schnarchteu doppelstimmig so rührend zusammen, daß ihr gesunder Schlaf einen Stein hätte erbarmen können. Haymo nahm die Adlerfeder von seiner Kappe und steckte sie auf Waltis Filzhut. Dann ging er.
Als er mit dem Abend in die Hütte zurückkehrte, waren die beiden Klostervögel lange schon ausgeflogen. Haymo zündete nicht einmal Feuer an, so müde war er. Er spürte die beiden auf den Herdsteinen verbrachten Nächte in allen Knochen; und er hatte sich heute geplagt wie nie. Keinen der Hut bedürftigen Platz in seinem weiten Revier hatte er unbesucht gelassen, jeden Steig und jeden Schneefleck hatte er abgespürt. Er wollte nicht ein zweites Mal so dastehen wie gestern in der Vogtstube. Herr Schluttemann war so liebevoll mit ihm umgesprungen wie die Katze mit der Maus; nur das Verschlucken hatte noch gefehlt. Aber auch Herr Heinrich hatte zu den beiden vermißten Steinböcken eine strenge Miene gemacht; doch er war nicht ungerecht gewesen und hatte auf Haymos Rechtfertigung gehört, trotz Herrn Schluttemann, der die Tischplatte gehörig donnern ließ. Schließlich war Haymo vom Propst sogar mit freundlicher Rede entlassen worden. „Und wenn es Dir Freude macht,“ hatte Herr Heinrich gesagt, „so magst Du am Feiertag nach der Frühpirsche herunterkommen zum Ostertanz!“
Diese Güte wollte Haymo mit doppeltem Fleiß vergelten. Wenn es das Glück nur wollte, daß ihm einer der Raubschützen bald in den Weg geriethe. Er ballte die Fäuste bei diesem Gedanken. Doch mitten in seinen flammenden Zorn hinein hörte er die Geigen und Pfeifen klingen.
Ob Gittli wohl zum Tanz käme? Nun, eine Dirn’, die nicht kommt, die kann man ja holen! An diesen Gedanken spann Haymo hundert andere, bis all sein Denken und Sinnen unmerklich hinüberfloß in Schlaf und Traum.
Nach dieser Nacht kam ein mühsamer Tag. Der Föhn tobte, als möchte er das ganze Haus der Berge in Trümmer werfen. Er wehte schwül wie der Sturm vor einem Gewitter. Der Schnee auf den steilen Halden schwand vor seinem Hauch, daß man es mit Augen sehen konnte, wie er weniger und weniger wurde. Ueber allen Felswänden wurde die weiße, starre Decke des Winters lebendig, und während die Lawinen rollten ohne Unterlaß, führte der Föhn den stäubenden Schnee in ganzen Wolken durch die Lüfte.
Haymo mußte sich vorwärts kämpfen Schritt um Schritt; den halben Tag verbrachte er auf der Jagd nach seiner Kappe. Gegen Abend, auf dem Heimweg, kam er am Kreuz vorüber. Leer starrten die Fußnägel aus dem Holz. Wo waren Gittlis Schneerosen hingekommen? Der Föhn hatte sie wohl entführt? Haymo spähte auf der Erde umher; in einer Steinschrunde sah er eine der Blüthen liegen, zerzaust und welk. Er hob sie auf und wollte sie auf seine Kappe stecken. Doch nein … die Blume gehörte schon einem andern. Lächelnd schob er sie wieder zwischen die beiden Nägel; kaum aber ließ er die Hand davon, da trug der Föhn sie schon hinweg.
Vor Einbruch der Nacht erreichte Haymo die Hütte. Heute blieb ihm keine Zeit zum Sinnen und Träumen. Die Augen drohten ihm schon zuzufallen, während er am flackernden Feuer seinen Imbiß bereitete. Kaum lag er auf dem Heubett, da schlief er auch schon. Rings um die Hütte tobte der Frühlingssturm und sang ihm ein brausendes Schlummerlied …
Als Haymo erwachte, war es noch finstere Nacht. Er lauschte verwundert. Diese Stille um die Hütte. Kopfschüttelnd trat er ins Freie; der Föhnwind hatte sich völlig gelegt, und nur noch leise rauschte der Bergwald. Blasse, dünne Nebelschleier flogen über den Himmel, an welchem in zahlloser Schar die Sterne funkelten. Der frische, klare Morgen versprach einen schönen Tag.
„Es wird Osterwetter!“ sagte Haymo. Dann blickte er nach dem Stand der Sterne und meinte, daß die dritte Morgenstunde wohl schon vorüber wäre. Da war er just zur richtigen Zeit erwacht, um den Auerhahn zu „verlusen“[1], den Herr Heinrich nach den Ostertagen erlegen wollte.
Haymo sperrte die Hütte zu und wanderte in die Nacht hinaus. Nun plötzlich blieb er lauschend stehen. Töne waren an sein Ohr gedrungen, wie Hammerschläge auf klingendes Eisen … nun wieder die gleichen Töne und noch ein drittes Mal. Kopfschüttelnd lauschte er; er wußte sich’s nicht zu deuten, aber es machte ihm keine Sorge, denn wer im Bergwald auf bösen Wegen schleicht, der thut es in aller Stille. Da war wohl einer der Almbauern, den die Arbeit am Tage festhielt, während der Nacht zu Berge gestiegen um mit dem frühen Morgen nachzuschauen, wie seine Sennhütte überwintert hätte … und an der Hüttenthür hatte er wohl mit seinem Hammer die eisernen Klammern losgeschlagen. Es war dem Lauschenden freilich gewesen, als klängen diese Tone nicht von den Almen her, sondern von einer höher gelegenen Stelle. Aber Haymo wußte aus Erfahrung, wie sehr ein Hall in der Nacht zu täuschen vermag. Eine Weile noch lauschte er; doch alles blieb still. Nun schritt er weiter; quer durch das Felsenthal, auf dem kürzesten Wege, stieg er zum Kreuzwald empor. Es dämmerte, als er sein Ziel erreichte. Lautlos, nach jedem Schritt horchend, schlich er von Baum zu Baum. Ueber den östlichen Bergen, jenseit der Schneefelder des Steinernen Meeres, zeigte sich noch kaum ein fahler Schimmer des nahenden Tages, da hörte Haymo schon das leise „klipp klipp“ des falzenden Huhnes. Achtsam sprang er ihn an, und endlich sah er auf einem dürren Aste den stolzen Vogel sitzen, der sich in seiner Schwärze scharf abhob vom erblassenden [295] Himmel. Eine Weile schaute er dem verliebten Sänger zu, wie er auf seinem Ast sich blähte und drehte, mit gefächertem „Stoß“ und zitternden Schwingen gaukelte, dann aber, als es so licht wurden daß Haymo über den Augen des Vogels schon die glühende „Rose“ zu erkennen vermochte, schlich er leise zurück, um den Hahn nicht zu „vergrämen“. Und je weiter es bergabwärts ging durch den Wald, desto rascher wurde sein Schritt, desto fröhlicher sein Blick. Nun ging es ja hinunter ins Thal, zum fröhlichen Fest, zum Ostertanz. Arm in Arm und Wang’ an Wange mit Gittli!
Ob er wohl mit jener andern auch einen Reigen tanzen würde? Wie hieß sie nur? Richtig. Zenza! Nun, vielleicht … wenn Gittli müde war und nichts dawider hatte. Müde? Die Gittli?
Er mußte laut auflachen. Doch plötzlich verstummte er. Aus dem Felsenthal heraus hatte er einen Laut gehört … wie das Kollern eines gelösten Steines. Ging jemand dort unten? Aber nein! Aesendes Steinwild oder eine ziehende Gemse hatte wohl den Stein gelöst! Weg mit der Sorge! Heute durfte er Wild und Bergwald beruhigt verlassen, denn so gottverloren war ja doch kein Mensch in allen Thälern rings umher, um Raub zu treiben am heiligsten Tage des Jahres.
Der volle Morgen erwachte; ein rother Schimmer fiel über den Wald, und die Kuppen der Berge leuchteten in der steigenden Sonne wie glühendes Erz. Als Haymo den Saum des Kreuzwaldes erreichte, ließ er sich zu kurzer Rast auf einen Felsblock nieder und staunte mit seinen lachenden Augen hinein in den schimmernden Glanz des schönen Morgens.
Von seinen Lippen wollte sich ein Jauchzer lösen, aber gewaltsam hielt er den jubelnden Aufschrei zurück, denn im Steinthal zu seinen Füßen, auf etwa tausend Gänge, sah er auf schneefreiem Hang einen Steinbock weiden. Er wollte das Thier, dem die Aesung noth that, nicht verscheuchen. Ohne Bewegung saß er und schaute dem Wild zu, wie es langsam über die Halde hinwegzog und seine kärgliche Nahrung suchte. Nun plötzlich warf das Thier den „Grind“ mit dem mächtigen Gehörn in die Höhe ... es schien Gefahr zu wittern ... in scheuer Eile suchte es den Schutz der nahen Felswand, doch ehe die Wand noch erreicht war, that es mit schlagenden Läufen einen Satz in die Luft, stürzte nieder, raffte sich wieder auf und verschwand in einer tieferen Mulde.
Haymo fuhr erblassend auf; das ging nicht mit rechten Dingen zu! Ein Ruck, und er hielt die Armbrust in Händen … ein lautloser Sprung, und er stand geborgen in dem dichten Gestrüpp der Zwergföhren, welche den Grat der Kreuzhöhe bedeckten. Geschmeidig wie eine Schlange glitt er durch das wirre Gezweig, und als er durch die letzten Büsche den Ausblick in die Mulde gewann, da schlug ihm das Herz und zitterten ihm die Hände in Zorn und brennender Erregung. Er sah, wie ein Mensch in Bauerntracht, mit schwarz berußtem Gesichte, den verendeten Steinbock nach einem nahen Dickicht schleifte.
„Hab’ ich Dich endlich, Du Dieb!“ zischte es durch die Zähne des Jägers, alles Zittern wich von ihm, und als er die Sehne der Armbrust spannte und den Bolzen in die Schiene legte, waren seine Hände wie Stahl und Eisen. Er hob die Wehr an seine Wange, aber durch die dichten Zweige hatte er keinen sichern Schuß. Lautlos erhob er sich, um hinauszuschleichen an den Rand der Büsche; dort draußen stand das Kreuz; hinter dem breiten Holze konnte er sich decken und hatte einen freien Schuß.
Jetzt wand er sich hervor aus den letzten Zweigen, jetzt hob er die Waffe … und da plötzlich rann es ihm durchs Herz wie kalter Schatter. Vom Kreuz hernieder blickte das lebensvolle Bildniß des Erlösers.
Gewaltsam wollte Haymo die Blicke wenden, allein er brachte sie nicht los von dem heiligen Bilde; mit ernsten, kummervollen Augen sah es auf ihn nieder, es schien zu leben in seinen frischen Farben, das rothe Blut an seinen Wunden schien eben jetzt geflossen … dem Jäger war es, als beginne es in den großen blauen Augen sonnengleich zu leuchten, als öffne sich der schmerzensbittere Mund und spreche mit sanften Worten: „Haymo! Willst Du morden an meinem Ostertag, der allen Menschen sein soll wie ein Tag des Glücks und der Versöhnung? Thu’s nicht, Haymo, thu’s nicht!“
In Haymos Händen neigte sich die Armbrust, und der Bolzen fiel aus der Schiene. Der Jäger hob ihn auf mit bebender Hand und küßte die Füße des Gekreuzigten.
Dann stieg er lautlosen Schrittes den Hang hinunter; der Raubschütz, der im dichten Gebüsch an dem erlegten Wild hantierte, hörte ihn nicht kommen; auf der Erde sah Haymo die Armbrust des Räubers liegen; er faßte sie und schleuderte die Waffe mit mächtigem Schwung hinaus in das Steingeröll; da fuhr der Raubschütz in die Höhe, und als er den Jäger sah, befiel ihn ein Wanken und er griff mit beiden Händen in die Luft.
„Wer bist Du?“ fragte Haymo mit harter Stimme.
Der andre stand wortlos, zitternd, und starrte vor sich nieder.
Haymo suchte ihn zu erkennen aber vergebens. Der Jäger war ja fremd im Thal und hatte nur wenige Menschen erst gesehen, auch trug der Räuber den Bart und die Haare mit Ruß bestäubt, und das Gesicht war mit Schwärze so dick bestrichen, daß Haymos forschender Blick kaum einen Zug erfassen konnte.
„Komm!“ sagte Haymo und deutete mit dem Arm die Richtung an.
Der Gefangene voran und der Jäger mit gespannter Armbrust hinter ihm, so schritten sie über den Hang empor, mit blitzenden Augen folgte Haymo jeder Bewegung des Raubschützen. Auf halber Höhe verhielt der Gefangene den Schritt, in seinem finstern Auge glühte die Verzweiflung.
„Jäger … es war das erste Mal … und ich that es aus Noth!“
„Geh’!“
„Jäger … ich habe Weib und Kind … sie gehen zu Grunde!“
„Durch Deine Schuld!“
Ein dumpfer Seufzer erschütterte die Brust des Mannes; das Haupt sank ihm, und mit schweren Schritten stieg er weiter. Nun erreichten sie die Kreuzhöhe. Und wieder wandte sich der Gefangene, unheimliche Gluth in seinen Augen.
„Was geschieht mit mir?“
„Was allen anderen geschah, welche thaten, was Du gethan!“
„Jäger! Erbarme Dich meines Weibes und meiner Kinder … laß mich entfliehen!“
„Und wenn ich auch wollte … ich darf nicht!“ sagte Haymo mit schwankender Stimme. „Ich steh’ in Pflicht und Eid! Ich hab’ geschworen!“
„So laß mich ein Vaterunser beten … für Weib und Kind!“
„Bete!“ sagte Haymo.
Der Raubschütz kniete vor dem Kreuz auf die Erde nieder, faltete die Hände und begann zu murmeln. Haymo trat an seine Seite und wollte das Haupt entblößen, um dem heiligen Bilde zu danken, das ihn vor Blut bewahrt und alles nach Recht gewendet hatte. Doch als er den Arm erhob, fuhr der andre blitzschnell in die Höhe, riß das Waidmesser von Haymos Gürtel, und ehe der Jäger sich zu decken vermochte, stieß er ihm die blitzende Klinge in die Schulter.
Aus Haymos Händen fiel die Armbrust, seine Knie brachen, stöhnend sank er auf das moosige Gestein, das sich färbte von seinem Blut … mit letzter Kraft noch richtete er sich halb wieder empor, mit brennendem Blick suchten seine Augen das starre Bild am Kreuze, dann fiel er zurück, und seine Sinne erloschen …
Ueber allen Höhen leuchtete die Sonne, mit lindem Hauche strich, nach allem Streit und Kampf des wilden Föhns, der laue Frühlingswind befruchtend über die Halden … und während auf dem steinigen Hang die überstürzten Tritte des fliehenden Mörders verhallten, schwoll es sanft und leise durch die Luft einher, weit her aus dem fernen tiefen Thal … der Klang der Osterglocken. „Ihre Seelen waren heimgekehrt von Rom,“ und durch das weite Land, von Thurm zu Thurm, erhoben sie ihre hallenden Stimmen, die Macht und Glorie des Gottes preisend, der vom Grab erstanden.
Ueber dem Hause des Sudmanns lag still und sternenhell die Osternacht. Nur die Albe rauschte; sonst kein Laut in der ganzen Runde; denn der eine, der in dieser Nacht zu dem kleinen Hause gegangen kam, wandelte auf unhörbaren Sohlen; er pochte an die verschlossene Thür … sie öffnete sich nicht vor ihm, und dennoch trat er ein.
[296]
[297] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [298] In der Stube erwachte das Weib; ein leises Stöhnen hatte sie geweckt. Sie lauschte … und da hörte sie es wieder. Es war das Kind.
„Katzi, was hast denn?“ fragte sie. Aber das Kind gab keine Antwort. Sepha war am Abend so schwach gewesen, daß sie sich nicht auf den Füßen erhalten konnte. Und jetzt mit einmal hatte sie Kraft. Mit stammelndem Laut sprang sie aus dem Bett. „Polzer!“ rief sie … in ihrem Schreck hatte sie ganz vergessen, daß Wolfrat nicht zu Hause war. Mit zitternden Händen tastete sie in der Finsterniß nach dem Feuerzeug; nur matte Funken brachte sie aus dem Stein, und der Zunder wollte nicht brennen. „Mein Gott, mein Gott, hätt’ ich mich doch nicht schlafen gelegt!“ jammerte sie. Bis lange vor Mitternacht hatte sie wach gesessen, dann war die Natur stärker geworden als ihr Wille. Gittli wollte die ganze Nacht bei dem Kinde bleiben, aber Sepha selbst hatte das Mädchen zur Ruhe geschickt. Das „Katzi“ schien ja so fest und gut zu schlummern! Freilich, es war ein böser Tag gewesen, der vorausgegangene, und bedrückten Herzens hatte Seph’ ihren Mann das Haus für die Nacht verlassen sehen; sie merkte es ihm auch an, daß er selbst nicht gerne ging. Wär’ es nur nicht um die paar Heller gewesen, die es zu verdienen gab! Als er schon den Hut auf dem Kopf, noch einmal mit der Hand über die Stirn des Kindes strich, da sagte er: „Gieb’ Dich, Seph’, gieb’ Dich, morgen soll’s besser sein!“ Seine Stimme hatte wohl gezittert, und dennoch hatte sein Wort so zuversichtlich geklungen! Vielleicht wußte er ein stärkendes Kraut oder eine heilsame Wurzel, die er von der Bergfahrt mit heimbringen wollte … vielleicht die „Nießwurz’“, die Wurzel der Schneerose. Von ihr hatte auch Gittli schon gesprochen …
Endlich war es ihr gelungen, Licht zu machen. Mit der flackernden Kerze leuchtete sie über das Bett und erschrak bis ins innerste Herz. Das Gesichtlein des Kindes kam ihr so verwandelt vor, als wäre das nicht mehr ihr eigen Kind, sondern ein fremdes. Sie taumelte zur Kammerthür und stieß sie auf.
„Gittli! Gittli!“
Das Mädcheu antwortete schlaftrunken.
„Ich thu’ Dich bitten, steh’ auf,“ sagte Seph’ mit tonloser Stimme, „das Kindl ist soviel ungut!“
Barfuß, das rothe Röcklein überwerfend, erschien Gittli unter der Thür.
„Da schau’ … mein Kindl, mein Kindl, mein Kindl!“ schluchzte Seph’ und hielt die Leuchte über das Bett.
Gittli beugte sich über das Kind und faßte sanft seine Aermchen, welche mit geballten Fäusten nach aufwärts lagen. „Mimmidatzi,“ flüsterte sie voll süßer Zärtlichkeit, „Mimmidatzi, kennst mich denn nimmer? Schau, die Dittibas’ ist bei Dir!“ … Eine Weile wartete sie vergebens auf Antwort. Dann rief sie noch einmal, alle Angst ihres Herzens in der Stimme: „Mimmidatzi!“
Ein kaum merkliches Zucken ging über das Gesicht des Kindes; ein leises Stöhnen, nicht wie in Schmerz, sondern wie von Sehnsucht quoll aus dem regungslosen, leicht geöffneten Mündlein … aber das Körperchen rührte sich nicht, das Köpfchen, umringelt vom goldblonden Gelock, lag starr auf die Seite geneigt, und unter den zarten halbgesunkenen Lidern blickten die einst so traulich und schelmisch leuchtenden Augen unbeweglich hervor, ohne Glanz und Leben.
„Ja mein Schatzi, mein lieb’s, ja was hast denn?“ stammelte Gittli, und dann, die Wangen von Thränen überronnen, schaute sie mit einem hilflosen angstvollen Blick in Sephas Gesicht.
„Mein Gott, mein Gott, wär’ nur der Polzer daheim!“ jammerte das Weib und sank neben dem Bett in die Knie. „Wenn er nur daheim geblieben wär’! Mein Gott, was thu’ ich denn? Mein Kindl, mein Kind! Ich weiß mir ja keinen Rath, ich weiß mir ja nimmer zu helfen! Was thu’ ich denn?“
„Schwah’rin, bleib’, bleib’ … ich lauf’ … und hol’ den Bader!“ schluchzte Gittli, und wie sie stand, barfuß im dünnen Röcklein, rannte sie davon.
Sie achtete auf dem Wege nicht der spitzen Steine, die sich schmerzend in ihre Sohlen drückten, nicht der Frische der Nacht, welche sie schauern machte, sie rannte nur und rannte, bis sie keuchend auf dem Marktplatz das Haus erreichte, in welchem der Bader wohnte. Wie von Sinnen schlug sie an der Thür den Klöppel, immerfort, so lange, bis sich im Obergeschoß ein Fenster öffnete.
„Wollt Ihr aufhören oder nicht! Was ist denn das für ein Lärmen in der Nacht!“ rief eine Männerstimme herunter.
„Ach, ich bitt’ Euch ... wir haben ein krankes Kind daheim!“ schluchzte Gittli mit aufgehobenen Händen. „Kommt doch, kommt, ich bitt’ Euch gar schön, ich bitt’, bitt’, bitt’!“
„Wer bist Du denn?“
„Die Gittli … die Schwester vom Sudmann Polzer!“
„Sooo?“ Der Name, den Gittli genannt, gab dem Bader zu denken. Ja, hätte sie nur den guten Einfall gehabt, hinauf zu rufen: ich bin die Zenza, die Tochter vom reichen Eggebauer ... dann hätte sie was erlebt, wie der Bader gesprungen wäre! „Sooo? … Also ja, gehe nur heim und sag’ ich komm’ schon, sobald es Tag wird.“
Klirrend schloß sich das Fenster. Gittli stand wie betäubt und griff sich mit beiden Händen an den Kopf. War es denn möglich! Ein Kind … solch ein süßes, herziges Dinglein … und es gab einen Menschen, der sich nicht die Seel’ aus dem Leibe lief, um zu helfen!
Helfen? Helfen? Wer jetzt … wer? Pater Eusebius! Der hatte das Büblein des Klostervogtes wieder gesund gemacht. Gittli rannte und athemlos erreichte sie die Klosterpforte. Die Glocke läutete schrill, denn mit dem ganzen Gewicht des Körpers hatte sich Gittli an den Strang gehängt.
„Pater Eusebius … wo ist der Pater Eusebius!“ schluchzte sie, als sich das vergitterte Fensterchen öffnete.
„Ein Dirnlein! In der Nacht?“ rief staunend der Pförtner. „Was willst Du vom Pater?“
„Wir haben ein krankes Kind daheim … der Pater Eusebius soll ihm helfen. Ach, guter Frater Pförtner, ich bitt’ Euch, bitt’ Euch …“
„O Du mein Gott, Kind, den Pater, den holst Du heut’ nimmer … der ist seit zwei Tagen in der Bartholomäer Klause.“
Gittli mußte sich an die Mauer stützen, um nicht umzusinken.
„Aber sag’, was fehlt dem Kindlein?“
„Es rührt sich nimmer und sieht nimmer … und kennt mich nimmer … ach, Frater Pförtner, so ein liebes, gutes Kindl!“
„Mußt nicht weinen, Dirnlein, der liebe Gott wird schon helfen! und … wart’ ein Weilchen …“ Das Gesicht hinter dem Gitter verschwand, dann streckte sich eine Hand heraus mit einem kleinen Fläschlein. „Nimm, Dirnlein, nimm! Es ist das Beste, was ich hab’: Oleum Sancti Quirini[2] vom Kloster Tegernsee.“
Gittli griff zu mit beiden Händen.
„Reibe dem Kindlein die Stirne damit ein, und die Schläfe, und die Pulsadern an den Händen und die Stelle, wo das Herz schlägt, und bete dazu drei Vaterunser … das hilft! Das hat schon vielen Tausenden geholfen! Und jetzt geh’, Dirnlein! Gelobt sei Jesus Christus!“
„Amen!“ stammelte Gittli. Es war ein Laut voll heißen Dankes. Und schluchzend flog sie davon, aber sie weinte nicht mehr in Schmerz, sie weinte vor Freude. Was sie in Händen hielt und an ihr Herz drückte … es war ja die sichere Rettung: geweihtes heiliges Oel! Immer und immer wiederholte sie Wort um Wort. „Die Stirn, die Schläfe, die Adern, und wo das Herz schlägt“ … und damit sie nur ja mit dem Beten nicht zu kurz käme, fing sie jetzt schon an, während sie rannte und rannte. „Vater unser … der Du bist … im Himmel …“
Erschöpft, keines Wortes mächtig, erreichte sie das Haus.
Seph’ kam ihr entgegen, das Gesicht verstört, kalkweiß und von Zähren naß. „Kommt er? Kommt er?“
Gittli schüttelte den Kopf; sprechen konnte sie noch nicht; doch während sie die eine Hand auf die fliegende Brust drückte, drängte sie mit der andern schon das Fläschlein in Sephas Hande.
„Mein Gott, Gittli, so red’ doch!“ jammerte Sepha, „schau, die Angst bringt mich ja um!“
„Nimm … nimm … das muß ihm helfen! Das hat … [299] schon tausend, tausendmal geholfen, hat er gesagt! Vater unser, der Du bist … im Himmel …“ Und betend sank sie neben dem Bett nieder, in welchem das Kind noch lag, wie sie es verlassen hatte.
„Aber Gittli. so red’ doch, wie soll’s dettn helfen, was soll ich denn machen damit?“
Mehr mit Zeichen als mit Worten wiederholte Gittli den Rath, den ihr der Frater Pförtner gegeben. Neben dem Bette kniend, mit thränenerstickter Stimme betend, hielt sie das flackernde Talglicht, während Sepha that, was der Mönch geheißen. Mit zitternden Händen, unter Weinen und zärtlichem Stammeln, entblößte die Mutter das Kind, welches vor ihr lag wie eine vom Stengel gefallene Blüthe. Ein zartes, holdes Körperchen, rund und weiß wie aus Wachs gebosselt … aber alle Gliederchen gefesselt von starrem Krampf.
Endlich richtete sich Sepha tief athmend auf, alles war gethan, was geschehen mußte. Sie legte die Kissen zurecht und breitete sorglich wieder die warme Decke über das Kind, welches unempfindlich schien für alles, was mit ihm geschah.
„Meinst, Gittli … es hilft was?“
„Ja, ja, es muß ja helfen!“
„Der liebe Herrgott soll’s geben! Wär’ nur der Polzer daheim!“
Nun faßen sie, Sepha und Gittli, die eine zu Häupten, die andre zu Füßen des Kindes, Stunde um Stunde, leise betend und des Wunders harrend, das sie mit Zuversicht erhofften.
Einmal streckte sich das Kind unter leisem Stöhnen, und die geballten Fäustchen schlugen seitwärts.
„Gittli!“ stammelte das Weib.
„Thu’ Dich nimmer sorgen ... es hilft, schau, es hilft ja schon! Weißt, er wehrt sich halt, der Krank[3], weil er spürt, daß er fort muß!“
Wieder saßen sie, betend und wartend. Auf leisen Sohlen schlich die Nacht davon, und durch die Fenster fiel der graue Dämmerschein des erwachenden Morgens.
Seph’ athmete auf. „Jetzt wird der Polzer ja doch bald kommen?“
Gittli nickte; die Hände im Schoß gefaltet, so saß sie, keinen Blick vom Gesichtchen des Kindes verwendend.
Wieder einmal befühlte Sepha das kleine, starr geschlossene Händchen. Sie erschrak. „Gittli … ich weiß nicht … das Kindl wird so kalt! Da, greif her … was sagst, was meinst denn?“ Ihre Augen waren starr geöffnet, und in ihrer Stimme zitterte die Angst.
Gittli umschloß mit beiden Händen das kalte wachsbleiche Fäustchen des Kindes. Da fuhr es auch ihr durchs Herz, sie wußte nicht wie. Sie konnte nicht sprechen. Mit einem bang erschrockenen Blick schaute sie zu Sepha auf.
„Was meinst …“ stotterte das Weib, „wenn ich ihm Tücher warmen thät’?“
„Ja, ja …“
Sepha zerrte einen Arm voll Linnenzeug aus einer Truhe, stürzte in die Küche, machte Feuer und preßte das Linnen in eine irdene Schüssel, um es an der Gluth zu wärmen. Schluchzend riß sie die Hausthür auf … der helle Glanz des Ostermorgens leuchtete ihr entgegen. Sie taumelte auf der Schwelle, raffte sich empor und rannte auf die Straße, um auszuschauen, ob ihr Mann nicht käme. Nichts, nichts, so weit ihre brennenden Blicke reichten.
„Mein Gott, mein Gott, wär’ er nur daheim geblieben!“ stammelte sie und wankte zurück.
Drinnen in der Stube kniete Gittli vor dem Bett, des Kindes kalte Fingerchen behauchend, die zwischen ihren Händen lagen. Sie wurden nicht wärmer. „Seph’, Seph’!“ rief sie in quälender Angst und wollte zur Thür eilen. Doch während sie sich erhob, schien es ihr, als hätte das Kind sein Köpfchen bewegt. Sie hatte recht gesehen … ein leises Zucken ging über die Augenlider, und das Mündchen bewegte sich, als wollt’ es sprechen.
„Mimmidatzi!“ schluchzte Gittli in neu erwachtem, freudigem Hoffen und warf sich wieder auf die Knie.
Da hob das Kind ein klein wenig die Aermchen und tastete mit gespreizten Fingerchen in die Luft. Gittli meinte, das Kind suche ihre Hände. „Ja, ja, mein Schatzi, das Handerl geben, gelt?“ flüsterte sie in heißer Zärtlichkeit, die beiden Händchen des Kindes fassend. „Dittibas’ geht nicht fort, nein … schau, ich bin ja schon bei Dir! Kennst mich denn nimmer, Schatzi?“
Es legte sich auf das bleiche Mündlein wie ein sanftes müdes Lächeln ein seufzender Athemzug, dann streckte sich das Körperchen und durch die kalten Fingerlein rann noch ein leises Zittern.
Jetzt kam die Mutter mit den warmen Tüchern gerannt. „Seph’, Seph’!“ rief ihr Gittli mit stammelnder Freude entgegen. „Besser geht’s, besser … es kennt mich schon wieder … und wie ich mit ihm geredet hab’, da hat es mich angelacht … schau nur, Seph’, schau nur, es lacht noch allweil!“
„O Du lieber, lieber Gott …“ stotterte Sepha. Die Freude benahm ihr fast die Stimme.
Nun griffen sie alle beide zu mit fliegenden Händen und hüllten das Kind von den Füßen bis an das Hälschen in die warmen Tücher; und wenn die Tücher zu erkalten begannen, wurden sie wieder ersetzt durch andere, warme …
Und immer lächelte das Kind; nur war das Gesichtchen so weiß wie Schnee, und das geschlossene Mündlein war anzusehen, als hätt’ es sich verwandelt in ein blasses Veilchen.
Stunde um Stunde verging … und immer lächelte das Kind.
„Ich mein’, es schlaft!“ flüsterte Gittli. Und dann plötzlich kam ihr ein Gedanke. „Seph’, ich lauf’ ins Kloster hinauf … meinst nicht, es wär’ gut, wenn ein Pater beten thät’?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte sie in ihre Kammer, schlüpfte in die Schuhe, zog ein Jäcklein über, streifte mit einem flüchtigen Kuß die rothe Wange des Buben, der in ihrem Bette schlief wie ein Murmelthierchen, und rannte aus dem Hause.
Als sie die Straße erreichte, sah sie zwischen den Bäumen einen Mönch des Weges kommen. Den hätte ihr der liebe Gott geschickt, so meinte sie. „Herr Pater, Herr Pater!“ rief sie und winkte ihm zu. Nun stand er vor ihr … Pater Desertus war es, der Fischmeister; er hatte im Kloster die Frühmesse gelesen und wollte heimkehren in seine Klause.
Gittli erschrak, da sie ihn erkannte, und zögerte; doch nur einen Augenblick, dann trat sie auf ihn zu, mit bittend erhobenen Händen, die Augen naß von Thränen.
Eine dunkle Röthe flog über seine bleichen Züge, seine Augen flammten, und wie in heißer Sorge streckte er die Hände nach ihr und fragte. „Mädchen, was ist Dir? Weshalb weinst Du?“
„Ach, Herr Pater, wir haben ein krankes Kind daheim … ich bitt’ Euch, kommt mit mir und betet für das arme Würmlein!“
„Beten?“ Ueber die Lippen des Mönches irrte ein Lächeln, das sich Gittli nicht zu deuten wußte. Scheu wich sie vor ihm zurück. Er aber faßte ihre Hand und sagte. „Komm’! Wir wollen sehen, was zu helfen ist!“
Sie wollte seine Rechte küssen, doch er wehrte es fast erschrocken. „Führe mich!“ sagte er und folgte ihr mit raschen Schritten; dabei verwandte er keinen Blick von ihrem Gesicht, und immer wieder schüttelte er den Kopf, als könnte er irgend etwas, das ihn zu bewegen schien in seinem tiefsten Innern nicht fassen und begreifen.
Nun erreichten sie die Hausthür, und da ließ er die Hand des Mädchens und fuhr sich über die Stirn wie um etwas von sich abzustreifen, was er nicht mit sich tragen wollte über diese Schwelle. Gittli bekreuzte sich, als der Pater ihr voran in die Stube schritt. Sepha erhob sich vom Bett und zog sich scheu in einen Winkel zurück. Gittli blieb mit gefalteten Händen an der Thür stehen, und so folgten die beiden Frauen mit brennenden Augen jeder Bewegung des Priesters, der neben dem Bett stand, tief über das regungslose, still lächelnde Kind gebeugt.
Nun richtete er sich auf, schwer athmend, und sein Antlitz schien noch blässer geworden. Mit wehmuthsvollem Blick suchten seine Augen die Mutter. „Kommt her zu Eurem Kind,“ sagte er mit leiser, schwankender Stimme.
Ein Zittern befiel Sephas Glieder, in ihrem Gesicht erstarrte vor Angst jeder Zug, nur die Arme konnte sie strecken, aber ihre Füße waren auf den Dielen wie festgewurzelt.
„Hier ist keine Hilfe mehr. Es müßte denn sein, daß unser Herr Jesus in diese Stube träte und zu Eurem holden Kind spräche wie zur Tochter des Jairus: „Steh’ auf und lebe!“
Gittli erbleichte bis in die Lippen, Sepha rang nach Athem, aber noch immer wollten sie nicht fassen, was geschehen war.
„Ach, guter Pater,“ stammelte das Mädchen, „schauet nur hin, es lachet ja, es lachet …“
[300] „Das Lächeln der Erlösung!“ Und Sephas Hand erfassend, sagte er: „Euer Kindlein ist heimgegangen zu seinem Schöpfer.“
„Ach Gott, ach Gott!“ schrie Gittli schluchzend auf. Wie von Sinnen stürzte sie dem Bett entgegen, doch ehe sie es erreichte, brachen ihr schon die Kniee, auf den Knieen rutschte sie weiter, schluchzend und schreiend, und mit Gesicht und Armen warf sie sich über die Füßchen ihres entschlafenen Lieblings: „Schatzi, mein Schatzi …“ In heißem Weinen erstickten ihre Worte.
Sepha stand noch immer wie ein steinernes Bild. Nun plötzlich rang es sich mit gellendem Schrei von ihren Lippen: „Mein Kindl!“ Mit beiden Fäusten stieß sie den Pater von sich, kreischend flog sie dem Bett zu, mit zuckenden Händen faßte sie das Kind, riß es halb aus den Kissen und rüttelte das zarte, wachsbleiche Körperchen, als könnte sie es gewaltsam wieder erwecken zum Leben. Dann wieder erlahmten ihre Glieder, starr quollen die Augen aus dem von Schmerz verzerrten Gesicht, und mit einem stöhnenden Laut, wie das gehetzte Wild ihn ausstößt, wenn es niederbricht inmitten der Meute, sank sie über das Bett, das Kind umklammernd. „Ja kann’s denn sein? Ja kann denn unser Herrgott so was zulassen! Mein Kindl! Mein Kindl! So was … so was muß über mich kommen! Ja warum denn? Warum denn? Warum denn?“
„Warum? Du armes Weib!“ Und Pater Desertus legte die Hand auf Sephas zuckende Schulter. „Tausende und Abertausende vor Dir haben diese Frage schon hinausgeschrieen aus brennendem Herzen, und keinem noch ist Antwort gekommen, weder aus der Höhe noch aus der Tiefe. Warum? Auf frühlingsgrüner Wiese steht eine Blume, hold und lieblich in ihren reinen Farben, in ihrem süßen Duft … wie ein gütiger Gedanke Gottes, der zur Erde niederflog und Wurzel schlug, um zu weilen als eine Freude der Menschen. Da kommt die Nacht mit ihrem tötenden Reif … ein Thier zieht über die Weide und tritt mit fühllosem Huf die erfrorene Blume in den Koth! Warum? Warum? – Auf sonniger Halde steht ein Baum, gesund und strotzend von Kraft; er hat geblüht in zahllosen Röslein, und nahe schon ist die Zeit, da er für treue Pflege danken will mit köstlichen Früchten. Doch vor der Ernte kommt der Sturm, ein Stoß nur, und der schöne stolze Baum liegt auf der Erde, verwüstet und gebrochen! Warum? Warum? – In weitem Feld steht die reifende Saat, getränkt vom Schweiße hoffender Menschen … der Hagel vernichtet sie. Warum? – In freundlichem Thal steht Hütte an Hütte; zufriedene, lachende Menschen unter jedem Dach … da brechen am Bergsee die steinernen Dämme, eine Stunde nur, und Trümmer und Leichen bedecken das Thal. Warum? – Redlichen Sinnes zieht ein guter Mensch seines Weges, sein Blick ist Treue, und Liebe jeder Schlag seines Herzens … da fallen die Wölfe über ihn her oder ein Blitz erschlägt ihn oder eine Brücke weicht unter seinem Fuß. Warum? – Es steht eine herrliche Burg, fest und stolz …“ die Stimme des Sprechenden verwandelte sich, klang dumpf und heiser … „in ihren Mauern wohnt das Glück, rein und heilig, wie es je noch hervorgegangen aus Gottes Hand. Aus ihrem Thor zieht ein glückseliger Mann … und da er wiederkehrt, dürstend nach dem Anblick seines Weibes, nach den süßen Augen seiner Kinder, findet er nur rauchenden Schutt und verkohlte Gebeine. Warum? Warum? Warum?“
Sepha richtete sich auf, verschlang die Hände, und zu dem Priester emporschauend, alle Verzweiflung ihres Herzens im Auge, schluchzte sie: „Ach, Herr, redet doch nicht so grausam und hart zu mir, sagt mir doch ein Wort des Trostes, nur ein einziges Wörtlein!“
„Ich weiß Dir keinen Trost, ich sehe Dein Kind und finde keinen. Nur eine Wahrheit kann ich Dir sagen, die ich erkannte mit blutendem Herzen: wer lebt, muß leiden, wer lacht, wird weinen müssen, und verlieren, wer besitzt!“
Sepha schlug die Hände vor das Gesicht.
Da klang aus der offenen Kammer eine Kinderstimme: „Muetterl!“ Und Lippele erschien auf der Schwelle, im langen Hemdlein, die runden Wangen hoch geröthet vom gesunden Schlaf, in der Hand ein hölzernes Pferdlein ohne Kopf und mit halben Beinen.
Sepha sprang auf, stürzte auf den Knaben zu mit schluchzendem Schrei und riß ihn empor an ihre Brust.
Pater Desertus war der Thür zugegangen; es schien, als wollte er sich noch einmal zurückwenden; aber schwer aufathmend deckte er die Hand über seine Augen und verließ das Haus.
Gittli lag noch immer auf den Knien, das Gesicht in die Arme gedrückt. Erst als Sepha nun wieder zum Bett trat, hob das Mädchen das Gesicht, schaute mit brennenden Augen und zuckenden Lippen zu der Schwäherin auf und schlug in hilflosem Schmerz die Hände ineinander.
Sepha kniete zur Seite des Bettes nieder, stellte den Knaben auf die Erde, und ihr Schluchzen mühsam bekämpfend, sagte sie: „Schau, Lippele … Dein Schwesterl … schau nur, schau … geh’, gieb ihr noch ein Handerl und sag’ zu ihr recht lieb: Behüt’ dich Gott, mein Schwesterl, du mein lieb’s!“
Lippele schaute auf das stille, wie im Traum lächelnde Kind, dann wieder auf die Mutter und fragte: „Warum denn?“
„Mußt nicht fragen, Lippele; thu’s nur, thu’s!“
Lippele streckte den Arm; doch als er die Kälte des starren Händchens fühlte, erschrak er und brachte kein Wort hervor. Aengstlich schaute er zu der Mutter auf und hob beide Hände nach ihr. Sepha umschlang ihn mit ihren Armen, der gewaltsam verhaltene Schmerz brach mit neuer Macht hervor aus ihrem gepreßten Herzen, und so kauerte sie schluchzend auf der Erde, das Gesicht des Knaben übergießend mit ihren Thränen.
„Muetterl, Muetterl,“ stammelte das Kind und begann zu weinen, weil es die Mutter weinen sah.
Gittli erhob sich und wankte in die Kammer; drinnen, am offenen Fenster, sank sie schluchzend nieder; mit breitem Strahl fiel die Morgensonne auf ihr gebeugtes Haupt.
Draußen im Freien webte der Glanz und Schimmer des Ostertages; die Albe rauschte, und in den Nachbarhöfen krähten die Hähne. Auf den Obstbäumen, deren Knospen schon zur Blüthe drängten, zwitscherten die Meisen und flogen ab und zu, Halme tragend für den Nestbau.
Trotz der hellen Sonne, die der Ostermorgen gebracht hatte, brannte in der Stube des Eggebauern ein mächtiges Feuer im Lehmofen. Der Bauer saß hemdärmelig hinter dem Tisch, vor sich einen großen Napf mit Milchsuppe, die er gemächlich auslöffelte. Er war soeben – um die neunte Morgenstunde – mit Zenza aus der Messe zurückgekehrt. Das Mädchen stand, mit halblauter Stimme trällernd, vor dem in die Wand eingemauerten Zinnspiegel und durchflocht die blonden Zöpfe mit rothen Bändern.
„Heut’ hat es aber der Pater Hadamar scharf gemacht in der Predigt,“ sagte der Eggebauer nach einer stillen Weile.
Zenza lachte.
„Hast Dir gemerkt, was er gescholten hat über den Tanz?“
Wieder lachte das Mädchen und warf die Zöpfe über die Schulter zurück. „Jetzt tanz’ ich nur desto mehr. Und fest an halten thu’ ich mich auch … daß ich nicht ausrutsch’.“
Sprechen konnte der Eggebauer nicht, denn er hatte gerade den Mund voll; er drohte nur mit dem Löffel; dann schluckte er und lachte. Da klang aus der Kammer eine weinerlich kreischende Weiberstimme: „Zenzaaa!“
„Jjaah!“ rief das Mädchen unwillig zurück, trat näher an den Spiegel, nestelte an dem Veilchenstrauß, der im Mieder steckte, und zupfte die Kraushärchen in die Stirn.
„Hörst, die Mutter ruft!“ mahnte der Eggebauer.
„Hab’ schon gehört!“ sagte Zenza; aber sie rührte sich nicht von der Stelle.
Der Eggebauer seufzte und löffelte weiter.
„Bauer! Aber Bauer! So komm’ halt Du!“ klang es jetzt mit keifenden Lauten aus der Kammer.
„Ist das ein Weib!“ brummte der Eggebauer. „Nicht einmal beim Essen hat man seine Ruh’!“ Er schüttelte den Kopf, warf einen Erbarmen heischenden Blick zur Stubendecke, legte den Löffel nieder und wollte sich erheben.
Da klapperten draußen die Tritte genagelter Schuhe, und ein Schatten fiel durch das Fenster.
„Zenz’,“ sagte der Bauer hastig, „ich thu’ Dich bitten, geh’ hinein zu ihr und bleib’ bei ihr drin eine Weil’. Es kommt einer, mit dem ich zu raiten[4] hab’.“
[301]
[302] Das Mädchen ging, aber nicht gerne, kaum hatte sie die Kammerthür hinter sich geschlossen, da stand auch Wolfrat schon auf der Schwelle; er war anzusehen, als käm’ er geradeswegs von der Sudpfanne: sein brennendes Gesicht und seine Hände glitzerten von Schweiß; an Hals und Schläfen sah man, wie es in den geschwollenen Adern hämmerte; sein Athem flog und keuchte, daß er nicht zu sprechen vermochte; er taumelte zur Bank, fiel nieder und drückte die Fäuste auf seine Brust.
Dem Eggebauer wurde ängstlich zu Muth; er schielte nach der Kammerthür, dann fragte er mit leiser Stimme: „Polzer, was hast denn? Ich will nicht hoffen, daß …“
„Schau nach der Zeit, Bauer!“ keuchte Wolfrat.
„Da brauch’ ich nicht zu schauen. Die neunte Stund' ist gnett[5] vorüber.“
„Und wie lang’ braucht einer vom Kreuz über die Almen herunter bis ins Ort?“
„Seine fünf geschlagenen Stund’.“
„So muß ich droben vom Kreuz schon wieder fort gewesen sein, ehvor es Tag worden ist,“ sagte Wolfrat mit heiserem Lachen. „Darauf könnt’ ein jeder schwören … Du auch!“
Der Eggebauer verfärbte sich. „Meinst, es wird sein müssen?“
Wolfrat zuckte die Schultern, wischte mit dem Aermel den Schweiß von der Stirn und erhob sich; sein Athem war ruhig geworden, sein Gesicht so weiß wie die Wand. Er trat zum Tisch, griff in eine Tasche und reichte dem Bauer eine hölzerne Büchse – sie war feucht, als hätte man sie in Wasser getaucht.
„Da nimm!“ sagte er. „Das Kreuzl mußt Dir schon selber herausschneiden ... ich hab’ mich tummeln müssen.“
Der Bauer öffnete die Büchse, die ein blutiges Herz enthielt, und schloß sie wieder. „Hast die Schweißbluh’ auch?“
Wolfrat nickte und griff an eine Tasche seiner Jacke. „Wenn ich die nicht hätt’ … für was denn hätt’ ich’s gethan?“ Der Kopf fiel ihm auf die Brust, und mit zitternder Hand strich er sich über die Stirn.
Der Bauer blickte scheu zu ihm auf und kniff die Lippen übereinander; dann ging er zu einem Wandschrank, verwahrte die Büchse und brachte ein Säcklein herbei, welches klang und klirrte, als er es auf die Tischplatte setzte.
„Hast nichts gehört, Bauer, wie es bei mir drüben steht?“ fragte Wolfrat.
„Gehört hab’ ich nichts. Aber sorg’ Dich nimmer … hast ja die sichere Hilf’ im Sack.“
Wolfrat athmete tief und stand schweigend, während der Eggebauer zehn Salzburger Schillinge und ein halb Pfund Heller auf den Tisch zählte.
„Streich’ ein ... hast es verdient!“
„Meinst?“ murmelte Wolfrat, und als er die Münzen in der Hand hielt, streckte er sie dem Eggebauer hin und sagte: „Ich weiß nicht … mir kommt so vor, als hätt’ das Geld einen rothen Schein.“
„Dummes Zeug!“ stotterte der Bauer. „Das Geld hat Silberfarb’.“
„So? Dann muß es wohl sein, daß es mir nur im Aug’ so glitznet … oder es schaut sich nur die Hand so an.“ Er schob das Geld in die Tasche. „Und was ich sagen wollt’, Bauer … gelt, wenn vielleicht eine Frag’ umgehen sollt’ … Du brauchst ja nicht mehr zu wissen, als daß ich gestern nach Feierabend um die achte Stund’ fort bin. Sieben Stund’ hab’ ich hinauf gebraucht in die Röth’ – lang genug, aber so ein Herrgott hat sein Gewicht – dann hab’ ich ihn ans Kreuz geschlagen; vor Tag war ich fertig, hab’ mich wieder auf die Füß’ gemacht und war daheim vor der neunten Stund’. Daß ich den Weg vom Kreuz bergab bis zu Deinem Haus in dritthalb Stund’ gelaufen bin, das brauchst ja Du nicht zu wissen.“
Der Eggebauer riß die Augen auf und schüttelte den Kopf.
„Und schau mich an, wie ich ausschau … daß Du’s weißt, wenn Dich einer fragen sollt’. Gelt, nein? Ich hab’ kein Stäuberl Ruß im Gesicht … kein Fleckerl Blut an meiner Jacke?“
Der Eggebauer, der eine Farbe bekam, als hätte man ihm das Gesicht mit Kalk bestrichen, stotterte: „Ja lieber Herrgott, Polzer, was hast denn gethan?“
„Was ich dutzendmal im Krieg gethan hab’, wenn mich einer hat fassen wollen.“ Er machte mit der Faust einen Hieb in die Luft, und seine Augen funkelten in finsterer Gluth. „Es hat sein müssen!“
„Polzer, Polzer!“ stöhnte der Bauer und schlug die Hände zusammen.
„Halt’s Maul! Wenn’s einer hört, der es weiterredet, kommt es zur Halbscheid über Dich. Und wo der Freimann[6] haust, das weißt ja! Seit voriger Woch’ hat er ein neues Rad … das alte hat er am Mattauser zu Schanden gemacht, der in der letzten Gebnacht[7] den Klosterknecht gestochen hat. Und somit behüt’ Dich! Ich hab’ Dir und mir geholfen … jetzt müssen wir’s auch tragen auf zwei Buckeln!“ Wolfrat wandte sich zur Thür.
Dem Eggebauer schlotterten die Knie; er wollte dem Sudmann nacheilen, aber er brachte keinen Schritt zuwege. „Polzer!“ keuchte er. „Und … und das Schießzeug? Hast es doch um Herrgottswillen nicht verloren, wo’s ein Unrechter finden könnt’?“
„Nein! Ich hab’s wieder geholt, und jetzt liegt es im Kesselbach in der tiefsten Klamm, mit einem Stein daran, den kein Wasser mehr in die Höh’ treibt. Ich wollt’ nur, es läg’ was anderes auch noch dabei! Aber aus mir herausreißen kann ich’s nicht!“ Er schlug mit der Faust auf seine Brust, nickte noch einen stummen Gruß und verließ die Stube.
Er schwang sich diesmal nicht über den Gartenhag, sondern ging auf die Straße zurück und betrat sein Lehen durch das Thürchen im Zaun. In einem Winkel des Gartens rannte Lippele hinter den gackernden Hennen her. Wolfrat wollte ihn rufen; dann schüttelte er den Kopf. „Der Bub’ soll mir heut’ nicht an die Hand rühren.“ Zögernd trat er ins Haus; im offenen Flur lag die Sonne; als aber Wolfrat über die Schwelle ging, bedeckte sein schwarzer Schatten den lichten Streif. Und wie still es war! Keines rief seinen Namen, keines trat ihm grüßend entgegen. Das Kind wird schlafen, dachte er sich, und sie wollen’s nicht wecken. Er stieß die Schuhe von den Füßen und betrat die Stube.
Neben dem Bett saß sein Weib im Weidenstuhl. „Grüß’ Dich Gott, Seph’!“ sagte er mit beklommener Stimme. Aber sie gab ihm keine Antwort; sie hatte die Hände im Schoß gefaltet, das zerraufte Haar hing ihr um die Schultern, und mit starren Augen, deren Thränen erschöpft waren, schaute sie ihm entgegen.
„Aber so red’ doch ein Wörtl! Wie geht’s ihm denn?“
Sie wollte sprechen, jedoch nur stumm bewegten sich ihre Lippen; dann plötzlich schrie sie laut auf.
Er warf einen Blick auf das Kind, und was er sah, machte ihn zittern an allen Gliedern. „Gieb Dich, Seph’, gieb Dich,“ stotterte er und riß aus der Tasche einen ledernen Beutel hervor, welcher braune Flecken hatte und zwischen Wolfrats Händen schlotterte. „Gieb Dich, Seph’ … schau, ich hab’ ’was heimgebracht, das muß ihm helfen. Dem Vogt seinem Kindl hat es auch geholfen. Gieb einen Löffel her …“
„Polzer!“ schrie sie gellend auf und fuhr sich mit zuckenden Händen in die Haare. „Unser Kindl! Unser lieb’s Kindl! O mein Gott, mein Gott …“
„Seph’!“
Er stürzte auf das Bett zu und riß das Laken weg, mit welchem das regungslose Körperchen verhüllt war. Aschfahl wurde sein Gesicht, die eine Hand fuhr nach seinem Herzen, die andere ließ den Beutel fallen, aus welchem das geronnene Blut, das er enthielt, in dicken Klumpen auf die Diele klatschte. Und lautlos, wie ein Stier, den das Beil auf die Stirn getroffen hat, brach er zusammen.
„Polzer!“ kreischte Sepha und suchte ihn empor zu richten.
War es ein Schluchzen oder ein heiseres Gelächter, was von seinen Lippen schütterte und seine wirren Worte halb erstickte? „Und alles umsonst, alles, alles … recht so … ja, ja, so hat’s kommen müssen … jetzt liegt mein Kindl da … und droben … droben liegt der ander' im Blut …“
„Heiliger Herr Jesus!“ stammelte Sepha. „Polzer … Polzer!“
Mit verstörten Augen schaute er zu ihr empor, und ein Schauer rüttelte seinen Körper. Er hatte schon zu viel gesagt … nun mußte er alles sagen. Mit beiden Armen umschlang er sie, [303] drückte stöhnend sein Gesicht in ihren Schoß, und in dumpfen hastenden Lauten bekannte er seine That. Alles, alles erzählte er: was ihn zum Wildraub verführt hatte, wie droben alles gekommen war, und wie ihm nur die Wahl geblieben zwischen Elend, Kerker, Peitsche – und dem, was er gethan hatte.
Sepha saß mit weißem Gesicht wie eine Gestorbene, und nur ihre Hände zitterten, die auf seinem Haupt lagen. Und als er nun verstummte, griff sie hinüber in die verwüsteten Kissen und faßte das starre kalte Händchen ihres Kindes. „Dank’s Deinem Herrgott, Du mein liebes Kindl, weil Du nur das nimmer hast erleben müssen!“
„Seph’!“ stöhnte er.
Sie neigte das Gesicht zu ihm hinunter und sagte ganz leise: „Weißt es auch, Polzer … weißt es denn auch, was Du gethan hast? Nicht bloß den andern hast erschlagen … uns alle, Dich und mich und Deinen armen Buben, und …“
Er preßte die Hand auf ihren Mund.
„Nein, Seph’, nein ... es weiß es ja keiner … nur ein einziger, der selber das Reden fürchten muß … und wenn sie mich gleich auf den Strecker spannen, ich sag’s nicht … und ich hab’ nichts anderes gethan als den Herrgott ans Kreuz geschlagen … und wenn er selber noch leben sollt’ und wieder aufkommen …“
Er verstummte plötzlich und hob erschrocken den Kopf. Jäh schoß er in die Höhe, stand mit geballten Fäusten und starrte mit finster drohenden Augen zur Kammerthür.
Gittli stand auf der Schwelle; ihre zitternden Hände suchten eine Stütze am Pfosten, als wollten ihr die Knie brechen. Ihrem entsetzten Blick, ihren entstellten Zügen sah man es an … sie hatte alles gehört.
„Dirn’!“ fuhr Wolfrat sie an. „Was willst?“
Abwehrend streckte sie die Hand gegen ihn, das Grauen schüttelte ihre schmalen Schultern und an der Wand sich entlang tastend, wollte sie zur Thür.
Mit einem zornigen Fluch sprang er auf sie zu und verstellte ihr den Weg. „Wohin willst?“
Da hob sie flehend die Hände und brach in Schluchzen aus: „Zu ihm! Zu ihm! Ob er tot oder lebig ist … laß mich, laß mich ... ich muß zu ihm.“
„Zu ihm? Und warum zu ihm?“
„Weil ich sterb’, wenn ich bleiben muß!“ schrie sie. „Laß mich … laß mich …“ Und wie von Sinnen faßte sie ihn am Arm und suchte ihn von der Thür wegzuzerren. Er schleuderte sie zurück, daß sie zu Boden sank, sie raffte sich auf und stürzte wieder auf ihn zu.
„Dirn’,“ knirschte er, „Du thust mir keinen Schritt aus dem Haus, oder …“ Er riß ein Beil von der Wand und schwang es.
„Jesus im Himmel … Polzer!“ kreischte Sepha, aber sie hatte nicht die Kraft, sich aufzurichten.
Mit ausgebreiteten Armen stand Gittli vor dem Bruder. „Schlag’ zu, schlag’ zu … hast ja ihn auch erschlagen. Thust mir nur eine Freud’ an, wenn Du zuschlagst, daß ich auch dalieg’ und meinen letzten Schnaufer thu’. Schlag’ zu, schlag’ zu … oder traust Dich nicht? Meinst, es wär’ an einem schon genug? Dann geh’ von der Thür weg und gieb meinen Weg frei!“
Hoch aufgerichtet stand sie vor ihm, mit blitzenden Augen, als wäre sie gewachsen und um Jahre gealtert in dieser Stunde.
Er ließ das Beil sinken und maß sie mit funkelnden Augen. „Du bleibst, Dirn’, ich sag’ Dir’s im guten …“
Es schien, als wollte sie ihn mit beiden Händen an der Brust fassen; aber sie besann sich, und dann plötzlich ging sie mit raschen Schritten auf das Bett zu. „Schau her auf Dein armes Kindl ... ich hab’ es lieber gehabt als mich selber, und heut’ in der Nacht hab’ ich gemeint, ich muß mir die Seel’ herausbeten aus dem Leib … und schau, jetzt leg’ ich die Hand auf sein kaltes Herzl, daß ich zu keinem Menschen ein Sterbenswörtl von dem sagen will, was ich weiß! … Bist jetzt zufrieden? … So gieb mir den Weg frei!“
„Du bleibst, sag’ ich. Und bevor ich nicht in aller Ruh’ mit Dir geredet hab’ ....“
„So halt’ mich, wenn Du kannst!“
Und ehe sie noch ausgesprocheu hatte, war sie in der Kammer verschwunden, er merkte ihre Absicht und stürzte ihr nach; doch bevor er die Schwelle erreichte, hatte sich Gittli schon auf die Brüstung des Fensters geschwungen. Mit einem Sprung war sie im Freien und flog der Straße zu.
„Gittli, Gittli! Dirn’! Ich thu Dich bitten um Gotteswillen … Gittli! Gittli!“ klang die Stimme des Bruders hinter ihr.
Aber sie schaute nicht um, schluchzend schüttelte sie im Lauf den Kopf und schlug ihre Hände vor die Ohren, um den Ruf nicht mehr zu hören. So rannte sie und rannte …
Es war nur eines in ihr, und dieses eine schrie nur immer: zu ihm, zu ihm!
Sie fragte sich nicht, was es wohl wäre, das mit Jammer und Sorge so plötzlich in ihr erwachte, das allen Schmerz der vergangenen Stunden in ihr erstickte, um ein noch größeres tieferes Weh über sie zu bringen, und das sie losriß von ihrem Bruder, um sie unaufhaltsam zu jenem anderen zu treiben, der doch vor wenigen Tagen noch für sie ein Fremder gewesen war. Sie fragte sich nicht, ob er tot liege in seinem Blut, ob er noch lebe, wie sie ihm helfen wolle, ob sie denn helfen könne, allein, mit ihrer schwachen Kraft. Sie fragte und sagte sich nichts als immer nur das eine: zu ihm, zu ihm!
Was in ihr lebendig geworden war, was sie trieb und jagte ohne Denken und Besinnen ... es war entfesselte Natur, die in diesem sechzehnjährigen Kinde nicht anders wirkte als in einem vieltausendjährigen Stein, der auf steilem Berghang liegt, ruhig, bedeckt von Moos, der Tritt eines Wildes, der Fuß eines Wanderers, das Wasser eines jähen Regens, ein Stoß des Zufalls setzt ihn in Bewegung; und unaufhaltsam geht nun seine Reise, nicht zur Rechten, nicht zur Linken, nur fort und fort und immer fort, dem unbekannten Ziel entgegen, keine Schranke messend, keine Tiefe scheuend, keinem Halt gehorchend, nur immer fort und fort, bis sein Weg vollendet ist, bis am Fuß des Berges ein sonniger Rasen ihn empfängt, oder bis ihn der dunkle See verschlingt, auf dessen tiefem Grund er den Ort der bleibenden Ruhe findet.
Die Leute, denen Gittli auf der Straße begegnete, blieben stehen, blickten ihr nach und schüttelten die Köpfe. Eine Dirne, welche mit wehenden Bändern im Haar zum Tanze ging und von Gittli überholt wurde, rief ihren Namen. Aber Gittli sah und hörte nichts. Sie rannte nur und rannte. Doch als sie, nahe den Bauernhöfen am Unterstein, von der Straße zu einem Fußpfad ablenkte, vernahm sie plötzlich von der Taferne her das Klingen der Geigen und Pfeifen! Dort wurde der Ostertanz gehalten. Da mußte sie an die Botschaft denken, welche Walti, der Klosterbub’, ihr gebracht hatte.
Tags zuvor, nach der Auferstehungsfeier, hatte der Bub’ sie vor dem Thor der Kirche erwartet. „Du, der Jäger schickt mich … ich soll Dich fragen, warum Du geweint hast, weißt Du, droben beim Vogt … und morgen wenn er herunterkommt zum Ostertanz, soll ich’s ihm wieder sagen!“
Er hatte an sie gedacht! Er hatte sich gesorgt um ihren Kummer! Und zum Tanz hatte er kommen wollen … zum Tanz mit ihr! Und jetzt … jetzt …
„Haymo! Haymo!“ schrie sie schluchzend aus und rannte weiter, während drüben in der Taferne die Stimmen der Pfeifen und Geigen übertönt wurden von einem wirren Jauchzen und Gejohl.
Ein Tanz war eben zu Ende. Mit brennendem Gesicht, aber gar wenig fröhlichen Augen trat Zenza aus der Thür der Taferne. Suchend schaute sie umher, ging bis in die Mitte der Straße und spähte in der Richtung gegen den See mit verdrossenem Blick den leeren Weg entlang.
Inzwischen kam von der entgegengesetzten Seite der Straße ein junger schmächtiger Bursch gegangen, mit freundlichem Gesicht und gutmüthigen Augen. Seine leichtgebeugte Haltung und die weißen schwielenlosen Hände verriethen den Bildschnitzer. Als er Zenza gewahrte, leuchteten seine Blicke freudig auf. Lächelnd schlich er sich an die Dirne heran und drückte ihr die beiden Hände über die Augen.
„Rath’!“ sagte er mit verstellter Stimme. „Wer bin ich?“
Zenza kicherte und griff nach seinen Armen. „Einer, auf den ich gewartet hab’!“
Diese Antwort machte sein ganzes Gesicht vor Freude glühen; aber er hielt fest … nun wollte er auch seinen Namen hören.
„Wer bin ich?“
[304] „Einer, den mir der Herrgott in der Röth’ geschickt hat.“
Er lachte; den „Herrgott“, der in der Röth’ am Kreuz hing, den hatte er ja selbst geschnitzt. Eine Feine, die Zenza! Die Wörtlein stellen, das verstand sie wie keine! Aber jetzt sollte sie erst recht den Namen nennen, jetzt gerade!
„Wer bin ich?“
„Einer, der sich heut nacht an meinem Fenster nicht hat klopfen trauen, wie er den Buschen gebracht hat, den ich im Mieder trag’!“ Und mit jähem Ruck riß Zenza die Hände des Burschen nieder, zog seine Arme fest um ihren Hals und blickte über die Schulter lachend zu ihm auf. Als sie aber sein Gesicht erblickte, verstummte ihr Lachen. „Ulei?[8] … Du?“ stotterte sie, und da er sie festzuhalten suchte, stieß sie ihn zornig von sich.
„Aber Zenza … ich bin’s ja doch …“ stammelte er und deutete auf die Veilchen an ihrer Brust.
Sie trat mit funkelnden Augen vor ihn hin. „Du? Du hast mir den Buschen gebracht?“ Mit häßlichem Lachen riß sie das Sträußchen aus ihrem Mieder und warf es dem Burschen an den Kopf. „Da hast mein Vergeltsgott!“
Ulei stand mit erblaßtem Gesicht, während Zenza in der Thür der Taferne verschwand. Sie mußte das Haus und dann einen Hof durchschreiten, um die Scheune zu erreichen, in welcher der Ostertanz gehalten wurde. Da ging es laut und lustig zu; auf dem Heuboden saßen zwei Fiedler und ein Sackpfeifer, welche sich eben anschickten, einen neuen Tanz zu beginnen. Einzelne Paare traten schon zum Reigen an, die Dirnen lachend, die Burschen jauchzend und mit den Füßen stampfend.
Unter dem Thor der Scheune blieb Zenza stehen und rief mit lauter Stimme in den wirren Lärm hinein: „Buben! Wer ist unter Euch der ärmste und der mindest’?“
Es wurde still, und alle Gesichter wandten sich ihr entgegen; doch erhielt sie keine Antwort; es wollte keiner der ärmste und schlechteste sein. Zenza trat in die Mitte der Scheune.
„Ist einer da, den gar keine andere mag?“
„Der Kropfenjörgi! Der Kropfenjörgi!“ schrien die Mädchen lachend durcheinander.
Zenza blickte suchend umher und sah in einem Winkel der Scheune einen Burschen hocken mit blatternarbigem Gesicht und blöden Augen; wer ihn ansah, brauchte nicht mehr zu fragen, weshalb er der Kropfenjörgi hieße. Zenza trat auf ihn zu und faßte seine Hand. „Komm her, Jörgi, heut’ tanz’ ich nur noch einen einzigen … und den tanz’ ich mit Dir! He, Spielleut’! Macht einen auf!“
Jörgi wurde roth und blaß; doch als er sah, daß es Zenza ernst meinte, stieß er einen gellenden Jauchzer aus, reckte sich stolz in die Höhe und faßte das Mädchen um die Mitte.
Die Geigen klangen, die Sackpfeife dudelte, aber kein zweites Paar trat zum Reigen an: die Burschen und Mädchen standen im Kreis umher und begleiteten den Tanz der Zenza und des Kropfenjörgi mit johlendem Gelächter.
- ↑ Verhören, durch Lauschen den Platz erkunden, auf welchem ein Auerhahn falzt.
- ↑ Oel des heiligen Quirinus. – Eine halbe Stunde von Tegernsee, in dem Weiler St. Quirin, steht noch heute die Kapelle, welche über der wunderthätigen Quirinusquelle errichtet wurde; die Quelle liefert ein dünnes Erdöl, welches Jahrhunderte hindurch als heilsam für mannigfache Krankheiten galt und vom Kloster Tegernsee in Krügen und Fläschchen als kostbare Arznei an alle übrigen Klöster versendet wurde. Nach der Aufhebung des Klosters Tegernsee erlosch auch im Gebirgsvolk bald der Glaube an die Heilkraft der Quirinusquelle.
- ↑ Der böse Geist der Krankheit. In gleichem Sinn bedeutet der „G’sund“ die lebensvolle Kraft des gesunden Körpers.
- ↑ Rechnen, ein Geschäft zum Austrag bringen.
- ↑ Kaum, knapp.
- ↑ Der Henker.
- ↑ Die Nächte vor dem Weihnachtsfest, vor dem Neujahrstag und vor dem Dreikönigsfeste hießen: „Gebnächte“
- ↑ Ulrich.
Die Hamburger Schreckenstage.
„Hört ihr’s wimmern hoch vom Thurm?
Das ist Sturm! …“
Ein halbes Jahrhundert ist seit jenen furchtbaren Tagen verflossen, in denen meine Vaterstadt Hamburg fast zu einem Drittheil in Flammen unterging und nahe daran war, völlig in einen einzigen ungeheuren Trümmerhaufen verwandelt zu werden; und bis auf den heutigen Tag gehört dieses Ereigniß zu den denkwürdigsten und zugleich entsetzlichsten meines Lebens. Die langen, langen Jahre haben das grauenvolle Bild in meiner Erinnerung wohl zurückzudrängen, aber nicht auszulöschen vermocht, und jetzt, wo ich es, gleichsam zu einer wehmüthigen Gedächtnißfeier, aufs neue in mir wachrufe, tritt es bis auf seine Einzelheiten wieder so lebendig vor meine Seele, als gehörte es der jüngsten Vergangenheit an.[1]
Eine kurze Vorbemerkung ist hier nöthig, um die gleich von Anfang an unglaublich schnelle Verbreitung der Feuersbrunst einigermaßen zu erklären. Der Monat April des Unglücksjahres 1842 war nämlich ungewöhnlich warm und trocken gewesen, so daß die vielen Fleete (Kanäle) der Altstadt, welche die Alster mit der Elbe verbinden, sowie der Stadtgraben im Osten fast wasserleer waren. Ferner bestanden dort, wo die Feuersbrunst ihren Anfang nahm, die meisten Häuser aus Fachwerk mit steil aufragenden Giebeln, welche das Besteigen der Dächer sehr erschwerten, und drittens geriethen gleich in den ersten Stunden einige große sechs- und siebenstöckige Speicher in Brand, die von unten bis oben mit den feuergefährlichsten Stoffen angefüllt waren, mit Sprit, Rum, Oel, Schellack etc., und ihren Inhalt in Flammenströmen auf die Straße ergossen.
Durch die Stille der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1842 ertönten plötzlich gegen zwei Uhr die dumpfen weithinschallenden Glockenschläge der Feuersignale von den beiden Thürmen der Michaelis- und der Katharinenkirche, und die Nachtwächter liefen mit ihren Rasseln und mit dem üblichen langgedehnten Rufe „Füer! Füer! Füer!“ durch die Straßen.
Mancher Schläfer fuhr wohl erschreckt empor, beruhigte sich jedoch sofort wieder bei dem Gedanken au die treffliche Hamburger Feuerwehr mit ihren berühmten Repsoldschen Spritzen, die sich damals in ganz Norddeutschland eines bedeutenden Rufes erfreuten.
Als aber gegen fünf Uhr morgens die Glocken von zehn zu zehn Minuten immer von neuem anschlugen, vom Michaelisthurm, als allgemeines Alarmsignal, gar in Doppelschlägen, da wurden die Bewohner jenes Stadtviertels doch mit Angst und Besorgniß erfüllt, warfen sich hastig in die Kleider und eilten nach der Brandstätte.
Der Anblick war ein entsetzlicher: drei hohe Speicher waren bereits in qualmende Trümmerhaufen verwandelt, vier andere brannten lichterloh von oben bis unten, zehn bis zwölf Wohnhäuser lagen schon in Schutt und Asche, und an ebensovielen schlugen die wilden, züngelnden Flammen aus allen Fenstern zugleich heraus. Auch die gegenüberliegenden Speicher, obwohl durch das breite, aber nur seichte Fleet von der Brandstätte getrennt, hatten bereits Feuer gefangen und loderten auf; eine halbe Stunde später bildeten sie gleichfalls ein einziges Feuermeer.
Tausende von Menschen standen auf den nahen Brücken und Fleetufern und starrten wie betäubt in diese Vernichtung, ein Werk von kaum sechs Stunden. Und bis auf den heutigen Tag ist das blitzähnliche Umsichgreifen des Feuers, trotz der oben angeführten Umstände, räthselhaft geblieben.
Die Spritzen mit ihren weißgekleideten Mannschaften waren in voller Thätigkeit, andere jagten heran und nahmen vor den zunächst bedrohten Häusern Aufstellung, aber der Wassermangel machte sich überall fühlbar. Hydranten, Dampfspritzen und die vielen sonstigen Rettungsvorrichtungen der neueren Zeit gab es damals vor fünfzig Jahren noch nicht. Man half sich mit ledernen Feuereimern, schöpfte Wasser, wo solches zu finden war, und bildete „Ketten“ – kaum mehr als ein Spielzeug gegen ein solches Flammenmeer!
Unaufhörlich dröhnten die Sturmglocken, und ein scharfer Südwestwind trieb den Funken und Aschenregen, vielfach mit zusammengeballten Feuerbündeln untermischt, über Giebel und Dächer weiter und weiter. Man sprach auch schon von Toten
- ↑ Die Erziehungsanstalt, in welcher ich mich damals als fünfzehnjähriger Schüler befand, lag ganz in der Nähe der Deichstraße, wo das Feuer bei einem Tabakshändler ausgebrochen war, und nach Art der Jugend, die ja bei jedem außergewöhnlichen Ereigniß dabei sein will, eilten auch wir sofort als neugierige Zuschauer hin. Aber nur zu bald begriffen wir den gewaltigen Ernst der Lage und haben alsdann unter Anleitung tüchtiger Lehrer wacker mitgeholfen beim Wassertragen und an den Spritzen – auch da, wo wir nicht „gepreßt“ wurden – bei der Vertheilnng von Lebensmitteln und Stärkungen an die zu Tode ermatteten Arbeiter, schließlich bei der Bergung von Hausrath und (mit weißen Armbinden) bei der Rettung der Staatsarchive.
[305] und Verwundeten und erschüttert und angstbeklommen fragte man sich: Wie soll das enden?
Und doch war das alles nur das Vorspiel!
Der 5. Mai, der erste Tag des Brandes, ein Donnerstag, war zugleich ein Festtag: Christi Himmelfahrt. Die Kirchen, besonders die der entlegeneren Stadttheile, füllten sich mit Andächtigen. Sogar in der hart bedrohten Nikolaikirche wurde noch ein kurzer Morgengottesdienst gehalten, und der Pfarrer schloß mit einem Gebet um Abwendung noch größerer Gefahr. Am Abend desselben Tages war das herrliche Gotteshaus ein flammender Trümmerhaufen.
Gegen Mittag hatte sich die Schreckenskunde von dem furchtbaren Brande in der Altstadt durch die entferntesten Gegenden der Neustadt, hinaus in die Vorstädte und hinüber nach Altona verbreitet, und unabsehbare Menschenmassen flutheten durch die Straßen nach dem einen schrecklichen Ziele. Und nicht Neugierige und Schaulustige allein, sondern auch viele Tausende, die bereit waren, zu helfen und zu retten, was noch gerettet werden konnte, und die auch redlich und unverdrossen das Ihrige gethan haben.
Nun stürmten auch schon von allen Thürmen unaufhörlich die Glocken, denn das Feuer hatte inzwischen zwei, drei weitere Straßen ergriffen und – ein neues Schreckniß! – der Südwestwind war zu einem Orkan aus Süden geworden, der das heulende Flammenmeer mit Riesengewalt und mit dämonischer Schnelligkeit nach Norden, also der Neustadt zujagte.
Nachmittags gegett drei Uhr stand der Thurm der Nikolaikirche in hellen Flammen. Man hatte bereits einige Stunden früher leichte Rauchwolken um die Kugeln der Kuppel spielen sehen, und mehr als hundert beherzte Männer bildeten von unten mit ihren vollen Eimern eine Kette bis oben hinauf, wo der Thürmer mit mehreren Leuten beschäftigt war, aus seinem bereits halb geleerten Wasserbehälter die glimmenden Balken zu löschen, die sich unter der glühenden Kupferbedachung entzündet hatten. Alles vergebens! Das obere Gebälk brannte schon lichterloh, als die letzten Männer die Wendeltreppe hinuntereilten, um ihr Leben zu retten, und als sie unten ankamen, war der Thurm in eine himmelhohe Feuerpyramide verwandelt. Er stürzte bald darauf unter donnerähnlichem Krachen und dem tausendstimmigen Aufschrei der Menge in sich zusammen; auf dem zweihundert Fuß hohen Thurmstumpf aber loderten die weithin sichtbaren Flammen wie auf einem riesigen Altar noch die ganze Nacht hindurch und sandten immer neue Funken- und Feuergarben in die Kirche hinein, die auch bis auf die meterdicken Seitenmauern vollständig ausbrannte.
Erhebend und erschütternd zugleich war der Augenblick, als das schöne Glockenspiel im Thurm, von der Gluth in Bewegung gesetzt, noch einmal erklang: „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr!“ und nach einigen Minuten in schneidenden Mißtönen auszitterte ... ein Sterbelied!
Schon am Nachmittag des 5. Mai versammelte sich trotz des Festtages der Senat zu einer außerordentlichen Sitzung und blieb von da an im ganzen neunzig Stunden in ununterbrochener Thätigkeit – würdige, ehrenfeste Männer, die bei dem verhängnißvollen Rufe: „Das Vaterland in Gefahr!“, sofort ihren ernsten und hohen Pflichten vollauf genügten, jedes persönliche Interesse unberücksichtigt ließen, um mit allen nur erdenklichen Mitteln das wie ein Blitz aus heiterer Luft über die Stadt hereingebrochene entsetzliche Unheil zu bekämpfen und zu bewältigen. [306] Proklamationen wurden erlassen, welche die Gesammtbevölkerung zur Hilfe ausriefen, ihr Muth und Vertrauen einsprachen und an den schon so oft bewährten Bürgersinn: „Alle für einen und einer für alle!“ appellierten. Die eindringliche Mahnung war nöthig, denn gegen Abend erlahmte mit den sinkenden Kräften der Muth, und der Beistand von auswärts war noch nicht zur Stelle.
An ein Löschen der brennenden Häuser durch die Spritzen war längst nicht mehr zu denken; höchstens konnte man die letzteren da, wo sich mehr Wasser in den Fleeten vorfand, für die nächsten Straßen verwenden, um vornehmlich die Decken auf den Dächern naß zu halten, aber es waren zumeist ohnmächtige Versuche. Man mußte zu schärferen und großartigeren Mitteln greifen.
Ein furchtbarer, lufterschütternder Knall, der sich von Viertelstunde zu Viertelstunde immer neu und immer gewaltiger wiederholte, verkündete, daß man begonnen hatte, die Häuser mit Pulver in die Luft zu sprengen, und zwar zunächst nach Westen hin, um den Brand von der Neustadt abzuhalten. Englische Ingenieure leiteten die Sprengungen, die nach dieser Seite hin den erwünschten Erfolg hatten; aber in der Richtung nach Nordosten war selbst dieses äußerste Mittel so gut wie vergebens.
Hier jagte der Sturm das Funken- und Gluthmeer unaufhaltsam weiter, und auf dem Burstah und an der Mühlenbrücke standen fast auf einmal über fünfzig hohe Häuser zugleich in Flammen.
Die Nacht – es war die erste, und zwei andere standen uns noch bevor! – die alle Schrecknisse und vollends Feuersgefahr doppelt schrecklich erscheinen läßt, war eine entsetzliche und spottet jeder Beschreibung. Bis auf zehn Meilen im Umkreis sah man den blutrothen Feuerschein am Himmel, und sogar Schiffer in der Nordsee, also in einer fast doppelten Entfernung, sollen ihn am Rande des Horizontes gesehen haben. Schon zählte man nicht mehr die niedergebrannten Häuser, sondern nur noch die zerstörten Straßen. Aber mit der wachsenden Noth kehrte gottlob der gesunkene Muth, bei vielen freilich der Muth der Verzweiflung, zurück, denn einige tausend Mann von der Bürgerwehr, die nicht zur öffentlichen Sicherheit nöthig waren, griffen thatkräftig mit ein.
Am Morgen des 6. Mai wurden die Alte Börse, das „Commercium“ und die Börsenhalle von den Flammen ergriffen; der „Alte Krahn“, ein cyklopischer Bau und eines der Wahrzeichen Althamburgs, lag bereits zertrümmert im Fleet, und von den brennenden Häusern an der Trostbrücke drohte dem nahen Rathhaus die unabwendbare Vernichtung.
Das schöne mittelalterliche Gebäude, in welchem die Väter der berühmten Hansestadt ein halbes Jahrtausend in Freud’ und Leid getagt, wurde in die Luft gesprengt, aber die steinernen Kaiserbilder der Hauptfassade blieben unversehrt und wurden glücklich geborgen, um jetzt, nach fünfzig Jahren, das im Bau begriffene neue Rathhaus zu schmücken.
In langem feierlichen Zuge verließen Bürgermeister und Senatoren ihr ehrwürdiges Heim, schmerzerfüllt, aber ungebeugt, und auf ihrem schweren Gange allen Trostesworte zusprechend und die Hoffnung neu belebend. Sie zogen nach Westen in das große städtische Waisenhaus, wo sie ihre Sitzungen fortsetzten und sich bis zum Bau eines neuen Rathhauses dauernd einrichteten.
Der Fall des Rathhauses hatte den der Bank nach sich gezogen, aber die wichtigen Bücher und Papiere waren beizeiten in Sicherheit gebracht und die Keller mit ihren Silberbarren im Werthe von mehr als zwölf Millionen unter Wasser gesetzt worden, so daß hier der Verlust ein verhältnißmäßig geringer war.
Hinter dem zerstörten Rathhaus lag auf dem Adolfsplatz das prächtige neue Börsengebäude, das man erst vor einigen Monaten bezogen hatte. Allgemeines Jammern und Wehklagen! Man hielt es bereits für verloren, und doch wurde es durch die übermenschlichen Anstrengungen einer Anzahl wackerer Bürger gerettet. Schwerlich wird einer dieser Ehrenmänner noch am Leben sein, denn die ganze damalige ältere Generation ist ja längst dahingestorben, aber ihr Andenken lebt noch bis auf den heutigen Tag im Gedächtniß der Hamburger fort.
Der moralische Eindruck dieser an ein Wunder grenzenden Rettung war ein außerordentlicher.
Allein wie wenn sich der Brand für das eine ihm entrissene Opfer hundertfach entschädigen wollte, wüthete er am 6. und 7. Mai und in der dazwischenliegenden Nacht mit verdoppelter Wuth fort und erlangte am Morgen des 7. Mai seine größte Ausdehnung. Man berechnete, soweit eine solche Berechnung überhaupt möglich war, daß in jener Nacht, der fürchterlichsten von allen, über dreihundert Häuser vernichtet wurden.
Zwischen dem Alten und dem Neuen Wall lag ein breites Fleet, das auch von der sogenannten Kleinen Alster mit Wasser hinreichend versorgt war, aber der Kanal war seiner ganzen Länge nach mit Hunderten von großen und kleinen Kähnen aller Art angefüllt, auf welche die Bewohner der angrenzenden Straßen sich mit ihren Habseligkeiten geflüchtet hatten. Diese Fahrzeuge wurden von dem Funkenregen, den der Sturm wie ein Feuerwerk von vielen tausend Raketen heulend vor sich her trieb, in Brand gesetzt; kaum, daß die darauf befindlichen Menschen sich an das Ufer retten konnten. Mehrere sollen dabei ertrunken oder verbrannt sein. Bald stand das ganze Fleet in Flammen, eine Viertelstunde darauf die Hinterseite des Neuen Walls, und damit war auch diese große und schöne Straße zu zwei Drittheilen verloren. Nur das Stadthaus und das Stadtpostamt blieben verschont.
Man hatte also von der Neustadt das Feuer nicht fern halten können; nicht allein die Hütten der Armen und die bescheidenen Wohnungen der Handwerker und des kleinen Gewerbestandes der Altstadt waren der Brandfackel zum Opfer gefallen, jetzt traf auch die prächtigen Häuser der Reichen und Vornehmen dasselbe schreckliche Los.
Der herrliche Alte Jungfernstieg, die auch im Ausland berühmte schönste Promenade Hamburgs mit den ersten Gasthöfen der Stadt, mit ihren Luxusläden und so manchem fürstlich ausgestatteten Palast der Kauf- und Handelsherren brannte vollständig nieder. Nur weniges konnte in der allgemeinen, alle Begriffe übersteigenden Noth und Verwirrung gerettet werden; der Verlust an Kunstschätzen und kostbarem Hausrath betrug hier allein mehrere Millionen. Aber schon bevor das Feuer die ganze Häuserreihe ergriffen, hatte man ein verzweifeltes Mittel zur Abwehr beschlossen: die letzten westlich gelegenen großartigen Gebäude, Streits Hotel und das stattliche Wohnhaus des Bankiers Salomon Heine, des reichsten Mannes von Hamburg, wurden in die Luft [307] gesprengt. Die ungeheuren Explosionen brachten eine Erschütterung hervor gleich einem Erdbeben, aber das dadurch entstandene weite Trümmerfeld, welches durch die von dem nahen Alsterbassin gespeisten Spritzen mit Wasser förmlich überschwemmt wurde, setzte doch hier dem Feuer eine dauernde Grenze. Der Gänsemarkt, der Neue Jungfernstieg mit der Esplanade, wo man bereits angefangen hatte, die Häuser zu räumen, kurz, der ganze westliche Stadttheil war gerettet. Die dortige Bevölkerung athmete auf; es war eine Erlösung von entsetzlicher Angst.
Im Nordosten der Stadt dagegen wüthete die Feuersbrunst mit teuflischer Hast weiter und zog immer mehr Straßen und Gassen in ihren verheerenden Flammenkreis hinein. Vom östlichen Ende des Jungfernstiegs hatte sie die Alster- und Bergstraße ergriffen und bedrohte jetzt die Sankt Petrikirche.
Inzwischen war die auf großen Pontons im jenseitigen Harburg eingeschiffte hannoversche Artillerie, welche der Senat zur Unterstützung erbeten hatte, am Grasbrook gelandet; in fieberhafter Eile wurden die Kanonen und Pulverwagen bespannt und rasselten alsbald durch die verschont gebliebenen südöstlichen Straßen. Es war wie zu Kriegszeiten in einer belagerten Stadt. Am Speersort nahmen die Batterien Aufstellung, um die Häuser des „Bergs“ niederzuschießen und dadurch möglicherweise die Petrikirche vor dem Untergang zu bewahren. Das schwere Geschütz donnerte weithin, die gewaltigen Kugeln schossen Bresche auf Bresche, und die schönen Gebäude, vor wenig Tagen noch von friedlichen und ahnungslosen Menschen bewohnt, stürzten krachend zusammen.
Aber auch hier war jede menschliche Kraftanstrengung vergebens. Der dichte Feuerregen vom „Breiten Giebel“ ergoß sich auf die Trümmerhaufeu und setzte sie trotz aller Löschversuche in Brand; aus einzelnen Dächern der am Petrikirchplatz gelegenen Häuser wirbelte bereits am Abend des 7. Mai blutrother Qualm auf. Gegen Mitternacht stand die 460 Fuß hohe herrliche Thurmpyramide, der Stolz aller Hamburger und in ganz Deutschland wegen ihrer meisterhaften Konstruktion berühmt, in feuriger Lohe, und ein ungeheurer, vom Sturme gepeitschter Flammenmantel umhüllte den stolzen Bau. Ein grauenerregender und doch prächtiger Anblick, und dem, der es mit angesehen, für sein ganzes Leben unvergeßlich! Auch hier, wie bei der Nikolaikirche, ließ das Glockenspiel seinen Klageruf ertönen - das Wimmern eines Kindes gegen ein blutgieriges Raubthier - und schon nach einigen Stunden war das grausige Werk der Vernichtung vollendet.
Der Brand tobte weiter nach dem Pferdemarkt hin und riß leider auch die schöne gothische Gertrudenkapelle mit in das allgemeine Verderben. Aber hier standen die aus Kiel und Lübeck auf Eilfuhren angelangten Spritzen mit ihrer kräftigen und unerschrockenen Bemannung und vertheidigten Schritt für Schritt und Haus für Haus die Umgebung der Jakobikirche, die auch glücklich gerettet wurde. Sogar der Sturm ward den Rettern gewissermaßen zum Bundesgenossen, denn er wandte sich plötzlich nach Nordwesten der Außenalster zu, so daß die Bewohner der Vorstadt Sankt Georg nichts mehr zu befürchten hatten
Die ganze Ostseite der Binnenalster freilich fiel noch der Vernichtung anheim. Das dort liegende Zuchthaus war bereits vorsorglich [308] tags vorher von seinen gefährlichen Insassen geräumt worden, weshalb das Feuer nur leere Räume und nackte Wände vorfand[1]; aber der daranstoßende Holzdamm, eine neue Straße mit prächtigen Häusern war nicht zu retten und wurde gleichfalls ein Raub der Flammen.
So war nach drei fürchterlichen Tagen und Nächten der vierte Morgen angebrochen, ein Sonntag!
Das Flugfeuer der im äußersten Norden brennenden Straßen hatte allerdings noch das letzte an der dortigen Wallpromenade liegende große Stadtgefängniß, das sogenannte „Detentionshaus“, entzündet und vollständig eingeäschert, als ob der Brand noch einmal seine ganze Wuth auslassen wollte, aber dann sanken die Flammen, weil sie nichts mehr zu verzehren und zu verwüsten vorfanden. Auf der weiten Brandstätte selbst loderten sie freilich hier und da sogar noch tagelang fort.
Am Nachmittage dieses unvergeßlichen Sonntages zog einschweres Gewitter aus Südwesten herauf und sandte einen Wolkenbruch über die Stadt – wäre die köstliche Himmelsgabe nur vierundzwanzig Stunden früher gekommen! – und bald darauf stand ein heller Regenbogen im Osten: ein Friedens- und Versöhnungszeichen!
Um dieselbe Stunde erließ der Senat jene Proklamation, die noch heute im Gedächtniß aller Hamburger fortlebt.
„Freunde! Mitbürger!“ hieß es darin, „mit des Allmächtigen Hilfe und der anstrengenden Thätigkeit und der eisernen Ausdauer unserer Bürger und Angehörigen und unserer wohlwollenden Freunde und Nachbarn ist der ungeheuren Feuersbrunst Einhalt gethan ...
Unser geliebtes Hamburg ist nicht verloren, und unsere regsamen Hände werden, wenn auch allmählich und in Monaten und Jahren, das schon wieder aufzubauen wissen, was das furchtbare Element in Stunden und Tagen so hastig zerstörte.
Nach der schon einige Tage später vorgenommenen amtlichen Erhebung waren in 52 Straßen und Gassen 2007 Häuser vollständig niedergebrannt, 219 Häuser dergestalt beschädigt, daß über die Hälfte von ihnen abgebrochen werden mußte; gegen 33000 Einwohner waren obdachlos geworden. Der Gesammtschaden wurde rund auf hundert Millionen Mark Banko = 50 Millionen Thaler geschätzt. Der Verlust an Menschenleben konnte nicht genau angegeben werden. Von 75 aufgefundenen Leichen wurden 54 nach ihrer Persönlichkeit festgestellt, und vielleicht sind ebenso viele in den Flammen umgekommen oder von einstürzenden Mauern erschlagen worden.
Der Hafen mit den vielen tausend Schiffen aller seefahrenden Nationen der Erde blieb glücklicherweise völlig verschont: ein Hafenbrand hätte vielleicht die Zerstörung von ganz Hamburg nach sich gezogen.
Die durch das Unglück hervorgerufene Theilnahme war ebenso groß wie allgemein, zunächst in Deutschland selbst, dann in ganz Europa und sogar über Europa hinaus. Fürsten wetteiferten mit ihren Völkern in Liebesgaben. Der König von Preußen sandte 50000 Thaler und ordnete Kirchenkollekten im ganzen Lande an: ein schönes Beispiel, dem alle übrigen deutschen Herrscher folgten. Der Großherzog von Mecklenburg gab gar 100000 Thaler, und die hannoversche Ständeversammlung bewilligte eine gleiche Summe. Der Kaiser von Oesterreich, die Könige von Bayern, Württemberg und Sachsen, von Dänemark und Schweden sandten wahrhaft königliche Gaben. Der Kaiser von Rußland schickte 50000 Rubel, die kaiserliche Familie die doppelte Summe, und der Petersburger Adel ebensoviel. Die Schwesterstädte Lübeck, Bremen und Frankfurt schlossen sich hochherzig an und überboten sich gegenseitig. Aus London allein kamen gegen 40000 Pfund Sterling. Die „Kölnische Zeitung“ brachte schon am 11. Mai einen erschütternden Aufruf, der in Rheinland und Westfalen Hunderttausende eintrug. Die Pariser Bankiers schickten eine bedeutende Summe, Louis Philippe stand mit 25000 Franken an der Spitze. Und so ging es weiter und weiter – wer könnte alle die Geber nennen!
Aber auch der gesammte Kaufmanns- und Bürgerstand, vor allem in Deutschland selbst, blieb nicht zurück, und schon nach einigen Wochen gab es kaum eine deutsche Stadt bis zum kleinsten Städtchen, wo sich nicht ein Hilfsverein gebildet hätte, der Beiträge sammelte, fast immer mit wahrhaft erhebendem Erfolge. Da durfte Hoffmann von Fallersleben wohl mit Recht ausrufen: <poem> „Niemals trat in schön’rer Reinheit Noch hervor zu einer Zeit Solch Gefühl von deutscher Einheit, Solch Gefühl für deutsches Leid!“
So flossen Millionen zusammen, die der in Hamburg eingesetzten Unterstützungsbehörde überwiesen wurden, und die begüterten und von der Heimsuchung verschont gebliebenen Bürger der Stadt gaben gleichfalls mit vollen Händen. Aber es galt nicht allein die augenblickliche Noth von vielen tausend verarmten Familien zu lindern, sondern auch für ihre nahe und ferne Zukunft zu sorgen.
[309] Schon während des Brandes waren auf der Elbe große Schiffsladungen und von den Nachbarländern zahlreiche Frachtfuhren angelangt mit Brot und Lebensmitteln aller Art, mit Betten, Kleidern und allem nur denkbaren Hausbedarf und sofort an die Bedürftigen vertheilt worden. Man hatte auf den freien Feldern vor den westlichen Thoren Zelte und Bretterbuden errichtet, wo die Abgebrannten ein vorläufiges Unterkommen fanden, und die werkthätige Nächstenliebe bewährte sich überall.
Dann raffte sich die Bürgerschaft thatkräftig und hoffnungsfreudig auf, und das so schrecklich verwüstete Hamburg erstand aus Schutt und Trümmern zu unvergleichlichem Glanze.
Die herrliche Stadt an der Elbe ist jetzt eine Weltstadt ersten Ranges und der Stolz Deutschlands geworden, und der würdige Schlußstein des neuerbauten Stadttheils, das Rathhaus, geht nun auch seiner Vollendung entgegen. Möge der Prachtbau ein Glück und Segen verheißendes Wahrzeichen sein für alle Zeit!
Die Franzosen Saint Simon und Fourier, die ersten namhaften Verkünder sozialistischer Lehren, hatten sich überlebt. Die neue Saint Simonistische Religion hatte keinen Anklang gefunden und ihr Oberhaupt, der „Vater“ Enfantin, beschloß seine Laufbahn mit nur achtunddreißig Getreuen vor dem Gerichte, das sich mit der Weibergemeinschaft und anderen Lehren der Propheten nicht zu befreunden vermochte. Auch die von Fourier angepriesenen „Phalansteren“, jene gemeinschaftlichen Wohn- und Arbeitsräume, in denen die Menschheit sich glücklich fühlen sollte, hatten sich als ein schöner Traum erwiesen. Die Nachfolger der ersten Propheten, welche nach dem Sturze des französischen Königreiches in den Wirren der Jahre 1847 und 1848 mit ihren Nationalwerkstätten keinen Erfolg hatten, wohl aber die Macht in der zweiten Republik an sich reißen wollten, hatten den kürzeren gezogen. In den furchtbaren Straßenkämpfen, welche im Juni 1848 durch Paris tobten, hatte das Bürgerthum den Sieg davongetragen. Die Sozialisten waren besiegt, aber die soziale Flage war dadurch nicht gelöst worden; sie blieb ein fortlaufender Gegenstand der öffentlichen Tagesordnung.
In jenen Jahren stand ein Mann auf der Höhe seiner Bedeutung, der sich gleichfalls mit sozialen Problemen befaßte, aber es weder mit den sozialistischen Parteien seiner Zeit, noch mit den Anhängern der alten Gesellschaftsordnung hielt, sondern seine eigenen Wege wandelte. Dieser Mann war Pierre Joseph Proudhon, der den breiten Massen durch den kecken Satz: „Eigenthum ist Diebstahl“ bekannt wurde und auf dessen Schultern sich im Laufe der Jahrzehnte die finstere Partei der Anarchisten zu
ihrer gegenwärtigen Bedeutung erheben konnte; denn Proudhon gebührt der herostratische Ruhm, die „Anarchie“, d. h. die Herrschaftslosigkeit, als eine Form für die menschliche Gesellschaft ausgedacht zu haben; er war der erste, der lehrte, daß die Menschen ohne Regierung und ohne irgendwelche Gesetze leben könnten, und war verblendet genug, zu behaupten, daß sie dabei glücklicher werden würden als in der heutigen Gesellschaftsform.
Damals legte man dem Auftreten Proudhons keine große Wichtigkeit bei; der Mann war kein Volkstribun, der in zündenden Reden die Volksmassen mit sich hätte fortreißen können, er war mehr ein Philosoph, ein Grübler und ein Denker, dessen [310] geistreiche Pointen nur die Gebildeteren verstehen konnten, und außerdem zog er aus seinen Lehren nicht alle die bedrohlichen Folgerungen, die in ihnen verborgen waren. Dieser eigenartige Weltverbesserer, der alle Gesetze aufheben wollte, mußte bei sämmtlichen Parteien, sowohl bei den Reaktionären wie bei den röthesten Sozialisten, Anstoß erregen, und die Franzosen fanden auch ein geflügeltes Witzwort, durch das sie Proudhon lächerlich zu machen suchten; sie fanden in dem Worte Anarchie einen Anklang an das Wörtchen ane, welches „Esel“ bedeutet, und nannten das neue System, mit dem die Welt beglückt werden sollte, nicht Herrschaftslosigkeit, sondern Eselsherrschaft.
Heute denkt die Welt über die Folgen der Lehren Proudhons anders; denn von allen Seiten her wird sie durch Nachrichten von verbrecherischen Attentaten in Empörung versetzt – von Attentaten, die aller Menschlichkeit spotten und nicht mehr als Zeichen eines politischen Kampfes, sondern als Ausgeburten einer finsteren Zerstörungswuth gedeutet werden müssen.
Im 4. Jahrhundert v. Chr. Geburt lebte in Ephesus ein gewisser Herostratos, der den Tempel der Diana in Brand steckte, nur um durch eine unerhörte That seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen. Der herostratische Trieb, der an den Wahnsinn grenzt oder bereits eine Frucht desselben ist, hat sich zu allen Zeiten in einzelnen Menschen bethätigt, und so hörte man oft von Verbrechen, welche für den gesunden Menschenverstand geradezu unbegreiflich waren. Es hat auch zu verschiedenen Zeiten politische Parteien gegeben, welche, um ihr Ziel zu erreichen, vor dem Verbrechen nicht zurückscheuten, aber sie bildeten stets nur vereinzelte Erscheinungen in der Geschichte.
Erst das 19. Jahrhundert hat eine Partei gezeitigt, welche die Zerstörung um jeden Preis auf ihre Fahne geschrieben hat, und der Geschichtschreiber unserer Zeit muß mit Beschämung feststellen, daß diese Grundsätze nicht etwa einmal wie ein unheimlicher Brand aufflackerten, um für immer zu erlöschen, sondern daß sie in den Massen von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt großgezogen werden konnten. In der That bildet die Geschichte des Anarchismus ein traurig düsteres Kapitel der Weltgeschichte, das mit philosophischen Redensarten beginnt und bereits bei vergossenem Blute und Dynamitbomben angelangt ist.
Pierre Joseph Proudhon wurde am 15. Juli 1809 als der Sohn eines armen Böttchers zu Besançon geboren. Er widmete sich dem Buchdruckergewerbe und wurde aus dem Setzer zum Theilhaber einer Buchdruckerei. Er war von einem regen, aber auch unruhigen Geiste, begann verschiedene Wissenschaften zu studieren und gab eine Grammatik heraus, wofür ihm die Akademie zu Besançon ein Stipendium von 1500 Franken auf drei Jahre ertheilte. Eine Preisfrage volkswirthschaftlicher Natur führte ihn auf das Gebiet des Sozialismus, und er überraschte von Paris aus die Akademie zu Besançon mit einer Schrift, welche den Titel: „Qu’est-ce que la propriété?“ (Was ist Eigenthum?) führte. Die Akademie äußerte Proudhon unverblümt ihr stärkstes Mißfallen und entzog ihm das Stipendium, aber die Schrift wurde für Proudhon und für viele andere, wie wir später sehen werden, grundlegend. Bereits in ihr hatte Proudhon die Grundzüge seines Systems aufgestellt, das in seinen späteren Werken nur noch näher ausgeführt wurde.
Der weise Mann von Besançon fand den Grund des sozialen Elends darin, daß in der heutigen Welt ungleiche Werthe zwischen dem Arbeiter und Eigenthümer ausgetauscht werden. Infolge seiner kapitalistischen Uebermacht bezahlt der Eigenthümer dem Arbeiter nicht den vollen Werth von dessen Leistung „und so erntet er, wiewohl er nicht säet, verzehrt er, wiewohl er nicht produziert, genießt er, wiewohl er nicht arbeitet.“ Der Eigenthümer wird auf diese Weise zum Dieb und Eigenthum ist Diebstahl. Alle Staatseinrichtungen und Gesetze laufen darauf hinaus, das Eigenthum zu schützen. Darum fort mit diesen Regierungen und Gesetzen! Jeder Mensch soll seinen eigenen Neigungen folgen dürfen, jeder arbeiten, was, wann und wieviel ihm beliebt. Nichts soll ihn beherrschen als seine eigene Vernunft und sein eigenes Gefühl und – das ist selbstverständlich – die Grundsätze, die Herr Proudhon für die Regelung des Austausches der Werthe aufstellt.
Der Krebsschaden unserer sozialen Einrichtung ist nach ihm der Austausch ungleicher Werthe; und er giebt einen „unfehlbaren“ Maßstab für die Beurtheilung des Werthes einer Leistung.
Gleichen Werth haben nach seiner Lehre Produkte, wenn sie in der gleichen Zeit und mit gleichem Aufwand hergestellt werden; also eine Stunde Freskomalerei wird ebenso bezahlt wie eine Stunde Kohlengraben; denn der Unterschied der Leistung hängt ja nur von Fähigkeiten der Menschen ab, und ein Musiker wie Beethoven wird für den gleichen Lohn lieber komponieren als Feldarbeiten verrichten!
Wer bezahlt aber den Lohn? Eine Behörde giebt es nicht. Nein, jeder, der etwas von einem anderen will, soll mit ihm einen Vertrag abschließen, und diese Verträge sollen die Stelle der Gesetze einnehmen.
Es wäre müßig, den Beweis führen zu wollen, daß in der Proudhonschen Gesellschaftsordnung die Uebervortheilung des einen durch den anderen Vertragschließenden im weitesten Maße möglich und die Folge davon erst recht die soziale Ungleichheit wäre. Wir möchten nur noch erwähnen, daß der erste Verfechter der Anarchie als eine Gewähr für die wirkliche Unabhängigkeit aller Produzenten den Privatbesitz hinstellte, leider aber es unterließ, genau zu bezeichnen, wie dieser Privatbesitz anders als das Eigenthum beschaffen sein sollte.
Um seine Ideen praktisch zu erhärten, gründete Proudhon während der Revolutionswirren eine „Tauschbank“, die aber kaum zur Thätigkeit gelangte, da ihr Gründer wegen Preßvergehen verhaftet und verurtheilt wurde.
Proudhon starb im Jahre 1865. Die verhängnißvolle Erbschaft, die er der Nachwelt hinterließ, war der Gedanke an einen Staat ohne Regierung und ohne Gesetze, kurz, der Gedanke des Anarchismus.
Proudhon selbst war kein Mensch, der zu Gewaltthaten neigte, er meinte, daß seine Weltordnung durch die ihr innewohnende geistige Kraft zum Siege gelangen würde. Vom allgemeinen Stimmrecht erwartete er nichts; da die Massen sich doch nur durch Führer leiten ließen, nannte er das allgemeine Stimmrecht „Erdrosselung des öffentlichen Bewußtseins“. Die Durchführung seiner Pläne erhoffte er lediglich von der Propaganda, von der Verbreitung seiner Lehren. „Sind die Ideen aufgestanden,“ sagte er, „so stehen die Pflastersteine von selbst auf, wenn anders die Regierung nicht vernünftig genug ist, sie nicht abzuwarten. Ist das nicht der Fall, so hilft alles nichts.“
Wir werden sehen, in welcher Weise der Gedankengang des Weisen von Besançon von seinen Nachfolgern fortgesponnen wurde.
Die Lehren Proudhons fanden in den vierziger Jahren ein wenn auch schwaches Echo in Deutschland. Es fanden sich hier in der gährenden sturmbewegten Zeit einige Leute, welche im Proudhonschen Sinne weiter philosophierten. Neben dem Agitator Moses Heß waren es namentlich die Schriftsteller Karl Grün, Max Stirner und W. Marr. Karl Grün versprach sich von dem herrschaftslosen Staate ein wahres Paradies auf Erden: was die Menschheit zu ihrer Lebensnothdurft brauche, das könnten an den vervollkommneten Maschinen Kinder unter fünfzehn Jahren „in Festkleidern als Spiel zur Zerstreuung“ produzieren. Max Stirner wußte an den Egoismus zu appellieren; der anarchistische Staat bestand nach ihm aus einem freien Verein von Individuen, und die Vortheile, die der einzelne daraus ziehen könnte, beleuchtete er mit den Worten: „Den Verein benutzest Du und giebst ihn pflicht- und treulos auf, wenn Du keinen Nutzen aus ihm zu ziehen weißt. Die Gesellschaft verbraucht Dich, den Verein verbrauchst Du!“ Wilhelm Marr schoß über Proudhon weit hinaus, in dem er unter anderem die Vernichtung der Ehe predigte.
Dieser deutsche Anarchismus verschwand mit den Stürmen der vierziger Jahre von der Bildfläche, und auch Proudhon wurde vergessen; das Schlagwort „Anarchie“, welches der Franzose ausgegeben hatte, sollte erst später von den Russen wieder aufgenommen werden. Erst als das Geistreichthun der Franzosen mit der rohen Gewalt der Russen sich paarte, sollte die Welt durch die ungeheuerliche Schöpfung des heutigen Anarchismus überrascht werden.
Am Anfang der sechziger Jahre gewann die sozialistische Bewegung neue Nahrung; in jene Zeit fällt die Gründung der „Internationale“ und der deutschen sozialdemokratischen Partei. Im Gefolge der Sozialistenführer erschien damals ein Mann, der schon auf eine wechselvolle revolutionäre Thätigkeit zurückblickte, der in den vierziger Jahren in Deutschland und Oesterreich [311] zum Tode verurtheilt und dann begnadigt worden war, der später als Strafkolonist Sibirien kennengelernt hatte und über Japan nach Kalifornien geflohen war: dieser Mann war Michael Bakunin. Er war zum Vertreter der radikalsten Richtung geworden und wurde sowohl von der Internationale als von den Sozialdemokraten ausgestoßen, aber er ließ sich nicht mäßigen und halten; er ging seinen Weg weiter und gründete seine eigene Partei, indem er von Proudhon das Schlagwort „Anarchie“ entlehnte. Für Bakunin bedeutete jeder Staat Herrschaft und somit jeder Staat Despotismus – Freiheit könne man nur von einer „freien Vereinigung“ von Menschen ohne jeden gesetzlichen Zwang erwarten. Wie diese Vereinigung beschaffen sein sollte, darüber zerbrach sich Bakunin den Kopf nicht, er erklärte vielmehr rundweg, daß es müßig sei, sich mit der genaueren Ausmalung der idealen Zukunftsgesellschaft zu befassen, da diese nach dem Sturze der alten sich von selber entwickeln werde. So mußten alle, die das Los der Menschheit verbessern wollten, nach seiner Meinung nur darauf bedacht sein, den Sturz der heutigen Gesellschaft herbeizuführen.
Auf Reformen ließ sich Bakunin nicht ein; parlamentarische Kämpfe waren für ihn ein müßiges Unterfangen, die Masse der Wähler werde ja doch durch einige wenige Führer beeinflußt, die Stimmzettel waren in seinen Augen keine Waffe – und er hatte von seinem Standpunkt ganz recht; denn auf den unsicheren Wechsel der herrschaftslosen Vereinigung, die sich erst nach dem Sturze der heutigen Gesellschaft bilden sollte, hätte er niemals eine größere Zahl von Anhängern werben können; er wäre auf sein leeres Programm niemals in ein Parlament gewählt worden.
Er predigte darum die Anwendung der Gewalt zur Vernichtung des Bestehenden. Seine Anhänger sollten sich die Aufgabe stellen, Anarchie, d. h. Gesetzlosigkeit und Unordnung im heutigen Sinne des Wortes herbeizuführen. Bakunin war es, der in dürren Worten die furchtbare Losung gab: „Anarchie in dem Sinne der Entfesselung alles dessen, was man heute böse Leidenschaften nennt, und der Vernichtung desjenigen, was man in derselben Sprache öffentliche Ordnung nennt!“ Zu diesem Zwecke gründete er einen Geheimbund, dessen Mitglieder laut seinen Satzungen „revolutionäre Leidenschaft besitzen, ja den Teufel im Leibe haben sollten“. Die Aufgabe des Geheimbundes bestand darin, den Generalstab für die kommende Revolution heranzubilden.
Man sollte meinen, daß Bakunin an katilinarischer Gesinnung das Möglichste geleistet habe, aber er wurde dennoch an Feuereifer von einem seiner Schüler übertroffen.
In dem Geheimbund Bakunins befand sich ein junger Mann von etwa 22 Jahren. Es war Sergei Netschajew, Sohn eines Hofbedienten und ehemaliger Lehrer in einer russischen Dorfschule. Bakunin und Netschajew lernten sich in der Schweiz kennen und von hier aus sandte Bakunin seinen Jünger nach Rußland; er sollte „unter das Volk gehen“ und auch in Rußland den Generalstab für die künftige Revolution sammeln. Die Hauptthätigkeit Netschajews fällt in das Jahr 1869.
Noch jung an Jahren, wandte sich Netschajew vor allem an die studierende Jugend und beredete seine Anhänger, die Hörsäle zu verlassen und „unter das Volk zu gehen“. Sie sollten für die kommende Revolution nicht nur die Bauern, sondern alle Stände zu gewinnen suchen, ja selbst vor dem Bunde mit Räubern nicht zurückschrecken. Als Anweisung für diese seine Sendlinge entwarf Netschajew feinen „Katechismus des Revolutionärs“.
Der Revolutionär sollte nach den Geboten Netschajews mit allem brechen, was ihm bis dahin lieb und heilig gewesen war.
Für ihn sollte es fortan nur einen Trost, nur einen Genuß, einen Lohn und ein Verlangen geben: den Erfolg der Revolution. Tag und Nacht sollte ihn nur ein Gedanke beschäftigen: der Gedanke an die unerbittliche Zerstörung. „Das Wort,“ lehrte Netschajew, „hat für uns nur Werth, wenn ihm die That auf dem Fuße folgt“, und zur Ausführung dieser That sollte man sich aller möglichen Mittel bedienen. Gift, Dolch, Strick u. s. w., alle Mittel billigte Netschajew, „denn die Revolution heiligt alles ohne Unterschied.“
Und welches Ideal, welche neue Staats- oder Gesellschaftsordnung schwebte diesem furchtbaren Fanatiker vor?
Gar keine! lautet die Antwort. Darin offenbart sich der schaurige Wahn des Anarchismus; er will nichts aufbauen. Die Gestaltung des neuen freien Reiches überläßt Netschajew – den künftigen Geschlechtern. „Unsere Arbeit,“ ruft er, „ist die schreckliche, totale unerbittliche Zerstörung!“ Diese Art der Revolution nannte Netschajew die „Propaganda der That“.
Netschajew wirkte in Rußland nur eine kurze Zeit. Er fürchtete von einem der Mitglieder seines Geheimbundes, daß es ihn an die Regierung verrathen würde, und er kam ihm zuvor, indem er es ermordete. Infolgedessen floh er nach der Schweiz, wurde aber von dieser im Jahre 1872 an die russische Regierung ausgeliefert. Niemand vermag zu sagen, was aus ihm geworden ist; mit seinem Verschwinden in den russischen Gefängnissen bricht die Lebensgeschichte des Erfinders der „Propaganda der That“ ab.
So haben die Russen auf Grund der Proudhonschen Philosophie den modernen Anarchismus geschaffen, den Proudhon selbst ohne Zweifel mit Abscheu verdammt hätte. Allein dieser reine moderne Anarchismus kam in Rußland wenig zur Geltung; dort bildete sich eine besondere revolutionäre Partei aus, welche durch ihre Schreckensthaten zu einer unheimlichen Macht wurde, aber die Ziele dieser russischen „Nihilisten“ sind politisch-nationaler Natur, so daß man diese Partei mit dem Anarchismus nicht verwechseln darf.
Dagegen fanden die Lehren Bakunins und Netschajews in hirnverbrannten Köpfen des europäischen Westens Anklang. Bakunin starb im Jahre 1873, doch seine Schüler setzten in der Schweiz die Agitation fort, und es gelang ihnen, dieselbe auch nach Deutschland zu verpflanzen. Zum Verfechter der Propaganda der That wurde hier Reinsdorf und später Johann Most, der, wie einst Bakunin, wegen seiner radikalen Anschauungen von der sozialistischen Partei sich trennen mußte. Die Schandthaten des Anarchismus in Deutschland sind jedem bekannt: auf diese wüste Agitation ist das Attentat Hödels auf den Kaiser Wilhelm I. im Jahre 1878 zurückzuführen; hierher gehört der Plan Reinsdorfs, im Jahre 1883 die deutschen Fürsten am Niederwalddenkmal in die Luft zu sprengen; eine Anarchistenthat war ferner die Ermordung des Polizeiraths Rumpff in Frankfurt a. M. durch Lieske im Jahre 1885 und allem Anschein nach auch der räuberische Angriff auf den Dekan Poninski in Koscielec, Reg.-Bez. Bromberg, von dem vor einigen Wochen Kunde zu uns gelangt ist.
Der Anarchismus vermochte jedoch in Deutschland nicht größere Fortschritte zu machen; denn er wurde nicht nur von der Regierung, sondern auch von den Leitern der sozialdemokratischen Partei bekämpft, Sozialdemokratie und Anarchismus gehen ja nicht nur in der Taktik, sondern auch in den Zielen auseinander. Die Sozialdemokratie will die Welt durch eine zwangsweise Regelung der Produktion verbessern, ihre Bestrebungen sind mehr oder weniger kommunistischer Natur, während der Anarchismus im vollsten Gegensatz hierzu allen Zwang aufheben will.
Unter dem modernen Anarchismus hat ferner Spanien zu leiden. Die Anarchisten benutzten schon die Revolution im Jahre 1873, um ihr Haupt zu erheben und sich sogar einiger Städte im Süden zu bemächtigen; sie wurden damals bald niedergeworfen und als sie später durch den Geheimbund „die schwarze Hand“ einen neuen Aufstand vorbereiten wollten, wurde dieser rechtzeitig entdeckt und im Keime erstickt. Leider aber hat nach den jüngsten Berichten der Anarchismus in Spanien wieder an Ausbreitung gewonnen.
Oesterreich wurde zu Anfang der achtziger Jahre von der anarchistischen Agitation heimgesucht; hier schritten die Anarchisten zum Morde von Privatpersonen, um sich Mittel für die Partei durch Raubmord zu verschaffen. Nach der Hinrichtung der Hauptschuldigen Stellmacher und Kammerer gelang es jedoch der Regierung, die Bewegung in kurzer Zeit zu unterdrücken.
Wenn auch England selbst von anarchistischen Attentaten verschont blieb, so bildete doch London lange Zeit den Schlupfwinkel der Anarchisten, hier gab auch Most seine berüchtigte Zeitung „Die Freiheit“ heraus, in welcher er offen zum Morde aufforderte. Als er schließlich in London keinen Drucker mehr für sein Blatt finden konnte, zog er nach Amerika, um dort seine Thätigkeit fortzusetzen. Es ist geradezu ungeheuerlich, was der wilde, blutgierige Wahnwitz dieses Menschen an Aufreizung zu leisten vermochte. Er gab Anweisungen in der „revolutionären Kriegswissenschaft“ und empfahl Mittel zur Vernichtung von Menschen, die sonst nur in Irrenhäusern ausgeheckt werden. Einen Irrsinnigen, der wie [312] Most predigen würde, man solle bei Gesellschaften Gift unter die Speisen mengen, würde man sicher als einen gemeingefährlichen Menschen einsperren, – Most ging frei umher, obwohl er lehrte, daß nur der zwanzigste Theil der Bevölkerung zu vernichten sei, um die Anarchie herbeizuführen, was für Deutschland den Mord von zwei und einer halben Million Menschen bedeutet!
Die Hetzreden Mosts in Nordamerika führten bald eine Katastrophe herbei; als im Jahre 1886 der große Streik in Chicago ausbrach, mischten sich die Anarchisten unter die Streikenden; es kam zu Tumulten und Zusammenstößen mit der Polizei. Die Anarchisten suchten ihre „Kriegswissenschaft“ zu verwerthen und warfen eine Dynamitbombe unter die Polizeimannschaft; sechzig Tote und Verwundete bedeckten den Kampfplatz. Damit aber war die Geduld der Amerikaner erschöpft; man ergriff die Rädelsführer und ließ sie henken. Most freilich kam mit einer Freiheitsstrafe davon; aber der Anarchismus in Amerika wurde wenigstens für längere Zeit zurückgedrängt.
Frankreich, in welchem die Idee des Anarchismns ausgedacht wurde, blieb längere Zeit von den Gewaltthaten der Anarchisten verschont. Als Propheten des Anarchismus traten hier in den siebziger Jahren der bekannte Geograph E. Reclus und der russische Fürst Krapotkin auf; aber die Bewegung fand so wenig Anklang, daß in Paris anarchistische Zeitungen nur infolge von Unterstützungen erscheinen konnten, die ihnen der Polizeipräsident Andrieux zukommen ließ, um durch den Hinweis auf das Vorhandensein solcher Blätter die Strenge seines Systems zu rechtfertigen. Mit dem Rücktritt Andrieux’ hörte dieses falsche Gebahren auf und der Anarchismus schien im Erlöschen begriffen zu sein, obwohl schon die Namen der verschiedenen anarchistischen Klubs in Paris, „die Brandfackel“, „die Dynamitbombe“, „der Panther“ etc., nichts Gutes ahnen ließen. Und in der That sollte Frankreich in allerjüngster Zeit zum Schauplatz der ruchlosen Dynamitattentate eines Ravachol werden. Es ist zu erwarten, daß die Regierung der Republik mit der nöthigen Kraft vorgehen wird, um diesen neuen Herd der Partei der Zerstorung zu unterdrücken.
Das sind in kurzen Umrissen fünfzig Jahre der Geschichte des Anarchismus; ein schauerlicher Beitrag zu den traurigen Verirrungen des menschlichen Geistes. Proudhon hat gesagt: „Sind die Ideen aufgestanden, so stehen die Pflastersteine von selbst auf, wenn anders die Regierung nicht vernünftig genug ist, sie nicht abzuwarten.“
In der That, die Anarchisten sorgen dafür, daß selbst den
Blinden die Augen aufgehen und daß die Regierungen Maßregeln ergreifen, damit die Pflastersteine nicht von selbst aufstehen.
Andererseits ist aber auch zu hoffen, daß mit der allmählichen Besserung der sozialen Lage, bei weiteren Fortschritten einer vernunftgemäßen Lösung der sozialen Frage auf der alten gesellschaftlichen Grundlage, die Erbitterung der Massen nach und nach schwindet und damit dem Anarchismus der Boden, auf dem er heute wuchert, entzogen wird. C. Falkenhorst.
Onkel Christians sieben Lieben.
Es war nach Lilis Hochzeit.
Wir hatten den Neuvermahlten zum Abschied das Geleite gegeben und standen nun auf der Terrasse – Onkel Christian und ich und die Geschwister alle, die von nah und fern gekommen waren zum Ehrentag der Jüngsten, unseres Lieblings. Und nun riefen wir und winkten noch dem entschwindenden Wagen nach, der sie uns entführte – „mit dem letzten Aufgebot aller disponiblen Kräfte“ hatte Bruder Edwin, der Generalstäbler, gerufen, während er lustig eine Serviette im Winde flattern ließ.
Sie waren alle in fröhlichster Stimmung, die Brüder, die Schwestern und Schwäger. Es war ja auch keine Trennung von unserer „Kleinen“; dort drüben auf der Höhe stand das stattliche Herrenhaus, das fortan ihr Heim sein sollte – und ein glückliches Heim, wenn nicht alle menschliche Voraussicht trog. Der lustige laute Nachklang des Hochzeitmahles und seiner schwungvollen Reden war somit berechtigt.
Nur mir ward es weh ums Herz, als ich das Schwesterlein lachenden Mundes an der Seite des fremden Mannes hinausfahren sah in die weite Welt – meine Lili, die ich fünfzehn Jahre lang gehegt und gehütet hatte wie mein Bestes. Ich fühlte, daß sich die Thränen gewaltsam vordrängten, und schlich hinäuf in das Erkerstübchen, um hier, fern von der lustigen Gesellschaft, in dem Raume, den wir all die Jahre gemeinsam bewohnt hatten – das „Kind“ und ich – den Thränen Audienz zu geben und all den Gedanken und Bildern auch, die wehmüthig und still vor meine Seele traten. das Bild des Vaters, der diesen Raum so liebevoll für mich geschmückt hatte, als ich, ein sechzehnjähriges Mädchen, aus dem Pensionat heimkehrte, um die fremde Mutter und das kleine blonde Schwesterchen auf dem Rüdenhof zu finden, und ihr Bild, das Bild der schönen bleichen Frau, welche so hilflos und fremd den ungezügelten Stiefkindern gegenübergestanden. Arme Mutter! So willig nahm sie den stützenden Arm der großen Tochter, und dann so bald, völlig gebrochen durch den plötzlichen Tod des Vaters, neigte sie das Haupt wie eine welkende Blume.
Da kam ihr Bruder, Onkel Christian, ihr zur Stütze, uns allen als Helfer. Seine Klugheit, sein milder Ernst löste jedes Wirrniß, jeden Zweifel, schaffte Ordnung unter den wilden Knaben, hob den Muth der verzagenden Mädchen.
Eines Tages trat er in dies Stübchen. Noch sehe ich ihn, den großen schlanken Mann mit seinen ruhigen und doch so leichten Bewegungen. Schmerzlich bewegt ergriff er meine Hand und führte mich hinab in Mamas Zimmer. Sie rang mit dem Tode, die arme Mutter, und daneben lag blond und rosig die kaum dreijährige Lili in süßem Schlummer! „Wir wollen treu zusammenstehen, Leonore,“ hatte der Onkel in seiner schlichten Art gesagt, „damit das Kind nie empfinde, daß es von früh an verwaist ist.“ Nach meinen besten Kräften habe ich das Gelöbniß gehalten, das ich dann in die erkaltende Hand der Sterbenden ablegte – ich habe Mutterstelle an Lili vertreten und, so gut es ging, an den anderen Geschwistern auch. Doch daß ich dies in meiner Jugend und Unerfahrenheit konnte, das verdankte ich Onkel Christians weisem treuen Rathe. Als unser aller Vormund nahm er sofort die Zügel der Verwaltung in seine feste Hand, im Hause aber ließ er mich schalten, mit unerschöpflicher Geduld unterstützend und belehrend, wo es noth that. Und Haus und Hof gedieh, und die Kinder entpuppten sich! Die jüngeren Schwestern wurden von meiner Seite weggeheirathet, die Brüder schieden einer nach dem anderen aus dem Hause, Edwin ging zur Armee, August auf die Hochschule. Endlich nahmen sie mir auch den blonden Egon, der durch seine zarte Gesundheit und sein weiches Wesen immer besonderer Pflege bedurft hatte.
Dabei flogen die Jahre dahin und nahmen meine Jugend mit sich. Manchmal freilich war es bis an mein Ohr gedrungen, ich sei eigentlich so übel nicht, wenn auch keine Schönheit wie Hilda und nicht so geistreich wie Jette, doch könne ich wohl diesem und jenem gefallen. Bei einem hätte ich das auch leiden mögen, wenn – ja, wenn! Aber ich hatte nicht Zeit zu eitlen Grübeleien. Lili war mir ja geblieben und Onkel Christians häufige Besuche, und die gute taube Miß Wood, die „Reliquie“, wie die Brüder sie nannten. Und dann die Wirthschaft und der zunehmende Briefwechsel! Du lieber Himmel, wo hätte ich da Muße finden sollen zu Jugendträumen, zu Hoffen und Harren? Die Jahre entschwanden auch gar zu schnell in der täglich sich erneuernden Sorge; ganz plötzlich war Lili unter meinen Händen zur holdesten Jungfräulichkeit erblüht, und „ach so bald, ach so balb!“ hatte es Nachbars Fritz entdeckt! Nun hatte ich auch dieses letzte und liebste Kind meiner Sorge ziehen lassen müssen!
Es überkam mich ein Gefühl der Vereinsamung und Leere. Was konnte ich nunmehr beginnen mit meinem verwaisten Leben? Ich trat vor den Spiegel. Mit grausamer Klarheit sagte er mir, daß mit vierunddreißig Jahren das Mädchen eine alte Jungfer ist. Ich bekenne, diese Selbsterkenntniß berührte mich heute unangenehm; so gern hätte ich zurückgreifen mögen nach den entschwundenen Jugendjahren!
[313]
Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen,
Da hab’ ich ihr gestanden mein Sehnen und Verlangen.
Heinrich Heine.
[314] Da tönte aus dem Salon, der unter meiner Stube lag, helles Lachen bis herauf in meine Einsamkeit.
„Und Onkel Christian?“ rief ich laut. „Welch abscheuliche Selbstsucht, des treuen Freundes zu vergessen!“
Rasch wusch ich meine verweinten Augen und eilte hinab in die Wohnräume. Ich durchschritt Billardsaal und Empfangszimmer, sie waren leer; aus der Bibliothek jedoch drangen mir laute Stimmen entgegen, die Stimmen der Brüder und Schwäger in lebhaftem fröhlichen Streite, der dann und wann von Egons Tenor und der Schwestern Lachen unterbrochen wurde. Was zankten sie denn? Ich trat ein und hörte Plato citieren, Schopenhauer und Kant, sogar den Thomas a Kempis. Schwager Philipp bat ums Wort, seine Frau hielt sich die Ohren zu, Egon rang die Hände. „Onkel Christian raubt mir meine Ideale!" – mit diesen rasch hingeworfenen Worten beantwortete er meine stumme Frage. Der Onkel aber, ein Fels im Meere, um den die Wogen branden, saß ruhig da, seinen Tschibuk rauchend, und lachte still vor sich hin.
„Um was streiten sie denn?“ fragte ich ihn.
„Um das Wesen der Liebe,“ war seine Antwort, „als wäre es zu ergründen!“
Egon jedoch, gewohnt, mich als Richterin zu betrachten, trat als Kläger vor. „Sag’ selbst, Leonore – Onkel behauptet, siebenmal geliebt zu haben, und jedesmal sei es echte, wahre Liebe gewesen; ist das möglich?“
„Siebenmal? Wirklich geliebt?“ – Onkel Christian lachte laut über mein verdutztes Gesicht.
„Ich theile Egons Ansicht,“ sagte ich. „Denn siebenmal und immer die rechte Liebe – nein, das ist unmöglich!“
„Leonore kann nicht mitsprechen in Liebesfragen,“ riefen im Chore Brüder und Schwäger, und es verdroß mich, daß sie eigentlich recht hatten. Der Onkel hingegen schien höchlich belustigt, ich hatte ihn nie so herzlich lachen hören. „Ich bin geneigt, diesen beiden Idealisten ein Zugeständniß zu machen,“ sagte er. „Möglicherweise war meine Liebe nicht in allen sieben Fällen wirkliche echte reine Liebe – aber ich hielt sie jedesmal dafür, und darauf kommt es schließlich an.“
Wieder erhob sich ein Sturm von Zwischenreden, von zustimmenden und widersprechenden. Schwager Lothars kräftiger Bariton übertönte ihn. „Ich beantrage, daß Onkel Christian aufgefordert werde, die sieben Fälle zu eingehender Betrachtung –“
„Und Belehrung,“ schaltete Edwin ein – „und Belehrung,“ fuhr Lothar fort, „dem versammelten Familienrathe vorzutragen.“
„Einverstanden! Einverstanden!“ erschallte es von allen Seiten. Nur Schwester Hilda sah sich vorsichtig um. „Ja so, die ‚Kleine‘ ist ja verheirathet,“ murmelte sie. Im Nu war die Zuhörerschaft um Onkels Armstuhl gruppiert und gab nicht nach mit Bitten, er solle seine Behauptung von den sieben echten Lieben durch die Erzählung rechtfertigen. Philipp, der Jurist, spielte Gerichtssaal und nahm die Personalien auf, wie er es nannte, während der Onkel lachend mächtige Wolken von sich blies.
„Also zur Sache!“ rief Philipp. „Fall Nummer eins – Name? Alter? Stand?“
„Halt, halt, nicht so rasch!“ rief der solchergestalt Verhörte, „ich muß mich erst besinnen, ‚Fall eins‘ ist lange her. Mein Alter? Etwa vierzehn Jahre. Das ihre ungefähr dreißig.“
Von unserer Heiterkeit oftmals unterbrochen, erzählte er nun launig und mit Humor von der schönen Babette in Prag, die als Ladenmädchen in einer Konditorei diente, wo er, von der Schule kommend, häufig einzukehren pflegte – „zur Magenstärkung, zur ‚Jause‘,“ erläuterte er, „an welche sich allmählich die Liebe knüpfte.“
Egon wollte Einwendungen erheben, Philipp verwies ihm das. „Gar nicht so ungewöhnlich, dieser Weg durch den Magen zum Herzen, mein Junge; mit vierzehn Jahren völlig normal.“
Onkel Christian gab die feierliche Versicherung, daß die Mohnkipfel und andere Herrlichkeiten eine untergeordnete Rolle gespielt hätten von dem Augenblick an, wo er sein Herz entdeckt zu haben meinte. Er schrieb Gedichte an die schöne Babette, brachte ihr Bücher und Blumen – und schon glaubte er sich ihrer Gegenliebe sicher, als er die fürchterliche Entdeckung machte, er selbst oder vielmehr seine Kappe habe als Liebesbote zwischen der Geliebten und dem eigenen Hofmeister gedient! Wilde Wuth erfaßte ihn, er wollte die Verräther und dann sich selbst töten. In Ermanglung eines Revolvers drang er mit dem Lineal auf seinen Nebenbuhler ein und hatte die Genugthuung, aus dessen Nase Blut fließen zu sehen, bevor man ihn selbst, den Rasenden, in sicheren Gewahrsam bringen konnte. „Später hat die ‚Süße‘ wohl Versöhnungsversuche gemacht, allein ich strafte die Falsche, indem ich ihr Gunst und Kundschaft entzog.“
So schloß der Berichterstatter den „Fall eins“ unter lautem Beifall der Herren.
„Hoffentlich war die zweite Liebe ernster,“ meinte Egon.
„Sentimentaler, denn sie fiel in die Zeit des Unterrichts in Rhetorik und Literaturgeschichte. Der Gegenstand war diesmal ein bleiches blondes Nähmädchen, in der ganzen Nachbarschaft als ‚Flick-Milly‘ bekannt. Sie flickte und stopfte auch bei uns allwöchentlich an bestimmten Tagen im sogenannten ‚Wäschezimmer‘. Es war dies eine Bodenkammer, fern vom lauten Treiben des großen Hausstandes, ein stilles Winkelchen, wo sie, die Holde, inmitten von riesigen Schränken und altem Gerümpel thronte, von ganzen Bergen Wäsche umgeben, und wo ich all meine Schiller-, Goethe- und sonstigen Schwärmereien ungestört in ihr ähnungsvolles Herz ergießen konnte. Ihre thränenreichen hellblauen Augen hatten es mir erschrecklich angethan; ich hielt für Schwermuth, was sich meist als Hunger erwies. Doch mich störte das wenig. Abendelang deklamierte ich und las ihr vor; alles war sie mir dabei, bald Gretchen und Klärchen, bald Hero oder Ophelia. Und sie weinte dazu, weinte Ströme von Thränen; nie wieder habe ich so wolkenbruchartig weinen sehen. Je heftiger aber ihre Thränen flossen, desto begeisterter klang mein Pathos, desto würdiger schien mir die Aufgabe, diese schöne Seele heranzubilden durch unsere großen Dichter und meine große Liebe.“
„Onkel, Du spottest!“ unterbrach ich ihn.
„Jetzt liegt mir der Spott allerdings nahe bei dieser Erinnerung, doch damals war es mir fürchterlich ernst. Ich wollte die bleiche Emilie wirklich und in aller Form heirathen! Da machte mein Vater kurzen Prozeß und steckte mich in die Armee.“
„Ein drakonisches Mittel,“ meinte Lothar.
„Sehr klug,“ betheuerte Edwin, „die Kaserne ist eine vorzügliche Kuranstalt für Sentimentalität. Ich wette, ‚Fall drei‘ ist pikant.“
„Pikant? Vielleicht für andere,“ entgegnete lachend der Onkel, „für mich ist er nur albern; eine schauderhafte Blamage.“
„Erzähle! Erzähle!“
„Stellt Euch einen langen scheuen ungeschlachten Burschen von neunzehn Jahren vor, aus einem verträumten Studentendasein in das flotte Leben eines Kavallerieregiments versetzt, wohlgemerkt: im vormärzlichen Ungarn, von dessen jubelnder berauschender Gastfreundschaft man sich heute keinen Begriff mehr machen kann. Auf mich wirkte es anfangs verblüffend; ich ließ mich gleich einer Marionette von den Kameraden hin und her schieben, zu den dienstlichen Vorstellungen wie zu den Besuchen in der Nachbarschaft. Bald genug jedoch regte sich das Soldatenblut in meinen Adern. Der ritterliche Geist, die schöne Kameradschaft, die Eleganz des Lebens verfehlten nicht, mit mächtigem Zauber auf mein leicht erregbares Gemüth zu wirken. Ich schloß mich warm an die neuen Freunde an, ihre Gesinnungen und Ansichten wurden die meinigen und mein ganzes Bemühen ging dahin, es ihnen auch in der äußeren Form gleichzuthun.
Es gab viele Edelsitze in der Nachbarschaft, wo die Gastfreundschaft fast noch überholt wurde von der Leichtlebigkeit; es gab hübsche Mädchen und allerlei Liebeshändel, deren durchsichtige Schleier von den unzarten Händen der Kameraden mehr oder minder gelüftet wurden, wenn wir an langen Abenden in der Garnison beisammen saßen. Ich horchte mit steigender Aufregung; so sehr ich mich auch bemühte, meine Neigung für die blonde Näherin vor den Freunden aufzubauschen, so erkannte ich doch mit Beschämung, daß ich eigentlich nichts Rechtes erlebt hatte. Diesem Mangel mußte schleunigst abgeholfen werden; ich sah mich in allem Ernste nach dem würdigen Gegenstand um, dem auch ich eine so stürmische Liebeserklärung hätte machen können wie etwa die, von denen der Rittmeister erzählte.
Da traf es sich glücklich, daß die Frau unseres Majors durch ein Avancement ihren glühendsten Verehrer einbüßte. Sie galt als eine Schönheit ersten Ranges – allerdings schon seit einer Reihe von Jahren! Für mich war sie die verkörperte Juno und sie imponierte mir gewaltig. ‚Versuche Dein Glück,‘ rieth einer der Freunde, ‚bist ja ein gefährlicher Schwerenöther!‘
[315] So versuchte ich denn mein Glück, und siehe da, die schöne Frau ermunterte huldvoll die schüchternen Versuche, meiner glühenden Verehrung Ausdruck zu geben.
‚Besuchen Sie mich öfter,‘ hatte sie gnädig gesprochen, in Erwiderung stummer, vermuthlich allzu beredter Blicke. So ritt ich denn hinüber nach der Stabsgarnison so oft ich nur konnte. ‚Nun?‘ fragten spöttisch die Kameraden, wenn ich erschöpft von dem weiten Ritte heimkam. Aber ich konnte immer nur durch die Beschreibung des Soupers ihren Neid erregen. Kein neues Zeichen ihrer Huld, keine Gelegenheit zu meiner kühnen, wohl vorbereiten Liebeserklärung!
Eines Tages – ich wußte den Major auf einer Dienstreise – ritt ich trotz eines schneidenden Herbstwindes wieder hinüber, in scharfem Trabe. Im Geiste sah ich mich schon auf den Knien vor der göttlichen Irene, sah ihren schmachtenden Blick, ihr huldvolles Lächeln – mir schwindelte! Wer beschreibt aber die Enttäuschung, die mich an der Thür der Angebeteten empfing – die gnädige Frau sei leidend, hieß es. Schon war ich wieder im Sattel und wollte in stummer Verzweiflung meinem Pferde die Sporen geben, da, zur guten Stunde, erschien das Kammerkätzchen.
‚O, den Herrn Lieutenant würde die gnädige Frau schon empfangen; die Migräne hat nachgelassen. Wenn der Herr Lieutenant eine Tasse Thee im Boudoir ...‘
In sehr gehobener, aber keineswegs behaglicher Stimmung folgte ich der niedlichen Führerin in das magische Halbdunkel des Heiligthums, wo die Majorin hingegossen lag, von dem knisternden Kaminfeuer à la Rembrandt beleuchtet. Die halbgeschlossenen Lider, der leidende Ausdruck des klassischen Gesichts, das wie gemeißelt auf dem dunklen Sammetkissen des Diwans ruhte, das alles erhöhte den bezaubernden Eindruck. Und als jetzt die schmale weiße Hand sich müde emporhob, um mich heranzuwinken, da war ich so befangen, so erregt, daß ich kein Wort hervorbrachte.
Ich begann denn sogleich mit der Einleitung zu meiner wohleinstudierten Erklärung – ich ließ mich auf ein Knie nieder, die schöne Hand zu küssen.“
„Sehr effektvoll,“ lobte Edwin. „Nun kommt das huldvolle Lächeln, der schmachtende Blick ...“
„So wäre es ohne Zweifel gekommen, wenn mein Schleppsäbel es nicht für gut befunden hätte, sich im entscheidenden Augenblick zwischen meine langen Beine zu stecken. Das verursachte einen Heidenlärm und überdies eine schwankende Bewegung meines Oberkörpers, die eine irrige Auffaffung meiner Kniebeugung veranlaßte – als sei sie nicht ganz freiwillig gewesen. Es traf mich ein strafender Blitz aus den Augen der göttlichen Irene, dem ein spöttisches Lächeln folgte. Nun stand ich, ein Bild des Jammers, erröthend da während der feierlichen Schwertentgürtung, bei welcher mir die Zofe, die eben wieder eintrat, mit einem nichtswürdig verständnißinnigen Gesicht Hilfe leistete. Dann schob die Kleine einen Lehnsessel an das Ruhebett der Herrin, was mir vollends alle Fassung raubte – war es denn auch schicklich, dieses nahe Zusammensein? Und dann lispelte die Majorin Fragen, die ich durchaus nicht verstehen konnte, ich – nach einigem Räuspern – machte schüchterne Versuche, allerlei Geschichten, die ich unserem Witzbold abgelauscht hatte, amüsant vorzutragen – umsonst! Ich hatte überall die Pointe vergessen!
Meine Befangenheit steigerte sich bedenklich; ich fühlte die Schweißtropfen auf der Stirn. Da – gottlob, ein Gepolter an der Thür! Ein reichgedecktes Tischchen wird an das Lager der Herrin geschoben. Das Kammermädchen reicht den Thee; die Bewegung um uns giebt mir die Haltung wieder.
Beim Anblick des kalten Hahnes und sonstiger Leckerbissen werde ich mir auch meines Hungers bewußt ich lasse es mir angelegen sein, den ermunternden Aufforderungen der schmucken Zofe zu genügen, und da meine schöne Wirthin die Augen geschlossen hält, sind mir für eine Weile die Qualen der Unterhaltung erspart. So schlürfe ich denn meinen Thee mit steigendem Wohlbehagen, er duftet köstlich. Dazu die angenehme Wärme, der bequeme Lehnsessel, die heimliche Stille, die dämmerige Beleuchtung – das Gefühl des Behagens wird immer mächtiger – weltvergessener – lautloser – –
Da, plötzlich, ein sonderbarer schnarrender Laut! Ums Himmelswillen, wo war ich denn? – Hatte mein Kopf nicht da auf dem Tische gelegen? War nicht ich der Urheber dieses sägenden Geräusches? Entsetzt schnellte ich in die Höhe. Ja, bei allen Heiligen, ich hatte geschlafen! Wie lange, das wußten die Götter und vielleicht die Frau Majorin, die mit höhnischem Lächeln bemerkte: ‚Süß geträumt, Herr Lieutenant?‘ Wie von den Furien getrieben, stürzte ich aus dem Zimmer, die Treppe hinab, nach dem Stalle – ‚und Roß und Reiter sah man niemals wieder!‘“
Unter zunehmender Heiterkeit der Znhörer hatte Onkel Christian seine Erzählung beendet und stimmte nun mit ein in das schallende Gelächter der Herren. Nur Egon blieb ernst. „Das ist doch nicht Liebe,“ meinte er kopfschüttelnd, und ich konnte nicht umhin, ihm beizustimmen.
„Bisher ist es Scherz,“ erklärte Schwester Jette, die sich etwas einbildete auf ihre Menschenkenntniß. „Doch paßt auf, nun kommt eine echte rechte Liebe! Ich habe beobachtet, daß Männer zwischen zwanzig und dreißig am tiefsten empfinden. Nicht wahr, Onkel, dem leichten Geplänkel des Jünglings folgte der ernste Kampf des Mannes?“
„Was nun folgte, war allerdings ein ernster Kampf, darin magst Du recht haben, Jette, ja es war eine wahnsinnige Neigung, und dennoch würde sie wohl vor Egons Richterstuhl nicht als echte rechte Liebe bestehen.“
„Ja, so ein kolossaler Aufwand von Empfinden ist nicht immer auch echte Liebe,“ bemerkte August.
„Das war’s, Du hast die richtige Bezeichnung gefunden, August – ein kolossaler Aufwand von Empfinden, an ein Wahngebilde meiner Phantasie vergeudet! – Es ist eine peinliche Erinnerung, ich wollte lieber davon schweigen.“
„Vielleicht nicht für Damenohren ‚Fall vier‘?“ nahm Edwin das Wort. „Ich beantrage Räumung der Galerie! Leonore, Hilda, Egon mögen ausgewiesen werden.“
Mit einem Schrei der Entrüstung wandte sich die Schwester gegen den „empörenden Antrag“.
Onkel Christian lachte herzlich. „Beruhige Dich, Hilda,“ sagte er. „‚Fall vier‘ ist entschieden weniger interessant als das Vorangegangene.“
„Aha, Du möchtest Dich um die Sache herumreden, Onkel! Aber jetzt kenne ich erst recht keine Gnade – heraus mit der Sprache!“ rief Hilda nachdrücklich.
„Onkel, wenn Du doch beginnen wolltest und Dich nicht unterbrechen ließest ...“
„Wie? Auch Du, Leonore? Auch Du willst die unsinnige Geschichte hören? Nun gut, Euer Wunsch sei mir Befehl. So hört denn! Zu Beginn des Jahres 1848 lag mein Regiment in einem der größeren ungarischen Städtchen, das von deutscher Kultur wohlthuend berührt war. Unter anderen Vorzügen besaß es auch ein ganz nettes deutsches Schauspielhaus ...“
„Ha!“ rief Lothar luftig, „ich wittere Coulissenluft.“
„O weh!“ seufzte August verständnißinnig, „eine Sirene von der Bühne! Armer Onkel!“
„Und eine der gefährlichsten ihrer Gattung,“ bestätigte dieser, „denn sie wußte sich mit einem Heiligenschein von Sittenstrenge zu umgeben, überdies mit geheimnißvollen Gerüchten über stolze Herkunft ...“
„Man kennt das – Leim, an dem die fetteste Beute hängen bleiben soll,“ brummte August.
„Beim Zeus, Du hast recht,“ gab Onkel Christian lachend zu, „darauf war es abgesehen; ein reicher Gatte sollte sich in dem Garne fangen. Damit hatte das aber in jener Zeit für eine Bühnenheldin größere Schwierigkeit als heutzutage. So suchte denn Julia – diesen Namen wollen wir ihr geben – das Unwahrscheinliche durch einen ungeheuren Aufwand von Tugendreklame wirklich zu machen. Sie führte einen förmlichen Hofstaat von Anstandsdamen mit sich; ‚das Corps der Rache‘ nannten wir diese Garde von alten Jungfern, die stumm und starr und steif sich auf feindselige Blicke beschränkten, wenn man wagte, ihrer Schutzbefohlenen zu nahen. Diesen Wächterinnen des Paradieses spielten wir Possen, wo wir nur konnten; dennoch imponierte uns die Sache und erhöhte durch den Reiz der Unnahbarkeit den Zauber von Julias Erscheinung.“
„War sie sehr schön?“ fragte ich neugierig.
„Ja, das war sie, eine äußerst schlanke Gestalt, fast etwas zu groß für die Bühne, aber in vollstem Ebenmaß gebaut; [316] das Antlitz von klassisch strenger Schönheit der Linien, eine Fülle dunkelblonder Flechten, welche diademartig das feine Köpfchen umrahmten. Sehr merkwürdig waren ihre Augen, hellbraun, genau in der Farbe der Haare, von langen schwarzen Wimpern beschattet. Julia zwinkerte mit den Lidern, wie Kurzsichtige zu thun pflegen, und hatte die Gewohnheit, von unten herauf durch den Schleier der dunklen Wimpern zu schauen, was dem Blicke etwas ungemein Berückendes verlieh. Wahrhaft vornehm war ihr Gang, ein stolzes Schweben, und die edle Ruhe ihrer Bewegungen, ihre anmuthige Würde – ja, sie war sehr schön – und ich war sehr jung.“
„Mildernde Umstände, die wir gelten lassen wollen,“ sagte Philipp. „Wenn sie dazu noch schauspielerische Begabung besaß, so will ich sogar unbedingt auf Freisprechung antragen.“
„Schauspielerische Begabung? Nein, die besaß Julia nicht. Auf der Bühne entzückte sie das Auge, allein ihr Spiel ließ kalt. Es fehlte ihr nicht an einer gewissen Routine, aber vollständig an Wärme der Empfindung und selbstloser Hingabe an ihre Rolle.“
„Eine Komödiantin, keine Künstlerin,“ schaltete Edwin ein.
„So war es. Doch davon überzeugte ich mich erst viel später. Als ich sie kennenlernte, galt mir Julia für eine Künstlerin von Gottes Gnaden; und nicht mir allein – das Publikum in meiner Garnison vergötterte sie. Der Direktor hatte nie so volle Häuser gesehen wie zur Zeit ihres Gastspiels, das sich denn auch, zur allgemeinen Befriedigung, ins unendliche ausdehnte.
Julia hatte Empfehlungsbriefe an mehrere der angesehensten Familien mitgebracht. Da sie gefällige Umgangsformen, Bescheidenheit und Zurückhaltung im Auftreten besaß, so konnte es nicht fehlen, daß sie bald in vielen Häusern als gern gesehener Gast verkehrte. Meine Kameraden wetteiferten mit den jungen Herren des Komitats, ihr Huldigungen darzubringen; Julia nahm diese freundlich hin, doch mit der ihr eigenen, kühlen Vornehmheit, welche die Uebermüthigsten in Schranken hielt.
In Gesellschaft erschien sie nur an der Seite einer stattlichen Matrone, die sich Madame Helonin nannte. und von Julia mit einer gewissen Absichtlichkeit als ihre ‚Pathin‘ bezeichnet wurde. Auch Madame gefiel allgemein, schon durch ihr schönes Französisch, in zweiter Linie durch ihre ehrwürdigen Locken. Die Frau galt als Respektsperson, und mit geheimnißvollen Andeutungen wußte sie den Glauben an Julias ideal angelegte Natur wesentlich zu bestärken, ein Glaube, der in meinem Herzen rasch zum unantastbaren Dogma wurde.
Als mein Regiment im Mai jenes ereignißreichen Jahres die Bestimmung erhielt, nach Italien zu marschieren, war ich besinnungslos verliebt in die schöne Julia, die mich aber zu meinem namenlosen Leide kaum beachtete. Ich betete sie an wie eine Heilige. wie ein höheres Wesen!
Im ganzen Regiment herrschte Jubel über die Aussicht, unter Vater Radetzky das Schlachtfeld zu betreten; dennoch schieden wir ungern aus der Gegend, wo wir frohe Gastfreundschaft genossen hatten. Man sah auch uns ungern scheiden, und so wurde dem gegenseitigen Abschiedsschmerz in zahllosen Festen Ausdruck gegeben, von denen mich jedes mit Julia zusammenführte und jedes von neuem in dem Schmerze zurückließ, von ihr übersehen worden zu sein. An einem der letzten Tage vor unserem Ausmarsch vereinigte ein besonders großartiges Abschiedsfest das ganze Offizierscorps und alle Honoratioren des Komitats. Erlaßt mir die Beschreibung von Illumination und Feuerwerk, von dem Ständchen, dessen ich mich nur verworren entsinne. Genau weiß ich, daß wir tanzten bis zum grauenden Morgen, und schließlich versammelte man sich noch zu einem improvisierten Frühstück.“
„Natürlich, die Krautsuppe,“ warf Edwin dazwischen, „das ungarische Mittel gegen Katzenjammer!“
„Ueber das Menu jenes Frühstücks weiß ich wahrlich nicht mehr Bescheid, ich hatte nur Augen für Julia, die mir gegenüber saß und deren stolze Schönheit auch gegen das fahle Licht der Morgendämmerung gefeit schien. Sie war ungemein lebhaft, die Augen schillerten in grünlichem Lichte. Auch die Stimme klang nicht weich und gedämpft wie gewöhnlich; mit scharfer Betonung kamen die Worte über die zusammengepreßten Lippen. Nicht einmal in ihren bewegtesten Rollen hatte ich Julia so leidenschaftlich erregt gesehen. Eine Ahnung sagte mir, man habe ihr wehgethan, und ich litt unsäglich bei dem Gedanken, sie nicht schützen, nicht trösten zu dürfen. In blöder Einfalt ahnte ich nicht, was die Verstimmung veranlaßt hatte.“
„Euer Ausmarsch mochte ihr leid thun,“ meinte Hilda.
„Vielleicht,“ entgegnete der Onkel mit halbem Lächeln. „Möglicherweise war die Verstimmung auch durch die Verlobung eines reichen Magnaten hervorgerufen, der seine Bewunderung für die schone Jülia ziemlich auffällig zur Schau getragen hatte; um so überraschender war es, als er zu jenem Feste an der Seite einer glückstrahlenden Braut erschien, der lieblichen Tochter eines Aristokraten.
Selbstverständlich bildete das große Ereigniß den Gesprächsstoff in allen Gruppen, auch an dem Tische, wo Julia mit einer ihrer Freundinnen inmitten einer fröhlichen Schar getreuer Verehrer thronte. ‚Ich würde den Grafen nur unter einer Bedingung genommen haben,‘ sagte jene Freundin, eine vorlaute, mir unangenehme Dame, ‚– er hätte mir seinen Vollbart opfern müssen. Sieht er doch aus, als trüge er die Perücke am Kinn.‘ Die Bemerkung war treffend, alle lachten, nur Julia entgegnete bitter: ‚Wie jung, wie naiv Du doch bist, wenn Du meinst, ein Mann sei zu solchem Opfer bereit! Keiner liebt stark genug, daß er auch nur ein Haar opferte.‘
Stürmischer Widerspruch folgte diesen Worten; ein jeder beeilte sich, überzeugende Beweise seiner oder auch fremder Opferwilligkeit zu erzählen. Ich konnte nichts sagen; der herbe Ton in Julias Rede schnürte mir das Herz zusammen. Was mußte sie leiden, um so bitter zu urtheilen! Da blitzte ein Gedanke durch mein überspanntes Gehirn! Es sollte ihr eine Genugthuung werden – um jeden Preis. Ich schlich davon – und so rasch, als dies ein verschlafener Haarkünstler zu besorgen vermochte, ward die Idee zur That – der Stolz meiner zwanzig Jahre, mein Schnurrbart war gefallen.“
„Ausgezeichnet! Glänzend! Famos!“ riefen Brüder und Schwäger im Chor.
„Als ich klopfenden Herzens den Saal wieder betrat, stand Julia im Begriff, ihn zu verlassen; lachend und scherzend umringte sie die Schar der Getreuen. Ich drängte vor – das Knie beugend, überreichte ich ihr die nicht ganz gewöhnliche Siegestrophäe auf der Säbeltasche. Der Erfolg war ungeheuer. Man schrie, man johlte und tobte. Julia jedoch blickte stumm und sichtlich überrascht auf mich nieder. ‚Der ist wohl ein edler Ritter,‘ sagte sie mit bewegter Stimme. Mir tief in die Augen sehend, neigte sie sich erröthend langsam herab – und flüchtig berührte ihr Mund meine Stirn. Alsbald faßten mich die Kameraden, hoben mich auf ihre Schultern, und ich entkam ihnen erst, als Julia längst entschwunden war.
Am nächsten Morgen – der Rausch der Begeisterung lag mir noch in allen Gliedern – erhielt ich Botschaft von ihr, die Bitte, sie vor dem Abmarsch zu besuchen. Ob meine Füße wohl den Boden berührten, als ich damals zu ihr flog? Nie wieder im Leben war ich so selig und so befangen wie in jenem Augenblick, da ich vor ihr stand, und doch war es zum Scheiden. Ihre rosigen Finger befestigten ein Amulett an meinem Halse – ‚Es möge Sie beschützen,‘ flüsterte sie, ‚wie meine Gebete Sie begleiten!‘ Dann bat sie mich, ihr manchmal Nachricht zu geben. ‚Ich bin nicht gewillt, meinen ritterlichen jungen Freund sogleich aus den Augen zu verlieren, da ich ihn kaum gewonnen habe,‘ sagte sie mit schmerzlichem Lächeln – und ich war entlassen.“
„Wie, so ohne weiteres? Ohne Abschiedskuß?“ fragte Lothar, einigermaßen enttäuscht.
„Ich hatte kaum gewagt, ihre Fingerspitzen zu berühren, so hoheitsvoll stand sie vor mir – eine Königin, eine Gottheit in meinen Augen! Ueberdies, die ganze ‚Garde‘ war zu diesem Empfang mobil gemacht worden; ein halbes Dutzend, saßen sie da wie Spinnen! Im Kreuzfeuer dieser lauernden Blicke brachte ich keinen Laut aus der Kehle. Ohne Worte nahm ich Abschied; aber dann schrieb ich um so mehr auf dem Marsche, im Biwak, vor dem Feiude – überall fand ich Muße und ein Stückchen Papier, mein übervolles Herz, meine ganze Seele auszuschütten.
Nach Jahren habe ich diese Briefe wiedergelesen; da konnte ich mich nicht genug wundern, wie ich es vermocht hatte, einer Frau, mit welcher ich kaum einige Worte gewechselt, einer Unbekannten, ich möchte sagen einem Gebilde meiner Phantasie, so ohne weiteres mein geheimstes Denken zu enthüllen ..."
[317]
[318] „Schade um die schone Begeisterung!“ brummte August.
„Schade, wahrhaftig!“ stimmte Onkel Christian bei, „schade auch um all die Aufzeichnungen, die philosophischen Betrachtungen, die ich – wie oft beim flackernden Scheine des Lagerfeuers! – für jene Unwürdige niederschrieb, für jene falschen Augen, die nichts darin zu lesen wußten als Fingerzeige, um sich meiner vollends zu bemächtigen ...“
„Aber sie – Julia – sie schrieb doch auch?“ rief Hilda gespannt.
„Gewiß, sie schrieb auch – flüchtige Antworten, meist in wenigen Zeilen, dennoch wahre Kabinettstücke von Schlauheit und Koketterie, die nichts sagten und doch genug errathen ließen, um meine Neigung stets neu anzufachen und mich zu rückhaltslosem Aussprechen zu ermutigen.“
„Nun bin ich aber doch neugierig auf die dramatische Schürzung oder Lösung des Knotens!“ sagte Edwin. „Ihr habt Euch hoffentlich wiedergesehen?"
„Ja, nach qualvoll langer Zeit, nach einem Jahre haben wir uns wiedergesehen, in Venedig, und zufällig, wie ich glaube.
Mein Regiment verließ damals Italien mit der Bestimmung, nach einer deutschen Garnison überzusiedeln. Julia, noch immer ohne festes Engagement, schlug selbst vor, wir sollten uns während des Marsches irgendwo in Kärnten oder Steiermark begegnen. Freudig stimmte ich bei, ohne zunächst eine nähere Nachricht zu erhalten. Eines Tages schloß ich mich einigen Kameraden an, die, eine kurze Rast in Udine benutzend, nach der Lagunenstadt hinüberfuhren. Im dortigen Theater spielte eine gute Truppe; die Gefährten wollten die Aufführung besuchen, während ich es vorzog, den Mondschein zu genießen. Träge blieb ich in der Gondel liegen, die uns zur Piazetta gebracht hatte. Es war eine jener bezaubernden Nächte, wie man sie in Venedig erlebt – ringsum alles still, nur ab und zu der leise Ruderschlag eines vorbeigleitenden Schiffchens.
Plötzlich ward es laut oben auf der Piazetta; ich erkannte die Stimmen der Freunde – sie riefen meinen Namen, doch ich rührte mich nicht.
Da schlug ein Laut, ein leises Lachen an mein Ohr und rüttelte mich auf. Mit einem Satze stand ich an der Treppe, auf deren oberstem Absatz jetzt eine Frauengestalt sichtbar wurde. Julia war’s! Sie schwebte die Stufen herab, bis ihre Hand meine Schulter berührte. ‚Mein edler Ritter!‘ hauchte ihr Mund, und wieder wie damals neigte sie sich langsam vor, mir tief ins Auge sehend. Ich hatte ihre Hand erfaßt, und im Taumel des Augenblicks würde ich sie wohl mit beiden Armen umfangen haben, wären die anderen nicht hinzugetreten, Madame Helonin und die Freunde. Diese hatten die beiden Frauen in einer Loge des Theaters entdeckt, und nach lebhafter Erkennungsscene waren sie gemeinsam ausgezogen, mich zu suchen. Nun blieben wir in der herrlichen Mondnacht auf dem Markusplatz beisammen bis lange nach Mitternacht, aber zu einem ungestörten Gespräch mit Julia ergab sich keine Gelegenheit. Und schon am nächsten Morgen mußte geschieden sein! Doch es war ein fröhliches Scheiden, denn ich hatte berechtigte Hoffnung, daß wir uns in Bälde in Wien treffen würden. Julia hatte bereits ihren Vertrag mit einer Bühne dort unterzeichnet, und ich war dem Inhaber unseres Regiments als Adjutant vorgeschlagen, dem alten Fürsten J., der nur in der Residenz zu existieren vermochte.
Dieses unerwartete Wiedersehen in Venedig hinterließ bei mir sehr getheilte Empfindungen. Es hatte mir zum Bewußtsein gebracht, wie fremd wir einander doch innerlich waren, Julia und ich, wie auch der rege Briefwechsel die Kluft keineswegs überbrückt hatte. Das betrübte mich. Andererseits fühlte ich mit Befriedigung, daß wir in einer Beziehung die Rollen getauscht hatten: ich hatte an Sicherheit des Auftretens gewonnen – wie ich meinte, auch an Besonnenheit und Erfahrung – während sie jetzt befangen mir gegenüberstand, zaghaft und scheu, wie ich sie früher nie gesehen hatte.“
„Ein Zeichen von echter Neigung,“ bemerkte Edwin.
„So deutete auch ich es; allein dem Jubel, der mich darob erfüllte, gesellte sich eine unbestimmte Bangigkeit vor der Zukunft. Was sollte werden? Seit der erneuten Begegnung schien Julia mir erst recht unfaßbar – wie ein Phantom.
Ich holte ihre Briefe hervor, die ich all die Jahre gehütet hatte wie mein bestes Kleinod; indessen als ich nun ihr Herz daraus ergründen wollte, wurde ich mit peinlichem Erstaunen gewahr, daß sie fast nur abgebrauchte Redensarten enthielten. Da war von ‚Verwandtschaft der Seelen‘ die Rede, von einer ‚Fügung des Himmels‘, die unser Schicksal ‚für ewig zusammengekettet‘, und dergleichen mehr. Aber nichts, nicht ein Wort, das mich auf ihr Gemüthsleben, ihre Lebensanschauungen, auf ihr eigentlichstes Wesen hätte schließen lassen! Ach, erlaßt mir den Rest – es ist eine peinliche Erinnerung!“
Ein Murren ging durch die kleine Versammlung. „Wir haben zuviel gehört, um auf den Rest verzichten zu können,“ nahm Jette das Wort. „Wir wollen wissen, wie Du entkamst ...“
„Ich entkam eben nicht ...“
„Wie, Onkel Christian, Du entkamst nicht?“
„Eigentlich nein, Leonore! Die Schlinge zog sich unaufhaltsam zu – nur äußere Umstände halfen dann, sie zu lösen.“
„Wie kam das? O bitte, erzähle!“
„So hört denn! Nachdem ich glücklich als Adjutant in Wien eingetroffen war und so die Möglichkeit hatte, Julia häufig zu sehen, rechnete ich auf einen ehrlichen unbehinderten Gedankenaustausch; denn gotttob, die ‚Garde‘ war entlassen, und Madame nahm es mit der Pflicht des Hütens auch leichter als vor Jahren. Allein nun begann erst meine Qual.
Ich liebte Julia, glaubte auch an ihre Neigung, und doch mußte ich schmerzlich jedes Vertrauen ihrerseits vermissen, jedes aufrichtige verständige Eingehen auf meine Eigenart, was mir unumgänglich nöthig schien, um unsere Beziehungen wirklich innig zu gestalten.
Bald wußte ich, daß sie keineswegs dem Ideal entsprach, das ich von meiner Lebensgefährtin im Herzen trug. Ihre Unaufrichtigkeit verletzte mich aufs empfindlichste, auch andere Charakterzüge mißfielen mir und beunruhigten mich. Noch maß ich alle Schuld dem bösen Einfluß von Madame Helonin zu, deren gemeine Natur sich allmählich mit Behagen enthüllte. Sie ließ es Julia entgelten, daß deren Talent in Wien keine Anerkennung fand; ihre Verstimmung und Streitsucht schufen eine schwüle Luft in dem öden Heim der beiden Frauen. Zudem nahm Julias Reizbarkeit zu mit ihren Mißerfolgen. Trotzdem sah ich mit offenen Augen zu, wie die Maschen des Netzes der intriguanten Frau sich enger und enger um mein Haupt zusammenzogen. Es fehlte mir an Muth, an entschlossener Ueberzeugung, um der Gefahr rechtzeitig zu entfliehen. – Du zuckst verächtlich die Achsel, Edwin? Was willst Du Freund! Ich liebte und wähnte mich wieder geliebt!
Eines Tages kam ich unerwartet in die Wohnung Julias und wurde Zeuge eines widerlichen Streites zwischen den beiden Frauen. Bevor sie auf meinen Zuruf acht gaben, hatte ich Vorwürfe, Schmähungen und Ausdrücke vernommen, wie sie einer feinfühligen Natur völlig unwürdig waren. Madame Helonin tobte, und als sie mich erblickte, kehrte sich ihre Wuth alsbald gegen mich.
‚Sie sind schuld, Sie allein, an der Undankbarkeit dieser Kröte!‘ schrie sie. ‚Sie will jetzt ihre eigenen Wege gehen, sie wird schon sehen, wo das endet und wie ihr edler Ritter sie in der Patsche stecken läßt. Was wollen Sie eigentlich von ihr? Sie haben ihr Herz geraubt, ihr Talent ist gelähmt durch diese blöde Liebe – nun, und was soll’s?‘ Ich stand starr vor diesem wilden Ausbruch häßlicher Wuth, da warf sich Julia an meine Brust. ‚Retten Sie mich - errette mich von diesem Dämon!‘ flehte sie. Das entschied.
Noch am selben Abend reiste ich nach Prag, um die Einwilligung meiner Eltern zu erflehen.“
„Herrje! Soweit ist es gekommen?“
„Nein, gottlob – es kam doch nicht soweit; dieser Schlag sollte meinem armen Vater erspart bleiben, um einen schweren Preis allerdings – seine Erkrankung band mir die Zunge. Dennoch sage ich ‚gottlob!‘ Denn in jenen bangen Tagen, welche ich mit meiner Mutter in schwerem Kummer an seinem Krankenlager verbrachte, erfuhr ich erst recht, wie sehr das Herz des strengen Mannes an mir hing, welche Hoffnungen er in meine Zukunft setzte; und ich sah wohl ein, daß sein hochmüthiger starrer Sinn nie einwilligen würde, sich diese Tochter zuführen zu lassen. Und war denn Julia dessen auch würdig? Wieder und wieder trat diese Frage in der trostlosen Stille jener Tage vor mein inneres Auge, und ich wagte nicht, sie zu bejahen. Des Vaters Geist blieb umnachtet, selbst als endlich Besserung des körperlichen [319] Befindens eintrat; unverrichteter Sache kehrte ich nach Wien zurück und wurde von Julia nicht eben freundlich empfangen.
Mittlerweile hatte ich meine Volljährigkeit erreicht. Der erste Akt, durch welchen ich meine Selbständigkeit bethätigte, war – eine bedeutende Wechselschuld einzugehen. Ja, wundert Euch nur! Das sieht dem alten pedantischen Onkel nicht ähnlich, nicht wahr? Allein ich wollte um jeden Preis Julia eine unabhängige Stellung schaffen, damit sie sich von der Bühne und der Bevormundung von Madame Helonin losmachen könnte; ich hoffte alles, eine völlige Umgestaltung ihres Wesens von dieser doppelten Befreiung. Das arme gequälte Mädchen hatte mir eingestanden, daß die Erkenntniß ihrer Talentlosigkeit ebenso theil habe an ihrer Verstimmung wie Madame Helonins Tyrannei.
Meine Absicht ging dahin, Julia in eine jährliche Rente einzukaufen und ihr so für alle Fälle ein anständiges Einkommen zu sichern. Merkwürdigerweise stieß ich damit auf Hindernisse bei den Frauen – die nöthigen Schriftstücke waren nicht aufzutreiben. Da es sich zunächst um Julias Taufschein handelte, glaubte ich zuerst an ein Widerstreben ihrer weiblichen Eitelkeit; schließlich besann ich mich auf jene Gerüchte, die seinerzeit über Julias Herkunft umgegangen waren, und wandte mich an Madame Helonin. Die leeren Ausflüchte dieses Weibes und Julias Verwirrung bestärkten meine Ueberzeugung, daß sie mir etwas verheimlichten. Madame zeterte gegen die Leibrente, sie wollte das Kapital in ihre Gewalt bekommen; davon konnte selbstverständlich nicht die Rede sein.
Diese Augelegenheit und der Umstand, daß ich eine öffentliche Verlobung während meines Vaters Krankheit rundweg verweigerte, hatten eine böse Spannung in unsere Beziehungen gebracht. Julia grollte, und ich verhehlte ihr nicht, daß ich erwartet hätte, in meinen Bemühungen um ihre Zukunft besser von ihr unterstützt zu werden.
So stand es um uns, als der Tod meines armen Vaters mich wieder nach Prag berief – diesmal zu langem Aufenthalt. Als einzigem Sohne lag mir die Ordnung der geschäftlichen Angelegenheiten ob, wodurch ich in Prag und auf unserer Besitzung zurückgehalten wurde.
Es war im Frühjahr 1851, als ich nach Hartenberg ging, nun der ‚neue Herr‘. Die Beamten hatten mir einen feierlichen Empfang bereitet und erwarteten meine Ankunft an der Freitreppe im Schloßhof. Es waren meist alte treue Diener meines Vaters, die ich seit früher Jugend kannte; nur ein fremdes Gesicht fiel mir auf, das des neuen Oberförsters. Es fiel mir besonders auf – durch eine Aehnlichkeit mit Julia: helle Augen blickten von unten durch dunkle lange Wimpern. Ich frug nach seinem Namen – Theobald Fischer. Julias Familiennamen hatte allerdings einen polnischen Klang, doch nahm ich mir vor, gelegentlich nach etwaigen Angehörigen des Oberförsters zu forschen.
An einem der nächsten Tage wanderte ich nach dem Forsthaus; die Thür stand offen, ich trat ein, mußte aber bis zur Küche vordringen, um auf ein menschliches Wesen zu stoßen. Dort hantierte am Herdfeuer mit Pfanne und Kochlöffel ein ältliches hageres Frauenzimmer, in welchem ich sofort eine von Julias Anstandsdamen aus dem ‚Corps der Rache‘ erkannte. Sie hieß mich in die Stube treten, der Bruder müsse jeden Augenblick kommen. ‚Sie sind des Försters Schwester?‘ fragte ich. ‚Ich glaube, Sie vor Jahren in C. gesehen zu haben ...‘ ‚Also haben mich Euer Gnaden doch erkannt?‘ rief sie. ‚Ich hab’ mir’s gleich gedacht und hab’ zum Theobald gesagt: gieb acht! hab’ ich gesagt, der gnädige Herr wird kommen nach dem Julerl zu fragen. Ja, aber leider weiß ich nichts von ihr, seit wir in München auseinander gegangen sind. Ich denke, sie wird wohl den amerikanischen Zahnarzt geheirathet haben, mit dem sie damals halb und halb verlobt war ...‘
Mein lautes heiseres Lachen, über welches ich ebenso erschrak wie die weiland Anstandsdame, unterbrach den Redeschwall, doch nur für Sekunden.
‚Der Theobald ist nur mein Stiefbruder, denn ich und die Schwestern sind von der ersten Ehe des Vaters, nur der Theobald und das Julerl sind die Kinder von der Stiefmutter – Euer Gnaden wissen von der Madame Helonin, der zweiten Frau vom Vater ...‘
‚Wie, was?‘ schrie ich, durch diese Nachricht um alle Fassung gebracht. ‚Madame Helonin Iulias Mutter?‘
‚Ja freilich, sie ist die rechte Mutter des Julerl. Sie war Bonne bei der Herrschaft, wo mein Vater Portier war, und wie die Mutter – die erste Mutter – gestorben ist ...‘ so plapperte das Geschöpf noch endlos weiter, aber ich hörte nichts mehr. In meinen Ohren toste es, ich rang nach Athem. Julia die Tochter jenes Weibes! In welches Gewebe von Lügen war ich gerathen! Wie hatte sich mein geheimes Mißtrauen nur allzugut bewahrheitet!
‚Also Julia ist – Ihre Schwester? Und heißt?‘
‚Meine Stiefschwester, sozusagen,‘ erwiderte die Anstandsdame, ‚und heißt Fischer natürlich. Aber der Name war halt nicht schön genug fürs Julerl; es war überhaupt nie was schön genug für sie, und wir haben’s ihr auch vergönnt – die Bildung, die feinen Hände, den schönen Namen – alles! Sie war ja unser Augapfel von klein auf, gar so schön und fein! Aber wir haben gesagt, die Schwestern und ich, wenn wir schon unser Geld hergeben für die höhere theatralische Ausbildung des Julerl, wollen wir auch dabei sein, wenn sie ihr Glück macht; und mitgegangen sind wir auf die Kunstreisen, die Schwestern und ich! Das Glück hat sich aber nicht so leicht einfangen lassen, wie wir geglaubt haben; der ungarische Graf, dem wir nachgereist sind, ist uns ausgekommen und daß es bei Euer Gnaden bald verrauchen wird, bei dem Altersunterschied – das hab’ ich gleich gesagt, trotz der schönen Briefe ...‘
Mit einem gebieterischen ‚Genug!‘ hemmte ich das athemlose Geschwätz. ‚Sind Sie ganz sicher – können Sie beschwören, daß Helonin nicht der richtige Name jener Frau ist?‘
‚Aber gewiß, Euer Gnaden, wir haben ja doch die Unterschrift auf den Quittungen von der Stiefmutter: Adele Fischer, geborene Helonin. Der Theobald kann es Euer Gnaden zeigen. Und wenn Euer Gnaden vom Julerl noch etwas wissen wollen ...‘
Nein, ich wollte nichts mehr wissen, gar nichts!
In das tiefste Waldesdickicht trug ich meinen Schmerz, meinen Zorn über diese Erbärmlichkeit und das Gefühl meiner Erniedrigung. Die elende Komödiantin! Endlich beschloß ich, Julia in einem Briefe über das Lügengewebe, in das sie sich verstrickt hatte, zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre Antwort war – die Rücksendung meiner Briefe und des Verlobungsringes. Ich athmete auf! Bald folgte eine unverschämte Epistel von Madame Helonin: ich müsse längst um das Allerweltsgeheimniß des veränderten Namens gewußt haben, es sei Heuchelei, wenn ich jetzt den Ueberraschten spiele, eine Finte, um mein Wort und mein Geldgeschenk zurückzuziehen; sie habe längst bemerkt, daß mich die Verlobung reue u. s. w. Die schlaue Frau erreichte mit dieser Anklage, was sie zunächst wünschte; noch am selben Tage erhielt mein Bankier die Weisung, die bei ihm hinterlegte Summe als Schenkung an Fräulein Julia Fischer zu übermitteln. Weder Name noch Alter ergaben diesmal Schwierigkeiten bei Erledigung der Formalitäten. Unter anderem erfuhr ich bei dieser Gelegenheit eine bezeichnende Thatsache. Veranlaßt durch irgend einen Formfehler beim Ausstellen des Wechsels, hatte mein Gläubiger die Schuld zur Kenntniß des Obersten gebracht; im Regiment verbreitete sich das Gerücht meines finanziellen Ruins. Einer meiner Freunde, der um meine Beziehungen zu Julia wußte, fand es angezeigt, dieser die schlimme Kunde mitzutheilen. In der ersten Bestürzung verriethen ihm die Frauen ihre Absicht, die Verlobung zu lösen.“
„Und Dich zu erlösen,“ rief Jette.
„Wahrhaft frei fühlte ich mich erst, als ich nach einigen Wochen eine Verlobungsanzeige von Julia erhielt – ein alter Hofrath war schließlich in dem Netze hängen geblieben.“
Onkel Christian schwieg erschöpft und lehnte sich in seinen Armstuhl zurück, ohne den erregten Reden der Brüder und Schwäger Gehör zu schenken. Unterdessen war es völlig finster geworden; ich erhob mich, um für Licht zu sorgen, und während man mit den Lampen ab und zu ging, löste sich die Gruppe, die sich um den Kamin geschart hatte; nur die Schwestern wollten nicht weichen.
„Hast Du damals schon den Dienst quittiert?“ fragte Jette, um den Onkel wieder ins alte Fahrwasser zu bringen.
„Nein,“ entgegnete er. „Damals ließ ich mich nach Böhmen versetzen, um in der Nähe meiner Mutter zu bleiben, deren Gesundheit angegriffen war.“
„Sie wohnte wohl in Hartenberg?“
„In den ersten Jahren nach meines Vaters Tod hielt Elisabeths Erziehung sie noch in Prag zurück, später bewohnte sie ihr Landhaus ...“
[320] „Ich weiß, Elsenheim, wo Papas Hochzeit in aller Stille gefeiert wurde. Nicht wahr, Onkel?“
„Richtig, Leonore! Du erinnerst Dich also noch? In Elsenheim hausten Mutter und Schwestern in großer Abgeschiedenheit; ich ermöglichte es, dort ein häufiger Gast zu sein. Es war ein gar trautes stilles Heim, sehr verschieden von dem großen geräuschvoll gastlichen Hause, das ich aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte.“
„Und dann? Was geschah dann?“ forschte Schwester Hilda.
„Es läßt sich nichts erzählen von den Jahren, die nun folgten, Hilda; ereignißlos löste eines das andere ab. Ich lebte ein stilles Leben. Mit dem Tode meines Vaters war mir ein reiches Maß von Pflichten und Sorgen geworden. Ich hatte abgeschlossen mit der Jugend und ihren Tollheiten und rang nach Klarheit, nach ruhiger Auffassung des Lebens, griff zu ernsten Büchern, versenkte mich namentlich in geschichtliche Studien, und lautlos glitten darüber die Jahre hin. Doch – was erzähle ich Euch da,“ unterbrach sich der Onkel plötzlich. „Verzeiht, ich bin weitschweifig geworden! Meine Entwicklungsgeschichte kann Euch nicht interessieren.“
„Doch, doch!“ rief Philipp, der hinzugetreten war. „Einleitung zu ‚Fall fünf‘!“
„‚Fall fünf‘!“ murmelte der Onkel. „Arme Maria Pia! Es ist Entweihung, die Erinnerung an Dich mit einer Nummer ins Gedächtniß zurückzurufen ...“
„Lauter, Onkel! Wir verstehen Dich nicht!“
„Jetzt ist’s genug, Kinder! Ich habe mich verleiten lassen, Euch einige Geschichten aus meiner Jugend zu erzählen, schon das war zu viel ...“
„Ach nein, nein – wir wollen mehr hören!“
„Es ist genug, und jetzt – basta! Jette braut mir wohl eine Tasse ihres köstlichen Thees – ich höre bedeutungsvolles Geklapper.“
Sie sahen, daß Onkel Christian entschlossen war, ihre Neugierde nicht weiter zu befriedigen; Jette eilte an den Theetisch, die anderen verloren sich allmählich; bald vernahm ich aus der Ferne das Rollen der Billardkugeln. Nur ich, ich saß wie festgebannt am Kamin und unwillkürlich folgte mein Auge den Blicken des Onkels, die wehmüthig ferne Bilder zu schauen schienen.
„Maria Pia!“ sprach ich vor mich hin, „wer war Maria Pia? Willst Du auch mir allein nicht weiter erzählen? Bist Du wirklich zu müde? Ach, bitte, lieber Onkel!“
Onkel Christian sah mich lange prüfend an. Und langsam, mit gedämpfter Stimme nahm er den Faden wieder auf.
„Maria Pia war eine Schulfreundin meiner Schwestern, die Tochter eines höheren Beamten, der sich aus der Welt, die seinem Verständniß entwachsen war, in die Tiroler Berge geflüchtet hatte – nach Meran, wo ich Vater und Tochter kennenlernte. Sie hieß Maria; doch in dem Kloster, in dem sie erzogen wurde und wo es der Marien viele gab, hatte man sie ‚Pia‘ zubenannt, ünd diese Bezeichnung, die so gut zu ihrem Wesen paßte, blieb ihr fürs Leben. Sie war ein blondes schlankes Geschöpf, mit feinen durchgeistigten Zügen. Und sie hatte Deine Augen, Lore, Deine freundlichen klugen veilchenblauen Augen.“
Er schwieg, indem er mich sinnend betrachtete, als wünsche er die Aehnlichkeit neuerdings festzustellen.
„Pia!“ sagte ich, „das heißt doch die ‚Fromme‘? War sie sehr fromm?“
„Ihr ganzes Sein war von ernster Gläubigkeit durchströmt, aber ihr Wesen war deshalb kein enges. Sie begeisterte sich für alles Schöne und zeigte in ihrer schlichten selbstlosen Art allen Menschen ein warmes liebendes Herz.
Daß wir uns gut wurden – ich weiß nicht, wie das kam! Aber es kam so selbstverständlich, als könne es eben nicht anders sein. In den ersten Tagen, als ich meiner Liebe gewiß wurde, wagte ich nicht, an die Möglichkeit von Pias Neigung zu glauben, ich fühlte einen Abgrund zwischen mir und diesem Engel. Sie selbst überbrückte ihn. ‚Da wir uns lieben‘ – sagte sie schlicht und ließ mir die Hand, die ich stammelnd und zögernd ergriffen hatte. Es war unter den großen Kastanien auf dem Wege nach Schönna – noch sehe ich das sonnige lachende Bild zu unseren Füßen. Pia und ich waren hinter den anderen zurückgeblieben –“
„Onkel,“ unterbrach ich ihn, „welche anderen? Und wie kam es, daß Du in Meran warst?“
„Wie zerstreut ich bin – damit hätte ich ja beginnen sollen! Die Aerzte hatten verordnet, daß meine Mutter den Winter in einem milden Klima zubringen solle, und gern willfahrte ich ihrem Wunsche, einen längeren Urlaub in ihrer Gesellschaft in dem gottbegnadeten Meran zu verbringen. Meine Schwestern wußten, daß sie ihre Freundin Pia dort finden würden. Mit Rücksicht darauf war die Wohnung gewählt – ihres Vaters Garten berührte den unseren.
Pia und ich verkehrten alsbald mit der größten Ungezwungenheit, was ihrem schlichten geraden Wesen in allen Fällen am besten entsprach. Sie plauderte gern und gut; doch nahm ein Gespräch mit ihr sofort eine ernstere Färbung an. Sie plauderte eben wie ein kluges Menschenkind, das selbst Antwort finden muß auf die Fragen und Zweifel, die sich ihm aufdrängen, und das froh die Gelegenheit ergreift, in dem Austausch mit Gleichgesinnten die Ansichten, die es in der Einsamkeit gewonnen hat, zu begründen und zu vertiefen. Wir waren nicht immer gleicher Meinung, Pia fand mein Urtheil mitunter zu schroff, zu hart. ‚Sie sehen eben mit dunklen Augen, ich mit blauen,‘ pflegte sie scherzend zu sagen, ‚im Grunde sehen wir doch beide dasselbe.‘
So, sorglos und frohen Muthes, durchwanderten wir Hand in Hand die herrliche Umgebung Merans. Und Pia, die kundige Führerin, verstand es, die Ruinen und Felsen beredt, Sage und Geschichte zur lebendigen Gegenwart zu machen! Ach – daß dieser sonnige Winter ein Ende nehmen mußte! Im Frühling sollte ich wieder zum Regiment. Vor meiner Abreise feierten wir die Verlobung. Die Unsrigen waren es zufrieden.
Da fiel der erste Tropfen Wermuth in den vollen Becher des Glückes. Der Arzt warnte Pias Vater; er glaubte, eine ernste Lungenkrankheit bei ihr entdeckt zu haben. So übertrieben mir auch seine Befürchtungen schienen, Pia und ich mußten uns den Wünschen des Vaters fügen und die Ausführung unserer Pläne auf Jahresfrist hinausschieben.“
„Aber der Arzt irrte?“
„Er irrte nicht! Wie ich später erfuhr, war Pias Mutter einer Lungenkrankheit erlegen. Der Blick des Arztes hatte nur zu richtig gesehen. Als ich im Herbste wiederkehrte, fand ich Pia so schwach, daß sie den Rollstuhl kaum mehr verlassen konnte. Das Uebel war entsetzlich rasch vorgeschritten. Doch, so hinfällig auch ihr Körper war, ihr Geist war reger denn je, ihre gleichmäßige liebenswürdige Heiterkeit unverändert. Nach wie vor liebte sie es, die Ereignisse des Tages, große wie kleine, zum Gegenstand der Erörterung zu machen, den Widerspruch förmlich herausfordernd, aber gar freundlich und anmuthig; sie führte die Waffen, um alle Welt für ihre Milde, ihr unerschöpfliches Wohlwollen zu gewinnen. So waren denn auch diese letzten Tage und Wochen, an welchen ich ihr Hinwelken von Stunde zu Stunde beobachten konnte, nicht ohne eigenthümliche Schönheit, schön trotz Bangigkeit und Trauer.
Der milde Winter erlaubte es, die Kranke beinahe täglich einige Stunden ins Freie zu bringen. Da saßen wir in dem sonnigen Gärtchen, oder ich rollte Pia in ihrem Krankenwagen an die Punkte in der Nähe, die sie liebte. Immer und immer wieder freute sie sich der schönen Bilder, der Sonne, der zauberischen Beleuchtung, und immer wieder strömte ihr Herz über von Dank für soviel Herrlichkeit, soviel Glück! Sie – so schön, so jung – und sterbend!“
„Sie ahnte wohl nicht …“
„So meinten wir auch. Doch ich glaube, sie war sich der Hoffnungslosigkeit ihres Zustandes längst bewußt. Eines Tages sprach sie es aus. Der Sohn des Gärtners, ein widerhaariger junger Bursche, sollte für irgend ein Vergehen hart bestraft werden – viel zu hart nach Pias Ansicht; mit Mühe gelang es mir, einen milderen Urtheilsspruch für den jungen Menschen zu erbetteln; und da Pia sich so lebhaft für die Sache interessierte, mag ich den Bericht über den Verlauf wohl etwas aufgebauscht haben. Leuchtenden Auges lauschte sie, und bevor ich es hindern konnte, hatte sie meine Hand, die in der ihren lag, an ihre Lippen gezogen. ‚O – Pia!‘ rief ich beschämt und gerührt, ‚ist es nicht Dein Einfluß, daß ich so gehandelt habe, daß ich milde und duldsam geworden bin!‘
‚Wenn es so ist, mein Freund, so laß diesen Einfluß mein Vermächtniß sein,‘ sprach sie leise und schloß die Augen. Doch unter der geschlossenen Wimper perlte eine Thräne hervor. Ich war tief bewegt und keines Wortes mächtig. Nach einer Pause fuhr sie fort: ‚Glaube, Freund, es ist besser so! Wolltest Du doch davon [321] überzeugt sein, mein Geliebter! Denn, siehst Du, eine kränkliche Frau hätte Deinen Lebensmuth gebrochen, und Du hast noch gar lange zu leben. Deshalb – nicht wahr, mein Freund, Du wirst Deine Trauer mäßigen, so lieb Du mich auch hast, und wirst Dich den Herrlichkeiten des Lebens nicht verschließen? Mein Bild und, so hoffe ich, mein Vermächtniß werden dennoch stets mit Dir gehen!‘
Und Pia hat sich mit den letzten Worten nicht getäuscht; die Selbstlosigkeit ihrer Liebe bis zum letzten Athemzug, der Adel ihrer Gesinnung – sie sind mir ein wirkliches Vermächtniß geworden, das mir mehr und mehr zu eigen wurde. Und so ist sie mein geblieben, die allzufrüh Heimgegangene!“
„Armer Onkel!“ rief ich, als ich der Rührung Herr geworden war, „welch’ unersetzlicher Verlust!“
Blätter und Blüthen.
Ein fürstliches Ehejubiläum. (Zu den Bildnissen S. 293.) Am 3. Mai dieses Jahres sind 50 Jahre verflossen, seit der damalige Prinz Ernst von Sachsen-Coburg der ältesten Tochter des badischen Großherzogs Leopold, der jugendschönen Prinzessin Alexandrine, die Hand zum Bunde für das Leben reichte. Wie dem Paare selbst, so gereichte auch dem Laude diese Verbindung zum Segen. Die gütige, allzeit hilfsbereite Fürstin fand schnell den Weg zu den Herzen ihrer Laudeskinder, und ihr schlichtes Wesen errang ihr eine Beliebtheit, die ebenso der Frau wie der Fürstin galt. Getragen von der Liebe ihres Volks haben beide in diesen ersten Maitagen das Fest ihrer Goldenen Hochzeit begangen, und wenn den Lesern der „Gartenlaube“ auch der Herzog Ernst längst kein Fremder mehr ist, so möchte sie doch bei solch menschlich schöner Feier es nicht unterlassen, sein Bild aufs neue wachzurufen und seiner Verdienste zu gedenken, welche er sich nicht bloß um sein Land, sondern um das ganze deutsche Volk erworben hat.
Nachdem der Prinz am 29. Januar 1844 als Ernst II. den Thron bestiegen hatte, zögerte er nicht, in der Verwaltung und Verfassung seiner Länder den fortgeschrittenen Ansprüchen an die Formen des staatlichen Lebens gerecht zu werden. Weit über die Grenzen des Herzogthums hinaus aber greift die Bedeutung, welche der nationalgesinnte Fürst durch seine hochherzige Förderung der deutschen Einheitsbestrebungen gewann.
Schon früh bekannte sich der Herzog zu der Ueberzeugung, daß die Einigung Deutschlands nur unter der Führung Preußens erreicht werden könne, und in Denkschriften und Briefen wies er die leitenden Kreise in Preußen auf die nationale Aufgabe des Hohenzollernstaates hin. Nachdem das Erfurter Parlament, welches die deutsche Verfassungsfrage ihrer Lösung nahe gebracht hatte, durch die bundesstaatlichen Regierungen geschlossen worden war, vertrat Herzog Ernst den Gedanken, durch Berufung eines Fürstenkongresses die Schwierigkeiten der deutschen Einigung zu überwinden, und er verstand es, Friedrich Wilhelm IV. für seinen Plan zu gewinnen. Am 7. Mai 1850 traten denn auch die Bundesfürsten zu den wichtigen Berathungen in Berlin zusammen. Herzog Ernst übernahm den Vorsitz und leitete die Verhandlungen, die mit der Einigung über alle Hauptpunkte und zugleich mit der Einwilligung zur erneuten Berufung des Parlaments endigten. Inzwischen aber war Friedrich Wilhelm IV. wieder anderen Sinnes geworden. In der Rede, mit welcher er den Fürstentag schloß, erwähnte der König weder die Berufung des Parlaments noch die Annahme der Verfassung. Noch am Ende desselben Jahres folgte Preußens Gang nach Olmütz, seine tiefe Demüthigung vor Oesterreich und Rußland. Die preußische Politik hatte damit alles Vertrauen bei den deutschen Fürsten und Völkern verscherzt.
Mit dieser schwächlichen Nachgiebigkeit gegenüber dem Ausland verband die preußische Regierung eine eifrige Unterdrückung aller auf Einigung der Nation und Reichsverfassung abzielenden Bestrebungen. Viele der Gemaßregelten fanden in Coburg-Gotha eine Zuflucht.
Die zerstreuten und vielfach durch reaktionäre Verfolgungen bedrückten nationalen Elemente suchte Herzog Ernst zu wirksamer Thätigkeit zusammenzufassen durch Gründung eines litterarisch-politischen Bundes, dessen Ziele hauptsächlich die Vertretung des Einheitsgedankens in der Presse und die Hebung des Sinns für den Konstitutionalismus waren. Bald konnte der Preßausschuß dieser Vereinigung, von dem polizeilich verfolgten Gustav Freytag und von Max Duncker geleitet, eine Zeitungskorrespondenz herausgeben, welche bei den öffentlichen Blättern schnell großes Ansehen errang. Der Same, der hier gesät worden war, ging auf in dem berühmten „Nationalverein“, der sich ebenfalls der lebhaften Förderung durch Herzog Ernst zu erfreuen hatte und der in der inneren Entwicklung unserer deutschen Geschichte eine so wesentliche Rolle zu spielen berufen war. – In allen diesen Bestrebungen drückte sich das volle Vertrauen aus, welches der Herzog dem erstarkenden deutschen Bürgerthum entgegenbrachte, und zugleich das damals nicht allzu häufige Verständniß, mit dem er die Wünsche des Volkes nach einer Betheiligung am staatlichen Leben als berechtigte und keineswegs fürstenfeindliche erkannte. Er wußte vielmehr, daß gerade dieses vielfach mit Mißtrauen betrachtete Bürgerthum den Boden bilden mußte, auf dem die Einigung erwachsen würde.
In dieser Erkenntniß stand Ernst II. auch den Vereinen der Turner und Sänger freundlich gegenüber, in dieser Erkenntniß ehrte er auch die zu jener Zeit sehr volksthümliche Schützensache dadurch, daß er das Präsidium des 1861 zu Gotha gegründeten Schützenbundes bereitwillig übernahm. Wie sehr man ihm dafür Dank wußte, das zeigte sich, als er im Jahre 1862 das Frankfurter Schützenfest besuchte, da wurde er von 12000 deutschen Männern aus allen Gauen des Vaterlandes mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt.
Wenn auch die Einigung Deutschlands später auf anderem Wege, durch „Blut und Eisen“ erfolgte – ihre Vorbereitung fand sie und ihren geistigen Sieg erfocht sie doch durch jene begeisterten Kreise, die in Herzog Ernst einen zielbewußten Fübrer sahen!
Der Fürst hat es selbst ausgesprochen, daß die Verbreitung des Nationalgedankens unter den weitesten Volkskreisen wesentlich dazu beigetragen habe, nach dem Kriege von 1866 so schnell allen Zwist und Hader zwischen Nord und Süd vergessen zu lassen und – fügen wir hinzu – bei der Aufrichtung des Kaiserthums jene Begeisterung jenseit und diesseit des Mains zu entflammen, die sich in den Tagen der Kaiserproklamation zu Versailles überall kundgab. A. Berger-Coburg.
Eine Markgräflerin. (Mit Abbildung.) Eine Landsmännin des gemüthreichen alemannischen Dichters Johann Peter Hebel sehen wir auf unserem Bilde vor uns, ein Mädchen aus dem gesegneten Landstrich zwischen Basel und dem badischen Städtchen Staufen, wo es neben einem Weine, der „wie Baumöl igoht“ (eingeht), auch noch
„Richi Herre, Geld und Guet,
Jumpfere wie Milch und Bluet“
giebt. Die, welche unser Bild darstellt, ist eine dieser „Jumpfere“ (Jungfern, Mädchen) und zwar „Eini, wo si cha sehe lo“ (eine, die sich sehen lassen kann). Heute hat sie sich aber auch ganz besonders hübsch gemacht, denn es ist Sonntag, und darum hat sie die gewöhnliche Werktagstracht mit einem Rock von feinem Tuch, das bunte, von der Großmutter ererbte „zwänzig Elle lange Mailänder Halstuech“ mit einem Spitzentuch vertauscht und eine „Chappe“ (Kappe, Mütze) mit besonders langen, mit Seidefranzen besetzten Flügeln aufgesetzt. Auch ein nagelneues seidenes „Fürtuech“ (Schürze) hat sie angelegt, denn – man sieht’s ihr recht gut an – sie will gefallen, wenigstens ihm, dem „Friedli“ (Friedrich), der ihr zum Kirchgang das Röslein geschenkt hat, welches sie noch in der Hand hält.
Und was sie beabsichtigt, wird sie wohl mit leichter Mühe erreichen: der Friedli müßte ja „ein Klotz“ sein, wenn ihm das hübsche „Maidli“ nicht gefiele. Wir brauchen uns deshalb wohl keine Sorgen zu machen!
Ein Zug aus dem Leben der Papageien. Wilhelm Junker, der berühmte Afrikaforscher, den uns die Influenza im Alter von 51 Jahren am 13. Februar 1892 entrissen, pflegte auf seinen Reisen im Dunklen Welttheil bei verschiedenen Negerfürsten für längere Zeit Aufenthalt zu nehmen, um Land und Leute besser kennenzulernen. In diesen Quartieren richtete er regelmäßig auch kleine Menagerien ein, um neben Menschenbeobachtungen auch Thierstudien anstellen zu können. Sein großes Reisewerk
[322] enthält darum eine Fülle treulicher Skizzen aus dem Leben der afrikanischen Thierwelt.
Als Junker einmal bei dem Negerfürsten Semio weilte, befand sich in seiner Menagerie ein Pärchen rothgeschwänzter grauer Papageien. Die Anhänglichkeit der Vögel aneinander war wahrhaft rührend, sie gebärdeten sich bei ihren Liebkosungen und Spielen recht wie ein zärtliches Paar. Mit dem gewaltigen Schnabel, der sonst eine gefährliche Waffe ist, suchten sie sich scherzweise zu fassen, wobei sie die größte Behutsamkeit entfalteten, um sich nicht weh zu thun. Dann wieder legte sich das eine auf die Seite oder auf den Rücken und ließ sich vom Gefährten schaukeln und rollen, was es durch Liebkosungen erwiderte. Leider wurde das Paar von einem tragischen Ende ereilt. Man pflegte nämlich die Vögel oft unter den Palmen auf eine Querstange zu setzen, von der sie nach Belieben herabkletterten oder flatterten. Einst, als ihre Flügel eben frisch gestutzt waren, mochte das Männchen wohl unbedacht zu Boden geflattert sein und sich beim Aufschlagen auf die Erde innerlich verletzt haben, denn es entleerte gleich darauf blutige Flüssigkeit aus dem Schnabel. Junker brachte es in seine Wohnung, und dort lag es. nun bald auf der einen, bald auf der andern Seite, immer die Lage des Kopfes wechselnd, aber an die Stelle gebannt, bis es nach etwa einer Stunde mit ausgebreiteten Flügeln verendete. Gleich nachdem Junker das Männchen zu sich genommen hatte, kam auch das Weibchen herbeigetrabt. Es benahm sich nun höchst sonderbar. Es begann alle Bewegungen des kranken Gefährten genau nachzuahmen. Es kauerte sich in einiger Entfernung von dem Sterbenden ebenso nieder, wechselte gleichzeitig mit ihm die Lage, seufzte, legte das Köpfchen nach rechts und links, kurz, es gebärdete sich vollständig, als wäre es auf dieselbe Weise verunglückt.
Das Erstaunen Junkers ging aber bald in Rührung über. Der Paroxismus von Nachahmungstrieb dauerte nämlich fort und blieb nicht ohne Folgen für den Organismus des kleinen Geschöpfes. „Der Schmerz, den es empfand,“ berichtet Junker, „oder irgendwelche andre räthselhafte Einflüsse bewirkten bei ihm so eingreifende Funktionsstörungen, daß es schon in der ersten Trauer um den Verlust des Lebensgefährten ein jähes Ende fand. Ohne der Gefahr zu achten, kam es dem Feuer allmählich so nahe, daß ich es schließlich davon entfernen mußte. Aber es war nun aus mit ihm, es rührte selbst die liebste Nahrung nicht mehr an, und kaum zwanzig Minuten nach dem Verenden des Männchens war auch das Weibchen tot. Was soll man zu solchen keineswegs vereinzelten Fällen sagen? Welchen Namen soll man dem Räthsel geben? Nachahmungstrieb, Instinkt oder Seele, Liebesgram – in der kleinen Brust des kleinen grauen Papageis!?“ *
Ein gutes Hausfilter. Die Fortschritte der Wissenschaft haben uns gelehrt, daß auch im Wasser Gefahren für die Gesundheit schlummern. In einem anscheinend guten, klaren Trinkwasser können Keime ansteckender Krankheiten schweben. Früher dachte man, daß diese Keime durch Filtration
vom Wasser getrennt würden, und hielt filtriertes Wasser für ein besonders gesundes Trinkwasser. Die Bakteriologen fanden aber bald heraus, daß die Filter, wie sie bis vor kurzem im Handel vorkamen, die Bakterien durchließen, daß für die winzigsten Lebewesen ihre Poren noch geräumige Pforten waren.
So bot das Filtrieren des Wassers keine Gewähr für die Fernhaltung derjenigen Epidemien, die, wie beispielsweise der Typhus, durch den Genuß infizierten Wassers verbreitet werden können. Man empfahl darum als bestes Mittel zur Verbesserung des Wassers das Abkochen. Leider stieß die Anwendung dieses Mittels bei den meisten Menschen auf Widerwillen, da abgekochtes Wasser fade schmeckt und in vielen Haushaltungen Vorrichtungen zur Abkühlung desselben während des Sommers fehlen. So blieb der Wunsch nach besseren, „keimfrei“ arbeitenden Filtern rege. Den Forschern und Erfindern war es auch in kurzer Zeit gelungen, namentlich aus gebrannter Porzellanerde Filter herzustellen, welche keine Bakterien durchließen; diese Filter fanden in wissenschaftlichen Laboratorien sehr willkommene Aufnahme, im Haushalte bewährten sie sich jedoch nicht besonders, da sie verhältnißmäßig geringe Mengen Filtrats lieferten und sich sehr bald verstopften.
Erst im vorigen Jahre trat ein Filter an die Oeffentlichkeit, das, wie vielfache Versuche erwiesen haben, allen hygieinischen und praktischen Anforderungen an ein gutes Hausfilter genügt. Dasselbe wurde von Dr. H. Nordtmeyer in Breslau und W. Berkefeld in Celle, Prov. Hannover, aus gebrannter Kieselguhrerde hergestellt. Die letztere, auch unter dem Namen „Infusorienerde“ bekannt, besteht aus Kieselpanzern winziger Pflanzen der Diatomeen, und ist außerordentlich porös. Die Poren der gebrannten Masse sind aber so eng und vielverschlungen, daß sie selbst die kleinsten Bakterien nicht durchlassen. Wasser, welches durch solche Masse durchsickert, ist vollständig keimfrei.
Die Filter werden in Form von hohlen, einseitig geschlossenen Cylindern gefertigt. Die Anwendung derselben erhellt am deutlichsten aus der oben stehenden Abbildung (Fig. 1) die ein Tropffilter für Haushaltungszwecke darstellt. Im Boden des oberen Glasgefäßes befindet sich ein Loch; durch dieses wird das Kopfstück des Filtercylinders durchgesteckt, dann im Innern mittels eines Gummiringes abgedichtet und von außen mit einer Schraubenmutter befestigt. Das obere Glasgefäß wird mit der zu filtrierenden Flüssigkeit gefüllt.
Das Wasser dringt durch die Poren von der Außenwand in das Innere des Cylinders und tropft von diesem durch das im Kopfstück angebrachte Röhrchen ab. Der Inhalt der Kanne beträgt zweieinhalb Liter. Dieses einfachste Filter liefert im Tage reichlich das von einer Familie benöthigte Trinkwasser. Das Reinigen des Filtercylinders wird einfach dadurch erreicht, daß man seine Außenwand unter Wasser mit Leinwand oder Luffaschwamm abreibt.
Das Filter wird auch mit der Wasserleitung in Verbindung gebracht. In einem Metallbehälter wird es, wie dies unsre Abbildung (Fig. 2) zeigt, an die Wasserleitung angeschraubt; das Wasser dringt in die Hülse, filtriert durch den Cylinder, da es aber in der Wasserleitung unter einem höheren Drucke steht, so filtriert es rascher. Ein Apparat mit einem 26 cm langen Cylinder liefert beispielsweise bei zweieinhalb Atmosphären Wasserleitungsdruck zwei Liter Wasser in der Minute. Damit kann man in der Haushaltung durchaus zufrieden sein.
Für Haushaltungszwecke werden auch Filter mit Bürstenvorrichtungen geliefert, die man in einfachster Weise durch das Drehen einer Kurbel reinigen kann, ohne den Apparat auseinandernehmen zu müssen.
Das Kieselguhrfilter läßt keine Bakterien durch; aber diejenigen, die sich in den Poren desselben gefangen haben, könnten an sich unter günstigen Umständen in denselben sich vermehren und schließlich durch die Wand in das Innere des Cylinders hineinwachsen.
Soweit man bis jetzt feststellen konnte, bringen nur die unschädlichen Wasserbakterien dieses Kunststück fertig; die bösen Krankheitserreger aber finden im Wasser keinen günstigen Nährboden, obwohl sie in demselben sehr lange lebensfähig bleiben und die Typhusbacillen unter ihnen sich auch vermehren dürften. Es ist indessen bis jetzt nicht gelungen, krankheiterregende Bakterien dahin zu bringen, daß sie durch ein Kieselguhrfilter drangen. Immerhin muß diese Möglichkeit im Auge behalten werden, und man muß von Zeit zu Zeit die im Filter angesammelten Bakterien töten, das Filter sterilisieren. Zu diesem Zwecke werden die Cylinder in bakteriologischen Laboratorien jeden vierten Tag mit kaltem Wasser angesetzt und dreiviertel Stunden lang gekocht. Im Haushalt werden sicher viel längere Fristen durchaus genügen.
Auf dem Lande, wo es keine Wasserleitung giebt, kann man besondere Filter anwenden, die mit einem Pumpwerk versehen sind und in der Minute etwa drei Liter filtriertes, bakterienfreies Wasser liefern. Man muß diese Kieselguhrfilter, die unter dem Namen Berkefeld-Filter in die Welt eingeführt wurden, als einen wesentlichen Fortschritt in der Lösung der so überaus wichtigen Frage der Wasserversorgung begrüßen. Betonen möchten wir aber, daß die Fabrik die Bürgschaft geben müßte, daß sie nur fehlerfreie Ware auf den Markt bringe. *
Zwischen zwei Feuern. (Zu dem Bilde S. 296 und 297.) Ein heiteres Bild auf tragischem Hintergrund! Der junge Kriegsheld zwischen den stickenden Schönen fühlt sich gewaltig – er gehört ja der großen Armee an, die der erste Napoleon nach Spanien warf, um das Königthum seines
Bruders aufrecht zu erhalten, und hält, wie so viele seiner Waffenbrüder, bei den feindlichen Spaniern die Stille vor dem Sturme für die Ruhe friedlicher Unterwerfung. So hat er denn breitspurig Platz genommen in dem alterthümlich schattigen Hofraum, dem „Patio“, um den zwei hübschen
Haustöchtern die Ehre seiner Unterhaltung zu erweisen, ohne zu bemerken, mit welch eisiger Kälte die Mutter im Lehnstuhl und ihr Freund, der alte Priester, seinen Gruß erwiderten. Das viele Nachdenken ist des jungen Kürassierhauptmanns Sache überhaupt nicht – er hat vielleicht gleich anderen Bauernsöhnen den Marschallsstab im Tornister, aber der „Merks“ in feineren Dingen ist ihm nicht mit den Epauletten angeflogen.
So dauert es denn auch eine geraume Zeit, bis er beginnt, stutzig zu werden über die spitzen Zünglein, welche mit den Nadeln um die Wette sticheln und seiner Soldateneitelkeit fühlbare Wunden beibringen, obwohl sie ganz harmlos bei der Perücke anfingen, die er aufgesetzt hat, um sich ein vornehmeres Aussehen zu geben. Argwöhnisch streicht er den Schnurrbart und schaut auf die blonde Angreiferin, die einstweilen mit bitteren Hohnreden plänkelt, bis – ja, bis in nächtlicher Stunde Vater und Bruder an der Spitze einer stürmischen Schar hier eindringen werden und es beim Fackelschein für die im Hause lagernden Franzosen schrecklich zu tagen beginnt. Sie sehnt diese Nacht herbei, die blonde Mercedes, sie ist Spanierin und fürchtet das Blut nicht. Aber sie haßt mit glühendem Herzen die Feinde ihres Vaterlandes! ...
Es lastet Schicksalsschwüle über dem anscheinend so friedlich stillen Patio. Die Empfindung dafür im Beschauer zu wecken, hat der Künstler vortrefflich verstanden. Bn.
Tagesneuigkeiten. (Zu dem Bilde S. 317.) Ach ja, das Zeitungslesen ist eine schwere Sache! Wäre das Wetter draußen nicht gar so rauh und unfreundlich, Antje und Lentje würden gewiß lieber spazieren gegangen sein, als die stille Base Jochmussen zu besuchen, die außer: „Ei, da seid Ihr ja!“ und „Wie geht es Euch?“ so wenig zu reden weiß. Von einem warmen Thee, auf den die Mädchen im stillen gehofft, ist auch keine Spur zu entdecken, und so ergreift denn Antje, als die thatkräftigere von beiden, den letzten Rettungsanker, das daliegende Zeitungsblatt, und erbietet sich, die Tagesneuigkeiten vorzulesen. Es ist ihr in der Schule immer mit dem Lesen gut gegangen, sie macht sich also getrosten Muthes dran. Aber – wie mag das zugehen? sie kann nicht recht vorwärtskommen, die Worte sind so kurios, und wenn man sie dann glücklich zurecht buchstabiert hat, was ist’s für langweiliges Zeug!
[323] Neuigkeiten heißen sie das – schöne Neuigkeiten! Wieviele Schiffe angekommen und abgefahren sind, was sie auf dem Rathhaus verhandeln, wie theuer der Centner Korn verkauft wird auf der Pro–du–kten–bör–se. O, es ist schrecklich, so seinen Sonntag-Nachmittag zuzubringen!
Lentje indessen sieht theilnehmend nach der stillen Base hin, die regungslos mit gesenkten Augen im Stuhle sitzt. Die jungen Dinger können nicht wissen, daß sie heute den Todestag ihres armen Jan, der im Meere ertrunken ist, still begeht und lieber allein wäre mit ihren guten und schweren Erinnerungen. So üben sie sich gegenseitig in der Geduld, die ja eine holländische Nationaltugend ist, nicht minder als die wundervolle Reinlichkeit, die überall von Wänden und Geräthen blinkt.
... Die moderne Kunst wendet sich mit großer Vorliebe wieder dem „holländischen Genre“ zu und thut wohl daran, denn die frischen Mädchen und Frauen im kleidsamen Florhäubchen nehmen sich auf dem Hintergrund dieser ganzen häuslichen Traulichkeit immer wieder von neuem gut aus. B.
Das Altern der Hand. Die Geschicklichkeit der Hand ist uns nicht angeboren; wir müssen die Handfertigkeit erst im Leben erlernen. Wann
erreicht nun die Hand die höchste Stufe der Fertigkeit? Wie lange erhält sie sich auf derselben und wann beginnt sie zu altern? Das sind interessante und für diejenigen, die auf ihrer Hände Arbeit angewiesen sind, höchst wichtige Fragen. Berühmte Virtuosen und große Künstler bilden Ausnahmen; wie ihr Genie ein außergewöhnliches ist, so sind auch ihre Hände mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Von allgemeinerer Bedeutung ist die Prüfung der Handfertigkeit der Durchschnittsmenschen, namentlich der Fabrikarbeiter.
Der englische Arzt Sir James Crichton Browne hat im Laufe der Jahre darüber Beobachtungen in den Fabriken von Birmingham und Staffordshire angestellt. Er fand dabei, daß, wenn die Arbeiter etwa im siebzehnten oder achtzehnten Lebensjahre in die Fabrik eintreten, die Geschicklichkeit ihrer Hände durch Uebung nach und nach größer wird, bis sie die höchste Stufe der Vollkommenheit etwa im dreißigsten Lebensjahr erreicht. Die geschicktesten Knopfdreher machen z. B. um jene Zeit 6240 Elfenbeinknöpfe täglich. Diese höchste Leistungsfähigkeit behält die Hand, wenn der Arbeiter sonst gesund bleibt, etwa bis zum vierzigsten Lebensjahr. Bereits von diesem Zeitpunkt an tritt ein Nachlaß ein, und Browne erläutert diese Abnahme der Handfertigkeit durch folgende Zahlen. Bis zum vierzigsten Lebensjahr kann ein geschickter Arbeiter wöchentlich in der Knopffabrikation 45 Schilling verdienen, im fünfundvierzigsten Lebensjahr sinkt sein Verdienst bereits auf 38 Schilling und beträgt im fünfundsechzigsten Jahre nur noch 20 Schilling, vorausgesetzt, daß der Mann sonst ganz gesund bleibt. Dieses frühzeitige Altern der Hand wird vor allem in Fabriken beobachtet, in welchen die Hand einseitig beschäftigt wird. Wenn wir bedenken, daß beispielsweise ein Arbeiter in den Federmesserfabriken zu Sheffield täglich 28000 Hammerschläge ausführt, so ist es kein Wunder, wenn die Nervencentren, die für eine und dieselbe Handlung so oft in Anspruch genommen werden, schließlich erlahmen. In anderen Gewerben, welche den ganzen Körper gleichmäßiger in Anspruch nehmen, namentlich in der Landwirthschaft, altert die Hand nicht so rasch.
Nun ist die Erhaltung der Handfertigkeit für den Handarbeiter eine Lebensfrage, und er muß danach streben, das Altern seiner Hand soweit wie möglich hinauszuschieben. Dies kann nur durch harmonische Uebung und Beschäftigung aller Gliedmaßen erreicht werden, und da erkennen wir an diesem Beispiel, wie wichtig Turnübungen, Spiele im Freien auch für den Hand- und Fabrikarbeiter sind. Aber auch die Personen, die fleißig nähen, sticken, schreiben und zeichnen müssen, können aus diesen Betrachtungen Nutzen ziehen, um ein frühzeitiges Altern ihrer Ernährerin, der Hand, zu verhüten. *
Bocks Buch vom gesunden und kranken Menschen ist nun seit nahezu vierzig Jahren im deutschen Hause heimisch. Unzähligen ist es ein treuer Rathgeber, ein werthvoller Führer zu gesundheitsgemäßer Lebensweise geworden, und sein Ruf ist weit verbreitet im deutschen Vaterland wie draußen in der Ferne, wo irgend Deutsche wohnen.
Es ist das Bestreben der Verlagshandlung, das Buch stets auf der Höhe der Wissenschaft zu erhalten, jeden Forachritt in der Erkenntniß des gesunden und des kranken Menschen auch in ihm zum Ausdruck zu bringen. Seit einer Reihe von Jahren ruht diese Aufgabe, da der ursprüngliche Verfasser Professor Dr. Karl Ernst Bock ja seit achtzehn Jahren tot ist, in den bewährten Händen des praktischen Arztes Dr. med. von Zimmermann in Leipzig, und er hat es auch unternommen, die eben erscheinende fünfzehnte Auflage auf den neuesten Stand der medizinischen Wissenschaft zu setzen. Auch die Zahl der dem Werke beigegebenen Abbildungen ist bedeutend vermehrt worden. So ist denn dafür gesorgt, daß auch diese neue Auflage dem altberühmten Namen des Buches in jeder Richtung Ehre mache.
Ausrottung der Kreuzotter. Seit einigen Jahren haben in Deutschland verschiedene Regierungen und Gemeinden Prämien auf den Fang von Kreuzottern festgesetzt. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Naturforscher, welche behaupteten, daß die Kreuzotter durchaus nicht so selten in Deutschland vorkommt, durchaus recht hatten. So wurden beispielsweise in einem verhältnißmäßig kleinen Bezirk, in der sächsischen Amtshauptmannschaft Grimma, im Jahre 1891 für eingelieferte Kreuzottern 671 Mark 50 Pfennig als Prämien ausgezahlt, und da die Prämie für einen Kreuzotterkopf 50 Pfennig beträgt, so ergiebt sich, daß in dieser Amtshauptmannschaft allein während eines Jahres 1343 dieser gefährlichen Reptile getötet wurden. Nach solchen Erfahrungen erscheint es wünschenswerth, daß Gemeinden, welche bis jetzt auf die Erlegung von Kreuzottern keine Prämien ausgesetzt haben, dies baldigst thun, wenn das Vorkommen der einzigen giftigen Schlange in Deutschland in ihrem Bezirke festgestellt ist.
Die Kreuzotter erwacht aus ihrem Winterschlaf selten vor Mitte März, immerhin aber früher als unsere unschädlichen Schlangen. Das Weibchen legt die Eier gewöhnlich erst in der zweiten Hälfte des August oder selbst im September. Die Zahl derselben beträgt fünf bis sechzehn. Es empfiehlt sich darum, die Ausrottung der Kreuzotter mit besonderem Nachdruck im Frühjahr und in der ersten Hälfte des Sommers zu betreiben. *
Die Pocken in Frankreich und Deutschland. Ein Vergleich der Pockenstatistik in beiden Ländern spricht sehr zu Gunsten der Schutzpockenimpfung. Während in Deutschland bei einer um 7 Millionen größeren Bevölkerung in den letzten Jahren durchschnittlich nur 110 Menschen jährlich an den Pocken zu Grunde gingen, beträgt die jährliche Durchschnittszahl der Opfer der Pockenepidemien in Frankreich 14000, ungerechnet derjenigen, welche die Pocken entstellen oder siech machen.
„Sollte man es für möglich halten,“ ruft eine französische Fachzeitschrift aus, „daß hundert Jahre nach Jenners Entdeckung eiae Stadt von 10000 Einwohnern in zwei Jahren 844 Einwohner an den Pocken verloren hat?“ In Frankreich ist die Schutzpockenimpfung nicht gesetzlich vorgeschrieben. Daß auch in Deutschland noch in verschiedenen Kreisen ein tiefwurzelndes Vorurtheil gegen den Impfschutz besteht, erklärt sich freilich durch das Vorkommen vereinzelter Sterbefälle trotz des Impfzwanges auch bei uns. Solche einzelne Fälle sollten aber nicht blind machen gegen den unleugbaren allgemeinen Segen des Schutzverfahrens, sondern nur zur strengsten Handhabung aller Vorsichtsmaßregeln bei Beschaffung der Lymphe, namentlich auch, wo es sich um Kinder der armen Bevölkerung handelt, mahnen. J.
Schachaufgabe Nr. 4.
Von Fr. Dubbe in Rostock.
SCHWARZ

WEISS
Weiß zieht an und setzt mit dem vierten Zuge matt.
Dominopatience.

Trennungsräthsel.
Wo Geist und Menschenkenntniß walten,
Genügt schon oft mein Wort getrennt,
Um das, was es vereint benennt,
In manche Lage zu erhalten.
Scherzräthsel.
Von der Vergänglichkeit der Dinge
Zeug’ ich – gefolgt von Erben – Dir,
Gesetzt nun, daß ich Wein empfinge,
Würd’ ich ein sehr geschätztes Thier;
Siehst du mit Erz mich vor dir stehen,
Hat jeder Fröhliche mich gern,
Doch bin mit Wermuth ich versehen,
So bleibt die Heiterkeit mir fern;
In mir verbirgt sich manche Gabe,
Giebst du ein Achtel mir sodann.
Jedoch sobald ich Neider habe,
Zieh’ ich die ganze Menschheit an.
Oscar Leede.
Logogriph.
Der Vater Rhein erblickt’s mit a; –
Auch du, Freund, warst vielleicht schon da
Einmal zur Sommerfrische.
Mit i wird es gar viel gejagt
Und hat mir immer sehr behagt,
Stand’s vor mir auf dem Tische.
Buchstabenräthsel.
Ein Dichter wird von mir genannt,
Der dir durch Dramen wohlbekannt,
Raubst du alsdann ein Zeichen mir,
Steht wieder ein Poet vor Dir.
Auflösung des Hieroglyphenräthsels auf S. 292: Wer’s Alter nicht ehrt, ist’s Alter nicht werth.
Auflösung der Skataufgabe Nr. 3 auf S. 292:
Die Sitzung ist folgende: Skat: e9, e8.
- Vorhand: e7, gK, gO, g8, g7, r7, sK, sO, s8, s7.
- Mittelhand: eW, gW, rD, rZ, rK, r9, r8, eD, g9, s9.
Das Spiel nimmt folgenden Verlauf: <poem>1. r7![2] rK, rO. 2. eW! sW, sK. 3. gW! rW, gK. 4. rD, eO, sO. 5. tZ, sZ, gO. 6. r9, gZ, s8. 7. r8, sD[3] g8. 8. s9! gD, g7. 9. g9, eK, s7. 10. eD, eZ, e7.
- ↑ „Schon am Morgen des 7. Mai,“ berichtet ein Augenzeuge, „wurden die Gefangenen, schwere Verbrecher, 73 an der Zahl, in ihren grauleinenen Kitteln, kurzen grauen Hosen, weißwollenen Strümpfen und hölzernen Pantoffeln, mit ihren eisernen Blöcken an den Beinen, unter starker Bedeckung von Kavallerie und Infanterie der Garnison, über den Wall und die Esplanade zum Dammthor hinausgeleitet. Ruhig, fast ängstlich zogen die Sträflinge mit ihren blassen und ernsten Gesichtern die Straße entlang bis zum Hafen, wo sie vorläufig an Bord der ‚Vesta‘ untergebracht wurden.“
- ↑ Vorhand bringt blanke r7 an, weil Mittelhand bis Rothsolo gereizt hatte.
- ↑ Der Spieler hatte das Fallen von K und O in g und s bemerkt und erwartet, daß Mittelhand eD besetzt haben werde, weshalb er eZ behält. Die Sitzung ist aber so ungünstig, daß er sein Grand mit Schwarz verliert.
Auflösung der Charade auf S. 292:
Ge – Flügel (die Flügel der Vögel – der Flügel als Instrument) – Geflügel.
Auflösung der Dominoaufgabe auf S. 292:
B hat:
Im Talon liegen:
C behält:
D behält:
Der Gang der Partie war: A 4/6, B –, C 6/3, D 3/5; A 5/4, B –, C –, D 4/2; A 2/6, B –, C 6/0, D 0/3; A 3/4, B –, C –, D 4/1; A 1/6.
Auflösung der Anagrammaufgabe auf S. 292:
a. 1. Sterne, 2. Calbe, 3. Hansa, 4. Elvas, 5. Freia, 6. Falun, 7. Egeria, 8. Lindau (Scheffel).
b. 1. Elster, 2. Kabel, 3. Kasan, 4. Elias, 5. Hfare, 6. Alaun, 7. Regina, 8. Daniel (Ekkehard).
Unseren Abonnenten machen wir die Mittheilung, daß wir uns infolge vielfach laut gewordener Wünsche entschlossen haben,
Die Mappe ist zur Aufnahme von ca. 50 Stück der Kunst-Beilagen, welche die Abonnenten der „Gartenlaube“ seit vorigem Jahr regelmäßig erhalten, berechnet, reicht also für drei Jahre aus; nach Ablauf dieser Zeit bildet die gefüllte Mappe ein vollständiges, werthvolles Prachtwerk, und es kann dann eine neue Sammel-Mappe für die folgenden Kunstblätter bezogen werden.
Abonnenten der „Gartenlaube“, welche die Kunst-Beilagen am Schlusse des Jahres mit den Heften zusammen einbinden lassen, können die Mappen auch zur Aufbewahrung der neuesten Hefte verwenden und dadurch zur Schonung derselben beitragen.
Leipzig, im Mai 1892. Die Verlagshandlung der Gartenlaube.