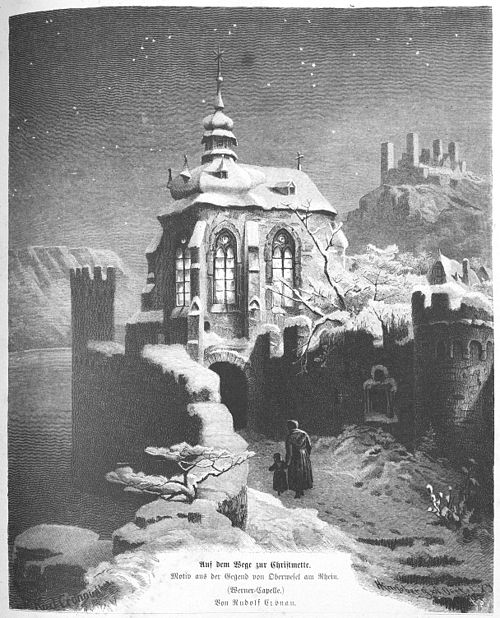Die Gartenlaube (1879)/Heft 51
[845]
| No. 51. | 1879. |
Illustrirtes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Wöchentlich 1 ½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 1 Mark 60 Pfennig• – In Heften à 50 Pfennig.
Heil’ge Nacht, du aller Feiern Krone,
Sonnenfest der grauen Väterzeit,
Durch das Kreuz dem größten Menschensohne
Und der deutschen Kinderschaar geweiht,
Aller Wonnen reinste
Bringst du durch das Aermste, Kleinste
Gnadenreich der Welt im Winterkleid.
Kinderlippen, schwache Kinderhände,
Aeuglein, unschuldsvoll und sonnig, sind
Heut die Träger einer Himmelsspende,
Die sich segnend durch das Leben spinnt.
Alle Schätz’ erbleichen,
Ist im Prunkgemach des Reichen
Nicht der höchste Reichthum heut – ein Kind.
Armer Reicher, stehst du so verlassen
In dem öden, kinderleeren Raum?
Sieh, der Reichthum winkt auf allen Gassen!
Und du ahnst des Glückes Nähe kaum.
Wimmert’s dort nicht leise?
Drück an’s Herz die arme Waise,
Und dein Glück erblüht am Weihnachtsbaum.
Ein Seebad.
Von Otto Girndt.
(Fortsetzung.)
Erminia rief ihre Kammerfrau und eröffnete ihr, was sie mit dem Mädchen verhandelt. Die Matrone nahm die Mittheilung anfangs mit Bestürzung auf; sie könne ihren Dienst noch mit ungeschwächter Kraft versehen, meinte sie; doch als sie den Trost empfing, sie solle keineswegs aus Amt und Würden verdrängt, sondern in ihren Leistungen nur unterstützt werden durch ein armes Kind, welches aus unerquicklichen Lebensverhältnissen in bessere zu kommen verdiene, da gab die gute Seele sich zufrieden.
Nach wenigen Stunden zog Angela mit ihren Habseligkeiten bei der neuen Herrschaft ein. Die Kammerfrau kam ihr mütterlich entgegen, klopfte ihr die Wangen und sagte:
„Sei nur immer recht artig gegen Hoheit! Sie verlangt nicht viel und ist nie schlechter Laune. Und wenn Du mit den Handreichungen in der ersten Zeit nicht Bescheid weißt, mein Töchterchen, so wende Dich getrost an mich! Ich werde Dich in Allem unterweisen.“
Angela fiel der alten Frau wie einer langjährigen Bekannten um den Hals, ließ sich ihr künftiges Zimmer zeigen, legte ihr Kleiderbündel ab, gönnte sich aber nicht Muße, es aufzuschnüren, bevor sie Erminia wiedergesehen. Die Kammerfrau begleitete sie, meldete sie an und blieb Zeugin der folgenden Begrüßung:
„Nun sei willkommen, Angela! Ich hoffe, Du wirst Dich bei uns wohl fühlen.“
„Ach, hier ist der Himmel, Hoheit. Mutter und Vater lassen Ihnen tausendfachen Dank für Ihre Gnade zu Füßen legen und werden täglich für Sie beten. Ich bringe auch eine große Neuigkeit mit.“
Erminia errieth, wen die Neuigkeit betraf, und entfernte die Kammerfrau mit einem kleinen Auftrage; dann befahl sie erwartungsvoll: Sprich!“
Angela’s Zunge ging wie ein Rädchen:
„Ich war unterwegs noch einmal im ‚Hôtel Danieli’. Habe ich Eurer Hoheit schon gesagt, daß es besonders das prächtige Haar der Gräfin ist, das dem Cavaliere Fabbris in die Augen gestochen? Ich weiß jetzt, wie seine Flamme zu löschen ist. Aber Hoheit müßten mir Urlaub geben, daß ich einmal in die Seebäder nach dem Lido hinausfahren kann.“
„Was schwatzest Du? Ich verstehe Dich nicht.“
„Ganz sollen mich Hoheit auch vor der Hand nicht verstehen; denn Sie werden sich nicht herablassen, eine Intrigue mitzuspielen.“
„Gewiß nicht!“ erklärte Erminia.
„Doch mich wollen Sie gewähren lassen?“
„Intriguen sind mir verhaßt – das merke Dir von vornherein!“
„Doch wenn es sich darum handelt, den Cavaliere vor Schaden zu bewahren?“
„Signor Fabbris steht in keiner Beziehung zu mir, die mich zu seiner Wächterin bestellte,“ entgegnete Erminia mit Haltung.
„Es kann Ihnen nimmermehr gleichgültig sein, wenn ein Freund Ihres Hauses und ein so edelmüthiger junger Herr Gefahr läuft.“
Hätte die Schwätzerin geahnt, wie sie der Hörerin aus der Seele sprach! Erminia ließ es nicht merken, wie ihr das Herz vor Freude darüber schlug, an ihrer Untergebenen ein Werkzeug zu gewinnen, das ihren Wünschen diente, ohne von ihr selbst dazu angeleitet zu werden. Scheinbar ruhig, ja kalt that sie die Frage: „Was willst Du auf dem Lido.“
„Das ist eben mein Geheimniß,“ lächelte Angela. „Der Portier bei Danieli, welcher das polnische versteht, hat ein Gespräch der Gräfin mit ihrer Dienerin belauscht. Der Cavaliere würde trotz seiner Schönheit doch kein Glück bei der Dame haben; denn sie [846] geht auf ganz andere Eroberungen aus. Sie will die Augen Seiner Majestät des Königs auf sich zu ziehen suchen, wenn der Monarch in der nächsten Woche unsere Stadt beehrt.“
„Nicht möglich!“ fuhr Erminia auf.
„Mein Portier verhört sich nicht,“ behauptete Angela. „Die Gräfin ist voller Wuth von Eurer Hoheit zurückgekommen, hat in ihren Zimmern laut auf die Kälte meiner gnädigen Herrin gescholten –“
Das Mädchen brach ab, da Erminia erregt einige Schritte durch das Gemach that.
„Dem ritterlichen König, der stets gegen meinen Vater und mich die Güte selbst gewesen, will diese – diese Circe nachstellen? Angela, ich ertheile Dir unbeschränkte Vollmacht; ich will Dein Mittel nicht kennen lernen, aber thu’, was Du magst, um das gefährliche Weib unschädlich zu machen!“
„O, das ist köstlich,“ frohlockte die Angerufene leise. „Doch wenn es gelungen, darf ich wohl erzählen, was ich angestellt? Im Vertrauen auf die Genehmigung meiner Herrin habe ich mit dem Portier schon das ganze Stückchen verabredet; es muß glücken; die Gräfin geht sicher in’s Garn, und die Badewärterin auf dem Lido ist meine Tante.“
Erminia war noch in Wallung.
„Ich begreife Dich nicht mit Deinem Lido, doch meinetwegen fahre hinaus!“
„Gut, ich verschwinde; vor Abend bin ich zurück, aber Hoheit müssen mir den Abend selbst auch noch Freiheit geben, wenn ich Alles in’s Werk richten und zwei –“
Sie stockte.
„Und zwei?“ wiederholte Erminia im Frageton.
„Verzeihung, ich wollte ungeziemender Weise sagen: wenn ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen soll. Heut Abend ist Concert auf dem Marcus-Platz, wenn das Wetter gut bleibt, und es bleibt gut. Bei der Musik fehlt der Cavaliere di Fabbris nie. Adio, Hoheit!“
Ohne die Antwort der Herrin abzuwarten, schlüpfte Angela geschmeidig wie eine Eidechse hinaus.
Erminia dachte unruhig, verstimmt den Reden des Mädchens nach. Gegen die Polin stieg geradezu Abscheu und Haß in ihr auf. Als sie den Vater heimkommen hörte, nahm sie sich zusammen, ihre Erbitterung zu unterdrücken, ließ die Bariatinska unerwähnt und theilte nur mit, daß sie eigenmächtig dem Dienstpersonal ein neues Glied einverleibt. Der Herzog, mit Allem zufrieden, was sein Töchterchen that, lobte ihren Einfall, weil man während der Abwesenheit des Königs mehr dienende Hände, als gewöhnlich, nöthig haben werde.
Der Abend kam. Auf dem Marcus-Platz herrschte großes Gewühl. Die Schauläden in den Arcaden der Procuratien, die Juwelier- und Glaswaarengewölbe, die Bilderhandlungen hatten in den beiden letzten Tagen merklich gearbeitet, ihr Bestes auszustellen; der Hof sollte seine Augenweide finden. Bis in die engsten, winkligsten Gassen war die Kunde von der nahen Ankunft des volksthümlichen Kronenträgers gedrungen, und Alles, was Beine hatte und nicht durch Krankheit gefesselt lag, war in Bewegung. Jeder wollte sehen, welche Zurüstungen getroffen wurden.
Antonio, der am Vormittag wieder tüchtig mit seinem Regiment exercirt hatte und dann in sein Quartier geeilt war, weil es ja möglich schien, daß er schon eine Einladung in den Palast Bevilacqua vorfand, hatte eben keine gefunden; sein goldhaariges Idol war also unzweifelhaft noch nicht bei Erminia gewesen. Er mußte sich in Geduld fassen und begab sich zu Tische in’s Arsenal. Ob die Gräfin sich heute wohl wieder unter die Menge auf dem Marcus-Platz mischte? Antonio wünschte es, deshalb hoffte er’s; und als die ersten Laternen ihr Licht ausstreuten, brach er sich Bahn durch den Volksstrom bis zu seinem Stammsitz vor dem Café Quadri.
Wie immer, gesellten sich Cameraden zu ihm; die Musik begann; sie spielte lebendiger, feuriger als je; die Vorfreude auf die kommenden Tage rauschte aus den Trompeten und Bombardons in die weiche Luft. Kaum war das erste Stück verklungen, so spürte Fabbris einen würzigen Duft in seiner Nähe und hörte von wohlbekannter Stimme einen freundlichen Abendgruß. Angela stand hinter ihm, ihr Blumenkörbchen wie sonst am Arm, und bot ihm das übliche Sträußchen dar. Aber als diesmal die halbe Lira in ihre Hand fallen sollte, lehnte sie die Annahme flüsternd ab und fügte, unhörbar für Antonio’s Tischnachbarn, hinzu: „Fahren Sie morgen Mittag nach dem Lido! Um zwei Uhr treffen Sie die blonde Gräfin dort in den Bädern. Still, Herr!“ bat sie, da sie sah, wie es ihn durchzucke. Den Finger auf den Mund gedrückt, huschte sie davon, im Nu von der großen Menschenwoge überfluthet.
Die anderen Officiere hatten die Fioraja ganz übersehen; ebenso entging ihnen die dunkle Gluth im Antlitz des jungen Waffenbruders, der sich einerseits unangenehm berührt fühlte, daß ein Mädchen wie Angela sein Herz durchschaut, andererseits aber wieder ihre Botschaft mit Entzücken vernommen hatte. Belogen war er sicherlich nicht, und am folgenden Tage fiel der Uebungsmarsch aus; in der Caserne sollten Monturen und Waffen geputzt werden; mithin stieß die Lidofahrt auf kein Hinderniß.
Angela eilte vom Marcus-Platze der Piazzetta zu. Dort schenkte sie ihr Körbchen einem Kinde, das ärmer war als sie. Zum letzten Mal hatte sie’s gefüllt, und sie triumphirte innerlich, daß sie sagen konnte: „Mein letztes Sträußchen war ein Geschenk an ihn.“ An der Riva wartete ihrer die Gondel des Freundes, der sie umsonst fuhr. Der braune Bursche ruderte in den großen Canal und hielt vor dem Palast Bevilacqua.
Der Lido ist die äußerste und umfangreichste der Inseln, welche das Wasser der Lagunen oder Strandseen vom Adriatischen Meere scheiden. Auf der Südseite des Lido sind über Holzpfählen die Zellen erbaut, worin sich die Badegäste entkleiden, die weiblichen links, die männlichen rechts, und zwar stehen diese Zellen in Zusammenhang mit einer dazwischen liegenden Restauration, welche von einer Terrasse aus den Blick nach beiden Seiten hin frei giebt. Der alte Griechendichter Euripides singt: „Das Meer spült alles Schlechte von den Menschen ab.“ Auch von der strengen Etikette befreit es sie; die Schaumfluthen, wenn sie halbwegs hochgehen, werfen jenseit der nicht allzuweit in die Wellen ragenden Scheidewand häufig Männlein und Fräulein hart zusammen, woran die Badenden so wenig Anstoß nehmen, wie an den Zuschauern, die sich über die Brüstung der Terrasse lehnen. Enganliegende Wollengewänder ohne Aermel umschließen die Glieder der Frauen. Der Salzgehalt der Adria ist stärker, als der des ligurischen und tyrrhenischen Meeres; deswegen lockt der Lido zur Sommerzeit zahlreiche Gäste aus Genua, Rom und selbst aus Neapel an. Der Portier des „Hôtel Danieli“ hatte der Gräfin Bariatinska auf Angela’s Betrieb das Märchen aufgebunden, der König liebe es sehr, schöne Damen baden zu sehen; sofort war die Polin entschlossen, sich mit dem Meere vertraut zu machen. Nur um ihr Haar hatte sie Besorgniß geäußert, allein der böse Feind raunte ihr zu, dafür gäbe es schützende Badekappen, die dem Einfluß des Salzwassers vorbeugten. Indeß ihre Ausbildung zur Nereide wollte sie gern unbeachtet vornehmen, der Rathgeber empfahl ihr deshalb die zweite Nachmittagsstunde, wo sie muthmaßlich die einzige Taucherin sein werde.
Die schönste Sonne begünstigte Ludovica’s Seeprobe. Um ein Uhr bestieg sie mit ihrer Dienerin das Dampfboot, welches allstündlich den Verkehr zwischen der Riva von Venedig und dem Lido vermittelt. Der Portier geleitete sie an die Bude, wo der Billetverkauf stattfindet, und schärfte ihr noch besonders ein, beim Anlegen des Meercostüms sich ja von der Badewärterin helfen zu lassen, die eine äußerst erfahrene, geschickte Person sei und namentlich mit der Unterbringung des Haares der Damen umzugehen wisse, sodaß es beim höchsten Wellenschlag von keinem Tropfen durchnäßt werde.
Den Lieutenant di Fabbris hatten Ungeduld und Sehnsucht schon zwei Stunden vor der Gräfin durch die Lagune getrieben. Erwartungsvoll aufgeregt schritt er den Strand entlang, eine Strecke über die Bäder hinaus; endlich warf er sich, da er ganz einsam dahinschlenderte, in den trockenen Dünensand, stützte den Kopf auf den Ellenbogen und blickte träumerisch hinaus über die weite, grünblaue Wasserfläche, die am fernen Horizont wie eine unbewegliche Linie erschien, wie ein stiller, großer Gedankenstrich der Schöpfung. Durch ein Fensterchen des Damenbades erspähten den Ruhenden zwei scharfe schwarze Augen, und ein schelmischer Mund kichern vergnügt. Angela besuchte heute wie gestern ihre Tante, die Badewärterin.
[847] Der Seewind milderte die Mittagswärme; Antonio ward durch die Sonne, obgleich sie fast senkrecht über ihm stand, nicht belästigt. Eine einzige Fischerbarke, den Farbenzeichen ihrer Segel nach einem Bewohner der Insel Chioggia gehörig, schwebte geräuschlos nahe am Lidostrande hin, als suchte sie eine Stelle zur Anfahrt. Plötzlich trottete ein junger Soldat kaum zwanzig Schritte vor dem Officier vorüber, ohne ihn zu gewahren. Die Büchse an langem Riemen über den Rücken geworfen, die Hände darunter verschlungen, stieg er bis dicht an’s Ufer hinab und marschirte der Barke entgegen. Es war der Strandwächter, der seine Aufgabe erfüllte. Spitzbübische Schiffer suchen hier gar zu gern heimlich zu landen, verbotene Waaren auszuladen und dieselben dann in kleinen Partieen auf Gondeln, die auf der Wasserdogana im venetianischen Hafen nicht visitirt werden, in die Stadt einzuschmuggeln.
Die Barke schwamm näher und näher, Antonio’s Adlerauge konnte die Gestalten auf ihr unterscheiden. Zwei schmutzige Männer, aus kurzen Pfeifen rauchend, saßen, scheinbar unbekümmert um den Strandwächter, auf dem Deck. Jetzt blieb der Soldat stehen, drohte stumm mit dem Zeigefinger und nahm sein Gewehr in den Arm. Da tauchte aus der Kajüte ein brauner Mädchenkopf empor. Noch ein paar Secunden stand der Hüter des Gesetzes still, dann sah er sich um, hängte die Büchse wieder über die Schulter, machte Kehrt, warf keinen Blick mehr rückwärts nach den Fischern, sondern schritt der Düne zu. Ungestört ging hinter ihm die Barke an’s Land.
Antonio hatte den Vorgang gespannt verfolgt; er begriff den Zusammenhang nicht. Als der Soldat ihm nahe genug war, stand der Officier mit einem Sprung aufrecht, wie aus der Erde gewachsen. Bei dem unverhofften Anblick des Vorgesetzten erblaßte der junge Mensch.
„Bursche, was hast Du gethan?“ donnerte ihn Fabbris an. „Siehst Du nicht, was dort geschieht?“
Der Schuldbewußte sank in’s Knie und faltete die Hände:
„Gnade, Hern Gnade!“
„Gnade?“ rief Antonio. „Weißt Du, daß Du die Kugel verdienst?“
„Herr, ich weiß es,“ wimmerte Jener, „aber wenn mich die schwerste Strafe trifft –“
„Sie wird Dich treffen,“ unterbrach der Lieutenant, „ich habe Alles gesehen; Du hast nicht aus Unachtsamkeit, sondern mit vollem Wissen und Willen gegen den Dienst gefehlt.“
„Ja, Herr, ich bin schuldig, aber wenn die Ninetta mit ihren Feueraugen mich anschaut, könnte der Tod neben mir stehen, ich vergäße ihn und Alles.“
„Die Dirne in der Barke?“
„Sie hat mir’s angethan, Herr!“
Das offene Bekenntniß entwaffnete Antonio’s Empörung. Durfte er als strenger Richter auftreten, wo ein armer Junge aus Liebe an seiner Pflicht gesündigt? Wenn er sich in die Lage des Frevlers versetzte – hätte er nicht vielleicht dasselbe Unrecht begangen? Was wäre er nicht im Stande zu wagen, wenn die blonde Gräfin ihn einmal anschaute wie die braune Dirne den Schächer, der vor ihm lag? Gemäßigt versetzte er:
„Die Halunken haben uns beobachtet; sie laden nicht aus, sie steuern seewärts; das kommt Dir zu statten. Ich will Dich nicht unglücklich machen – steh auf, fort!“
Der Soldat sprang auf die Füße und wollte davonrennen.
„Halt!“ gebot Fabbris.
Der Delinquent stand angewurzelt.
„Wenn Du mir wieder begegnest, kennst Du mich nicht. Verstanden?“
Der Begnadigte kreuzte wie ein betender Türke die Arme über der Brust. Auf einen kurzen Wink des Officiers schoß er hinweg, so rasch er laufen konnte.
Antonio ging langsam den Bädern zu. Er empfand an sich selbst, wie die Leidenschaft für ein Weib des Mannes Sinn und Seele zu berücken vermag, und ein altes Lied hebräischen Ursprunges fiel ihm ein, das er leise vor sich hin murmelte:
„Stark wie der Tod ist Liebe,
Fest wie die Unterwelt ihr Wille,
Eine Flamme Gottes;
Keine Gewalt der Erde
Lindert ihre Gluth.
Nie erlischt die Liebe
In gewaltiger Wogen
Brausender Wasserfälle,
Noch durch wilder Stürme
Aufgeregte Wuth – “
Hier verließ ihn sein Gedächtniß, er fand die Schlußzeilen nicht und grübelte ihnen noch nach, als er schon auf der Terrasse inmitten der Bäder stand. Je angestrengter wir etwas in unserer Erinnerung suchen, desto geringer ist meist der Erfolg. Antonio gab endlich alles Kopfzerbrechen auf; war doch inzwischen die Zeit nahe gerückt, wo die Gräfin kommen mußte.
Und siehe da: als wäre sein Gedanke eine Wünschelruthe, rauschte plötzlich ein Kleid durch den offenen Saal hinter seinem Platz; Ludovica mit ihrer alten Dienerin stand neben ihm. Die heftige innere Bewegung, die ihn ergriff, legte einen Flimmer vor seine Augen, daß er ihre Züge wiederum nicht deutlich erkannte; nur in unbestimmten Umrissen schwankten Antlitz und Gestalt hin und her. Um so klarer war der Blick der Gräfin: die Schönheit des jungen Mannes in der schmucken Uniform überraschte sie, und als er sich unwillkürlich verneigte, lächelte sie ihn holdselig an:
„Können Sie mir sagen, mein Herr, wo ich in das Damenbad gelange?“
Statt sich von seiner Verwirrung zu erholen, verlor er die Fassung noch mehr, sodaß ihm die Antwort fehlte. Zum Glück kam ihm eine Hülfe, die er nicht vermuthet, ja die ihn in höchstes Befremden versetzte.
„Folgen Sie mir, ich bitte, Signora! Ich werde Sie führen,“ rief aus dem Hintergrunde des Saales eine Mädchenstimme.
„Ah, gut!“ sagte die Gräfin und nickte so freundlich, als hätte Antonio Auskunft ertheilt: „Ich empfehle mich, Signor!“
Damit entschwebte sie.
Fabbris strich sich über die Augen: „War das nicht Angela?“ Auf dem verdeckten Gange in die Badezellen konnte sein Blick von der Terrasse aus Niemand verfolgen, doch war er auch ohne das überzeugt, sich nicht geirrt zu haben. „Ja, ja, Angela. Aber wie kommt sie hierher?“
Daß ihre Anwesenheit in einer Verbindung mit ihrer Einflüsterung vom vorigen Abend stand, errieth Antonio, allein in welcher Verbindung, das blieb ihm dunkel, obwohl der nebelhafte Schleier vor seinem Gesichte zerfloß und seine körperliche Sehkraft die gewohnte Schärfe wiedergewann.
Währenddessen hatte Angela die Gräfin an eine Zelle geführt, und Ludovica fragte nach der Badewärterin, die, wie sie gehört, in ihrer Hantierung so gewandt sein solle, daß sie es vorziehe, sich von der Frau, statt von ihrer eigenen alten Dienerin, für’s Wasser costümiren zu lassen. Angela holte ihre Tante. Als sie mit ihr erschien, hatte Ludovica den Hut bereits abgelegt. Die Wärterin brach in laute Verwunderung über das üppige Haar aus; reicheren Naturschmuck habe sie in ihrem Leben nicht gesehen, obschon sie vornehmen Damen aus allen Weltenden die Badekappe aufgesetzt.
„Ich verlasse mich auf Sie, gute Frau,“ entgegnete die Polin, „daß Sie mein Haar vor jeder Befeuchtung schützen. Vorsichtshalber will ich zunächst ein leichtes Tülltuch über den Scheitel ziehen.“ Gesagt, gethan. „Ich vertrage durchaus keine Nässe daran,“ schloß sie.
„Meine Nichte wird mir helfen,“ erwiderte die Wärterin.
Angela sprang hinzu.
„Gewiß, Tante! Wir müssen Nadeln zur Befestigung nehmen – hier sind sie!“
Die Gräfin ließ sich entkleiden und in das ärmellose wollene Gewand hüllen.
„Ach, wie wundervolle, weiße Arme!“ rühmte Angela dabei. „Was würden unsere Bildhauer darum geben, wenn sie solche Modelle hätten!“
Ludovica lächelte wohlgefällig.
Jetzt ging’s an die Bergung des Haares. Die Wärterin schaffte die größte Kappe aus ihrem Vorrathe herbei. Die schweren goldenen Locken wurden aufgerollt und eingepreßt. Als die Nadeln gesteckt werden sollten, verlangte Ludovica zwei Handspiegel, einen wollte sie selbst vor sich halten; den anderen befahl sie dem jungen Mädchen hinter ihr emporzuheben, damit sie prüfen könne, ob die Coiffüre zu ihrer Zufriedenheit ausfalle. Angela runzelte einen Moment die Brauen, fügte sich aber und brachte die Spiegel.
[848] Das Werk gedieh zu Ende. Nichte und Tante begleiteten die Gräfin an die kleine Stiege, die in’s Wasser führte. Schon war die Dame zwei Stufen hinunter, als Angela rief:
„Erlauben Sie, Signora! Bleiben Sie stehen! Eine Locke quillt hervor; ich stecke sie Ihnen geschwind noch fest.“
Arglos ließ die Polin sich den Dienst leisten, diesmal ohne ihn durch den Spiegel zu controliren. Angela warf einen flüchtigen Blick voll Schalkheit in das feuchte Element und heftete an der Haarverkleidung zwei Schnürchen mit kleinen spitzen Angelhaken ein. Dann drängte sie:
„Nun rasch, Signora, rasch, daß Sie sich nicht erkälten! Treten Sie nur fest auf; der Grund ist flach; ich werde Ihnen mit dem Finger zeigen, wie Sie gehen müssen, damit Sie von keiner Sturzwelle getroffen werden. Hier, mehr nach rechts!“
Die Badende folgte vertrauensvoll der Anweisung, doch nach einigen Schritten fragte sie aus der Tiefe hinauf: „Kommt man dort nicht in’s Schilf?“
„Das ist kein Schilf, Signora; das nennt man Seetang; er thut Ihnen nichts – nur muthig weiter, immer rechts gehalten, rechts! Sie können sich auch dreist geradeaus wagen, bis zu den eingerammten Pflöcken dort!“
Während das Mädchen so durch Wort und Wink die schöne Frau leitete, die sich schnell sicher auf dem Meeresboden fühlte, stand Antonio di Fabbris regungslos, einem Säulenheiligen gleich, und verwandte kein Auge von den schwellenden Armen, die bald in der freien Luft Schaumperlen von den feinen Fingern schüttelten, bald unter dem Wasser Schwimmbewegungen übten.
Wer das Meer kennt, sieht einer Welle schon aus der Entfernung an, ob sie matt verlaufen oder, ihres Gleichen an sich ziehend, zur schäumenden Sturzwelle werden wird, und Angela kannte ihre Adria ausgezeichnet. Sie hatte eine Minute geschwiegen, die Gräfin sich kokett wiegen und biegen lassen und mitunter seitwärts nach Antonio geschielt; jetzt rief sie: „Links, Signora, links!“
Ludovica that, wie ihr geheißen; im nächsten Augenblicke jedoch ward sie von sprühendem Gischt überschüttet, verlor das Gleichgewicht, sank rücklings, wähnte, die Wucht des Wassers erdrücke sie, ward aber von derselben Macht, die sie niedergeworfen, ebenso schnell wieder aufgerichtet und vorwärts geschleudert, wobei ein jäher Schmerz durch ihre Stirn fuhr, als würde ihr der Kopf in zwei Hälften aus einander gerissen.
Die Empfindung beruhte nicht auf bloßer Täuschung, denn – das wunderbare Haar hatte bis auf einige unbedeutende Ueberbleibsel die Schläfen und den Nacken schmählich verlassen und sich sammt der Kappe, deren Obhut es anvertraut gewesen, kraft der Angelhaken an den Seetang geklammert.
Angela stieß einen Schreckenslaut aus und rief alle Apostel an; ihre Tante schlug entsetzt die Hände zusammen: „Signora, Signora!“ Die Gräfin lehnte an der Treppe, erschöpft nach Athem ringend; sie hörte erst, als Tante und Nichte von Neuem Lärm erhoben, tastete in den Nacken und war nahe daran, abermals umzusinken. Hülfreich glitt Angela die Stufen hinab, ergriff die Wankende am Arm und stützte sie beim Emporsteigen. Ein giftiger Blick war der Lohn für ihren Beistand. Aber kein lautes Wort des Vorwurfs traf das Mädchen; die Gräfin knirschte nur hörbar mit den Zähnen, und Angela sah so betreten, so unschuldig-dumm aus, daß Ludovica nicht im Entferntesten eine absichtlich gestellte Falle wittern konnte.
Schweigend eilte die Lockenberaubte in ihre Zelle. Hier erst fragte Angela, die ihr mit der Tante auf den Fersen geblieben, mit verschüchterter Stimme:
„Sollen wie Ihr Haar auffischen, Signora, und an der Sonne trocknen? Es wird vielleicht wieder brauchbar.“
Die Gräfin machte nur eine heftig verneinende Geste und herrschte ihre perplex dareinschauende Dienerin in ihrer den Italienerinnen unverständlichen Sprache an, die Hände zu rühren und sie anzukleiden. Die Alte winkte der Badewärterin wie dem Mädchen, sich zu entfernen, und schloß die Thür. Draußen verständigten sich Tante und Nichte, leise kichernd, durch Zeichen; dann lief Angela den Brettergang hinauf nach der Terrasse. Sie suchte den Lieutenant – er war fort. Als sie unverrichteter Sache zurückkehrte, hörte sie abermals in der Zelle der Gräfin fremdländische Laute und schloß aus der Tonfarbe, daß die Polin zornig schalt und schimpfte. Die Tante hatte unterdessen einen kleinen Nachen neben der Wassertreppe gelöst, ihn an die Stelle gestoßen, wo die goldenen Locken nach wie vor in den grünen Armen des Seetangs halb über, halb unter der Meeresfläche tanzten, nur nicht mehr gekräuselt, sondern in lange Strähnen zerfasert, und mit einem Bootshaken arbeitete die gute Frau an der Befreiung des gefangenen Kunstwerks, welches bisher im Glauben der Welt als Naturproduct gegolten. Der Zustand, in welchem es endlich der rettenden Stange folgte, war trostlos; nichtsdestoweniger griff Angela begierig darnach und schwenkte es triumphirend, wie ein siegreicher Krieger in der Schlacht die zerfetzte Fahne des Feindes. Vor der Zelle erwartete sie damit das Heraustreten der entthronten Haarkönigin und hielt es ihr mit einem stummen Knicks entgegen.
Die Gräfin trug den Kopf verbunden wie eine Bauerfrau, die an Zahnweh leidet; Angela und ihre Tante hätten beinahe laut aufgelacht. Die Reste ihres zerstörten Schmucks riß Ludovica mit stummem Ungestüm an sich und schleuderte sie ihrer Dienerin zu, die das kostbare Gut mit zitternden Fingern unter ihren Shawl stopfte. Der Badewärterin ein Trinkgeld zu verabreichen, vergaß die Dame, und während die Italiener sonst nicht blöde sind, für die kleinste Dienstleistung, oft sogar für die bloße Antwort auf eine Frage, Entschädigung in klingender Münze zu fordern, wich Angela’s Tante doch hier einmal von der Landessitte ab und ließ es geschehen, daß die Polin ohne Erleichterung ihrer Börse wie ohne mündlichen Abschied das Seebad dröhnenden Schrittes verließ.
Weihnachten! Nach fast vierzehnjähriger Abwesenheit von der Heimath ist es mir wieder vergönnt, die traulichsten Erinnerungen an die goldenen Tage der Kindheit durch eine echt deutsche Weihnachtsfeier aufzufrischen.
Drüben im Lande der Palmen feiert man auch Weihnachten, aber das ist nur ein schwacher Abglanz der Weihnachtslust, welche hier von Jung und Alt empfunden wird. In buntem Reigen ziehen in diesen Tagen wieder und wieder jene Weihnachtsabende an mir vorüber, wie ich sie in jenen vierzehn Jahren verlebt. Ich will Einiges davon aufzeichnen; vielleicht, daß sein fremd anmuthendes Farbenspiel auch Andere unterhält.
Es war im Jahre 1866, und ich mit ein paar Freunden auf dem Wege nach Porto Alegre, wo ich die Weihnachtsferien verleben wollte. Nach mehrtägigem Ritt durch Urwald und Camp (Grasebene) befanden wir uns glücklich in Rio Grande do Sul, just am 24. December.
Rio Grande do Sul ist eine langweilige, rings von Dünensand umgebene Hafenstadt. Nur dem Umstande, daß sie Hafenstadt ist, verdankt sie es, daß sich viele Europäer, besonders aber viele Deutsche, daselbst niedergelassen haben. Wo sich aber Deutsche niederlassen, da gründen sie eine „Germania“, das heißt: einen deutschen Club, in welchem deutsche Zeitungen gelesen und deutsche Biere und Weine getrunken werden. Auch Rio Grande do Sul besitzt seine „Germania“, und zwar eine ganz vorzügliche, was Speisen und Getränke anbelangt. Dorthin schlenderte ich nach meiner Ankunft, um mich an einem kühlen Glase Erlanger zu erquicken. In tiefer Andacht führte ich mein Seidel zum Munde, als ich den mir befreundeten Dr. E., Director der deutschen Schule, eintreten sah.
„Sie kommen mir gerade recht,“ sagte er, „wir wollten heute Abend eine Weihnachtsbescheerung in der Schule veranstalten, und nun hat der Tischler noch nicht einmal den Baum gemacht. Ich weiß nicht, wie ich fertig werden soll. Sie müssen helfen.“
Dazu war ich gern bereit. Der Tischler wohnte nebenan, und wir gingen zunächst zu ihm. Der Baum, den er fabricirte, war fast vollendet; er leimte soeben in den Stamm die obersten [849]
Zweige ein. Stamm und Zweige waren glatt gehobelt, und das Ganze sah wie ein Kleiderständer aus. In einen Baum sollte ich es verwandeln. Nachdem der Lehrbursche das Gestell in den großen Schulsaal getragen, umwand ich es mit den grünen Zweigen einer Ginsterart, welche als einziges Grün in den Dünen von Rio Grande wuchert. Schüler und Schülerinnen des Dr. E. schleppten große Körbe voll von diesem Kraute herbei. Im Zeitraum von einer Stunde war aus dem Kleiderständer ein Tannenbaum geworden, und nun wurde die liebe Jugend hinausgeschickt, damit sie nicht sehe, was weiter den Baum schmücken sollte. Wir aber hatten ihn bald mit Lichtern, vergoldeten Nüssen und Confect behängt und auf weißgedeckten Tischen die sonstige Bescheerung für die Zöglinge geordnet.
Es war ein furchtbar heißer Tag und ein ebenso heißer Abend; ein wahres Schwitzbad hatten Eltern, Lehrer und Zöglinge auszustehen, als sie sich gegen Abend vor dem in reichem Lichterglanze prangenden Weihnachtsbaum versammelten und ein heimatliches Weihnachtslied anstimmten. Eine hübsche Ansprache des Directors und die Vertheilung der aus nützlichen Büchern und Süßigkeiten bestehenden Geschenke beschloß die Feier.
Trotz der Hitze des Südens war mir weihnachtlich zu Sinn geworden und diese Stimmung hielt auch den ganzen Abend über an,
[850] denn in den verschiedenen Familien, die ich später besuchte, traf ich auch strahlende Bäume – freilich nur künstliche – und fröhliche Kindergesichter; bei einem Maler war sogar der Baum von grüner Pappe angefertigt; er erfüllte aber doch seinen Zweck und wurde von den Kindern mit dem Liede: „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter!“ angesungen.
Als ich um Mitternacht durch die Straßen schritt, waren diese wie ausgestorben. Alles schlief, aber im Hafen ertönte noch Gesang. Ja, dort unweit der Landungsbrücke schaukelte sich eine Hamburger Brigg auf den Fluthen. Bei dem Schiffslichte erkannte ich den wachthabenden Matrosen, welcher auf dem Verdeck hin und wider schritt und in die Nacht hinaussang: „Stille Nacht, heilige Nacht!“ So feierte der sein Weihnachtsfest. Leise in die schöne Weise einstimmend kehrte ich in meinen Gasthof zurück.
Der nächste heilige Abend sah mich in einer schrecklichen Lage. Die Colonisten von Sao Lourenço, größtentheils Pommern, waren durch Feinde ihres Coloniedirectors irre geleitet worden, und das verkehrte Auftreten des Letzteren hatte nicht wenig dazu beigetragen, sie in der falschen Ansicht, daß er ihnen eine zu hohe Summe Geldes für das von ihm verkaufte Land abgenommen habe, zu bestärken. Lange gährte es in der Colonie. Drohbriefe wurden an den Director gesandt, und Alle, welche sich auf die Seite des Letzteren stellten, wurden verhöhnt und mit dem rothen Hahn auf ihrem Dache bedroht. Die Regierung hatte auf meine Verwendung, durch die ich mir allerdings den Haß der aufrührerischen Colonisten zuzog, dreißig Mann Nationalgardisten, einen Officier und einen Sergeanten zur Aufrechterhaltung der Ordnung geschickt, leider waren aber in echt brasilianischer Weise die Waffen ausgeblieben, weshalb der Sergeant mit zwei Mann in die ferne Stadt gesandt werden mußte, um sie zu holen.
Am 23. December 1867 saßen der Director, der Officier und ich, der ich inzwischen die Function eines Adjuncten übernommen hatte, am Spieltisch beim portugiesischen Solo. Die Vaterlandsvertheidiger lagen im Schatten des Hauses und drehten sich aus Maisstroh und feingeschnittenem Tabak Cigaretten; die Damen des Hauses beschäftigten sich mit den Kindern. Da plötzlich erschien mit entfärbten Wangen eines der Dienstmädchen und rief: „Da kommen sie von allen Seiten, und Alle haben Pistolen und Messer!“
Kaum war dieses Wort ausgesprochen, so vernehmen wir schon Pferdegetrappel und hören die rauhen Stimmen anscheinend betrunkener Bauern.
Wir schließen die Thür. Der Officier tritt an das einzige geöffnete Fenster und fragt die Leute in portugiesischer Sprache nach ihrem Begehr. Er wird nicht verstanden. Ein wüstes Geschrei erhebt sich, und der Anführer der Rotte, ein desertirter schwedischer Matrose, der schon zweimal als Mörder in Haft war und später wegen Mordversuchs an seinem Schwiegervater von den Pommern mit Knütteln todtgeschlagen wurde, schwingt sein Waldmesser und sucht am Fenstersims emporzuklettern.
„Die muthige Donna Maria tritt an das Fenster – die Colonisten draußen verstummen. Alle haben große Achtung vor dieser Frau, welche sie als gute Mutter und Gattin kennen.
„Was wollt Ihr, Leute?“ fragte Donna Maria.
Nun erheben sich erst einzelne Stimmen und lassen die ungerechtfertigtsten Klagen und die wahnsinnigsten Forderungen laut werden, plötzlich aber schreit die ganze Rotte: „Wir wollen das Geld heraushaben, das man uns zu viel abgenommen; wir wollen den Director aufhängen.“ Dazwischen ertönten einzelne Rufe: „Reißt den Zaun ein, und wenn man uns nicht hören will, so steckt das Haus an allen Ecken in Brand!“
Schon hört man, wie die Aexte in Bewegung gesetzt werden, und immer größer wird der Haufe der Revoltanten. Es sind gewiß über hundert Kerle, die das Haus umzingelt haben, alle offenbar trunken vom Genuß des Zuckerbranntweins, den sie auch jetzt noch unter sich kreisen lassen, unter gemüthlicher Betheiligung der waffenlosen Vaterlandsvertheidiger.
Noch hält sich Donna Maria tapfer am geöffneten Fenster und beschwört die Leute, aus einander zu gehen, und diese Zeit benutze ich, um ihren wie Espenlaub zitternden Gemahl auf dem Bodenraum hinter Kisten und Gerümpel zu verstecken. Während dieser Zeit hat sich Donna Maria mit den Kindern entfernt, wohin? weiß ich nicht; ich selbst behalte eben Zeit, den Revolver, den ich in der Hand trage von mir zu werfen, um nicht mit Waffen ergriffen zu werden, worauf ich dem Keller zuspringe – eine Vertheidigung wäre ja doch nicht möglich gewesen. Kaum hat sich die Fallthür hinter mir geschlossen, so weicht die Hausthür dem Andringen so vieler Menschen, die mit starken Pfählen dawiderstoßen, und die Menge der Trunkenen wogt in das Haus. Die Kellerluken sind vergittert; an ein Entfliehen ist nicht zu denken. Ich höre, wie über meinem Haupte geflucht, gelästert, getanzt, gesungen und vor allen Dingen geraubt wird; denn über mir ist das große Waarenlager des Directors, der zugleich Kaufmann ist. Das schurrende Geräusch, welches ich gerade von dorther vernehme, bezeugt, daß man die Waarenkisten zerschlagen und zum Anzünden des Hauses gebrauchen will. Einmal droht eine Stentorstimme allen Hausinsassen mit Gurgelabschneiden.
Inzwischen ist es dunkel geworden, und durch die Luken fällt Sternenschein in mein freiwilliges Gefängnis, aus welchem zu entrinnen ich nicht hoffen kann, wenn die Unmenschen ihre Drohung, Feuer anlegen zu wollen, ausführen. Ich öffne ein wenig die Fallthür, und im Kerzenschein, der vom Corridor hereinfällt, erkenne ich den Officier, welcher einigen Colonisten seinen Degen übergiebt und sich als ihr Gefangener erklärt. Er wird nebst seiner Frau hinausgeführt und sein Gepäck ihm nachgetragen. Dann höre ich ein Zerschlagen von Waarenkisten, und schon wähne ich Alles verloren – da erklingt über mir eine wohlbekannte laute Stimme und übertönt das Geschrei der Anderen: „Wo Sie auch immer im Hause sein mögen, Herr R…, kommen Sie getrost her! Es soll Ihnen nichts geschehen. Wir sind hier, Ihre Freunde!“
Nun folgt ein kurzer Kampf zwischen den gutgesinnten und den aufrührerischen Colonisten, der anscheinend zu Gunsten der ersteren entschieden wird. Es tritt Stille ein; ich schließe, daß der Director zum Vorschein gekommen ist und, geschützt von den Freunden, die gestellten Forderungen unterzeichnet.
Gegen Mitternacht verziehen sich die Ruhestörer, und ich kann nun mein Versteck verlassen. Dort sitzt der Mann noch mit der Feder in der zitternden Hand, und Donna Maria geht weinend im Zimmer auf und nieder.
„Was haben Sie gethan?“ frage ich.
Er schiebt mir ein Blatt Papier hin, welches vor ihm liegt. Es enthält ganz unmögliche Versprechungen, welche er mit den Anführern der Rotte zusammen unterzeichnet hat. Ein Exemplar des Vertrages haben Letztere mitgenommen.
„Das ist ein werthloser Wisch,“ sage ich. „Sie haben hier unter dem Druck der Gewalt Ihr Wort verpfändet und brauchen es aus diesem Grunde nicht zu halten. Vor Allem müssen Sie und Ihre Familie so schnell wie möglich gerettet werden. Geben Sie mir Geld, und lassen Sie mich für Alles sorgen.“
Ich ging, um mein Pferd zu satteln, fand es aber in der Dunkelheit nicht und benutzte daher das erste beste Soldatenpferd, das ich erwischte. Der Officier lagerte draußen im Freien mit seiner Frau und wagte sich nicht in das Haus zurück, weil ihm dies von den Colonisten verboten worden.
Nachdem ich das nöthige Geld empfangen, ritt ich fort. In vielen Colonistenhäusern schimmerte noch Licht, und dann und wann hörte ich Stimmen vor mir auf dem Wege. Ich mußte daher vorsichtig reiten. Bei Tagesanbruch lag der Urwald hinter mir, und vor mir, vom Schein der Morgenröthe erhellt, breitete sich der weite Camp aus, von der Lagoa dos Patos (das große südbrasilianische Binnenmeer) wie von einem Purpurband umsäumt.
Nach einer kleinen Stunde hielt ich vor dem Hause eines befreundeten brasilianischen Kaufmanns, der an der Mündung des Sao Lourençoflusses wohnte. Ich pochte an die Hausthür. Eine Sclavin öffnete mir und führte mich in das Haus. Ich trat an das Bett des Freundes, erzählte ihm kurz, was geschehen, und theilte ihm meinen wohl durchdachten Rettungsplan mit. Er weckte sogleich seine männliche Dienerschaft und einen Herrn, der in seinem Hause logirte und Besitzer von Pferd und Wagen war. Letzterer war bereit, Hülfe zu leisten. Kaum ließen sich die Herren Zeit, einen Morgenimbiß zu nehmen; dann trabten sie fort, und das erwähnte Fuhrwerk folgte ihnen auf dem Fuße.
Ich begab mich jetzt zu dem portugiesischen Schiffsführer des einzigen Schiffes, welches im Hafen lag. Er weigerte sich, allem Herkommen zuwider, am ersten Feiertage in See zu gehen, [851] doch überwand ich seine christlichen Bedenken mit der Schilderung der traurigen Folgen, welche sein Zögern haben könnte, vor allen Dingen aber wohl mit dem Inhalt der wohlgespickten Börse, die ich bei mir führte. Er sagte endlich zu und versprach, im Laufe des Tages Alles seeklar machen zu wollen.
Beruhigt kehrte ich in das Haus des Freundes zurück, um mich dem Schlummer hinzugeben. Noch lag ich mit offenen Augen auf einer Feldbettstelle – da trat die schwarze Sclavin herein und flüsterte mir zu:
„Sie werden verfolgt. Draußen im Laden sind Colonisten, welche Sie suchen. Kommen Sie! Ich werde Sie verstecken.“
Ich folgte ihr in eine Waarenkammer, wo ich hinter großen Tonnen eine günstige Deckung fand. Bald erkannte ich die Stimmen meiner Verfolger, welche den Aussagen der Sclavin, daß ich gar nicht hierhergekommen, keinen Glauben schenken wollten und bis in den Raum vordrangen, in welchem ich mich befand. Sie gingen einen Schritt von mir jenseits der Tonnen, hinter welchen ich saß, vorüber und verzogen sich dann. Bald hörte ich draußen Pferdegetrappel, das sich entfernte, und ich verließ mein Versteck. Schlaflos verging mir der Tag, der mir wie eine Ewigkeit erschien, und der Abend zog herauf – der heilige Abend.
Heiliger Abend! Ja, ich will an Dich denken, so lange ich lebe! Es war schon dunkel – und noch keine Nachricht, ob die Familie des Directors gerettet sei oder nicht! Der Schiffsführer kam und meldete, daß Alles bereit sei. Großer Gott, wo blieben die Unglücklichen? Waren sie vielleicht überfallen und ermordet? Ich lief in die Nacht hinaus, und auf dem ersten Berge, den ich erreichte, warf ich mich nieder und legte das Ohr auf den Boden, um besser horchen zu können. Nichts! Nichts! Ueber mir stand der Orion, das freundliche Gestirn, das heute über so viele weihnachtsfrohe Menschen seinen Glanz entsandte, und hier sah es auf ein Menschenkind in unsäglicher Qual.
Ich kehrte an den Hafen zurück. Die Negerin stand vor der Thür; das gute Geschöpf schien an unserm Schicksal herzlichen Antheil zu nehmen.
„Es in schon Mitternacht,“ sagte sie, „oben bei Guimaraes haben eben die Hunde gebellt; wenn sie jetzt nicht kommen, so ist gewiß ein Unglück geschehen.“
Ich seufzte und strengte mein Gehör an. Bei Gott! Das war Pferdegetrappel, welches mit jeder Secunde näher kam. Ich trat in den Schatten des Hauses, um, selbst ungesehen, mich über die Personen der Kommenden vergewissern zu können. Schon von Weitem erkannte ich die Stimme des Directors, und bald hielt er mit seinem Begleiter, einem Soldaten, vor der Thür und stieg ab. In diesem Augenblicke trat die Negerin mit einer Laterne vor das Haus. Welch ein Anblick! Blutend und mit zerfetzten Kleidern standen der Director und sein Begleiter vor mir. Mit wenigen Worten erzählten sie mir, daß kein anderes Mittel zum Entweichen gewesen, als sich quer durch den Urwald, der Richtung des Compasses folgend, Bahn zu brechen, ohne indeß ein Waldmesser zu benutzen, wodurch ihre Fährte zu leicht verrathen worden wäre. Die zahlreichen Urwaldsdornen hätten ihnen die Kleider und die Haut zerfetzt. Ein wohlwollender, diesseits des Waldes wohnender Brasilianer hätte ihnen Pferde gegeben; sonst hätten sie noch gar nicht hier sein können.
„Wo ist meine Frau mit den Kindern?“ fragte der Director. „Sie müssen ja schon lange hier sein, wenn die Colonisten sie durchgelassen haben.“
Ich zuckte die Achseln und entgegnete beruhigend: „Sie werden schon kommen.“
„O Gott, o Gott!“ rief er aus und sank schluchzend in einen Lehnstuhl. Ich sah dem Manne an, daß er bis zum Tode erschöpft war, und wirklich hemmte der Schlaf bald den Lauf seiner Thränen. Als ich ihn schnarchen hörte, ließ ich ihn allein. Der Soldat lag draußen und schlief auch. Ich aber fand keinen Schlaf und lief ruhelos auf dem Camp umher, und Alles, was ich dachte, war – Donna Maria und ihre Kinder!
Es mochte drei Uhr sein – da vernahm ich Wagengerassel und Donna Maria’s ferne Klagerufe: „Mein Mann! Mein unglücklicher Mann! O wenn ich doch wüßte, ob er gerettet ist!“
Da war es mir wirklich weihnachtlich zu Sinn, aber viel schöner noch wie sonst am heiligen Abend, denn so habe ich noch nie bescheert, und unsere Donna Maria ist wohl auch niemals so bescheert worden, wie damals, als ich ihr durch die Nacht zurief:
„Trösten Sie sich! Ihr Mann ist gerettet. Er ist hier.“
Wie jauchzte sie bei dieser Nachricht vor Freuden auf, und mit ihr jubelten die wackern Männer, welche sie sicher hierher geführt hatten.
„Wir haben keine Zeit zu verlieren, Donna Maria!“ sagte ich und geleitete sie in das Haus, wo ich zunächst ihren Mann aus seinem festen Schlafe weckte. Das war ein fröhlich-trauriges Wiedersehen! Ich ließ es aber kaum zu einer Aussprache zwischen den Ehegatten kommen, sondern nahm das jüngste Kind auf den Arm, und mit den Eltern und den andern Kindern schritt ich an Bord. „Vorwärts, Matrosen!“
Schon vergoldeten die ersten Sonnenstrahlen die weite Wasserfläche der Lagoa dos Patos; da lag unser Schiff an dem Ausflusse des Sao Lourenço vor der sogenannten Barre. Es war zu wenig Wasser zum Auslaufen vorhanden, und selbst der Versuch, die Anker auszuwerfen und mit Hülfe der Ankerketten das Schiff über den Sand zu ziehen, förderte uns wenig. Schon sahen wir auf den benachbarten Bergen zahlreiche Reiter, welche dem Hafen zueilten, unsere – Verfolger, da säuselte ein freundlicher Westwind in den breitästigen Figueirabäumen am Ufer und blähte die aufgespannten Segel des Schiffes, das sich endlich in Bewegung setzte. Schnell zogen wir die Anker ein, und nun durchfurchte der Kiel die letzte Sandbank, und wenige Minuten später tanzte das Schiff auf den lustigen Wellen. Meine Hände hatte ich beim Ziehen der Ketten blutig gearbeitet, aber jetzt, da ich das Rettungswerk vollendet sah, war mir dies gleichgültig, und vergnügt brannte ich mir eine Cigarre an. Gegen Abend ankerten wir im Hafen von Rio Grande, von wo aus Schritte zur Bestrafung der Schuldigen eingeleitet wurden.
Jetzt ist über der ganzen Begebenheit schon lange Gras gewachsen; der Director R… schlummert hier auf heimathlicher Erde den letzten Schlaf, und seine Colonie, das Werk seines rastlosen Schaffens, erfreut sich einer gedeihlichen Entwickelung und friedlicher Zustände.
Im Jahre 1868 führte ich ein sehr bewegtes Leben. Gut, daß Einem der Kampf um’s Dasein nicht immer so schwer gemacht wird, wie dies in jener Zeit bei mir der Fall war. Der Weihnachtstag jenes Jahres fand mich fern von Menschen unter einer einsamen Palme lagernd. Meine Gedanken folgten den weißen Wolken, die unter dem tiefblauen Firmamente dahinzogen, und eilten ihnen bis über die Grenzen des sichtbaren Raumes voraus und immer weiter und weiter bis zum fernen Vaterhause, wo vielleicht gerade zu jener Stunde der Tannenbaum angezündet wurde. Ein tiefes, inniges Sehnen überkam mich, und in der Sprache der Heimath sang ich es hinaus in die einsame Fremde, mein Lied vom „Wihnachtsabend in de Frömd“:
Nu brennen to Hus woll de Dannenböm,
Un Allens fret sick un lacht,
Un nachsten, denn hebbens so selige Dröm,
Kinn Jes hett so Jeden bedacht.
Min Mutting allen wakt noch spät in de Nacht,
De Thran ut de Ogen ehr föllt:
„Kinn Jes hett den Enen ja doch nich bedacht;
De is jo so wit in de Welt.“
De Eu, min lew Mutting, de En dat bün ick,
Mi hett dat Kinn Jes nich bedacht;
För mi giw’t ken Lust un ken hüsliches Glück –
För mi giw’t ken heilige Nacht.
Ick sitt so verlaten, so trurig, allen,
Wo de Palmenbom ragt in dat Land,
Wo de Sünnenstrahl gläugt up dat Felsengesten,
Un stütt mi den Kopp in de Hand.
Doa denk ick torüg an de glückliche Tid,
Wo ick ok vör den Dannenbom stahn;
Min Hart ward so weik, min Hart ward so wit,
As füng dat to bläuden mi an.
Doa swewt mi dat Bild von den Kirchenplatz vör,
Von dat Varehus trulich un still.
Sneeschanzen liggen bet dicht vör de Dör,
Un de Flocken, se driben ehr Spill.
Wat kümmert de Snee mi; is’t Hart doch so het,
Un tüht an de Laden mi ran:
In de Laden tor Rechten ein Knastlock ick wet,
Wo nah binnen man rinkiken kann.
[852]
Doa stahn se denn All üm den Dannenbom
Un freuen sick äwer sin Licht,
Un ick – ick stah buten und kik as in’n Drom
In Mutting ehr lewes Gesicht.
Wo lücht’t ehr de Freud’ ut de Ogen so warm,
As se Jeden hett geben fin Del;
Dunn küssen’s ehr All un nehmens in’n Arm
Un seggen, dat wir doch to vel.
Wie Korlbror’ woll an den Clawzimbel geht
Un spelt den schönen Choral,
Dat olle, dat lewliche Wihnachtsled:
„Von’n Hewen hoch kam ick hendal!“
Un as nu dat Vörspill to Enn is gahn
Von de lewliche Melodie,
Dunn stimmen de Annern so fröhlich mit an,
Un ick? – Ick bün nich dorbi –
Ick sitt so verlaten, so trurig, allen,
Wo de Palmenbom ragt in dat Land,
Wo de Sünnenstrahl gläugt up dat Felsengesten,
Un stütt mi den Kopp in de Hand. –
In den nun folgenden Jahren verbrachte ich die Weihnachtsfeste in Porto Alegre, Sao Leopoldo oder auch auf den deutschen Colonien. Dort wird der Tannenbaum in der vollkommensten Weise durch die jungen Stämme der Araucarie ersetzt, und man feiert das schöne Fest ganz in heimathlicher Weise, ja, es hat die liebliche Sitte der Weihnachtsbescheerung und der Christbäume sogar schon bei den Brasilianern Eingang gefunden und gewinnt immer größere Verbreitung.
Traurig allerdings verfloß mir der Weihnachtsabend 1872. Da wurde mir kein brennender Tannenbaum, wohl aber ein brennender Tannenwald bescheert. Ich hatte mich einige Monate zuvor verheirathet und gedachte mit meiner Frau ein recht vergnügtes Fest zu verleben. Wir saßen bei Sonnenuntergang vor der Thür und sprachen von der fernen Heimath – da schlug in meinem unfern gelegenen Araucarienwalde eine helle Feuersgluth empor, und dunkle Rauchwolken wälzten sich in das Thal hinab, in welchem mein Haus lag. Auf die Ausnutzung dieses Waldes hatte ich meine Zukunft gegründet; der Verlust desselben wäre ein harter Schlag für mich gewesen. Ich warf den Rock ab, griff zu Axt und Hacke und eilte fort.
Es brannte glücklicher Weise nur ein kleiner, isolirter Theil des Waldes. Wenn es mir gelang, durch Aufwerfung eines Grabens das Feuer von dem andern Theile abzuschneiden, so konnte ich desselben Herr werden.
Meine Nachbarn waren auch herbeigekommen, und nun wurde mit vereinten Kräften gearbeitet. Oft hüpften die Flammen über die in Folge langer Dürre verdorrten Gräser dahin, und dann galt es, sie so schnell wie möglich mit darauf geworfener Erde zu ersticken. Einige von uns suchten alle brennbaren Stoffe aus der Nähe des Grabens, welchen die Anderen aufwarfen, zu entfernen, und so gelang es uns allmählich, besonders da der Wind umgesprungen war, die Gefahr des Umsichgreifens zu mindern.
Rauchgeschwärzt kehrten wir um Mitternacht nach Hause zurück; es brannte noch immer, aber kaum hatten wir die müden Glieder zur Ruhe gelegt, so vernahmen wir das ferne Grollen des Donners, und die Hoffnung auf ein regenbringendes Gewitter versetzte uns wieder in eine fröhlichere Stimmung. Immer heller zuckten die Blitze, und immer lauter folgte ihnen der Donner, bis er endlich rings in den Felsenkesseln des zerklüfteten Gebirges, in dem wir wohnten, widerhallte. Da schlugen die ersten schweren Tropfen eines warmen Tropenregens an die Fenster, und in Kurzem war kein Feuerschein mehr draußen im Walde zu sehen. Das war unsere Christbescheerung.
Weihnachten 1877 herrschte statt der Dürre eine ungewöhnliche Nässe; der Arroio do Paraizo, ein über zerklüftetes Gestein dahineilender Bach, an welchem mein Haus lag, übertönte mit seinen Wasserfällen unsere eigenen Worte.
Meine Christbescheerung trug ich auf dem Arme; mein blauäugiges Töchterchen war freilich schon vor sieben Monaten auf die Welt gekommen und sah schon ganz verständig in dieselbe hinein; aber da ich die Kleine am Weihnachtsfeste auf dem Arme trug, war es mir, als sei sie mir noch einmal bescheert worden, und meiner Frau ging es gerade so. Wir saßen am offenen Fenster und blickten hinab in den Gischt der Wellen, die sich am Gestein brachen. Die Kleine streckte die Arme aus, als wollte sie die Leuchtkäfer haschen, die am Fenster vorbeiflogen. Wunderbarer Anblick, diese brasilianischen Leuchtkäfer! Sie entwickeln am Kopfe und unter dem Bauche einen so starken phosphorischen Glanz, daß man bei dem Lichte eines einzigen Thieres lesen kann, wenn man dasselbe über das zu lesende Blatt hält. Sie fliegen mit großer Geschwindigkeit und könnten leicht für laternentragende Menschen gehalten werden, wenn sie nicht so zahlreich wären. Auch an jenem Weihnachtsabend schwirrten sie zu Tausenden durch die Luft und hoben sich in ihrem Glanze vortrefflich von dem dunklen Hintergrunde des Urwaldes ab.
„Wir haben keinen Weihnachtsbaum aufgeputzt,“ sagte ich zu meiner Frau, „da wollen wir wenigstens versuchen, ob wir denselben nicht durch Leuchtkäfer ersetzen können.“
Und ich öffnete die Fenster und zündete Licht an, um damit die Thiere anzulocken. Es dauerte auch nicht lange, so flogen einige große, prächtige Nachtfalter in das Zimmer herein, und ebenfalls vom Lichte angezogen, folgten Leuchtkäfer auf Leuchtkäfer, ein herrlicher Anblick! Nun drehte ich die Lampe herunter. Die Augen meines Töchterchens folgten dem glänzenden Fluge der Käfer voll Entzücken, und wenn einer ihr zu nahe am Näschen vorbeisummte, dann streckte sie die Aermchen aus, als wollte sie ihn haschen, bis endlich der Sandmann sich einstellte und der seltsamen Christbescheerung ein Ende machte.
Und nun, nach langen Jahren fällt mein Blick wieder auf eine winterliche Landschaft, die mich an das nahende Weihnachtsfest gemahnt. Zwar haben sich die lieben, treuen Mutterhände, die mir als Kind meinen Weihnachtstisch schmückten und den Tannenbaum anzündeten, lange schon zum letzten Schlaf gefaltet; Schnee bedeckt den Grabhügel, unter welchem die Unvergeßliche schlummert, und in dem epheuumrankten Elternhause am Kirchplatze, wo einst so viele Strahlen der Liebe und des Glückes das Christfest zum schönsten Tage des Jahres machten, wohnen Fremde. O, das thut bitterlich weh!
Dämonen.
Von E. Werber.
(Fortsetzung.)
Als ich mit dem ersten Sonnenstrahle am Hause meiner Großmutter geläutet hatte und die Treppe emporstieg, kam mir mit verstörten Zügen Alphons entgegen und drückte mir die Hand.
„Maurus, wir verlieren unsern Schutzengel – meine Mutter stirbt,“ sagte er.
„O Glück, versinkst Du mir schon?“ rief mein Herz, und ich warf mir vor, die Nacht in Liebesträumen verbracht zu haben. Wie ein Schuldiger kniete ich in Zerknirschung am Bette meiner Großmutter nieder und küßte ihre erkaltende Hand. Sie war bei Bewußtsein, aber die Schwäche erschwerte ihr das Sprechen. [853] Als die Sonne einen Strahl auf das Fenster warf, sagte sie langsam: „Die Sonne kommt – und ich gehe –“ Und dann schloß sie die Augen und öffnete sie nicht wieder. –
Am dritten Tage nach meiner Großmutter Begräbniß ging ich nach Rouen; mir war bange um Theresa.
Als ich in den Flur ihres Hauses trat, kam mir der Geruch von Weihrauch entgegen. Man führte mich in ein Zimmer, in welchem viele Blumen und viele Bücher waren, und Theresa stand in einem schwarzen Kleide bei den Blumen. Sie war sehr blaß. Ich war mit einem großen Muth und einem großen Entschlusse gekommen; dennoch bebte ich, als ich eintrat und sie sah – ihre Gestalt erschien mir edel und schön.
„Guter Herr,“ sagte Theresa traurig und reichte mir die Hand.
„Ich habe immer an Sie gedacht,“ stammelte ich, „aber ich konnte nicht früher kommen; es ist mir ein großes Unglück geschehen – meine Großmutter ist gestorben.“
Sie blickte mich mit heiligem Schrecken an:
„Großer Gott! Sehen Sie nicht, daß ich ganz schwarz gekleidet bin? Man hat meinen Großvater gestern begraben.“ Und sie brach in Schluchzen aus.
„Theresa!“ Ich kniete vor ihr nieder und küßte ihre Hände.
„O – o, stehen Sie auf!“ bat sie sanft, „Sie bringen mich aus aller Fassung.“
Da erhob ich mich, und sie wehrte mir nicht, als ich meinen Arm um sie schlang und sie auf einen Divan zog. Nach einem Schweigen voll innigen Schmerzes sagte ich leise:
„Theresa, wir haben ein gleiches Schicksal –“
Sie nickte, trocknete ihre Thränen und strich sich das schwarze Haar aus der Stirn; dann wollte sie ein wenig von mir wegrücken, aber ich hielt sie um so fester.
„Theresa, bleiben Sie!“ bat ich. „Ich habe ein paar Fragen an Sie zu richten – versprechen Sie mir beim Andenken Ihres Großvaters, mir aufrichtig zu antworten!“
„Ich verspreche es Ihnen,“ sagte sie zitternd.
„Theresa – als Sie mich zum ersten Male sahen, erschraken Sie nicht vor mir?“
Sie blickte mich erstaunt an und sagte: „Nein!“
„Sie empfanden keinen Abscheu?“
„Abscheu?“
„Es zog sich nichts in Ihnen zusammen?“
„Nein!“
„Sie dachten nicht: O, wie entsetzlich!?“
„Nein, nein! Aber warum fragen Sie mich dies?“
„Weil ich weiß, daß ich grauenhaft häßlich bin.“
„Nein, das sind Sie nicht,“ rief sie und setzte leise hinzu: „Aber ich bin es.“
„Theresa, Sie kennen sich nicht. Sie haben lauter falsche Spiegel im Hause. Meine Seele ist der einzige, der Sie so zeigt, wie Sie wirklich sind. Blicken Sie einmal hinein! – O, wenn Sie wüßten, wie mir war, als ich neulich von Ihnen wegging! Draußen vor der Stadt, im Wetterleuchten, brach es wie ein feueriger Strom in mir aus. Und ich sprach zu Ihnen – o Theresa, haben Sie es nicht gehört?“
Sie schauerte in meinen Armen und drückte ihr Gesicht an meine Brust.
„Ich hin noch jung an Jahren, Theresa, beinahe so jung wie Sie, aber in Gedanken bin ich ein Mann. Als ich erfuhr, wie häßlich ich bin – wehren Sie mir nicht, Theresa! – da war ich ganz vernichtet, dann aber fing ich an, die Schönheit zu hassen, und jetzt verachte ich sie. Und da Sie, edles Mädchen, keinen Abscheu vor mir empfinden –“
Sie athmete tief, und sie zitterte.
„Theresa, sagten Sie aus Mitleid oder aus Philosophie, daß Sie keinen Abscheu vor mir empfinden?“
„O, sprechen Sie doch das entsetzliche Wort nicht mehr aus! Sie sind ja nicht häßlich – Sie sind schön.“
Da kam ein himmlischer Rausch über mich – ich wußte jetzt, daß ich geliebt war.
„O Theresa,“ sagte ich mit Inbrunst, „ich liebe Dich. Ich liebe Dich mit der hohen Geistesliebe und mit der süßen Herzensliebe. Wäre ich Deiner doch schon würdig! Wären wir doch schon im stillen Hause am Meeresstrande! So groß und stark und tief und von gewitternder Leidenschaft, wie das Meer, soll unsere Liebe sein. Und wenn neugierige Menschen unsere Einsamkeit stören wollen, dann werden die Meervögel sie verscheuchen mit den großen sturmrauschenden Flügeln. Theresa, es ist ein großer hoher Saal in meinem Hause; seine Fenster gehen auf’s Meer; am Abend scheint eine Glorie von allen Farben in den Saal herein, und das Meer singt große heilige Gesänge. Es sind auch kleinere, lauschige Gemächer in meinem Hause; ihre Fenster gehen auf ein Tannenwäldchen, von wo würziger Duft und süßer Vogelsang herdringen. Und im Garten, Theresa, blühen Veilchen und Flieder und Rosen und Geranien, und die Mauern sind mit Epheu umrankt, wie alte Ruinen, und der ganze Wohnplatz ist mit träumerischem Zauber umsponnen. Theresa, willst Du in jener Einsamkeit mit mir leben – für immer?“
„Für ewig!“
Die edle Theresa zauberte eine wohlthätige Milde in mein Gemüth, und die Poesie ihrer Augen sang alle schmerzlichen Erinnerungen in mir zur Ruhe. Einige Wochen, nachdem ich ihre Liebe gewonnen, that ich die harte Pflicht gegen mich selbst, sie für ein Jahr zu verlassen; ich besaß wohl eine allgemeine höhere Bildung, denn ich hatte viel gelesen und von Alphons über das Wesen und den Geist der Kunst Vieles gelernt, aber ich fühlte den inneren Drang und, der hochgebildeten Theresa gegenüber, die Nothwendigkeit, mir ein positives Wissen anzueignen.
Deshalb ging ich mit Alphons nach Paris, um an der Universität und den anderen geistigen Quellen jener Stadt meine Kenntnisse zu vermehren.
Ich stürzte mich mit Leidenschaft in die Studien. Jeden dritten Tag erhielt ich einen Brief von Theresa und erwiderte ihn sogleich. Ich führte sie in meinen Briefen durch die Straßen von Paris, in die Hörsäle der Universität, in die Concerte und Kunstgallerien, in die Gärten und Wäldchen und auf die Blumen- und Vogelmärkte und – durch mein Herz. Ihre Briefe enthielten nicht so Vielerlei wie die meinigen, aber sie enthielten dennoch mehr, und sie wurden ein leidenschaftliches Bedürfniß für mich.
Alphons, der nie lange an einem Orte bleiben konnte, verließ Paris nach dreimonatlichem Aufenthalte.
„Maurus,“ sagte er, „ich will ein wenig nach Italien hinuntergehen, meine Füße sind ungeduldig.“
„Und Suleika?“ fragte ich lächelnd.
„Ich kann nicht immer in Person bei meiner Frau sein, doch in Gedanken bin ich’s. Ich bin fort und bin nicht fort.“
„Aber wenn Du ihr untreu würdest?“
„Du weißt, daß ich mir keine Frau mehr kaufen kann.“
In der That, Alphons hatte viel mehr von seinem Vermögen verbraucht, als seine Mutter geahnt hatte. Es schwebte schon eine fremde Hand über seinem Hause, und von den übrigen Besitzungen trug keine mehr den Namen Conihoult. Aber dies machte ihm keine Sorgen. „So lange ich noch Mittel habe, so lange will ich genießen,“ sagte er. „Eine vorsichtige, kleine Existenz ist kein Leben. Wenn ich einmal nichts mehr habe, dann werde ich Eremit.“
Es war meinem Auge und meinem Gefühle nicht entgangen, daß Alphons’ Freunde und Bekannte, als sie mich zum ersten Male sahen, vor mir erschraken, und manche unter ihnen konnten auch später noch die Ueberwindung nicht verbergen, zu welcher sie im Gespräche mit mir sich anstrengten. Was jener Maler im Garten meiner Großmutter vorausgesagt, war auch eingetroffen: ich hatte junge Mädchen die Köpfe zu einander stecken und lachen sehen, wenn ich in eine Gesellschaft trat. Ich sah auch, daß ich in manchen Menschen Mitleid erweckte, aber ich bäumte mich vor der Ueberwindung, vor dem Lachen und vor dem Mitleid, und benahm mich mit unsäglichem Stolze und fühlbarer Verachtung. Am allerfühbarsten war meine Verachtung den schönen Menschen und den Kunstwerken gegenüber, welche nur die Schönheit ausdrückten.
Fern von Theresa’s Augen, ihrer sanften Stimme und ihren milden versöhnenden Worten fühlte ich den Zwiespalt wieder in meine Seele schleichen; ich ward düster und hochfahrend, und man fand, ich sei ein unverschämter Mensch, der sein Gesicht wohl verdiene.
Da Alphons’ Bekannte jenen Kreisen angehörten, welche der Schönheit in allen Lebens- und Kunsterscheinungen einen wirklichen [854] und begeisterten Cultus widmen, so fand meine Erbitterung immer neue Nahrung, und nachdem Alphons Paris verlassen hatte, zog ich mich mehr und mehr von der Gesellschaft zurück. Mit einem Menschen jedoch war ich auch dann noch oft zusammen; er zog mich an, weil er das Schöne weniger liebte als das Fremdartige, das Seltsame. Dennoch blieb er in den Kunstsälen manchmal vor Bildern stehen, welche nur die Schönheit zum Gegenstande hatten. Wenn ich ihn dann seiner Abtrünnigkeit wegen schalt, sagte er jedes Mal: „Das Schöne ist eben doch schön.“ Manchmal dachte ich über dieses Wort nach und verglich Theresa mit den jungen Mädchen, die ich sah, und dann sagte ich mir wohl, daß Theresa ohne Kränkung sich nicht neben sie stellen könnte, allein ich sagte mir auch: sie hat mehr, als die Schönheit ist. Ich gäbe sie nicht um Venus selber hin. Und nie schrieb ich ihr innigere Briefe, als nach solchen Stunden.
Aber Venus warf einen Brand in mich, und er zündete.
Nach einem warmen Gewitterregen ging ich eines Tages über den Pont neuf; ich ging langsam in süßen Gedanken an Theresa, die mir geschrieben hatte: „Ich bin eine ganz schlechte Philosophin. Eine Haupttugend des Philosophen, die Geduld, habe ich verloren, und wie ängstlich ich sie auch suche – ich finde sie nicht mehr.“
Ich blickte nach Westen zu den Hügeln hin, die in frischem, starkem Grün unter grauen, mit sanfter Eile hintreibenden Wolken hervortraten. Nach Westen zogen die Wolken, nach Rouen, zu Theresa, zum Hause am Meeresstrande. Der Traum meines Herzens zog mit ihnen und noch weiter; er schlich sich in das einsame Haus, in den hohen Saal und in die lauschigen Gemächer, wo ein süßes, heiliges Glück beim Rauschen der Meeresbrandung in stolzer Verborgenheit selbstgenügend der übrigen Welt vergaß. Da plötzlich ergriff Jemand meinen Arm – es war Roudel, der manchmal sagte: das Schöne ist eben doch schön.
„Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein Bild, ein Portrait. Sie müssen es sehen.“
Er führte mich in ein Atelier, wo nur ein Knabe zugegen war; ein Bild stand auf einer Staffelei in der Mitte des Raumes. Nach einem ersten Blicke auf dieses Bild fühlte ich, wie wenn eine fremde Gewalt über mich käme und sich mit sanftem, wohligem Drucke meines inneren und äußeren Menschen bemächtigte. Ich hörte Roudel sprechen, aber ich verstand nicht, was er sagte; das Bild verschwamm vor meinen Augen in ein rosenrothes pulsirendes Luftmeer, das einer schwarzen Nacht entstieg – ich fühlte die Schläge meines Herzens bis in die Stirn hinauf. „Ich muß mich setzen,“ konnte ich noch sagen, und dann saß ich eine Weile mit geschlossenen Augen und in tödtlicher Angst. Was war mir geschehen?
Es wurde nach und nach wieder klar in mir, aber ich wagte noch immer nicht, die Augen zu öffnen. – Wenn es das Bild war, das diese Wirkung auf mich hervorgebracht hatte?! Aber es konnte ja nicht anders sein. Und doch hatte ich es kaum angesehen. Ich hatte kein anderes Bewußtsein davon, als daß es eine Frauengestalt bis zu den Knieen darstellte und daß die vorherrschende Farbe des Bildes rosenroth war. – Wenn ich es jetzt ansehe – dachte ich – und es hat wieder diese Gewalt über mich, dann bin ich ein verlorener Mensch. Aber vielleicht war ich zu schnell die Treppe hinauf gegangen, vielleicht war es nur das Blut. Ich öffnete die Augen: Roudel stand vor mir und reichte mir ein Glas Wein.
„Nein,“ sagte ich, „keinen Wein! Ich hatte einen Blutandrang nach dem Kopfe – ich habe dies öfters – jetzt aber ist es vorüber und mir ist ganz wohl.“
Ich trat vor das Bild – Alles in mir schwoll, und jener sanfte, wohlige Druck bemächtigte sich meiner wieder, doch nicht bis zur Ohnmacht. Ich konnte stehen und schauen; es blieb mir sogar die Fähigkeit des aufmerksamsten, feinsten Blickes.
O, dieses junge Weib war göttlich schön. Sie stand, als träte sie aus einer rothschwarzen Nacht dem Lichte entgegen. Das feine, weiche Gewand, welches ihr Brust und Hüften eng umschloß, war nicht eigentlich rosenroth, sondern von der Farbe des allerhellsten, des allerzartesten Geraniums; Goldfäden schlangen sich durch das Gewebe und weiße flockige Knötchen. Ihr braunes Haar lag wie eine schlafende Schlange um den Kopf gewunden und war auf dem Scheitel mit einem Dolche von blaßrother Koralle befestigt. Ihre Brauen waren geschwungen wie ausgespannte Schmetterlingsflügel, und von den zart eingesenkten Schläfen führte das rosige Oval der Wangen zu einem feinen, kaum merklich gespaltenen Kinn herab. Der Ausdruck ihrer Züge war der einer heiteren Ruhe. Sie sah mich mit großen stahlblauen Augen an, und ihres Mundes Siegeslächeln sagte: Ich habe Dich!
Ich stand bebend vor dem Bilde, und als Roudel sagte: „Das Original ist noch mächtiger als das Bild,“ da fühlte ich mein Herz schmerzhaft zucken.
„Wer ist sie?“ fragte ich.
„Eine Russin, oder eigentlich eine halbe Tscherkessin – mehr weiß ich nicht.“
„Wo haben Sie dies Weib gesehen?“
„Hier, als sie zu dem Bilde saß.“
„Wie heißt sie?“
„Sie hat einen russischen Namen, den ich vergaß, aber ihren Vornamen vergaß ich nicht; sie heißt: Suhra.“
Ich hielt mit meinen hastigen Fragen inne und sagte leichthin: „Sie muß ein sehr schönes Geschöpf sein – auch das Bild ist schön; ich meine: schön als Malerei.“
„Das ist Alles, was Sie darüber zu sagen wissen?“
„Alles!“ erwiderte ich, das Atelier verlassend.
„Sie sind ein Barbar,“ rief mir Roudel nach, als ich, um allein zu sein, eiligst davonging.
Ich hatte in tiefster Seele die Ueberzeugung, daß ein Wetterstrahl in mein Leben gefahren war. „Ich bin verloren,“ rief ich. „O Theresa, Stern des Friedens, gehe mir nicht unter!“ –
Es zog mich zu dem Bilde mit dämonischer Gewalt, und ich floh es mit der Angst, mit welcher glückliche Menschen den Tod fliehen. Ich floh das Haus und die Straße, wo es war; ich floh Paris – ich floh zu Theresa.
„Theresa, ich habe Fieber und Angstträume – laß mich bei Dir gesund werden!“ sagte ich und sank in ihre Arme.
Und als ich in ihren Armen lag, bemächtigte sich meiner eine verrätherische Empfindung: Ich war unendlich selig, denn ich fühlte Theresa’s Herz an meinem klopfen und bildete mir ein, sie habe Suhra’s Gesicht.
„O Uebermaß von Glück! O selige, allerseligste Liebe!“ stammelte ich und bedeckte geschlossenen Auges ihr Angesicht mit Küssen.
„O Maurus,“ hauchte sie und entzog sich mir, und ihr Haupt sank auf den Nacken. Da schaute ich sie an, und obgleich ihr Gesicht von Liebe beseelt war, zog sich alles Feuer von meinen Lippen zurück – es preßte mir etwas das Herz zusammen – ich erwachte wie aus einem Rausche.
Ich führte sie zu einem Stuhle und setzte mich neben sie; meine Hand erkaltete in der ihren – ich blickte in’s Leere und wünschte mir den Tod.
„Maurus, Du bist krank, ernstlich krank,“ sagte sie.
Und ich, der gekommen war, um lange bei ihr zu bleiben und mich von ihr heilen zu lassen, ich erwiderte:
„Nein, Theresa, ich hatte nur in den letzten Tagen ein wenig Fieber. Aber es ist mir schon besser, da ich Dich gesehen habe, und ich werde morgen nach Paris zurückgehen und meine Studien fortsetzen können.“
„Morgen? O, das ist zu bald.“ Und sie umschlang mich. O reines Herz von Liebe – dachte ich – eher als Dir wehe thun, will ich Dich belügen, süß belügen. Und ich schloß die Augen und träumte, ich hielte Suhra in meinen Armen, und ich küßte in Wirklichkeit Theresa und sprach Worte süßer Leidenschaft zu ihr. Mein Gewissen klagte mich an, mein Herz sprach mich frei, und im Zwiespalt meiner Gefühle fand ich Wonne und Qual. Als es dunkel ward, holte Theresa Licht und führte mich in das Zimmer, wo die Bücher standen.
„Was machen Deine Philosophen?“ fragte ich sie.
„Meine Philosophen? Ach, ich glaube, sie sind sehr unzufrieden mit mir. Sie haben auch Recht; ich lasse sie hier im Staube verkommen. Neulich, als ich einen herausnahm – es war Montesquieu – schämte ich mich des Staubes, der auf ihm lag, und als ich eine Weile darin gelesen hatte, schlug sich das Buch wie von selber zu, und in mir sagte es: Ach, Deine Gedanken sind ja ganz wo anders, verliebte Thörin!“
Mir drangen diese Worte in’s Herz , und ich drückte einen Kuß auf Theresa’s reine Stirn. Dann lasen wir und tauschten [855] ernste und hohe Gedanken aus, und ich bewunderte Theresa’s klaren Geist und ihre feine Empfindung. – Es war spät, als sie mich in das Zimmer führte, in welchem ich schlafen sollte, und als sie mir sagte: „Maurus, schlafe wohl! Und wenn Du Dich in der Nacht unwohl fühlen solltest, so klopfe an der Wand! Ich werde es hören; ich schlafe neben Dir“ – da schloß ich sie mit einer hohen Empfindung in die Arme und dachte: Ich schlafe neben meinem Schutzgeist! –
Aber als ich am nächsten Tage Theresa verließ, nahm ich die Ueberzeugung mit mir, daß ich sie verehrte wie ein reineres, besseres Wesen, aber sie nicht liebte. – Und mit jeder Minute, die mich mehr von ihr entfernte, wuchs meine Angst vor dem, was nun kommen würde. Als ich dann in meine Wohnung in Paris trat, fand ich auf meinem Schreibtische einen Brief von Roudel, und es stand darin: „Ich hole Sie heute Abend zu einem Besuche bei der Tscherkessin ab. Erwarten Sie mich um neun Uhr!“
Ich sank auf einen Stuhl; ich zitterte am Körper und in der Seele. – Nach und nach ward ich ruhiger; ich sagte mir, daß das wirkliche Wesen vielleicht einen ganz andern Eindruck auf mich machen werde, als das Bild, und daß ich von meinem Fieber vielleicht durch Suhra selbst geheilt würde. Ja, sagte ich mir, ich werde hingehen; ich werde gegen diese geheimnißvolle Gewalt kämpfen und vielleicht siege ich. – Diese drei „Vielleicht“ klangen mir, wie von höhnischer Stimme gesprochen, in der Seele nach. –
Es waren viele Menschen in Suhra’s Zimmern versammelt, und ich kannte die meisten; es waren Alphonsens Freunde und Bekannte, von welchen ich mich seit Monaten zurückgezogen hatte. Sie begrüßten mich mit Erstaunen und Kühlheit.
Nach einigen peinlichen Momenten hörte ich aus einem Nebensalon ein helles, vibrirendes Lachen und fühlte, daß diese Stimme Suhra’s Stimme war. Als ich eben von Jemandem angeredet wurde, trat Suhra plötzlich unter die Thür. Sie stand dort wie auf dem Bilde, aber hundertmal schöner, hundertmal mächtiger. Ich weiß nicht, ob sie vor meinem Gesichte erschrak, als ich ihr vorgestellt wurde, denn ich hatte die Augen vor ihr niedergeschlagen; ich erinnere mich auch nicht, was sie zu mir sprach und was ich ihr erwiderte oder ob ich überhaupt zu ihr sprach. Aber als ich dann endlich zu ihr aufblickte, ruhten ihre großen stahlblauen Augen auf mir, und ihres Mundes Siegeslächeln sagte: Ich habe Dich.
Ich stand vor ihr, wie ein Streiter mit zerbrochener Waffe vor seinem Sieger steht.
Einen ganz genauen Eindruck ihrer Person erhielt ich indeß an jenem Abend nicht; ich war in einem Zustande solcher Erregtheit, daß sich Alles vor meinen Augen verwirrte. Wenn sie in meine Nähe kam, fühlte ich etwas wie einen magnetischen Strom von ihr zu mir herüber gehen, und als sie sich einen Augenblick neben mich setzte und ich aufstehen wollte, hatte ich nicht die Kraft dazu. Ich wandte mein Gesicht ab, damit sie mich nicht ansprechen solle; sie that es auch nicht, aber sie wehte mir mit ihrem Fächer einen starken, fremden Wohlgeruch zu. Wohl fühlte ich, daß zwischen ihr und mir etwas Besonderes bestand; war es nur der furchtbare Gegensatz meiner Häßlichkeit zu ihrer Schönheit, oder war es mehr? Ich vermochte nicht, es zu unterscheiden, allein sie hatte sich absichtlich neben mich gesetzt – dessen war ich mir bewußt. Als sie dann aufgestanden war und sich unter die Gäste gemischt hatte, verließ ich den Saal und das Haus. Ich lief – ich wußte nicht durch welche Straßen – ich lief, bis der Tag anbrach; da sah ich, daß ich bis über Vincennes hinaus gegangen war. Ich legte mich erschöpft in’s feuchte Gras. Jetzt, jetzt ist sie da, die Liebe – ich fühlte es und sagte mir, daß ich an ihr zu Grunde gehen werde. Und als die Sonne am Horizont aufflammte, rief ich laut und mit ekstatischem Verlangen: „Suhra!“
Ja, sie war da, die Liebe, die Leidenschaft, und ich kämpfte nicht mehr dagegen. Ich suchte jetzt jene Bekannten wieder auf, die ich seit Monaten gänzlich gemieden hatte; ich that es, um Suhra so oft wie möglich zu begegnen. Jedesmal, wenn ich sie sah, hatte sie für mich jenes Siegeslächeln, und wenn sie mit Anderen sprach, suchte ihr Blick mich. Jedesmal kam sie mir möglichst nahe und wehte mir mit dem Fächer jenen fremden Wohlgeruch entgegen; sie sprach nicht zu mir, aber ihre blauen, etwas kühlen Augen waren zuweilen von Blitzen durchzuckt, die ihrem Blicke etwas Aufforderndes gaben. Ich sagte mir wohl, daß sie unmöglich ein anderes Interesse an mir haben könne, als das der Eitelkeit; sie hatte natürlich durchschaut, daß meine Leidenschaft für sie eine ungewöhnliche, eine rettungslose war.
O Theresa, Stern des Friedens! Versinkst Du?
An einem warmen Märztage ging ich in’s Wäldchen von Boulogne und setzte mich in einem einsamen Seitenwege. Ich hatte einen Brief an Theresa geschrieben, der mich viele Mühe kostete, denn ich wagte nicht, ihr wehe zu thun, und vermochte doch nicht Gefühle auszudrücken, die ich nicht empfand. Der quälende Druck auf meinem Herzen löste sich allmählich, nachdem ich mich im Tannengebüsch gesetzt hatte. Zuweilen drang gedämpft der rollende Ton der Wagen von den Fahrwegen zu mir; die Schatten der Tannen schwankten sanft auf dem sonnigen Boden, und ich versank in eine Stimmung, wie man sie bei großer Müdigkeit vor dem Einschlafen hat.
Da hörte ich das Rauschen eines seidenen Gewandes und ein starker Wohlgeruch wehte mir zu; als ich aufblickte – trat Suhra zu mir, setzte sich neben mich und sagte sogleich:
„Darf ich heute mit Ihnen sprechen?“
Es zitterte Alles in mir; ich rang nach Fassung und nach Worten und stammelte endlich:
„Ich erinnere mich nicht, jemals absichtlich dieser Ehre mich entzogen zu haben.“
„Sie sind nicht aufrichtig. Können Sie mich mit gutem Gewissen ansehen?“
Der Klang ihrer Stimme war bei dieser Frage gedämpft und zutraulich und verlieh mir den Muth, ihr in’s Auge zu blicken.
O hätte ich es nimmermehr gethan! Der dunkelblaue Schimmer, kühl und heiß, schalkhaft und gebietend, frei und geheimnißvoll, überwältigte mich, und stöhnend schlug ich den Blick zu Boden.
Da sagte sie in tiefem, leisem Tone:
„Gleich am Abend, da ich Sie zum ersten Male sah, in meinem eigenen Hause, wandten Sie das Gesicht ab, als ich mich neben Sie setzte. – Mißfalle ich Ihnen denn so sehr?“
„Diese Frage ist grausam,“ stieß ich hervor. „Hat man Ihnen noch nicht gesagt, wie schön Sie sind?“
„Viel zu oft! Von Ihnen möchte ich Anderes hören – ich fühle mich eigenthümlich zu Ihnen hingezogen. Sie sind kein Schönredner; Sie sind stolz, und ich glaube, Sie können hassen – das gefällt mir. So sind die Männer im Lande meiner Mutter, im Lande der Tscherkessen: stark! Ich liebe die Stärke – was lieben Sie?“
Bethörend wie Musik war der Ton, mit dem sie fragte, und er riß mich zu dem Worte hin: „Warum fragen Sie? Sie wissen es ja.“
Es entstand eine Pause, in welcher ich das Gefühl eines Verbrechers hatte, der sein Urtheil erwartet. Das Urtheil kam, und es war süß und verderblich.
Eine sammetweiche Hand legte sich sanft auf die meine, und als ich zuckte, sagte Suhra:
„Ich denke viel an Sie – Maurus!“
Die Sinne schwanden mir beinahe. „Sie?“ hauchte ich.
„Ja. Ich weiß vieles von Ihnen – ich habe Ihre Bekannten ausgefragt, und sie haben mir Alles gesagt.“
Erschrocken fragte ich: „Was verstehen Sie unter ,Alles’?“
„Sie haben eine Braut – wann werden Sie sich mit ihr vermählen?“
„O seien Sie schonungsvoll!“ bat ich und senkte meinen Kopf auf die Brust.
Theresa – wenn Du mich jetzt sähest neben diesem schönen Weibe, die Untreue auf den Lippen und den Gewissensbiß in der Seele! –
Da sagte Suhra:
„Wenn Sie nur glücklich werden! Ich glaube nicht recht an das Glück der Ehe –“
„Warum glauben Sie nicht daran?“
„Weil das Glück kurz ist und die Ehe lang.“
Diese Antwort überraschte mich.
„Sie dachten noch nie daran?“ fragte sie lächelnd und fügte, in ihrem Pelzmantel schauernd, hinzu:
„Mich friert. Kommen Sie, führen Sie mich! Ich will ein wenig gehen.“ [856] Und sie legte ihren Arm in den meinen, sehr sanft, sehr zart, und doch war mir, als ergriffe mich ein heißer Sturm. Ich wünschte, es möchte ein Wunder geschehen, das Wäldchen möchte sich plötzlich in ein wildes Thal im Kaukasus verwandeln oder in eine Oase der Sahara.
„Gehen wir schnell! Ich liebe das,“ sagte sie, „und erzählen Sie mir von Ihrer Braut!“
„Verzeihung – ich kann es nicht.“
„Ist sie schön?“
Da sagte ich bitter:
„Wie könnte ich eine schöne Braut haben?!“
„Warum nicht?“
„Schöne Frau, es hat einmal Einer gesagt, ich hätte ein Gesicht wie ein unglücklicher Affe.“
„Und Sie glauben, was oberflächliche Menschen sagen? Ihr Gesicht ist unbeschreiblich interessant; es hat eine magische Anziehungskraft – eine fesselnde Gewalt. Wenn Sie zugegen sind, muß ich stets nach Ihnen sehen, und wenn Sie abwesend sind –“
Es wurde mir schwül – leise fragte ich: „Und wenn ich abwesend bin?“
„Dann sehe ich nur Sie.“
Da stand ich stille und legte meine Hand auf die ihre: „Suhra, wissen Sie, was Sie sagen?“
„Ja.“
„Suhra!“ rief ich mit verhaltener Gluth. „Hier will ich Ihnen nicht ein Bekenntniß thun, das nicht weiter hallen soll, als in Ihr Herz. Aber ich kann jetzt auch von nichts Anderem mit Ihnen sprechen. Erlauben Sie, daß ich Sie zu Ihrem Wagen bringe. Heute Abend werde ich kommen. Haben Sie schon eine Wüste gesehen? Eine Wüste, über welcher die Feuergenien langsam den Sonnenball dahinrollen und wo die Sonnenstrahlen in den Boden hineinwachsen? Eine Wüste, die ungeheure Träume und glühende Stürme hat? Eine solche Wüste bin ich, Suhra. Seien Sie groß und gütig gegen mich!“
Sie blickte vor sich nieder und sagte leise: „In der Wüste will ich wohnen.“
Dann geleitete ich sie stumm zu ihrem Wagen; als er davon gerollt war, ging ich zur Stadt zurück, Wonne und Ungeduld in der überraschten, überwältigten Seele.
Vernünftige Gedanken einer Hausmutter.
Ein altes wahres Wort sagt: „Es giebt der Dichter gar viele, die niemals einen Vers geschrieben haben.“ – Ja, es giebt dieser unbewußten „Dichter“ gar viele in jedem Lebenskreise; sie reimen nicht, aber sie drücken den Stempel ihres „Dichterthums“ ihrer ganzen Umgebung auf. Das Leben wird anders aufgefaßt, Freud’ und Leid wird ganz anders getragen in einem Hause, wo, nach den Worten Anastasius Grün’s, noch:
„Wallt auf Erden
Die Göttin Poesie“
und wo:
„Mit ihr wandelt fröhlich[WS 1],
Wem sie die Weihe lieh. –“
Trittst du in ein fremdes Haus, so wirst du es schon in der ersten Stunde empfinden, beim ersten Willkommen hören, beim ersten Blicke sehen, ob in diesen Räumen „Einer“ wandelt, dem die Göttin „die Weihe lieh“. – Nicht gleich aber wirst du zu erkennen vermögen, welcher der Hausbewohner der Gottbegnadete ist; dazu bedarf es schon längeren Studiums. Vielleicht ist es der Vater, trotz seines grauen Strubelkopfes und der spießbürgerlichen „Pfeife“, die er raucht; oder es ist die Mutter, die einzig von kleinen Kindern und häuslichen Angelegenheiten zu sprechen weiß – laß dich dadurch nicht irre machen – sie kann es dennoch sein! Ist’s aber keines von den Eltern, dann ist es vielleicht jener Knabe mit den tiefen, glänzenden Augensternen, oder das halb schon zur Jungfrau erblühte Mädchen dort, die unter deinen Blicken die Augen schnell auf die feine Handarbeit senkt – ja, sogar die alte Magd, die dir soeben den Imbiß credenzt, kann jene still verborgene Dichternatur sein, die du im Hause ahnest, aber vergeblich heraus zu finden strebst.
Beim Fortgehen wirfst du vielleicht zufällig einen Blick durch die offen stehende Thür in die Kammer der Magd und bemerkst, wie das Fenster dicht umrahmt ist von wohlgepflegtem Epheu; auf dem Sims steht ein mächtiger Strauß Feldblumen – die „alte Marie“ hat ihn vom letzten Sonntagsausgang mit heim gebracht. Eine schneeweiße Decke ist über den kleinen Tisch am Fenster gebreitet. An der Wand darüber hängt eine alte, verblichene Photographie; ob sie des Mädchens Vater, Bruder, oder den ungetreuen Liebsten vorstellt – gleichviel, der zarte, wunderniedliche Kranz von rothen Steinnelken und blauen Vergißmeinnicht, der das Bild umrahmt, die sorgfältig gehaltenen alten Bücher auf der Commode, die gepreßten Blumen in der aufgeschlagenen Bibel, all das ist – Poesie!
Die alte Magd mit der spiegelblanken breiten Leinwandschürze und dem glattgescheitelten grauen Haar, die seit zwanzig Jahren in gleich stiller Emsigkeit dem Hause dient, ist seine gute Fee; sie ist eine von jenen Dichterinnen, die nie einen Vers geschrieben, ja kaum jemals einen gelesen haben, und doch stammt von ihr die poetische Weihe des Hauses – verlaß dich darauf! –
Auch von außen, von fern her kann jener süße, heilige Zauber der Poesie wirken. Der Sohn, der nur einmal des Jahres „in die Ferien“ kommt, kann binnen dieser sechs Wochen das Elternhaus für’s ganze Jahr mit solchem Zauber weihen; eine ferne Mutter oder Schwester kann es durch ihre Briefe thun, ein lieber Freund durch häufigen Verkehr im Hause. Wo du höhern Gedankenschwung triffst, und ideale Auffassung des Lebens, da forsche nur nach – ein Jünger der Poesie wird nicht fern sein.
Schon oft habe ich darüber nachgesonnen, was Poesie denn eigentlich sei, und konnte keine genügende Definition dafür finden. Ich möchte sagen: „Die Poesie liegt nicht in den Dingen selber, sondern in der Art, wie wir sie ansehen.“ Sowie nach jenem schönen Spruche „dem Reinen Alles rein“, ist dem wahren, echten Poeten Alles poetisch. Er denkt in Bildern und sieht nur lauter abgeschlossene einzelne „Bilder“ um sich her. Was nun in eines dieser Gemälde nicht passen will, das sucht er aus dem Rahmen zu entfernen, oder er rückt den unliebsamen Gegenstand möglichst in den Schatten, bis er sich sein „Bild“ nach seiner Weise zurechtgelegt hat, dann erst beschaut er es befriedigt. Man möchte behaupten: der Poet hat einen Sinn mehr als die übrigen Menschen, und dieser sechste Sinn wird ebenso empfindlich beleidigt durch die Formlosigkeiten des Lebens, wie das Gehör durch einen Mißton, das Auge durch häßliche Farbenzusammenstellung oder der Geschmack durch bittere Speisen. Es ist also nur reiner Egoismus, wenn der Poet mit ängstlicher Hast die Widersprüche des Lebens zu versöhnen, dessen Disharmonien umzustimmen trachtet, wenn er nicht ruht und rastet, bis er auch dem Allergewöhnlichsten eine poetische Seite abgewonnen hat, um es ohne Schmerz oder Widerwillen betrachten zu können. Ist der Poet ein Mann des Wortes, so wird er dieses Streben in dichterischen Schöpfungen verkörpern. Für viele Andere bietet die Umgebung des täglichen Lebens das Material, um sich zu äußern.
Selbstverständlich findet man die meisten für Poesie begeisterten Menschen in den höheren Lebenskreisen, wo der Geist schon früh mit den besten Producten unserer Dichter und Schriftsteller bekannt gemacht, wo feines Gefühl sorgfältig gepflegt und der Mensch zu höheren Zwecken herangebildet und erzogen wird. Da bedarf es nur einer geringen natürlichen Anlage, um diese herrliche Gottesgabe, diesen „sechsten Sinn“ auszubilden. Wir finden ferner die meiste Poesie auch selbstredend im Jugendalter, in den Jahren des Drängens und Stürmens, in der Periode der Ideale und der ersten Liebesregungen. Wer bei guter Erziehung, im Alter von sechszehn bis vierundzwanzig Jahren keinen Vers geschrieben oder für keinen Dichter „geschwärmt“ hat, muß schon fast beschränkten Geistes genannt werden.
[857]
[858] Dieses zeitweilige Auflodern schöner Empfindungen aber ist es nicht, was ich meine. Wer die echte Weihe der Göttin empfangen hat, der folgt ihrer Spur mit gleicher Treue nach, bis hinauf in’s höchste Alter, der bleibt ihr unwandelbar ergeben, auch in den drückendsten, erbärmlichsten Lebenslagen, für den giebt es eben absolut keine – Prosa in dieser Welt; er sieht sie nicht, er fühlt sie nicht, oder nur auf Augenblicke; er weiß immer und überall noch ein Blümchen zu finden, und sollte er es unterm Schnee hervorgraben; er sieht einen Stern leuchten selbst in der dunkelsten Nacht, und durch diese herrliche Gottesgabe gestärkt, geht er mit unverwüstlich heiterem Muthe durch’s Leben.
Vor uns liegt ein altes Notizbuch aus der Jugendzeit; darin steht ein Auszug, mit dem Namen „W. Nade“ gezeichnet, der solch eine Natur schildert:
„Ja, quäle Dich einmal bei Tag und Nacht,“ heißt es da; „ängstige Dich unaufhörlich, schau mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit, mit heißem Kummer in die Augen, die Dir lieb sind, und empfange nichts dafür als gleichgültige Worte, mißmuthige Reden, launischen, hastigen Tadel um Nichts, oder vielmehr – für Deine Güte und Liebe; lächle mit den Lippen und weine in Kopf und Herzen heimlich die bittersten Thränen – und habe das alles und siege dennoch! Geh’ aus dem Kampfe hervor und sage, er sei Dir leicht geworden! O ja, ich weiß es wohl, daß es Menschen giebt, deren Sinn so einzig hoch und klar ist, daß sie über alles Erdenleid gleichsam nur lächelnd hinweg schweben. In alten Sagen erzählt man sich von einem wunderbaren blauen Vogel, der von Zeit zu Zeit des Nordens Wälder besuchen und mit zauberhaftem Gesang erfüllen soll. So selten wie jener Vogel ist solch ein Gemüth, und wo es erscheint, da starrt man es verdummt an und begreift es nimmer, und nennt die Elasticität des Geistes – Leichtsinn. Ich hatte etwas an mir von solch einem blauen Vogel, aber Leichtsinn war es nicht.“[WS 2]
Ja sicherlich, Leichtsinn ist es nicht, wenn eine Mutter am Bettchen des todtkranken Kindes liebliche Märchen erzählt, daß unter dem sanften Klang ihrer Worte das dunkle Krankenzimmer zum hohen Königsschlosse wird, oder zum rauschenden Eichenwald – Leichtsinn ist es nicht, wenn sie bei allem Herzeleid ein lustig Liedlein singt, leiser und immer leiser, bis die müden brennenden Augen des Kindes sich langsam schließen, während noch ein halbes Lächeln auf den zuckenden Lippen liegt.
„Wie kannst Du erzählen und singen, armes Weib, als wäre rings um Dich nur Glück und Sonnenschein?“ möchte man da fragen.
Und wenige Wochen später, da ist’s Ostern geworden, und die Brüder des kleinen Mädchens, welches genesen, mit glücklichem Ausdruck in dem noch etwas bleichen Gesichtchen, auf der Mutter Schooß harrend am Fenster sitzt, können jeden Augenblick „in die Ferien“ eintreffen.
Mitten in der Stube steht ein weißgedeckter Tisch, darauf liegt für den ältesten der heimkehrenden Schüler ein neuer schwarzer Anzug und ein Gesangbuch, auf dessen erster Seite die Mutter die Nummern ihrer Lieblingslieder verzeichnet hat, daneben die alte silberne Uhr, das Andenken an den verstorbenen Gatten, das sie so treu gehütet hat bis zu dieser Stunde. Frische Blumen zieren die mit so viel Liebe aufgebaute Bescheerung für den Confirmanden. Damit aber sein jüngerer Bruder nicht zu kurz kommt, hat für ihn am anderen Ende des Tisches ein schon längst ersehntes Lesebuch und ein neuer Strohhut Platz gefunden.
Der Tisch am Fenster ist schon gedeckt zum Abendbrod. Auf den Tellern der Söhne prangen bunte Serviettenbänder, die klein Lisbeth unter der Mutter Anleitung in großen Stichen ausgenäht hat, und unter der Gabe des Schwesterchens verborgen, ruht das willkommene Geldgeschenk des fernen Pathen. Nicht gleich soll es der Bruder finden, es muß noch eine Ueberraschung dabei geben. Draußen in der Küche stehen in verdeckter Schüssel die bunten Eier, die „Mutter“ noch spät am Abend draußen im Gärtchen verstecken wird, und welche die Kinder dann früh am Ostermorgen suchen sollen.
„Horch, Lisbeth!“ – wieder ein Schritt auf dem Pflaster. „Ach, sie sind’s noch immer nicht!“ Es ist nur die Nachbarin, die einen kurzen Besuch machen will. Erstaunt sieht sie die Vorbereitungen im Wohnzimmer und ruft lachend:
„Nun, das sollte mir doch nicht beikommen, so viel Umstände um eine Confirmation! Meine Grethe wird auch mit eingesegnet, die hat ihr Pathengeschenk schon vorige Woche bekommen. Aber um ihr Kleid sorge ich mich recht; die Schneiderin hat es noch immer nicht fertig. Ach, was das für ein Elend ist mit so viel Kindern, und der Trubel, das Lärmen, wenn sie alle zu Hause sind! Ich danke meinem Schöpfer allemal, wenn die Ferienzeit erst wieder vorüber ist.“
Die so spricht, ist eine recht brave, tüchtige Hausfrau; sie hat auch ihre Kinder so lieb wie die Freundin die ihrigen, aber wenn eines krank ist, dann geht sie den ganzen Tag mit verweinten Augen herum und hört nicht auf, die Hände zu ringen und laut zu jammern. Es ist eine brave – eine gute, rechtschaffene Frau, aber vom „sechsten Sinne“ hat sie keine Spur geerbt, wie die harrende Mutter, welche nicht anders kann, als um Leid wie Freude den versöhnenden und verklärenden Schimmer der Poesie zu weben.
Während Solches daheim vor sich geht, nähern sich die erwarteten Söhne auf ihrer Wanderung immer mehr der Heimath. Jetzt ist die letzte Anhöhe erreicht, und weit unten in der Ebene sieht man, inmitten hoher Obstbäume, das heimathliche Dorf liegen. Der Himmel ist von schweren Wolken bedeckt, die ein heftiger Aprilwind hin und her peitscht. Jetzt theilen sie sich und grell schießt ein Sonnenblick herab zur Erde.
„Bruder, sieh nur, sieh!“ ruft der Aeltere.
„Was denn?“ fragt ruhig der Jüngere. „Die Wolken ziehen vorüber, wir kommen schon noch ohne Regen bis nach Hause.“
„Aber siehst Du denn nicht das wundervolle Bild?“ fragt sein Bruder erregt. „Sieh nur hinab: Alles dunkel rings um uns her, und nur das liebe Vaterhaus allein in hellstem Sonnenglanze! – So soll es sein, so soll es bleiben,“ fährt der Jüngling dann träumerisch fort, „mag auch die ganze Welt umwölkt und dunkel sein, nur für dieses Haus spare mir stets einen Sonnenstrahl auf, barmherziger Himmel – dann will ich zufrieden sein.“
So verschieden sehen verschiedene Naturen das gleiche Bild! Dieser ältere Sohn, was ist er anders, als ein Poet?
Immer bleibt es vor Allem Frauenaufgabe, die Poesie im Hauskleid zu hegen und zu pflegen nach besten Kräften. Dem Manne kann wohl draußen im Kampf mit so viel Widerwärtigkeiten der Sinn dafür verkümmern, aber die Frau muß, wenn ihr anders die poetische Anlage nicht ganz versagt ist, gleich der Vestalin des Alterthums, die göttliche Flamme hüten. Oft – ich will es gern zugeben – glimmt sie nur noch schwach unter den Schlacken von Müh und Sorgen, von Kummer und Aerger, aber es kommen schon auch wieder Tage, die ihr neue Nahrung bringen; es streicht schon auch wieder ein frischer Luftzug durch’s Haus, der sie zu heller Flamme anfacht, wenn nur treu und unermüdlich die glimmenden Funken gehütet wurden.
Der Abend war herabgesunken; die große Stadt hatte ihre tausend Lichter angezündet und strahlte in hellem Glanze.
Wie die Menge geschäftig durch einander wogte! Wie eilig sie es hatten, die winterlich gekleideten Leute auf allen Gassen! Es war ja Weihnachtsabend; die Liebe regierte; die Freude flog von Haus zu Haus; sie küßte die kleinen und großen Menschenkinder – und auf allen Wangen blühten ihre Rosen.
Ein hoher ernster Mann tritt in eine glänzende Passage. Sein Fuß stößt an; er bückt sich; da, etwas in das Dunkel gerückt, sitzt auf einem Schemel ein altes Mütterchen; sie streckt ihm bittend die welke Hand entgegen. Was spricht zu ihm aus diesem milden todesbleichen Angesicht? Nur langsam schreitet er weiter; mit unwiderstehlicher Gewalt zwingt es ihn, sich umzusehen. Und seltsam, die Alte beugt sich weit vor und winkt ihm lächelnd zu. Er schreitet weiter, weiter – verloren in das bunte gestaltenreiche Weihnachtsgedränge.
Weihnacht! – welch ein Zauber in dem einen Wort! Die Gegenwart versinkt ihm; die Vergangenheit öffnet ihr Grab, und mit unabweisbarer Gewalt drängt sich die Erinnerung an längst Vergessenes ihm auf.
War das eine glückliche Jugend!
Er war der einzige Sohn liebevoller Eltern; der Vater starb früh,
[859] und der Mutter Herz schlug von da an nur für ihn. O, er wußte es wohl, und heute stand es wieder lebhaft vor seiner Seele: sie liebte ihn über Alles – sie liebte ihn wohl nur zu sehr. Und wie die Mutter, so hatten ihn Alle lieb, die ihn sahen, die auf der Lebensbahn eine Weile neben ihm hingingen. Und nun, nachdem so lange Jahre vergangen, nun in der festlichen Stimmung des Weihnachtsabends sah er im Geiste sein eigenes Bild aus jenen Tagen sonnigen Jugendglückes vor sich: die schlanke, elastische Gestalt, an der jedes Glied, jede Bewegung von selbstgewisser Kraft und thatenfreudiger Männlichkeit sprach, die helle und doch so kräftige Stimme, die ihm jedes Herz gewann, die hohe Stirn, die ein Wald von dunklen Locken umrahmte, und auf dieser Stirn ein Zug – „ein Zug stolzen Trotzes“, sagte die Welt. Aber es war mehr gewesen als Trotz, was auf dieser Stirn stand und das Schicksal seines Lebens geworden – heute verhehlte er es sich nicht mehr: ein brennender Durst war es gewesen, groß zu sein in der Welt und ihre Schätze zu gewinnen – Genußsucht, Eitelkeit, Ehrgeiz.
Das Leben lag vor ihm, so schön geschmückt; er vor Allen war geladen, an der reichbesetzten Tafel Platz zu nehmen, und mit rücksichtsloser Begehrlichkeit durchbrach er die Schranken der gegebenen Verhältnisse.
So hatte er in seiner Heimath eine zeitlang hingelebt – neben der Mutter, die ihn mit Entzücken geistig und körperlich wachsen und reifen sah. Mit ahnender Mutterliebe blickte sie in die Zukunft und schloß die Augen, geblendet von den glänzenden Bildern, die sich ihr im Leben des geliebten Sohnes enthüllten. Konnte sie ihm versagen, was er auch immer verlangt? Unmöglich! Und was er verlangte, das war viel, unendlich viel – Alles.
Und dann kam ein Tag – er zog hinaus in die Welt, die ihn so unwiderstehlich lockte, und ließ die Mutter zurück, hülflos und verlassen, arm und gebeugt von der Jahre Last.
Ihm aber blieb jenseits des Oceans das Glück getreu. Sein Blick hing unverwandt an den schönen Augen jener Göttin, die nicht nach Recht und Gerechtigkeit, nur nach Gunst und Laune ihre Gaben spendet, und die Erinnerung an die Heimath, an die Mutter starb allmählich. –
Seine persönlichen Vorzüge und Talente bahnten ihm überall den Weg, und schnell gelang es ihm, eine glänzende Stellung zu erringen. Genießen, in vollen Zügen genießen, das hieß bei ihm leben, und im grenzenlosen Leichtsinn verpflichtete er sich auf lange Jahre hinaus, nicht nach Europa zurückzukehren. Wohl zog zuweilen durch seine Träume die Erinnerung an die Heimath und rührte sein Herz durch die Erscheinung seiner Mutter, deren Antlitz ihm so bleich und traurig entgegenblickte. Wenn er aber erwachte aus den Träumen, dann lachte ihm die ewig junge, schöne Göttin alle düsteren Gedanken hinweg, und sein Gewissen beruhigte er mit dem festen Vorsatz, „einst“ Alles wieder gut zu machen.
Die Jahre schwanden, und längst war er zum Manne gereift. Aber wie das Leben uns auch packen und werfen, umschmeicheln und liebkosen mag, ganz kann sie doch niemals sterben, die Erinnerung an das süße Ehedem der Kindheit.
Als sich der erste Silberstreif in seinen dunklen Locken zeigte, ergriff ihn ein tiefes Weh; ein ungestümes Verlangen nach Glück trieb ihn hinaus in die Welt; ein stilles, heimliches Sehnen nach einem unsagbaren Etwas hieß ihn – heimwärts ziehn.
Da war er wieder in der Heimath, reuig und liebend die Mutter suchend, die ihn so unendlich geliebt, aber seiner Reue war der Friede versagt. Die alte Frau hatte lange, lange auf ihn gewartet – umsonst! Heute hatte er an der Mutter Grab gestanden.
Und wie er nun durch die menschenbelebten Gassen schreitet, da legt sich das bittere Gefühl der Schuld ihm schwer auf’s Herz. Fort aus diesen vom festlichen Licht der Weihnacht bestrahlten Märkten und Plätzen! Ihm blüht keine Freude.
Er will entfliehen – wohin, wohin? Wer wandelt da plötzlich an seiner Seite? Wer nickt ihm so mild lächelnd zu? Seltsam, da ist sie wieder, die alte Frau. Schweigend gehen sie neben einander hinaus in einsame abgelegene Gassen. Er ist wie in ihrem Bann.
„Wo geht Ihr hin?“ fragt er endlich.
„Nach Hause,“ antwortet sie.
„Wen habt Ihr dort?“
„Niemand!“
„Und wen erwartet Ihr?“
„Mein einziges Kind, meinen Sohn.“
„Und wenn er nicht kommt?“
„Er kommt!“ antwortet sie, und ein überirdischer Glanz blitzt in ihren Augen.
Sie traten in ein altes Haus, und der vornehme Mann, in den seinen Pelz gehüllt, folgt der Alten die schmale Stiege hinauf. Er fühlt: er muß. Sie treten ein in ein kleines Gemach; die Alte zündet ein Licht an. Er blickt um sich wie im Traume; auf dem Tisch steht ein Tannenbaum und darunter liegt die Bibel. Bald brennen die Kerzen; die Beiden sitzen sich gegenüber.
„Wie viele, viele Jahre warte ich nun schon auf ihn; heute, am heiligen Christabend, muß er doch endlich kommen, und ich darf nicht sterben, ehe ich ihn gesegnet.“
Wie schwer die Worte auf sein Herz fielen! „Und warum ging er von Euch?“ fragte er.
„Er war so schön und so klug; er brauchte Geld, viel Geld, und ich hatte keins mehr. Da zog er hinaus in die Welt. Gold wollte er erringen; auch für mich wollte er es; auch mich wollte er reich und glücklich sehen. Und als er fort war, da wurde es Nacht um mich her. – Das Elend zog bei mir ein, und die Krankheit warf mich auf’s Lager, meine Liebe aber war stärker als sie – ich muß leben, bis diese Hand auf seinem Haupte geruht.“
Er stöhnte laut auf.
„Mutter, denke, ich bin Dein Sohn! Siehe hier ist Gold, viel Gold; Alles ist Dein; segne mich!“ – Da lag es nun auf dem kleinen Tisch, das verführerische Metall, nach dem die Menschen so rastlos jagen und das noch keinen beglückt. Wie das funkelte und blitzte! Wie es lachte, das schöne Gold – umsonst; hier hat es seine Macht verloren; es ist todt. Lächelnd schiebt die alte Frau es zurück; sie winkt ihm: „Komm’, mein Sohn!“
Und der starke Mann kniet und beugt das Haupt tief herab. Ihre welke Hand streicht leise über sein volles Haar. Ein Zittern durchfliegt seinen Körper.
„Meine Liebe und mein Segen folgen Dir – gehe hin in Frieden!“
Die alte Frau lehnt sich in den Stuhl zurück; er erhebt sich. Seine Augen werden feucht, und ein heißer Thränenstrom wäscht alle Schuld von seiner Seele. Er fühlt sich frei werden, und ein nie gekanntes himmlisches Gefühl schwellt seine Brust. Das Glück konnte ihm die Welt, die ihm so viel, die ihm Alles gab, doch nicht geben; aus der Hand der Bettlerin sollte er es empfangen, das höchste Glück, die Ruhe seines Herzens, den Frieden seiner Seele.
Die Lichter sind verlöscht; der Mond und die Sterne scheinen in das Gemach; ihr bleiches Licht zittert in den dunklen Tannenzweigen. Von ferne tönt Gesang: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“
Wie Himmelsklänge dringt das Lied in seine Seele.
Er tritt an das kleine Fenster, und sein Blick verliert sich in das Sternenmeer. Seine Seele hebt ihre Flügel und strebt dem Unendlichen entgegen. – Er blickt um sich; stolz hebt er das Haupt; er breitet die Arme aus; er ist so unaussprechlich reich und glücklich.
Ist denn Niemand da, mit dem er sein Glück theilen kann?
„Mutter!“ ruft er leise.
Schläft sie?
„Mutter,“ ruft er noch einmal und erfaßt ihre Hand. Sie ist kalt – die alte Frau ist todt. Da wird es klar in seiner Seele: bis über das Grab folgte ihm die Liebe seiner Mutter; in der Gestalt der alten Frau war sie ihm erschienen, um ihm das zu geben, was er überall umsonst gesucht. – – –
Und draußen auf dem Friedhof, da ruhen sie neben einander, die beiden Mütter; eine Linde streut ihre Blüthen auf die Hügel; in ihren Zweigen singt eine Nachtigall das alte, ewig junge Lied von Glück und Liebe. Und der ernste Mann, der an des Baumes Stamme lehnt, versteht das Lied.
Bald erscheint er nicht mehr allein; sie begleitet ihn – sein junges Weib. Am Weihnachtsabend aber da kommt er allein; in Schnee und Eis gehüllt ist die Natur, und der kalte Nord tobt in den Aesten der alten Linde. Das Herz des ernsten Mannes, der gedankenvoll an den Gräbern steht, schlägt warm, und voll heißen Dankes gedenkt er jener Stunde, da er den Frieden, da er sich selbst gefunden.
Unsere Illustrationen. Vor unseren beiden Bildern können wir fragen: Herz, was begehrst Du? Die einfache und doch so erhebende und rührende Feier einer Christmette – oder das bunte Treiben auf dem Weihnachtsmarkte einer belebten Stadt? Jenes steht uns am Rhein zu Gebote und dieses in Deutschlands Mitte; jenes führt uns vor die St. Werner-Capelle in Oberwesel, dieses auf den Augustus-Platz der deutschen Rechtshauptstadt Leipzig.[WS 3]
Eine Christmette! Wem ihre Lichter in die Kindesaugen geleuchtet, der vergißt ihre heiligen Schauer nie und gönnt sie gern seinem eigenen Kinde. So früh am Morgen aus den Betten; es ist noch ganz Nacht. In warme Kleider gehüllt, in der Hand ein Stück Kerze, geht nun die Wanderung mit Eltern und Geschwistern in die Kirche. Wie zappeln die vielen kleinen Beine durch den Schnee! In der Kirche – ah, die vielen Lichter! So ist oder war es wenigstens in des Verfassers Heimath: Jeder Kirchengänger, jung und alt, bringt sein Licht mit und steckt’s vor sich hin auf seinen Platz. Ueber diese vielen Lichter sich zu freuen, das ist der Kinder Gottesdienst während der Predigt, aber schier athemlos lauschen sie den Tönen der Orgel und dem Chorgesang, und das stimmt sie dann ganz feierlich, sodaß die Gesichtchen gar rührend ernsthaft darein schauen. Und ist die Mette aus, dann geht’s in schönster Gemüthsverfassung heim zum leuchtenden Weihnachtsbaum. Auf unserer Abbildung der St. Werner-Capelle hat die Christmette bereits begonnen. Rechts ragen die Giebel von Oberwesel und hoch darüber auf dem Berge die Ruinen der Schönburg empor. Und wenn in der Capelle die Gesänge schweigen, hören wir’s, wie drunten der Rhein uns feierlich entgegenrauscht.
Wir eilen aus dieser Einsamkeit, wo das Mittelalter uns noch mit seinen Mauern umfängt, in die frische, freie Neuzeit der lebenvollen Stadt. Aber nicht den Leipziger Christmarkt sehen wir vor uns, sondern den Augustus-Platz als Christbaumwald. Der größere, vor der Universität bis zum Museum sich ausbreitende Theil des Platzes ist wirklich mit einem Wäldchen von Fichten- und Tannenstämmen bedeckt und von Fußwegen durchschnitten, auf welchen uns der Weihnachtsduft anweht. Von hier aus wird das Hauptprachtstück jeder Christbescheerung in alle Häuser der festfröhlichen Stadt getragen. Der ortskundige Leser erkennt leicht im Hintergrunde unseres Bildes zur Linken das neue Theater und zur Rechten das Gebäude der Post, die für das Weihnachtsfest der großartigste Knecht Ruprecht der deutschen Welt geworden ist.
[860] Liebende Eltern für verlassene Kinder! Keine Zeit des Jahres fordert so von selbst auf, den Werth eines Kindes zu schätzen, wie die des Weihnachtsfestes: die köstliche Zeit, wo das gegenseitige Freudemachen die höchste Pflicht aller Menschen von deutscher Sitte ist und wo die reinste Selbstlosigkeit der Liebe ihre schönsten Triumphe feiert. Mit keinem andern Gedanken, als dem, irgend Jemandem eine „heimliche Freude“ zu bereiten, wie der Volksmund eine freudige Ueberraschung bezeichnet, läuft Alt und Jung zum Christmarkt und zwischen den Weihnachtsbuden umher, und wer bepackt davon geht, trägt eine „heimliche Freude“ heim. Aber der Mittelpunkt all der Liebe ist – das Kind. Ein Familienchristbaum, unter welchem kein Kind jubelt, ist ein trauriger Anblick.
Ein Ehepaar, das an diesem Abend allein und hoffnungslos am Fenster steht und die leuchtenden, von glückseligen Kindern umringten Christbäume der Nachbarschaft betrachtet, ist beklagenswerth – aber nur wenn ihm die Mittel fehlen, ein Kind zu erziehen. Wer ein Kind ernähren kann, steht dem „armen Reichen“ unseres heutigen Eingangsgedichtes gleich, auch er kann ein Waisenkind an das Herz drücken, auf daß auch ihm „erblüht das Glück am Weihnachtsbaum“.
Darum haben wir diese „heilige Zeit“ gewählt, um alle Kinderlosen, welche im Besitz des Herzens und der Mittel zur Erziehung eines Kindes sind, wieder einmal an die vielen armen verlassenen Kinder zu erinnern, die nach liebenden Eltern schmachten.
Der Tod und die Noth arbeiten ja unablässig der Barmherzigkeit in die Hände; niemals hat es uns an armen Kindern, desto häufiger freilich an kinderfreundlichen Eltern gefehlt. Dennoch ist es uns seither wieder gelungen, eine erfreuliche Anzahl von Kindern recht glücklich unterzubringen. Diese Erfolge und vor Allem die Gewähr, die Kinder nur edlen Eltern an das Herz gelegt zu haben, verdanken wir zum großen Theil der aufopferungsvollen Theilnahme eines braven, gewissenhaften und pflichtstrengen Mannes, der unsere Bestrebungen unterstützte. Seiner treuen Mithülfe auch für die Zukunft sicher, können und müssen wir es nun auf’s Neue wagen, kinderlose Eheleute zur Annahme von Kindern aufzufordern, und zwar bitten wir dieselben diesmal, ihre Anträge, selbstverständlich mit genauer Angabe ihrer eigenen Lebensstellung und der Wünsche hinsichtlich des Alters und Geschlechts der Kinder, direct an unsern Vertrauensmann Herrn Schuldirector Mehner in Burgstädt bei Chemnitz in Sachsen zu richten.
Unsere Liste verlassener Kinder ist in letzter Zeit ziemlich stark angewachsen, obschon strenge Prüfung und Auswahl eine Anzahl ausgeschieden hat, welche uns nur der Leichtsinn und gewissenlose Bequemlichkeit anboten. Uebrigens dürfte manches der Kinder anderweit untergebracht worden sein, und für diesen Fall möchten wir die Betreffenden bitten, uns Nachricht zu geben, damit wir bereits versorgte Kinder nicht vergeblich auf unserer Liste fortführen.
Und so möge diese Weihnacht für die armen verlassenen Kinder eine recht gesegnete werden! Wir bitten ja nicht blos um Wohltaten, sondern wir bringen den Wohlthätern den Werth einer aufblühenden Kinderseele entgegen. Wer dieses Aufblühen zu belauschen und zu schätzen weiß, der wird bald erkennen, daß der Lohn größer ist als die Wohlthat. Wir wollen mit einem Beispiel schließen. Kurz vor dem Weihnachtsfest des vorigen Jahres kam zu unserem Vertrauensmann ein preußischer Lehrer, der über seine einsame, weil kinderlose Ehe klagte. Er war an den rechten Mann gekommen, denn als er heimwärts fuhr, hatte er von vier jüngst verwaisten Kindern das jüngste, einen zweijährigen Knaben auf dem Schooße. In seinem Wohnort verbarg er bei Freunden das Kind bis zum Abend des Christfestes. Auch an diesem Abend stand wieder, wie seit Jahren, der einsame Christbaum mit den gegenseitigen Geschenken bereit, als aber des Lehrers Gattin das Zimmer betrat, streckte der Knabe ihr über die Lichterpracht jubelnd die Aermchen entgegen – und da war ja das Glück erblüht am Weihnachtsbaum! – Ihr Tausende von Kinderlosen, gehet hin und thuet desgleichen.
Mehrere Beamte in Berlin. In dem Artikel in Nr. 40 der „Gartenlaube“ ist die Competenz des Reichsgerichts im Allgemeinen so umschrieben: „sie reicht so weit wie das Gebiet der Straf- und Civilproceßordnung“. Der weitere Zusatz: die Gerichtsbarkeit des Reichsgerichts erstrecke sich so weit, wie „Reichsrecht“ gilt – bezieht sich nur auf die Abgrenzung der Gerichtsbarkeit des Reichsgerichts gegenüber den Landesgerichten – z. B. in der Richtung, daß auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts, wo wir noch kein gemeinsames oder Reichsrecht haben, zur Zeit die Landesgerichte (Oberlandesgerichte) noch Manches entscheiden können, was, wenn erst auch hier nur „Reichsrecht“ gilt, in letzter Instanz an das Reichsgericht wird gehen müssen.
Nun bezieht sich die Strafproceßordnung nur auf die ordentlichen Gerichte (Strafproceßordnung § 3); vor die ordentlichen Gerichte aber gehören „alle Strafsachen, für welche nicht die Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten begründet ist“ (Gerichtsverfassungsgesetz § 13), Disciplinarsachen aber sind solche, „für welche die Zuständigkeit eines Verwaltungsgerichts begründet ist“. Denn daß Disciplinarbehörden (auch wenn sie Disciplinargerichte genannt werden) nicht wirkliche „ordentliche“ Gerichte (im Sinne der Strafproceßordnung), nicht „Strafgerichtshöfe“, wie sich die Fragesteller ausdrücken, sind, geht schon daraus hervor, daß jedes solche Disciplinargericht nur zum Theil aus richterlichen, zum Theil aus anderen Personen gebildet wird – selbst die Disciplinarkammern und der Disciplinarhof für die Reichsbeamten (Reichsgesetz vom 31. März 1873, § 89, 91).
Da übrigens die Fragesteller preußische Beamte zu sein scheinen, so werden dieselben am besten aus Rönne’s „Staatsrecht der preußischen Monarchie“, Ia. 255 ff., IIa. 295, 336 ff., sich überzeugen, daß Disciplinarbehörden keine „ordentlichen Gerichte“ sind, folglich auch nicht von ihnen an das oberste „ordentliche Gericht“, das Reichsgericht, appellirt werden kann, vielmehr da, wo es sich um preußische Beamte handelt, von den Provinzialdisciplinarbehörden an den obersten Disciplinarhof und eveutuell an das Staatsministerium, und da, wo um Reichsbeamte, an den Reichsdisciplinarhof, welcher zum Theil aus Mitgliedern des Reichsgerichts besteht (auch das ist ein Beweis, daß nicht das Reichsgericht als solches Appellinstanz in Disciplinarsachen ist).
Bei richterlichen Beamten verhält es sich anders. (Siehe Rönne, a. a. O. IIa. 335 und „Gerichtsverfassungsgesetz für das Deutsche Reich“ § 8.) Diese sind von Haus aus richterlich organisirten Disciplinarbehörden unterworfen.
Am 6. December begrub man auf dem Friedhofe von Zwickau in Sachsen in zwei großen Gräbern 77, und auf den Gottesäckern ihrer Heimathdörfer noch 12 Bergleute; sie alle hatten bei ihrer Arbeit durch schlagende Wetter einen plötzlichen Tod gefunden. –
Am 1. December, Abends 6 Uhr, war eine Belegschaft von 150 Mann im zweiten Schachte des Brückenberg-Steinkohlenvereins bei Zwickau angefahren und gegen 10 Uhr erfolgte der Wetterschlag, welcher so vielen Leben ein schreckliches Ende bereitete. Rettung war nicht mehr möglich, der Versuch, den Cameraden zu Hülfe zu kommen, hat sogar noch mehreren wackeren Männern den Tod gebracht. –
Das Geschlecht, welches die großen Kriege miterlebte, ist gewiß abgehärtet gegen das Grauenhafte des Anblicks von zerschmetterten und zerfetzten Menschenleibern; was aber hier bei dem Heraufbringen der Todten sich dem Auge enthüllte, hätte das furchtbarste Schlachtfeld nicht schrecklicher aufzuweisen vermocht.
Am Nachmittag des 6. December standen die 77 Särge auf zwei großen Begräbnißstätten des Friedhofs, jeder Sarg umringt von den jammernden Hinterbliebenen, die es sich hier und da nicht verwehren ließen, noch einmal den Sargdeckel zu öffnen und Abschied zu nehmen von den oft entsetzlichen Resten ihrer Lieben, ihrer Väter, ihrer Brüder, ihrer Gatten und Söhne. – Um 2 Uhr zogen 800 Cameraden der Todten in bergmännischer Feiertracht heran; sie hatten in der Marien-Kirche Zwickaus dem Trauergottesdienste beigewohnt und brachten nun an den Gräbern den Todten die letzte Ehre dar. Viele dieser Opfer ihres Berufs waren nicht blos Helden „tief unter der Erde“, sondern auch auf den Schlachtfeldern Böhmens und Frankreichs gewesen; ihnen donnerten die Ehrensalven über das Grab.
Die Todten ruhen – aber die Lebenden wollen leben, und für sie bitten wir um Gaben der Liebe. Von den 89 Verunglückten waren 58 Familienväter, welche 132 Kinder hinterlassen haben. Da thut Hülfe Noth. Wohl sind die gewerbfleißigen Städte Sachsens wacker bemüht, den drückendsten Sorgen der Wittwen und Waisen abzuhelfen – aber Niemand lasse sich von dem Gedanken die Hand lähmen, daß diesen Armen durch die Wohlthätigkeit zu viel dargebracht werden möchte: mehr, als sie verloren haben, kann ihnen Niemand geben, denn sie Alle haben ihr Liebstes verloren. –
Die „Gartenlaube“ stellt hiermit ihren Opferstock auf und sie wird über alle Gaben gewissenhaft quittiren.
Für die Hinterbliebenen der verunglückten Bergleute von Zwickau sind bis jetzt eingegangen: Die Verlagshandlung der „Gartenlaube“ Mk. 300; Dr. Ernst Ziel Mk. 30; Dr. Friedrich Hofmann Mk. 10; Dr. Albert Fränkel Mk. 10; Frau Emma Blüthgen, Leipzig Mk. 10.
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Vorlage: fröhlich; im zitierten Gedicht „Der letzte Dichter“ von Anastasius Grün lautet es jubelnd.
- ↑ zitiert aus Aus den Memoiren eines Vagabunden von Edmund Hoefer, 1867
- ↑ Leipzig war von 1879 bis 1945 der Sitz des Reichsgerichts.