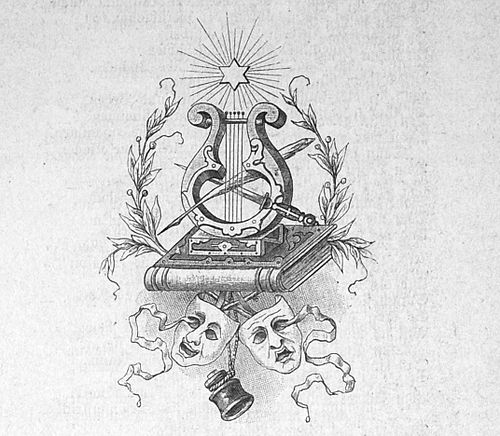Die Gartenlaube (1888)/Heft 45
Eine Hofgeschichte aus dem 17. Jahrhundert von Stefanie Keyser.
(Fortsetzung.)
Archatius stand wortlos bei Käthchens heftiger Abweisung. Der ehrliche Mädchenzorn hatte den alamoden Kavalier auf den Sand gesetzt. Er sah mit einem scheuen Blick Gertruds an. Hatte sie gehört, wie Käthe ihn abkapitelte?
Was war das? Ihr Blick ging an ihm vorüber mit sehnsüchtigem Ausdruck nach einem benachbarten Tisch. Wen suchte sie da? Dem Galan, der sich so von ihr anschauen ließ, wollte er seinem Degen in die Brust jagen. Aber seinen Augen begegnete ein schmales altes Frauenantlitz, das zärtlich und heiter der Trude zunickte. Es war die Frau von Heilingen.
Da dunkte es ihn, als lege sich plötzlich eine kühle, linde Hand auf seine brennende Stirn. Warum – zum Kuckuck – wüthete er denn nur also unter dem Frauenzimmer herum?
Gottlob! Da kam ein neuer Gang und befreite ihn aus der Klemme. Ein Wink der Herzogin Eleonore befahl ihm, eigenhändig eine Pastete, deren Deckel mit kleinen Vogelköpfen verziert war, vor dem Herzog von Eisenach niederzusetzen.
„Wollen Eure Liebden den ersten Angriff auf dieses Gericht machen?“ sagte die fürstliche Hausfrau mit schelmischem Lächeln. „Ein Weidmann weiß am besten Bescheid mit solchem Vogelherd.“
Der alte Herr schaute ein wenig verwundert drein; aber er that ihr den Willen und lüftete den Deckel. Im nächsten Augenblick warf er ihn lachend auf die Tafel.
Ein Schwarm kleiner Vögel schwirrte auf, Schmetterlinge und Libellen flatterten dazwischen. Die Gäste wehrten sich lachend gegen verscheuchte Spatzen, die dreist wider fürstliche Häupter rannten, gegen bunte Käferlein, die darauf bestanden, sich in Malvasier zu baden.
Mit hundert schelmischen Fältchen in seinem alten Jägergesicht rief der Eisenacher Herr: „Nur einen losen Vogel vermissen Wir in Eurer Gnaden Vexirpastete: den Cupido. Und selbiger wäre bei Unsern drei noch unbeweibten Neffen sehr am Platz.“
Herzog Ernst schüttelte sanft das Haupt. „Ich stimme zwar dem Herrn Doktor Luther, christmilden Gedächtnisses, bei, welcher sagt: ‚Es giebt kein lieber Ding auf Erden als Frauenliebe, wem sie kann zugetheilet werden.‘ Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen.“
„Die Braut, die ich mir erkoren habe,“ rief Bernhard stürmisch, „macht mir die Werbung schwer; sie heißt: Viktoria!“
Verstohlne Blicke richteten sich auf Albrecht und Dorothea.
Das junge fürstliche Paar saß allen zur Schau unbewegt auf den hohen Thronstühlen neben einander. Sie hielt ihr vergüldetes Gäbelein in den
[758] zarten Fingern, er hatte die Hand mit dem großen blitzenden Siegelring um den Fuß seines Pokals gelegt. Nur eine rasche Röthe, die über beider Antlitz jagte, verrieth, daß sie den Scherz gehört und verstanden hatten.
Albrechts Blick glitt nach seiner schönen Nachbarin hinüber. Wie sie ein paar Athemzüge lang mit gesenkten Wimpern verharrte, trat ein weicher Zug in sein Antlitz; es war, als schwebe ein leises Wort auf seinen Lippen.
Aber im nächsten Augenblick schon durchbrach sie den Bann, hob das Köpfchen und sah ihn neckisch an.
„Den Cupido werden Eure Liebden ablehnen,“ sprach sie mit ihrer hellen Stimme; „denn er ist uns fremdländischer Gott.“
Er hielt ihren schillernden Blick mit den Augen fest. „Eure Gnaden haben das Rechte errathen. Das leichte Liebesgeplänkel, zu welchem der kleine griechische Gott verlockt, ist nicht nach meinem Geschmack. Ich halte es mit einer ernsten deutschen Liebe.“
Er sprach die letzten Worte, für sie allein hörbar, in einem innigen Ton. Ihr aber war zu Muthe, als solle sie mit Sanftmuth eingemauert werden. Fast ungestüm rief sie: „Das Deutsche und immer nur das Deutsche heischen Sie und können doch das Schöne nicht entbehren, das aus der Fremde kommt. Sie trinken den feurigen Malvasier, obwohl die Sonne Griechenlands ihn gezeitigt hat.“ Und indem sie die Steinrosen in ihren Locken nach dem Licht drehte, daß sie Strahlen sprühten, fuhr sie fort: „Fühlen sich Ihre Augen offendiret durch diese Diamanten, weil selbige nicht in deutschen Bergwerken gebrochen wurden? Erscheinen Ihnen die sanft leuchtenden Perlen dieses Halsbandes odios, weil nicht biedere Alemannen sie aus dem Schwäbischen Meer fischten? Die herrlichen Tulipanen, die Sie mir ohne Gewissenspein geschenkt haben, entstammen den Niederlanden. Und diese goldigen Orangen wurden aus Welschland eingeführt.“ Sie zog das Majolikakörbchen, das mit dem Nachtisch aufgesetzt worden war, heran. „Welch ein Sprüchlein ziert das Geräth? ‚Nicht mir und nicht Dir, sondern es sei zwischen uns getheilt.‘ Wie plaisant! Thun wir nach dem Wort.“ Sie entnahm dem Körbchen eine überzuckerte Pomeranze und theilte dieselbe. „Warum sollen wir auch nicht von einander annehmen? Sind wir nicht Kinder einer Erde?“
Und mit einem lieblichen Lächeln bot sie ihm die Hälfte der Frucht.
Er empfing sie auf seinem Silberteller mit tiefer Neigung.
Aber sein Blick war bei ihrem lieblichen Gaukelspiel immer ernster geworden. „Sie verwechseln äußere Dinge mit innersten Eigenschaften,“ sagte er, leise den Kopf schüttelnd.
„O, auch in Bezug auf unsere Sentiments können wir von den Fremden lernen,“ rief sie. „Wie verstehen es die Franzosen, jeder Regung der Seele nachzugehen, jede Empfindung des Herzens zu zerlegen! Hoch zu loben ist ihr Brauch, die Gefühle in zarten Diskursen zu ergründen, zu klären, zu veredeln, bis jeder Zwiespalt sich ausgeglichen hat.“
„Ein wahres Gefühl läßt sich so wenig zerlegen wie der Sonnenstrahl,“ entgegnete Herzog Albrecht. Jedoch in verändertem entschiedenen Tone, als schiebe er plötzlich alle Disputationen bei Seite, fuhr er fort: „Darin aber stimme ich Ihnen zu, daß eine wahrhaftige ehrliche Aussprache hoch vonnöthen ist zwischen Menschen, die ihre Herzen sich gegenseitig in Verwahrung geben wollen. Wenn Eure Gnaden derselben guten Meinung sind, so bitte ich Sie, huldvoll den Ort dazu küren zu wollen.“
Sie neigte das Haupt, daß der seidige Schleier von Locken einen Augenblick ihre Züge verhüllte. Dann sprach sie leise: „Wenn morgen die Sitzungen unserer Gesellschaften im welschen Garten zu Ende sind –“ sie breitete den Fächer vor ihr Gesicht, sah ihn mit muthwilligen Augen darüber hinweg an und flüsterte: „Wenn Luna lächelt und Philomele klagt, dann harrt Astrea ihres Celadon.“
Und sie lachte wie ein Silberglöckchen.
Er neigte sich tief; aber er lachte nicht mit. In Sinnen verloren blickte er vor sich hin.
Die Tafel neigte sich ihrem Ende zu. Immer lauteres Summen erfüllte den Bankettsaal, je öfter sich die Spitz-, Zucker- und Tellerbärtchen in Flügelgläser und Silberbecher versenkten.
Die jungen Schnarcher und Pocher, die im Vorgemach saßen, fluchten lästerlich, wie es ihnen im Kriegsdienst geläufig geworden war; wohlgenährte Landjunker thaten nach dem Wort: „Wer nicht vertrucknen will, muß sich feucht halten“, und liefen fürwitzig mit ihren Humpen zum Schenktisch; selbst ehrsame Räthe speisten „alla francese“, wobei jeglicher selbst sich zulangte. Und jetzt stieg gar der Hofzwerg des Herzogs von Koburg auf den Tisch des Frauenzimmers und machte Anstalt, in der Marmelade der rundlichen Hofmeisterin sich auf den Kopf zu stellen.
Da hob die große Uhr, auf deren Zifferblatt ein kleiner Sonnengott die Zeit wies, aus und schlug die achte Stunde. Und ein Flötenspiel reihte den majestätischen Choral daran: „Wachet auf, ruft uns die Stimme.“
Eine plötzliche Stille trat ein, als die ernsten Klänge verhallten. Die Tafel wurde aufgehoben. Die Fürstlichkeiten begaben sich nach ihrem Losament.
„Auf Wiedersehen im welschen Garten!“ sagte Herzog Albrecht leise, als er sich von Dorothea verabschiedete.
„Auf Wiedersehen im welschen Garten,“ flüsterte die rundliche Hofmeisterin, da sie, ihrer Herrschaft folgend, an Achatius vorüberstreifte.
Das rothe runde Gesicht des Schloßhauptmanns leuchtete gleich einem Vollmond seiner Herrschaft voraus nach den Rosenkammern. Beruhigt folgte ihm die Frau Witwe. Die Herzogin Christine hatte ihr mitgetheilt, daß sie ihrem Fräulein Dorothea das Horoskop gestellt und alle Zeichen günstig gefunden habe.
Dorothea ging wie auf Wolken. So würde sie es doch durchsetzen, daß ihr Verlöbniß nicht von einem alten Aktenwurm am grünen Tisch zusammengesponnen wurde, sondern im grünen Garten, beim säuselnden Zephyr, unter webendem Mondstrahl.
Das Köpfchen gesenkt, die letzte wie immer, seit sie in Weimar war, beschloß Käthchen den Zug.
„Auf Wiedersehen im welschen Garten!“ flüsterte es auf dem dämmerigen Korridor, allwo Achatius die Koburger und Eisenacher Herrschaften mit den letzten Reverenzen versorgte.
„Auf Wiedersehen im welschen Garten!“ wisperte es noch über das Treppengeländer, als die Hofjungfrauen der Herzogin Eleonore in ihre Wohnungen hinauf sich begaben, während Achatius in das Erdgeschoß hinab ging, wo er die Reste der Speisen an Arme zu vertheilen hatte.
Ruhig stieg Gertrud neben der zerstreut vor sich hinlächelnden Benigna die Treppe empor. Aber als sie die Thür ihres Stübchens hinter sich geschlossen hatte, da drückte sie einen Augenblick die zitternden Hände auf das beklommene Herz, und ein tiefer Seufzer kam über ihre Lippen. Dann begann sie die Hofkleider abzulegen.
Während sie ihre einzige Schmuckzierde, die Bernsteinkette, von ihrem zarten weißen Hals löste, glitt ihr Blick hinab auf den Schloßplatz. Er war taghell erleuchtet. An der Pforte loderten Pechpfannen, und der Mond stand über den spitzen Giebeln und steilen Dächern der Stadt.
Die Gäste strömten von dannen, mancher Würdenträger schwer auf seinen Knecht gestützt; in wunderlichem Zickzackgang andere. Diener mit Stablichtern leuchteten den nahe wohnenden Frauen voraus, die in zobelverbrämten Mänteln davontrippelten. Lange schwerfällige Kutschen fuhren vor und nahmen die auf, welche einen weiten Weg zu machen hatten.
Dort stand halb im Schatten zurück gedrängt eine krumme Gestalt im blau und weiß getheilten Mantel, mit einem kurzen Spieß. Das war der treue Michel, der ihre Mutter abholen wollte.
Also war sie noch nicht in ihr Heim zurückgekehrt. Gewiß wollte sie erst das Getümmel sich verlaufen lassen.
Das Herz des jungen Mädchens zog sich zusammen: wegen des Vorderstückes von Damast und der Rückseite von dünnem Zindel. Sie hatte ja auch nur eine kurze alte Schaube mit einem steifen Pelzkräglein, das wie ein Heiligenschein ihr Haupt umstarrte. Den Fischotter dazu hatte ihr Vater noch auf dem Gut erlegt in fernen schönen Zeiten. Wie war ihre Mutter damals stolz darauf gewesen! Jetzt traute sie sich nicht damit hervor unter die anderen fröhlichen geputzten Menschen, stand im zugigen Portal, wo der Hofmeister dem scheidenden Frauenzimmer Kußfinger nachwarf und die hübschesten Bettelmädchen mit guten Bissen bedachte. Die feinen Lippen zuckten unsäglich bitter.
Da war er ja. Er trat aus dem Portal heraus und winkte einem seiner Diener, die sie an den bunten Dienstkleidern erkannte.
Wie respektvoll flog der Gerufene herbei. Nun eilte er von dannen hinüber nach dem Haus des Hofmeisters. Was war wohl geschehen, daß Achatius so in Aufruhr sich befand? Er stand mit dem Hut in der Hand und redete zu einer von dem Thorpfeiler verborgenen Person.
[759] Sieh! Da kamen Leute mit einem Tragstuhl herbei. Der gehörte niemand als dem alamoden Hofherrn. Wer hätte sonst solche Federbüsche auf dem Stuhlhimmel angebracht?
Ah so! Er ließ galant eine Dame nach Hause tragen, während ihr Mütterlein geduldig warten und dann heimgehen mußte.
Da führte er das Frauenzimmer heran.
Ein halb erstickter Schrei drang über ihre Lippen.
Das war die Fischotterschaube. Er führte ihre Mutter an die Thür des Tragstuhles und half ihr sorgfältig hinein.
Dann trat er mit ehrerbietiger Reverenz zurück.
Voll wohlwollender Würde neigte sich die steife Haube, und mit vornehmer Anmuth winkte das kleine alte Fähnlein heraus.
Dann ging er zurück, und das Zöpflein an der Seite schwenkte sich lustig.
Aber Achatius behielt recht. Gertrud lachte nicht über ihn. Ein heiße Thräne fiel auf das Bernsteinhalsband und glitzerte in dem Mondlicht, daß es schien, als bewege das versteinerte Mücklein die Flügel.
Warm strahlte die Sonne am andern Tag auf den welschen Garten herab. Auch dieses Stückchen Erde beseelte der Lenz, obgleich es anzusehen war, als sei es von einem Baumeister mit Richtscheit und Winkelmaß geschaffen. Auf einem großen Beet am Eingang bildeten Melissen, Salbei und Rautenstauden das sächsische Wappen; ein würziger Duft stieg von den Pflänzlein auf. Die Fichtenpyramiden, deren verfilztes Gezweig dem stachligen Fell eines Igels glich, waren mit maigrünen Tüpflein gesprenkelt. Das aus einem Maßholder gezogene Einhorn hatte ein unziemlich langes, von zarten Fächerblättchen umkräuseltes Horn getrieben; auf seiner Spitze wiegte sich eine Nachtigall und flötete und flötete. Leises Plätschern und Murmeln begleitete den süßen Gesang; das Wasser des Bassins, in die vieleckige Steineinfassung gezwängt wie Spiegelglas in den Rahmen, hatte seine muntere natürliche Sprache nicht verlernt.
Das schmiedeeiserne Thor war weit aufgethan. Unaufhörlich strömten die Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft von allen Seiten herzu. Sie trugen um den Hals das Palmgeschmeide, eine am papageigrünen Band hängende, in Gold getriebene Medaille, die den Palmbaum zeigte mit der Inschrift: „Alles zum Nutzen.“
In dem Tempel der Flora, wie ein von glattgeschorenen Hainbuchenhecken umzirkelter Kiesplatz genannt wurde, fand sich ein Trupp junger Edelleute zusammen.
„Ob der Verspruch zwischen dem Unansehnlichen und der Freudigen wohl stattgefunden hat?“’ fragte der eine, aus dessen Wams die Ecke eines Papieres herausschaute.
„Habt Ihr Euch auch mit einem Gedicht zum Verlöbniß gequält?“ seufzte ein anderer, der den Fuß der steinernen Göttin als Schreibpult benutzte.
„Wenn nur der Name Albrecht sich gefügiger erweisen wollte in dem neuen heroischen Vers, den der Dichter Opitz den Franzosen abgelernt hat.“
„Ich finde auf Dorothee keinen andern Reim als, o weh!’“ klagte ein würdiger Rath, den Stift kummervoll hinter das Ohr steckend.
Der Herzog von Eisenach, der mit seinem Bruder, dem Koburger Herrn, vorüberging, schüttelte den Kopf, „Sie werden dem jungen Paar noch einen Weidmann setzen. Wahrlich, es ist gerathen, jegliches bevorstehende Ereigniß vor den Palmgenossen geheim zu halten, damit sie nicht einen Ueberfall machen mit einem Lobgedicht oder einer Denksäule.“
Der Koburger nickte. „Jetzt schreibt jeder, der Hände hat, und wer lügen kann, hält sich für einen Dichter. Von rechtswegen sollten sie alle eingesperrt werden.“
Der Eisenacher Herzog lachte. Das war seines Bruders Allheilmittel.
Auf dem breiten, von Schwibbogen überwölbten Hauptweg wandelte eine Schar Herren heran, in echter Thüringer Art nach je drei Schritten stehen bleibend. Sie hatten den Hofmeister von Krombsdorff in ihre Mitte genommen.
„Was meint der hochwertheste Wohlriechende?“ fragte ihn ein wohlbeleibter Herr, behäbig lachend. „Wird wirklich das Buchstäblein ‚e‘ so viel als thunlich eingeschluckt werden?“
„Wollt Ihr noch mehr einschlucken?“ erwiderte Achatius. „Heißt Ihr doch schon ,der Dicke’ und führt einen Kürbis als Bild.“
Aber der Dicke ließ sich nicht beirren. „Ich habe vernommen,“ sprach er und machte abermals Halt, „hinfüro dürft Ihr nicht mehr langgezogen, gleich einem Sprosser, flehen: ‚Liebet mich, holde Herzenskönigin!‘ sondern müßt befehlen wie ein Rottenmeister: ,Liebt mich!“
„Morbleu!“ schrie Achatius mit wildem Blick. „Laßt mich in Ruhe! Das Getändel ist mir odios.“ “
Allgemeiner Jubel erhob sich. „Er hat zwei fremde Worte gebraucht. Auf den Drehstuhl! Zur Hänselung mit ihm!“
Der Mehlreiche, wie der Hofmarschall von Teutleben hieß, glitt heran. „Hier darf kein Umstand gebildet werden,“ flüsterte er. „Die Herrschaften kommen.“
Im eifrigen Gespräch nahten die fürstlichen Herren, die heute nur mit ihren Ordensnamen genannt wurden.
„Giebt es denn kein Mittel,“ ließ sich sichtlich erregt der Unansehnliche vernehmen, „unsrer alten Heldensprache solchen Aufschwung zu verleihen, daß sie die glatten schmeichlerischen Worte der Franzosen in den Staub tritt? Vermögen wir nicht, Männer unter uns zu erziehen, die durch echte Dichtungen die gleißenden Poesien des fremden Volks überstrahlen wie Sterne die Irrlichter? Weiß unser Einrichtender keinen Rath?“ wendete er sich an den Geheimerath Hortleder.
Der ehemalige Präceptor der jungen Herzöge, welcher jetzt auf dem ersten Platz des Landes stand, schüttelte die grauen Locken. „Die Sprache wächst mit der Seele des Volkes. Wie diese sich entwickelt, so spiegelt jene es wieder. Da hilft das Schneiteln und Drechseln nicht viel. Einst hat die deutsche Sprache Kraft und Wohllaut besessen. In Jahrhunderten, in denen unser Volk daniederlag, hat sie beide verloren. Doktor Luther gab ihr die Kraft zurück, wie die streitende Zeit sie bedurfte. Ich getröste mich: einst, wenn in unsrem Vaterland Frieden geworden ist, wird auch der Wohllaut sich wieder einfinden. Und die Dichter können wir nicht erziehen, die ernennt allein Gott der Herr.“
„Aber,“ fügte der Schmackhafte, wie Herzog Wilhelm hieß, zuversichtlich hinzu, „das soll uns nicht irremachen, an unserer Stelle nach Kräften zu wirken. Der eine pflügt und säet, der andere erntet. So kann der Boden, den wir itzo bestellen, in kommenden Zeiten die Dichter tragen, die das Werk vollbringen, von dessen Herrlichkeit wir nur eine Ahnung haben.“
„Amen,“ sprach feierlich Teutleben.
„Amen,“ hallte ein Echo mit leisem Klang von der Hihe drüben zurück.
Sie waren am Ende des Bogenganges bei dem blühenden Birnbaum angelangt, unter welchem die Tafel für die Palmgenossen errichtet war; denn die von einer Wespe benagte Birne war das Sinnbild des Schmackhaften, welcher den Vorsitz führte.
Die Herren nahmen ihre Plätze ein. Trabanten und Lakaien besetzten die Zugänge, daß niemand die Sitzung störe.
Die Berathungen begannen. –
Auf dem Lusthäuschen, das in hohe Lindenbäume hineingebaut war, versammelten sich die Tugendlichen, geschmückt mit den safranfarbigen Ordensbändern. Die erhöhten Plätze nahmen die Fürstinnen ein, eine Stufe tiefer saß das adlige Frauenzimmer.
Ueber die sammetnen und brokatnen Röcke huschten die Schatten der jungen Lindenblätter, als würden sie mit Herzen bestreut.
Andern Antheil nahm das Herz nicht an ihren Berathungen. „Ich lege den Tugendlichen ein Rezept vor,“ sprach die alte Gräfin von Gleichen mit ihrer zitternden Stimme zu den Fürstinnen, „wie Löffelgänse am feinsten zu bereiten sind. Und rathe ich jeglicher Hausfrau, den leckern Braten ihrem Gemahl aufzutischen. Es ist eine alte Erfahrung, daß diejenige Frau am treusten geliebt wird, welche den Magen ihres Herrn wacker versorgt.“
„Und ich,“ sagte am Tisch des adligen Frauenzimmers die Braut des jüngsten Palmgenossen, „habe das Sinnbild gestickt, so mein Bräutigam im Orden führt. Es sind Rapunzeln,“ setzte sie kleinlaut hinzu, „und der Name lautet: ,der Faselnde am Berge’.“
Die Tugendlichen ließen die feine Arbeit stumm von Hand zu Hand gehen und verbargen hinter Windfähnlein und Faltfächern eine Anwandlung zum Gähnen.
Da wurde ein leichter schwebender Schritt auf der schraubenförmigen Treppe vernehmbar, und im nächsten Augenblick trat Dorothea in den Kreis. Sie trug den Schäferstab in der Hand, über der Schulter hing ihr das Hirtentäschlein mit dem brennenden
[760][761] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [762] Herzen. Der aurorafarbige Rock war kurz geschürzt, wie bei einem Landmädchen, das Leibchen mit Perlen verschnürt gleich einem Mieder; aus den langen Locken skalierte ein Rosenband.
Die Fächer sanken nieder. Aller Blicke richteten sich auf sie. Dann tönte es laut von allen Lippen: „Astrea!“
„Ja, Astrea,“ sagte Dorothea und pflanzte ihren Schäferstab auf wie ein Krieger seinen Speer. „Astrea, die kommt, um den Bund der Tugendlichen zu fragen, warum sie sich zu einem solchen vertrockneten Leben kondemniret haben. Sind wir nicht zusammengekommen, um uns ein Plaisir zu machen? Und ist es ein solches, die geknüpften Borten zu beschauen, daran sich die Damen die Augen ruiniret haben? Rezepte aufzuzeichnen, nach denen alles, was kreucht und fleugt, am Spieße gebraten wird? Gestehen Sie es frei! Nicht Kurzweil finden wir dabei, sondern Langeweile.“
Beistimmendes Gemurmel ging durch die Reihen der Damen.
„Längst haben die Fürstinnen anderer Höfe erkannt,“ fuhr Dorothea fort, „daß unsre Ergötzlichkeiten einer Umwandlung hoch bedürftig sind. Und sie haben ein anmuthiges Spiel erfunden, um dem abzuhelfen. Aus dem Roman ‚Astrea‘ entlehnen Herren und Damen die Namen der Schäfer und Schäferinnen, die sie in Affektion genommen hohen. Das Frauenzimmer geht einher, begleit von Lämmern, die seidene Schleifen um den Hals tragen. Die Kavaliere folgen demüthig ihren Spuren, den Schäferstab in der Hand, an welchen die Kürbisflasche gebunden ist. Jede Schäferin kürt ihren Schäfer, und dieser ist verobligiret, sie zu adoriren. Er klagt in den Grotten den Najaden sein Liebesleid oder ruft im schön gepflegten Buschwerk mit sehnlichem Verlangen nach seiner Schäferin.“
Wie ein Sturm brach die Begeisterung los. „Das ist ein herrliches Spiel, wohl geschickt, die Langeweile aus der Welt zu schaffen.“
„Wohlan,“ rief Dorothea, „wir wollen dieser Landplage von hinnen helfen! Meine Hirtentasche setze ich gegen die gestickten Rapunzeln und die gebratene Löffelgans ein. Stellen Sie Nadel und Kochbuch zur Ruhe und armiren Sie sich mit diesem Stab. Einen Hirtenverein wollen wir gründen, an Diskursen über unsre zartesten Empfindungen uns erlaben. Denn wichtiger als die Verfeinerung unserer Küche und Handarbeit ist die Verfeinerung unserer Sentiments.“
Eine allgemeine Erhebung folgte.
Nur die Frau Witwe warnte: „Mich dünkt das ein gefährliches Fürhaben. Denkt an unsre drei Gelübde. Zum ersten: Tugendliches Leben; zum zweiten: Gegenseitige Freundschaft; zum dritten: Weibliche Arbeiten. Wer weiß, wie die Palmgenossen über Schäferspiele denken?“
Aber die gelehrte Herzogin Christine antwortete: „Es liegt in jeder Frauenseele, selbst in der schlichtesten, ein Zug, der über die Alläglichkeit hinausstrebt. Vielleicht kann ein Hirtenverein eine unschuldige Zuflucht sein für manche Frau, deren Sehnsucht nach einem edleren, höheren Dasein nicht verstanden wird. Und wenn wirklich hier und da die allzu holde Auffassung dieser Welt eine kleine Verwirrung, in den Frauenköpfen stiftet, so wird dieses reichlich dadurch ausgewogen, daß auch in manch armes Leben ein Sonnenstrahl der Poesie fällt und die Phantasei wenigstens mit schönen Bildern füllt.“
„Ja, wir wollen einen Schäferorden gründen, vieltheuere Schwägerin, und ich werde eine liebevolle Mutter fürstellen,“ rief triumphirend die kinderlose Herzogin von Koburg.
„Und ich die Nymphe Silvia mit den vergüldeten Stiefelein,“ trumpfte die Gräfin von Mansfeld, eine sehr unternehmende Dame, auf.
Das jüngste fürstliche Fräulein, welches während der Berathung heimlich Puppenhüte aus Lindenblättern gemacht hatte, zwitscherte dazwischen: „Daß mir nur niemand die hochverständige Schäferin Diana wegschnappt, die Augen wie Feuer und ein Herz wie Eis hat.“
„Ich befehle mir den Herzog Bernhard,“ jubelte ein anderes fürstliches Fräulein auf, das noch bis an die Ohren in einem steifen Halskräglein steckte.
Und das dritte hob drohend ein Fäustchen. „O, wie wollen wir den frommen Herzog Ernst nach uns schmachten lassen. Warum hat er mit uns gesprochen, als sei er ein Präceptor und wir kleine Schützen!“
Ein Raunen und Flüstern unter dem jüngeren Frauenzimmer wurde endlich in den Worten laut: „Und Ihre fürstliche Gnaden, die Herzogin Dorothea, soll die Astrea sein in unsrem Hirtenverein.“
Einige der Damen begannen bereits in den Lindenästen zu knacken, um sich Hirtenstäbe herauszubrechen.
Die Pagen wurden gerufen, und bald schnitzelten auch sie in den Buchengängen. Die bunten Seiden- und Wollenfäden, welche zu den Stickereien mitgebracht waren, dienten dazu, Zweige und Blumen um die Stäbe zu winden.
„Ich werde meinen Schäferstab mit Rauke schmücken,“ sagte die Herzogin Eleonore lächelnd. „Pflückt mir einen Strauß von dem balsamischen Kräutlein, liebe Hellingen.“
„Wollet mir den Purpurfaden anknüpfen, Jungfrau Gertrud; ich verstehe keinen Kreuzknoten zu machen,“ bat die eine Eisenacher Hoffjungfrau.
„Wenn Ihr mir doch die Maiglöckchen schenktet, die Ihr vorgesteckt habt; ich möchte meinen Stab damit krönen,“ wünschte der Cherub.
„Trude, borg’ mir Deine Florschleife,“ heischte Benigna.
Gertrud half, wo es verlangt wurde. Sie selbst trug kein Begehren nach einem Schäferstab. Im Ernst bewarb sich niemand um die Liebe des blutarmen, unscheinbaren Mädchens, und zum leichtfertigen Liebesspiel war sie zu stolz.
Käthchen saß stumm und wand alle von den andern verschmähten Maßliebchen, und Butterblümchen zusammen. Es wurde ihr ordentlich wohl dabei. Die kleinen Blumengesichter sahen sie hier in Weimar so vertraut an wie daheim. So gelb, so weiß mit rothen Blattspitzchen schauten sie aus dem Rasen, der die Domburg umgab, und so saß sie gar oft im Hain, band sich einen Kranz, setzte ihn auf und kam damit auf den Hof. Da stand dann das ganze Ingesinde und schlug die Hände zusammen über die Schönheit.
Ach! Wer doch in dem lieben friedlichen Nestchen wäre, wo es keine Falschheit gab, wo die Leute wußten, welch eine wichtige Person die Käthe war! Ob wohl die Zeit nur endlich wieder kommen würde, da sie zurückkehrte?
„Die Sitzung der Palmgenossen ist zu Ende,“ verkündigte die Gräfin von Rudolstadt, durch die Zweige lugend. Dort kommen die Herren.“
„So wollen wir ihnen unsren Beschluß zu wissen thun,“ sagte Christine, einen Diamantstern auf ihrem Stab befestigend.
„Und die Schäfer küren!“
„Und die lieblichen Diskurse anheben!“ riefen die Damen durch einander und eilten dem Ausgange zu.
„Wer der Celadon sein wird, darüber brauchen wir uns nicht den Kopf zu zerbrechen,“ sprach lächelnd die kinderlose Mutter und folgte den andern.
Die Schäferinnen stürmten die Wendelstiege hinab. Mit hocherhobenen Köpfen nahten die Palmgenossen vom Birnbaum her, der leise über ihnen seinen blühenden Wipfel schüttelte.
„Ich wähle den stattlichen Grafen von Mansfeld, “ entschied sich die hochverständige Diana, fürbaß eilend wie beim Haschenspiel.
Aber seine Gemahlin mit den güldenen Stiefelein zürnte, sie an: „Jede Frau behält ihren Mann! So ist’s Brauch hier zu Lande.“
Das andere Fräulein marschirte auf den Herzog Ernst los. Dieser sah verwundert auf die kleine Prinzessin und befahl einem Hofjunker: „Ruft die Gubernantin dieses Fräuleins!“
Bernhard wehrte das Dämchen mit dem hohen Halskräglein lachend ab. „Ich bin Aristander, der schon im Anfang des Romans gestorben ist.“
Klagend lief das junge alamode Gesindlein zu seinen Müttern.
Aber auch den älteren Damen ging es nicht besser. Hinter einem kugelrund gezogenen Maßholder zankte sich ein Ehepaar.
„Nur nicht in der Luft herum gegangen! Immer mit den Füßen auf der Erde geblieben!“ griesgramte der Herr.
„Das besorgt Ihr weidlich! Heißt Ihr doch der Gemästete und führt einen Scheffel fetter Bohnen als Bild,“ barmte die Frau.
„Mein wertster Bräutigam heißt fortan Dämon,“ flüsterte die kunstfertige Stickerin dem jungen Faselnden zu, der am Bassin die heiße Stirn kühlte.
Dieser aber hob das Haupt. „Der Mann verleiht dem Weibe den Namen, nicht umgekehrt.“
Aus einer Grotte säuselte es: „Ich ernenne Euch gnädigst zu meinem Schäfer.“
„Das wollet gnädigst abwarten,“ brummte es dagegen. „Der Mann kürt, nicht die Frau.“
„Redet doch nicht so grobianisch.“
„Ich rede deutsch.“
[763] Nur Frau von Tautenburg war auf Seiten der Palmgenossen. „Ist das ein verrückter Anschlag unseres fürstlichen Fräuleins!“ murmelte sie ihrem Ehegesponsen ins Ohr. „Wenn ich die Frau Herzogin wäre!“
Aber der Schloßhauptmann schlug sich auf die Seite der Schäferinnen. „Ich finde nichts Schlimmes dabei,“ entgegnete er. „In den Spinnstuben der Bauern wird ein Schmätzlein geraubt, bei Hofe werden den Schäfern kleine Freiheiten erlaubt. Ich bin gesonnen, einen galanten Schäfer zu spielen.“
Sie rückte ihre Perlenhaube auf Sturm. „Ich verhoffe,“ sagte sie nachdrücklich, „mein vielwerther Eheherr wird mit mir vereint ein besorgtes Ehepaar in dieser Komödie fürstellen.“ –
Aengstlich lugte Achatius in jeden Gang, ehe er seinen Fuß hinein setzte. Wie hatte nur sein Sinn sich so gänzlich gewandelt seit dem Augenblick, da die Gertrud Heilingen ihrer Mutter zärtlich zuwinkte! Als er am Abend die alte fürnehme Frau in ihrer ärmlichen Kleidung so geduldig ohne daß sie einen Augenblick die ruhige Würde verlor, in der zugigen Schloßpforte harren sah, bis die prutzigen Herren und Frauen den Weg räumten, da wurde es ihm heiß im Herzen; er vergaß seinen gerechten Zorn gegen die Sippe Heilingen und brachte sie zu Ehren. Und als sie ihm dann vertrauensvoll gedankt hatte, wie eine alte hilfsbedürftige Mutter ihrem braven jungen Sohn, da geschah es ihm, daß er auf einmal die jungen Bettelmädchen auszankte und den alten Werbern die Henkeltöpfe füllen ließ.
Gleich einem Alb drückte ihn in der Nacht die Erinnerung an die Stelldichein, die er sich über den Hals gerissen hatte. Wie konnte er ihrer nur wieder ledig werden? Wie kam er an all den Stauden und Grotten vorüber, die er zu zärtlichen Zusammenkünften bestimmt hatte, ohne von den verliebten Nymphen erwischt zu werden?
Ueberall schimmerten die bunten Bänder der Schäferstäbe, überall suchten die Damen ihre Amants zu küren.
Seine Gedanken hielten an. Würde Sie sich auch einen solchen wählen? Gewißlich! Aber wen? Etwa den Sauerhaften, den fürstlichen Rath, dem allezeit ein Aktenstück aus der Brusttasche ragte? Er wollte doch gleich einmal sehen.
Achatius vergaß die Vorsicht und rannte fürbaß.
Am 20. September 1870 zog das geeinte Italien in Rom ein, um dasselbe zur Hauptstadt des Königreichs zu machen. Neapel, Turin, Florenz, die bisherigen großen Residenzen, hätten keine der anderen den Vorrang als Hauptstadt gegönnt, nur gegen Rom traten sie freiwillig zurück. Rom, das ewige, das einst Mittelpunkt der ganzen damals bekannten Welt gewesen, mußte auch die Hauptstadt des modernen bürgerlichen Staates werden. Aber die lokalen Verhältnisse, die unüberwindlichen Schwierigkeiten schienen dies zur Unmöglichkeit zu machen.
Mit das schlimmste Hinderniß bot die Umgebung der Stadt. Ein meilenweites Todtengefilde, von giftigen Dünsten unbewohnbar gemacht, ohne andere Ansiedelungen als einige Rohrhütten der Hirten für den Winter, einige Weinschenken auf erhöhten Stellen am Wege, zu denen die Fieberdünste nicht hinaufgelangen, Ruinen außerdem und alte Römergräber, das war alles, was die nahe Umgebung der neuen Hauptstadt zu bieten vermochte. Während der heißen Monate des Sommers konnte selbst ein kurzes Verteilen in der Campagna von Rom tödlich werden; im Winter besserte sich die Luft, da die kältere Witterung das Aufsteigen der Giftdünste niederhielt. In dieser traurigen, nur von Hirten bevölkerten Oede sollte Rom wieder zu früherer Herrlichkeit und Größe gelangen; das schien unmöglich.
Das alte, mächtige Rom hat günstigere Lebensbedingungen gehabt, erst spät und allmählich ist die Campagna verödet. In allerfrühester Zeit ist ja die spätere Weltstadt ein armes Bergnest gewesen, bewohnt von Bauern, Hirten, wilden Gesellen, die gern räuberische Streifzüge in die Umgebung machten. Da lag, wenige Meilen entfernt, eine Menge ähnlicher Dörfer und Städtchen auf natürlichen Erhöhungen des Bodens, deren Bewohner ihre Aecker bestellten, ihre Herden zur Weide trieben, dem damals fruchtbaren Gefilde der Campagna gute Erträge abgewannen, gesund in gesunden Orten wohnten. Rom hat sie nach und nach alle bezwungen. Diese Dutzende kleiner Flecken verschwanden, wurden zerstört oder von Römern kolonisirt – bald hieß die weite, blühende Campagna römischer Ackergrund.
Nun ward die Stadt immer mächtiger und größer, die Zeit der Kaiser kam und mit ihr ein Glanz, eine Pracht, wie die Welt sie bisher nicht gekannt hatte. Da verwandelte der Fruchtacker sich in Lustgefilde. Die Landschaft ist ja von hoher, malerischer Schönheit. Die weite, in sanften Hügelwellen bewegte Campagna wird im Westen vom blauen Meere begrenzt; im Osten umrahmen sie die hohen, röthlichgrauen Kalksteinwände der Sabiner Gebirge, wie dieser Theil des Apennin heißt; da blicken Schneehäupter über die vorderen Ketten, da schieben begrünte Hügel sich am Fuße vor, besiedelt mit Schlössern und Landhäusern der Großen. Dort hat Kaiser Hadrian Lustanlagen geschaffen mit Rennbahnen, Badehallen, Tempeln, Theatern; in den kühlen Thalgründen der Gebirgsflüsse lebten römische Dichter unter dem gastlichen Dache ihrer hohen Gönner. Ein anderes Gebirge schob sich im Süden mitten in die Campagna von Rom. Dort hatte einst unterirdisches Feuer den Boden gehoben, Lavaströme sich über das Gebiet ergossen, das jetzt die römische Campagna heißt. Nun sind die Krater der Vulkane erloschen, feuriger Wein wächst auf dem warmen Boden, an dessen gerundeten, waldbedeckten Bergkuppen ebenfalls Schlösser, Landhäuser, Lustgärten der römischen Großen lagen.
Aber auch das Gefilde zwischen der Stadt und diesen Gebirgszügen wurde damals von dem reichen und üppigen Rom völlig in Anspruch genommen. An den durch die Campagna führenden großen Landstraßen wurden nach damaliger Sitte die Vornehmen in herrlichen Grabtempeln von Marmor. bestattet. Zu beiden Seiten dieser Straßen standen Säulen, Urnen, Obeliske, Tempelchen, hohe Thürme, alles mit Bildwerk aus Marmor geschmückt, dicht neben einander. Neunzehn verschiedene Wasserleitungen führten auf hohen Bogenbauten die kühlen Quellen der Gebirge durch die Campagna zur Stadt. Es entstanden Landhäuser mit weiten Gärten, es wurden Rennbahnen für die Wettkämpfe zu Pferde und in Wagen erbaut, die viele Tausende Zuschauer faßten. Der Fruchtacker damit zerstört, der Boden sollte keinen anderen Ertrag liefern, sondern den Besitzern und dem vergnügungslustigen Volke nur zur Lust dienen.
Die Herrlichkeit des alten Rom hat nicht ewig gedauert, der heidnische Staat ging zu Grunde, das junge Christenthum eroberte Rom und seine Campagna. In den Katakomben, den höhlenartigen Gängen und Hallen, von denen das mürbe vulkanische Gestein durchzogen war, hatte das Christenthum sich geheim befestigt und ausgebreitet; nun stieg es hervor ans Tageslicht, um Rom in Besitz zu nehmen, dort zu herrschen. Auch die Campagna verwandelte sich damit. Die altrömische Pracht verfiel, die Grabtempel wurden in Kapellen und Kirchen verwandelt, die großen Geschlechter des Mittelalters, die ewig im Kampf miteinander lagen, bauten ihre plumpen Vertheidigungsthürme auf den Fundamenten der Schlösser, umgaben die hohen Grabstätten mit Zinnenmauern, setzten ihre Burgen auf die Vorsprünge des Gebirges, theilten den Boden unter sich und mit der Kirche. Die Campagna von Rom verödete immer mehr. Die Wasserleitungen waren geborsten, ihr Inhalt ergoß sich auf den porösen Boden von Bimstein, Lava, Tuff, der ihn gierig aufsog und, wenn die Sonne brannte, die faulige Flüssigkeit in giftigen Fieberdünsten wieder abgab. Die Feudalherren gaben den Acker, den sie selbst nicht bewirtschaften wollten, an Pächter für ein Billiges, die Kirche, die Klöster und Stiftungen ließen ihn meist gänzlich ruhen; das weite Blachfeld wurde zu einer unendlichen Viehweide, die Wohnstätten verschwanden.
Damals hat die Campagna von Rom den Charakter angenommen, der ihr bis heute eigen ist, den eines weiten Todtengefildes, einer majestätischen Grabstätte der großen Vergangenheit. Im September nach den ersten Herbstregen bedeckt die hügelige [764] Ebene sich mit kurzen Kräutern, mit Gras und Blumen. Bald aber ziehen dann die braunen, malerisch in dunkle Mäntel gehüllten Hirten mit vielen Tausenden von Ziegen, Schafen und Rindern aus dem Gebirge herab, um das endlose Weidegebiet zu bevölkern. Die Luft ist dann reiner geworden, Menschen und Thiere können jetzt hier athmen. Schutz finden jene in irgend einem alten Gemäuer oder in den Höhlen und Grotten des weichen Tuff, aus denen man die Puzzolanerde geholt, die dem Römer, mit Kalk gemischt, einen trefflich festen Mörtel giebt.
Die nächste Wasserleitung hat man angezapft, um einen gemauerten Trog am Rande des Wegs zur Tränke zu füllen. Hier ziehen auch die Campagnolen vorüber, die auf hohen, zweiräderigen, mit Stieren bespannten Karren den Wein aus den Bergen zur Stadt führen, die Eseltreiber, die ihre Lastthiere in langem Zuge heimtraben.
Es ruht ein melancholischer Zauber, ein feierlicher Ernst auf dieser historischen Landschaft. Alle Vergangenheit hat hier ihre Spuren zurückgelassen. Wenn wir zwischen zertrümmerten Grabdenkmälern die appische Straße entlang schlendern, die südwärts nach Capua und Neapel führt, so blicken wir von ihrer Höhe über die Ruinen einer weiten Rennbahn, welche Maxentius, der letzte heidnische, von Konstantin besiegte römische Kaiser, hat erbauen lassen; die Bogen einer geborstenen Wasserleitung erheben sich aus der Oede, klotzige Kriegsthürme erinnern an das Mittelalter, die Kreuze und Glocken aus kleinen einsamen Kapellen, welche das Christenthum aus antiken Grabtempelchen umgewandelt, an jene Frühzeit des Uebergangs. Undeutbares Ruinengemäuer fesselt den Blick, der aber hinüberschweift zu den herrlichen Gebirgszügen. Auf den Kuppen der Albanerberge erkennt er deutlich die Stammburgen der Colonna und anderer alter berühmter Geschlechter, die Städtchen und Villen, die Reste des antiken Tusculum, denen das heitere Bergstädtchen Frascati zu Füßen liegt. Aus dem Sabinergebirge bricht in tiefer Schlucht der Anio hervor, an den Abhängen breitet Tivoli sich aus. Während schöner sonniger Wintertage zeigt sich die römische Campagna, mit den Hirten, Karrenführern, Eseltreibern belebt, als Landschaft großen Stils.
Steigt aber die Sonne höher, kommen die Monate April und Mai, dann beginnt sie zu veröden. Die Hirten haben die jungen Lämmer und Zicklein als leckere Braten in die Stadt verkauft und ziehen nun mit ihren Herden zurück in die kühleren gesünderen Berge. Die sengende Sonne tödtet allen Pflanzenwuchs, das modernde Wasser, das sich in unterirdischen Löchern und in dem mürben Gestein gesammelt, beginnt in der Hitze zu verdunsten und jene Pestluft auszuhauchen, welche die furchtbaren Fieber erzeugt, die meist sofort tödlich wirken. Die Campagna der großen italienischen Hauptstadt versinkt in langen Sommerschlaf.
Der moderne Staat wendet alles dran, um sie aus demselben zu erwecken, die Umgebung der Hauptstadt gesund und bewohnbar zu machen. Strenge Gesetze sind zu dem Zwecke erlassen worden. Die weiten, brach liegenden Gebiete, meist im Besitze der Kirche oder dem hohen Feudaladel gehörend, sollen bebaut und besiedelt werden. Der Staat fordert, daß in jedem Jahre damit in kleinen Streifen vorgegangen werde, behält sich jedoch das Recht vor, falls in einer festgestellten Reihe von Jahren dies nicht geschehen, den Landbesitz durch Enteignungsverfahren erwerben und an kleine Leute abgeben zu können. Entwässerungsarbeiten werden geplant, um den schlimmsten Feind der Campagna von Rom, die unterirdischen Wasserpfützen, welche die furchtbaren Fieber erzeugen, zu verbannen. Man nimmt jedoch an, daß schon eine dichtere seßhafte Bevölkerung und die regelmäßige Bebauung des Bodens die Landschaft fieberfrei machen dürfte.
Dann soll die Anpflanzung eines australischen Baumes mithelfen, der in dem römischen Klima sich bereits völlig eingebürgert hat. Der Eukalyptus (Fieberbaum) hat die Eigenschaft, alle Feuchtigkeit aus dem Boden und aus der Luft anzuziehen und sich damit zu mästen. Er verbraucht zu seinem staunenswerth schnellen Wachsthum alle Feuchtigkeit, die seine Wurzeln und Blätter erreichen können, und hat schon manches Besserungswerk unterstützt. In dem Theile der Campagna, der sich südwestwärts zum Meere hinzieht, steht einsam die Abtei der drei Brunnen. Das Haupt des an dieser Stelle geköpften Apostels Paulus, so erzählt die Legende, soll dreimal von der Erde in die Höhe gesprungen sein und an jedem Punkte ist da ein Brünnlein hervorgesprudelt.
Die frommen Väter, die dort beschaulicher Andacht lebten, waren nun genöthigt, in jedem Juni nach der Stadt überzusiedeln, um dem tödlichen Fieber zu entrinnen. Sie sehnten sich fort aus dieser gifthauchenden Umgebung, und als französische Trappisten den Wunsch aussprachen, die verlassene Abtei zu beziehen, willigten sie gern ein. Diese begannen sofort damit, das ganze Hügelgelände mit Eukalyptus zu bepflanzen, in so weiten Abständen, daß darunter noch Feldfrucht gebaut werden konnte. Die Bäume gediehen und schufen Wunder. Heute nach kaum einem Jahrzehnt ist dieser Theil der Campagna völlig gesund, die Brüder Trappisten bleiben den ganzen Sommer hindurch in ihrer Abtei; kein Fieber zehrt an ihrer Gesundheit, sie bestellen den gewonnenen Acker und destilliren aus den Blattkeimen des fremden Baumes einen bitteren Schnaps, den man von ihnen kaufen kann.
Ob es gelingen wird, auch die tieferen, muldenförmigen Theile der Campagna von Rom derartig zu kultiviren, ob die Bodenarbeiten zur Beseitigung der faulenden Wasser nicht während des Sommers bedeutende Opfer an Menschenleben fordern werden – denn nicht selten fallen die vom Fieber ergriffenen Menschen plötzlich um, um nie wieder aufzustehen – das ist schwer vorherzusagen. Die Landschaft von Rom muß aber eine andere werden, wenn die Hauptstadt des Königreichs nicht ferneren Schäden ausgesetzt bleiben soll.
Der Zauber, den dieses unabsehbare, mit Ruinen bedeckte, von Hirten und Campagnakärrnern allein belebte Gefilde mit den Gebirgen, die es umrahmen, jetzt auf jeden Besucher ausübt, die hohen und ganz eigenartigen Reize dieser einzigen historischen Landschaft werden dann schwinden, wenn Getreideäcker, Dörfer und Gutsgebäude sie bedecken, wenn Eukalyptuswäldchen die Tiefen füllen, auf den Rücken alter Lavaströme neben den Festungswerken, die das neue Italien dort zum Schutze seiner Hauptstadt erbaut, Pumpstationen Wasserthürme, Dienstwohnungen sich erheben werden.
Doch alle ästhetischen und künstlerischen Liebhabereien kommen nicht in Frage, wenn es gilt, Rom eine gesunde, bewohnbare Umgebung zu schaffen, und wie so manches in der Stadt selbst der neuen Zeit mit ihren Anforderungen hat weichen müssen, so sind auch die Tage der jetzigen Campagna von Rom vielleicht schon gezählt.
Wie im Fluge sind die „Kaisertage“ verrauscht, welche uns gestatteten, eines der merkwürdigsten Kapitel Geschichte mitzuerleben, ein Kapitel, von dem der Historiker wird sprechen müssen, um die Innigkeit des Verhältnisses zu kennzeichnen, wie es sich zwischen dem Deutschen Reiche und Oesterreich-Ungarn langsam, aber sicher – mit der Tendenz unabsehbarer Dauer – herausgebildet hat. Am 3. Oktober morgens langte Kaiser Wilhelm in Wien an; er verließ die österreichische Hauptstadt oder eigentlich deren nächste Umgebung am 5. Oktober nachmittags, um vorerst mit seinem kaiserlichen Jagdfreunde dem Weidwerk obzuliegen und dann die Fahrt nach Rom anzutreten. Ein kurzer Aufenthalt war es, der erlauchte Gast ging in die Ferne, kaum daß er gekommen; aber die enge Spanne Zeit faßte einen der bedeutsamste Zwischenfälle der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts in sich. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, daß die Augen der ganzen civilisirten Welt auf Wien gerichtet waren, und daß niemand, der für die europäische Lage Herz und Sinn hat, sich unklar sein konnte über die Wichtigkeit des Ereignisses.
Monarchenbesuche von Hof zu Hof sind in unseren Tagen nichts Seltenes. Aber diesmal handelte es sich um mehr als um einen Akt der Höflichkeit, als um einen Zoll, dargebracht der zwingenden Konvenienz. Der Enkel Kaiser Wilhelms I. wollte durch persönliches Erscheinen bekräftigen, daß er unentwegbar hochhalte, was sein erhabener Großvater geschaffen; er eilte in die Arme des kaiserlichen Freundes, der in seiner selbstlosen, nur
[765][766] des Volkes Wohl erwägenden Art sich längst mit Verhältnissen abgefunden hat, welche sich so ganz anders gestalteten, als es zur Zeit seiner Thronbesteigung sich ahnen ließ. Kaiser Franz Josef hat es hochherziger Weise über sich vermocht, im reifen Mannesalter mit der Vergangenheit abzuschließen und aus einer veränderten Gegenwart heraus an dem Baue der Zukunft zu schaffen. So brachte er Wilhelm I. aufrichtige Freundschaft entgegen; er hat diese auf Wilhelm II. übertragen, und man hörte den Ausdruck seiner wahrsten Empfindungen, als er während des Galadiners im Redoutensaale sein Glas erhob, um auf das Wohl seines lieben Gastes zu trinken. Und nicht nur die Herzen der Herrscher haben sich zusammengefunden, sondern in gleichem Maße auch jene der Völker.
Heute spricht der Kaiser uns allen aus der Seele, wenn er den Gefühlen „herzlich treuer und unauflöslicher Freundschaft und Bundesgenossenschaft“ Ausdruck verleiht, wenn er den Allmächtigen bittet, den Freund zu geleiten auf der Bahn, „die er mit jugendlicher Kraft, mit männlicher Weisheit und Entschiedenheit betreten hat.“ Und wir lauschen mit ungeheuchelter Freude dem Echo solchen Grußes und Wunsches, wenn der edle Hohenzollernsprosse sich darauf beruft, er sei „nicht als Fremder“ in Wien erschienen, wenn er von „ bewährter und unverbrüchlicher Freundschaft“ redet und sich dabei in der Ausführung eines „heiligen Vermächtnisses“ begriffen sieht. Die vier Trinksprüche, welche im Redoutensaale gewechselt wurden − zwei auf die Monarchen und ihre Häuser, zwei auf die beiderseitige Heere, die wackeren Kameraden − waren Zeugnisse unverbrüchlicher Bundesfreundschaft, und in ihnen wurde durch die berufensten Herolde dargelegt, was den Kern der weihevollen Stunde ausmachte.
Niemand, dem es vergönnt gewesen, der grandiosen Kundgebung beizuwohnen, wird jemals den Eindruck vergessen, den sie hervorgebracht. Die Anwesenden hatten Freundschaftsbezeigungen in Form von Toasten erwartet, aber daß diese den Rahmen höfischer Etikette weitaus, wie mit elementarer Gewalt überschreiten würden, das ahnten die wenigsten.
Das Bild, aus welchem die ewig denkwürdige Scene erwuchs, war ein blendend schönes. Der taghell erleuchtete Saal, behängt mit den berühmten kaiserlichen Gobelins, faßte eine Fülle von Farbenreichthum in sich, die Pracht der Damentoiletten, die vielfältigen Nuancen der Uniformen, das Strahlen des Schmuckes, das Glitzern der Orden, der Zierat des mit Lichtschimmer und duftigem Blumenprangen übergossenen hufeisenförmigen Speisetisches, das alles vereinigte sich zu einer die Sinne wahrhaft bestechenden Wirkung, und unter den Schönen die Schönsten waren Kaiserin Elisabeth und ihre anmuthige Schwiegertochter Kronprinzessin Stephanie. Man konnte nicht müde werden, zu schauen, um das unbeschreibliche Bild in sich aufzunehmen.
Aber der Zauber dieses Bildes trat zurück, als Kaiser Franz Josef sich erhob, um seinen Gast zu ehren. Nun sah man niemand als die beiden Kaiser − alles andere verschwand; es war, als hätten sich die übrigen Gestalten verflüchtigt, um den zwei Trägern des historischen Augenblickes Platz zu machen. Rasch aufeinander folgten die Trinksprüche, und kaum hatte Kaiser Wilhelm den seinigen geendet, als Kaiser Franz Josef neuerdings das Wort ergriff und ein Hoch dem „leuchtendsten Muster aller militärischen Tugenden, den preußischen und deutschen Kameraden“ brachte − überraschend für jeden Zuhörer, überraschend für den deutschen Kaiser, der, offenbar unvorbereitet, doch ohne Zögern und mit nicht zu verkennender Freudigkeit sogleich antwortete und dankte. Ein dreimaliges Hoch auf die „Kameraden von der österreichisch-ungarischen Armee“ schloß seinen Toast.
Die hochbedeutsamen Aeußerungen beider Kaiser riefen in der ganzen auserlesenen Versammlung eine geradezu stürmische Bewegung und Begeisterung hervor, und in dieser mächtig ergreifenden, weltgeschichtlichen Scene hatte der Kaiserbesuch in Wien unzweifelhaft seinen Höhepunkt erreicht. Der fernere Aufenthalt des hohen Gastes in der österreichischen Hauptstadt konnte bestätigen, wie vollgewichtig ernst die an der historischen Tafelrunde gesprochenen Worte gemeint waren − Größeres, Bedeutsameres aber vermochte er kaum mehr zu zeitigen, und wir verstehen daher unseren Künstler und danken es ihm, daß er in seinem trefflichen Bilde gerade diese fesselnde Scene wiedergiebt, auf welche es bei dem ganzen Kaiserbesuch in erster Reihe ankommt.
Ueber die weiteren Festlichkeiten in Wien, über die Besuche, welche Kaiser Wilhelm an den folgenden Tagen Fürsten und bedeutenden Persönlichkeiten abstattete, über die Audienzen, welche er ertheilte, etc. sind unsere Leser aus den Tageszeitungen zur Genüge unterrichtet und auch der Jagdausflug mit dem kaiserlichen Gastgeber ist ausführlich beschrieben worden, so daß wir es uns versagen können, hierauf näher einzugehen. Aber wenn wir auch von einer Schilderung der ferneren mehr oder minder wichtigen Vorgänge absehen, eines können wir zum Schluß nicht unterlassen, einer Ueberzeugung aus vollem Herzen Ausdruck zu geben, welche in allen Schichten unserer Bevölkerung gleich lebendig ist: Wie viele Huldigungen Wilhelm II. bei seinen Besuchen in St. Petersburg, Stockholm und Kopenhagen, bei dem Großherzog von Baden, dem König von Württemberg und dem Prinz-Regenten von Bayern als Kaiser auch erlebt hat, er darf sicher sein, daß ihm nirgends wärmere Neigung gewinkt hat, daß nirgends Hof und Bevölkerung in der Freude über sein Erscheinen inniger vereint waren als eben in Wien, wo das deutsch-österreichische Bündniß im Palast wie in der Hütte als Schutz und Schirm des europäischen Friedens betrachtet und verehrt wird!
Alle Rechte vorbehalten.
Der Arbeiterhaufen stob auseinander, als Erna in wildem Galopp herangesprengt kam; einige der Leute, die da glaubten, das Pferd sei scheu geworden und durchgegangen, fielen ihm in die Zügel und hielten es auf. Erna schien das kaum zu bemerken, ihr Blick suchte in Todesangst nur eins − Wolfgang! und jetzt sah sie ihn, aufrecht und unverletzt in der Mitte des Kreises.
Aber auch er hatte sie gesehen, als sie diesen Kreis durchbrach; er sah den Blick, der ihn suchte, das tiefe, tiefe Aufathmen, als sie ihn lebend gewahrte, und da brach es aus seinen Zügen hervor wie ein Strahl leidenschaftlichen Glückes. Seine Todesgefahr hatte ihr endlich das Geheimniß entrissen, er wurde doch geliebt!
„Die Angst war unnöthig, der Herr Chefingenieur ist ja unverletzt,“ sagte Ernst Waltenberg, der seiner Braut unmittelbar gefolgt war und jetzt, einige Schritte entfernt, außerhalb des Kreises hielt. Aber seine Stimme hatte einen seltsam fremden Klang; aus seinem Antlitz schien jeder Blutstropfen gewichen zu sein und in den dunklen Augen, die unverwandt auf den beiden hafteten, glühte ein unheimliches Feuer. Erna schrak zusammen und Wolfgang wendete sich rasch um; es bedurfte nur eines Blickes, um ihm zu zeigen, daß er von dieser Stunde an einen Todfeind hatte; gleichviel, es galt, sich zu fassen vor all den fremden Zeugen.
„Die Sache hätte sehr schlimm ablaufen können,“ sagte er mit erzwungener Ruhe. „Die Sprengung versagte anfangs ganz und ging dann zu früh los, ehe wir uns in Sicherheit bringen konnte. Wir sprangen glücklicherweise noch im letzten Moment seitwärts, aber zwei der Leute sind verletzt worden, anscheinend nur leicht. Wir andere sind wie durch ein Wunder der Gefahr entgangen.“
„Aber Sie bluten ja auch, Herr Elmhorst!“ rief einer der Ingenieure, indem er auf die Stirn seines Chefs deutete, von der einzelne Blutstropfen niederrannen. Wolfgang zog sein Taschentuch hervor und drückte es aus die Wunde, die er jetzt erst bemerkte.
„Das ist nicht der Rede werth; einer der auffliegenden Steine wird mich gestreift haben. Sehen Sie nach den Verwundeten, sie müssen sofort verbunden werden!“ − Gnädiges Fräulein, ich bedaure, daß der Vorfall Sie erschreckt hat −“
„Mein Pferd wenigstens hat er erschreckt,“ fiel Erna mit schneller Geistesgegenwart ein. „Es scheute und jagte davon, ich konnte es nicht halten.“
[767] Der Vorwand klang sehr glaubhaft und wurde auch von all den Umstehenden geglaubt; er erklärte vollkommen das stürmische Erscheinen der jungen Dame, ihre sichtbare Angst und Aufregung. Es war ein Glück, daß man das scheue Pferd noch rechtzeitig aufgehalten hatte.
Nur zwei ließen sich nicht täuschen, Wolfgang, dem jene angstvollen Minuten eine Gewißheit gegeben hatten, die jetzt freilich zu spät kam, die er aber doch um keinen Preis hingegeben hätte, und Ernst, der noch immer an seinem Platze hielt, ohne das Auge von den beiden zu wenden; es lag ein bitterer Hohn in seiner Stimme, als er antwortete:
„Dann hätten wir ja ein zweites Unglück haben können! Hast Du Dich jetzt erholt, Erna?“
„Ja!“ versetzte sie tonlos.
„So wollen wir unseren Weg fortsetzen! − Auf Wiedersehen, Herr Elmhorst!“
Wolfgang verneigte sich mit kalter Gemessenheit, er verstand vollkommen, was dies „Auf Wiedersehen!“ bedeutete; aber er wandte sich ruhig zu den beiden Verwundeten, deren Verletzungen sich in der That als ungefährlich herausstellten; auch seine eigene Wunde war nur leicht, ein Steinsplitter hatte ihm im Vorüberfliegen die Stirn gestreift. Der ganze Vorfall schien unerwartet glücklich vorübergegangen zu sein.
Aber es schien nur so, denn wer Waltenbergs Gesicht sah, mußte doch anderer Meinung werden. Er ritt stumm an der Seite seiner Braut, ohne ein Wort zu sprechen, ohne sich ihr ein einziges Mal zuzuwenden; das dauerte Minuten, dauerte eine Viertelstunde lang, bis Erna es nicht mehr zu ertragen vermochte.
„Ernst!“ sagte sie halblaut.
„Du wünschest?“ fragte er.
„Laß uns umkehren, ich bitte Dich! Das Wetter wird drohender und wir können den Rückweg ja über die Bergstraße nehmen.“
„Wie Du befiehlst.“
Sie wandten die Pferde, um auf einem anderen Weg zurückzukehren, und wieder trat jenes Stillschweigen ein. Erna wußte nur zu gut, daß sie sich verrathen hatte; aber sie hätte den wildesten Ausbruch der Eifersucht ihres Verlobten leichter ertragen als dies dumpfe Brüten, das etwas Furchtbares hatte. Sie zitterte freilich nicht für sich, aber eben deshalb sollte und mußte es zu einer Erklärung kommen, sobald man das Haus erreicht hatte.
Doch ihre Absicht wurde vereitelt, vor der Thür der Villa half ihr Ernst zwar vom Pferde, stieg aber sofort wieder in den Sattel.
„Du willst wieder hinaus?“ fragte sie betroffen.
„Ja − ich muß heute noch ins Freie!“
„Bleib’, Ernst, ich wollte Dich bitten −“
„Leb’ wohl!“ unterbrach er sie kurz und schroff, und ehe sie noch einen weiteren Versuch machen konnte, ihn zurückzuhalten, sprengte er bereits davon und ließ sie allein mit einer namenlosen Angst, die ihr das Herz zusammenpreßte, sie wußte ja nicht, was er plante.
Als Ernst den Wald erreicht hatte, mäßigte er den Lauf seines Pferdes und ritt langsam dahin unter den dunklen Tannen, in deren Wipfeln der Herbstwind brauste. Er wollte keine Erklärung, brauchte keine mehr; er wußte ja alles, alles! Aber mitten durch den Sturm, der in seinem Inneren wühlte, brach eine wilde, glühende Genugthuung; der Schatten, der ihn so lange gequält und gemartert, hatte endlich Fleisch und Blut gewonnen; jetzt konnte er mit ihm kämpfen − und ihn vernichten!
Es war Abend geworden, Elmhorst befand sich in seinem Arbeitszimmer mit dem Doktor Reinsfeld, der vor einer halben Stunde gekommen war, und man sah es an den Mienen beider, daß der Gegenstand ihres Gespräches ein tiefernster war, Benno besonders schien sehr erregt zu sein.
„So steht die Sache!“ schloß er jetzt eine längere Auseinandersetzung. „Gronau kam unmittelbar nach der Unterredung mit dem Präsidenten zu mir und ich habe vergebens versucht, ihn von seinem Entschluß abzubringen. Ich gab ihm zu bedenken, daß es ihn seine Stellung bei Waltenberg kosten wird, der ein solches Vorgehen gegen den Oheim und Vormund seiner Braut nicht dulden kann; daß er keine direkten Beweise in Händen hat, daß Nordheim alles dran setzen wird, ihn als Lügner und Verleumder hinzustellen − umsonst! Er warf mir mit den bittersten Worten Feigheit und Gleichgültigkeit gegen das Andenken meines Vaters vor; Gott weiß es, daß er mir damit unrecht thut, aber − ich kann nicht mit einer Anklage auftreten!“
Wolfgang hatte schweigend zugehört, nur um seine Lippen spielte ein unendlich bitteres und verächtliches Lächeln. Es war hohe Zeit gewesen, daß er sich von dem Bündniß mit diesem Manne losmachte, er zweifelte auch nicht einen Augenblick daran, daß Gronau die Wahrheit gesprochen hatte.
„Ich danke Dir für Deine Offenheit, Benno,“ sagte er. „Es wäre sehr verzeihlich gewesen, wenn Du gar keine Rücksicht auf mich genommen und Dich nur als Sohn Deines Vaters gefühlt hättest. Ich weiß, was Du mir mit diesem Vertrauen giebst.“
Benno schlug die Augen nieder bei diesem Danke, denn er war sich bewußt, ihn nicht verdient zu haben. Es war ja nicht der Freund gewesen, den er schonen wollte, als er jene Entdeckung begraben zu sehen wünschte.
„Ich konnte keinen Schritt in der Sache thun, das begreifst Du,“ entgegnete er leise. „Ich muß Dir das überlassen, Du wirst mit Deinem Schwiegervater reden −“
„Nein!“ unterbrach ihn Wolfgang kalt.
Reinsfeld sah ihn erstaunt an.
„Du willst nicht?“
„Nein, Benno; Gronau hat ihm ja offen und rückhaltlos den Krieg erklärt, wie Du sagst; er ist also vorbereitet und übrigens hat sich meine Stellung zu ihm vollständig geändert. Wir haben uns ein für alle Mal getrennt.“
Der Doktor fuhr in grenzenloser Ueberraschung auf.
„Getrennt? Und Deine Verlobung mit Alice −?“
„Ist aufgehoben! Erlaß es mir, Dir das ‚Warum‘ ausführlich auseinander zu setzen. Nordheim hat sich auch mir von der Seite gezeigt, von der Du ihn jetzt kennen gelernt hast; er stellte mir Bedingungen, die ich nicht für vereinbar mit meiner Ehre hielt, und darauf bin ich zurückgetreten.“
Reinsfeld starrte ihn noch immer ganz fassungslos an; er begriff nicht, wie der Mann, der einst alles an diese Verbindung gesetzt hatte, mit solcher Ruhe von dem Scheitern seiner Pläne sprechen konnte.
„Und Alice ist frei?“ stieß er endlich hervor.
„Ja,“ sagte Wolfgang befremdet. „Aber was hast Du denn? Du bist ja ganz außer Dir.“
Benno sprang in heftiger Bewegung auf.
„Wolf, Du hast Deine Braut nie geliebt, ich weiß es ja, sonst könntest Du auch nicht so ruhig, so kalt von ihrem Verlust sprechen. Ich glaube, Du fühlst es nicht einmal, was Du mit ihr verlierst, Du wußtest ja auch nie, was Du an ihr besaßest.“
Die Worte klangen in so leidenschaftlichem Vorwurfe, daß sie alles verriethen. Elmhorst stutzte und heftete einen halb erstaunten, halb ungläubigen Blick auf das Gesicht des Doktors.
„Was soll das bedeuten? Benno, wäre es möglich – Du liebst Alice?“
Der junge Arzt hob die ehrlichen blauen Augen, in denen kein Falsch war, zu dem Freunde empor.
„Du brauchst mir keinen Vorwurf daraus zu machen. Ich bin Deiner Braut mit keinem Worte genaht, das ich nicht vor Dir vertreten kann; und als ich die Unmöglichkeit einsah, meine Liebe zu bekämpfen, da entschloß ich mich zum Gehen. Glaubst Du denn, ich hätte jemals die Stellung in Neuenfeld angenommen, von der ich argwöhnen muß, daß sie von der Hand des Präsidenten kommt, wenn mir ein anderer Ausweg geblieben wäre? Aber ich hatte keine Wahl, wenn ich von Oberstein fort wollte.“
In Wolfgangs Zügen malten sich die widerstreitenden Empfindungen, welche diese Entdeckung in ihm hervorrief. Er hatte freilich seine Braut nie geliebt, aber das Geständniß Bennos berührte ihn doch seltsam und es lag etwas wie Bitterkeit in seiner Stimme, als er antwortete:
„Nun, ich stehe Dir ja jetzt nicht mehr im Wege, und wenn Du Hoffnung hast, Deine Liebe erwidert zu sehen −“
„So wäre es doch umsonst!“ fiel Reinsfeld ein. „Du weißt ja jetzt auch, was zwischen unseren Vätern vorgefallen ist, das trennt mich und Alice für immer!“
„Wie Du nun einmal geartet bist, vielleicht! Ein anderer würde es im Gegentheil benutzen, um Nordheim zu einer Einwilligung zu [768] zwingen, die er freiwillig niemals geben würde. Du wirst das freilich nicht thun, wie ich Dich kenne.“
„Nein, niemals!“ sagte Benno gepreßt. „Ich gehe nach Neuenfeld und werde Alice nicht wiedersehen!“
Sie wurden unterbrochen durch die Meldung, daß Herr Waltenberg da sei und den Herrn Chefingenieur zu sprechen wünsche. Elmhorst erhob sich sofort und auch Reinsfeld machte Anstalt aufzubrechen.
„Gute Nacht, Wolf!“ sagte er, ihm treuherzig die Hand bietend. „Wir bleiben doch, was wir uns stets gewesen sind, trotzalledem - nicht wahr?“
Wolfgang erwiderte fest und warm den Händedruck.
„Ich komme morgen zu Dir − Gute Nacht, Benno!“
Er geleitete ihn bis zu der Thür, durch welche in demselben Augenblicke Waltenberg eintrat; man wechselte einen Gruß und einige gleichgültige Worte, dann ging der junge Arzt, und die beiden anderen waren allein.
Ernst schien auf seinem stundenlangen, einsamen Ritt die Selbstbeherrschung zurückgewonnen zu haben; er war äußerlich wenigstens kalt und ruhig, nur in seinen Augen glühte noch immer jenes unheimliche Feuer, das nichts Gutes verhieß.
„Ich störe Sie hoffentlich nicht, Herr Chefingenieur?“ sagte er, indem er langsam näher trat.
„Nein, Herr Waltenberg, ich habe Sie erwartet,“ lautete die ruhige Antwort.
„Um so besser, dann kann ich mir die Einleitung ersparen. Ich danke!“ unterbrach er sich, als Elmhorst ihn mit einer Handbewegung zum Sitzen einlud. „In unserem Falle sind diese Höflichkeitsformen überflüssig. Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, weshalb ich Sie aufsuche. Wir fassen wohl beide den Vorfall von heute nachmittag anders auf, als die Fremden, welche Zeugen davon waren, und ich habe einige Worte mit Ihnen darüber zu reden.“
„Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung,“ erklärte Wolfgang mit eisiger Höflichkeit.
Ernst kreuzte die Arme und seine Stimme gewann einen Anflug von Hohn, als er fortfuhr:
„Ich bin mit Baroneß Thurgau verlobt, wie Sie ja wissen, und bin nicht gesonnen, meiner Braut eine so stürmische Theilnahme an der Gefahr eines anderen zu gestatten − doch das werde ich mit ihr selbst ausmachen. Für jetzt wünsche ich nur zu wissen, inwiefern Sie daran betheiligt sind. Lieben Sie Fräulein von Thurgau?“
Die Frage klang dumpf und drohend, aber Wolfgang zögerte nicht mit der Antwort. „Ja!“ sagte er einfach.
Ein Blitz tödlichen Hasses zuckte aus den Augen Waltenbergs und doch sagte ihm dies Geständniß nichts Neues. Er wußte es ja aus Ernas eigenem Munde, daß sie einen anderen geliebt hatte, aber er glaubte, diesen anderen im Grabe, unter den Schatten suchen zu müssen. Jetzt stand er lebend vor ihm, der Mann, der keiner reinen und großen Liebe fähig gewesen war, der eine Erna dem elenden Mammon geopfert hatte, und stand so hochaufgerichtet, die Stirn so stolz erhoben, als brauche er sie vor niemand auf der Welt zu beugen. Das reizte Ernst nur noch mehr.
„Und diese Liebe datirt vermuthlich nicht erst von heut oder von gestern?“ fragte er. „So viel mir bekannt ist, verkehrten Sie schon jahrelang im Hause des Präsidenten, bevor ich nach Europa zurückkehrte, bevor Baroneß Thurgau gebunden war.“
„Ich bedaure, eine solche Erörterung ablehnen zu müssen,“ erklärte Wolfgang in demselben eisigen Tone wie vorhin. „Ich werde Ihnen Rede stehen auf jede Frage, zu der Sie ein Recht haben; examiniren lasse ich mich nicht.“
„Das glaube ich!“ rief Waltenberg mit bitterem Auflachen. „Sie würden auch schlecht bestehen bei diesem Examen als − Bräutigam von Alice Nordheim!“
Elmhorst biß sich auf die Lippen; das traf seine verwundbare Stelle; aber schon in der nächsten Minute hatte er sich gefaßt.
„Vor allen Dingen, Herr Waltenberg, ersuche ich Sie, diesen Ton zu ändern, wenn Sie überhaupt wünschen, daß wir das Gespräch fortsetzen. Ich dulde keine Beleidigungen, das sollten Sie nachgerade wissen, und von Ihnen dulde ich sie am wenigsten.“
„Es ist nicht meine Schuld, wenn die Wahrheit Sie beleidigt,“ gab Ernst hochmüthig zurück. „Widerlegen Sie meine Worte und ich bin bereit, sie zurückzunehmen. Bis dahin erlauben Sie mir wohl, mein eigenes Urtheil über einen Mann zu haben, der eine junge Dame liebt oder zu lieben vorgiebt, während er sich gleichzeitig um eine reiche Erbin bewirbt. Sie können doch unmöglich Achtung verlangen für eine solche Erbärm −“
„Genug!“ fiel ihm Wolfgang mit mühsam beherrschter Stimme ins Wort. „Es bedarf keiner Beschimpfung, um Ihren Zweck zu erreichen. Ich errathe vollkommen, was Sie hergeführt, und werde Ihnen nicht ausweichen. Dergleichen Worte aber verbiete ich Ihnen − ich bin in meinem Hause!“
Er stand todtenbleich, aber ungebeugt vor dem Gegner. Dieser Elmhorst hatte nun einmal etwas Imponirendes, selbst in der Art, wie er die verdiente Verachtung zurückwies; es war ihm nicht beizukommen damit, das fühlte Ernst, wenn auch widerwillig genug.
„Sie sprechen ja in sehr hohem Tone!“ sagte er mit herbem Spotte. „Schade, daß Ihre Braut nicht Zeuge dieser Unterredung ist, vielleicht würden Sie ihr gegenüber nicht so selbstbewußt auftreten.“
„Ich habe keine Braut mehr!“ erklärte Wolfgang kalt.
Waltenberg trat aufs äußerste betroffen einen Schritt zurück.
„Was − wollen Sie damit sagen?“
„Nichts! Ich theile Ihnen nur eine Thatsache mit, um Ihnen zu zeigen, daß die Voraussetzung, auf welche hin Sie mich beleidigten, nicht mehr zutrifft, denn ich war es, der zurücktrat.“
„Und wann? Aus welchem Grunde?“ Die Frage klang in athemloser Hast.
„Darüber bin ich Ihnen wohl keine Rechenschaft schuldig.“
„Vielleicht doch, denn wie mir scheint, wird hier auf meine Großmuth gerechnet. Darin täuschen Sie sich aber. Ich gebe Erna niemals frei und sie selbst wird diese Freiheit auch nie von mir erbitten, das weiß ich. Sie giebt nicht heute ihr Wort, um es morgen wieder zu brechen, und sie ist viel zu stolz, sich einem Manne nachzuwerfen, der das Geld ihrer Liebe vorzog.“
„Hören Sie doch endlich auf, die alte Waffe zu brauchen, sie hat ihre Spitze verloren,“ sagte Wolfgang finster. „Was wissen Sie, der in der Fülle des Reichthums aufgewachsen ist, dem nie die Entbehrung, nie die Versuchung nahte, von dem Kämpfen und Ringen eines Emporstrebenden, der sich um jeden Preis freie Bahn schaffen will, von dem glühenden Ehrgeiz, der ein großes Ziel vor Augen hat! Ich bin der Versuchung erlegen, ja; aber jetzt habe ich mich frei gemacht und biete Ihnen und Ihrem Tugendhochmuth die Stirn. Sie wären auch unterlegen, wenn Ihnen das Leben Glück und Genuß versagt hätte, Sie zuerst! Aber Sie hätten sich vielleicht nicht daraus emporgerissen wie ich, denn leicht ist das wahrlich nicht.“
Es lag eine so zwingende Wahrheit in den Worten, daß Ernst davor verstummte. Er, dem der schrankenlose Genuß eine Lebensbedingung war, hätte schwerlich vor der Versuchung bestanden; aber eben weil er das fühlte, haßte er um so mehr den Mann, der Sieger geblieben war in dem schwersten Kampfe, in dem Streite mit sich selbst.
„Und nun gehen Sie hin und halten Sie Ihre Braut fest an dem gegebenen Worte,“ fuhr Wolfgang bitter fort. „Sie wird es nicht brechen und sie wird mir nicht verzeihen, was geschehen ist, darin haben Sie recht. Ich habe meine Schuld mit meinem Glücke bezahlt. Erzwingen Sie sich die Hand Ernas, ihre Liebe werden Sie sich nie erzwingen, denn die gehört mir − mir allein!“
„Ah, Sie wagen es −!“ fuhr Ernst wie ein Rasender auf, aber Wolfgangs Blick begegnete mit kühnem, stolzem Triumph dem seinigen, in dem es unheilverkündend glühte.
„Nun, weshalb wollen Sie denn sonst mit mir rechten? Daß ich Ihre Braut liebe, ist doch wohl keine Beleidigung; daß ich geliebt werde, können Sie nicht verzeihen − ich weiß es freilich auch erst seit heute!“
Waltenberg sah aus, als hätte er sich am liebsten auf den Gegner gestürzt, um das Wort zu rächen, das er nicht mehr Lügen strafen konnte;seine Stimme klang halb erstickt vor Leidenschaft, als er antwortete:
„Nun, dann werden Sie es begreifen, daß ich die Liebe meiner Braut mit keinem anderen theilen will, wenigstens mit keinem, der mir lebend gegenübersteht!“
Elmhorst zuckte nur die Achseln bei dieser Drohung.
„Soll das eine Forderung sein?“
[769]
[770] „Ja, und ich denke, wir machen die Sache so rasch als möglich ab. Ich werde Ihnen morgen Herrn Gronau schicken, um das Nöthige festzustellen, und ich hoffe, Sie sind einverstanden, wenn wir noch an demselben Tage −“
„Nein, das bin ich nicht,“ unterbrach ihn Wolfgang. „Ich habe morgen keine Zeit, auch übermorgen nicht.“
„Keine Zeit für eine Ehrensache?“ brauste Ernst auf.
„Nein, Herr Waltenberg. Ich habe überhaupt keine große Achtung vor dieser ‚Ehrensache‘, die darin besteht, daß man einen Mann, den man haßt, möglichst bald aus der Welt zu schaffen sucht. Aber es giebt Fälle, wo man gegen seine Ueberzeugung handeln muß, um nicht in den Verdacht der Feigheit zu gerathen. Ich bin also bereit. Aber wir Männer der Arbeit haben noch eine andere Ehre als die kavaliermäßige, und die meinige erfordert, daß ich mich nicht der Möglichkeit aussetze, niedergeschossen zu werden, bevor die Aufgabe, die ich übernommen habe, erfüllt ist. In acht bis zehn Tagen wird die Wolkensteiner Brücke fertig sein. Ich will selbst den Schlußstein legen, will mein Werk vollendet sehen, dann stehe ich zu Ihrer Verfügung, nicht eine Stunde früher, und Sie werden sich diesen Aufschub gefallen lassen müssen.“
Es lag eine beinahe verächtliche Ueberlegenheit in der Art, wie das Verlangen gestellt wurde, und hier wurde es einem Manne gestellt, der überhaupt kein Verständniß dafür hätte. Er hatte ja nie gearbeitet, nie ein Werk geschaffen, das er liebte und vollendet sehen wollte, sondern immer nur gethan, wozu Wunsch und Laune ihn trieb. Jetzt trieb es ihn zur Vernichtung des Feindes oder zum eigenen Untergange − gleichviel, danach fragte er nicht; aber warten zu müssen, tagelang, seine Rachsucht zu zügeln, das schien ihm ein Ding der Unmöglichkeit.
„Und wenn ich diese Bedingung nicht annehme?“ fragte er scharf.
„So nehme ich Ihre Forderung nicht an − Sie haben die Wahl.“
Ernst ballte in verhaltener Wuth die Hand, aber er sah, daß er sich fügen mußte; wenn der Gegner sich ihm stellte, so hatte er auch das Recht, den Aufschub zu verlangen.
„Es sei!“ sagte er, sich gewaltsam bezwingend. „Also in acht bis zehn Tagen! Ich verlasse mich auf Ihr Wort.“
„Das hoffe ich! Sie werden mich bereit finden.“
Noch ein stummer, feindseliger Gruß von beiden Seiten, dann trennten sie sich. Ernst verließ das Gemach und Wolfgang trat langsam an das Fenster.
Draußen warf der Mond, der nur hin und wieder zwischen den jagenden Wolken sichtbar wurde, sein ungewisses Licht auf die Umgebung. Jetzt trat er auf einen Moment klar hervor, und in seinem Schein blinkte die Brücke auf, das große, kühne Werk, das seinem Schöpfer eine so stolze Zukunft verhieß. Und in demselben Mondesstrahle schritt der Mann dahin, der ihm den Tod geschworen hatte, dessen Hand sicher nicht fehlte, wenn es galt, den Todfeind zu treffen. Wolfgang täuschte sich darüber nicht; er schloß jetzt ab mit den Zukunftsträumen, wie er schon mit dem Glücke abgeschlossen hatte.
Wieder wanderte ich nach tagelanger Eisenbahnfahrt mutterseelenallein meinem Heimathdörfchen zu, und wieder schwelgte ich in glücklichen Träumen aus goldenen Tagen der Kindheit. Sage und Volkslied, Sitte und Brauch, kurz: die ganze liebe Heimath, der Hansjochenwinkel der Altmark, wurde vor meinem geistigen Auge um so lebendiger, je weiter ich in Wirklichkeit wieder einmal in sie hinein kam.
Aber war sie denn auch wirklich noch die alte, diese Heimath um mich her? Jene kleinen altehrwürdigen, strohbedachten Bauernhäuser, wohin waren sie doch gekommen? Moderne Zwitterbauten von Stadt- und Landwohnungen standen an ihrer Stelle und schauten unbeholfen neugierig um sich wie hoch aufgeschossene Kinder, die noch nichts erlebt haben. Und der Wald und große Strecken Gestrüppbodens, wo waren sie nur geblieben? Sie waren dem Pfluge des emsigen Landmannes gewinnen. Ja, sie war eine andere geworden, die traute Heimath, als sie ehedem war, da ich als Bauernjunge hier durch Flur und Feld, durch Wald und Wiese streifte; da ich hinter dem mächtig großen Kachelofen hervor Großmütterleins Spukgeschichten und ihren Sagen lauschte; da ich schüchtern mein dünnes Kinderstimmlein hineinmischte in jene Weisen, welche in der Spinnstube erklangen, und die ich seitdem nimmer und nirgend wieder vernommen.
„Dir werden sie geblieben sein, deine Lieder sowohl wie deine Sagen, du Land des zähen, knorrigen Volksstammes wendisch-deutscher Herkunft!“ tröstete ich mein trauerndes Gemüth, und in übermüthigem Scherzen setzte ich hinzu: „Denn wo diese schweigen, da werden die Steine reden.“ Kannte ich sie dereinst doch alle gar gut, jene Steine, welche, von Volkssagen umrankt, hierorts seit uralten Zeiten in Feld und Wald zerstreut lagen.
Gleich rechts am Wege mußte ja schon einer derselben zu finden sein, der Dahrendorfer Lenekenstein, jene aus dem Hannöverischen ins Preußische herübergeholte Braut, die an dieser Stelle für alle Ewigkeit in Stein verwandelt liegt. Doch was ist eine Ewigkeit für uns sterbliches Geschlecht! Die ewige Dauer des Lenekensteins war wenigen Scherben gewichen, die vom Zerstückeln desselben das einzige, aber auch das beredtste Zeugniß ablegten. −
Später stand ich dann wieder an der Stelle, an welcher der Teufelstein von Holzhausen lag; aber auch dieser war vom gewinnsüchtigen Besitzer zerschlagen und zum Stahlbau abgefahren. Wie lange, und jene Sage vom goldenen Sarge oder von der goldenen Wiege unter ihm, aus dem heraus allnächtlich des Teufels Gold vom Berge weithin sichtbar brannte, wird verklungen sein. Niemand wird dann mehr zu berichten wissen vom Schäfer Krone, der den Schatz hob und nach Hamburg verkaufte und dem dafür der Gottseibeiuns den Hals umdrehte; oder vom Pferdehirten, der nachts um die zwölfte Stunde am Steine im Aschenhausen feurige Kohlen glimmen fand und darüber hinwegstrich, um nach der Weise von Leuten mit hartschwieligen Händen eine glühende Kohle zu haschen, damit die Pfeife anzuzünden. Als unser Hirt jedoch nach einer zweiten Kohle langen wollte, ertönte plötzlich der warnende Zuruf, es bei dem einen Griffe bewenden zu lassen. Andern Morgens aber, als der Pferdehirt wiederum zur Stelle kam, waren alle Kohlen, die er beim Aufrühren des Aschenberges gestreift hatte, in blitzblanke Goldklümplein verwandelt. So der geheimnißreiche Mund der Volkssage.
Und wieder stand ich am Markauer Lenekenstein, der − nebenbei bemerkt − in Nr. 19 der „Gartenlaube“ von 1882 abgebildet ist. Die mit dem Steine verbundene Sage erzählt von Schön-Lenchen aus Bonese, das den Sohn des reichen Schulzen von Markau heirathen sollte und ihn durchaus nicht wollte, weil es heimlich sich mit dem Knechte des Nachbarn versprochen hatte. Auf der Hochzeitsfahrt erklärte sie dann an der Markauer Feldmarkgrenze, diese nicht überschreiten, sondern lieber „auf der Stelle zu einem Stein“ werden zu wollen. Und indem sie vom Wagen sprang, ging sofort ihr Wunsch in Erfüllung; sie wurde zu einem mächtigen Steine, an dem man noch lange zwischen elf und zwölf Uhr in mondhellen Nächten die Brautperlen am Halse glänzen sehen konnte.
Der Stein stand allerdings noch an Ort und Stelle, aber seine Brüder, die um ihn herum im Kreise gelegen hatten und die für den späteren Forscher von so großer Bedeutung sind, waren zerkleinert und abgefahren. „Warte nur, balde“ wird auch der Lenekenstein selber verschwunden sein. − Und das alles geschieht ist einem Landstriche, der, wörtlich genommen, steinreich ist, in dem ein erratischer Block nur ganz verschwindenden Werth hat, da es deren in Hülle und Fülle giebt; geschieht dort unter den Augen der Behörde, unter den Augen von Alterthumsfreunden. Ja, die Behörde hat sogar später selber im eigenen Interesse zum Bau einer Kreischaussee von jenem Lenekensteinen verwendet. „Wenn das geschieht am grünen Holz, was soll man vom dürren sagen!“ −
Vor zwei Jahren habe ich meine Stimme an einer Stelle, deren Einfluß und guten Willen ich wohl überschätzte, um behördlichen Schutz für die kärglichen Reste sagenumrankter Steine im Hansjochenwinkel der preußischen Altmark erhoben: mir ward das Loos eines Predigers in der Wüste. Ich lasse meine Stimme heute an dieser Stelle laut werden; möchte man mich doch hören, ehe es gänzlich zu spät ist. Nur die Behörde kann in dieser Sache mit Erfolg nachhaltig wirken, und es ist Ehrenpflicht für sie, es zu thun, es endlich zu thun. Sind ja doch nicht einmal alle unsere Hünengräber vor dem Untergange gesichert worden! So ist man z. B. im Begriff, das im Jahrgang 1882 der „Gartenlaube“ (Nr. 41) abgebildete „Hünengrab“ bei Borne in der Magdeburger Börde um 50 Pfennig die Fuhre abzufahren. Freilich nützen Verfügungen, von oben her in bester Absicht erlassen, so lange nicht nachhaltig, bevor nicht Jahr für Jahr ihre Ausführung an untersten Stellen strengstens überwacht wird. Auch auf dem Wege der Belehrung, namentlich durch Presse und Schule ließe sich bei der Landbevölkerung sicherlich vieles erreichen. − Wie viele Volkssagen in deutschen Landen noch immer an Steine anknüpfen, davon zeugt unter anderem eine Sammlung von Steinsagen, die in der Zeitschrift für volksthümlich-wissenschaftliche Kunde „Am Urdsbrunnen“ auf meine Veranlassung vorgenommen worden ist, davon zeugen für die Altmark im besondern des hochverdienten Temmes „Volkssagen aus der Altmark“. −
Möchte mein Mahnruf diesmal gehört werden, nicht nur in der Altmark, sondern im weiten deutschen Vaterlande: das ist mein Herzenswunsch! −
„Die Hexe kommt!“ Voll Schrecken, bang und bleich
Duckt sich die Schar der Kleinen ins Gesträuch,
Wenn sie im Walde naht die finstre Alte. –
Ihr kennt das Hüttlein an der Rothwandspalte,
Das wie ein morsches Nest am Abgrund schwebt,
Von Waldgerank und Tobeldunst umwebt,
Dort haust sie, einsam wie ein Uhu haust,
Vom Volk gemieden. Selbst den Förster graust,
Wenn er des Nachts am Kreuzpfad ihr begegnet,
Daß er, ein Sprüchlein murmelnd, fromm sich segnet:
Denn schier unhörbar, meint er, schritt ihr Fuß. –
Wohl dreizehn Jahre hat sie Dank und Gruß
Nicht einem mehr gegönnt; seit man im Tann
Am Hochstein fand erschlagen ihren Mann,
Den Waldwart, hingestreckt in blut’ge Lache –
Es war ein Graus! Noch schreit das Blut um Rache!
Den rothen Berndt sprach der Gerichtshof frei
Ob mangelnder Beweise. Keck vorbei
An ihrem Zeugenstuhl mit Hohngelächter
Schritt er zum Saal hinaus, der reiche Pächter.
Fest, aufrecht hinter ihren Gitterstäben
Stand sie, die Faust geballt in Wuth und Beben,
Den Blick gewandt nach ihm voll Hassesflammen –
„Frei war er! Frei!“ Erschöpft brach sie zusammen.
Dann schritt sie heim, starr, wortlos, ohne Klage.
Vom Leben aber wandt’ seit jenem Tage
Ihr Herz sich ab und schloß der Welt die Thür –
Wohl zahlt den Zins, den Schoß sie nach Gebühr –
Doch nie mehr sah man sie im Kirchlein knie’n
Und nie hat sie den Spruch der Welt verzieh’n.
Der Pfarrherr sprach: „Die Rache steht bei Gott!“
„Nein, Herr!“ rief sie, „hier muß er aufs Schafott!“
Und als der Graf das Gnadenbrot ihr bot,
Sprach sie: „Herr Graf, mir thut nur eines Noth -
So lang' die Blutthat nicht an ihm gerächt,
Will ich nicht Gnade, Herr – ich will mein Recht!“
Dann ging sie. Nur das Hüttlein nahm sie an,
Das einst aus Trümmern hier erbaut ihr Mann;
Drin lebt sie dorffern, freundlos, winterhart,
Vom Schnee umbaut, in Grimm und Gram erstarrt.
Der Amtmann meint, daß Wahn ihr Hirn umstrickt;
Doch wer ins strenge Auge ihr geblickt,
In ihres Antlitz’ Runen las, der weiß,
Daß hier ein Geist noch lodert hell und heiß.
Der Wald nur ist ihr Freund. Sein fromm’ Gethier,
Selbst Reh und Häslein flieh’n nicht mehr vor ihr;
Oft dünkt ihr fast, als lausche er vertraut,
Spricht sie mit ihrem Gott geheim und laut.
Kaum von der Kreatur des Wald’s geschieden,
Lebt sie dahin in seinem Bann und Frieden,
Verwittert selbst schon wie ein greiser Baum –
O spinne um sie deinen stillen Traum,
Gieb ihr ein Grab, o Wald, in kühler Erde,
Daß endlich Ruh’ auch diesem Herzen werde!
Zwei neue Berliner Theater. Die deutsche Reichshauptstadt nimmt von Jahr zu Jahr an Umfang und Bevölkerung zu, kein Wunder, daß sie auch in Bezug auf das Theaterleben sich in ungeahnter Weise entfaltet. Neben dem Schauspielhause hat ein Theater gleicher Tendenz, das Deutsche Theater, bisher erfreuliche Erfolge zu verzeichnen, und nun ist diesen beiden Bühnen eine neue doppelte Konkurrenz erwachsen: am 11. Sept. ist das Lessing-Theater, am 16. das Berliner Theater eröffnet worden, beide wirken mit schauspielerischen Kräften ersten Ranges, und wenn das erstere mehr ein das Konversationsstück pflegendes Salontheater, das letztere ein Volkstheater für die große Tragödie und das Schaustück werden will, so treten sie doch beide mit gleichen Ansprüchen neben das Hoftheater und das Deutsche Theater und wollen wie diese berufener Dichtung im ernsten und heiteren Genre ein Asyl gewähren. Daneben bestehen zahlreiche Bühnen fort, welche mehr oder weniger eine Specialität pflegen, sei es die großen Ausstattungsstücke mit Ballet oder die französischen Dramen von der Seine, das derbere Lustspiel, den Schwank und die Operette.
Der Theatersinn der Berliner Bevölkerung ist so regsam, daß daß man wohl annehmen darf, dem gesteigerten Angebot werde eine gesteigerte Nachfrage entsprechen. Der Wetteifer der Bühnen kommt dem Publikum zugute, aber auch der dramatischen Litteratur, die bisher, an einer oder zwei Thüren zurückgewiesen für Berlin gleichsam todtgeschwiegen wurde. Jetzt ist für mannigfache Richtungen und Talente freier Spielraum geschaffen und Werke, die aus irgend welchen Rücksichten von der einen Bühne zurückgewiesen wurden, bei der andern wegen irgend einer Geschmacksverschiedenheit der Direktion keine Annahme fanden, dürfen jetzt darauf rechnen, an dieser oder jener Stätte der Kunst das Licht der Prosceniumslampen zu erblicken. Die bestehenden Bühnen aber werden sich mehr als früher vor jeder Einseitigkeit oder Engherzigkeit hüten müssen, denn die Erfolge der Konkurrenten mit abgewiesenen Dramen würden ihnen doch das peinliche Gefühl einer in aller Stille erlittenen Niederlage nicht ersparen.
Das Lessing-Theater ist am 11. September mit einer Aufführung von „Nathan der Weise“ eröffnet worden. Ein von dem Direktor Dr. Oskar Blumenthal gedichteter Prolog, den Frau Claar-Delia sprach, hob besonders hervor, daß das Haus der modernen Muse geweiht sein solle. Die Aufführung eines Lessingschen Dramas galt gewissermaßen dem Schutzheiligen des Hauses, welches die Pflege der Klassicität sonst nicht zu seinen Aufgaben zählt. Den „Nathan“ spielte Herr Possart; er ist nicht bloß die hervorragendste künstlerische Kraft des Lessing-Theaters, er führt auch, wie lange Jahre in München, die Oberregie und wird nächst dem Direktor die Seele des ganzen Unternehmens sein. Eine Salondame wie Frau Claar-Delia, der für später gewonnene treffliche Charakterspieler Herr Adolf Klein, der den Derwisch im „Nathan“ mit glänzendem Erfolg spielte, werden nebst jüngeren Kräften die künstlerischen Träger des Unternehmens sein.
Der Theaterbau selbst, unter der Leitung der Architekten von der Hude und Hennicke, unter der technischen Leitung des Regierungsbaumeisters H. Weiß entstanden, hat alle Erfordernisse und Errungenschaften der Neuzeit auf diesem Gebiete berücksichtigt. Das Theater liegt frei, überall zugänglich; die Grundform ist der des Königlichen Schauspielhauses nachgebildet, das Vestibül enthält als Hauptzierde die schöne Eberleinsche Gruppe, einen Genius, die Büste Lessings kränzend. Die Korridore sind bequem, die Garderoben ebenfalls. Für je eine Gruppe von Parkettbänken ist eine besondere Thür angebracht; das Foyer macht mit seiner Ausschmückungen weißen und matten Farben und Gold einen vornehmen Eindruck; dasselbe gilt von der in leichtem Rokoko gehaltenen Dekoration des Zuschauerraums in Blatt, Weiß und Gold; die Wände sind mit röthlich-braunen Tapeten bekleidet. Um das Parkett zieht sich ein halbkreisförmiger sehr breiter Wandelgang. Elektrisches Licht durchstrahlt alle Räume; für die Feuersicherheit sind nicht nur durch einen eisernen Vorhang, sondern auch durch zahlreiche höchst bequeme Ausgänge ins Freie die besten Vorkehrungen getroffen worden.
Doch eine Merkwürdigkeit bietet das Lessing-Theater: es hat kein Orchester, weder ein hoch-, noch ein tiefgelegenes. Es ist so ausschließlich der Schauspielkunst, dem recitirenden Drama gewidmet, daß auch alle musikalisch-dramatischen Mischgattungen ausgeschlossen sind. Für das moderne Konversationsstück soll hier eine Stätte geschaffen werden, welche von Hause aus auch jenes höhere Drama ausschließt, das eine pomphafte Inscenirung verlangt, deren Effekt mehr oder weniger durch Orchesterwirkungen erhöht wird.
Das „Berliner Theater“, dessen Scepter Ludwig Barnay schwingt, ist am 16. September eröffnet worden. Das frühere Walhallatheater, dem Dienst der heiteren Operettenmuse geweiht, ist in fast allen seinen Theilen vollständig umgebaut worden, so daß es nach jeder Richtung hin den Eindruck eines prächtigen Neubaus macht. Die Bühne wurde tiefer gelegt und durch Anbau an den Seiten und Ausbau nach hinten bedeutend vergrößert, ebenso erhöht durch Aufsetzen eines Stockwerkes. Obermaschinenmeister Lautenschläger in München hat dieselbe mit allen Einrichtungen versehen, welche die neueste Zeit erfunden und welche eine Bühne für die Aufführung großer Schaustücke geeignet machen. Die Fassade ist prächtig und künstlerisch durchgeführt. Was die inneren Einrichtungen betrifft, so sind zunächst die Treppen, Korridore und Eingänge nach allen Seiten hin bedeutend vergrößert und verbreitert worden. Das Vestibül ist geschmackvoll, prächtige Foyers befinden sich im Souterrain; das Logenhaus ist gänzlich neu gemalt und dekorirt; das Parkett ist erhöht, das Orchester tiefer gelegt, und wenn es geräumt werden muß, werden elegante Orchesterfauteuils die Stelle der Musikerpulte einnehmen. Das Haus und die Bühne sind durchweg elektrisch beleuchtet.
Der Leiter, der am Steuerruder des neuen Bühnenschiffs steht, hat sich in Deutschland als dramatischer Künstler einer hervorragenden Stellung zu erfreuen, wie er auch als Vorkämpfer der Bestrebungen des Schauspielerstandes für die Wahrung seiner berechtigten Interessen in erster Linie genannt wurde. Es ist Ludwig Barnay, dem die „Gartenlaube“ bereits vor Jahren einen eingehenden Artikel widmete (Jahrgang 1878, Heft 1). Sein energisches Darstellungstalent hat er besonders in den großen Aufgaben der Tragödie bewährt oder in der Darstellung eigenartiger Schauspielhelden wie „Graf Waldemar“. So wird auch das von ihm geleitete Institut seinen Schwerpunkt in der großen Tragödie suchen und damit eine Volksbühne im wahren Sinn des Wortes werden; denn was man auch hierüber fabuliren mag: wahrhaft volkstümlich ist heutigen Tages das große Trauerspiel Shakespeares, Friedrich Schillers und ihrer Nachfolger, wenn auch das eigentliche Theaterpublikum im engeren Sinn sich mehr dem leichteren Genre der Bühnendichtung zuneigt. Freilich, eine Darstellung mit hervorragenden und würdigen Kräften ist die Bedingung für den Erfolg der großen Tragödie; sonst bleibt ja den Gleichgültigen oder denen, die gegen die Erzeugnisse des dichterischen Genius blasirt sind, die willkommene Ausrede, daß die unwürdige Darstellung des Großen und Würdigen jeden Genuß verkümmere und unmöglich mache. Daß ein Volkstheater höheren Stils auch die andern dramatischen Gattungen pflegen wird, ist selbstverständlich.
Die Künstlerschar, die sich um die Fahne des neuen Bühnenleiters sammelt, rekrutirt sich zum Theil aus glänzenden Namen des netten Theaters. Da ist Klara Ziegler, die imposante, mit den schönsten Mitteln ausgerüstete Heroine unserer Bühne; da ist Friedrich Haafe, der ausgezeichnete Meister der Kabinetsmalerei und der großen Charakterzeichnung in der Tragödie; da ist Hedwig Niemann-Raabe, die vortreffliche Schauspielerin, die aus dem Fache der Naiven zu den Heldinnen des Rührdramas übergegangen ist, und diese beiden letzteren bürgen dafür, daß auch das Schauspiel zu seinem Rechte kommen wird; da ist Kainz, der jugendliche Liebhaber, der durch sein Feuer zündende Wirkungen ausübt.
Die Eröffnungsvorstellung brachte den Schiller-Laubeschen „Demetrius“; die Aufnahme war eine begeisterte; von namhaften Künstlern den sogenannten stars, wirkte Klara Ziegler als Marfa mit. Die Hoheit [772] ihrer Erscheinung, die Modulationsfähigkeit ihres klangvollen Organs brachten besonders den schwunghaften Monolog Schillers zu zündender Geltung. Die Inscenirung von seiten des Direktors Barnay fand die wärmste Anerkennung.
Hoffentlich nimmt die Direktions- und Regiethätigkeit den Künstler Ludwig Barnay nicht so in Anspruch, daß er außer seinen bekannten Glanzrollen auch neue einzustudiren vermag, um dem Repertoire der Gegenwart nicht bloß an seinem neuen Theater eine Stätte zu bereiten, sondern ihm auch durch sein hervorragendes künstlerisches Talent festen Halt zu geben.
Ein Künstlerjubiläum. Am 4. Oktober feierte in Leipzig ein Künstler seinen achtzigsten Geburtstag, der auf seinem Gebiete bahnbrechend gewirkt hat, der ehrwürdige Senior der Aquarellmalerei, Karl Werner. In der Musenstadt Weimar am 4. Oktober 1808 geboren, studirte er auf der Akademie und Universität in Leipzig, dann in München, wo er hauptsächlich Landschaften mit Architektur malte. Zwanzig Jahre lang hielt er sich dann in Italien auf, wo seine Kunst sich in gleicher Richtung schöpferisch zeigte. Die Architektur und Geschichte der italienischen Städte wirkten in hohem Maße anregend auf dieselbe, namentlich Venedig, die Marmorstadt der Lagunen, bot ihm reiche Ausbeute; wir erwähnen hier nur seine großen Bilder „Venedig in seinem Glanze und seinem Verfall“, „Der Dogenpalast mit einer Scene aus Shakespeares ‚Kaufmann von Venedig‘“, "Der Triumphzug des Dogen Contarini“, und auch den benachbarten Lagunenstädten gewann er Vorlagen für seine Bilder ab, wie sein in Nr. 41 unseres Blattes aufgenommenes Bild „Der Markuslöwe von Torcello“ beweist. Von einer Reise nach Spanien 1857 brachte er sein schönes Bild „Der Löwenhof der Alhambra“ mit. Die Hauptstoffquelle für seine Aquarellmalerei bot ihm indeß der Orient, boten ihm die Reisen von 1862 und 1864 nach Aegypten, Syrien und Palästina. Wie viele Stätten des heiligen Landes hat er uns lebensvoll und stimmungsvoll vorgeführt! Eine Londoner Ausgabe dieses Albums umfaßt 30 Blatt mit Text. Obschon Werner seinen festen Wohnsitz in Leipzig genommen, so war er doch nach wie vor häufig auf längeren Reisen abwesend, 1875 in Griechenland, 1877 bis 1878 im Sudan, 1881 in Skandinavien. Seit 1882 bekleidet er ein Lehramt an der Leipziger Akademie.
Werner ist ein Meister der Aquarellmalerei und hat zuerst gezeigt, daß dieselbe an Kraft und Glanz der Farbe mit der Oelmalerei wetteifern kann. Auch in den äußern Maßen, in der Größe dieser Aquarellbilder hat er einen solchen Wettkampf nicht gescheut. „Wasser thut’s freilich nicht“ – sagte der eine Festredner bei der Jubiläumsfeier mit Bezug auf Luthers Ausspruch – „es muß auch Geist bei dem Wasser sein.“ Und diesen Geist hat Werner in allen seinen Schöpfungen bewährt. Der ausnehmend produktive, bei hohen Jahren noch unermüdlich schaffende Künstler hat die deutsche Aquarellmalerei der französischen und englischen ebenbürtig hingestellt und übertrifft beide noch mit Bezug auf die Präcision der Zeichnung.
Wünschen wir, daß der würdige Nestor der Kunst noch lange seine geistige Jugendfrische bewahren möge!Des Jägers Freude. (mit Illustration S. 757.) An einem sonnigen, windstillen, nicht zu kalten Wintertage sind wir auf dem Felde zur Hasensuche. Zur Linken geht mit würdigem Schritt Nimrod, der „ferme“ Gebrauchshund. Kaum giebt es ein unweidmännischeres Jagen, als die Suche auf Hasen ohne einen solchen Begleiter.
Jetzt sind wir auf einem Sturzacker, da sitzt der Hase gern. Richtig! Dort auf 100 Schritt, viel zu weit zum Schuß, geht schon einer los – „der Bursch muß anderes Wetter im Kopfe haben, sonst hielte er wohl besser“ – denkt der Jäger. Nimrod bleibt stehen, hebt den Kopf höher und sieht ruhig Meister Lampe nach. Dieser stellt sich auf die Hinterläufe, besieht sich Jäger und Hund aus sicherer Entfernung, rekognoscirt dann das Feld vor sich und hoppelt „mit der Blume schnirzelnd“ (das Schwänzchen auf und ab bewegend) gemüthlich weiter. Es ist ein Rammler; schade, daß es zu weit war. Jetzt steht einer auf 20 Schritt auf – es knallt – und mit dreimaligem Purzelbaum tritt er seine Reise ins Jenseits an. Noch bevor Nimrod bei ihm ist, wird wieder einer hoch – aber ziemlich weit. Die Schroten sausen ihm um den Kopf, die Wolle stiebt − aber Lampe ist scheinbar gesund und flüchtig geht er ab. Nimrod, apporte! Der brave Hund versteht seinen Herrn – über den verendeten Hasen hinweg geht’s dem kranken nach. Immer näher kommt er demselben – nur noch wenige Schritte trennen beide – da sieht Lampe, daß er verfolgt wird, und jetzt strengt jeder seine Kräfte an. Den einen treibt die Todesangst, den andern die Jagdleidenschaft – und beides sind sehr scharfe Sporen. In wildem Wettlauf geht’s dem nahen Buschwald zu. Schon ist Nimrod seinem Opfer fast zum Greifen nahe – ein Sprung – aber Lampe duckt sich – und der Hund schießt weit über ihn hinweg. Wieder hat der Hase einen Vorsprung gewonnen und beide verschwinden in den dichten Büschen. Das sind lange, erwartungsvolle Minuten – banges Hoffen, eine der vielen süßen Foltern, die das Jagen würzen. Endlich – endlich trabt er aus den Büschen − den Hasen im Rachen − „Nimrod, bist ein braver Kerl – des Jägers Freude!“Die richtige Zusammenstellung der in diesem Bilde versteckt befindlichen Buchstaben ergiebt den Namen eines deutschen Klassikers.
J. K. in Dresden. Für die freundliche Uebersendung von 20 Mark – infolge des Gedichtes „Eine Bitte für arme Kinder“ von Emil Rittershaus – danken wir Ihnen herzlich. Wir haben den Betrag an Herrn Emil Rittershaus in Barmen gesandt, der denselben für den in dem Gedichte angegebenen Zweck verwenden wird.
M. P. in Leipzig. Das in Nr. 41 unseres Blattes enthaltene Vollbild „Feuerwehrübungen am Theater“ wurde nach einer Zeichnung von Arthur Krüger auf Holz übertragen von Paul Wagner.
K. R. in A. Sie Skizze „Friedrich der Große in Kamenz“ von Rudolf von Gottschall steht in Nr. 33 der „Gartenlaube“ Jahrgang 1886.
Co. Wir bedauern, für das Gedicht keine Verwendung zu haben.
- In unserem Verlage beginnt zu erscheinen und nehmen die meisten Buchhandlungen Bestellungen entgegen:
- In diesem berühmten Buche, welches für alle Zeiten ein unübertreffliches Muster klarer, leichtfaßlicher und im besten Sinne des Wortes volksthümlicher Darstellung bleiben wird, ist dem größeren Publikum ein Werk geboten, worin es eingehend über den Bau des menschlichen Körpers, die Verrichtungen seiner einzelnen Organe, sowie über den Gesundheits- und Krankheitszustand derselben unterrichtet und über eine vernünftige naturgemäße Pflege des Körpers im gesunden und kranken Zustande belehrt wird.
- Die neue vierzehnte Auflage ist von dem durch seine populär-medicinischen Arbeiten bekannten Herausgeber Dr. med. von Zimmermann, einem Schüler Bock’s, wiederum auf das Sorgfältigste durchgesehen und den Fortschritten der stetig und rastlos sich entwickelnden Wissenschaft entsprechend mit zahlreichen Zusätzen, Berichtigungen und Ergänzungen versehen worden. Durch die Erscheinungsweise in 20 Lieferungen zum Preise von nur 50 Pfennig wird auch dem Minderbemittelten Gelegenheit geboten, sich das nützliche bewährte Werk nach und nach anzuschaffen.