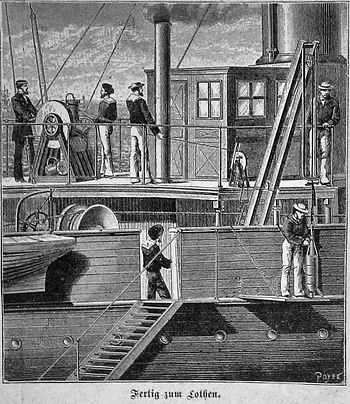Die Gartenlaube (1890)/Heft 2
[37]
| Halbheft 2. | 1890. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Flammenzeichen.
Die Familien Falkenried und Wallmoden waren seit langen Jahren befreundet. Als Gutsnachbarn verkehrten sie oft und viel miteinander, die Kinder wuchsen zusammen auf, und eine Menge von gemeinsamen Interessen knüpfte dies Freundschaftsband noch fester. Da aber beide nur mäßig begütert waren, so mußten die Söhne nach vollendeter Erziehung sich ihren Weg im Leben selbst bahnen, und das hatten der Major Hartmut von Falkenried und Herbert von Wallmoden denn auch gethan.
Sie waren Jugendgespielen gewesen und auch als Männer der alten Knabenfreundschaft treu geblieben. Einst hatten sie sich auch verwandtschaftlich nahe treten sollen, denn von seiten der Eltern wurde eine Verbindung geplant zwischen dem damaligen Lieutenant Falkenried und Regine Wallmoden. Das junge Paar schien auch vollkommen einverstanden und alles auf dem besten Wege zu sein, als ein Ereigniß eintrat, das diesem Plane ein jähes Ende machte.
Ein Vetter der Wallmodenschen Familie, ein unverbesserlicher Leichtsinn, der sich mit allerlei tollen Streichen in der Heimath unmöglich gemacht hatte, war vor Jahren in die weite Welt gegangen und nach manchen Irrfahrten und einem ziemlich abenteuerlichen Leben schließlich nach Rumänien verschlagen worden, wo er die Besitzungen eines reichen Bojaren verwaltete. Nach dessen Tode gelang es ihm, die Hand der Witwe zu erringen und damit auch die Lebensstellung zurückzugewinnen, die er einst leichtsinnig verscherzt hatte, und jetzt traf er nach mehr als zehnjähriger Abwesenheit mit seiner Gattin zu einem längeren Besuche bei den Verwandten ein.
Frau von Wallmoden stand schon in reiferem Alter und war längst verblüht, aber in ihrer Begleitung befand sich ihre Tochter erster Ehe, Zalika Rojanow, und die junge, kaum siebzehnjährige Slavin, mit dem Zauber ihrer fremdartigen Schönheit und dem Reiz ihres gluthvollen Temperamentes, flammte wie ein Meteor auf an dem Horizonte dieser deutschen Landedelleute, deren Leben sich in so ruhigen, gemessenen Bahnen bewegte.
Sie nahm sich allerdings seltsam genug aus in diesem Kreise, über dessen Formen und Rücksichten sie sich mit souveräner Gleichgültigkeit hinwegsetzte, und der sie anstaunte wie ein Wunder aus einer fremden Welt. Aber es gab doch auch manches ernste Kopfschütteln, manchen Tadel, der nur deshalb nicht laut ausgesprochen wurde, weil man in dem Mädchen nur
[38] einen flüchtigen Gast sah, der wohl eben so schnell wieder verschwinden würde, als er aufgetaucht war.
Da kam Hartmut Falkenried aus seiner Garnison auf das väterliche Gut und lernte im Hause der befreundeten Familie die neuen Verwandten kennen. Er sah Zalika, und damit nahte ihm das Verhängniß seines Lebens. Es war eine jener Leidenschaften, die plötzlich, fast blitzschnell entstehen, die einem Rausche, einem Taumel gleichen und nur zu oft mit der Reue eines ganzen Lebens bezahlt werden.
Vergessen waren die Wünsche der Eltern, die eigenen Zukunftspläne, vergessen die ruhige, herzliche Neigung, die ihn zu seiner Jugendgespielin Regine zog. Er hatte keine Augen mehr für die heimische Waldblume, die ihm damals noch jung und frisch erblühte, er sog nur den berauschenden Duft der fremden Wunderblüthe ein, alles andere verschwand und versank neben ihr, und in einer Stunde des Alleinseins stürzte er zu ihren Füßen und bekannte ihr seine Liebe.
Seltsamerweise wurden seine Gefühle erwidert. Vielleicht war es die alte Lehre von den sich berührenden Extremen, die Zalika zu einem Manne zog, der in jeder Hinsicht der vollste Gegensatz ihres eigenen Wesens war, vielleicht schmeichelte es ihr, daß ein Blick, ein Wort von ihr die ernste, ruhige und schon damals etwas düstere Natur des jungen Offiziers in Flammen zu setzen vermocht hatte, genug, sie nahm seine Werbung an und er durfte sie als Braut in die Arme schließen.
Die Nachricht von dieser Verlobung erregte einen Sturm in dem gesammten Familienkreise, von allen Seiten kamen Einreden und Warnungen, auch Zalikas Mutter und ihr Stiefvater waren dagegen, aber der allgemeine Widerstand steigerte nur die Leidenschaft des jungen Paares. Die Verbindung wurde trotz alledem durchgesetzt, und ein halbes Jahr später führte Falkenried seine junge Gattin in sein Haus.
Aber die Stimmen, welche dieser Ehe Unglück prophezeiten, sollten nur zu sehr recht behalten. Dem kurzen Rausche des Glückes folgte die bitterste Enttäuschung. Es war ein verhängnißvoller Irrthum gewesen, zu glauben, eine Frau wie Zalika Rojanow, die in schrankenloser Freiheit aufgewachsen und an das regellose, verschwenderische Leben der Bojarenfamilien ihrer Heimath gewöhnt war, könne sich jemals deutschen Anschauungen und Verhältnissen fügen. Auf wildem Rosse stundenlang umherjagen, mit den Männern, die ihre Zeit zwischen Jagd und Spiel theilten, in dem allerfreiesten Tone verkehren und sich im Hause, das immer eine Schar von Gästen füllte, mit einem äußeren Glanze umgeben, der mit dem ärgsten Verfall der verschuldeten Güter Hand in Hand ging – das war das Leben, das sie bisher allein kennen gelernt hatte und das ihr auch allein zusagte. Der Begriff der Pflicht war ihr ebenso fremd wie das Verständniß für ihre neue Lebensstellung überhaupt.
Und diese Frau sollte sich nun dem Haushalt eines jungen Offiziers, dem nur beschränkte Mittel zu Gebote standen, den Verhältnissen einer kleinen deutschen Garnisonstadt anbequemen! Daß das unmöglich war, zeigte sich schon in den ersten Wochen. Zalika begann damit, sich auch hier über alle Rücksichten hinwegzusetzen und ihr Haus auf dem gewohnten Fuße einzurichten, indem sie ihre nicht unbedeutende Mitgift in der sinnlosesten Weise verschwendete.
Vergebens bat und mahnte der Gatte, er fand kein Gehör hei ihr; sie hatte nur Spott für Schranken und Formen, die ihm heilig waren, nur ein Achselzucken für seine strengen Ehr- und Anstandsbegriffe. Es gab bald genug die heftigsten Zerwürfnisse, und Falkenried erkannte zu spät die schwere Uebereilung, die er begangen hatte.
Er hatte auf die Allmacht der Liebe gebaut, all den Warnungsstimmen zum Trotz, die auf die Verschiedenheit der Abstammung, der Erziehung und der Charaktere hinwiesen, und mußte nun erkennen, daß Zalika ihn überhaupt nie geliebt, daß nur Laune oder höchstens eine flüchtig auflodernde Leidenschaft, die ebenso schnell wieder erstarb, sie in seine Arme geführt hatte. Jetzt sah sie in ihm nur noch den unbequemen Gefährten, der ihr jeden Lebensgenuß verkümmerte, der mit seiner thörichten Pedanterie, seinen lächerlichen Ehrbegriffen ihr überall Schranken und Fesseln auferlegte. Und doch fürchtete sie diesen Mann, dessen Energie es gelang, ihre charakterlose Natur immer wieder unter seinen Willen zu beugen.
Auch die Geburt des kleinen Hartmut vermochte in der schon damals tief unglücklichen Ehe nichts mehr zu versöhnen und auszugleichen, aber sie hielt diese Ehe wenigstens äußerlich noch zusammen. Zalika liebte ihr Kind mit vollster Leidenschaft, und sie wußte, daß der Gatte es ihr nun und nimmermehr lassen würde, wenn es zur Trennung käme. Das allein hielt sie an seiner Seite fest, während Falkenried mit verbissenem Schmerze sein häusliches Elend trug und alles dran setzte, es wenigstens vor der Welt zu verschleiern.
Die Welt freilich kannte trotzdem die Wahrheit, sie wußte Dinge, die der Gemahl nicht einmal ahnte und die man ihm aus Schonung noch verschwieg. Aber endlich kam doch der Tag, wo man dem betrogenen Manne die Augen öffnete und ihm verrieth, was anderen längst kein Geheimniß mehr war. Die unmittelbare Folge davon war ein Duell, in dem Falkenrieds Gegner fiel, während er selbst zu einer längeren Festungshaft verurtheilt, aber sehr bald begnadigt wurde. Man wußte es ja, daß der beleidigte Gatte nur seine Ehre gesühnt hatte.
Inzwischen war auch die Scheidung eingeleitet und ausgesprochen worden; Zalika erhob keinen Widerspruch dagegen, sie wagte es überhaupt nicht, ihrem Gatten wieder zu nahen, denn seit jener Trennungsstunde, wo er sie zur Rede stellte, zitterte sie vor ihm. Aber sie machte verzweifelte Versuche, sich den Besitz ihres Kindes zu sichern, um das sie einen Kampf auf Leben und Tod führte.
Es war vergebens, Hartmut wurde unbedingt dem Vater zugesprochen, der mit eiserner Unerbittlichkeit jede Annäherung der Mutter zu hindern wußte. Zalika durfte ihren Sohn nicht einmal wiedersehen und erst, als sie sich überzeugt hatte, daß in dieser Hinsicht nichts zu erreichen war, kehrte sie in ihre Heimath, in das Haus ihrer Mutter zurück.
Sie schien verschollen zu sein für ihren ehemaligen Gatten, bis sie plötzlich und unerwartet wieder in Deutschland auftauchte, wo Major Falkenried jetzt eine hervorragende Stellung an der großen militärischen Erziehungsanstalt einnahm, die in der Nähe der Hauptstadt lag.
Es war ungefähr acht Tage nach der Ankunft Hartmuts in Burgsdorf. In ihrem Wohnzimmer saß Frau von Eschenhagen und ihr gegenüber der Major, der vor einer Viertelstunde eingetroffen war. Der Gegenstand ihres Gespräches mußte wohl ein sehr ernster und unangenehmer sein, denn Falkenried hörte mit tief verfinstertem Gesichte der Gutsherrin zu, die jetzt in ihrem Berichte fortfuhr.
„Mir fiel Hartmuts verändertes Wesen schon am dritten oder vierten Tage auf. Der Junge, dessen Uebermuth anfangs gar nicht zu bändigen war, sodaß ich einige Male drohte, ihn wieder nach Haus zu schicken, wurde plötzlich ganz kopfhängerisch. Er beging keine einzige Tollheit mehr, trieb sich stundenlang allein im Walde umher und träumte, wenn er zurückkam, mit offenen Augen, sodaß man ihn förmlich wecken mußte. ‚Er fängt an, vernünftig zu werden,‘ meinte Herbert, ich aber sagte: ‚die Sache ist nicht richtig, dahinter steckt etwas!‘ und nahm mir meinen Willy vor, der mir auch ganz merkwürdig vorkam. Er war richtig mit im Komplott. Er hatte die beiden eines Tages überrascht, Hartmut hatte ihm das Wort abgenommen, daß er schweigen werde, und mein Junge schweigt wirklich, verschweigt mir, seiner Mutter, etwas! Er beichtete erst, als ich ihm ernstlich zu Leibe ging. Nun, zum zweiten mal thut er es nicht wieder, dafür habe ich gesorgt.“
„Und Hartmut? Was sagte er?“ unterbrach sie der Major hastig.
„Gar nichts, denn ich habe noch keine Silbe mit ihm darüber geredet. Er hätte mich wahrscheinlich gefragt, warum er seine eigene leibliche Mutter nicht sehen und sprechen solle, und die Antwort auf diese Frage kann ihm doch nur – der Vater geben.“
„Er wird sie wohl bereits von anderer Seite erhalten haben,“ sagte Falkenried bitter. „Die Wahrheit freilich hat er schwerlich erfahren!“
„Das fürchte ich auch und deshalb verlor ich keine Minute, Sie zu benachrichtigen, nachdem ich die Geschichte entdeckt hatte. Was nun?“
„Nun werde ich allerdings eingreifen,“ entgegnete der Major mit erzwungener Ruhe. „Ich danke Ihnen, Regine, aber ich [39] ahnte bereits Unheil, als Ihr Brief mich so dringend herrief. Herbert hatte recht, ich durfte unter diesen Umständen meinen Sohn auch nicht eine Stunde von meiner Seite lassen, aber ich glaubte ihn hier in Burgsdorf sicher vor jeder Annäherung. Und er freute sich so auf den Ausflug, er sehnte sich mit einer förmlichen Leidenschaft danach, ich hatte nicht das Herz, es ihm zu versagen; – er ist ja überhaupt nur froh, wenn er fern von mir ist.“
Es lag ein dumpfer Schmerz in den letzten Worten: aber Frau von Eschenhagen zuckte nur die Achseln.
„Das ist nicht die Schuld des Jungen allein,“ sagte sie offenherzig. „Ich halte meinen Willy auch tüchtig in Zucht, aber er weiß trotz alledem, daß er eine Mutter hat, der er ans Herz gewachsen ist. Hartmut weiß das nicht von seinem Vater, er kennt ihn nur von der strengen, unzugänglichen Seite. Wenn er ahnte, daß Sie ihn insgeheim vergöttern –“
„So würde er das sofort mißbrauchen und mich wehrlos machen mit seiner schmeichlerischen Zärtlichkeit. Soll auch ich mich von ihm beherrschen lassen wie alles, was in seine Nähe kommt? Seine Kameraden folgen ihm blindlings, so oft er ihnen auch Strafe zuzieht mit seinen Tollheiten. Ihren Willibald hat er gänzlich unter seiner Botmäßigkeit, sogar seine Lehrer behandeln ihn mit besonderer Nachsicht. Ich bin der einzige, den er fürchtet, und infolge dessen auch der einzige, den er respektirt.“
„Und Sie glauben es mit der Furcht allein zu zwingen bei dem Jungen, der jetzt zweifellos von seiner Mutter mit den unsinnigsten Zärtlichkeiten überschüttet wird? Wenden Sie sich nicht ab, Falkenried, Sie wissen, ich habe nie jenen Namen vor Ihnen genannt, aber jetzt, wo er so unabweisbar wieder in den Vordergrund tritt, wird man ihn wohl einmal aussprechen dürfen. Und da wir gerade bei dem Punkte sind, so sage ich Ihnen offen heraus, die Geschichte war nicht anders zu erwarten, seit Frau Zalika wieder auftauchte. Es hätte nichts geholfen, wenn Sie Hartmut nicht von Ihrer Seite gelassen hätten, denn man kann einen Siebzehnjährigen nicht mehr hüten wie ein kleines Kind. Die Mutter hätte doch den Weg zu ihm gefunden, und das war im Grunde ihr Recht – ich hätte es ebenso gemacht.“
„Ihr Recht?“ fuhr der Major heftig auf. „Und das sagen Sie mir, Regine?“
„Das sage ich, weil ich weiß, was es heißt, ein einziges Kind zu haben! Daß Sie Ihrer Frau den Buben nahmen, war in der Ordnung, eine solche Mutter taugt nicht zur Erziehung; daß Sie es ihr aber jetzt, nach zwölf Jahren verweigern, Ihren Sohn wiederzusehen, das ist eine Härte und Grausamkeit, die nur der Haß eingeben kann. Wie groß auch ihre Schuld sein mag – die Strafe ist zu hart.“
Falkenried blickte finster vor sich nieder, er mochte fühlen, daß eine Wahrheit in den Worten lag; endlich sagte er langsam:
„Ich hätte nie geglaubt, daß Sie die Partei Zalikas nehmen würden. Ich habe Sie einst bitter gekränkt um ihretwillen, ich zerriß ein Band –“
„Das noch gar nicht einmal geknüpft war,“ unterbrach ihn Frau von Eschenhagen abwehrend. „Es war ein Plan unserer Eltern, weiter nichts.“
„Aber der Gedanke daran war uns doch lieb und vertraut seit unseren Kinderjahren. Versuchen Sie nicht, mich zu entschuldigen, Regine, ich weiß nur zu gut, was ich damals Ihnen und – mir gethan habe.“
Regine richtete die klaren grauen Augen fest auf ihn, aber es lag etwas wie ein feuchter Schimmer darin, als sie erwiderte:
„Nun ja, Hartmut, jetzt, wo wir beide längst über die Jugend hinaus sind, werde ich es ja wohl eingestehen dürfen. Ich habe Sie damals gern gehabt und Sie hätten auch wohl etwas anderes aus mir machen können, als ich jetzt geworden bin. Ich war immer ein eigenwilliges Ding und nicht leicht zu regieren, aber Ihnen hätte ich mich gefügt, vielleicht Ihnen allein auf der ganzen Welt. Als ich drei Monate nach Ihrer Hochzeit mit Eschenhagen vor den Altar trat, da war es umgekehrt, da nahm ich die Zügel in die Hand und fing an zu kommandiren, und seitdem habe ich es gründlich gelernt. Doch jetzt fort mit den alten, längst abgethanen Geschichten! Ich habe sie Ihnen nicht nachgetragen, das wissen Sie, wir sind trotzdem Freunde geblieben, und wenn Sie mich jetzt brauchen, mit Rath oder That – ich bin da.“
Sie streckte ihm die Hand hin und er legte die seinige hinein.
„Ich weiß es, Regine, aber hier kann ich mir nur allein rathen und helfen. Bitte, rufen Sie Hartmut zu mir, ich werde mit ihm sprechen!“
Frau von Eschenhagen kam seinem Wunsche nach, sie stand auf und verließ das Zimmer, aber im Gehen murmelte sie halblaut:
„Wenn es nicht schon zu spät ist! Sie hat den Vater damals blind und toll gemacht, sie wird sich den Sohn wohl auch schon gesichert haben!“
Nach etwa zehn Minuten trat Hartmut ein; er schloß die Thür hinter sich, blieb aber an der Schwelle stehen. Falkenried wandte sich um.
„Komm näher, Hartmut, ich habe mit Dir zu reden!“
Der Jüngling gehorchte und kam langsam näher. Er wußte bereits, daß Willibald hatte beichten müssen und daß die Zusammenkünfte mit der Mutter verrathen seien, aber in die Scheu, mit der er sonst stets dem Vater nahte, mischte sich heute ein unverkennbarer Trotz, der dem Major nicht entging. Er streifte mit einem langen düsteren Blick die jugendlich schöne Erscheinung seines Sohnes.
„Meine plötzliche Ankunft scheint Dich nicht zu überraschen,“ begann er wieder. „Du weißt also vermuthlich, was mich herführt?“
„Ja, Vater, ich errathe es.“
„Gut, so brauchen wir uns nicht erst mit einer Einleitung aufzuhalten. Du hast erfahren, daß Deine Mutter noch am Leben ist, sie hat sich Dir genähert und Du verkehrst mit ihr – ich weiß es bereits. Wann sahst Du sie zum erstenmal?“
„Vor fünf Tagen.“
„Und seitdem hast Du sie täglich gesprochen?“
„Ja, am Burgsdorfer Weiher.“
Fragen und Antworten klangen gleich kurz und gemessen. Hartmut war an diese streng militärische Art gewöhnt, selbst im Verkehr mit dem Vater, der kein überflüssiges Wort, kein Zögern und Ausweichen bei den Antworten duldete. Er hielt auch heute diesen Ton fest, der seine qualvolle Erregung vor den ungeübten Augen des Sohnes verschleiern sollte. Dieser sah in der That nur das ernste, unbewegte Antlitz, hörte nur den Ton kalter Strenge, als der Major fortfuhr:
„Ich will Dir keinen Vorwurf daraus machen, denn ich habe Dir in dieser Hinsicht nichts verboten. Der Punkt ist ja überhaupt nie zwischen uns berührt worden. Da wir aber einmal so weit sind, muß ich wohl das Schweigen brechen. Du hieltest Deine Mutter für todt und ich habe das stillschweigend geduldet, denn ich wollte Dich vor den Erinnerungen bewahren, die mein Leben vergiftet haben; Deine Jugend wenigstens sollte frei davon sein. Das ist nicht durchzuführen, wie ich sehe, so magst Du denn jetzt die Wahrheit erfahren!“
Er hielt einen Augenblick inne, dem Manne mit seinem reizbaren Ehrgefühl war es eine Folter, diesen Punkt vor seinem Sohne zu erörtern, und doch gab es jetzt keine Wahl mehr, er mußte weiter sprechen.
„Ich habe als junger Offizier Deine Mutter leidenschaftlich geliebt und vermählte mich mit ihr, gegen den Willen meiner Eltern, die in dieser Ehe mit einer Frau aus fremdem Stamme und Blute kein Heil sahen. Sie hatten recht, die Ehe war eine tief unglückliche und wurde schließlich getrennt, auf mein Verlangen. Ich hatte ein unbedingtes Recht dazu und mir wurde auch der Besitz meines Sohnes unbedingt zugesprochen. Mehr kann ich Dir nicht sagen, denn ich will die Mutter nicht vor ihrem Sohne anklagen; also laß Dir daran genug sein!“
So kurz und herb diese Erklärung auch lautete, sie machte einen eigenthümlichen Eindruck auf Hartmut. Sein Vater wollte die Mutter nicht vor ihm anklagen, vor ihm, der doch täglich die bittersten Anklagen und Schmähungen gegen den Vater von ihr hörte. Zalika hatte selbstverständlich die ganze Schuld der Trennung auf ihren Gatten und seine unerhörte Tyrannei gewälzt und sie fand ein nur zu williges Ohr bei dem Jüngling, dessen unbändige Natur so schwer unter der Strenge des Vaters litt. Und doch wirkten jetzt dessen kurze, ernste Worte mehr als all jene leidenschaftlichen Ausbrüche; Hartmut fühlte instinktmäßig, auf welcher Seite die Wahrheit lag.
„Und nun zu der Hauptsache!“ hob Falkenried wieder an. „Was war der Inhalt Eurer täglichen Unterredungen?“
[40] Hartmut mochte diese Frage wohl nicht erwartet haben, denn eine glühende Röthe floß plötzlich über sein Gesicht, er schwieg und sah zu Boden.
„Ah so, Du wagst nicht, es mir zu wiederholen! Ich verlange es aber zu wissen. Antworte, ich befehle es Dir!“
Aber Hartmut schwieg noch immer, er preßte nur fester die Lippen zusammen und sein Auge begegnete mit finsterem Trotze dem des Vaters, der jetzt dicht vor ihn hintrat.
„Du willst nicht reden? Hat vielleicht ein Verbot von jener Seite Dich stumm gemacht? Gleichviel, Dein Schweigen sagt mir mehr als Worte. Ich sehe, wie sehr Du mir bereits entfremdet bist, und Du würdest mir ganz verloren gehen, wenn ich Dich diesem Einflusse noch länger überließe. Diese Zusammenkünfte mit Deiner Mutter haben von jetzt an ein Ende, ich verbiete sie Dir. Du begleitest mich noch heute nach Haus und bleibst unter meiner Obhut. Ob Dir das grausam erscheint oder nicht, es muß sein und Du wirst gehorchen.“
Aber der Major irrte, wenn er glaubte, seinen Sohn wie sonst mit einem bloßen Befehl unter seinen Willen zu beugen. Hartmut war in den letzten Tagen in einer Schule gewesen, wo ihm der Trotz gegen den Vater in wirkungsvollster Weise beigebracht worden war.
„Vater, das kannst, das darfst Du mir nicht befehlen!“ brach er jetzt mit erschreckender Heftigkeit aus, „Es ist meine Mutter, die ich endlich wiedergefunden habe, die einzige, die mich liebt auf der ganzen Welt! Ich lasse sie mir nicht wieder nehmen, wie sie mir schon einmal genommen wurde; ich lasse mich nicht zwingen, sie zu hassen, weil Du sie hassest. Drohe, strafe mich, thue, was Du willst, mit mir, aber ich gehorche diesmal nicht, ich will nicht gehorchen!“
Die ganze unbändige Leidenschaft des jungen Mannes fluthete in diesen Worten, das unheimliche Feuer flammte wieder in seinen Augen, die Hände ballten sich, jede Fiber bebte in wilder Empörung – er war augenscheinlich entschlossen, den Kampf mit dem sonst so gefürchteten Vater aufzunehmen.
Doch der Zornausbruch, den er mit voller Bestimmtheit erwartete, kam nicht; Falkenried sah ihn nur schweigend an, aber mit einem Blick ernsten, schweren Vorwurfes.
„Die einzige, die Dich liebt auf der ganzen Welt!“ wiederholte er langsam. „Du hast wohl vergessen, daß Du noch einen Vater hast!“
„Der mich aber nicht liebt!“ rief Hartmut in überquellender Bitterkeit. „Erst seit ich meine Mutter wiederfand, habe ich erfahren, was Liebe ist.“
„Hartmut!“
Der Jüngling sah betroffen auf bei diesem seltsamen, schmerzdurchbebten Tone, den er zum erstenmal hörte, und der Trotz, der eben wieder von neuem ausbrechen wollte, erstarb auf seinen Lippen.
„Weil ich keine Schmeichelworte und Liebkosungen für Dich hatte, weil ich Dich mit Ernst und Strenge erzog, zweifelst Du an meiner Liebe?“ sagte Falkenried, noch immer in dem gleichen Tone. „Weißt Du, was diese Strenge mich gekostet hat, meinem einzigen, meinem geliebten Kinde gegenüber?“
„Vater –?“ Das Wort klang noch scheu und zögernd, aber es war nicht mehr die alte Scheu und Furcht, es lag etwas darin wie aufkeimendes Vertrauen, wie frohes, noch halb ungläubiges Staunen, und dabei hingen Hartmuts Augen wie gebannt an den Zügen des Vaters, der jetzt die Hand auf seinen Arm legte und ihn leise an sich zog, während er fortfuhr: „Ich habe auch einst Ehrgeiz gehabt, stolze Lebenshoffnungen, große Pläne und Entwürfe, das war zu Ende, als ein Schlag mich traf, den ich nie verwinden werde. Wenn ich jetzt noch ringe und strebe, so spornt mich neben dem Pflichtbewußtsein nur eins noch, der Gedanke an Dich, Hartmut. In Dir ruht all mein Ehrgeiz, Deine Zukunft groß und glücklich zu gestalten, ist das einzige, was ich noch vom Leben fordere, und sie kann groß werden, mein Sohn, denn Deine Begabung ist eine ungewöhnliche, Dein Wille ein stärker im Guten wie im Schlimmen. Aber es liegt noch etwas anderes, Gefährliches in Deiner Natur, das weniger Deine Schuld als Dein Verhängniß ist und das man bei Zeiten bändigen muß, wenn es nicht überwuchern und Dich ins Unglück stürzen soll. Ich habe streng sein müssen, um diese unselige Anlage zu bannen, leicht ist mir das nicht geworden.“
Das Antlitz des Jünglings war wie in Gluth getaucht, mit fliegendem Athem schien er jedes Wort von den Lippen des Vaters zu lesen, und jetzt sagte er in einem Flüsterton, hinter dem sich kaum noch der mühsam verhaltene Jubel barg:
„Ich wagte es ja bisher nicht, Dich zu lieben, Du warst, immer so starr, so unzugänglich, und ich –“ er brach ab und sah wieder zu dem Vater auf, der jetzt den Arm um seine Schulter legte und ihn noch fester an sich zog. Ihre Blicke tauchten tief, tief ineinander und die Stimme des sonst so eisernen Mannes brach, als er leise sagte:
„Du bist mein einziges Kind, Hartmut! Das einzige, was mir übrig geblieben ist von einem Traume des Glückes, der in Bitterkeit und Enttäuschung zerrann. Ich habe damals viel verloren und habe es ertragen; aber wenn ich Dich verlieren sollte, Dich – das ertrüge ich nicht!“
Seine Arme schlossen sich fest wie unlöslich um den Sohn, der sich schluchzend an seine Brust warf, und in heißer, leidenschaftlicher Umarmung, in welcher alles andere zu versinken schien, hielten sich Vater und Sohn umschlungen. Sie hatten es beide vergessen, daß noch ein Schatten aus der Vergangenheit drohend und trennend zwischen ihnen stand. –
Drüben im Eßzimmer saß inzwischen Frau von Eschenhagen und hielt ihrem Willy eine Standrede. Sie hatte das zwar schon heute morgen gethan, war aber der Meinung, daß die doppelte Portion in diesem Falle nicht schaden könne. Der junge Majoratserbe sah sehr zerknirscht aus, er fühlte sich im Unrecht, sowohl der Mutter als dem Freunde gegenüber, und war doch ganz schuldlos an der Geschichte. Als gehorsamer Sohn ließ er sich aber geduldig abkanzeln und warf nur von Zeit zu Zeit einen wehmüthigen Blick auf das Vesperbrot, das bereits auf dem Tische stand, von dem aber seine Mutter vorläufig noch keine Notiz nahm.
„Das kommt davon, wenn man hinter dem Rücken der Eltern Heimlichkeiten hat!“ schloß sie ihre Strafpredigt. „Dem Hartmut wird jetzt da drüben der Kopf gewaschen, der Major wird nicht gerade sanft mit ihm verfahren, und Du, denke ich, läßt es in Zukunft auch bleiben, bei solch einem Komplott den Helfershelfer zu spielen.“
„Ich habe ja nicht dabei geholfen,“ vertheidigte sich Willy. „Ich hatte nur versprochen, zu schweigen, und mußte doch Wort halten.“
„Gegen Deine Mutter durftest Du nicht schweigen, die ist immer und überall eine Ausnahme,“ sagte Frau Regine bestimmt.
„Ja, Mama, das hat Hartmut wahrscheinlich auch gemeint, als es sich um seine Mutter handelte,“ meinte Willibald, und die Bemerkung war so richtig, daß sich schlechterdings nichts dagegen einwenden ließ; um so mehr ärgerte sich Frau von Eschenhagen darüber.
„Das ist etwas anderes, etwas ganz anderes,“ versetzte sie kurz, aber der junge Majoratsherr fragte hartnäckig:
„Warum ist es denn hier etwas anderes?“
„Junge, Du bringst mich noch um mit Deinen Fragen und Reden!“ fuhr die Mutter zornig auf. „Das ist eine Sache, die Du nicht verstehst, auch gar nicht verstehen sollst. Schlimm genug, daß der Hartmut Dich überhaupt in Berührung damit gebracht hat. Jetzt schweigst Du und kümmerst Dich nicht weiter darum! Verstanden?“
Willy schwieg pflichtschuldigst, es war wohl das erste Mal in seinem Leben, daß man ihm zu vieles Fragen und Reden zum Vorwurf machte. Ueberdies trat jetzt sein Onkel Wallmoden ein, der soeben von einer Ausfahrt zurückkehrte.
„Falkenried ist bereits hier, wie ich höre?“ sagte er, zu seiner Schwester tretend.
„Jawohl,“ versetzte diese. „Er kam unverzüglich nach Empfang meines Briefes.“
„Und wie hat er die Nachricht aufgenommen?“
„Aeußerlich ziemlich ruhig; aber ich merkte nur zu gut, wie es in seinem Innern aussah. Jetzt ist er allein mit Hartmut, und da wird wohl der Sturm losbrechen.“
[41]
[42] „Leider! Aber ich habe ihm diesen Ausgang vorhergesagt, als ich von Zalikas Rückkehr hörte. Er hätte gleich damals mit seinem Sohn sprechen müssen. Jetzt, fürchte ich, fügt er einen zweiten Mißgriff zu dem ersten und sucht mit Verboten und mit Zwang eine Trennung herbeizuführen. Dieser unselige Starrsinn, der nur ein ‚entweder – oder‘ kennt! Er ist hier gerade am wenigsten am Platze.“
„Ja, mir dauert die Geschichte da drüben auch zu lange,“ sagte Frau von Eschenhagen besorgt. „Ich werde einmal nachsehen, wie weit die beiden eigentlich miteinander sind, ob der Major das übelnimmt oder nicht: Bleibe hier, Herbert, ich komme sogleich zurück.“
Sie verließ das Zimmer, und während Wallmoden unmuthig auf- und niederschritt, saß sein Neffe einsam am Tische mit dem Vesperbrot, um das sich noch immer kein Mensch kümmerte. Sich allein darüber herzumachen wagte er nicht, denn es herrschte ja heute eine förmliche Aufregung in Burgsdorf und die Frau Mama war äußerst ungnädig gestimmt. Zum Glück kehrte sie schon nach Verlauf von einigen Minuten zurück, und diesmal lag auf ihrem Gesicht der hellste Sonnenschein.
„Die Sache ist in Ordnung,“ sagte sie kurz und bündig. „Er hält seinen Jungen in den Armen und der hängt an seinem Halse, und das weitere wird sich nun schon von selbst machen – Gott sei Dank! Und nun kannst Du auch Dein Vesperbrot essen, Willy, die Konfusion, die uns die ganze Hausordnung gestört hat, ist zu Ende.“
Willy ließ sich das nicht zweimal sagen und machte schleunigst von der ertheilten Erlaubniß Gebrauch. Wallmoden schüttelte aber den Kopf und sagte halblaut:
„Wenn sie nur auch wirklich zu Ende ist!“
Falkenried und sein Sohn hatten es nicht bemerkt, daß die
Thür leise geöffnet und wieder geschlossen wurde. Hartmut hing
noch immer am Halse des Vaters. Er schien auf einmal alle
Scheu, alle Zurückhaltung verloren zu haben und er war hinreißend
liebenswürdig in seiner neuerwachten stürmischen Zärtlichkeit,
von welcher der Major vielleicht nicht mit Unrecht fürchtete,
daß sie ihn wehrlos machen könnte. Er sprach nur wenig, aber
er drückte wieder und immer wieder seine Lippen auf die Stirn
seines Sohnes und blickte unverwandt in das schöne lebensvolle
Antlitz, das sich dicht an das seinige schmiegte. Endlich fragte
Hartmut leise:
„Und – meine Mutter?“
Ueber Falkenrieds Stirn flog wieder ein Schatten, aber er ließ seinen Sohn nicht aus den Armen.
„Deine Mutter wird Deutschland verlassen, sobald sie sich überzeugt, daß sie Dir auch in Zukunft fernbleiben muß,“ sagte er, diesmal ohne Härte, aber mit vollster Entschiedenheit. „Du magst ihr schreiben, ich werde einen Briefwechsel unter gewissen Einschränkungen gestatten, einen persönlichen Verkehr kann und darf ich nicht zulassen.“
„Vater, bedenke –“
„Ich kann nicht, Hartmut, es ist unmöglich!“
„Hassest Du sie denn so sehr?“ fragte der Jüngling vorwurfsvoll. „Du hast die Trennung gewollt, nicht meine Mutter, ich weiß es von ihr selbst.“
Falkenrieds Lippen zuckten, er wollte ein bitteres Wort aussprechen und seinem Sohne sagen, daß jene Trennung ein Gebot der Ehre gewesen sei; aber da sah er wieder in die dunklen, fragenden Augen, und jenes Wort erstarb. Er konnte die Mutter nicht vor ihrem Kinde anklagen.
„Laß die Frage!“ entgegnete er düster. „Ich kann sie Dir nicht beantworten; vielleicht lernst Du später einmal meine Gründe kennen und würdigen. Jetzt kann ich Dir die herbe Wahl nicht ersparen, Du darfst nur einem von uns gehören, das andere mußt Du meiden – nimm es als ein Verhängniß!“
Hartmut senkte das Haupt, er mochte wohl fühlen, daß sich für jetzt nichts weiter erreichen ließ. Daß die Zusammenkünfte mit der Mutter ein Ende nehmen mußten, wenn er nach Haus, in die strenge Disziplin der Anstalt zurückkehrte, wußte er ja längst; jetzt wurde ihm sogar ein Briefwechsel gestattet, das war mehr, als er zu hoffen gewagt hatte.
„So will ich es der Mutter sagen,“ versetzte er niedergeschlagen. „Jetzt, wo Du alles weißt, darf ich doch wohl offen zu ihr gehen.“
Der Major stutzte, er hatte an diese Möglichkeit noch gar nicht gedacht.
„Wann wolltest Du sie wiedersehen?“ fragte er.
„Heute, um diese Stunde, am Burgsdorfer Weiher. Sie wird sicher schon dort sein.“
Falkenried schien mit sich zu kämpfen, in seinem Innern erhob sich eine warnende Stimme und mahnte ihn, diesen Abschied nicht zuzulassen, und doch fühlte er, daß es grausam wäre, ihn zu verweigern.
„Wirst Du in zwei Stunden zurück sein?“ fragte er endlich.
„Gewiß, Vater, noch früher, wenn Du es verlangst.“
„So geh’!“ sagte der Major mit einem tiefen Athemzuge; man hörte es, wie schwer ihm die Einwilligung wurde, die sein Gerechtigkeitsgefühl ihm abrang. „Sobald Du zurückkehrst, fahren wir nach Hause, Deine Ferien nehmen ja ohnehin bald ein Ende.“
Hartmut, der schon im Begriff war, zu gehen, hielt plötzlich inne. Die Worte riefen ihm auf einmal wieder in das Gedächtniß, was er in der letzten halben Stunde völlig vergessen hatte, den Zwang und die Strenge des so gehaßten Dienstes, der nun wieder seiner harrte. Er hatte es bisher nicht gewagt, seine Abneigung dagegen offen zu verrathen, aber diese Stunde nahm mit der Scheu vor dem Vater auch das Siegel von seinen Lippen. Einer augenblicklichen Eingebung folgend, kehrte er um und legte von neuem seine Arme um den Hals des Vaters.
„Ich habe eine Bitte,“ flüsterte er, „eine große, große Bitte, die Du mir gewähren mußt, und Du wirst es thun, ich weiß es, als Beweis, daß Du mich wirklich liebst.“
Zwischen den Brauen des Majors erschien eine Falte und er fragte mit leisem Vorwurf.
„Verlangst Du erst noch Beweise dafür? Nun, so laß hören!“
Hartmut schmiegte sich noch fester an ihn, seine Stimme gewann wieder jenen schmeichlerisch süßen Klang, der sein Bitten so unwiderstehlich machte, und die dunklen Augen baten so heiß und flehend mit.
„Laß mich nicht Soldat werden, Vater! Ich liebe den Beruf nicht, für den Du mich bestimmt hast, werde ihn niemals lieben lernen. Wenn ich mich bisher Deinem Willen gebeugt habe, geschah es mit Widerstreben, mit heimlichem Groll, und ich bin grenzenlos unglücklich dabei gewesen; ich wagte nur bisher nicht, Dir das zu gestehen.“
Die Falte auf der Stirn Falkenrieds vertiefte sich und langsam ließ er seinen Sohn aus den Armen.
„Das heißt mit anderen Worten, Du willst nicht gehorchen!“ sagte er herb, „und gerade Dir ist das nothwendiger als jedem anderen.“
„Ich kann aber keinen Zwang ertragen!“ brach Hartmut leidenschaftlich aus, „und der Dienst ist ja nichts anderes als Zwang und Ketten. Immer und ewig gehorchen, nie einen eigenen Willen haben, sich Tag für Tag einer eisernen Disziplin beugen, starren kalten Formen, mit denen man jede eigene Regung niederhält – das ertrage ich nicht länger! Alles in mir drängt nach Freiheit, nach Licht und Leben. Laß mich hinaus, Vater! Halte mich nicht länger fest an der Kette, ich sterbe, ich ersticke darin!“
Er hätte seine Sache nicht schlimmer führen können als mit diesen unvorsichtigen Worten vor einem Manne, der mit Leib und Seele Soldat war. Noch klangen sie in stürmischer, glühender Bitte. noch lag sein Arm um den Hals des Vaters; aber dieser richtete sich jetzt plötzlich auf und stieß ihn zurück.
„Ich dächte, der Waffendienst wäre eine Ehre, keine Kette!“ sagte er schneidend. „Schlimm genug, daß ich meinem Sohne das erst in das Gedächtniß rufen muß. Freiheit, Licht und Leben? Meinst Du vielleicht, man hat mit siebzehn Jahren schon das Recht, sich ohne weiteres in das Leben zu stürzen und all seine Güter an sich zu reißen? Für Dich wäre die ersehnte Freiheit nur die Zügellosigkeit – das Verderben!“
„Und wenn das wäre!“ rief Hartmut völlig außer sich. „Lieber verderben in der Freiheit, als weiter leben in diesem Zwang. Für mich ist er nun einmal eine Kette, eine Sklaverei –“
[43] „Schweig’! kein Wort mehr!“ herrschte ihn Falkenried so drohend an, daß der Jüngling trotz seiner furchtbaren Aufregung verstummte. „Du hast überhaupt keine Wahl mehr, und wehe Dir, wenn Du Deine Pflichten, vergessen solltest! Erst hast Du Offizier zu werden und Deine Schuldigkeit als solcher voll und ganz zu thun, wie jeder Deiner Kameraden; dann, wenn Du mündig geworden bist und ich keine Macht mehr habe, Dich zu hindern, magst Du Deinen Abschied nehmen, wenn es mir auch den Todesstoß geben wird, zu erleben, daß mein einziger Sohn den Waffendienst – flieht!“
„Vater, hältst Du mich für einen Feigling?“ brauste Hartmut auf. „Wenn ich im Kriege, im Kampfe stehen könnte –“
„So würdest Du tollkühn und blind jeder Gefahr entgegenstürmen, auf eigene Hand, und mit diesem Eigenwillen, der keine Disziplin kennt, Dich und die Deinigen vernichten. Ich kenne ihn, diesen wilden, maßlosen Freiheits- und Lebensdrang, dem keine Schranke und keine Pflicht heilig ist, ich weiß, von wem Du ihn geerbt hast und wohin er schließlich führt. Darum halte ich Dich fest an der ‚Kette‘, gleichviel, ob Du sie hassest oder nicht. Du sollst gehorchen und Dich beugen lernen, so lange es noch Zeit ist, und Du wirst es lernen, darauf gebe ich Dir mein Wort!“
Seine Stimme klang wieder in der alten, unbeugsamen Härte, jede Weichheit, jede Zärtlichkeit war ausgelöscht in den eisernen Zügen, und Hartmut kannte den Vater zu gut, um jetzt noch die Bitte oder den Trotz zu versuchen. Er erwiderte keine Silbe, aber in seinem Auge glühte wieder jener dämonische Funke, der ihm alle Schönheit nahm, und um die Lippen, die sich fest aufeinanderpreßten, legte sich ein fremder, böser Ausdruck, als er sich stumm zum Gehen wandte.
Der Major folgte ihm mit den Augen – da erhob sich wieder die warnende Stimme in seinem Innern, es kam wie die Ahnung eines Unheils über ihn, und er rief den Sohn zurück.
„Hartmut, Du wirst doch in zwei Stunden wieder hier sein? Du giebst mir Dein Wort darauf?“
„Ja, Vater!“ Die Antwort klang grollend, aber fest.
„Gut, so will ich Dich einmal als Mann behandeln. Mit diesem Worte, das Du mir verpfändest, lasse ich Dich ruhig gehen, sei pünktlich!“ –
Der junge Mann war erst einige Minuten fort, da trat Wallmoden ein.
„Du bist allein?“ fragte er etwas befremdet. „Ich wollte Dich nicht stören, aber ich sah eben Hartmut durch den Garten eilen. Wohin geht er denn so spät noch?“
„Zu seiner Mutter, um Abschied von ihr zu nehmen.“
Der Botschaftssekretär stutzte bei dieser unerwarteten Auskunft.
„Mit Deiner Bewilligung?“ fragte er rasch.
„Gewiß, ich habe es ihm erlaubt.“
„Wie unvorsichtig! Ich dächte, Du hättest doch nun gesehen, wie Zalika ihren Willen durchzusetzen versteht, und jetzt überläßt Du ihr Deinen Sohn von neuem auf Gnade und Ungnade!“
„Auf eine halbe Stunde und nur zu einem Lebewohl, das ich nicht verweigern konnte. Was fürchtest Du denn? Doch nicht etwa einen Gewaltstreich? Hartmut ist kein Kind mehr, das man in den Wagen trägt und trotz seines Sträubens entführt.“
„Wenn er sich nun aber nicht sträubt bei einer etwaigen Entführung?“
„Ich habe sein Wort, daß er in zwei Stunden zurückkehren wird,“ sagte der Major mit Nachdruck.
Wallmoden zuckte die Achseln.
„Das Wort eines siebzehnjährigen Knaben!“
„Der aber zum Soldaten erzogen ist und die Bedeutung des Ehrenwortes kennt. Das macht mir keine Sorge, meine Befürchtungen gehen nach einer anderen Richtung.“
„Regine sagte mir, Ihr hättet Euch gefunden,“ bemerkte Wallmoden mit einem Blick auf die noch immer schwer umdüsterte Stirn des Freundes.
„Auf Minuten, dann mußte ich wieder der harte, strenge Vater sein, und gerade diese Stunde hat mir gezeigt, wie schwer die Aufgabe ist, diese unbändige Natur zu beugen und zu erziehen – gleichviel, ich werde sie bewältigen.“
Der Botschaftssekretär trat an das Fenster und blickte in den Garten hinaus.
„Es dämmert schon und der Burgsdorfer Weiher ist über eine halbe Stunde entfernt,“ sagte er halblaut. „Du hättest diese letzte Zusammenkunft, wenn sie nun einmal stattfinden sollte, nur in Deiner Gegenwart gestatten sollen.“
„Und Zalika wiedersehen? Unmöglich, das konnte und wollte ich nicht.“
„Wenn dies Lebewohl nun aber anders endigt, als Du annimmst – wenn Hartmut nicht zurückkehrt?“
„So wäre er ein Elender, ein Wortbrüchiger!“ fuhr Falkenried auf, „ein Deserteur, denn er trägt schon die Waffe an der Seite! Beleidige mich nicht mit solchen Gedanken, Herbert, es ist mein Sohn, von dem Du redest.“
„Es ist auch Zalikas Sohn! Doch laß uns jetzt nicht darüber streiten, man erwartet Dich drüben im Eßzimmer; Du willst heute schon wieder fort?“
„Ja, in zwei Stunden,“ sagte der Major fest und ruhig. „Bis dahin ist Hartmut zurück – ich bürge Dir dafür.“
Ueber Wald und Feldern lagen schon die grauen Schatten der Dämmerung, die mit jeder Minute dichter und dunkler wurden. Der kurze nebelerfüllte Herbsttag ging zu Ende und bei dem schwer umwölkten Himmel brach die Nacht noch früher als sonst herein.
Am Rande des Burgsdorfer Weihers ging eine Frauengestalt unruhig und ungeduldig auf und nieder. Sie hatte den dunklen Mantel dicht um die Schulter gezogen, aber sie achtete nicht auf das Frösteln, mit dem die kalte Abendluft sie durchschauerte, ihr ganzes Wesen war fieberhafte Erwartung und gespanntes Lauschen auf einen Schritt, der sich noch immer nicht hören ließ.
Seit dem Tage, an dem Willibald die beiden überrascht und man ihn nothgedrungen in das Vertrauen gezogen, hatte Zalika die Zusammenkünfte mit ihrem Sohn auf die späten Nachmittagsstunden verlegt, wo es ganz einsam und öde im Walde war. Sie pflegten sich aber stets vor einbrechender Dämmerung zu trennen, damit Hartmuts späte Rückkehr in Burgsdorf keinen Argwohn erwecken sollte. Er war stets pünklich gewesen, heut harrte die Mutter schon seit einer Stunde vergebens. Hielt ihn ein Zufall zurück, oder war das Geheimniß verrathen? Seit ein Dritter darum wußte, mußte man ja stets auf diese Möglichkeit gefaßt sein.
Es war todtenstill ringsum im Walde, nur das trockene Laub raschelte unter dem Saume des Gewandes der ruhelos Auf- und Abschreitenden. Unter den Baumwipfeln lagerten schon nächtliche Schatten, über dem Weiher, wo es noch freier und lichter war, schwebte eine Nebelwolke, und dort drüben, wo das kleine Gewässer von einer Wiese begrenzt wurde, die trügerischen Moorgrund barg, quoll es noch dichter empor, weißgraue Dunstschleier, die dem Boden entstiegen und sich gährend und wallend ausbreiteten. Es wehte feucht und kalt von dort herüber wie Grabesluft.
Da endlich, ein leichter Schritt, anfangs noch in weiter Ferne – aber er kam in fliegender Eile näher und nahm seine Richtung nach dem Weiher. Jetzt erschien eine schlanke Gestalt, kaum noch erkennbar in der wachsenden Dunkelheit, Zalika flog ihr entgegen und in der nachsten Minute lag ihr Sohn in ihren Armen.
„Was ist geschehen?“ fragte sie unter den gewohnten stürmischen Liebkosungen. „Weshalb kommst Du so spät? Ich verzweifelte schon daran, Dich heut noch zu sehen. Was hat Dich zurückgehalten?“
„Ich konnte nicht früher hier sein,“ stieß Hartmut, noch athemlos von dem raschen Laufe, hervor. „Ich komme von meinem Vater!“
Zalika zuckte zusammen.
„Von Deinem Vater? Er weiß also –?“
„Alles!“
„So ist er in Burgsdorf? Seit wann? Wer gab ihm Nachricht?“
Der junge Mann berichtete in fliegenden Worten, was geschehen war, aber er hatte noch nicht geendigt, als ein bitteres Auflachen seiner Mutter ihn unterbrach.
[44] „Natürlich! Sie sind ja alle, alle im Komplott miteinander, wenn es gilt, mir mein Kind zu entreißen – und Dein Vater? Er hat wohl wieder gedroht und gestraft und Dich das schwere Verbrechen büßen lassen, daß Du in den Armen Deiner Mutter gelegen hast?“
Hartmut schüttelte den Kopf. Die Erinnerung an jenen Augenblick, wo der Vater ihn an seine Brust zog, hielt doch stand, trotz all der Bitterkeit, in der jene Scene schließlich geendigt hatte.
„Nein,“ sagte er leise, „aber er verbot mir, Dich wiederzusehen, und forderte unerbittlich die Trennung von Dir.“
„Und trotzdem bist Du hier! O, ich wußte es ja!“
Es klang wie jubelndes Frohlocken in den Ausruf.
„Triumphire nicht zu früh, Mama!“ sagte der junge Mann bitter. „Ich komme nur, um Abschied zu nehmen.“
„Hartmut!“
„Der Vater weiß darum, er hat mir dies Lebewohl gestattet und dann –“
„Dann will er Dich wieder an sich reißen und Du sollst mir verloren sein für immer! Ist es nicht so?“
Hartmut antwortete nicht, er umklammerte mit beiden Armen die Mutter und ein wildes, leidenschaftliches Schluchzen kam aus seiner Brust, das ebensoviel von Groll und Bitterkeit als vom Schmerz hatte.
Es war in zwischen völlig dunkel geworden, die Nacht brach an, eine kalte, düstere Herbstnacht, ohne Mond- und Sternenglanz, aber dort auf der Wiese, wo vorhin die weißen Dunstschleier wallten, fing es jetzt an, sich zu regen. Es zuckte etwas auf, mit bläulichem Schimmer, das anfangs nur matt durch den Nebel blinkte und dann heller und klarer leuchtete wie eine Flamme.
Jetzt verschwand es, jetzt tauchte es wieder auf und mit ihm ein zweites und drittes – die Irrlichter begannen ihr gespenstiges, unheimliches Spiel.
„Du weinst?“ sagte Zalika, ihren Sohn fest an sich pressend. „Ich habe das längst kommen sehen, und selbst wenn der junge Eschenhagen uns nicht verrathen hätte, an dem Tage, da Du zu Deinem Vater zurückkehren solltest, wärst Du doch vor die Wahl gestellt worden zwischen Trennung oder – Entschluß.“
„Welchen Entschluß? Was meinst Du?“ fragte Hartmut betroffen.
Zalika beugte sich zu ihm nieder, und obwohl sie allein waren, sank ihre Stimme doch zu einem Flüstern herab.
„Willst Du Dich wehrlos und willenlos einer Tyrannei beugen, die das heilige Band zwischen Mutter und Kind zerreißt und unser Recht wie unsere Liebe mit Füßen tritt? Wenn Du das kannst, dann bist Du nicht mein Sohn, dann hast Du nichts geerbt von dem Blute, das in meinen Adern rollt. Er sandte Dich, um mir Lebewohl zu sagen, und Du nimmst das wie eine letzte Gnade geduldig hin? Du kommst wirklich, um Abschied von mir zu nehmen auf Jahre hinaus, wirklich?“
„Ich muß ja!“ unterbrach sie der junge Mann verzweiflungsvoll. „Du kennst den Vater und seinen eisernen Willen, giebt es eine Möglichkeit, sich dagegen aufzulehnen?“
„Wenn Du zu ihm zurückkehrst – nein! Aber wer zwingt Dich denn dazu?“
„Mama! Um Gotteswilien!“ fuhr Hartmut entsetzt auf, aber die umschlingenden Arme ließen ihn nicht, und das heiße, leidenschaftliche Flüstern drang wieder zu seinem Ohre.
„Was schreckt Dich denn so bei dem Gedanken? Du sollst ja nur mit Deiner Mutter gehen, die Dich grenzenlos liebt und hinfort nur für Dich leben wird. Du hast es mir ja oft geklagt, daß Du den Beruf hassest, der Dir aufgezwungen werden soll, daß Du Dich verzehrst in der Sehnsucht nach Freiheit. Wenn Du zurückkehrst, giebt es keine Wahl mehr für Dich, Dein Vater wird Dich unerbittlich festhalten an jener Kette, und wenn er wüßte, daß Du daran stürbest, er gäbe Dich doch nicht frei.“
Sie hätte ihrem Sohne das nicht erst zu sagen brauchen, er wußte es besser als sie, hatte er doch vor kaum einer Stunde die ganze Unbeugsamkeit des Vaters kennen gelernt, dies harte: „Du sollst gehorchen und Dich beugen lernen!“ gehört. Seine Stimme erstickte fast in Bitterkeit, als er antwortete:
„Gleichviel, ich muß zurück! Ich habe mein Wort gegeben, in zwei Stunden wieder in Burgsdorf zu sein.“
„Wirklich?“ fragte Zalika scharf und hohnvoll. „Ich dachte es mir! Sonst darfst und sollst Du ja nichts anderes sein als ein Knabe, dem jeder Schritt vorgezeichnet, jede Minute berechnet wird, der nicht einmal einen eigenen Gedanken haben darf; aber sobald es gilt, Dich festzuhalten, gesteht man Dir die Selbständigkeit des Mannes zu. Nun wohl, so zeige es, daß Du nicht bloß in Worten mündig bist, und handle auch als Mann! Ein erzwungenes Versprechen hat keinen Werth, zerreiße diese unsichtbare Kette, an der man Dich halten will, und mach Dich frei!“
„Nein – nein!“ murmelte Hartmut mit einen erneuten Versuch, sich loszumachen. Es gelang ihm nicht, er wandte nur das Gesicht ab und starrte mit heißen Augen hinaus in die Nacht, in das öde schweigende Waldesdunkel und hinüber, wo die Irrlichter noch immer ihren Gespensterreigen führten. Ueberall tauchten jetzt die zuckenden, zitternden Flammen auf, die sich zu suchen und zu fliehen schienen, sie schwebten über den Boden hin und versanken dann oder zerflatterten in dem Nebelmeer, um immer wieder von neuem zu erstehen. Es lag etwas Grauenhaftes und doch zugleich etwas seltsam Lockendes in diesem geisterhaften Spiel, der dämonische Zauber der Tiefe, die jener trügerische Moorgrund barg.
„Komm mit mir, mein Hartmut!“ bat Zalika jetzt in jenen süßen Schmeichellauten, die ihr wie dem Sohn so allmächtig zu Gebote standen. „Ich habe längst alles vorgesehen und vorbereitet; ich wußte es ja, daß ein Tag wie der heutige kommen müsse. Eine halbe Stunde von hier hält mein Wagen, er bringt uns nach der nächsten Eisenbahnstation, und ehe man in Burgsdorf ahnt, daß Du nicht zurückkehrst, trägt der Kurierzug uns schon hinaus in die Ferne. Dort ist die Freiheit, das Leben, das Glück! Ich führe Dich hinaus in die weite große Welt, und wenn Du sie erst kennen lernst, wirst Du aufathmen und aufjubeln wie ein Erlöster. Ich weiß es ja, wie einem Befreiten zu Muthe ist, ich habe ja auch Ketten getragen, die ich in thörichter Verblendung mir selbst schmiedete, aber ich hätte sie schon im ersten Jahre zerrissen, wenn Du nicht gewesen wärst. O, sie ist süß, die Freiheit, Du wirst es auch noch fühlen!“
Sie wußte nur zu gut den Weg zu finden, der zum Ziele führte. Freiheit, Leben, Glück! Die Worte fanden ein tausendfaches Echo in der Brust des Jünglings, dessen ungestümer Freiheitsdrang bisher gewaltsam niedergehalten worden war. Wie ein leuchtendes Zauberbild, von magischem Glanze umflossen, stand dies verheißene Leben vor ihm. Er brauchte nur die Hand danach auszustrecken, dann war es sein.
„Mein Wort!“ murmelte er, mit einem letzten Versuch, sich aufzuraffen. „Der Vater wird mich verachten, wenn –“
„Wenn Du Dir eine große stolze Zukunft errungen hast?“ unterbrach ihn Zalika leidenschaftlich. „Dann tritt wieder vor ihn hin und frage ihn, ob er es noch wagt, Dich zu verachten! Er will Dich am Boden festhalten und Du hast doch Flügel, die Dich emportragen! Er versteht eine Natur wie die Deinige nicht, wird sie nie verstehen lernen. Willst Du an einem bloßen Worte verkümmern und zu Grunde gehen? Komm mit mir, mein Hartmut, mit mir, der Du alles bist, hinaus in die Freiheit!“
Sie zog ihn fort, langsam aber unwiderstehlich, er sträubte sich wohl noch, aber er riß sich nicht los, und unter dem Flehen, unter den Liebkosungen der Mutter hörte auch allmählich dieses Sträuben auf – er folgte.
Einige Minuten später lag der Weiher ganz einsam. Mutter und Sohn waren verschwunden, ihre Schritte verhallt, rings herrschte Nacht und Schweigen. Nur drüben im Nebeldunst des Moores regte sich noch immer jenes lautlose, geisterhafte Leben. Sie schwebten und zerflatterten, tauchten auf und versanken im ruhelosen Spiel – die geheimnißvollen Flammenzeichen der Tiefe.
Der Deutsche Ritterorden hatte längst die Landgebiete des altpreußischen Weichselthals erobert, seine Residenz in der Marienburg aufgeschlagen, Städte gegründet und mit deutschen Kolonisten besiedelt in den Gauen, die wir heute Westpreußen nennen. Bald aber erschien ihm sein Landbesitz zu klein, er trachtete danach, weiter nach Osten vorzubringen, auch diejenigen Gaue der alten heidnischen Preußen zu unterjochen, die weit nach Sonnenaufgang, jenseit der Höhenzüge lagen, welche bis jetzt seiner Herrschaft Grenze bildeten. So zog er auf Schiffen mit seinen Heereshaufen über das Frische Haff, den Strandsee, der sich viele Meilen lang von Elbing bis zu der Einmündung des Pregelstroms dehnt, und diesen Fluß hinauf bis zu der ersten steilen Höhe, welche, weithin die Umgebung beherrschend, an seinen Ufern sich erhebt. Dort ward um die Mitte des 13. Jahrhunderts die erste Burg im Lande Ostpreußen gegründet und dem König Ottokar von Böhmen zu Ehren, der zu dieser Ansiedelung gerathen hatte, „Königsberg“ genannt. Selten ist ein vom Zufall bestimmter Namen für eine Stadt so verheißungsvoll geworden wie dieser. Königsberg, die Wiege der Monarchie, die von dem Lande, in welchem es lag, den Namen „Preußen“ entnommen, ist mit dem Geschicke dieser Monarchie stets aufs engste verwachsen gewesen; sie ist Krönungs- und dritte Residenzstadt des Königreiches.
Das mittelalterliche Königsschloß überragt auch heute alle Umgebung von seiner freien Höhe aus. Es ist wohl das erste und älteste Gebäude der Stadt, denn zugleich mit deren Gründung hat man auch den Bau begonnen, der in seinen ältesten Theilen mit cylindrischen Eckthürmen, tiefen Thorbogen, klotzigem Mauerwerk noch ganz den Charakter jener Zeit trägt. Weit später erst sind die modernen Flügel des Bauvierecks entstanden, so daß die ganze Architekturgruppe einen ungemein bunten Eindruck gewährt. Die ganze westliche Seite des Gevierts wird von der Schloßkrche eingenommen, die am Ende des 10. Jahrhunderts erbaut wurde. Alles ist hier Geschichte, jeder Stein mahnt an die großen Tage des preußischen Königthums. Es war ja doch kaum mehr als Zufall, daß der erste preußische König 1657 in diesem Schlosse geboren wurde, der sich dann 1701 in dieser Kirche selbst die Krone aufs Haupt setzte. Alle seine Nachfolger kamen zur Erbhuldigung in diese Stammburg des Königthums, und als im Verfassungsstaat dieser Akt wegfallen mußte, hat König Wilhelm ebenfalls in der Königsberger Schloßkirche seine Krönung mit größtem Pomp vollzogen.
Waren die ernsten Feierlichkeiten vorüber, so stieg die Festversammlung hinauf in einen unmittelbar über der Kirche gelegenen Saal, um dort ihre heiteren Feste zu feiern. Dieser „Moskowitersaal“ im Oberstock einer Kirche mag auch wohl einzig in seiner Art sein. Er soll den Namen einem anderen Raume entlehnt haben, in welchem unter Hochmeister Markgraf Albrecht von Brandenburg eine Gesandtschaft des moskowitischen Großfürsten Wassiliy gewohnt hat.
Noch vor kurzem versammelte jede größere Feier die Königsberger und ihre Gäste oben im Moskowitersaale, und ebenso haben sie seit alters her mit Vorliebe die tiefsten Gewölbe und Verließe des alten Gemäuers aufgesucht. Dort, wo einst grauses Folterwerkzeug die Unglücklichen peinlich befragte, ist der fröhliche Weingott eingezogen, und noch immer nennt man die mittelalterlichen Kellergewölbe das „Blutgericht“; der Wein schmeckt deshalb in dem kühlen Raume nicht minder gut.
Dieses alte Schloß ist von Beginn an Kern und Mittelpunkt von Königsberg gewesen, wie es trotz aller Prachtbauten bis heute noch dessen merkwürdigstes Architekturstück ist. Anfangs hat sich wohl nur zu seinen Füßen unten am Abhang des Berges bürgerliches Leben angesiedelt, die „Altstadt“, die sich stromaufwärts längs des Pregelufers fortsetzte in dem Stadttheil „Löbenicht“. Auch die kleine Insel, die unmittelbar vor dem Schlosse von zwei Armen des Pregels gebildet wird, ist zu jener Zeit besiedelt worden und heißt noch heute der „Kneiphof“. Diese drei Stadttheile zusammen bilden das alte Königsberg. Denn eng sind seine Gassen, himmelhoch oft einzelne Giebelhäuser; es ist unverändert geblieben, als dem Deutschen Ritterorden die Marienburg verloren gegangen war und er seine Residenz hierher verlegte. Auch als der letzte Hochmeister aus dem Hause Brandenburg sich zum weltlichen Fürsten, zum Herzoge von Preußen machte, hat er aus seinem Schlosse wohl nur die Dreistadt: Löbenicht, Altstadt, Kneiphof überschaut. Wir erkennen dieses frühere Königsberg noch heute deutlich; die spätere moderne Stadt hat sich freieren Raum gesucht, ist strahlenförmig aus dem alten Kern herausgewachsen, und um sie herum hat sich der Festungswall und ein Gürtel weit vorgeschobener Forts gelegt.
In dem Banne der Fürstenburg sehen wir jetzt noch altes Gemäuer, Thurmstümpfe, Reste früherer Befestigungen mitten in die moderne Welt hineinragen. Zu den malerischen Partien dieses Burgbannes gehört heute noch ein kotziger, mittelalterlicher Thurmbau, den man nicht abgetragen, sondern an Geschäftsleute überlassen hat. Da verstecken sich Gärten, Höfe, altes Gewinkel in dem Bezirk, der die Stadtseite des Schlosses, den ältesten Theil desselben, umgiebt. Das kleine Verkehrsleben mag sich in den engen krummen Gassen unmittelbar am Fuße des steilen Schloßberges entwickelt haben. So ist es noch heute. Auch jetzt drängt sich hier der Kleinverkehr zwischen der natürlichen Bodenterrasse und dem Flusse zusammen. Anders ist das Gepräge der Kneiphofinsel in alter Zeit gewesen, und ist es auch heute noch. Dort hatte der Bischof von Samland um das Jahr 1330 den Dom zu bauen begonnen, ein kräftiges ernstes Bauwerk, schmucklos und [46] derb, wie die baltische Gothik zu bauen liebt. Da das Schloß damals nach keine eigene Kirche besaß, kamen Hochmeister und Herzog hier herab zum Gottesdienst. Hier finden wir ihre Grabmäler. Dennoch aber haben die Hochmeister die die Macht gefürchtet, die diese Bischofskirche mitten in der bürgerlichen Gemeinde ausübte, denn innerlich standen die Ordensleute und der von seinem Klerus umgebene Bischof einander feindlich gegenüber.
Da kam die Reformation, es kam die Verwandelung des Ordensstaates in ein weltliches Herzogthum, es kam die Regierungszeit des Herzogs Albrecht. Da wandelte inneres und äußere Leben sich mächtig in Königsberg. Die Lehre Luthers fand schnell Eingang in der deutschen Nordostmark. Neben dem alten gothischen Dome gründete Herzog Albrecht die Universität 1544 als eine „streng lutherische“, ein Schwiegersohn Melanchthons wurde ihr erster Rektor und unmittelbare Nachkommen Luthers sind hier in der Seelsorge thätig gewesen. Noch heute erinnert ein von dem Königsberger Studenten getragenes Abzeichen, welches aus der Initiale dieser Schilderung uns entgegenschaut, an den ehrwürdigen Stifter der „Albertus-Universität“. Seit jener Zeit ist Königsberg eine Stätte regsten geistigen Lebens geworden und geblieben: der Liederdichter Simon Dach predigte auf der Kanzel des Domes, die Lehrstühle der Hochschule haben Kant, Herder, Hippel geziert.
Die offene Stadt, von dem festen Schlosse beherrscht, wurde nun zu enge. Unten im Kneiphof entwickelte sich lebhafter Handel, da fand das Gemeindeleben mit Rathhaus und Junkerhof seine Stätte, die Insel wurde der vornehmste Bezirk des sich entwickelnden Königsbergs.
Wer heute diese Stadt besucht, der wird, besonders wenn er von dem nahen Danzig kommt, sich mit Recht darüber wundern, daß die bedeutende Vergangenheit, die verschiedenen Blütheperioden nirgends in würdevollen Bauwerken architektonisch Ausdruck gefunden haben. In Danzig erkennt man heute noch das gothische und das Zeitalter der Spätrenaissance; die Bauten beider Perioden verleihen der mächtigen Hansestadt ihren hohen malerischen Reiz, machen sie zu einer der schönsten Deutschlands. In Königsberg finden wir kaum eine Spur solcher alten baulichen Würde und Pracht. Das Schloß trägt in seinem ältesten Theile entschieden den Charakter einer zur Landesvertheidigung errichteten Burg, der Dom ist schwerfällig, schmuck- und fast stillos. Rathhäuser, Gildenhallen, Patricierwohnungen aus jenen früheren Entwicklungszeiten sucht man hier vergebens: an das alte dürftige, nur für das engste Bedürfniß seiner anspruchslosen Bewohner erbaute Königsberg schließt sich sofort das moderne. Und so ist Königsberg in seiner äußeren Erscheinung weder eine historische noch eine eigentlich schöne Stadt, obgleich es einzelnes enthält, um das andere Städte es beneiden könnten. Immer aber hat das geistig angeregte Leben, das Vorwärtsgehen auch auf wirthschaftlichem und gewerblichem Gebiete Königsberg eine hervorragende Stellung im altpreußischen Lande verschafft.
Die „Stadt der reinen Vernunft“ nennt man wohl ab und zu die alte Pregelstadt und man knüpft damit an ihres größten Sohnes berühmtestes Werk an. Immanuel Kant, der große Philosoph, der nie über die Mauern seiner Geburtsstadt hinausgekommen sein soll, hat hier seine „Kritik der reinen Vernunft“ geschrieben, hier ist er am 12. Februar 1804 gestorben. In den Arkaden, die sich längs der Nordseite des Domes hinziehen und die unter dem Namen des „Professorengewölbes“ bis zum Anfange dieses Jahrhunderts als Begräbnißplatz der Professoren der Albertus-Universität benutzt wurden, fand er, sechzehn Tage nach seinem Tode, seine Ruhestätte, wurde aber fünf Jahre nachher wieder ausgegraben und an das Ostende dieser Arkaden verbracht, wo er in einem abgegrenzten Raume neu eingesenkt wurde. Indessen auch hier sollten seine irdischen Ueberreste noch nicht endgültig zur Ruhe kommen. Die zunehmende Verwahrlosung der neuen Grabstätte veranlaßte eine Anzahl Männer, für eine würdige Herstellung derselben Sorge zu tragen, zu welchem Zwecke zunächst das Ostende der Arkaden in eine einfache Kapelle, die Stoa Kantiana, umgewandelt wurde. Dann schritt man im Juni 1880 dazu, die Gebeine des großen Todten auszuheben, wobei mit großer Vorsicht und genauester Prüfung verfahren werden mußte, denn infolge jener Umbettung im Jahre 1809 hatten sich die sicheren Anhaltspunkte über die Stelle, wo sie zu suchen waren, verwischt. Es gelang aber insbesondere mit Hilfe einer kurz nach Kants Tode abgenommenen Maske, die Identität des gefundenen Schädels mit demjenigen Kants unzweifelhaft festzustellen, worauf die Gebeine in einem neuen doppelten Metallsarge, zugleich mit einigen die Ausgrabung betreffenden Urkunden, aufs neue in einer ausgemauerten Gruft an derselben Stelle, wo sie vorher geruht hatten, beigesetzt wurden. Den denkwürdigen Vorgang dieser Ausgrabung hat Professor Heydeck, welcher den Haupttheil der Arbeit eigenhändig ausführte, in einem Gemälde verewigt, dessen getreue Holzschnittnachbildung wir unsern Lesern bieten.
Die moderne Zeit, die eigentlich nur erst nach Jahrzehnten rechnet, fand in Königsberg genügend Raum für ihre Schöpfungen, sie fand ihn hauptsächlich auf der Hochfläche, an deren steilem Rande das alte Schloß steht. Dort breiteten ehedem sich grüne Anger, Pferdeweiden, Jagdgründe aus, von Wegen durchzogen, die ins flache Land hinausführten; dort sammelten sich die Wasser der grasigen, mit alten Bäumen geschmückten Flur in langgestreckten Weihern, deren blinkende Spiegel bis in die unmittelbare Nähe des Schlosses sich dehnten. Allmählich war im Laufe der Jahrhunderte die Stadt hier hinaufgezogen, Gartengrundstücke, Milchwirthschaften, kleine ländliche Häuschen bedeckten einen Theil des Bodens, längs der Landstraßen mögen wohl von Beginn an die Wohnungen dichter bei einander gestanden haben. „Steindamm“, „Roßgarten“, wie jene Stadttheile heute noch heißen, deuten mit ihren Namen den Ursprung und den früheren Charakter dieser Ansiedelungen an. Dort ist vorzugsweise das moderne Königsberg erbaut worden und auch alle groß angelegten Bauwerte der Neuzeit, mit Ausnahme der Börse, die unten in der Handelsstadt am Strome bleiben mußte, haben den freien Boden, die reinere Luft dieser nördlichen Bezirke aufgesucht. Früh schon war dort das Theater erbaut worden, und 1844, als die Universität unten im Dome ihr dreihundertjähriges Jubiläum feierte, ward oben an dem heiteren, weiträumigen Königsgarten der Grundstein zum Baue einer neuen Hochschule gelegt, die 1862 vollendet wurde und nun, im Rundbogenstile italienischer Paläste gehalten, einen Schmuck des modernen Königsbergs bildet. Auf dem Platze vor der Universität, dem „Paradeplatze“, fand 1851 ein Reiterstandbild [47] Friedrich Wilhelms III. seine Stelle. Später wurde eine Bronzestatue Kants von Rauch, welche früher am Kantschen Hause in der Nähe des Schlosses gestanden hatte, ebenfalls auf diesen Platz versetzt.
Der höchsten Verwaltung des Staates genügte das alte Schloß nicht mehr, für sie und als Residenz des Oberpräsidenten wurde in einer der Straßen, die wie Spinnenfüße von dem Mittelpunkte der alten Stadt nordwärts ins freie Land sich ausstrecken, ein stolzer Palast von Sandstein und gelben Backsteinfüllungen errichtet, ein Flügelbau mit reichem Skulpturenschmucke. Die Provinz hatte inzwischen Selbständigkeit erlangt und baute sich an einer andern jener Strahlenstraßen ihr „Landeshaus“. So hatte das moderne Königsberg innerhalb kurzer Jahrzehnte mehr Monumentalbauten geschaffen, als die langen Jahrhunderte vorher ihm hinterlassen hatten.
Auch dem Handel und der Industrie, die durch energisches Streben und klugen Geschäftsverstand der Bürger zur Blüthe gelangt sind, dankt das moderne Königsberg die stolzen Bauten, die neuerdings die Stadt verschönen. Frühere Jahrhunderte haben ihr an Patricierhäusern gar nichts hinterlassen. Nun schoben sich Prachtbauten des wohlhabenden Bürgerthums zuerst in die Lücken ein, die sich etwa in der alten Dreistadt fanden. Als diese aber nicht mehr genügten, wurden jene weiten Gartengründe [48] und Felder, die zwischen den zu den nördlichen Außenthoren führenden Straßen Streindamm mit seiner herrlichen, grünen Promenade, den „Hufen“, Tragheim, Roßgarten sich ausdehnten, von der Baulust erobert.
In manchem dieser Reviere wohnt man heute noch fast wie auf dem Lande. Stille Straßen, weite Gärten, völliger Mangel an Geschäftsleben, selbst an demjenigen, dessen ein moderner Haushalt nicht entrathen kann, sind dort nicht selten. Mehr und mehr füllt sich der weite Bezirk mit modernen Wohnhäusern, denen weder äußerer Schmuck noch innere Bequemlichkeit fehlt, immer mehr verschwinden die kleinen niedrigen Häuserchen, die an jenen früheren Landstraßen noch heute zu finden sind.
An Baugrund fehlt es hier oben nach immer nicht, und die Bevölkerungsziffer, welche sich heute auf über 100 000 Seelen beläuft, steigt so stetig, daß auch die Baulust rege bleibt. Königsberg ist immer dem Charakter seiner ersten Entwickelung treu geblieben. Aus verschiedenen kleinen Städtewesen lose zusammengeschweißt, hängt auch seine neueste moderne Gestaltung ihrer äußeren Erscheinung nach nur lose mit dem Früheren zusammen. Unten in den alten Städten überall Enge, überall bauliche Kargheit, dafür aber regstes Leben und Treiben; hier weite Plätze mit grünem Laubschmuck, breite Straßen, neben den Prachtbauten zu öffentlichen Zwecken stolze Privathäuser, mit allem ausgestattet, was die zeitgenössische Technik und die schmückende Kunst zu leisten vermag, dafür aber große Stille, die nur ein gewisser Luxusverkehr unterbricht. So besitzt Königsberg weit entschiedener als jede andere Stadt von ähnlicher Größe und Bedeutung eine Scheidung, wie sie London mit „City“ und „Westend“ bezeichnet: dort nur Geschäft, hier die Stätte wissenschaftlichen, künstlerischen Lebens inmitten gut ausgestatteter, gesunder, ja üppiger Wohnungen.
Noch eins kommt hinzu, um diesen Vergleich noch treffender zu machen. Der langgestreckte Weiher, der diese Hochebene in der Mitte durchschneidet und sich bis in die Nähe des Schlosses zieht, ist nun ringsum von modernen Stadttheilen umgeben. Das Erholungs- und Genußleben drängt sich an seinen Ufern zusammen. Königsberg besitzt von Natur nur sehr wenig landschaftliche Reize. Dafür bietet denn dieser Schloßteich einigermaßen Ersatz und von ihm aus ist auch unsere Hauptansicht der Stadt aufgenommen. An sein südliches Ende dringen die Häuser mit ihren Gärten, Balkonen, offenen Veranden vor, da besitzt jedes seine Gondel zu abendlichen Lustfahrten. Nordwärts aber von der Fußgängerbrücke, die diesen Weiher überspannt, hüllen die Laubmassen großer Gärten die Ufergelände in tiefen Schatten, da besitzen die Logen, die große Ressource der Kaufleute ihre Sommerlokale, in denen die oberen Schichten der Bevölkerung alle schönen Sommerabende verleben, wo Musik erschallt und feenhafte Beleuchtung vom Spiegel des stillen Wassers zurückgeworfen wird. Der Schloßteich ist der Glanzpunkt Königsbergs, hierher entsendet die alte Unterstadt, wie die moderne obere ihre Gesellschaft, hier begegnen wir Studenten, Offizieren, Beamten, Kaufleuten und Gewerbtreibenden, hier haben an jedem freien Uferfleckchen Bierhallen sich angesiedelt, hier gondelt man zu allen Tagseiten. Der Schloßteich ist reizend, gerade auch wegen der Verschiedenartigkeit seiner Uferstaffage. Auf der einen Seite überblicken wir den Kranz von Häusern, halb in Gartengrün versteckt, überragt von Thürmen und hohem Kirchengemäuer, auf der anderen die Massen alter Kastanien und Linden, die, wo der Seespiegel eine leichte Biegung macht, sich zusammenschließen. Wenn das Oberhaupt des Reiches, wenn irgend ein Kongreß, eine Wanderversammlung Königsberg besucht, der Schloßteich wird dann immer zum Schauplatz irgend einer Lustbarkeit gemacht. In den Logengärten veranstaltet man Konzert und Feuerwerk, der Börsengarten wird in ein Lichtmeer getaucht, Gesang und Instrumentalmusik ertönt aus den erleuchteten Gondeln, die das stille Wasser durchfurchen und die Schwäne aus ihrer Nachtruhe scheuchen.
Der Fremde fühlt sich bald heimisch und wohl in der alten Königsstadt. Es herrscht in ihr ein heiter geselliges, geistig ungemein angeregtes Leben, die Königsberger sind gastfrei und leicht zugänglich, man verkehrt zwanglos mit ihnen und hat etwas davon. Aufs glücklichste mischen sich hier Stände, Gesellschaftsgruppen, Berufskreise. Unter den am stärksten vertretenen Ständen ist der kaufmännische eigentlich der jüngste. Als die Hochschule schon lange berühmt in der ganzen Kulturwelt war, stand der Handel Königsbergs noch weit zurück gegen den anderer alter Hansestädte. Das hat sich in neuester Zeit vollständig geändert.
Der Theehandel des Festlandes hat sich in Königsberg einen Mittelpunkt geschaffen, die Königsberger Thee-Kompagnie ist eine der hervorragendsten kaufmännischen Unternehmungen in ganz Deutschland. Die russischen und polnischen Weizenernten gehen großentheils hierher, denn die Seeschiffe, welche dieselben nach dem Auslande verladen, können den tiefen Pregel herauf bis zu der Speicherstadt gelangen. Die Rosse nährenden Fluren Litauens senden ihre edlen Pferde hierher auf die weltberühmten Märkte, zu denen Käufer aus allen Ländern sich einstellen. Dies alles sind Schöpfungen, Eroberungen der neun Zeit. Wenn wir dafür auch mit großem Interesse, mit ehrfurchtsvollem Sinne auf das historische Königsberg, auf die Stadt König Ottokars, die Stadt des großen Herzogs Albrecht von Brandenburg, auf das Schloß blicken, in dem die Wiege des ersten Preußenkönigs gestanden, zu der Kirche, in welcher er sich die Krone aufgesetzt hat, die moderne Stadt mit ihrer äußeren Entwickelung, mit ihrem kräftig treibenden Leben übt dennoch eine nicht minder anziehende Wirkung auf uns aus.
[50]
Die Erforschung der Meere.
Im Sommer und Herbst des vorigen Jahres verfolgten die Zeitungsleser mit Spannung die Nachrichten von den Schicksalen des Dampfers „National“, der eine deutsche Expedition zur Erforschung der Meere über den Atlantischen Ocean trug. Das Wort „Plankton“, welches die Gesammtmasse aller im Meere treibenden Organismen bezeichnet und bis dahin nur einem engen Forscherkreise bekannt war, erhielt mit einemmal eine große Volksthümlichkeit; die Expedition bildete einen Anstoß, um das Interesse für das Meer und seine Wunder, das ewig in der menschlichen Brust schlummert, von neuem anzufachen. Die gelehrten Theilnehmer an jenem Forscherzuge sind glücklich in die Heimath zurückgekehrt und damit beschäftigt, die gewonnene wissenschaftliche Ausbeute zu verarbeiten. Es dürfte darum an der Zeit sein, unsere Leser mit einigen Abschnitten der Meereskunde vertraut zu machen, ehe wir auf die Bedeutung und die Errungenschaften der jüngsten deutschen Expedition des näheren eingehen.
Seit uralten Zeiten wurde das Meer befahren, aber es war lange nur eine Handelsstraße. Die Grenzen des Oceans waren unbekannt und die Phantasie verlegte allerlei Wundergebilde dorthin. Eine neue Zeit begann erst, als Columbus den Atlantischen Ocean durchmessen hatte; auf die Entdeckung der Neuen Welt folgte die Entdeckung des „Südmeers“, des Großen Oceans, und dreißig Jahre nach der ersten Fahrt des kühnen Genuesen erschien an der spanischen Küste am 6. September 1522 das Schiff „Viktoria“, von Würmern zerfressen, geflickt, mit zerbrochenen Masten, zerrissenen Segeln, das einzige Schiff von der Flotte Magalhaes’, welches die erste Erdumseglung ausgeführt hatte. Bei weitem größer als man gedacht hatte, erschien jetzt das Meer, und jemehr Entdecker in die fernen Gegenden hinauszogen, desto mehr Wasser entdeckten sie, bis James Cook auf seinen Weltumseglungen in großen Umrissen die Grenzen der Gewässer auf der Erde feststellte. Seit jener Zeit etwa wissen wir, daß Festland und Meer im Verhältniß von drei zu acht auf der Erdoberfläche vertheilt sind.
Man suchte schon damals nicht nur die Geographie, sondern auch die „Natur des Meeres“ zu erforschen, und die Physik des Meeres bildete einen wichtigen Theil der Aufgaben, die sich die beiden Forscher, die Begleiter Cooks auf dessen zweiter Reise, stellten. Demselben Gegenstande widmeten Benjamin Franklin und Alexander Humboldt ihren Scharfsinn, aber erst in jüngster Zeit wurde die Oceanographie, die Meereskunde, zu einem Wissenschaftszweig erhoben. Dem Amerikaner M. F. Maury verdanken wir, daß die Schiffe, welche jetzt die Oceane durchkreuzen, zugleich dem Handel und der Wissenschaft dienen, daß ihre Logbücher von den Seewarten wissenschaftlich verwerthet werden. Die Anregung hierzu ward vor kaum fünfzig Jahren gegeben.
Damals stand die Menschheit an der Schwelle des großen Zeitalters der Elektricität. Der Telegraph rückte weit entfernte Länder dicht aneinander; das Meer bildete eine Schranke zwischen der Alten und Neuen Welt, aber auch diese mußte fallen. Man wollte dem Grund des Oceans das gedankenleitende Kabel anvertrauen, man führte aus, was man wollte, und legte damit den Grund zur Erforschung des Meeresbodens und zu einem neuen Zweige der Wissenschaft, der Tiefseeforschung. Eine neue Welt, ein unterseeisches Reich, wurde damit entdeckt, und nun zogen Schiffe aus, um es zu erkunden.
Die Amerikaner forschten in ihren Gewässern, in den Binnenmeeren entfalteten alle Nationen eine rührige Thätigkeit, die Polarforscher suchten den Eismeeren ihre Geheimnisse zu entlocken, und dann wurde das englische Kriegsschiff „Challenger“ (der Herausforderer) in ein Forscherschiff umgewandelt und dampfte 1872 bis 1876 um die Erde, um mit einer wissenschaftlichen Riesenbeute aus allen Oceanen beladen heimzukehren.
Um dieselbe Zeit (1874 bis 1876) durchforschte die deutsche „Gazelle“ unter dem damaligen Kapitän von Schleinitz die Geheimnisse des Indischen und Atlantischen Oceans im Anfang der achtziger Jahre zogen die französischen Schiffe „Travailleux“ und „Talisman“ zu gleichen Eroberungszügen hinaus. Zuletzt sahen wir den „National“ von Kiel aus über das weite Meer kreuzen; wir werden sehen, welche Stellung dieser letzten Expedition unter den ruhmreichen Vorgängerinnen gebührt; naturgemäß suchte sie das zu erklären, was an den Funden der früheren räthselhaft geblieben war, und darum müssen auch wir weiter ausholen, bevor wir von ihren Ergebnissen sprechen können.
Wie tief ist das Meer? Seit jeher beschäftigte diese Frage die Menschen und für die Schiffer war sie auch von praktischer Bedeutung. Aber bei den Lothungen, welche von Kriegs- und Handelsschiffen vorgenommen wurden, bediente man sich nur eines zwölfpfündigen Bleis und einer 200 Faden[1] langen Leine. Mit diesen Mitteln konnten nur die Untiefen des Meeres erkannt werden, der bei weitem größte Theil blieb – unergründlich. Wunderbare Ansichten bildete man sich über den Meeresboden: man glaubte sogar das Wort „unergründlich“ wörtlich deuten zu müssen. und noch im siebzehnten Jahrhundert mußte Varenius in seiner „Geographia generalis“ Beweise für die Richtigkeit der Behauptung geben, daß der Ocean überall einen Boden habe.
Verworrene Ansichten herrschten auch lange Zeit über die physikalischen Verhältnisse in großen Tiefen. Allgemein war die Meinung verbreitet, daß Schiffstrümmer, untergegangene Schätze, Heergeräth und Kanonenkugeln nicht bis zum Seegrunde hinabsinken könnten, sondern von den immer dichter werdenden Wassermassen der Tiefe in der Schwebe gehalten würden. Voller Geheimnisse war für die Menschen das Meer, ein Tummelplatz für allerlei ungeheuerliche Meinungen. Erst unser Zeitalter ersann Mittel, „aus der unergründlichen schweigenden Tiefe eine Antwort zu erhalten.“
Und wie fiel diese Antwort aus? Was die Tiefseesonde und das Schleppnetz unserm Geiste enthüllten, das war eine neue Welt: das waren unermeßliche, unterseeische Länder mit gewaltigen Bergen und breiten Thälern mit engen Kesseln und weit [51] ausgedehnten Hochebenen, das waren Gründe, in welchen unzählige Thierarten sich des Daseins freuten, das war ein Reich ewiger Kälte und ewiger Finsterniß und dennoch ebenso reich an Wundern wie die Welt, in der wir athmen im rosigen Licht!
Noch zu Zeiten Alexanders von Humboldt hielt man den Atlantischen Ocean für eine tiefe Mulde, welche die Alte Welt von der Neuen trennte. Wie anders stellt sich sein Meeresboden heute unserm geistigen Auge dar! Durchwandern wir, von der Lothleine geleitet, die Gründe desselben, so finden wir hier eine Mannigfaltigkeit von Formen, die anfangs den Forscher verwirrte, bis endlich nach einer mühseligen Arbeit ein klares Bild von den Hebungen und Senkungen des oceanischen Bodens auf den Karten eingetragen werden konnte. Wir wissen, daß in der Mitte des Atlantischen Oceans der Boden desselben sich zu einem Gebirge aufthürmt, welches den Grund des nördlichen Eismeeres mit dem des südlichen verbindet und einen Sförmigen Verlauf hat wie der Ocean selbst. Die Azoren, die St. Paulsfelsen, die Inseln Ascension und Tristan da Cunha sind die höchsten Gipfel dieses unterseeischen Gebirgszuges. Lothen wir das Meer über demselben, so erhalten wir fast niemals Tiefen, die mehr als 3000 m betragen. Dieses Gebirge, dessen nördlicher Theil Dolphin-Rise und dessen südlicher der Challengerrücken genannt wird, trennt das Becken des Atlantischen Oceans in zwei Rinnen: in die östliche, in der wir Tiefen von 5000 bis 6000 m begegnen, und in die westliche mit Tiefen von 7000 bis 8000 m. Im Süden öffnet sich das westliche Thal breit nach den Tiefen des antarktischen Eismeeres, das östliche dagegen ist in der Höhe von Damaraland von dem Becken des Eismeeres durch einen Quertiegel, der von dem Challengerrücken nach dem afrikanischen Festlande läuft, abgetrennt. Im Norden zieht sich eine ähnliche Erhebung von Ost nach West hin: das berühmte Telegraphenplateau
von Maury, auf dem die ersten atlantischen Kabel gelegt wurden. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die weiteren Einzelheiten der Gestaltung des Meeresbodens zu erörtern; aber das eine muß hervorgehoben werden, daß es nicht so leicht war, alle diese Meerestiefen zu ergründen, und die wenigsten von den Laien, welche eine Tiefenkarte betrachten, haben eine Ahnung von der Summe menschlicher Arbeit, die in derselben steckt.
Wie mißt man den Meeresboden? Wie mißt man Tiefen, welche die stolzen Höhen unserer Alpen übersteigen und fast der Höhe des Gaurisankar gleichkommen? Wahrlich, es muß nicht leicht sein, eine Leine zu handhaben, die eine Meile lang ist. Dazu sind Hilfsmaschinen nöthig und diese Hilfsmaschinen wurden erst in der neueren Zeit erdacht. Alle die mühevollen Messungen, die in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts mit unzulänglichen Mitteln gemacht wurden, müssen als ungenau verworfen werden.
Das erste zuverlässige Tiefloth wurde von einem jungen amerikanischen Seeoffizier Brooke, einem Schüler des großen Begründers der Oceanographie Mathew Fontaine Maury, erfunden. Unsere Abbildungen veranschaulichen die Anwendung desselben. A ist eine eiserne Kanonenkugel die in der Mitte durchbohrt ist. Durch diese Kugel wird eine eiserne inwendig hohle Stange B gesteckt. An dem oberen Ende der Stange befinden sich zwei scharnierartig sich bewegende Haken C, welche an den Schnüren b die Kugel A so lange tragen, als der an die Lothleine a aufgehängte Apparat frei schwebt, wie dies Fig. 1 zeigt. Berührt nun der eiserne Stab, der Peilstock, den Meeresboden, so kommt das Gewicht der Kugel zur Geltung; sie gleitet an dem Peilstock abwärts, zieht die Haken C nach unten, so daß sie sich schließlich selbstthätig aushängt (Fig. 2). In die untere Oeffnung des Peilstockes sind inzwischen Proben des Meeresschlammes eingedrungen. Um sie festzuhalten, hat man Ventile angebracht, die beim Heraufziehen des Peilstockes sich schließen. Hat man an Bord des Schiffes bemerkt, daß das Loth den Grund erreicht hat, so windet man die Leine wieder herauf, die eiserne Kugel bleibt auf dem Meeresgrund liegen.
Bei dem verbesserten Tiefloth ist die eiserne Kugel durch eiserne Cylinder (Fig. 3) ersetzt, von denen jeder 1 Centner wiegt; man legt mehr oder weniger Cylinder auf, je nach der Tiefe, die man vermuthet; man rechnet in der Regel ein Gewicht auf 1000 Faden Tiefe.
Das Loth bildet aber nur einen Theil des Apparates. Den zweiten Theil bildet eine etwa 12 000 m lange Leine, die über eine Dampfrolle läuft. Früher nahm man zu diesem Zweck Leinen aus Manillahanf, die in Abständen von 25 zu 25 Faden durch farbige Zeichen markirt waren; neuerdings ist der Manillahanf durch Klaviersaitendraht ersetzt worden.
Große Meerestiefen können nur von einem Dampfer aus und bei windstillem Wetter gemessen werden. Die Fahrgeschwindigkeit des Schiffes muß so gegen die Strömung bemessen werden, daß es auf der Stelle stehen bleibt, damit die Leine zu dem hinabsinkenden Loth stets in senkrechter Richtung sich befindet.
Wir übergehen die Hilfsapparate, die dazu dienen, die Spannung zu verringern und ein Zerreißen der Leine bei unvorhergesehener ruckweiser Bewegung zu verhindern. Ist nun der Apparat fertig zum Gebrauch, so tritt die Dampfrolle in freie Thätigkeit, indem sie die Lothleine abrollt; auf das Kommando „Fallen!“ wird das Loth senkrecht ins Wasser gelassen und saust nach der Tiefe. Anfangs fällt es rasch hinab. Um die ersten hundert Faden zurückzulegen, braucht es nur [52] 40 Sekunden; aber mit zunehmender Tiefe verringert sich wegen der gleichfalls zunehmenden Reibung die Geschwindigkeit, und wenn z. B. 2000 Faden abgelaufen sind, so legt das Loth die nächsten 100 Faden erst in 110 Sekunden zurück. Erreicht es den Meeresgrund, so läuft zwar die Leine infolge des Beharrungsvermögens noch weiter ab, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit. Der Augenblick, in dem diese plötzlich eintritt, heißt der „Sprung“. Alle Zahlen werden genau vermerkt und aus ihnen berechnet man alsdann die Meerestiefe. Das Aufwinden der Lothleine mit dem Peilstock geschieht mit Dampfmaschinen und dauert je nach der Tiefe mehrere Stunden.
Mit den früheren unzuverlässigen Mitteln glaubte man Meerestiefen von 15 000 m und mehr gefunden zu haben. Diese Zahlen mußten später bedeutend herabgesetzt werden. Die größte bekannte Meerestiefe liegt im Nordpacific nordöstlich von der Insel Nipon, sie beträgt 8513 m und wurde im Jahre 1874 von dem amerikanischen Schiffe „Tuscarora“ gelothet, welches den Boden des Stillen Oceans wegen einer geplanten Kabellinie zwischen Asien und Amerika sondirte. Würden wir den höchsten Berg der Erde, den Gaurisankar, in diese Tiefe versenken, so würde seine Spitze noch als ein Felseneiland von 327 m Höhe aus dem Meere herausragen.
Auch der Nordatlantic hat nördlich von den Antillen die bedeutende Tiefe von 8341 m aufzuweisen.
Wie sind nun diese Meeresgründe beschaffen? Was theilen uns die von dem Peilstock heraufgebrachten Bodenproben mit?
Der Felsboden ist nur selten im Meere anzutreffen, meist wird der Meeresgrund von lockerem Material bedeckt. In der Küstennähe herrscht das vom Meere und von Flüssen zernagte Material des Festlandes vor, aber dieser Sand und Schlamm erreicht die eigentliche Tiefsee nicht. Hier treten uns andere Ablagerungen entgegen.
Unter ihnen ist zunächst ein gelblicher oder etwas gräulicher Schlamm hervorzuheben, der beim Trocknen weiß wird und ein kreideartiges Aussehen erhält. Es ist der weiße Tiefseeschlamm. Das Mikroskop belehrt uns über seine Zusammensetzung. Wir finden in ihm zahllose Reste kleinster Wesen, welche das Meer mit ihrem Leben erfüllen: Foraminiferen oder Kammerlinge mit Kalkschalen, Radiolarien oder Strahlenthierchen mit Kieselpanzern, Kieselnadeln, welche Reste der Kieselschwämme darstellen, Diatomeen, jene wunderbar geformten Algen, welche die Kieselguhrerde bilden, zahllose Trümmer von Schalen der oben erwähnten Lebewesen, Mineralkörner und eine Unmasse von Coccolithen, kleinen runden Kalkgebilden, deren Natur bis jetzt noch nicht klar erkannt ist. Bald wiegt in dem Schlamm der eine, bald der andere Bestandtheil vor. Sehr weit verbreitet sind in ihm die Schalen der Globigerinen, einer Art der Kammerlinge, und man spricht darum von Globigerinenschlamm, der weite Strecken des Bodens im Atlantischen Ocean in dessen wärmeren Theilen bedeckt. In einem Kubikcentimeter dieses Schlamms fand Gümbel 7 Millionen Coccolithen, 5000 größere, 200 000 kleinere Foraminiferen, 220 000 Theilchen ihrer zerbrochenen Schalen, 4 800 000 winzige Kalkstäbchen und Staubtheilchen und 240 000 Mineralkörner. In anderen Gegenden fördert die Tiefensonde Schlammproben zu Tage, in denen die Strahlenthierchen oder Diatomeen überwiegen; so ist der südliche Theil des Meeresbodens in der Südsee mit einem Schlamm bedeckt, der zur Hälfte aus Diatomeen besteht und eine Art unterseeischen Kieselguhrs bildet. Diese gewaltigen Ansammlungen von Skeletten, die im Laufe ungeheurer Zeiträume entstanden sind, geben uns beachtenswerthe Aufschlüsse über die Entstehung vieler Gesteinsschichten unserer Erde. In einer Reihe von Kalken sind Schalen von Foraminiferen enthalten. Solche winzige Schälchen bilden den Miliolideenkalk des Pariser Beckens und aus ihnen ist ein großer Theil der Stadt Paris gebaut. Ebenso besteht die weiße Kreide zumeist aus Foraminiferen und Coccolithen. Der weiße Tiefseeschlamm giebt uns also Auskunft, wie die winzigsten Gebilde des Meeres am Aufbau der Erdrinde arbeiten. Ebenso wie Paris kann auch Berlin hier als Beispiel herangezogen werden. Sein Untergrund besteht zum großen Theil aus Diatomeenerde, die einst wohl den schlammigen Grund eines von diesen Algen belebten Gewässern bildete.
In unseren Teichen findet sich zuweilen der Süßwasserschwamm, sein Skelet ist nicht wie das des Badeschwammes aus Horn-, sondern aus Kieselnadeln aufgebaut. Auch seine näheren Verwandten, die Kiesel- oder Glasschwämme, spielten einst beim Aufbau der Erdschichten eine wichtige Rolle. Wer hat uns den Feuerstein geliefert, dem wir früher Funken entlockten, um Feuer anzuzünden? Er ist nach und nach aus den Kieselnadeln abgestorbener Generationen der Glasschwämme entstanden, wobei auch andere kieselgepanzerte Wesen wie die Strahlenthierchen und Diatomeen ihren Antheil gehabt haben mögen.
Der weiße Tiefseeschlamm bedeckt aber den Meeresgrund nur bis zu einer gewissen Grenze Er wird aus Tiefen bis zu 4000 m heraufgeholt; in größeren Tiefen findet man ihn nur ausnahmsweise; die Kalkschalen verschwinden hier allmählich. Zunächst sind sie noch da, aber ihre Umrisse sind undeutlich, wie von Säuren angeätzt, und in den untersten Thälern des Meeresbodens fehlen sie ganz. Auf eine noch nicht aufgeklärte Weise werden sie von dem Meerwasser aufgelöst.
Aus den ungeheueren Abgründen von 5000 bis 6000 m bringt uns die Tiefensonde andere Bodenproben. Dort ist alles mit dem rothen Tiefseethon bedeckt. Er ist bald hell, bald dunkelbraun, enthält Eisenoxyd und Braunstein, sowie winzige Kieselskelette, man findet in ihm kleine Partikelchen von Magnet- und Titaneisen, die als kosmischer Staub von dem Weltraume auf die Erde niederfallen. Man erkennt in ihm Ueberreste von Bimsstein, dem vulkanischen Glase, welches nach Ausbrüchen der Feuerberge oft große Strecken des Meeres bedeckt und durch Meeresströmungen Hunderte von Meilen weit verschleppt wird, bis es sich mit Wasser vollsaugt und zu Boden sinkt. Der rothe Tiefseethon ist die echteste Tiefseeablagerung, welche die Forscher am meisten interessirt, weil seine Herkunft noch dunkel ist wie die Abgründe, in denen er ruht. Jedenfalls bildet er sich außerordentlich langsam. Die Forscher haben auch in diese Tiefen ihre Schleppnetze hinabgelassen und den seit Aeonen gesammelten Thon aufgewühlt, und es war geradezu überraschend, welche Mengen von Knochen dabei zu Tage gefördert wurden. Freilich waren es nur die härtesten Skelettheile, die hier der Zerstörung der Zeit Widerstand geleistet hatten: Zähne von Haifischen und die äußerst soliden Ohrknochen der Wale. „Welch ungeheuere Zeiträume müssen vergehen“, ruft Neumayr in seiner „Erdgeschichte“ aus, „ehe sich die Zähne und vereinzelten Knochen in so riesiger Menge ansammeln können! Dabei muß man die Mittel ins Auge fassen, mit welchen wir den Meeresboden untersuchen; es ist ein ähnliches Verhältniß, als ob man die Beschaffenheit des festen Landes von einem in 6000 bis 7000 m Höhe schwebenden Luftballon dadurch untersuchen wollte, daß ein einige Meter großer Sack an einem Seile auf die Erde niedergelassen, einige Zeit am Boden fortgeschleppt und dann wieder aufgezogen wird. Man kann daraus ermessen, in welchen Massen Knochen und Zähne in den größten Tiefen des Meeres verbreitet sein müssen, wenn unsere unvollkommenen Mittel sie uns in solcher Menge finden lassen.“
Und unter den Zähnen der Haie befinden sich noch solche, die längst ausgestorbenen Arten angehören, die wir sonst nur noch in den Ablagerungen der Tertiärzeit finden! In diesen Zeiträumen, die sich nach Jahren nicht zählen lassen, hat sich somit nur eine so dünne Schicht des rothen Tiefseethones gebildet, daß sie von einem Schleppnetz aufgewühlt werden kann.
Es gab eine Zeit – und nur wenige Jahrzehnte trennen uns von ihr – wo man diesen an Formen so wechselvollen, an Räthseln so reichen Grund der Tiefsee für weiter nichts als einen großartigen Friedhof hielt, der bedeckt wäre mit dem Staub der Gesteine und Knochenresten zahlloser Wesen. Finster und kalt, jedes Lebens bar sollten die ungeheueren Tiefen des Meeres sein, das war ein Lehrsatz, so fest eingewurzelt, daß die ersten glücklichen Fänge aus der Tiefsee als Irrthümer mißachtet wurden! Und heute? Heute sind jene Abgründe, in denen das reichste Leben vorhanden ist, das gelobte Land der Zoologen, welche die Fülle der neuentdeckten Thierformen kaum zu bewältigen vermögen. Die Tiefsee ist auch in der That eine „Neue Welt“, die in unserem Jahrhundert entdeckt wurde und die uns das Meer in seiner ganzen Majestät begreifen läßt. Steigen wir im Geiste in jene finsteren, kalten, lautlosen Abgründe hinab, um zu sehen, wie dort die Allmacht des Lebens, fern von dem leuchtenden Sonnenstrahl, unter einem ungeheueren Drucke sich in tausend Formen entfaltet.
[53]
Quitt.
(Fortsetzung.)
Opitz hatte sich ausgewettert, und als ihm gleich danach eine behaglichere Stimmung wiederkehrte, trat er auch wieder ans Fenster und lehnte sich hinaus, um sich an den Narzissen und Aurikeln zu freuen, die spärlich in seinem Vorgarten blühten. Dabei blies er Wolken aus seinem Meerschaum in die stille Luft und ließ, unter behaglichem Träumen, alles an sich vorüberziehen, was der Tag gebracht hatte.
Lehnert war, als er an Opitz vorbei war, auf sein Haus zugegangen, das unmittelbar jenseit der Lomnitz lag, der Försterei so nahe, daß man sich gegenseitig in die Fenster sehen konnte. Nichts als Fluß und Fahrstraße trennte beide Gehöfte, deren gesammtes Acker- und Heideland in alten Zeilen ausschließlich Stellmacher Menzsches Eigenthum gewesen war, bis man auf dem diesseit der Lomnitz gelegenen Kusselstreifen eine Försterei gebaut und nur alles jenseit des Flusses Gelegene bei den Menz belassen hatte. Das war jetzt runde dreißig Jahr und fast eben so lange hatte man hüben und drüben ohne Neid und Eifersucht gelebt, trotzdem zum Neid, wie nun ’mal die Menschen sind, vielleicht Grund gewesen wäre. Denn wenn einerseits die neue Försterei mit ihrer Sauberkeit und ihrem rothen Dach die drüben gelegene, hier und da sehr baufällige Stellmacherei weit in Schatten stellte, so hatte diese dafür die „fette Seite“ behalten, während sich die Förstersleute, den kleinen Vorgarten abgerechnet, mit einem Streifen Heideland und einem noch schmaleren Lupinenstreifen begnügen mußten. Aber das alles hatte die ganze Zeit über keinen Aerger geschaffen und noch weniger der rein zufällige Umstand, daß das auf einer Stein- und Geröllinsel inmitten zweier Lomnitzarme gelegene Menzsche Wohnhaus, so wenig gepflegt es war, doch kastellartig auf alles unmittelbar Umhergelegene herabsah und natürlich auch auf die Försterei. Zu keiner Zeit, um es zu wiederholen, war an diesem und ähnlichem Anstoß genommen worden, bis Opitz ans Regiment kam, von dem, ohne daß er es zugab, die Hochlage der Stellmacherei drüben einfach als eine Beleidigung empfunden wurde.
Selbstverständlich unterhielt diese malerische Kastellinsel auch ihre Verbindungen mit dem Festland, und zwar mit Hilfe zweier Brückenstege, von denen der eine beinah unmittelbar nach der Försterei, der andere nach der entgegengesetzten Seite hin nach dem Menzschen Ackerland hinüberführte, hinter dem gleich der schräg ansteigende gräfliche Forst begann. Der Ackerstreifen war mit Roggen und Kartoffeln bestellt, von denen der Roggen in diesem Jahre ganz wundervoll stand, auf dem Inselchen selbst aber befand sich, in geringer Entfernung vom Wohnhaus, noch ein Arbeitsschuppen, drin Lehnert die schon von Vater und Großvater her ererbte Stellmacherei betrieb, ein Geschäft, das im Frühjahr und Herbst meist gut ging, im Sommer aber beinah’ ruhte.
So war es auch heut. Alles still. Freilich sah man einen Pflug und ein paar alte Karren und Wagenachsen unter dem Schuppen stehen, aber all diese Dinge konnten ebenso gut zur eignen Wirthschaft gehören, wie zur Ausbesserung abgeliefert sein. In dem abgeschrägten Vorgarten von nur geringer Tiefe, durch den eine Feldsteintreppe zu dem Häuschen hinaufführte, blühten Georginen und Reseda, während ein alter Rosenstrauch von beträchtlicher Stärke neben der Hausthür aufwuchs und sein mit gelben Rosen überdecktes Gezweig unter dem Strohdach hin ausspannte, Nachmittagssonne lag auf Haus, und Gehöft und nichts war hörbar, als die doppelarmig vorüberschießende Lomnitz und das Meckern einer Ziege vom Stall her. Ein Hahn, ein schönes Thier mit Silberhals, stolzierte den Schuppen entlang, aber er krähte nicht und hatte wenig Aufmerksamkeit für die Hühner, die sich Erdlöcher gemacht hatten, um sich zu kühlen.
Nicht ganz so still war es drinnen im Hause, in welchem Lehnert inzwischen eingetroffen war.
Er hatte sich unterwegs nicht beeilt, ebenso wenig wie Opitz. Vom Pastorhause war er zunächst nach dem Kretscham hinübergegangen und hatte hier von dem ihn begrüßenden Wirth erfahren, daß Frau Menz, seine Mutter, eben da gewesen sei und gerad’ an demselben Tisch erst einen „Grünen“ und dann einen Ingwer getrunken habe. Das hörte Lehnert nicht gern. Er gönnte der alten Frau die kleine Herzstärkung, denn er liebte sie trotz all ihrer Schwächen, aber er ärgerte sich wieder über die Heimlichkeit, und dieser Aerger war noch nicht voll verwunden, als er beim Betreten der Schwelle seines Hauses der am Herde hantierenden Alten ansichtig wurde.
„Guten Tag, Metier. Pohl läßt grüßen.“
„Welcher?“
„Nu, der aus dem Kretscham unten.“
„So, der! Warst Du da?“
„Ja, Mutter. Und Du kannst Dir denken, ich habe mich just da hingesetzt, wo Du gesessen hattest. Und Dir zu Ehren hab’ ich meinen Ingwer aus Deinem Glase getrunken. Es stand noch da.“
Die Alte sah verlegen vor sich hin und sagte dann: „Aber nur einen, Lehnert. Mir war so schwach.“
Lehnert lachte. Dann ging er auf sie zu und sagte, während er ihr das graue Haar streichelte: „Gott, Mutter, wie Du so bist! Wenn das einer hört, so müßt’ er denken, der Lehnert ist ein Filz und schlechter Kerl und gönnt seiner alten Mutter nicht einmal einen Tropfen Stärkung. Aber wie liegt es denn? Ich gönne Dir nicht einen Ingwer, ich gönne Dir zwei, und wenn Dir’s nicht zu viel wird, Alte, dann können es auch drei und vier werden. Ich habe Dich auch noch eigens gefragt und da hast Du ,nein’ gesagt, aber freilich, als Du ,nein’ sagtest, da sagtest Du schon ,ja’, und als ich die Klingelthür bei Siebenhaar noch kaum aus der Hand hatte, da bist Du schon hinübergegangen. Immer versteckt! Du kannst nichts offen thun, auch nicht ’mal das, was die Sonne gar nicht zu scheuen braucht. Alles muß heimlich sein. Und sieh, Mutter, so hast Du mich auch erzogen und angelernt. Das muß ich Dir immer wieder sagen. Gott sei’s geklagt, daß ich’s muß. Es ist immer ein und dasselbe, was Du so bei Dir denkst: es sieht es ja keiner; bei Nacht sind alle Katzen grau und es darf bloß nicht ’rauskommen. Und wenn es nicht ’rauskommt, dann ist alles gleich. So denkst Du bei Dir und denkst auch wohl: ach, der liebe Gott, der is nicht so, der ist gut und freut sich, wenn man einem Förster oder Grenzaufseher ein Schnippchen schlägt.“
„Ach, Lehnert, rede doch nicht so! Du weißt ja doch . . .“
„Und wenn es dann schief geht, ja, dann ist es wieder anders. Dann geht es in die Predigt und Siebenhaar . . . na, Du weißt schon, ich hab’ es Dir heute schon ’mal gesagt . . . der muß dann wieder einen Heiligen aus mir machen. Ach, Mutter, Du meinst es mit keinem bös, und mit mir erst recht nicht, aber Du hast das Ehrlichsein nicht gelernt und davon ist alles gekommen . . . Und nun will auch Siebenhaar noch mit ihm sprechen, mit Opitz, als ob das was helfen könnte, will mich mit ihm versöhnen, und ich hab’s auch versprechen müssen. Aber ich mag nicht. Ich hasse ihn, und Haß ist überhaupt das beste, was man hat?“
„Ueberlege Dir’s, Lehnert! Er ist ein gräflicher Förster und is nu doch ’mal der Herr.“
„Ach was, der Herr! Ein Diener is er. Ich bin ein Herr, eher als er, und kann machen, was ich will.“
„Er hat das Ansehen vor den Leuten und ich weiß es von Christine, er ist nicht so schlimm, wie Du glaubst und ihn immer machen willst. Er kann auch durch die Finger sehen. Aber er verlangt, daß man ihm gute Worte giebt und ihn für was Besonderes ansieht. Und das thust Du nicht. Er kann bloß Deinen Trotz nicht leiden. Und darum hab’ ich Siebenhaar gebeten . . .“
„Aha,“ lachte Lehnert. „Also Du! Nun meinetwegen.“
„Und darum,“ so wiederholte die Alte, „Hab’ ich Siebenhaar gebeten, als ich nu doch ’mal mit ihm sprach, daß er ihn gut für uns stimme. So viel weiß ich, er giebt was auf Siebenhaar und wenn der ihn ’rum kriegt und Opitz Dir dann die Hand giebt, dann nimm sie, dann stoße sie nicht weg und vergiß all das Alte. Sieh, Lehnert, es hat ja doch alles seine zwei Seiten und vielleicht hat er nicht so ganz unrecht gehabt und Du hast [54] aus der Sache mit dem Kreuz mehr gemacht, als Du hättest machen sollen. Gieb nach, Lehnert! Trutz macht Feind’. Und wir brauchen Freunde, weil wir arm sind und das Geschäft schlecht geht und gerade jetzt im Sommer. Und unser Nachbar ist er auch. Es is doch sonst mit den Försters gut gegangen. Gieb nach und versöhne Dich mit ihm! Dann haben wir gute Zeit, und wenn dann ’mal was vorkommt, na, Du weißt schon, was ich meine, so verpufft und verknallt es. Kennst ja doch unser altes Sprichwort: der Wald ist groß und der Himmel ist weit.“
Lehnert ging auf und ab, die Hände aus dem Rücken. Er hatte das alles schon oft gehört, nur eines nicht: daß er das mit dem Kreuz doch vielleicht schlimmer genommen hätte, als nöthig. Und so hochmüthig er war, so bescheiden war er auch.
„Wenn es so wäre? Wenn ich mehr daraus gemacht hatte, als nöthig?“ so gingen seine Gedanken.
Und er nahm der Mutter Hand und sagte: „Gut, Alte, ich will es mir überlegen.“
Was hüben die Mutter ihrem Sohn und drüben die Frau ihrem Mann gesagt hatte, blieb doch nicht ganz ohne Einfluß, weil beide Parteien klug genug waren, das Wahre darin herauszufühlen. Opitz war strenger als nöthig, Lehnert war aufsässiger als nöthig, und der schlichte Ton, worin das einem jeden gesagt wurde, that seine Wirkung. So machte sich’s, daß beide still schweigend übereinkamen, sich wenigstens nicht mehr reizen zu wollen, und weil sie dabei fühlen mochten, daß das bei steten persönlichen Begegnungen sehr schwer sein würde, so faßten sie den Entschluß, sich nach Möglichkeit aus dem Wege zu gehen. In der That, sie vermieden es, sich zu sehen, und gaben es unter anderm auf, zu gleicher Zeit wie sonst wohl im Vorgarten zu sitzen und sich über die Straße hin mit den Augen zu messen. Ja, Lehnert seinerseits ging noch weiter und machte, wenn er ins Dorf mußte, nur um die Försterei zu vermeiden, lieber den Umweg am Waldsaume hin. Auch die Hühner, die durch ihre Besuche drüben im Garten der Försterei beständig Anlaß zu Klagen und bitteren Worten gegeben hatten, hielt er besser in Ordnung. An einen völligen Ausgleich der alten Gegensätze war freilich nicht zu denken, dazu war zu viel vorgefallen, aber wenn Friede nicht sein konnte, so war doch wenigstens Waffenstillstand.
Und unter solchem Waffenstillstande verging eine Woche.
Nun war wieder Sonntag und die Glocken der Arnsdorfer Kirche klangen wie gewöhnlich vom Thal zu den Bergen herauf. Aber diesem Rufe folgten heute nur wenig, weil oben in der Kirche von Wang ein Brückenberger Paar getraut werden sollte. Das veranlaßte denn alle die, die sich mehr von der Trauung einer jungen hübschen Braut als von der Predigt des alten Siebenhaar versprachen, lieber bergauf nach Wang zu steigen, und das um so mehr, als über das wundervolle Brautkleid, das aus Hirschberg und nach andern sogar aus Breslau stammen sollte, schon die ganze Woche lang gesprochen worden war. In der That, Schaulust und Neugier gaben heute den Ausschlag. Aber einige stiegen doch nicht bloß als Neugierige, sondern als recht eigentliche Trauzeugen und Hochzeitsgäste hinauf, unter ihnen auch Opitz in Gala.
Zu den zur Hochzeit Geladenen hatte wegen aller guter Beziehungen zum Bräutigam anfangs auch Lehnert gehört; als dieser aber durch Christine von Opitz’ wahrscheinlicher Anwesenheit erfuhr, war er sofort zum Fernbleiben entschlossen gewesen. Wußt’ er doch, daß mit Opitz, wenn dieser ein Glas über den Durst getrunken hatte, doppelt schwer zu verkehren war, und auf diese Gefahr hin wollt’ er eine Begegnung mit ihm nicht wagen. So zog er es denn vor, zu Hause zu bleiben und in einem von Amerika handelnden Buche zu lesen, das ihm ein alter Kriegskamerad neuerdings geliehen und auf das er sich schon ein paar Tage lang gefreut hatte. Daneben war es ihm übrigens durchaus recht, daß seine Mutter, ohne gerade zu den Geladenen zu zählen, an dem Kirchgänge nach Wang hinauf theilnehmen und sich hinterher in dem ihr aus besseren Tagen wohlbekannten Hochzeitshause nach Möglichkeit nützlich machen wollte.
Der Tag wurde freilich unserem Lehnert ganz gegen Erwarten lang und schwer genug. Denn bald nach Opitz waren auch Frau Bärbel und Christine nach Wang hinaufgestiegen, und so kam es, daß der auf seinem Inselchen Zurückgebliebene zwölf Stunden lang nichts als das Vorüberschießen der Lomnitz hörte, wenn nicht gerade drüben der Opitzsche Hofhund anschlug. Bis gegen abend sah er so draußen im Freien und las von Urwald und Prairie, von großen Seen und Einsamkeit. Er schwelgte darin und vergaß die Zeit, aber mit einemmal ergriff ihn doch ein Grauen. „Einsamkeit! Nein, nein, nicht Einsamkeit! Nicht einsam leben, nicht einsam sterben.“ Und er wiederholte sich das Wort und in seiner überreizten Einbildungskraft sah er sich auf einem Bergkegel, ein Thal zu seinen Füßen und den Sternenhimmel über sich. Ein Frösteln überkam ihn zuletzt, und so ging er denn wieder hinein und warf Kienäpfel in die Gluth und starrte darauf hin. Aber das Hineinstarren in die Flamme war ihm bald nicht weniger unheimlich als das Bild, das eben draußen vor seiner Seele gestanden hatte. Dabei war es ihm beständig, als ob er Stimmen höre, Stimmen von weit, weit her. Und er sprang auf und trällerte vor sich hin, um sich alles, was ihn ängstigte, fortzusingen. Aber es wollte nicht recht glücken und er war froh, als er um die zehnte Stunde seine Mutter über den Brückensteg schreiten sah.
„Singst ja so, Lehnert. Was is es denn?“ sagte die Alle beim Hereintreten. „Christine war wohl da . . . Ja, sie ging schon, als der Tanz eben anfing.“
„Ach, laß doch die Christine!“
„Du nimmst sie doch noch.“ Und während die Alte das sagte, stellte sie ein Bündel, das sie bis dahin vorsichtig in den Händen gehalten hatte, auf den Tisch und löste den Knoten eines buntgeblümten Taschentuchs, in das alles eingeschlagen war, was sie vom Hochzeitshause her mitgebracht hatte: große Stücke Streußelkuchen, eine halbe Wurst, ein Schinkenknochen und ein Napfkuchen.
„Wollen wir uns noch einen Kaffee machen, Lehnert?“
Er schwieg.
„Du hast ja noch Feuer im Ofen. Und das ist recht. Oben auf Wang, in der Kirche, war es wieder so kalt und auf dem Kirchhof pfiff es, daß es einem bis auf die Seele ging. Ich glaub’, ich habe mir wieder was geholt, hier links unterm Schulterblatt. Aber wenn wir uns noch einen Kaffee machen und ein Glas Rum einthun, ich habe noch welchen . . . ja, Lehnert, ein paar Tropfen muß man doch immer haben . . . dann vergeht es wieder. Und ein Katzenfell ist auch gut.“
Während sie noch so sprach, hatte sie ein Messer geholt und begann den Rapskuchen in große Scheiben zu schneiden. „Iß, Lehnert; frisch schmeckt er doch am besten!“ Und dabei griff sie nach dem größten Stücke.
Lehnert schwieg noch immer.
„Iß doch, Jung’!“
„Ich mag nicht, Mutter . . . Und wie das alles wieder aussieht, – wie’n Bettelsack. Haben sie Dir’s denn gegeben?“
„Gewiß! Ich werde mir doch nichts wegstibitzen und ab zieh’n wie die Katze vom Taubenschlag!“
„Ach, das mein’ ich ja nicht, Mutter. Ich meine bloß, ob sie Dir’s aus freien Stücken gegeben haben oder ob Du darum gebeten hast?“
„Versteht sich, hab ich drum gebeten. Alle haben . . .“
„Opitz auch?“
„Nu, der wohl nich. Der is ja was Vornehmes. Und Siebenhaar auch nich.“
„Siebenhaar? War denn Siebenhaar auch da?“
„Gewiß war er da. Der von Wang hat freilich getraut, aber Siebenhaar kam auch noch und kam eben, als alles zu Tisch ging, und war großer Jubel, als er kam, und saß gerade der Braut gegenüber und hat auch eine Rede gehalten. Und als sie die Tische wegtrugen und das Tanzen anfangen sollte, da nahm Siebenhaar Opitzen am Arm und beide gingen wohl an die vier oder fünfmal um die Wiese ’rum. Und immer, wenn sie wieder an dem Staketzaun vorüber kamen, hab’ ich gehorcht.“
„Das glaub’ ich. Du horchst immer. Aber der Horcher an der Wand . . .“
„Diesmal nicht, Lehnert. Es war bloß Gutes, und daß es von Dir war, ist sicher; ich habe Deinen Namen gehört. Und Opitz, der wieder etwas fisslig war - er hielt sich aber und ließ sich nichts merken – Opitz nickte. Das hab’ ich mit diesen meinen Augen gesehen. Und einmal hört’ ich ganz deutlich, daß er sagte: ,Nu, ja, ja! Jeder ist ein Mensch und jeder hat seine Menschlichkeiten [55] und seine Fehler. Und ich auch.’ Siebenhaar hat ihm also ins Gewissen geredet. Und Du sollst seh’n, Lehnert, es wird noch alles gut, und Du kommst mit ihm auf Freundschaft und Du und Du. Und dann guckt er uns durch die Finger und wir haben gute Tage.“
„Ja, ja,“ sagte Lehnert, „durch die Finger gucken, das kenn’ ich. Is ja das alte Lied. Na, gute Nacht, Mutter! Ich bin müde.“
Und dabei nahm er eine Oellampe und das Amerika-Buch und stieg in seine Giebelkammer hinauf. Oben aber schob er einen Stuhl an sein Bett und eh’ er das Licht auslöschte, sah er noch einmal auf den Titel des Buchs. Der lautete: „Die neue Welt oder Wo liegt das Glück?“
Eine Woche verging, während der Lehnerts Stimmung beständig wechselte, was bei den Erlebnissen der letzten Zeit und mehr noch bei seinem von Natur beweglichen Gemüth nicht wohl Wunder nehmen konnte. Denn so gewiß er einen Hang nach dem Abenteuerlichen hatte, so gewiß überkam ihn auch, inmitten dieses Hanges, eine plötzliche Sehnsucht danach, die Hände in den Schoß zu legen und alles ruhig über sich ergehen zu lassen. Er war dann mit einem Male von der Vergeblichkeit alles Ankämpfens überzeugt und verlor in diesem ihn überkommenden Gefühl seiner Ohnmacht auch die Lust zum Kampf. „Ja, die Alte hat eigentlich ganz recht. Was ist all die Jahre bei meiner Auflehnung herausgekommen? Nur Aerger und böses Blut. Und so geht es dann weiter, immer Zug um Zug, bis man sich das Messer in die Brust stößt. Ach, es ist besser, ich thue, was ich versprochen hab’, und grüß ihn, anstatt ihn anzustarren und ein spöttisch Gesicht zu machen. Er ist der Stärkere, weil er im Dienst ist und die Gerichte neben und hinter sich hat. Und wer mit dem Stärkeren anbindet, so lang er noch eine Wahl hat, der ist ein Narr. Wahrhaftig, was hab’ ich davon gehabt? Nichts, als daß ich zwei Monate hinter Schloß und Riegel war und daß nun in meinen Akten steht: ,Bestraft’. Und wer kann immer gleich erzählen, wie’s kam und daß es eigentlich nichts war; bestraft ist bestraft, und wenn man gefragt wird, wie’s denn eigentlich mit einem stehe, so wird man roth und steht da, als ob man ein Galgenvogel wär’ oder einer, der den Leuten die Uhr aus der Tasche zieht.“
In dieser Richtung gingen tagelang Lehnerts Betrachtungen, und mehr, er that auch danach, und wenn er in der letzten Woche, bloß um einer Begegnung mit Opitz auszuweichen, den großen Umweg am Waldsaume hin gemacht hatte, so zwang er sich jetzt, die Begegnung geradezu zu suchen, nur um durch artigen Gruß oder auch wohl durch ein „Guten Morgen, Herr Förster“ seinen Respekt zu bezeigen. Und Opitz freute sich dieser Wandlung und gefiel sich seinerseits darin, den Gnädigen zu spielen. Er trat jetzt öfter, wenn Lehnert vorüber ging, mit einer Art wohlwollenden Behagens an den Staketenzaun heran und verstieg sich nicht bloß zu Fragen und Scherzworten, sondern einmal sogar bis zur Inanspruchnahme kleiner Gefälligkeiten. „Ihr geht ja nach Arnsdorf, Lehnert. Bitte, nehmt das mit an den Grafen, und wenn Ihr bei Pohl vorbei kommt, so bringt mir eine Kruke Himbeersaft mit herauf. Oder lieber eine Flasche, wenn er’s in Flaschen hat. Ich kann heut die Christine nicht schicken.“
An solchen Annäherungen war eine Zeit lang kein Mangel und Frau Menz berechnete sich schon, was im Herbst beim Gänseschlachten, auf das sie sich ganz vorzüglich verstand (sie sang dann immer, wenn sie die Gans zwischen die Kniee nahm und mit dem Messer zu bohren anfing, allerlei Wiegenlieder), an Federn und Fett für sie abfallen würde. „Ja, Lehnert, Du siehst es nun. Ist es nicht besser so? Haben wir nicht gute Tage? Sage selbst!“
Aber diese guten Tage sollten nicht Dauer haben. Im Gegentheil, sie gingen so rasch wie sie gekommen waren, und wie gewöhnlich war es ein bloßes Geklätsch, was den ersten Anstoß zu diesem Wiederhinschwinden gab.
Christine, die wohl wußte, welche Pläne Frau Menz mit ihr hatte, war jetzt oft drüben bei der Alten, öfter vielleicht als gut war und jedenfalls öfter als sie sollte. Zu verdenken war es ihr freilich nicht, denn wenn Opitz im Wald war, dann war die Försterei ein schweigsames, ja beinah’ ein melancholisches Haus, in dem wenig gesprochen wurde. Plaudern aber und sich aussprechen war Christinens größte Lust und dazu gab es für sie keine bessere Gelegenheit, als bei den Menzes drüben. Alles nahm ihr die Alte wie vom Munde weg, und wenn drüben bei Opitzens eine Maus gefangen worden oder ein Fliegenstock umgefallen war, so war es ein mittheilenswerthes Ereigniß, an das sich sofort allerlei Hoffnungen und Befürchtungen knüpften.
Und zu solcher Plauderstunde war man eben wieder beisammen und genoß sie doppelt, weil Christine nicht mit leeren Händen, sondern mit einem Teller voll prächtiger Glaskirschen herübergekommen war, deren Heranreifen die alte Menz schon seit anderthalb Wochen mit Aufmerksamkeit verfolgt hatte.
„Die schickt Euch die Frau Försterin,“ sagte Christine.
„Gott, Gott, die Frau Försterin! Eine seelensgute Frau, das muß wahr sein, und alle wie frisch vom Baum und keine angestoßen. Aber er auch, er is auch gut; ein bischen bullrig und kollert gleich, aber wer es bloß versteht, der hat es gut mit ihm. Und wie soll er’s denn auch anders machen? Er muß doch auch welche anzeigen. Lehnert sagt es auch. Und sie sind ja jetzt ein Herz und eine Seele.“
„Ja,“ sagte Christine. „Das sind sie. Das heißt so lang es dauert.“
„Wird schon dauern, Kind, wird schon. Warum soll es nicht dauern? Sie haben sich nun beide die Hörner abgestoßen und sehen, daß Frieden besser ist als Krieg. Lehnert grüßt ihn und gafft ihm nicht mehr ins Gesicht. ,Guten Morgen, Herr Förster,’ sagt er. Und dann stehen sie beid’ an dem Staketenzaun und haben ihren Schnack. Und neulich hat ihm Opitz einen Zettel an den Grafen mitgegeben und eine Bestellung für unten bei Pohl, und Lehnert hat ihm alles besorgt und ihm den Himbeersaft auch richtig mit ’rauf gebracht. Eine ganze Flasche voll. Es war gerade der Tag, als der neue Oberförster kam und Ihr drüben den Semmelpudding hattet. Aber was sag’ ich nur, Du mußt es ja besser wissen als ich . . .“
„Freilich weiß ich es. Aber ich weiß auch, was Opitz sagte.“
„Was war es, was er sagte?“
„,Nu,’ sagte er, als er vom Flur in die Küche kam und den Saft vor uns hinstellte, ,da habt Ihr den Saft, das süße Zeug, das der Lehnert mit ’rauf gebracht hat. Und diesmal mag es drum sein. Aber das nächste Mal, Bärbel, das nächste Mal paß besser auf! Der große Herr drüben ist auf eine Weile zahm geworden und frißt vorläufig aus der Hand. Aber wer weiß, ob es vorhält . . . ’ Ja, Frau Menz, das war es, was Opitz sagte. Und als meine gute Frau darauf antwortete und ihm zureden wollte, weil Lehnert ja jetzt grüße, da ließ er sie gar nicht zu Worte kommen und bullerte gleich los: ,Das verstehst Du nicht, Bärbel. Was heißt Gruß? Er grüßt; aber es ist auch danach. Er hat noch dieselben Mucken wie sonst; ich seh’s ihm jedesmal an, wenn er so verlegen dasteht und nicht weiß, was er sagen soll. Und ein Glück ist es, daß er wenigstens eine Weile klein beigegeben hat! Davon erholt er sich nicht wieder. Wer ’mal zu Kreuze gekrochen ist, der bringt die Courage nicht mehr fertig. Das ist nu ’mal so.’“
So ging das von Frau Menz und Christine geführte Gespräch, das noch eine Weile weiter gesponnen wurde, weil sie sich allein glaubten. Aber sie waren nicht allein. Dicht hinter ihnen stand Lehnert in der offenen Thür und hatte jedes Wort mit an gehört. Er zog sich, eh’ sie seiner gewahr wurden, still wieder zurück und ging auf seinen Arbeitsschuppen und in diesem auf die Stelle zu, wo die Späne hoch aufgeschichtet lagen. Da warf er sich hin und schlug sich vor die Stirn und schwur und zitterte. Denn er war seiner Sinne kaum noch mächtig. Zuletzt verfiel er in ein krampfhaftes Weinen, aber auch die Thränen gaben ihm keine Erleichterung. Er hatte sich klein und verächtlich gemacht und alles umsonst! Alles lag wieder wie vordem, und vor seiner Seele stand es, wie’s kommen würde.
Am anderen Tage hatte sich Lehnert von dem, was er gehört, insoweit erholt, daß er die Kraft aufbrachte, sich’s ruhiger zurecht zu legen. „Er traut mir nicht. Soll ich ihm böse darüber sein? Trau ich ihm? Was dem einen recht ist, ist dem andern billig. Es ist gut, daß ich nun weiß, wie’s mit ihm steht und
[56][57] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [58] was ich von ihm zu gewärtigen habe. Wenn ich ihm so weiter geglaubt hätte, so wär’ ich vielleicht unvorsichtig geworden, und das thut nie gut, am wenigsten einem Opitz gegenüber . . . Ich will nicht wieder anfangen, nein, er soll anfangen. Dann bin ich ohne Schuld.“ So sprach er noch weiter vor sich hin, ohne die leiseste Vorahnung, daß derselbe Tag noch den alten Streit wieder anfachen sollte. Nur schärfer und bitterer als je zuvor.
Es war ein heißer Tag und die Steine, die durch die Lomnitz hin zerstreut lagen und bei niedrigem Wasserstand einen Uebergang von einem Ufer zum andern bildeten, blitzten in der Sonne; das Heidekraut drüben auf der Opitzschen Seite schimmerte roth und von dem Lupinenfeld, das, freilich als schmaler Strich nur, durch das Heidekraut hinlief, zog ein süßer Duft nach dem Inselchen herüber. Der Himmel stand in einem wolkenlosen Blau. Lehnert, der sich der großen Hitze halber von dem Vorplatz am Schuppen unter den Schuppen selbst zurückgezogen hatte, sah einen Augenblick von seiner Arbeit auf und wurde dabei mehrerer Taubenschwärme gewahr, deren einer eben über die Tannen am Waldsaum hinschwebte. Plötzlich aber, während er noch so hinaufsah, vernahm er durch die Mittagsstille hin einen Hundeblaff und gleich danach einen durchdringenden Hahnenschrei, der, weitab davon, sicher und siegesfroh wie sonst wohl die Seinen zu Hauf zu rufen, umgekehrt etwas von einem Angst- und Todesschrei hatte. Lehnert ahnte, was es war, sprang auf die Deichsel und Vorderachse des gerade vor ihm stehenden Arbeitswagens und sah von dieser Hochstellung aus, was drüben vorging. Diana hatte den Hahn an seinem Silberkragen gepackt und schüttelte ihn. Und nun ließ der Hund wieder ab und die plötzliche Lautlosigkeit verrieth nur zu deutlich, daß das schöne Thier, das er gepackt und geschüttelt hatte, todt war. Das gab Lehnert einen Stich ins Herz, denn neben dem prächtigen gelben Rosenstrauch an Haus und Dach war der Silberhahn so ziemlich das einzige, woran er hing; alles andere war in Rückgang und Verfall. Er ballte die Faust und drohte nach drüben hin, aber er bezwang sich wieder und richtete seinen Zorn und Unmuth, einen Augenblick wenigstens, statt gegen Opitz gegen die eigene Mutter.
„Die ist schuld, die, ,die liebe Frau Menz’; hab’ ich den da drüben nicht schon ein dutzendmal sagen hören: ,liebe Frau Menz’, wenn Sie nicht nach dem Rechten sehen und das Hühnervolk immer über den Steg und die Steine bis in meinen Vorgarten lassen, ich stehe für nichts; Diana packt ’mal zu? Nun hat Diana zugepackt und wir sind unseren Hahn los und müssen noch still sein und vielleicht auch noch gute Worte geben wegen der Aurikeln und Levkoien oder was das arme schöne Thier sonst noch zerpflückt und zertreten hat . . . Aber so ist die Alte, sie will die paar Futterkörner sparen und selbst ihre Hühner sollen drüben zu Gaste gehen. Es ist ein Elend und bloß neugierig bin ich, was er nun machen und ob er sich entschuldigen und so was von Bedauern sagen wird.“
Und sieh, es währte keine Viertelstunde, so kam denn auch Christine und bestellte von Förster Opitz: es thät’ ihm leid, daß seine Diana den Hahn gewürgt hätte. Mehr könn’ er aber nicht sagen. Er habe der Frau Menz im voraus gesagt, daß es so kommen würde. Sein eigener Schade sei noch größer, und wenn er zusammenrechne, was die Menzschen Hühner ihm alles verdorben hätten, so käme mehr heraus als der Hahn.
„Und will er denn den Hahn behalten?“ wimmerte die Alte.
„Nein,“ sagte Christine, „den Hahn sollt’ ich Euch bringen. Aber Frau Opitz sagte, ,der würd’ Euch doch nicht schmecken.’ Und hinterher hat sie mir heimlich gesagt, ich sollt’ Euch fragen, was Ihr dafür haben wolltet, und sie wollt’ es alles bezahlen und noch ein Reugeld dazu.“
Lehnert war, als seine Mutter und Christine so sprachen, von seinem Arbeitsschuppen herbeigekommen.
„Ich will den Hahn,“ sagte er, „und nicht das Geld. Aber gegessen wird er nicht, Mutter. Ich begrab’ ihn und mach’ ihm einen Stein. Das schöne Thier! Meine einzige Freude! Nun ist er hin. Diese Diana, diese Bestie! Mir will sie auch immer nach den Beinen. Aber sie soll sich vorsehn, und ihr Herr auch!“
Und er ging wieder an seine Arbeit, während Christine bei der Alten blieb und ihr ohne weiteres das Geld gab, das die gute Frau Opitz für den erwürgten Hahn bewilligt hatte. –
Lehnert verwand es schneller, als er selber gedacht haben mochte. Hätt’ er klarer in seinem Herzen lesen können, so würd’ er gefunden haben, daß er eigentlich froh war, seines Gegners Schuldsumme wachsen zu sehen. Je mehr und je rascher, desto rascher mußt’ auch die Abrechnung kommen, das war das Gefühl, das ihn mehr und mehr zu beherrschen begann. Bei Tisch sprach er nicht, und als er den Krug Bier, den ihm die Mutter aus dem Kretscham geholt, geleert hatte, ging er auf seine Kammer hinauf und schlief.
Als er wieder wach war, war er zunächst willens, doppelt fleißig zu sein und bei der Arbeit alles zu vergessen – nicht für immer, dafür war gesorgt, aber doch auf ein paar Stunden. Am Abend wollt’ er dann in den Querseiffner Kretscham geh’n, wo heute Tanz war.
„Ich sitze jetzt zu viel an der Schnitzelbank und lebe . . . nun, wie leb’ ich? Ja, wie wenn ich nur noch Botenfrau wär’, Botenfrau für Opitz. Ich will es mir heute ’raustanzen aus dem Geblüt.“
Und damit ging er von seiner Kammer in die Küche, nahm da den Bunzlauer Topf, drin ihm die Alte den Nachmittagskaffee warm zu stellen pflegte, vom Herd und ging wieder auf seinen Schuppen zu. Die Hühner lagen hier in ihren Erdlöchern und sahen ihn wie fragend an.
„Ihr wollt mich wohl gar noch verantwortlich machen? Dummes Volk! Ich sag’ euch, er wäre nicht ’rüber gegangen, er hielt auf sich und hätte sich seine paar Körner auch hier gesucht. Ihr seid schuld, ihr habt ihn verleitet, und er ist euch bloß gefolgt, um euch nicht im Stich zu lassen. Nun ist er weg und ihr habt das Nachsehen. Solchen schönen Herrn kriegt ihr nicht wieder, verdient ihr auch gar nicht.“
Er unterhielt sich noch so weiter und freute sich, daß er selbe gute Laune wieder hatte.
So vergingen etliche Stunden und die Sonne machte schon Miene, hinter der mit Tannen besetzten Höhe zu verschwinden. Lehnert aber, der all die Zeit über mit besonderem Fleiße gearbeitet, hatte seines in die Hobelspäne gestellten Kaffees ganz vergessen und wollt’ eben aufstehen, um das Versäumte nach zuholen, als die Mutter in großer Hast und Aufregung vom Haus her auf ihn zukam und in den Arbeitsschuppen hineinrief: „Ein Has’, Lehnert, ein Has’!“
„Wo, Mutter?“
„In unserm Korn.“
Und ehe zwischen beiden noch weiter ein Wort gewechselt werden konnte, sprang Lehnert auch schon von seiner Arbeit auf, lief auf das Haus zu, riß die Flinte vom Riegel und stürzte durch die Hinterthür, über den Hof fort, auf den zu Feld und Wald hinüberführenden Brückensteg zu. Bevor er diesen aber erreichen konnte, wurd’ es dem Hasen drüben nicht recht geheuer, der denn auch in kurzen Sätzen, und zwar immer an dem Kornfeldstreifen entlang, sich auf den Wald zu zog. Freilich nur langsam und mit Pausen. „Sieh, er sputet sich nicht ’mal, er hat nicht ’mal Eile,“ sagte Lehnert vor sich hin und legte den Kolben an die Schulter und zielte. Da wurde der drüben mit einem Male flinker und beeilte sich, den kaum zehn Schritt breiten Abhang, der zwischen Acker und Wald die Grenze zog, hinauf zukommen; aber eh’ er noch bis an das Unterholz heran war, fiel der Schuß. Am Saume hin zog der Pulverrauch und wollte sich nicht gleich verthun; Lehnert indeß, der wohl wußte, daß er keinen Fehlschuß gethan hatte, ging langsam auf die Stelle zu, nahm den Hasen vom Boden und kehrte dann über Steg und Hof in sein Häuschen zurück.
„Da, Mutter. Der soll uns schmecken. Opitz kann sich den Hahn braten lassen.“
Erst als Lehnert diesen Namen nannte, kam der Alten die nur zu berechtigte Sorge wieder, was Opitz zu dem allem wohl sagen würde. Lehnert selbst aber war guter Dinge, sprach in einem fort von Haus- und Feldrecht und suchte der Alten ihre Befürchtungen auszureden. Ob es ihm ernst damit war und ob er wirklich an sein „Haus- und Feldrecht“ glaubte, war schwer zu sagen und blieb auch da noch im Ungewissen, als eine halbe Stunde später Opitz in Person von seiner Försterei herüberkam und den Hasen forderte.
Lehnert spielte den Unbefangenen, ja zunächst sogar den Verbindlichen und bat Opitz, Platz nehmen zu wollen, und erst als dieser, unter Ablehnung der Artigkeit, die Forderung wiederholte, stellte sich Lehnert mit dem Rücken an den Ofen und sagte: „Was man nicht hat, kann man nicht geben.“
[59] Um Opitz’ Züge, der nur zu gut wußte, daß er jetzt seinen alten Gegner in Händen habe, flog ein spöttisches Lächeln, und es trieb ihn mächtig, diesem seinem Gefühle von Ueberlegenheit auch sofort einen Ausdruck zu geben. Er bezwang sich aber und sagte: „Lehnert, Ihr nehmt den Streit wieder auf und thätet doch klüger und besser, es nicht zu thun. Ich warn’ Euch. Ich mein’ es gut mit Euch.“
„Ich habe den Hasen nicht.“
„Ihr habt von dem Brückensteg aus gezielt und geschossen.“
„Ich habe von dem Brückensteg aus geschossen, aber nicht gezielt. Der Hase saß in unserm Feld; er ist jetzt öfters bei uns zu Gast, und nachts wird er wohl mit Familie kommen. Ich brauche keinen Hasen in meinem Felde zu leiden und ich hab ihn verjagen wollen.“
„Ein Has’ ist ein Has’ und Ihr braucht bloß in die Hand zu klatschen . . .“
„Aber ein Schuß hilft mehr.“
„Namentlich, wenn er getroffen hat.“
Lehnert schwieg und sah an Opitz vorbei, der seinerseits eine kleine Weile vergehen ließ, fast als ob er Lehnert eine Frist zur Ueberlegung gönnen wolle. Als aber jedes Entgegenkommen ausblieb, nahm er zuletzt das Wort wieder und sagte: „Lehnert, Ihr bringt Euch in Ungelegenheiten. Ihr habt einen Haß gegen mich und das verdirbt Euch Euren guten Verstand. Ihr streitet mir den Hasen ab, Ihr, der Ihr immer von Eurer Wahrheitsliebe sprecht, und es wäre mir doch ein leichtes, den Hasen in Eurem Hause zu finden. Und wenn ich ihn nicht fände, so doch Diana . . . Kusch dich! . . . Ihr habt den Hasen verjagen wollen. Nun, meinetwegen; das ist Euer gutes Recht. Und wenn Ihr’s Euch einen Schuß Pulver kosten lassen wollt, nun, so mag auch das hingehen, obwohl es auffällig ist und eigentlich nicht in der Ordnung. Es ist nicht Brauch hier zu Land, einen Hasen durch einen Flintenschuß zu verjagen. Und der letztberechtigte dazu seid Ihr, der Ihr schon manches auf dem Kerbholz habt. Ich sah von meiner Giebelstube her, daß Ihr im Anschlag lagt, und ich sah auch, wie der Hase zusammenbrach. Und zum Ueberfluß hab’ ich mir die Stelle drüben, eh’ ich in Euer Haus kam, mit allem Vorbedacht angesehen und habe den Schweiß an dem hohen Farnkraut gefunden, das drüben steht.“
Die Bedrängniß, in der sich Lehnert befand, wuchs immer mehr, und ein begreifliches Verlangen überkam ihn, aus dieser seiner Lage heraus zu sein. Er war aber schon zu tief drin, und was die Hauptsache war, er konnte sich nicht entschließen, zuzugeben, daß er eine Lüge gesprochen habe. So pfiff er denn leise vor sich hin, als ob er andeuten wolle, daß der Worte genug gewechselt seien.
Opitz seinerseits aber war nicht willens, seinen Triumph abzukürzen, und fuhr, während er eine gewisse Gütigkeitsrolle weiterspielte, ruhigen Tones fort. „Ich sehe, Lehnert, daß Ihr ungeduldig werdet, und will Eure kostbare Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Und so hört denn meinen letzten Vorschlag! Ich will den Hasen nicht, und meine Frau, die’s, wie Ihr wißt, gut mit Euch meint, mag Euch auch noch den Speck dazu schicken. Und ich, Lehnert, ich will’s bei dem Grafen verantworten, und wenn er sich wundern sollte, so will ich, aus Rücksicht für Euch, von einem Schreckschuß sprechen, der zufällig getroffen habe. Der Graf ist ein gnädiger und nachsichtiger Herr, und wenn er das mit dem ,Schreckschuß’ auch nicht glauben wird, so wird er doch so thun, als glaub’ er’s. Aber das verlang’ ich von Euch, daß Ihr Euch vor mir zu dem bekennt, was Ihr getan habt, und daß Ihr Euch entschuldigt. Hab’ ich Euch doch mein Bedauern über den Hahn ausgesprochen und war nicht dazu verbunden. Aber Ihr, Ihr seid’s. Und nun heraus mit der Sprache! Beichten ist immer das beste, da wird die Seele wieder frei, nicht wahr? Und man kann jedem wieder ins Auge seh’n.“
„Kann ich!“ sagte Lehnert, und sein Auge suchte das des Försters, um sich mit ihm zu messen. Aber das Gefühl seines Unrechts war doch stärker als sein Trotz und er senke den Blick wieder.
Opitz lächelte.
„Guten Abend, Frau Menz. Ich werde meine Frau von Euch grüßen. Und auch Christine. Und nun Gott befohlen!“
Und ohne weiter ein Wort an Lehnert zu richten, verließ er das Haus und ging auf den Steg zu. Diana folgte.
Die Alte war ihm bis in den Vorgarten gefolgt und rechnete darauf, daß er sich noch einmal umsehen würde, für welchen Fall sie unterthänigst zu knixen vorhatte; als sie aber schließlich gewahr wurde, daß auf einen gnädigen Abschiedsblick nicht mehr zu rechnen sei, gab sie’s auf und ging in die Stube zurück. Hier stand Lehnert noch am alten Fleck und sah vor sich hin.
„Ach, Lehnert, wenn Du’s doch nicht gethan hättest . . . Und Speck will er uns auch noch schicken. Sieh, so ist er immer und meint es gut. Aber wenn ich ihn auch mit Schmand[2] brate, schmecken thut er mir doch nicht. Wie kann er mir auch schmecken? Wenn man Angst hat, schmeckt einem nichts, gar nichts, und will nicht ’runter, und ich fühle schon, wie’s mir hier sitzt.“
„Ach, Mutter, was soll das? Aber so bist Du. Du willst alles haben, und wenn dann nachher ’was passirt, was nach Gerichtsvorladung aussieht, oder wenn Du gar zu glauben anfängst, nun ist es mit dem Schinkenknochen und dem Liesenschmalz drüben vorbei, dann heißt es wieder: ja warum auch? warum hast Du geschossen?“
„Ich habe nichts gesagt, ich habe Dir nicht zugeredet.“
Lehnert stampfte heftig auf, fiel aber rasch wieder ins Lachen und sagte. „Wir wollen uns vertragen, Mutter. Du bist, wie Du bist. Nein, zugeredet hast Du nicht. Du kamst bloß, als ob wenigstens das Haus in Brand stünd’, und riefst : ,Ein Has’, ein Has’!’ Nun sage, was hieß das? was sollte das? Sollt’ ich kommen und mir das Wunderthier anseh’n? Oder ihn wegjagen? Kannst Du nicht selber einen Hasen wegjagen? Ich habe just das gethan, was Du wolltest, und Du hast dabei gedacht: ’Opitz wird heute still sein von wegen des Hahns und vielleicht auch von wegen der neuen Freundschaft.’ Und weil es nun anders gekommen ist, so bist Du wieder mit Vorwurf und Klage bei der Hand und weinerst mir wieder ’was vor, weil ich geschossen hab’, und sähest es am liebsten, ich ginge gleich ’rüber und würfe mich ihm zu Füßen und küßte seinen Rockzipfel. Aber daraus wird nichts. Er mag nun wieder seine Schreiberei machen und alles zur Anzeige bringen. Anschreiben und anzeigen versteht er, das war schon seine Kunst, als er noch bei den Soldaten war. Aber ich werde mich schon zu verteidigen wissen und werde vor Gericht aussagen, daß ich meinen Kohl und meinen Hafer oder was es sonst ist nicht für Opitz und seine Hasen ziehe. Geschossen hätt’ ich blind drauf los, was dann aus dem Hasen geworden, das wüßt’ ich nicht und braucht’ ich nicht zu wissen, und wenn Opitz eines Hasen Schweiß gefunden habe, was ja sein könnte, so sei’s nicht der, um den sich’s hier handle, der sei lustig in die Welt gegangen.“
„Aber dann werden sie Dir einen Eid zuschieben. Willst Du schwören?“
„Nein, das will ich nicht. Schwören thu’ ich nicht. Aber ich werde schon was finden, um aus der Geschichte ’raus zu kommen.“
Er sagte das so hin, halb um der Mutter zu widersprechen, halb um sie zu beruhigen, war aber klug genug, zu wissen, daß er schwerlich eine Ausrede finden und somit sehr wahrscheinlich einer zweiten Verurteilung entgegen gehen werde. Das war ihm ein schrecklicher Gedanke, so schrecklich, daß ihm alle Lust an der Arbeit auf ganze Tage verloren ging und er sich müßig umherzutreiben begann, was er ohnehin liebte. Den Tag über sprach er in dieser oder jener Baude vor oder ging auch wohl ins Böhmische hinüber, wo er, bis nach Sank Peter und Trautenau hin, viel Anhang hatte, abends aber saß er in den nächstgelegenen Kretschams, im „Waldhaus“, in Brückenberg, in Wang, heute hier und morgen da, und erzählte jedem, der’s hören wollte, daß wieder ein Krieg in der Luft sei, drüben in Böhmen wüßten sie schon davon, und daß er seinerseits warten wolle, bis es wieder losgehe.
Krieg im Frankreich, das sei das einzig vernünftige Leben; wenn es aber nicht wieder losgehe, nun, dann gehe er und er wiss’ auch schon wohin. Er wolle zu den Heiligen am Salzsee, da habe jeder sieben Frauen, und wenn er auch immer gesagt habe, daß eine schon zu viel sei, was auch eigentlich richtig, so woll’ er’s doch ’mal mit sieben versuchen; es sei doch ’mal was anderes.
[60] Er war sehr aufgeregt und sprach immer in diesem Ton, und sein einziges Vergnügen war, daß man ihn für einen Ausbund von Klugheit hielt und sich wunderte, wo er das alles her habe.
Aber all das Sprechen von Krieg und Auswanderung und Salzsee war doch nur ein müßiges Spiel; im Grunde seines Herzens hing er mit Zärtlichkeit an seinem Schlesierland und dachte gar nicht ans Fortgehen, wenn ihm der Boden unter den Füßen nicht zu heiß gemacht würde. Aber das war es eben. Machte „der da drüben“ Ernst, so war der heiße Boden da und zugleich der Augenblick, wo das, was er bisher bloß an die Wand gemalt hatte, Wirklichkeit werden mußte. Denn zum zweiten Mal ins Gefängnis, das zu vermeiden war er fest entschlossen, und so hing denn alles an der Frage: wird Opitz Ernst machen oder nicht?
Der Urgrund der Fehde wider die Fremdwörter.
Der Leser weiß, daß in unserem Vaterlande während des letzten Jahrfünfts eine Bewegung in Fluß gekommen ist, die den Fremdwörtern den Krieg bis aufs Messer erklärt und hierbei nicht nur sprachliche, sondern auch nationale Gesichtspunkte mit einem sonst in Deutschland nicht alltäglichen Eifer in den Vordergrund stellt.
Man unterscheidet jetzt – und zwar häufig nach persönlicher Willkür – zwischen dem „Fremd-“ und dem „Lehnwort“. Das Fremdwort soll ein gänzlich unberechtigter Eindringling, das Lehnwort dagegen ein geduldeter, gleichsam nationalisirter Gast sein.
Nun liegen die Dinge bei näherer Betrachtung so:
Die Lehnwörter sind uns natürlich ebensogut „fremd“ wie die Fremdwörter.
Der Unterschied zwischen den beiden Klassen besteht nur darin, daß die „Lehnwörter“ schon in früheren Jahrhunderten, zumeist schon zu Zeiten des Althochdeutschen, in unsern Sprachschatz aufgenommen und durch Abschleifung gewisser nicht-deutscher Lautverhältnisse den urdeutschen Wörtern ähnlich gemacht worden sind.
Das Gleiche würde jedoch im Lauf der Jahrhunderte mit einer gewissen Anzahl von Fremdwörtern unserer Epoche geschehen können. Geschieht es nicht, so trägt der Geist der neuhochdeutschen Sprache die Schuld daran – nicht der fremdartige Charakter der betreffenden Wörter.
Hätten sich unsere Altvordern, die wir so gern als die Urbilder echtdeutschen Wesens in Anspruch nehmen, ebenso feindselig gegen die Fremdwörter gestellt wie die Gegenwart, so würde unser Neuhochdeutsch um ein Beträchtliches ärmer sein. Eine Unzahl von Wörtern, die uns jetzt völlig in Fleisch und Blut übergegangen sind, die jeder Bauer, ja jeder Gassenjunge versteht und anwendet, die nicht nur zur Steigerung unserer Ausdrucksfähigkeit, sondern auch zur Vermehrung unserer Abtönungsmittel wesentlich beitragen, würde uns niemals zu eigen geworden sein.[3]
Kein althochdeutscher Biedermann galt für einen ehrlosen Wälschling, weil er das lateinische scribere herübernahm und „scribôn“, neuhochdeutsch „schreiben“, sagte.
Freilich war er bei dieser Herübernahme so klug, die Abgeschmacktheit späterer Zeitläufte zu vermeiden, die, anstatt sich des fremden Wortstammes zu bemächtigen und ihn mit einer deutschen Auslautung zu versehen, fremdländische Bildungs- und Beugungssilben ins Deutsche einschmuggelte. Das ist eine widerliche Verhöhnung des Sprachgefühls, deren sich das Neuhochdeutsche immer noch schuldig macht.
Wenn wir z. B. jetzt das lateinische scribere neu einführten, so würde es die abscheuliche Form „scribiren“ bekommen, just so wie aus dem lateinischen dictare „diktiren“ und aus dem französischen promener „promeniren“ gemacht worden ist. Zu einem „skriben“ und „dikten“ vermag sich der unschöpferische germanische Sprachgeist der Gegenwart nicht mehr emporzuschwingen. Eine frühere Periode war noch imstande, aus dem lateinischen dictare die Form „dichten“ zu bilden.
Nur in ganz vereinzelten Fällen hat sich das Neuhochdeutsche eines Fremdworts bemächtigt, um ein selbstständiges Zeitwort mit deutscher Endung daraus zu gestalten. Dabei scheint es jedoch, als sei dieser schwache Versuch ursprünglich scherzhaft gemeint, und erst nach und nach in die ernsthafte Rede mit einverleibt worden. So sagen wir jetzt: „Der Schauspieler ‚mimt‘“ –; nicht er „mimirt“, was dem sonst allgemein üblichen Sprachgebrauche bei fremden Wurzeln entsprechen würde. Solche Ausnahmen jedoch lassen sich an den Fingern herzählen. Im übrigen bleibt bei sämmtlichen Zeitwörtern und bei der Mehrzahl der Ding- und Eigenschaftswörter, die wir aus fremden Sprachen herübernehmen, die Thorheit zu recht bestehen: wir borgen nicht nur den fremden Stamm, sondern wir bilden, betonen und wandeln auch undeutsch.
Ich behaupte nun: es ist nicht sowohl die Herübernahme des fremdländischen Wortstammes, als vielmehr die Unfähigkeit unseres Sprachgeistes, ihn sich vollständig anzueignen, ihm ein echtdeutsches Gewand umzuhängen, was den jetzt überschäumenden Widerwillen gegen das Fremdwort erzeugt hat.
Besäße der Deutsche die Fähigkeit, die undeutschen Fäden in seinem sprachlichen Gewebe vollständig aufgehen zu lassen, so würden wir, dem Beispiele anderer Völker entsprechend, die Aufnahme fremder Wurzeln als eine Bereicherung betrachten. Nur diese massenhaften Wörter mit lateinisch oder romanisch klingenden Endungen, diese Hauptwörter auf „ität“, auf „ion“, diese Zeitwörter auf „iren“, vor allem aber die vielen französischen Wörter, bei denen man uns die Beibehaltung der ursprünglichen Aussprache zumuthet, – diese Thorheiten sind es, die für das feiner entwickelte Sprachgefühl etwas Verletzendes haben.
Als die Normannen im Jahre 1066 unter Wilhelm dem Eroberer das britische Inselreich einnahmen und sich als Herrscher über das Land festsetzten, da drang in verhältnismäßig kurzer Frist eine Unsumme französischer Elemente in die germanische Sprache der Angelsachsen ein, dergestalt, daß sich das Englische unseres Jahrhunderts seinem Wortvorrath nach als eine Mischsprache darstellt; thatsächlich aber, seinem innersten Geiste, seiner Denk- und Formbildungsweise nach, ist das Englische rein germanisch, – und gerade z. B. in Beziehung auf die Behandlung der fremdländischen Zeitwörter hätte der Deutsche von seinen angelsächsischen Vettern mancherlei lernen können.
Im Englischen giebt es kein „produciren“, wie im Neuhochdeutschen, sondern ein selbstständig gebildetes „produce“, was einem deutschen „produzen“ oder „produtzen“ entspräche. Es giebt kein unglückseliges „kommandiren“, sondern ein flottes „command“, was einem deutschen „kommanden“ entspräche. Ein derartiges „kommanden“ würde uns kaum fremdartiger klingen, als „vollenden“ oder „versenden“; und mehr noch würden uns ähnliche Wörter anheimeln, bei denen lateinisch-romanische Vorsilben wie co-, con-, com-, pro-, prae- etc. nicht vorhanden sind.
Aus dem französischen „mêler“ hat das Englische nicht ein widerliches „meliren“, sondern ein ganz germanisch klingendes „meal“ („vermischen“) gebildet. Dieses „meal“ ist äußerlich gar nicht mehr von dem urgermanischen Worte „meal“ („Mehl“, oder „mit Mehl bestreuen“) zu unterscheiden, das die englischen Wörterbücher in ihrer noch häufig zu Tage tretenden Unwissenschaftlichkeit mit jenem Fremdworte „meal“ sogar ohne weiteres zusammenstellen.
Aus dem französischen „forcer“ macht der Engländer sein durchaus germanisch klingendes „force“. Wir natürlich haben das Wort nicht in der Form „ich forse“, sondern in der üblichen Verballhornung „ich forcire“ entlehnt.
Das Gleiche gilt noch von hundert und aber hundert französischen Zeitwörtern, die alle im Englischen die germanische Volkstracht angelegt haben, während das Neuhochdeutsche, allerdings
[61] [62] </noinclude>
nach dem berühmten Muster des Mittelhochdeutschen, die unerquickliche Bildungssilbe „ir“ verwendet. Vergleiche: französisch „passer“, englisch „pass“, deutsch „passiren“; französisch „sonder“, englisch „sound“, deutsch „sondiren“; französisch „charger“, englisch „charge“, deutsch „chargiren“; französisch „changer“, englisch „change“, deutsch „changiren“. Und so weiter ins Unbegrenzte.
Bei dem Worte „changiren“ kommt noch die oben erwähnte
Unzuträglichkeit hinzu, daß ein dem Neuhochdeutschen durchaus fremder Laut, der Nasallaut des „an“, herübergenommen ist, was in der That, falls man sich nicht wie der Berliner mit einem kurzweg gesprochenen „ang“ behilft, eine sehr einschneidende Verfremdlichung der Sprache zur Folge hat.
Außerdem wirken alle diese Zeitwörter mit der Endung „– iren“ schon um deswillen störend auf ein empfindliches Sprachgefühl, weil sie den Hauptton auf der Ableitungssilbe haben, nicht auf der Stammsilbe. Die Hauptbetonung der Stammsilbe aber ist in allen germanischen Sprachen Grundregel. Man betrachte z. B. das Wort „Mann“ und die nachstehend verzeichneten Wandlungs- und Ableitungsformen: „dem Manne“; , „den Männern“; „bemannen“; die „Männlichkeit“. Ueberall verbleibt hier der Hauptton auf der Silbe „mann“ oder „männ“. Im Griechischen, im Lateinischen, im Französischen etc. ist dies beinahe umgekehrt. Hier fällt zwar auch der Hauptton gelegentlich einmal auf die Stammsilbe, fast immer jedoch ändert sich dies im Laufe der Abwandlungen. Während im Deutschen das Zeitwort „lieben“ in allen Formen der Konjugation stets auf der Silbe „lieb“ betont wird, rückt der Hauptton, der in der Gegenwartsform des lateinischen Zeitworts „ámo“ auf der ersten Silbe liegt, in der Vergangenheitsform auf die zweite, das heißt die Ableitungsform, vor. Die Vergangenheitsform (ich liebte) lautet nicht ámavi, sondern amávi; die Zukunftsform nicht ámabo, sondern amábo.
Diese Grundverschiedenheit des Betonungsgesetzes ist sehr wesentlich für den Charakter der beiden Sprachgruppen. Sie übt ihren weitestgehenden Einfluß z. B. auf die Poetik aus, indem sie den romanischen Völkern einen fast unerschöpflichen Reichthum an Reimen verleiht. Alle Zeitwörter der nämlichen Konjugation bilden z B. in den entsprechenden Zeitformen echte Reime: „amávi“, „saltávi“, „arávi“, während im Deutschen „ich liebte“, „ich tanzte“, „ich ackerte“ nicht reimen.
Es versteht sich von selbst, daß ein so durchgreifender musikalischer Unterschied nicht straflos übersehen werden kann. Ein sprachlicher Mißton ist die unausbleibliche Folge, wenn Elemente der ersten Gruppe unverändert oder doch in diesem Hauptpunkte unverändert in die zweite herübergenommen werden.
Was von den Zeitwörtern auf „– iren“ das gilt ebenso von den zahlreichen Dingwörtern auf „– ion“ „– ität“ etc. Auch hier können wir von fremden Nationen lernen, wie wir hätten verfahren sollen, um das Entlehnte in unser Fleisch und Blut zu verwandeln.
Warum sagen wir nicht z. B. statt „Gravität“ „Gravheit“? warum nicht für „Produktion“ „Produtzung“ – nach dem Vorbilde von „Benutzung“? Diese Formen klingen uns jetzt befremdlich oder komisch, aber nur weil wir fühlen, daß ihre Schöpfung jetzt etwas Gekünsteltes hätte. Wüchsen sie frisch und lebendig aus dem Boden des Sprachgeistes, so würde diese befremdliche Färbung wegfallen, – gerade so wie für den Deutschen die eigenthümliche Komik holländischer Vokabeln wegfällt, sobald er das Holländische derart beherrscht, daß er holländisch denkt.
Aber nicht genug, daß wir eine solche Formgebung, die uns neben manchem entbehrlichen Wort auch manches schätzbare dauernd gesichert hätte, schmählich versäumt haben, – der undeutschen Endung zu Liebe! – wir haben uns leider sogar bewogen gefunden, fremdländische Bildungssilben an deutsche Stämme zu schweißen und so abermals gegen den Geist unserer Wortbetonung zu sündigen.
Wir sagen „schattiren“; warum nicht „schatten“, „abschatten“? – „halbiren“; warum nicht „halben“?
Bei manchen Wörtern findet sich die verdeutschte Form neben der undeutschen. So heißt es „probiren“ und „proben“; die Form auf „iren“ erweist sich hier vollständig überflüssig.
Ebenso widerwärtig sind moderne Zwitterbildungen mit der griechisch-lateinisch-romanischen Nachsilbe – „ist“. Der „Flötist“, der „Blumist“ und vollends der „Lagerist“ flößen mir Schauder ein.
„Ja, wer wird aber auch solche Wörter gebrauchen!“ höre ich den geschmackvollen Leser ausrufen. In der That gehört der „Lagerist“ vorwiegend dem Privatstile unserer neuhochdeutschen Kaufmannschaft an, die sich – bei aller sonstigen Tüchtigkeit – um die Verkrüppelung unseres Sprachgefühls unsterblich verdient gemacht hat. Aber aus dem Privatstil dringen die Wörter ins Volk und aus dem Volk in das Schriftthum des Volkes!
So giebt es eine dem deutschen Sprachgeist schnurstracks zuwiderlaufende Nachsilbe, die wir alle unausgesetzt anwenden, die ursprünglich ganz so unschön und harmoniewidrig war wie das – „ist“ des „Flötisten“ und „Lageristen“, und die sich doch nicht mehr ausrotten läßt: die Nachsilbe „ei“ in Wörtern wie „Polizei“, „Flegelei“, „Schlächterei“.
Dieses „ei“ kennzeichnet sich sofort dadurch als ungermanisch, daß es den Hauptton hat. Wenn es deutsch wäre, könnte man nicht betonen: „Flegeleí“, sondern „Flégelei“.
In der That ist die Nachsilbe „ei“ nichts anderes als das griechisch-lateinische „ia“, französisch „ie“. Das Mittelhochdeutsche nahm dies französische „ie“ in der Form „îe“ herüber, und neuhochdeutsch ward „îe“ zu „eie“ und dann zu „ei“, wie „lîp“ zu „Leib“ und „wîp“ zu „Weib“ ward. Das griechisch-lateinische „melodia“ z. B. lautet neuhochdeutsch eigentlich Melodei; nur dadurch, daß man auf das Urwort zurückgriff, kam neuerdings wieder die Form „Melodie“ in Gebrauch.
Im Mittelhochdeutschen fing man bereits an, diese fremdländische Endung „îe“, neuhochdeutsch „ei“, an deutsche Stämme zu setzen. Heutzutage bilden wir von jedem Zeitwort ein Dingwort auf „ei“, ohne uns irgend bewußt zu sein, daß wir fremdländische Mittel verwenden. Wir sprechen von „Lauferei“, „Kocherei“, „Esserei“, „Aufwascherei“, „Näherei“, „Schlosserei“, „Bierbrauerei“; ja, die Führer der Fremdwörterfehde bekämpfen die „Ausländerei“, – und fühlen nicht mehr, daß diese Wortbildung eine Art Mißgeburt ist. Der Gebrauch, der unser aller Tyrann ist, hat hier das Fremde, sogar das Sprachwidrige, ein für allemal mit dem Bürgerrechte belehnt.
Fassen wir den Kern dieser Betrachtungen nochmals zusammen, so ergiebt sich der folgende Satz:
Wenn das Neuhochdeutsche – wie seiner Zeit das Althochdeutsche, das Angelsächsische, und noch in späterer Zeit die romanischen Sprachen – die Kraft besäße, fremdsprachliche Elemente so mit dem eigenen Sprachsafte zu durchdringen, wie dies der triebmächtige Baumstamm mit den ihm aufgepfropften Schößlingen thut, so würde eine Fremdwörterfrage für uns ebenso wenig vorhanden sein wie für die Franzosen, Italiener, Spanier etc. Die sogenannte Sprachreinigungsbewegung, die jetzt manchmal das Kind mit dem Bade ausschüttet, ist erst möglich geworden durch die namentlich in der Tagespresse überhand nehmende Verwendung undeutscher Formen. Das dritte Zeitwort, dem man begegnete, ging aus „iren“, das vierte Hauptwort auf „ion“, auf „anz“, auf „enz“ oder auf „ität“ aus, ganz abgesehen von einer Unmasse solcher Wörter, die ohne jede Veränderung geborgt und kurzer Hand – sans façon schrieben die Zeitungen – eingeflickt wurden. Dieses Sprachgemengsel wirke verstimmend, und wie nun einem bekannten Naturgesetze zufolge jeder Rückschlag über den eigentlich anzustrebenden Ruhepunkt wieder hinausgeht, so übertreibt jetzt auch die Fremdwörterhetze oft ihre an sich förderlichen und lobenswerthen Bestrebungen. Eine „Sprachreinigung“, wenn sie Gedeihliches leisten soll, kann nur allmählich von statten gehen. Gewaltsame Umwälzungen bringen auf staatlichem wie auf gesellschaftlichem und geistigem Gebiete in der Regel mehr Schaden als Nutzen. Sehr viele Fremdwörter besitzen eine jahrhundertelange Geschichte und demgemäß eine so reiche Begriffsfülle, daß keine auch noch so geschickte Verdeutschung vollkommenen Ersatz bieten kann. Es ist ein Unding, plötzlich „übernatürlich“ zu sagen und dabei „metaphysisch“ zu meinen; denn „übernatürlich“ ist uns bis jetzt etwas anderes gewesen, – und die Sprache hat doch vor allem den Zweck, die Gedanken möglichst unzweideutig und für jeden Hörer verständlich zum Ausdruck zu bringen.
Nach einer Sage soll das „Gesundheitwünschen“ bei dem Niesen in einer Epidemie entstanden sein, welche mit Schnupfen begann und viele Opfer an Menschenleben forderte. Man möchte die Wahrheit dieser Erzählung glauben, wenn man die Geschichte der früheren Influenzazeiten überblickt. Besonders das Jahr 1580 zeichnete sich durch eine große Sterblichkeit infolge dieser Erkrankung, welche sich damals über Asien, Afrika und Europa verbreitet hatte, aus. In Rom allein sollen gegen 9000 Menschen durch sie zu Grunde gegangen sein und Madrid wurde durch die Zahl der Todesfälle fast menschenleer. Ein so schwerer Verlauf war bei dieser Epidemie aber eine große Ausnahme. Die Mehrzahl der Erkrankungen glich vollständig den jetzt herrschenden, eine große Anzahl von Menschen wurde plötzlich befallen, aber nur einige starben. Ob die Influenza schon im Alterthume aufgetreten ist, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten, einige Beschreibungen sprechen dafür, doch besitzen wir die ersten sicheren Angaben erst aus dem Jahre 1323, von welcher Zeit ab sich dann eine reiche Zahl von Epidemien nachweisen läßt. Ein großer Theil ging von Osten nach Westen über die Länder, doch kam auch die umgekehrte Richtung, wenn auch seltener, vor. Es ist merkwürdig, daß die Erinnerung an die Influenza so schnell aus dem allgemeinen Gedächtniß geschwunden ist, denn noch im Jahre 1836 und 1837 nahm eine Epidemie den ganz ähnlichen Weg wie die jetzige und zeigte die gleichen Massenerkrankungen mit größerer Sterblichkeit als jetzt. Sie begann im Dezember in Rußland. In London erkrankten später fast die sämmtlichen Bewohner. Kleinere, auf Städte oder Länder beschränkte Epidemien fanden seitdem oft statt, z. B. im Jahre 1874 in Berlin und 1883 in Würzburg; die Bevölkerung wurde fast stets im gleichen Verhältniß ergriffen, nur sollen manchmal mehr Frauen als Männer, in anderen Zeiten umgekehrt, oder auch die Soldaten frei geblieben sein. In leichteren Epidemien starben fast nur Greise, Schwache und Kinder. Ueber das Herkommen der Influenza bildete beinahe jede Epidemie eine andere Ansicht. Vom Nordpol aus sollte sich zusammengeballter Sauerstoff über die Erde hinziehen, oder elektrische Veränderungen sollten stattfinden. Auch ein Insekt, welches Grippe genannt wurde, sollte die Weiterverbreitung der Krankheit vermitteln. Ueberall aber herrschte die Meinung vor, daß in der Luft durch ein Miasma die Epidemie sich entwickele, die Jahreszeit und das Klima wären dabei gleichgültig. Eine Bestätigung dieser Ansicht wurde besonders in den Erkrankungen von Schiffsleuten auf dem Meere bei Influenzaepidemien gefunden und in dem plötzlichen Auftreten der Grippe an ganz verschiedenen Orten. Auch geistig durchlebten unsere Vorfahren vollkommen die jetzigen Zustände; nach einer Verspöttelung der „Modekrankheit“, welchen Namen die Influenza in mehreren Epidemien vor ihrem jetzigen führte, stellten sich schwerere Erkrankungen und eine größere Anzahl von Todesfällen ein und erregten dann allgemeine Sorge.
Der Beginn der jetzigen Epidemie, die als eine leichte bezeichnet werden muß, ist noch in aller Erinnerung. Rußland, Berlin und Paris waren die zuerst betroffenen Stellen und hieran schloß sich die Ausbreitung nach allen Gegenden. Meine Erfahrungen gründen sich zumeist auf die Verhältnisse in Leipzig, welches sicher mit am schwersten betroffen worden ist. Eine Zahl der Erkrankten bestimmen zu wollen, ist eine vollständige Unmöglichkeit. Hierzu fehlt eine jede Unterlage, da der Arzt meist nur zu den schwereren Erkrankungen hinzugezogen wurde. Nichtsdestoweniger kann man behaupten, daß weit über die Hälfte der Bewohner Leipzigs von der Seuche ergriffen worden ist. Vielfach kam es vor, daß ganze Familien danieder lagen und einige Tage die Nahrung auf die einfachste Weise zubereitet wurde. In den Fabriken erkrankte allmählich der größere Theil der Arbeiter, in einer z. B. 70 Arbeiter von 73, doch war zumeist nur ein tageweises Aussetzen der Arbeit erforderlich, sodaß im allgemeinen eine Benachtheiligung der Fabrikation nicht stattfand. –
Ich glaube, aus Zufall die erste Hausepidemie in Leipzig beobachtet zu haben. Der erste Krankheitsfall trat daselbst, wie es scheint von Berlin verschleppt, am 5. Dezember auf, in den nächsten 14 Tagen schlossen sich in demselben Grundstücke rasch 14 weitere Erkrankungen an. Erst von Mitte Dezember begannen in Leipzig selbst sich häufiger Kranke zu zeigen, und nun traten plötzlich die Massenerkrankungen auf, welche Weihnachten ihren Höhepunkt erreichten und so vielen das Weihnachtsfest verbitterten. Vom Beginn des Januars datirt ein langsamer Rückschritt der frischen Erkrankungen, es traten dann mehr die Nachfolgekrankheiten der schweren Fälle hervor. Den Beginn bildeten merkwürdigerweise in der größeren Anzahl kräftige, junge Männer, später machte sich dann kein großer Unterschied mehr bemerkbar. Nur zeigten bis zuletzt die mittleren Männerjahre die schwereren und längeren Krankheitsprozesse, die Frauen und jungen Mädchen waren leichter krank und am leichtesten das kindliche Lebensalter. Jeder Fall der Influenza bot einige Verschiedenheiten, doch ließen sich drei Hauptbilder feststellen. Bei dem normalen Verlaufe trat die Erkrankung plötzlich zumeist mit Schüttelfrost oder Kältegefühl auf, starker Kopf- und Kreuzschmerz war beinahe immer vorhanden. Die Schwäche ist oft so plötzlich, daß Ohnmachten oder größte Mattigkeit entstehen. Appetit ist gar nicht vorhanden, dagegen Widerwillen gegen alle Speisen, und es tritt selbst Erbrechen ein; Schnupfen in verschiedener Stärke, Husten kurz anstoßend, Schmerz der Augenbewegungen, reißende Schmerzen im ganzen Körper, besonders längs der Rippen und entlang der Beine, vervollständigen das Bild. Das Fieber ist wechselnd, selten sehr hoch, manchesmal gar nicht, oft Neigung zu Schweiß vorhanden, das Gesicht oft stark geröthet, der Puls im Beginn häufig zusammengezogen, kaum fühlbar, später auch nach dem Nachlassen des Fiebers beschleunigt. Die Stuhlentleerung bleibt aus. Dieser Zustand dauert 3–4 Tage, dann beginnen die Schmerzen nachzulassen, der Kranke fühlt sich besser, doch braucht er oft noch Wochen, um seine alte Kraft und Rüstigkeit wieder zu erlangen.
In einer zweiten Reihe von Erkrankungen bildet sich ein mehr chronisches Bild heraus; die gleichen Symptome wie die beschriebenen – aber schwächer – sind gleichfalls im Beginn vorhanden; besonders vor den Festtagen kam dieses häufig zur Beobachtung, die Kranken kämpfen förmlich gegen den Infektionsstoff an, das Fieber zieht sich länger hin, tritt nur abends auf, endlich aber überwindet das Gift den Organismus und es machen sich stärkere Symptome bemerkbar. Hierdurch entsteht häufig die Angabe, der Kranke habe Rückfälle überstanden, er glaubt, getäuscht durch die geringen Anfangssymptome, die Influenza überwunden zu haben, plötzlich erkrankt er nach Tagen wieder an starken Kopfschmerzen oder Erbrechen; es ist dies aber zumeist die eine für den Körper noch nicht abgeschlossene Erkrankung. Sehr häufig ist der dritte Verlauf: nach einem mehr oder weniger stürmischen Anfang setzt sich der Katarrh auf Nase und Luftwegen fest. Der im Beginne zähe, durchsichtige Schleim wird undurchsichtig, katarrhalisch, es entstehen Luftröhrenkatarrhe von verschiedener Ausdehnung, welche wochenlang den Kranken arbeitsunfähig machen können. Von der Nase aus verbreitet sich der Katarrh auf Stirnhöhlen und Ohren, heftiger Gesichtsschmerz, seltener Ohreneiterung bilden dann die Folge. Schwerhörigkeit, welche zumeist bald wieder verschwindet, ebenso Stimmlosigkeit durch den Kehlkopfkatarrh sind gleichfalls häufige Erscheinungen. Bei nervösen Naturen und Kindern überwiegen oft die Erregungen des Nervensystems, selbst Krämpfe können eintreten, bedingen aber fast niemals eine Gefahr. Diese starke Betheiligung des Nervensystems, die öftere Schlaflosigkeit, der spätere große Schwächezustand sind Folgen des Influenzagiftes, nicht des geringen Fiebers, und unterscheiden schon hierdurch die Krankheit von einem noch so erheblichen Schnupfenfieber.
Wie in den meisten andern Städten war es auch in Leipzig der Fall, daß die Epidemie gegen das Ende zu schwerer zu werden schien, indem verschiedene Todesfälle eintraten. Es kann nicht geleugnet werden, daß eine plötzliche Verschlimmerung der Katarrhe eintrat, und zwar besonders infolge Ostwinds, welcher in Leipzig zumeist eine Verschlimmerung der Katarrhe an und für sich bewirkt. Todesfälle entstanden entweder durch hinzugetretene Lungenentzündung oder durch Verbreitung des Katarrhs auf die kleinsten Luftröhrenäste, wodurch zuletzt Herzschwäche hinzukam. In mehreren Fällen trug nur die Vernachlässigung des Anfangsprozesses die Schuld, in anderen waren es Schwache und Greise, welche nicht den nothwendigen Widerstand bieten konnten. – Daß bei solchen [64] Massenerkrankungen derartige Naturen schließlich zum Opfer fallen, kann noch nicht als Schwere der Epidemie gedeutet werden, dann müßte der Prozentsatz der Sterblichkeit ein bei weitem höherer sein, als er glücklicherweise ist.
Was ergiebt sich nun aus der Leipziger Epidemie bezüglich der Ansteckung?
Ganz sicher, daß die Influenza eine reine Infektionskrankheit ist wie Scharlach, Masern und Pocken. Der Glaube an ein Luftmiasma ist besondere durch das plötzliche massenhafte Auftreten der Epidemie entstanden, es werden aber die ersten Fälle, wegen ihrer Aehnlichkeit mit Katarrhen, leicht übersehen, wie ich dieses jetzt so deutlich in Leipzig beobachten konnte. Die Krankheit beginnt zumeist auch nicht so plötzlich, als es scheint. Der Kranke fühlt sich fast immer schon den Tag vorher matt und appetitlos, auch kleine Fiebersteigerungen machen sich oft bemerkbar. Es erkrankt im Durchschnitt in einer Familie ein Mitglied zuerst, nach einigen Tagen folgen dann die übrigen, angesteckt durch das erste; mancher Mensch erkrankt gar nicht, ein anderer ist zuerst gefeit, um schließlich doch noch zu erkranken; die gleichen Verhältnisse bietet auch der Scharlach. Ob Gesunde und Gegenstände die Uebertragung vermitteln, erscheint fraglich, die Hauptansteckung scheint von dem Erkrankten selbst auszugehen und ist wie bei den Masern genügend, eine große Epidemie hervorzurufen.
Auch in den früheren Epidemien finden sich Stützen für die persönliche Uebertragung, in einer wird die Schnelligkeit der Verbreitung mit der eines Reiters verglichen, in anderen soll sie nicht so schnell vorwärts gegangen sein. Bei den Schiffserkrankungen wird hervorgehoben, daß sich die Schiffe in der Nähe der Influenzaküste befunden hatten; da der Stoff zur Entwickelung einen Tag wenigstens bedarf, so ist die Erkrankung auf hoher See dann begreiflich. Auch das Fortschreiten bei der jetzigen Epidemie in kleinen Dörfern dient zum Beweis; es giebt immer erst wenige Erkrankungen, woran sich die andern anschließen.
Begünstigt wird die Weiterverbreitung durch die große Neigung, welche der Mensch zu dieser Erkrankung besitzt, wie es in der gleichen Weise bei Masern der Fall ist.
Wiederholte Erkrankungen sind sicher selten und hierdurch ist in großen Städten das schnelle Erlöschen einer Epidemie, gewöhnlich nach sechs bis acht Wochen, erklärlich. Wegen dieses allgemeinen Befallenwerdens ist eine Bekämpfung der Epidemie selbst unmöglich und die Hilfe muß auf den einzelnen Fall beschränkt werden. Mit Sicherheit hat sich durch die Beobachtung ergeben, daß die größte Anzahl der schweren Luftröhrenkatarrhe durch die Nichtbeachtung im Beginne entstanden ist. Es sollte das Zimmer nicht verlassen werden, so lange Fieber besteht und Reizungen der Luftröhre noch vorhanden sind. Auf die Diät ist große Sorgfalt zu verwenden, Reizmittel bei dem bestehenden Appetitmangel nutzen nichts, die Besserung tritt von selbst nach kurzer Zeit ein. Starke Rücken-, Kopf- und Kreuzschmerzen, Fieber und Erbrechen machen ärztliche Hilfe erforderlich; für leichtere Fälle genügt Berücksichtigung der Verdauung, nasse Kompressen mit spirituöser Einreibung, Senfteige. Das Durstgefühl wird am besten mit leichtem Pfefferminzthee gestillt, kohlensaures Wasser ist besser zu vermeiden. Wegen der Betheiligung der Augen ist in den ersten Tagen jedes Lesen zu unterlassen. Man hüte sich noch längere Zeit vor Erkältungen, da eine große Empfindlichkeit der Luftröhre zurückbleibt.
Merkwürdig bleibt auch in dieser Epidemie das Verschwinden von beinahe sämmtlichen anderen akuten Krankheiten; weder Scharlach, noch Masern, noch Diphtherie sind sichtbar, nur Influenza mit ihren Begleiterscheinungen tritt auf. In früheren Epidemien wurde nur bei dem Nachlassen derselben ein Hervorbrechen anderer Krankheiten beobachtet, besonders Masern sollen in größerer Anzahl ausgebrochen sein, ebenso Wechselfieber. Diese Thatsache ist leicht erklärlich, denn gerade für diese Erkrankungen bereitet die Influenza durch Schwächung der bezüglichen Organe einen günstigen Boden. Eine große Besorgniß hört man oft aussprechen, daß die Influenza der Vorbote der Cholera sei. Diese Furcht ist vollkommen unberechtigt; in einigen wenigen Epidemien hat sich allerdings die Cholera angeschlossen, aus Zufall, weil sie vorhanden war und geschwächte Menschen vorfand, aber bei der Mehrzahl der Epidemien war dieses sicher nicht der Fall, wie sich durch eine Vergleichung der Jahre ergiebt.
Woher die Epidemie stammt? Diese Frage müssen wir unentschieden lassen! In manchen Epidemien kamen zahlreiche Erkrankungen von Pferden vor, auch jetzt soll es in England der Fall sein. Vielleicht gleicht ihr Ursprung dem der Cholera, insofern der Ansteckungsstoff an irgend einem Orte immer vorhanden ist und unter günstigen Bedingungen seine Weltreise antritt. Wir können dann nur wünschen, daß der Verlauf im Durchschnitt immer ein so günstiger sein möge wie bei dieser Epidemie.
Hermann Lingg.
Wenn wir im vorigen Jahre eine Reihe von Dichtern die Grenzlinie der Siebziger überschreiten sahen, so bringt uns dies Jahr bald nach seinem Beginn ein neues „Dichterjubiläum“; man darf es wohl so nennen, denn die Feier des siebzigsten Geburtstages ist zu einer Art von Jubelfeier für die Dichter geworden, denen dieses Lebensalter zu erreichen vergönnt ist. Ein bedeutender Poet, Hermann Lingg, geboren am 22. Januar 1820, feiert an diesem Tage im Jahre 1890 seinen siebzigsten Geburtstag.
Die Erlebnisse Linggs haben durchaus nichts Wechselvolles, nichts, was über ein ruhiges, den Musen geweihtes Dasein hinausginge. Seine Geburtsstadt ist Lindau im Bodensee; er besuchte das Gymnasium zu Kempten, studierte seit 1837 in München, Berlin, Prag und Freiburg Medicin, war zwei Jahre Armenarzt in München und ließ sich dann als Militärarzt anstellen; als solcher nahm er seinen Aufenthalt abwechselnd in Augsburg, Straubing und Passau. Einen ihm bewilligten Urlaub benutzte er zu einer Reise nach Rom und Neapel, welche seine Phantasie mit einer Fülle von Anschauungen befruchtete, denen er später dichterische Gestalt verlieh. Im Jahre 1851 nahm er seinen Abschied aus Gesundheitsrücksichten, wohl auch, um ganz der Muse leben zu können, die ihn schon seit längerer Zeit mit ihrer Gunst erfreute und die sich in den Militärlazarethen schwerlich heimisch fühlen konnte. Seitdem lebt er in München. König Maximilian II., der ja eine dichterische Tafelrunde um sich versammelte, gab ihm ein Jahrgehalt, und Emanuel Geibels Freundschaft ging ihm zur Hand, als er im Jahre 1854 die erste Sammlung seiner Gedichte veröffentlichte. Sie erregten alsbald Aufsehen, und schon seit jener Zeit zählt Linggs Name zu den gefeierten Dichternamen Deutschlands. Auf dem Gebiete lyrischer Dichtung, aus dem er seine ersten Lorbeern errungen hat, blieb er unermüdlich thätig und seine Schöpferkraft versiegte bis in das höhere Alter nicht. Der ersten Sammlung seiner „Gedichte“ folgte eine zweite (1868), der zweiten eine dritte (1870); es erschienen 1869 „Vaterländische Balladen und Gesänge“, im Jahre 1878 die Gedichte „Schlußsteine“, 1885 die Sammlung „Lyrisches“, und jetzt eben hat die Cottasche Verlagsbuchhandlung zur Jubelfeier des Dichters einen neuen Band Gedichte unter dem Titel „Jahresringe“ herausgegeben. Hermann Lingg hat in diesen späteren Sammlungen keine neuen Bahnen eingeschlagen, wenn er auch mit vielen neuen trefflichen und köstlichen Kleinodien den Juwelenschrein seiner Dichtung bereichert hat. Es liegt keine Entwicklung vor, der man Schritt für Schritt folgen müßte; man zieht die Summe seines dichterischen Schaffens, wenn man alle diese Sammlungen gleichzeitig ins Auge faßt und die überall gleichmäßige Eigenart seines Talentes in ihrer steten Erneuerung und Verstärkung beleuchtet.
Hermann Lingg gehört zu den Poeten, die sich durch großartigen Gedankenschwung auszeichnen; er ist in erster Linie Oden- und Hymnendichter, obschon er nur selten die Versmaße des Alterthums nachgekünstelt hat. Seine Bedeutung aber liegt darin, daß er das solcher Dichtung entfremdete Publikum der Gegenwart für dieselbe gewonnen hat; denn das Los schwunghafter Gedankenpoeten ist sonst meistens Vereinsamung. Wenn Lingg mit einzelnen seiner Gedichte, trotz ihrer geistigen Tiefe und Schwere, in das Volk gedrungen ist, so ist er dadurch wahrhaft in die Fußtapfen Schillers getreten.
Linggs Gedichtsammlungen machen den Eindruck eines Pantheons, in welchem die Götter aller Völker in Gebeten und Hymnen gefeiert werden; seine Poesie hat etwas Seltsames, [65] Fremdartiges, etwas vom Wundervogel Phönix, und wie dieser sich sein Nest aus würzigen Myrrhen baut, so baut sie es sich aus Sagen von exotischem Duft. Die eigentliche Heimath der Linggschen Muse ist das Alterthum; ja er greift in die vorsündfluthliche Zeit zurück in der Gedichtgruppe „Weltleben“, in der „Elefantenwanderung“, und seine Phantasie weilt bei der Erdgeschichte, ehe die Geschichte der Menschen beginnt. Doch die graue Sagenwelt ist ihm nicht bloß ein geheimnißvoll beleuchtetes Gewölke, besten dämmrigen Zauber er festzuhalten sucht; jene Sonne der Wahrheit, die allen Zeiten leuchten soll, bricht auch dort mit ihren Strahlen durch. So tönt aus Dodonas heiligen Eichenwäldern ein Orakel, das noch in der Gegenwart ein Echo wecken soll:
„Von Aegyptens Pyramiden
Bis zu Delphis Priesterin,
Bis zu Ganges’ Tempelfrieden
Herrsche einer Lehre Sinn:
Trost zu spenden, Schmerz zu lindern,
Licht zu wecken weit und breit,
Freiheit allen Erdenkindern,
Freiheit, Liebe, Menschlichkeit.“
In „Niobe“ ist die Gestalt der jammernden Mutter dem Kreise des Griechenthums entnommen und zu allgemeiner Bedeutung vertieft worden; es ist die uralte Mutter aller Völker, welche über den Brudermord derselben klagt. In dem „Gesang der Titanen“ spricht sich der Trotz auf das irdische Glück aus gegenüber dem Zorn der Götter. In der dritten Sammlung ist ein Gedicht den unheimlichen Jungfrauen, den Harpyen, gewidmet; diese greifenklauigen Sagenheldinnen werden tiefsinnig als Hüterinnen eines Reiches der Ausgestoßenen dargestellt:
„Und zu ihnen kommt, wer flüchtig aus der Heimath irren muß,
Wen die Menschheit ausgestoßen, oder Lebensüberdruß;
Elternlose, bleiche Kinder, schuldlos wie im Paradies,
Die kein Vaterland mehr haben, die das eigne Blut verstieß.
Dahin kommen stolze Frevler, Geister, die zu kühn und groß
Allzufrüh vom sichern Ufer banden ihre Schiffe los,
Abgehau’ne Heldenzweige eines einst berühmten Baums,
Träumer, die zu tief geschlafen auf den Kissen ihres Traums.“
Doch nicht bloß der alten Sage, auch der alten Geschichte Roms und Griechenlands hat Lingg zahlreiche Stoffe entnommen, von „Spartacus“ in der ersten Sammlung, einem wilden Kampfruf des Sklavenaufstandes, bis zu „Alexanders Tod zu Babylon“ und dem Gedichte „Korinth“, einem düster beleuchteten Bild der von den römischen Legionen eroberten und geplünderten Stadt.
So wandert seine Muse auch durch das Mittelalter und die Neuzeit; doch diese reiche und bunte Stoffwelt ist kein orbis pictus, kein locker zusammengeheftetes Bilderbuch; es ist der Geist des Denkers, der sich in die Räthsel der Geschichte vertieft, der Fernes und Nahes verknüpft. Sinnbildlich dafür mag das Gedicht „Die Römerstraße“ sein, wo der Dichter an der von den Römern erbauten Straße steht und die Kohorten gepanzert vorüberziehen sieht:
„Da plötzlich ruft ein Laut mich wach,
Ein Erzgedröhn auf nahen Gleisen –
Ich steh’ am Kreuzweg; hier durchbrach
Den Römerpfad der Pfad von Eisen.
Und donnernd rollt der Wagenzug
Vorbei den alten Meilensteinen,
Wie Blitz des Zeus und Geisterflug,
Der Erde Völker zu vereinen.“
Der tiefere Sinn und der große geschichtliche Geist hob gleich die ersten Gedichte Linggs aus der Menge heraus in einer Zeit lyrischer Verschwommenheit; sie befreiten das Gemüth von dem Druck enger und kleinlicher Empfindungen. Einzelne von ihnen hatten den genialen Wurf, der sie dem Gedächtniß einprägt. In der reinen Höhe seines denkenden Geistes fallen die Schranken der Zeitalter; von dem schwerterklirrenden Schlachtgewühl des Trasimenischen Sees werden wir unter die Geschütze von Friedrichshall, vom römischen Janustempel zur Gralsburg, von Hannibals Kämpfen zum Krimkrieg, von den Cyklopenmauern an die Bastille geführt; von Nimrod versetzt uns der Dichter zu Cartesius und Gutenberg, von der ormuzdgläubigen Mandane zu dem Inka Perus, der zur Sonne betet. Doch immer huldigt der Dichter den „Genien der Menschheit“, nicht bloß in dem Gedichte, das diesen Namen trägt; immer tönt jener Orakelspruch von Dodona mit geheimnißvoller Weihe durch alle Geschichtsbilder und Herzensergüsse hindurch.
Eine Lieblingsform der Linggschen Dichtweise sind die meistens reimlosen „Freien Rhythmen“, die sich der üblichen strengen Messung entziehen und sich nur an das Taktgefühl wenden, welches dem gebenden Dichter und dem empfangenden Leser gemeinsam ist. Sie eignen sich, wie schon des Griechen Pindar Vorgang bewies, für höheren Gedankenschwung; namentlich in der Sammlung „Lyrisches“ finden sich derartige Gedichte, welche viel Schönes, Großgedachtes und oft schlaghaft Ausgesprochenes enthalten, so daß manche Gedanken wie in Erz gegossen, wie in bleibende Votivtafeln eingetragen erscheinen. Bisweilen reimt Lingg auch solche Gedichte, wie das schwunghafte „Girgenti“ in der Sammlung „Lyrisches“ und das prächtige Naturbild „Gewitter am Morgen“ in den „Jahresringen“ beweisen.
Einem so zum Großen und Gedankenschweren sich hinneigenden Talent scheint das eigentliche Lied mit seinem leichten Guß und Fluß und seinem stimmungsvollen Duft ferner zu liegen; gleichwohl könnte man aus Linggs Gedichtsammlungen mühelos einen Liederband zusammenstellen, und obschon hier und dort eine Liederblüthe durch die auf ihr lastende Gedankenschwere geknickt wird, so bleibt doch noch ein reicher duftiger Liederstrauß übrig und des Dichters Eigenart bringt es mit sich, daß diese Lieder nicht der Alltagsflora angehören, sondern daß aus ihren Blüthenkronen ein besonders würziger Hauch ausströmt. Und auch dem alternden Sänger hat sich dieser Zauber nicht verschlossen, wie das Gedicht „Wilde Rose“ in den „Jahresringen“ beweisen mag:
Es war eine sternenlose,
Von Blitzen schwang’re Nacht,
Da ist die wilde Rose
Zum vollen Blüh’n erwacht.
Da kamst du still gegangen,
Da flogst du auf mich zu:
Ich hielt dich jubelnd umfangen,
Du wilde Rose du!
[66]
Es fiel kein Thau, kein Regen,
Die Donner rollten fern,
Kein Glück für uns, kein Stern.
Und durch die regungslose,
Gewitterschwüle Luft
Ergoß die wilde Rose
Wie melodisch und die Komposition herausfordernd klingen die Strophen des Liedes „Julinacht“, das die zweite Sammlung enthält:
„Schwüle, schwüle Julinacht –
Südwind küßt die Zweige.
Was dich so stolz und elend macht,
Schweige, mein Herz, verschweige!
Wehen die Wolkenschatten,
Ueber die stille schlafende Fluth,
Ueber die schimmernden Matten.
Hörst du’s, wie zur Hochzeitnacht
Was dich so stolz und elend macht,
Schweige, mein Herz, verschweige!“
Aber nicht bloß Liebeslieder und Stimmungsbilder, auch Lieder von weiterreichender Bedeutung und volkstümlichem Gepräge hat Lingg gedichtet; Lieder mit einem mehr genrehaften Zug, wie das „Lied an die Armen“, dessen erste Strophen lauten.
„Ihr Armen mit dem dürren Stab,
Der nimmer grünt und blühet,
Ihr geht die Erde aus und ab,
Verzehrt und abgemühet;
Und fürchtet keinen Regen;
Gedeiht das Korn, geräth der Wein,
Für euch ist’s doch kein Segen.
Das Jahr sei noch so früchtereich,
Wann esset ihr euch satt an Brot?
Ja, wenn die Steine blühen! –
Ihr säet Müh’ und erntet Noth
Und euer Feld sind Mühen.
Blüht’ euer Garten immer,
Und euer Weinberg steht auf Schutt
Und euer Gold ist Glimmer;
Mit Wolken deckt die Nacht euch zu,
So erscheint das Bild des Lyrikers Hermann Lingg unstreitig als ein vielseitiges. Auch wo er sich der größeren epischen Schöpfung zuwendet, bleibt er ein Gedankendichter, der großartige Fresken man im Kaulbachschen Stil.
So in den drei Büchern seines Epos „Die Völkerwanderung“ (1866–1868), welches allerdings keinen künstlerischen Damm gegen die Ueberfluthung der geschichtlich gegebenen Stofffülle errichtet, Völker und Helden in der Reihenfolge, wie sie auf der Weltbühne auftraten, an uns vorüberführt, so daß weder der epischen Schilderung, noch der verweilenden Betrachtung Zeit gelassen wird. Der Grundton bleibt derjenige einer Chronik in Versen, und der unermüdliche Vorbeimarsch der Gestalten erinnert an die Schattenwelt einer „nächtlichen Heerschau“. Es ist mehr das Auge des Denkers, der die Jahrhunderte umfaßt, als der Blick des Dichters, der liebevoll die einzelne Gestalt, das einzelne Begebniß ausspäht und in künstlerischer Harmonie gestaltet. Gleichwohl hebt sich auch hier aus dem beklemmenden Sturm und Drang der Völkerbewegung manches geschlossene Bild ab von fesselndem Reiz, und diese Episoden, die wie funkelnde Edelsteine an das weithinwallende, oft staubaufwühlende Gewand der Dichtung geheftet sind, werden denjenigen volles Genügen gewähren, welche nur ungern dem raschen Flug der erzählenden Muse durch die Jahrhunderte folgen.
Von Linggs Dramen hat „Catilina“ (1864) wohl den bedeutendsten Eindruck gemacht, auch von der Bühne herab, da das Münchener Hoftheater dies Römerschauspiel zur Aufführung brachte. Es pulsirt Römerblut in diesem Drama; wir wissen ja aus den römischen Balladen, daß Linggs Muse den dichterischen Takt zu dem eisernen Schritt der Legionen in ihrer Gewalt hat. Einzelnes wie die erste Scene des zweiten Aktes ist von trefflicher Haltung, und schwunghaft sind auch viele Reden Catilinas. Doch ist die Handlung etwas zersplittert und die Vorliebe für das Sagenhafte giebt einzelnen Austritten durch Einführung derartiger Gestalten einen alterthümelnden Zug. „Violante“ (1871), ein in Süditalien spielendes Stück aus der letzten Hohenstaufenzeit, hat eine blassere Färbung; schwunghafter ist vieles in den „Walküren“ (1864), einer allerdings auf dem Boden der Sage stehenden Dichtung. Die Erfindung in dem Schauspiel „Der Doge Candiano“ (1873) trägt ein dramatisches Gepräge und ist nicht ohne anmuthende Romantik. Der Doge hat sich in seiner Jugend, als ihn der Vater verbannt hatte, den Seeräubern angeschlossen, als Doge zieht er gegen dieselben zu Felde. Darin liegt ein Verhängniß, das wohl einen tragischen Ausgang herbeizuführen vermag. In einem ganz anderen Stil, in Faustversen, ist das Schauspiel „Berthold Schwarz“ (1874) gehalten, mit einem dem schlicht Voksthümlichen zugekehrten Streben. In dem mehr historienhaften Drama „Macalda“ (1877) kehrt Lingg noch einmal zur Hohenstaufenzeit zurück. Die Tochter Manfreds, sowie diejenige Carls von Anjou spielen darin mit; die Hauptheldin aber, Macalda, ist mit der sicilianischen Vesper eng verknüpft. „Die Bregenzer Klause“ (1887) behandelt Verwickelungen aus der letzten Zeit des Dreißigjährigen Krieges, ein anziehendes Stück von schlichter und natürlicher Sprache und ungezwungener Steigerung der Handlung.
Dies Schauspiel hat der Dichter nach einer Erzählung in seiner Novellensammlung „Von Wald und See“ (1883) für die Bühne bearbeitet; denn auch als Novellist ist Lingg aufgetreten, besonders in den „Byzantinischen Novellen“ (1881), und es bewährte sich auch in dieser Prosaform das Talent des Balladendichters, geschichtliche Stimmungsbilder von oft düsterer Beleuchtung zu schaffen.
So tritt das Bild des greisen Dichters am Ehrentage seines siebzigsten Geburtsfestes vor uns hin, bedeutsam in seiner Eigenart, dem Höchsten zugewendet im Denken und Dichten, in einer Zeit, in welcher leichtflüssige Gewandtheit allzusehr das Talent und glückliche Mache die schöpferische Kunst zu ersetzen vermag. Dem Nationalschatze deutscher Dichtung gehören einzelne seiner Gedichte für alle Zeiten an; denn sie haben das dauernde Gepräge, welches ein unter dem Antriebe echter Begeisterung schreibender Dichter seinen Schöpfungen aufdrückt.
Ein Hospiz für Verirrte. An den Westmarken des Reichs, zwischen den Quellen der schon dem Stromgebiet der Maas angehörenden Flüsse Roer (Ruhr), Vesdre (Weser) und Amblève breitet sich meilenweit ein ungastlicher öder Landstrich aus, das „hohe Venn“ („Venn“ oder „Veen“ = Moor, französisch „les hautes fagnes“), der ungefähr zu gleichen Theilen an die beiden hier zusammengrenzenden Staaten Preußen und Belgien fällt. Die Straße von Eupen nach Malmedy durchschneidet dieses nur spärlich bewohnte Hochmoor an seiner höchsten und gefährlichsten Stelle. Wehe dem Wanderer, der hier oben von einem Schneewetter überrascht wird! Im Nu ist Weg und Steg verschneit; keine Hand ist vor den Augen zu sehen; spitze Schnee- und Eisnadeln machen jeden Ausblick unmöglich und schlagen Gesicht und Hände blutrünstig, während ein durchdringender eisiger Wind das Blut beinahe ins Stocken bringt. Der Aermste ist verloren, wenn ihn nicht ein günstiger Zufall die einzige menschliche Wohnung in dieser Wüste erreichen läßt: die Baracke Michel.
Opferwillige Menschenliebe ist es, die Verirrten hier ein Asyl bereitet hat. Freilich, keine Bernhardiner werden hier ausgeschickt, um die Erstarrten aufzusuchen; aber stets während eines Unwetters wird man durch das Heulen des entfesselten Windes den Ruf eines Glöckchens vernehmen; der ermattete Wanderer strengt seine letzten Kräfte an, er folgt dem Glockenton und findet sich endlich angesichts einer Kapelle; es ist die Kapelle Fischbach gegenüber der Baracke Michel.
Die Baracke ist hart an der Grenze auf belgischem Boden erbaut. Einige ländliche Gebäude, von denen ein Theil vergangenen Herbst niedergebrannt ist, und ein Aussichtsthurm, das ist alles. Die Kapelle Fischbach liegt schon in Preußen.
Gegründet wurde die Baracke vor etwa 50 Jahren von einem Deutschen Namens Michael Schmitz, und noch heute ist das Anwesen im Besitz von dessen Familie, deren gegenwärtiges Oberhaupt sogar Angestellter des Brüsseler Observatoriums ist, da sich bei seinem Besitz, auf der höchsten Erhebung des belgischen Landes, 672 Meter über dem Meere, ein topographisches Höhenzeichen befindet. Besucht wird die Baracke, nach Fertigstellung der Bahnlinie Aachen-Malmedy, meist nur noch im Sommer von Touristen aus Spaa, Malmedy oder Aachen. Eine fast unbegrenzte Fernsicht genießt man von dort; mit einem guten Glase soll man die Helmspitzen des Domes von Antwerpen sehen können.
[67]
Als größte Merkwürdigkeit aber wird von dem Besitzer das „eiserne Buch“ gezeigt - eine Art Dankalbum. Die im Laufe der Jahre vom Tode Geretteten haben hier ihre Erlebnisse, ihren Kampf mit Sturm und
Schnee und dem tückischen Moor niedergelegt sammt ihrem Dank für endliche Erlösung, und die Familie Schmitz bewahrt das Buch von Geschlecht zu Geschlecht als ihren größten Schatz.
Physikalische Uebungs-Aufgaben für die reifere Jugend. In jedem Zögling höherer Schulanstalten, der Sinn und Neigung für Naturwissenschaften besitzt, erwacht frühzeitig der Wunsch, die Experimente, welche der Lehrer in der Unterrichtsstunde vorführt, selbst machen zu können. Dieser Wunsch ist durchaus berechtigt, denn wir begreifen und lernen die Wirkung der Naturkräfte erst dann vollkommen, wenn wir die Versuche selbst angestellt haben. Die Schule bei ihrer gegenwärtigen Einrichtung kann dieses Verlangen ihrer Zöglinge nicht befriedigen; bis jetzt fehlte es an Apparaten-Sammlungen, die ohne besonderen Kostenaufwand und mit wirklichem Nutzen dem Schüler überlassen werden konnten. Vieles, was zu Laboratorien für die Jugend empfohlen wurde, eignete sich nicht für die strengeren Anforderungen des experimentellen Studiums. Neuerdings sind von den physikalisch-technischen Werkstätten von Meiser und Mertig in Dresden Sammlungen von Apparaten zusammengestellt worden, welche das Studium der wichtigsten Abschnitte der Physik, der galvanischen Electricität, der Influenzelectricität, der Akustik und Optik ermöglichen. Jeder Sammlung sind 120 Aufgaben und Lösungen derselben beigegeben. Diese Sammlungen sind selbstverständlich für diejenigen Schüler bestimmt, welche die Grundsätze der Physik in der Schule bereits kennen gelernt haben, und sollen auch nur solchen gegeben werden. Sie eignen sich wohl als Geschenke, aber selbst der verhältnismäßig geringe Preis von 25 Mark für die Sammlung macht dieselben nur den reicheren Kreisen zugängig, und doch wäre es so wünschenswerth, das Experimentiren thunlichst vielen entsprechend beanlagten Schülern möglich zu machen. Dies ließe sich ohne Zweifel dadurch erreichen, daß der Lehrer die Sammlung dem betreffenden Schüler leihweise überlassen würde. Der Vortheil einer solchen Einrichtung liegt auf der Hand. Das Interesse für die in unsern Lehrplänen so stiefmütterlich bedachten Naturwissenschaften würde bei den Schülern wesentlich gehoben werden; das Experimentiren selbst nach einem durch die gestellten Aufgaben wissenschaftlich geregelten Plan würde keine weitere Ueberbürdung bedeuten, im Gegentheil, es würde den Schülern eine Erholung sein und vor allem ihre Sinne schärfen und ihnen die so überaus wichtige Gelegenheit geben, wirklich beobachten zu lernen. Es liegt uns durchaus fern, die betreffenden Sammlungen, was die Auswahl der Apparate anbelangt, als mustergültig hinzustellen; es ist möglich, daß dieses oder jenes in denselben geändert werden könnte. Es kommt uns in erster Linie darauf an, die Idee, welche diesen Sammlungen zu Grunde liegt und als ein mächtiger Hebel des bei uns so vernachlässigten naturwissenschaftlichen Unterrichts dienen dürfte, zur Geltung zu bringen. Von diesem Gesichtspunkte aus möchten wir Eltern, namentlich aber Lehrern die betreffenden Sammlungen von Apparaten zur Beachtung empfehlen. Ihr Nutzen liegt auf der Hand, denn eigene Anschauung ist die Grundlage der wahren Naturerkenntniß.
Die Kanarienvögel vom Truteschen Stamm. Von Harzer Kanarienvögeln spricht heutzutage jedermann oder er weiß es doch, wenn die Rede darauf kommt, daß im Harz die eigentliche Heimstätte der vorzüglichsten Sänger dieser Art sein soll. Wer sodann einigermaßen näher eingeweiht ist, kennt auch die Vögel vom Truteschen Stamm und bei allen wirklichen Liebhabern gelten sie als weltberühmt.
Während der Kanarienvogel nachweislich erst seit etwas länger als dreihundert Jahren dem Menschen gleichsam als Hausthierchen zugänglich geworden und von dem schlicht gelblich-graugrünen, freilebenden Vogel oder Wildling zum goldgelben Kulturvogel sich verwandelt hat, können wir die Entwicklung des Kanarienvogels als eines Sängers gar erst seit Jahrzehnten verfolgen.
Das Bergstädtchen St. Andreasberg im Harz war es, von wo diese Veredlung des Kanarienvogelgesanges ausging, bis sie in allerneuester Zeit sich auch in vielen anderen Gegenden unseres deutschen Vaterlandes festgesetzt und weiter entwickelt hat; so außer in den übrigen Harzer Städtchen namentlich in Berlin, Hannover, Frankfurt a. M., Nürnberg, Stuttgart, Köln, Leipzig, Dresden u. a. m.
Bei weitem die meisten der am vorzüglichsten singenden Harzer Kanarienvögel bezeichnet man einfach als Schläger, bezw. Hohlroller vom Truteschen Stamm, und dies schreibt sich daher, daß unter den verschiedenen Kanarienstämmen in St. Andreasberg der des Bergmanns Trute der bedeutendste war und noch ist, neben welchem als gleich hervorragend eigentlich nur noch der Erntgessche Stamm (gezüchtet vom Kaufmann Erntges in Elberfeld) in Betracht kommt.
Wilhelm Trute war ein einfacher, biederer Mann. Wie es in St. Andreasberg üblich ist, geht die Kanarienvogelzüchtung als Nebenbeschäftigung und Nebenverdienst der Bergleute vom Vater auf den Sohn über und jeder sucht den Gesang seines Kanarienvogelstammes weiter auszubilden und zur möglichst hohen Vollkommenheit zu führen. Dazu gehört nicht bloß Eifer, Liebe und Lust, volles Verständniß und Geschmack, reiche Kenntniß und Erfahrung, sondern vor allem ein feines sicheres musikalisches Gehör. Diese Eigenthümlichkeiten können dann aber auch zu einer wahren Goldgrube werden.
So züchtete Trute alljährlich 200 bis 275 Kanarienhähne, die er in früherer Zeit zum Durchschnittspreis von 7,50 Mark, seit zehn Jahren aber mit 10 Mark für den Kopf an einen Berliner Vogelhändler verkaufte, welcher die sorgsam ausgemusterten oder, wie man zu sagen pflegt, „abgehörten“ Vögel sodann zum Durchschnittspreise von 15 bis 20 Mark, und einzelne köstliche Sänger für 30 bis 60 Mark, im höchsten Einzelpreise bis zu 100 Mark an die Liebhaber absetzte. Eine beträchtliche Anzahl der besten Vögel behielt Trute stets zurück, und für dieselben fand er bereitwillige Abnehmer im einzelnen zu 60 Mark, 75 Mark, 100 Mark bis 150 Mark und wohl noch darüber. Für seine Zuchtvögel sind ihm zuweilen 300 Mark und mehr für den Kopf auf den Tisch gelegt worden, ohne daß er sich jemals dazu hätte verleiten lassen, dieselben fortzugeben, denn von ihnen hing ja der Bestand und der Werth seiner ganzen Kanarienvogelzucht und damit einer nicht unerheblichen Erwerbsquelle ab.
Jetzt ist Teute, leider viel zu früh, im Alter von noch nicht 50 Jahren verstorben, und alle, die ihn gekannt und in seinem anspruchslosen und rechtschaffenen Wesen, namentlich aber in seinem achtungswerthen Streben geschätzt haben, werden die Ueberzeugung hegen, daß sein Andenken ein bleibendes ist, denn Kanarienvögel vom Truteschen Stamme wird es in aller Zeit geben, solange wir den goldgelben Hausfreund hegen und pflegen.
Goldgewinnung der Alten. Der alte Plinius, welcher bekanntlich. im 1. Jahrhundert n. Chr. eine dicke Naturgeschichte geschrieben hat, war der Meinung, daß das Gold in Indien nicht durch der Menschen Fleiß gesammelt werde, die hierzu unvermögend seien, sondern daß große fliegende Ameisen die Goldkörner zusammentragen. Wahrscheinlich glaubte er, man finde dann die letzteren in den Ameisenhaufen, wie man heutzutage in denselben die Ameiseneier findet. Torquemadus, ein mittelalterlicher Schriftsteller, ist noch weit phantastischer als Plinius; er stellte sich
die Goldgewinnung so vor, daß in dem schwarzen Fluß von Lappland ein Fisch Namens „Trevion“ gefangen werde, der im Winter schwarz, im Sommer weiß sei. Das Schmalz dieses Fisches wirke auf das Gold
magnetisch; werde es nun an einem Seile auf den Grund dieses Flusses niedergelassen, so ziehe es die dort zahlreich lagernden Goldkörner an sich und so sei das Gold in Menge gefischt worden.
Arbeiterbäder. In dem Artikel "Gründet billige Volksbäder!" (vergl. Jahrgang 1887, S. 282) haben wir das Volksbrausebad von Dr. O. Lassar in Berlin ausführlich besprochen und dasselbe als sehr zweckmäßig für Fabriken bezeichnet. Auf der „Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung“ in Berlin bildeten die Arbeiterbäder gleichfalls einen wichtigen Punkt innerhalb der gesteckten Aufgabe, da diese sehr geeignet sind, die Gesundheit der Arbeiter zu stärken und durch die Gewöhnung an größere Reinlichkeit auch der Ausbreitung ansteckender Krankheiten Einhalt zu gebieten. Der deutsche Brauerbund hat in richtiger Würdigung dieser Thatsachen einen Preis von tausend Mark ausgeschrieben, welcher derjenigen Einrichtung von Bädern für Arbeiter zuerkannt werden sollte, „welche sich durch Brauchbarkeit, Solidität, Einführbarkeit bei gleichzeitig einladender und einfachster Beschaffenheit auszeichnet“. Von den ausgestellten Einrichtungen hat keine den geforderten Bedingungen vollkommen entsprochen. Am nächsten kamen denselben die Badeeinrichtungen der Firma Börner u. Komp. (Dr. Lassarsches Arbeiterbrausebad) und der Deutschen Jute-Spinnerei und Weberei in Meißen (Arbeiterbrausebad), unter die der Preis getheilt wurde.
Das Preisgericht hat sich jedoch nicht auf die Preisertheilung beschränkt, sondern sich auch in dankenswerther Weise der Mühe unterzogen, Grundsätze für Errichtung von Arbeiterbädern aufzustellen, die in der von B. Knoblauch herausgegebenen Schrift „Arbeiterbadeeinrichtungen“ (in Kommission bei Carl Heymanns Verlag, Berlin) der Oeffentlichkeit übergeben worden sind.
Welcher Art diese Grundsätze sind, wollen wir nur an einigen Beispielen zeigen: Was die Brause anbelangt, so fordert das Gutachten zuvörderst, daß sie schräg gestellt werde. Das senkrecht aus der Höhe herabstürzende Wasser ist namentlich schwächeren oder zu Blutwallungen neigenden Personen unzuträglich. Eine im Winkel von ungefähr 45 Grad stehende und unter gelindem Druck ausströmende Brause würde das Richtige treffen. Dies ist ein Grundsatz, der in vielen uns bekannten sogenannten feineren Bädern nicht durchgeführt ist: ebenso wissen die meisten der Badenden gar nichts von dem Unterschied in der Wirkung einer senkrechten und schrägen Brause.
Große Aufmerksamkeit hat das Preisgericht der Reinlichkeit der Badeeinrichtung zugewandt und sich gegen die Verwendung von Holzwerk im Baderaum ausgesprochen. Der Lattenrost soll thunlichst vermieden werden. Von der Aufstellung eines Holzschemels im Baderaum ist abzusehen, da er besonders geeignet ist, Krankheitsstoffe aufzunehmen und zu übertragen. Derselbe läßt sich durch einen Zinkwulst auf massiver Unterlage ersetzen. Kämme und Bürsten sind nicht auszulegen, weil durch ihren allen gemeinsamen Gebrauch leicht Kopfkrankheiten übertragen werden können. Diese Regel sollte in allen öffentlichen Bädern befolgt werden, denn die ausgelegten Kämme und Bürsten wirken oft verführerisch selbst auf Personen, denen die Gefahr der Uebertragung von Haar- und Hautkrankheiten durch die Benutzung derselben nicht unbekannt ist, die aber vergessen haben, Kamm und Bürste in das Bad mitzubringen.
Möge das Gutachten des Preisgerichtes die wohlverdiente Beachtung finden und zum Fortschritt auf dem Gebiete der Volksbäder führen!
Einheitlicher Personentarif in Preußen. Der bereits seit dem 1. April 1889 in den Bezirken der östlichen preußischen Eisenbahndirektionen gültige Personentarif wird mit dem 1. April dieses Jahres auch auf die drei westlichen Bezirke ausgedehnt, so daß von da ab für ganz Preußen einheitliche Sätze bestehen. Dieselben betragen in gewöhnlichen Personenzügen für die 4 Klassen 8, 6, 4 und 2 Pfennig für den Kilometer. Für Schnellzüge (auch Kurier- und Expreßzüge) erhöht sich die Taxe für die drei ersten Klassen auf 9, 6 2/3 und 4 2/3 Pfennig; für Rückfahrkarten sind 12, 9 und 6 Pfennig zu zahlen; Karten 4. Klasse werden für Schnellzüge und als Rückfahrtarten nicht ausgegeben.
Weiß man also die kilometrische Entfernung, so kann man sich mit Leichtigkeit die Kosten der Eisenbahnfahrt selbst ausrechnen.
[68]Allerlei Kurzweil.
| Rösselsprungrebus. | Logogryph. | Auflösung des Homonyms auf S. 36: Drache. Auflösung des Räthsels auf S. 36: Fremde – Freude. Auflösung des Trennungsräthsels auf S. 36: Zu Fall! – Zufall. Auflösung des Logogryphs auf S. 36: Thier – Theer. Auflösung des Kapselräthsels auf S. 36: Spa – nie – n. |
Mit l ein Thier, Homonym.
In jäher Furcht ist einst vor meines Hammers Schlage, Der nur vernichtend traf, ein großes Volk erbebt, Doch welche Wandlung, ach, hab’ ich seitdem erlebt, Denn es verspottet nur die Welt mich heutzutage. Oscar Leede.
Kapselräthsel.
Berg’ ich den Liebesgott in mir, Stehst du in meine Pracht versunken, Doch zeig’ ich ohne Gott mich dir, Werd’ mit Behagen ich getrunken. Emil Noot.
|
| Dominoaufgabe. | Auflösung der Skataufgabe Nr. 1 auf S. 36: | |
| A, B und C nehmen je acht Steine auf. Vier Steine, darunter Vier-Blank, bleiben verdeckt im Talon. B hat auf seinen Steinen 6 Augen mehr als A, aber 6 Augen weniger als C. A hat: A setzt Doppel-Zwei aus und gewinnt dadurch, daß er die Partie bei der siebenten Runde mit Drei-Zwei an Drei sperrt. B konnte nur bei der zweiten Runde ansetzen. A und C haben nicht gepaßt. C behält zwei Steine mit zusammen 14 Augen. Die Summe der Augen auf den 14 gesetzten Steinen beträgt 86. Welche Steine lagen im Talon? Welche Steine behielt C übrig? Wie war der Gang der Partie? |
a. Bei folgender Sitzung: Skat: g7, r8. Mittelhand: eW, gW, cZ, gK, sZ, sK, sO, s9, s8, r7. Hinterhand: rW, sW, cD, gZ, rD, rZ, rK, rO, r9, s7. nimmt das Spiel folgenden Verlauf: | |
| 1., c7, cZ, eD (– 21) 2., rD, eK, r7 (+ 15) |
3., c8, gW, sW (– 4) 4., gK, gZ, gD (+25) oder (s8, s7, sD) | |
| 5., c9. cW, rW (– 4) | ||
| und der Spieler, welcher keinen Stich mehr abgiebt, hat mit Schneider gewonnen. b. Dürften dagegen die Gegner r7 mit s7 vertauschen, so ergiebt sich folgendes Spiel: | ||
| 1., e7, eZ, eD (– 21) 2., rD, eK, gW (– 17) 3., sZ!! sW, sD (– 23) |
4., rZ, eO, eW (– 15) 5., sK, gZ!!! e9 (+ 14) 6., gD, gK, rW (– 17) | |
| und der Spieler hat mit Schneider verloren. | ||
| Auflösung der Schachaufgabe Nr. 1 auf S. 36: | ||
| 1. D c 2 – h 2 f 6 – f 5 2. K d 5 – c 4 K e 3 – c 4 a) 3. D h 2 – g 3 f 5 – f 4 4. D g 3 – e 1 matt. |
1. … K e 3 – d 3 2. D h 2 – e 2 † K e 3 – e 2 3. K d 5 – c 5 beliebig. 4. D e 2 – c 2 matt. | |
| a) 2. … g 4 – g 3 3. D h 2 – e 2 † K e 3 – f 4 4. S d 4 – e 6 matt |
||
| 1. … g 4 – g 3 2. D h 2 – e 2 † K e 3 – f 4 3. S d 4 – e 6 † K f 4 – f 5 4. D e 2 – h 5 matt. |
1. … f 6 X e 5 2. D h 2 – e 2 † K e 3 – f 4 3. D 3 2 X e 5 matt. | |
| Auflösung des Doppelmonogramms auf S. 36: | Auflösung der Kombinationsaufgabe auf S. 36: |
| Man beginne mit den kleinsten Buchstaben (P und N) und lasse hierauf die übrigen nach Maßgabe ihrer Größe folgen; dann erhält man: Prosit Neujahr! A. St. |
Prometheus, Yard, Terpsichore, Heidelberg, Andalusien, Gneisenau, Oldenburg, Rheinlachs, Adrianopel, Sacramento – Pythagoras. |
Auflösung des Scherzbilderräthsels auf S. 36: Freimaurer.
Kleiner Briefkasten.
A. Sch., St. Louls. Besten Dank für Ihren poetischen Gruß, aus dem wir mit Freude Ihre treue Anhänglichkert an das alte Vaterland diesseit des Oceans erkennen. Indessen haben Sie selbst gefühlt, daß Sie als Neuling noch nicht ganz sicher unter den Palmen der Dichtkunst wandeln, und so nehmen Sie es auch der „Gartenlaube“ wohl nicht übel, wenn sie es bei der rückhaltlosen Anerkennung Ihrer Heimathtreue sein Bewenden haben läßt.
Pauline St. in F. Was Sie in den Delikatessenhandlungen als „Japanknöllchen“ angeboten finden, ist ein neues Knollengemüse, stachys tuberifera, das „Choro-gi“ der Japaner. Es sind kleine runde weiße Knöllchen, die geschmort, gebacken, in Essig eingelegt etc. wie Edelkastanien schmecken. In Nordamerika werden die Japanknöllchen stark kultivirt, und dort wurden sie auf ihren Nährwerth untersucht. Sie enthalten im Vergleich zu den Kartoffeln viel mehr Wasser und mehr fleischbildende Albuminoidstoffe, aber statt der Stärke, die in der Kartoffel bis zu 15% vorkommt, nur Zucker und zwar 16,6%. Da die Pflanze, eine perennirende Staude, vollkommen frosthart ist, so kann sie auch bei uns angebaut werden. Die Knöllchen werden vom Februar bis April in beliebigen, am besten jedoch etwas sandigen Boden gelegt, und zwar 1 bis 3 Stück auf je 40 cm Entfernung und etwa 10 cm tief. Zur Pflege braucht man nur das Beet unkrautrein zu halten und bei starker Trockenheit zu gießen. Die Ernte beginnt im November, und es empfiehlt sich, die Knöllchen frisch zu verwenden, da sie an der Luft welk und schwarz werden. Man deckt darum das Beet mit Laub zu, damit man im Winter ernten kann. Das Beet trägt jahrelang. Größere Samenhandlungen werden gewiß in der Lage sein, gute Saatknöllchen auf Bestellung zu liefern.
H. P. in Kiew und A. S. in Bozen. Geben Sie uns gefälligst Ihre genaue Adresse an, damit wir Ihnen brieflich antworten können.
E. J. in Reichenberg, Böhmen. Es ist uns bekannt, daß Prof. Thiersch fehlende Nasen ersetzt, indem er künstliche Nasen durch herausgeschnittene Hautlappen im Gesichte bildet. Aber es ist fraglich, ob er auch Nasenkorrektionen der von Ihnen angedeuteten Art vornimmt.
L. B. in Koblenz. Zu 1. Wenn nach dortiger Spielweise Grand mit zwei Matadoren höher steht als Null ouvert, so muß derjenige, welcher ouvert spielen will, dies sofort melden, wenn er auf Grand gereizt wird. Keinenfalls hat er das Recht, das Spiel auf Grand zu behalten und dann ein Spiel anzusagen, welches niedriger ist als das, auf welches er gereizt worden ist. – Zu Ihrer 2. Frage: Bei gleich hohen Spielen hat die Vorhand vor Mittelhand, und letztere wieder vor der Hinterhand das Vorrecht. (Vergleichen Sie das Nähere in § 23 und § 25 der „Allgemeinen Deutschen Skatordnung“ von K. Buhle, Verlag von Theod. Thomas in Leipzig.)
K. P. in Rußland. Das einzige bis jetzt als durchaus zuverlässig bekannte Mittel zur Desinfektion der von Ihnen erwähnten Gegenstände ist die Anwendung heißer strömender Dämpfe nach dem von und in dem Artikel „Oeffentliche Desinfektionsanstalten“ (1889, Halbheft 20) beschriebenen Verfahren. Wäschestücke u. s. w. kann man auch durch ein längeres Eintauchen in 5% Karbolsäure und Kochen desinfizieren. Betten, Roßhaarmatratzen u. s. w. kann man aber schwerlich so behandeln, und doch sind alle anderen empfohlenen Desinfektionsmethoden unzuverlässig.
In dem unterzeichneten Verlage ist erschienen und durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen:
Der Kalender enthält unterhaltende und belehrende Beiträge von A. Ohorn, W. Heimburg, P. von Schönthan, H. Villinger, Dr. L. Fürst, Dr. H. Tischler, Dr. K. Ruß, Rud. Falb, Schmidt-Weißenfels u. A., prachtvolle Illustrationen erster Künstler.
Bestellungen auf den „Gartenlaube-Kalender“ (1890) wolle man der Buchhandlung übergeben, welche die „Gartenlaube“ liefert. Wo der Bezug auf Hindernisse stößt, wende man sich unter Einsendung von 1 Mark und 20 Pf. (für Porto) in Briefmarken direkt an die
- ↑ 1 Faden = 1.883 m.
- ↑ Sahne.
- ↑ Fremdlinge, die theils zu Zeiten des Althochdeutschen, theils später unserem Sprachschatze einverleibt wurden, sind z. B. die Wörter „Pferd“, „Kopf“, „Masse“, „Messe“, „Kirche“, „Kirsche“, „Fenster“, „Punkt“, „Tisch“, „Bischof“, „Papst“, „Almosen“, „Pfingsten“, „Brief“, „Zettel“.