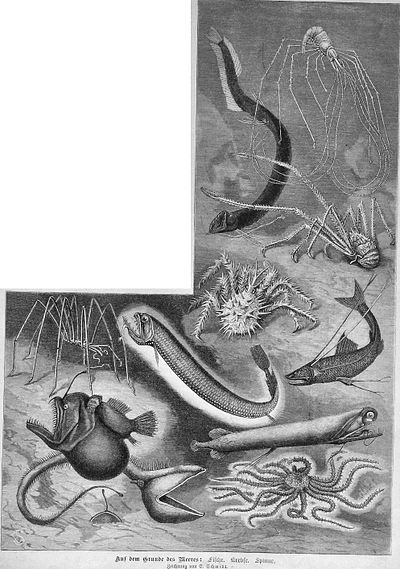Die Gartenlaube (1890)/Heft 3
[69]
| Halbheft 3. | 1890. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Flammenzeichen.
Es war wieder Herbst geworden und das warme, goldige Licht eines klaren Septembertages lag auf dem grünen Waldmeer, das sich endlos ausdehnte, so weit das Auge reichte.
Die mächtigen Forsten hatten noch etwas von den einstigen Urwäldern, die vor Jahrhunderten diesen Theil Süddeutschlands bedeckten, und die hundertjährigen Stämme gehörten darin nicht zu den Seltenheiten. Das Ganze trug den Charakter eines Waldgebirges, denn Höhen und Thäler wechselten fortwährend miteinander; aber während die Eisenbahn ringsum im Lande ihre Netze spann und einen Ort nach dem andern in ihr Bereich zog, lag der „Wald“, wie dieser meilenweite Bezirk kurzweg im Volksmunde genannt wurde, noch so abgeschlossen da wie eine grüne Insel, fast unberührt von all dem Wogen und Treiben draußen.
Hier und da tauchte aus dem Waldesgrün eine Ortschaft hervor oder ein altes Schloß, das, grau und verwittert, seinem Verfall entgegenging; nur das mächtige, altersgraue Bauwerk, das, auf einer Anhöhe liegend, die ganze Umgegend beherrschte, machte eine Ausnahme davon. Es war der Fürstenstein, ein Jagdschloß des Landesherrn und gegenwärtig der Wohnsitz des Oberforstmeisters. Das Schloß stammte aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts
[70] und war mit der ganzen Raumverschwendung jener Zeit erbaut, wo der Jagdsitz eines Fürsten oft wochenlang den gesammten Hofhalt aufnehmen mußte. Aus der Entfernung war der Fürstenstein nur theilweise sichtbar, denn der Wald bedeckte den ganzen Schloßberg, und die grauen Mauern, die Thürme und Erker strebten aus grünen Tannenwipfeln empor. Erst wenn man vor dem Eingangsthore stand, hatte man den vollen Eindruck der Größe des alten Bauwerkes, dem sich noch eine Menge kleinerer Baulichkeiten aus späteren Zeiten anschloß. Daß hier sorgfältig jedem Verfall vorgebeugt wurde, verstand sich von selbst, denn die zahlreichen Räumlichkeiten der oberen Stockwerke wurden zur Verfügung des Fürsten gehalten, der im Herbste bisweilen hierherkam. Das ebenfalls sehr weitläufige Erdgeschoß dagegen war dem Oberforstmeister von Schönau eingeräumt, der schon seit Jahren hier seinen Wohnsitz hatte und sich mit einem sehr gastfreien Hause und häufigen Besuchen in der Nachbarschaft die Einsamkeit ganz angenehm zu gestalten wußte.
Er hatte auch jetzt Besuch: seine Schwägerin, Frau Regine von Eschenhagen, war gestern eingetroffen und ihr Sohn wurde gleichfalls erwartet. Die beiden Töchter des Wallmodenschen Hauses hatten sehr annehmbare Partien gemacht: während die ältere den Majoratsherrn von Burgsdorf heirathete, vermählte sich die jüngere mit einem Herrn von Schönau, der aus einer süddeutschen, ebenfalls reich begüterten Familie stammte. Die Schwestern waren trotz der Entfernung in regem, herzlichem Verkehr geblieben, und auch nach dem Tode der jüngeren, der vor einigen Jahren erfolgt war, blieben die freundschaftlichen Beziehungen der Verwandten bestehen.
Es hatte allerdings seine eigene Bewandtniß mit dieser Freundschaft, denn der Oberforstmeister stand ein für allemal auf dem Kriegsfuße mit seiner Schwägerin. Da sie beide gleich derbe und rücksichtslose Naturen waren, geriethen sie bei jeder Gelegenheit aneinander, vertrugen sich zwar regelmäßig wieder und beschlossen, in Zukunft Frieden zu halten, aber dies Versprechen wurde ebenso regelmäßig gebrochen. In der nächsten Stunde gab es eine neue Meinungsverschiedenheit, die beiderseitig mit vollster Leidenschaft durchgefochten wurde, bis der Zank von neuem im Gange war.
Augenblicklich jedoch schien eine ungewöhnliche Eintracht zwischen den beiden zu herrschen, die auf der kleinen Terrasse vor dem Empfangszimmer saßen. Der Oberforstmeister, trotz seiner vorgerückten Jahre noch ein stattlicher Mann, mit kräftigen, sonnenverbrannten Zügen und leicht ergrautem, aber noch vollem Haar und Bart, lehnte sich behaglich in seinen Stuhl zurück und hörte seiner Schwägerin zu, die wie gewöhnlich das Wort führte. Sie stand jetzt bereits im Anfange der Fünfziger, hatte sich aber kaum verändert in dem letzten Jahrzehnt, denn die Jahre vermochten dieser urkräftigen Natur nicht viel anzuhaben. In dem Gesicht zeigte sich wohl hier und da ein Fältchen, und in das dunkle Haar woben sich vereinzelte Silberfäden, aber die grauen Augen hatten nichts von ihrer Klarheit und Schärfe verloren, die Stimme war noch ebenso laut und volltönend, die Haltung ebenso energisch wie früher. Man sah es, die Dame führte nach wie vor den Kommandostab in ihrem Reiche.
„Also Willy kommt in acht Tagen,“ sagte sie soeben. „Er war mit den Erntearbeiten noch nicht ganz fertig; aber in der nächsten Woche sind sie zu Ende, und dann macht er sich auf die Brautfahrt. Die Sache ist ja längst abgemacht zwischen uns, aber ich war entschieden für den Aufschub, denn ein junges Ding von sechzehn oder siebzehn Jahren hat noch lauter Kindereien im Kopfe und kann einem ordentlichen Haushalt noch nicht vorstehen. Jetzt ist Toni zwanzig Jahre alt und Willy siebenundzwanzig, das paßt gerade. Du bist doch einverstanden, Schwager, daß wir nun mit der Verlobung unserer Kinder Ernst machen?“
„Ganz einverstanden!“ bestätigte der Oberforstmeister, „und in allem übrigen sind wir ja einig. Die Hälfte meines Vermögens fällt dereinst an meinen Sohn, die andere Hälfte an meine Tochter, und mit der Mitgift, die ich ihr für die Heirath ausgesetzt habe, kannst Du auch zufrieden sein.“
„Ja, Du bist darin nicht sparsam gewesen. Was Willy betrifft, so hat er ja seit drei Jahren das Majorat von Burgsdorf angetreten, das übrige Vermögen bleibt laut Testament in meinen Händen, nach menem Tode fällt es selbstverständlich auch an ihn. Noth zu leiden braucht das junge Paar gerade nicht, dafür ist hinreichend gesorgt, also abgemacht!“
„Abgemacht! Wir feiern jetzt die Verlobung und im nächsten Frühjahr die Hochzeit!“
Der bisher so klare Himmel der verwandtschaftlichen Eintracht wurde hier durch die erste Wolke getrübt. Frau von Eschenhagen schüttelte den Kopf und sagte diktatorisch: „Das geht nicht, die Hochzeit muß im Winter sein, im Frühjahr hat Willy keine Zeit zum Heirathen.“
„Unsinn! Zum Heirathen hat man immer Zeit,“ erklärte Schönau ebenso diktatorisch.
„Auf dem Lande nicht,“ behauptete Frau Regine. „Da heißt es: erst die Arbeit und dann das Vergnügen. So ist es stets bei uns gewesen und so hat es auch Willy gelernt.“
„Ich bitte mir aber sehr aus, daß er mit seiner jungen Frau eine Ausnahme macht, sonst hol’ ihn der Kuckuck!“ rief der Oberforstmeister ärgerlich. „Ueberhaupt, Du kennst meine Bedingung, Regine. Das Mädchen hat Deinen Sohn seit zwei Jahren nicht gesehen. Wenn er ihr nicht gefällt – sie hat freie Wahl!“
Er traf seine Schwägerin damit an ihrer empfindlichsten Stelle, sie richtete sich im beleidigten Mutterstolze hoch auf.
„Mein lieber Moritz, ich traue Deiner Tochter denn doch einigen Geschmack zu. Im übrigen halte ich es mit der guten alten Sitte, daß die Eltern ihre Kinder verheirathen. So war es zu unserer Zeit und wir haben uns wohl dabei befunden. Was versteht das junge Volk von solchen ernsten Dingen! Aber Du hast Deinen Kindern von jeher den Willen gelassen, man merkt es, daß keine Mutter im Hause ist.“
„Ist das etwa meine Schuld?“ fragte Schönau gereizt. „Sollte ich ihnen vielleicht eine Stiefmutter geben? Einmal habe ich es allerdings gewollt, aber da wolltest Du ja nicht, Regine.“
„Nein, ich habe an dem einen Male genug,“ lautete die trockene Antwort, die den Oberforstmeister noch mehr aufbrachte. Er zuckte spöttisch die Achseln.
„Nun, ich dächte, über den seligen Eschenhagen hättest Du Dich nicht beklagen können! Der tanzte ja mit seinem ganzen Burgsdorf vollständig nach Deiner Pfeife. Bei mir hättest Du freilich das Regiment nicht so ohne weiteres angetreten.“
„Aber in vier Wochen hätte ich es gehabt,“ erklärte Frau Regine mit Seelenruhe, „und Dich hätte ich zu allererst unter mein Kommando genommen, Moritz.“
„Was? Das sagst Du mir ins Gesicht? Wollen wir es einmal probiren?“ fuhr Schönau in voller Wuth auf.
„Danke, ich heirathe nicht zum zweiten Male, gieb Dir keine Mühe!“
„Fällt mir auch gar nicht ein! Ich habe genug an dem einen Korbe, Du brauchst mir keinen zweiten zu geben!“
Damit stieß der Oberforstmeister noch immer wüthend seinen Stuhl zurück und lief davon. Frau von Eschenhagen blieb ruhig sitzen, nach einer Weile sagte sie ganz freundschaftlich: „Moritz!“
„Was giebt es?“ grollte es von der anderen Seite der Terrasse.
„Wann kommt denn Herbert mit seiner jungen Frau?“
„Um zwölf Uhr!“ klang es noch immer sehr grimmig herüber.
„Das freut mich. Ich habe ihn nicht wiedergesehen, seit er nach Eurer Residenz gesandt wurde, aber ich sagte es ja immer, Herbert ist der Stolz unserer Familie, mit dem man überall Staat machen kann. Jetzt ist er preußischer Gesandter an Eurem Hofe, ist Excellenz –“
„Und nebenbei ein junger Ehemann von sechsundfünfzig Jahren!“ spottete der Oberforstmeister.
„Ja, er hat sich Zeit gelassen zum Heirathen, aber dafür hat er auch eine glänzende Partie gemacht. Für einen Mann in seinen Jahren war es immerhin keine Kleinigkeit, eine Frau wie Adelheid zu gewinnen, jung, schön, reich –“
„Aber bürgerlicher Geburt,“ warf Schönau ein.
„Unsinn! Wer fragt heutzutage nach dem Stammbaum, wenn eine Million dahinter steht! Herbert kann sie brauchen; er hat sich sein lebelang mit knappen Mitteln durchschlagen müssen, und der Gesandtschaftsposten wird auch mehr Aufwaud erfordern, als das Gehalt beträgt. Uebrigens braucht sich mein Bruder seines Schwiegervaters nicht zu schämen, Stahlberg war einer unserer ersten Industriellen und dabei ein Ehrenmann durch und durch. Schade, daß er sobald nach der Heirath seiner Tochter starb, jedenfalls hat sie eine sehr vernünftige Wahl getroffen.“
[71] „So, das nennst Du eine vernünftige Wahl, wenn ein Mädchen von achtzehn Jahren einen Mann nimmt, der ihr Vater sein könnte?“ rief der Oberforstmeister, der im Eifer des Gefechtes allmählich wieder näher kam. „Freilich, man wird ja Frau Baronin und Excellenz, man spielt als Gemahlin des preußischen Gesandten eine erste Rolle in der Gesellschaft. Mir ist diese schöne, kühle Adelheid mit ihren ‚vernünftigen‘ Ansichten, die einer Großmutter Ehre machen würden, ganz und gar nicht sympathisch. Ein unvernünftiges Mädel, das sich bis über beide Ohren verliebt und dann den Eltern erklärt: ‚Der oder keiner!‘ ist mir viel lieber.“
„Das sind ja schöne Ansichten für einen Familienvater!“ rief Frau von Eschenhagen entrüstet. „Ein Glück, daß Toni nach meiner Schwester gerathen ist und nicht nach Dir, sonst könntest Du eines Tages dergleichen an Deinem eigenen Kinde erleben. Da hat Stahlberg seine Tochter doch besser erzogen, ich weiß es von ihm selbst, daß sie in erster Linie seinem Wunsche folgte, als sie Herbert die Hand reichte, und so ist es auch in der Ordnung, so gehört es sich, aber Du verstehst nichts von Kindererziehung.“
„Was? Ich soll als Mann und Vater nichts davon verstehen?“ schrie der Oberforstmeister, kirschroth vor Aerger. Die beiden waren auf dem besten Wege, wieder aneinander zu gerathen, aber diesmal wurden sie glücklicherweise unterbrochen, denn ein junges Mädchen, die Tochter des Hausherrn, trat auf die Terrasse.
Antonie von Schönau konnte eigentlich nicht für hübsch gelten, aber sie hatte die stattliche Gestalt ihres Vaters und ein frisches, blühendes Gesicht, mit hellen, braunen Augen. Das braune Haar war in einfachen Flechten um den Kopf gelegt und die Kleidung, obgleich dem Stande der jungen Dame angemessen, zeigte die gleiche Einfachheit. Uebrigens stand Antonie in den Jahren, wo die Jugend jeden anderen Reiz ersetzt, und als sie herantrat, frisch, gesund. tüchtig in ihrer ganzen Erscheinung, war sie so recht eine Schwiegertochter nach dem Herzen der Frau von Eschenhagen, die sofort den Streit abbrach und ihr freundlich zunickte.
„Vater, soeben kommt der Wagen von der Bahnstation zurück,“ sagte die junge Dame in sehr bedächtigem, etwas schleppendem Tone. „Er ist schon am Fuße des Schloßberges, der Onkel Wallmoden wird in einer Viertelstunde hier sein.“
„Der Tausend, da sind sie schnell gefahren!“ rief der Oberforstmeister, dessen Gesicht sich gleichfalls aufhellte bei der Nachricht. „Die Fremdenzimmer sind doch in Ordnung?“
Toni nickte so gelassen, als verstehe sich das von selbst, und während ihr Vater aufbrach, um nach dem Wagen zu sehen, der die Gäste brachte, fragte Frau von Eschenhagen, mit einem Blick auf das Körbchen, welches das junge Mädchen in der Hand trug:
„Nun, Toni, bist Du wieder fleißig gewesen?“
„Ich war im Küchengarten, liebe Tante. Der Gärtner behauptete, es gäbe noch keine reifen Birnen, ich habe aber selbst nachgesehen und einen ganzen Korb voll gesammelt.“
„Recht so, mein Kind!“ sagte die künftige Schwiegermutter hochbefriedigt. „Man muß überall selbst die Augen und Hände haben und sich nie auf seine Leute verlassen. Du wirst einmal eine tüchtige Gutsherrin werden! Aber nun komm, wir wollen gleichfalls hinunter und Deinen Onkel begrüßen.“
Herr von Schönau war bereits vorangegangen und schritt eben die breite, steinerne Freitreppe hinab, die nach dem Schloßhofe führte, als aus einem der Seitengebäude ein Mann trat, der jetzt stehen blieb und respektvoll grüßend den Hut zog.
„Sieh da, Stadinger! Was machen Sie denn hier in Fürstenstein?“ rief der Oberforstmeister. „Kommen Sie doch näher!“
Stadinger kam der Aufforderung nach; trotz seiner eisgrauen Haare schritt er noch rüstig vorwärts, in strammer, aufrechter Haltung, und aus dem braunen. verwitterten Gesichte blickte ein Paar scharfer, dunkler Augen.
„Ich war bei dem Schloßkastellan, Herr Oberforstmeister,“ versetzte er, „und hab’ angefragt, ob er mir nicht ein paar von seinen Leuten zur Aushilfe geben kann, denn bei uns in Rodeck geht es jetzt drunter und drüber, wir haben nicht Hände genug für all die Arbeit.“
„Ja so, Prinz Egon ist zurück von seiner Orientreise, ich habe es schon gehört,“ sagte Schönau. „Wie ist er denn aber gerade diesmal auf Rodeck verfallen, auf das kleine Waldnest, das weder Raum noch Bequemlichkeit bietet?“
Stadinger zuckte die Achseln.
„Das weiß der Himmel! Bei unserer jungen Durchlaucht darf man ja nie nach dem Warum fragen. Eines Morgens kam die Nachricht, und nun hieß es Hals über Kopf das Schloß instand setzen, so gut oder schlecht das eben ging. Ich habe Noth und Mühe genug gehabt, um in zwei Tagen fertig zu werden.“
„Das glaube ich, Rodeck ist ja seit Jahren nicht bewohnt worden, aber auf diese Weise kommt doch wieder einmal etwas Leben in das alte Gemäuer.“
„Aber dabei wird das alte Gemäuer vollständig auf den Kopf gestellt,“ brummte der Schloßverwalter. „Wenn Sie nur wüßten. wie es bei uns aussieht, Herr Oberforstmeister! Der ganze Jagdsaal ist vollgepfropft mit Löwen- und Tigerfellen und allerhand ausgestopftem Gethier und die lebendigen Affen und Papageien sitzen in allen Zimmern herum. Das ist ein Fratzenschneiden und ein Lärm, daß man oft sein eigenes Wort nicht hört. Und nun hat mir Durchlaucht noch angekündigt, daß auch ein ganzer Trupp Elefanten und eine große Seeschlange unterwegs seien. Ich denke, mich soll der Schlag treffen.“
„Was ist unterwegs?“ fragte Schönau, der nicht recht gehört zu haben glaubte.
„Eine Seeschlange und ein Dutzend Elefanten! Ich habe mich dagegen gewehrt mit Händen und Füßen. ‚Durchlaucht,‘ habe ich gesagt, ‚noch mehr von dem Gethier können wir nicht unterbringen, vor allem die Seeschlange nicht, denn solch ein Vieh braucht doch Wasser, und wir haben keinen Teich in Rodeck. Und was die Elefanten betrifft, so müßten wir sie gerade im Walde an die Bäume binden, sonst weiß ich keinen Rath.‘ ‚Gut,‘ sagte Durchlaucht, ‚dann binden wir sie an die Bäume, das wird sich sehr malerisch ausnehmen, und die Seeschlange geben wir einstweilen in Fürstenstein in Pension, der Schloßweiher ist groß genug!‘ Ich bitte Sie, Herr Oberforstmeister, er will die ganze Nachbarschaft mit den Ungethümen bevölkern!“
Der Oberforstmeister lachte laut auf und klopfte dem Alten, der sich seiner besonderen Gunst zu erfreuen schien, auf die Schulter.
„Aber Stadinger, haben Sie denn das wirklich für Ernst genommen? Sie kennen doch Ihren Prinzen! Er scheint allerdings nicht viel gesetzter zurückgekommen zu sein, als er fortgegangen ist.“
„Nein, wahrhaftig nicht!“ seufzte Stadinger. „Und was Durchlaucht nicht weiß, das heckt der Herr Rojanow aus. Der treibt es noch zehnmal ärger. Daß uns auch gerade ein solcher Tollkopf in das Haus fallen mußte!“
„Rojanow? Wer ist das?“ fragte Schönau, aufmerksam werdend.
„Ja, das weiß man eigentlich nicht recht, aber bei uns ist er so ziemlich alles, denn Durchlaucht kann nicht leben ohne ihn. Er hat diesen ‚Freund‘ irgendwo da hinten in den heidnischen Ländern aufgegriffen, es wird wohl selbst ein halber Heide oder Türke sein, er sieht ganz danach aus, mit seinem dunklen Gesicht und seinen schwarzen Feueraugen. Und das Kommandiren versteht er aus dem Grunde, er jagt oft die ganze Dienerschaft durcheinander mit seinen Befehlen und thut, als wäre er Herr und Meister in Rodeck. Aber bildhübsch ist er, fast noch hübscher als unser Prinz, und der hat strenge Anweisung gegeben, seinem Freunde in allen Stücken zu gehorchen wie ihm selber.“
„Vermuthlich irgend ein Abenteurer, der den jungen Fürsten ausbeutet, ich kann es mir denken,“ murmelte Schönau und laut setzte er hinzu: „Nun Gott befohlen, Stadinger, ich muß jetzt meinen Schwager begrüßen, und wegen der Seeschlange lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen. Wenn Durchlaucht Ihnen wieder damit droht, so sagen Sie nur, ich würde ihr mit Vergnügen den Fürstensteiner Weiher anbieten, aber erst müßte ich sie leibhaftig vor mir sehen!“
Er winkte lachend dem alten Verwalter zu, der sehr getröstet aussah, und schritt nach dem Eingangsthor. Inzwischen war auch Frau von Eschenhagen mit ihrer Nichte erschienen. und jetzt wurde auf dem breiten Waldwege des Schloßberges der Wagen sichtbar, der wenige Minuten später im Schloßhofe vorfuhr.
Regine war die erste bei der Begrüßung; sie drückte und schüttelte ihrem Bruder so herzhaft die Hand, daß er mit einem leisen Aufzucken die seinige zurückzog. Der Oberforstmeister war [72] etwas zurückhaltender, er hegte eine gewisse Scheu vor seinem diplomatischen Schwager, dessen Sarkasmen er im geheimen fürchtete, während Toni sich weder durch den Onkel Excellenz nach durch dessen Gemahlin aus ihrer Gelassenheit bringen ließ.
An Herbert von Wallmoden waren die Jahre nicht so spurlos vorübergegangen wie an seiner Schwester. Er hatte recht gealtert, sein Haar war völlig ergraut und der sarkastische Zug um die schmalen Lippen hatte sich vertieft. Sonst aber war er ganz der kühle, vornehme Diplomat geblieben, vielleicht noch um einige Grade kälter und zurückhaltender als früher. Mit der hohen Stellung, die er gegenwärtig einnahm, schien auch die Ueberlegenheit gewachsen zu sein, die er von jeher gegen seine Umgebung gezeigt hatte.
Die junge Frau an seiner Seite wäre allerdings von jedem Fremden für die Tochter des Gesandten gehalten worden. Jedenfalls hatte dieser bei seiner Wahl Geschmack bewiesen. Adelheid von Wallmoden war in der That schön, freilich von jener kühlen, ernsten Schönheit, die auch nur kühle Bewunderung zu erwecken pflegt, aber sie schien der Lebensstellung, die diese Ehe ihr gab, in jeder Hinsicht gewachsen zu sein. Die kaum neunzehnjährige Frau, die erst seit sechs Monaten vermählt war, zeigte eine so vollendete Sicherheit des Benehmens, eine so unbedingte Beherrschung aller Formen, als habe sie bereits ein halbes Menschenalter an der Seite des alternden Gemahls gelebt.
Wallmoden war seiner jungen Gattin gegenüber die Artigkeit und Aufmerksamkeit selbst. Er bot ihr auch jetzt den Arm, um sie nach ihrem Zimmer zu führen, er selbst aber kehrte schon nach Verlauf von einigen Minuten zurück, um seine Schwester aufzusuchen, die ihn auf der Terrasse erwartete.
Das Verhältniß zwischen den beiden Geschwistern war in mancher Hinsicht ein eigenthümliches. Sie waren die schroffsten Gegensätze in der äußeren Erscheinung wie im Charakter und auch gewöhnlich verschiedener Meinung, aber die Blutsverwandtschaft gab ihnen trotzdem das Gefühl engster Zusammengehörigkeit. Das zeigte sich jetzt, wo sie nach langer Trennung wieder beieinander saßen.
Herbert wurde zwar wieder etwas nervös bei diesem Gespräche, denn Regine fand es nicht für gut, ihre derbe Art zu mäßigen, und setzte ihn mehr als einmal in Verlegenheit mit ihren rücksichtslosen Fragen und Bemerkungen, aber er hatte längst gelernt, das als unvermeidlich hinzunehmen, und ergab sich auch jetzt mit einem Seufzer darein.
Man sprach zunächst von der bevorstehenden Verlobung Willibalds und Tonis, die Wallmoden vollständig billigte. Er fand die Partie gleichfalls sehr passend, und man war ja auch in der Familie längst einig darüber. Jetzt aber schlug Frau von Eschenhagen ein anderes Thema an.
„Nun, wie fühlst Du Dich denn eigentlich als Ehemann, Herbert?“ fragte sie. „Du hast Dir allerdings Zeit gelassen, aber besser spät als gar nicht, und im Grunde hast Du mit Deinen grauen Haaren doch noch ein unverschämtes Glück gemacht.“
Dem Gesandten schien diese Anspielung auf seine Jahre nicht gerade angenehm zu sein, er preßte einen Augenblick die schmalen Lippen zusammen und entgegnete dann mit einiger Schärfe:
„Du könntest wirklich in Deinen Ausdrücken etwas taktvoller sein, liebe Regine! Ich kenne mein Alter sehr genau, aber die Lebensstellung, die ich meiner Braut als Morgengabe brachte, dürfte den Unterschied der Jahre doch einigermaßen ausgleichen.“
„Nun, ich dächte, die Mitgift, die sie Dir zubrachte, wäre auch nicht zu verachten!“ meinte Regine, ganz unbekümmert um die Zurechtweisung. „Hast Du Deine Frau schon bei Hofe vorgestellt?“
„Erst vor vierzehn Tagen in der Sommerresidenz. Die Trauer um meinen Schwiegervater legte uns ja bisher noch Zurückgezogenheit auf, im Winter werden wir allerdings ein Haus machen, wie meine Stellung es erfordert. Uebrigens war ich aufs angenehmste überrascht von der Art, wie Adelheid sich bei Hofe einführte. Sie bewegte sich auf dem ihr völlig fremden Boden mit einer Ruhe und Sicherheit, die geradezu bewundernswerth war. Ich habe da wieder von neuem eingesehen, wie glücklich meine Wahl in jeder Hinsicht gewesen ist. – Doch ich wollte Dich ja nach verschiedenen Dingen aus der Heimath fragen. Vor allem, wie geht es Falkenried?“
„Nun, das brauchst Du doch nicht erst von mir zu hören, Ihr schreibt Euch ja regelmäßig!“
„Ja, aber seine Briefe werden immer kürzer und einsilbiger. Ich habe ihm meine Vermählung ausführlich gemeldet, aber nur einen sehr lakonischen Glückwunsch erhalten. Du mußt ihn doch häufig sehen, seit er in das Kriegsministerium berufen ist, die Stadt ist ja nahe genug.“
Ueber Regines eben noch so helle Züge glitt ein Schatten und sie schüttelte leise den Kopf.
„Da bist Du im Irrthum, der Oberst läßt sich kaum mehr in Burgsdorf sehen, er wird immer starrer und unzugänglicher.“
„Das weiß ich leider, aber mit Dir pflegte er sonst immer eine Ausnahme zu machen, und ich hoffte viel von Deinem Einfluß, seit er wieder in Eurer Nähe weilt. Hast Du es denn nicht versucht, die alten Beziehungen wieder herzustellen?“
„Im Anfange wohl, aber ich habe es schließlich aufgegeben, denn ich sah, daß sie ihm lästig waren. Da ist nichts zu machen, Herbert! Seit der unglücklichen Katastrophe, die wir beide miterlebten, ist der Mann wie zu Stein geworden. Du hast ihn ja einige Male wiedergesehen seitdem und weißt, was da alles zu Grunde gegangen ist.“
Wallmodens Stirn hatte sich gleichfalls umwölkt und seine Stimme gewann einen herben Klang, als er erwiderte: „Ja, der Bube, der Hartmut hat ihn auf dem Gewissen! Aber jetzt liegen doch mehr als zehn Jahre dazwischen und ich hoffte, Falkenried würde sich allmählich dem Leben wieder zuwenden.“
„Ich habe es nie gehofft,“ sagte Frau von Eschenhagen ernst. „Der Streich ist an die Wurzel gegangen! Ich werde ihn mein lebelang nicht vergessen, den unglückseligen Abend in Burgsdorf, wo wir warteten und warteten, erst mit Unruhe und Sorge, dann mit Todesangst. Du erriethest gleich die Wahrheit, aber ich wollte sie nicht aufkommen lassen, und nun vollends Falkenried! Ich sehe ihn noch, wie er am Fenster stand und in die Nacht hinausstarrte, bleich wie ein Todter, mit zusammengebissenen Zähnen, und auf jede Befürchtung und Vermuthung nur die eine Antwort hatte: ‚Er kommt! Er muß kommen! Ich habe sein Wort!‘ Und als Hartmut trotz alledem nicht kam, als die Nacht hereinbrach und wir endlich auf unsere Anfrage bei der Bahnstation erfuhren, daß die beiden im Wagen angekommen und dann mit dem Kurierzuge davongejagt seien – Gott im Himmel, wie sah der Mann aus, als er sich so stumm und starr zum Gehen wandte! Ich nahm Dir das Versprechen ab, ihm nicht von der Seite zu gehen, denn ich glaubte, er würde sich eine Kugel vor den Kopf schießen.“
„Da hast Du ihn falsch beurtheilt,“ sagte Wallmoden mit voller Bestimmtheit. „Ein Mann wie Falkenried hält es für Feigheit, Hand an sich zu legen, selbst wenn ihm das Leben zur Folter wird. Er hält aus, auch auf dem verlorenen Posten. Was freilich geschehen wäre, wenn man ihn damals wirklich hätte gehen lassen, das wage ich nicht zu entscheiden.“
„Ich weiß, er forderte seinen Abschied, weil es sich mit seinen Ehrbegriffen nicht vertrug, weiter zu dienen, nachdem sein Sohn zum Deserteur geworden war. Es war ein Verzweiflungsschritt.“
„Ja wohl, und es war ein Glück, daß man eine militärische Kraft wie die seinige nicht entbehren konnte und wollte. Der Chef des Generalstabes nahm sich ja persönlich der Sache an und brachte sie vor den König, und man kam schließlich überein, den ganzen unseligen Vorfall, wenigstens so weit er für den Vater hätte Folgen haben können, als einen unsinnigen Knabenstreich zu behandeln, dem ein hochverdienter Offizier nicht zum Opfer fallen dürfe. Falkenried mußte sein Gesuch zurücknehmen, wurde in die ferne Garnison versetzt und die Sache selbst möglichst todtgeschwiegen. Jetzt, nach zehn Jahren, ist sie ja auch in der That begraben und vergessen von aller Welt.“
„Nur von einem nicht,“ ergänzte Regine. „Mir wendet sich oft das Herz im Leibe um, wenn ich denke, was Falkenried einst war und was er jetzt ist. Die bitteren Erfahrungen seiner Ehe hatten ihn wohl ernst und ungesellig gemacht, aber in guten Stunden brach es doch wieder so warm und herzlich aus seinem Innern hervor, da war er so ganz der Alte, mit der vollen Liebenswürdigkeit seines Wesens. Jetzt ist das alles vorbei, jetzt kennt er nur noch starres eisernes Pflichtgefühl, alles andere ist todt und erstorben. Sogar die alten Freundschaftsbeziehungen sind ihm peinlich geworden – man muß ihn seinen Weg gehen lassen!“
[73]
[74] Sie brach ab mit einem Seufzer, der verrieth, wie nahe ihr das Geschick des einstigen Jugendfreundes ging, und die Hand auf den Arm ihres Bruders legend, schloß sie:
„Vielleicht hast Du recht, Herbert, man wählt in späteren Jahren am besten und vernünftigsten. Du hast das Schicksal Falkenrieds nicht zu fürchten, Deine Frau stammt aus einer guten Art. Ich habe Stahlberg ja auch gekannt, er hat sich mit Ernst und Tüchtigkeit zu den Höhen des Lebens emporgearbeitet und ist auch als Millionär der Ehrenmann geblieben, der er von jeher war, und Adelheid ist in jedem Zuge die Tochter ihres Vaters. Du hast Dich besser vorgesehen, und ich gönne Dir Dein Glück von Herzen.“
Das Jagdschlößchen Rodeck, das zu den fürstlich Adelsbergschen
Besitzungen gehörte, lag etwa zwei Stunden von Fürstenstein
entfernt, mitten in tiefster Waldeseinsamkeit. Das kleine,
ziemlich geschmacklose Gebäude enthielt höchstens ein Dutzend
Zimmer, deren veraltete und verblichene Einrichtung man jetzt, so
gut es in der Eile gehen wollte, in stand gesetzt hatte. Das
Schlößchen war seit Jahren nicht benutzt worden und sah auch
etwas vernachlässigt aus, aber wenn man aus dem tiefen dunklen
Forst in die Lichtung heraustrat und am Ende des weiten grünen
Rasenplatzes das alte graue Gemäuer mit seinem hohen spitzen
Ziegeldach und den vier Thürmchen an den Ecken erblickte, hatte
es doch etwas von einer Waldidylle an sich.
Die Adelsberg waren ein ehemals reichsfürstliches Geschlecht, das allerdings schon längst seine Souveränität verloren hatte, dem aber mit dem Fürstentitel auch ein riesiges Vermögen und ein sehr bedeutender Grundbesitz verblieben war. Die einst weit verzweigte Familie zählte gegenwärtig nur noch wenige Vertreter, die Hauptlinie nur einen einzigen, den Fürsten Egon, der als Herr der sämmtlichen Familiengüter und überdies durch seine verstorbene Mutter mit dem regierenden Hause nahe verwandt unter dem Adel des Landes die erste Rolle spielte.
Der junge Prinz hatte von jeher für einen Wildfang gegolten, der bisweilen sehr excentrischen Neigungen huldigte und sehr wenig nach der fürstlichen Etikette fragte, wenn es galt, irgend einer augenblicklichen Laune zu folgen. Der alte Fürst hatte seinen Sohn allerdings ziemlich scharf im Zügel gehalten, aber sein Tod machte Egon von Adelsberg verhältnißmäßig sehr früh zum unumschränken Herrn seines Willens.
Er kehrte jetzt eben von einer Orientreise zurück, die ihn fast zwei Jahre lang fern gehalten hatte, aber anstatt das fürstliche Palais in der Stadt oder eins seiner anderen Schlösser zu beziehen, die für einen Sommer- und Herbstaufenthalt mit aller nur erdenklichen Pracht eingerichtet waren, hatte er den Einfall, das alte Waldnest, das kleine, halb vergessene Rodeck aufzusuchen, das gar nicht auf die Ehre vorbereitet war, den Herrn aufzunehmen, und auch nur eine nothdürftige Unterkunft bieten konnte. Der alte Stadinger hatte recht, man durfte bei dem Prinzen Egon nie nach dem Warum fragen, es hing da alles von der augenblicklichen Laune ab.
Es war in den Vormittagsstunden eines sonnigen Herbsttages. Auf dem Rasenplatze standen zwei Herren im Jagdanzuge und sprachen mit dem Schloßverwalter, während ein leichter, offener Wagen drüben auf dem Kieswege zur Abfahrt bereit stand.
Die beiden jungen Männer hatten auf den ersten Blick eine gewisse Aehnlichkeit miteinander. Es waren hochgewachsene, schlanke Gestalten, mit tiefgebräunten Gesichtern und Augen, in denen der ganze feurige Uebermuth der Jugend blitzte; aber bei näherer Betrachtung zeigte es sich doch, wie unendlich verschieden die beiden waren.
Bei dem Jüngeren, der etwa vierundzwanzig Jahre alt sein mochte, entstammte diese südliche Färbung offenbar nur dem längeren Aufenthalt unter einer heißeren Sonne, denn das krause blonde Haar und die blauen Augen paßten nicht dazu, sie verriethen den Deutschen. Ein leichter blonder Bart, kraus wie das Haar, umgab ein hübsches, offenes Gesicht, das allerdings nicht den strengen Formen der Schönheit entsprach. Die Stirn war etwas zu niedrig, die Linien nicht regelmüßig genug, aber es lag etwas in diesem Antlitz, das wie heller Sonnenschein jeden anmuthete und jeden gewann.
Sein Gefährte, der um einige Jahre älter war, hatte nun freilich nichts von diesem Sonnenschein, aber seine Erscheinung war entschieden die bedeutendere. Schlank wie der jüngere, überragte er diesen doch an Größe, und die dunkle Hautfarbe hatte bei ihm wohl nicht allein der Sonnenbrand geschaffen. Es war jenes matte Braun, das selbst ein lebensfrisches Gesicht bleich erscheinen läßt, und das bläulich schwarze Haar, das in dichten Wellen auf die hohe Stirn fiel, ließ diese anscheinende Blässe noch mehr hervortreten. Schön war dies Antlitz wohl mit seinen edlen, stolzen Linien, die sich so fest und energisch ausprägten, aber mit ihnen traten auch die tiefen Schatten hervor, die auf der Stirn und in den Augen lagen, Schatten, wie man sie selten in so jugendlichen Zügen findet. Die großen dunklen Augen, die etwas Düsteres hatten, sprachen von heißer, ungezügelter Leidenschaft, es loderte ein Feuer darin, das zugleich unheimlich und räthselhaft anziehend war. Man fühlte es, daß sie mit dämonischer Gewalt bestricken konnten, und die ganze Persönlichkeit des Mannes hatte etwas von diesem unheimlich fesselnden Zauber.
„Ja, ich kann Dir nicht helfen, Stadinger,“ sagte soeben der jüngere der beiden Herren, „die neue Sendung muß ausgepackt und untergebracht werden, wo – das ist Deine Sache.“
„Aber Durchlaucht, wenn es doch absolut nicht möglich ist!“ widersprach der Schloßverwalter in einem Tone, der verrieth, daß er auf ziemlich vertrautem Fuße mit seinem jungen Herrn stand. „In Rodeck ist kein Winkelchen mehr frei, ich habe schon Mühe genug gehabt, die Dienerschaft unterzubringen, die Durchlaucht mitbrachten, und nun kommen alle Tage Kisten an, groß wie die Häuser, und immer heißt es: ‚Packe aus, Stadinger! Schaffe Platz, Stadinger!‘ Und dabei stehen in den andern Schlössern die Zimmer dutzendweise leer –“
„Brumme nicht, alter Waldgeist, sondern schaffe Platz!“ unterbrach ihn der junge Fürst. „Die Sendungen werden hier in Rodeck aufgestellt, wenigstens vorläufig, und im schlimmsten Falle mußt Du Deine eigene Wohnung hergeben.“
„Ja wohl, Stadinger hat Raum genug in seiner Wohnung,“ mischte sich jetzt der zweite Herr ein. „Ich werde das selbst anordnen und ausmessen.“
„Die Zenz kann ihm ja dabei helfen,“ unterstützte der Fürst den Vorschlag seines Genossen. „Sie ist doch daheim?“
Stadinger sah den Fragenden von oben bis unten an, dann antwortete er trocken.
„Nein, Durchlaucht, die Zenz ist fort.“
„Fort?“ fuhr der Fürst auf. „Wo ist sie denn?“
„In der Stadt,“ lautete die lakonische Antwort.
„Was? Du wolltest Dein Enkelkind ja den ganzen Winter hier in Rodeck behalten!“
„Das hat sich geändert,“ versetzte der Schloßverwalter mit unerschütterlicher Ruhe. „Jetzt ist nur noch meine Schwester, die alte Resi, daheim; wenn Sie mit der die Wohnung ausmessen wollen, Herr Rojanow – es wird ihr eine große Ehre sein!“
Rojanow warf dem Alten einen nichts weniger als freundschaftlichen Blick zu, der junge Fürst aber sagte strafend:
„Höre, Stadinger, Du behandelst uns in einer ganz unverantwortlichen Weise. Jetzt nimmst Du uns sogar die Zenz fort, die einzige, die noch des Anschauens werth war. Was sonst von Weiblichkeit in Rodeck vorhanden ist, hat bereits die Sechzig hinter sich und wackelt mit den Köpfen, und die Küchendamen, die Du Dir zur Aushilfe von Fürstenstein hast kommen lassen, beleidigen nun vollends unseren Schönheitssinn.“
„Durchlaucht brauchen sie ja nicht anzuschauen,“ meinte Stadinger. „Ich sorge schon dafür, daß die Mägde nicht in das Schloß kommen, aber wenn Durchlaucht selbst in die Küche gehen wie vorgestern –“
„Nun, ich muß doch meine Dienerschaft bisweilen inspiciren! Uebrigens gehe ich nicht zum zweitenmal in die Küche, dafür hast Du gesorgt. Ich habe Dich im Verdacht, daß Du die sämmtlichen Häßlichkeiten des ‚Waldes‘ zur Feier meiner Ankunft hier versammelt hast, Du solltest Dich schämen, Stadinger.“
Der Alte sah seinem Herrn fest und scharf in die Augen und seine Stimme hatte einen sehr nachdrücklichen Klang, als er antwortete:
„Ich schäme mich gar nicht, Durchlaucht. Als der hochselige Fürst, Ihr Herr Vater, mir den Ruheposten hier gab, sagte er zu mir: ‚Halte Ordnung in Rodeck, Stadinger, ich verlasse mich auf Dich!‘ Nun, ich habe Ordnung gehalten, zwölf Jahre lang, im Schlosse und in meinem Hause erst recht, und das werde ich [75] auch in Zukunft thun. – Haben Durchlaucht sonst noch Befehle für mich?“
„Nein, Du alter Grobian!“ rief der junge Fürst, halb lachend, halb ärgerlich. „Mach’, daß Du fortkommst, wir brauchen keine Moralpredigten.“
Stadinger gehorchte, er grüßte und marschirte ab. Rojanow blickte ihm nach und zuckte spöttisch die Achseln.
„Ich bewundere Deine Langmuth, Egon, Du gestattest Deinem Diener wirklich eine sehr weitgehende Freiheit.“
„Ja, der Stadinger ist eine Ausnahme,“ erklärte Egon. „Der erlaubt sich schließlich alles und übrigens hat er gar nicht so unrecht, wenn er die Zenz fortschickt, ich glaube, ich hätte es an seiner Stelle auch gethan.“
„Es ist aber nicht das erste Mal, daß dieser alte Schloßverwalter sich herausnimmt, Dich und mich förmlich zurechtzuweisen. Wenn ich sein Herr wäre – er hätte in der nächsten Stunde seine Entlassung.“
„Das sollte ich einmal probiren, das würde mir übel bekommen!“ lachte der junge Fürst. „Solch ein altes Familienerbstück, das schon der dritten Generation dient und einen als Kind auf den Armen getragen hat, will mit Hochachtung behandelt sein. Mit Befehlen und Verbieten richte ich da gar nichts aus, Peter Stadinger thut doch, was er will, und liest mir auch gelegentlich den Text, wenn es ihm gerade einfällt.“
„Wenn Du es Dir gefallen läßt – mir ist so etwas unbegreiflich.“
„Das kannst Du auch nicht begreifen, Hartmut,“ sagte Egon ernster. „Du kennst nur die sklavische Unterwürfigkeit der Diener in Deiner Heimath und im Orient. Das kniet und beugt sich bei jeder Gelegenheit und bestiehlt und betrügt seinen Herrn, wo es nur weiß und kann. Stadinger ist von einer beneidenswerthen Grobheit, meine Durchlauchtigkeit schüchtert ihn nicht im mindesten ein, er sagt mir oft die ärgsten Dinge ins Gesicht, aber ich könnte Hunderttausende in seine Hände legen, es würde kein Pfennig davon veruntreut, und wenn Rodeck in Flammen stände und ich wäre drinnen, der Alte, mit seinen siebzig Jahren, ginge ohne sich zu besinnen mitten in das Feuer hinein – bei uns in Deutschland ist das eben anders.“
„Ja, bei Euch in Deutschland!“ wiederholte Hartmut langsam, und dabei verlor sich sein Blick träumerisch in das Waldesdunkel.
„Bist Du noch immer so dagegen eingenommen?“ fragte Egon. „Es hat mich Ueberredung und Bitten genug gekostet, Dich zu bewegen, daß Du mir folgtest, Du wolltest ja durchaus den deutschen Boden nicht wieder betreten.“
„Ich wollte auch, ich hätte es nicht gethan!“ sagte Rojanow finster. „Du weißt –“
„Daß hier allerlei bittere Erinnerungen für Dich wurzeln – ja, das hast Du mir gesagt, aber Du mußt doch damals noch ein Knabe gewesen sein, hast Du den alten Groll noch nicht überwunden? Du bist überhaupt in diesem Punkte von einer hartnäckigen Verschlossenheit, ich habe noch bis heute nicht erfahren, was es eigentlich gewesen ist, das Dich –“
„Egon, ich bitte Dich, laß das!“ fiel ihm Hartmut schroff ins Wort. „Ich habe Dir ein für allemal erklärt, daß ich Dir darüber nicht Rede stehen kann und will. Wenn Du mir mißtraust, so laß mich gehen, ich habe mich Dir nicht aufgedrängt, das weißt Du, aber dies Fragen und Forschen ertrage ich nun einmal nicht.“
Der stolze, rücksichtslose Ton, den er dem fürstlichen Freunde gegenüber anschlug, schien diesem nichts Neues zu sein, er zuckte nur die Achseln und sagte beschwichtigend:
„Wie gereizt Du wieder bist! Ich glaube, Du hast recht, wenn Du behauptest, die deutsche Luft mache Dich nervös, Du bist wie verwandelt, seit Du den Fuß auf diesen Boden gesetzt hast.“
„Möglich! Ich fühle es ja selbst, daß ich Dich und mich quäle mit diesen Stimmungen, darum laß mich fort, Egon!“
„Ich werde mich hüten! Habe ich Dich darum mit so vieler Mühe eingefangen, um Dich nun wieder fliegen zu lassen? Daraus wird nichts, Hartmut, ich lasse Dich um keinen Preis los.“
Die Worte klangen scherzhaft, aber Rojanow schien sie übel zu nehmen, seine Augen blitzten fast drohend auf, als er erwiderte:
„Und wenn ich nun fort will?“
„Dann halte ich Dich so fest“ – Egon legte mit einem unendlich liebenswürdigen Ausdruck den Arm um die Schulter des Freundes – „und frage, ob dieser schlimme, starrsinnige Hartmut es verantworten kann, mich allein zu lassen. Fast zwei Jahre lang haben wir zusammen gelebt und Gefahr und Genuß getheilt wie zwei Brüder, und jetzt willst Du wieder in die Welt hinausstürmen, ohne nach mir zu fragen? Gelte ich Dir so wenig?“
Es lag eine so warme, herzliche Bitte in den Worten, daß Rojanows Gereiztheit davor nicht standhielt. Seine Augen leuchteten auf mit einem Ausdruck, der verrieth, daß er die leidenschaftlich schwärmerische Neigung, die der junge Fürst ihm entgegen trug, ebenso leidenschaftlich erwiderte, wenn er auch in ihrem beiderseitigen Verhältnisse unbedingt der Herrschende war.
„Glaubst Du, daß ich einem anderen zuliebe nach Deutschland gegangen wäre?“ fragte er leise. „Vergieb, Egon! Ich bin nun einmal eine unstete Natur, ich habe es nirgends lange ausgehalten an einem Orte, seit – seit meinen Knabenjahren.“
„So lerne es hier in meiner Heimath!“ fiel Egon ein. „Ich bin eigens nach Rodeck gegangen, um sie Dir in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen. Dieses alte Gemäuer, das sich so mitten im tiefen Forst eingenistet hat wie ein Märchenschloß, ist ein Stück Waldpoesie, wie Du sie bei keinem meiner anderen Schlösser findest, ich kenne Deinen Geschmack. – Aber jetzt muß ich wirklich fort! Du fährst also nicht mit nach Fürstenstein?“
„Nein, ich will Deine vielgepriesene Waldpoesie genießen, die Dir bereits langweilig zu sein scheint, da Du Besuche machen willst.“
„Ja, ich bin kein Poet wie Du, der den ganzen Tag schwärmen und träumen kann,“ sagte Egon lachend. „Wir haben ja eine volle Woche lang ein wahres Einsiedlerdasein geführt, aber nur von Sonnenschein und Waldesduft und den Moralpredigten Stadingers allein kann ich nicht leben. Ich brauche Menschen, und der Oberforstmeister ist so ziemlich der einzige Umgang, den wir in der Nähe haben. Uebrigens ist dieser Herr von Schönau ein prächtiger, jovialer Mann, Du wirst ihn auch noch kennen lernen.“
Er rief durch einen Wink den harrenden Wagen herbei, reichte seinem Freunde die Hand und stieg ein. Rojanow blickte ihm nach, bis das Gefährt hinter den Bäumen verschwunden war, dann wandte er sich um und schlug einen der Wege ein, die in den Forst führten.
Er trug die Flinte über der Schulter, dachte aber augenscheinlich nicht an Jagen und Schießen, sondern schritt, wie in Gedanken verloren, immer weiter und weiter, planlos, ohne auf den Weg und die Richtung zu achten, bis ihn ringsum die tiefste Einsamkeit umgab.
Fürst Adelsberg hatte recht, er kannte den Geschmack seines Freundes. Diese Waldpoesie mit ihrem ganzen Zauber nahm ihn gefangen. Er war endlich stehen geblieben und athmete tief, tief auf, aber die Wolke auf seiner Stirn wollte nicht weichen, sie wurde nur düsterer, als er so an dem Stamme eines Baumes lehnte und die Augen umherschweifen ließ. Es lag etwas Friedloses und Freudloses in diesen schönen Zügen, das all die sonnige Schönheit ringsum nicht auszulöschen vermochte.
Er sah diese Gegend ja zum ersten Male; seine einstige Heimath lag weit entfernt, im Norden Deutschlands, hier erinnerte ihn nichts unmittelbar an die Vergangenheit und doch wachte gerade hier etwas auf, das längst erstorben zu sein schien, das sich nicht geregt hatte in all den Jahren, da er Länder und Meere durchmaß, da ihn die Wogen des Lebens umbrandeten und er in vollen, durstigen Zügen die Freiheit trank, der er so viel, der er alles geopfert hatte.
Die alten deutschen Wälder! Sie rauschten hier im Süden, wie dort im Norden, durch die Tannen und Eichen wehte derselbe Hauch, der dort in den Wipfeln der Föhren flüsterte, dieselbe Stimme, die einst dem Knaben so vertraut gewesen war, wenn er auf dem moosigen Waldboden lag. Er hatte so viele andere Stimmen seitdem gehört, lockend und schmeichelnd, berauschend und begeisternd, hier klang es so ernst und doch so süß aus dem Waldesrauschen – die Heimath sprach darin zu dem verlorenen Sohne!
Da regte sich etwas drüben im Gebüsche. Hartmut blickte gleichgültig auf, in der Meinung, daß irgend ein Wild dort vorüberstreife, aber statt dessen sah er deutlich ein helles Gewand durch die Zweige schimmern; auf einem schmalen Seitenpfad, der sich in Windungen durch den Forst zog, trat ihm eine Dame entgegen [76] und blieb dann stehen, augenscheinlich ungewiß über den Weg und die Richtung, die sie einschlagen sollte.
Rojanow war aufgefahren, die unerwartete Begegnung weckte ihn jäh aus seinen Träumereien und rief ihn in die Wirklichkeit zurück, aber auch die Fremde hatte ihn bemerkt. Sie schien gleichfalls überrascht, doch nur einen Augenblick lang, dann trat sie näher und sagte mit einem leichten Gruße:
„Darf ich Sie bitten, mein Herr, mir den Weg nach Fürstenstein zu zeigen? Ich bin fremd hier und habe mich auf einem Spaziergange verirrt. Ich fürchte, ziemlich weit von meinem Ziele abgekommen zu sein.“
Hartmut hatte mit einem raschen Blick die Erscheinung der jungen Dame gestreift und war sofort entschlossen, die Führung zu übernehmen. Er kannte zwar den Weg, nach welchem sie gefragt hatte, nicht und wußte nur ungefähr die Richtung, in welcher das Schloß lag, aber das kümmerte ihn sehr wenig, er machte eine ritterlich artige Verbeugung.
„Ich stelle mich Ihnen ganz zur Verfügung, mein gnädiges Fräulein. Fürstenstein ist allerdings ziemlich weit entfernt und Sie können den Weg unmöglich allein finden, ich muß Sie deshalb schon bitten, meine Begleitung anzunehmen.“
Die Dame hatte wohl darauf gerechnet, daß man ihr den Weg einfach bezeichnen werde, die angebotene Begleitung schien ihr nicht gerade willkommen zu sein, aber sie mochte fürchten, sich ein zweites Mal zu verirren, und die vollendete Artigkeit, mit welcher das Anerbieten gemacht wurde, ließ ihr auch kaum eine Wahl. Nach einem augenblicklichen Zögern neigte sie flüchtig das Haupt und erwiderte:
„Ich werde Ihnen dankbar sein. Also bitte, gehen wir!“
Als bei Sedan die Kanonen donnerten und deutsche Tapferkeit Frankreich zu Boden warf, da blühte auf dem blutigen Schlachtfelde in einem Gärtlein, dessen Zierde längst von den Hufen der Rosse zertreten war, eine einsame weiße Rose. Ein schmucker preußischer Jägersmann, dem der blauen Bohnen an dem Tage schon viele um den Kopf geflogen waren, entdeckte die Blume und pflückte sie. Er legte sie in seine Brieftasche und dachte ihrer erst wieder am Abend, als der große Sieg errungen war. Die Rose vom Schlachtfeld von Sedan! Wem sollte er sie schicken? Er hatte weder Mutter, noch Schwester, noch Braut; da gedachte er der Frauen, die seit dem Ausbruch des Krieges pflegend, helfend und tröstend um die wunden Helden sich bemüht hatten, und rasch entschlossen sandte er die bleiche Blume an den Magistrat von Berlin, mit der Bitte, sie derjenigen Frau zu überreichen, die sich in der Pflege und Sorge für die Verwundeten am meisten hervorgethan habe. Der Magistrat von Berlin berieth nicht lange, für ihn lag’s klar zu Tage, wer die Rose verdient habe. Er überreichte sie der Königin, die sie freilich in edler Bescheidenheit zurückwies und im Betsaale des großen Barackenlazareths auf dem Tempelhofer Felde unter Glas und Rahmen aufhängen ließ. Aber der Magistrat von Berlin war im Recht: während König Wilhelm draußen im Felde seine Mannen zu Sieg und Ehre führte, hatte seine Gemahlin auch eine Fahne entrollt. In der flog freilich kein stolzer Adler auf, hob nicht dräuend ein Löwe die grimmigen Pranken, drohte kein trotziger Stier, es stand nichts darin als ein rothes Kreuz, und das Fahnentuch selbst war weiß. Das Wunderbarste aber war, daß dieser Fahne nicht nur Männer zueilten, sondern hauptsächlich Frauen vom jugendlichen Mädchen an bis zur betagten Greisin. Das Banner der Barmherzigkeit war’s, das die Königin entfaltet hatte. Dieses Banner in realer Gestalt mit dem eisernen Kreuze über das ganze Fahnentuch und dem rothen Kreuz oben in der Ecke, das einzige in dieser Gestalt existirende, welches Kaiser Wilhelm I. seiner Gemahlin verliehen hatte, ließ Kaiser Wilhelm II. der Heimgegangenen auf den Sarg legen, als ihr höchstes Schmuckkleid neben dem Krönungsmantel der preußischen Königin.
Selten hat eine Frau ihre vor aller Welt erhöhte Stellung in so hohem Sinne aufzufassen verstanden wie diejenige, die nach dem Zusammenbruch des alten Deutschen Reiches zuerst wieder den stolzen Namen einer Deutschen Kaiserin führen durfte. Von dem Tage an, da sie am 30. September 1811 zu Weimar als jüngste Tochter des damaligen Erbprinzen Carl Friedrich und dessen Gemahlin Maria Pawlowna, einer russischen Großfürstin, das Licht der Welt erblickte, bis auf den andern, jenen 7. Januar 1890, an dem sie eingehen durfte zur ewigen Ruhe – welch ein groß Stück Erdenwegs, welch eine Wandlung der Zeiten und Gedanken, welch ein Arbeiten in Prüfung und Kampf!
Betrachtet man das Leben der Kaiserin genauer, so findet man, daß der Gedanke an Fürsorge für die Nothleidenden nicht plötzlich in ihr auftauchte, sondern daß er mit ihr aufwuchs und reifte. Sehr jung, am 11. Juni 1829, war sie die Gemahlin des damaligen Prinzen Wilhelm geworden, aber sie war noch kein Jahr in der neuen Heimath, als man schon von ihrer offenen Hand zu erzählen wußte. Nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. erhielt Prinz Wilhelm den Titel eines Prinzen von Preußen, er war der Nächste am Throne, mit ihm fühlte sich seine Gemahlin als die Nächste in den Pflichten dieser erhabenen Stellung. Wo es eine Sammlung galt zu wohlthätigen Zwecken, ein rasches Geben bei plötzlichen Unglücksfällen, da war die Prinzessin von Preußen die erste, die gab und die reichlich gab, oft über ihre Mittel. Oft mußte sie sich selbst einen Lieblingswunsch versagen, um nur geben zu können, wie ihr Herz es wünschte. Und wo die Mittel nicht zureichten, verkaufte sie von ihren Schmucksachen. Nicht selten scherzte der hochselige Kaiser mit ihr über, man kann sagen – ihre Passion des Gebens. Sie nahm die erstaunten Blicke ihrer Schwägerin, der Kaiserin von Rußland, über ihre bescheidene Toilette hin und tröstete sich mit ihrem guten Bewußtsein. Sonst trat die Prinzessin damals noch wenig in den Vordergrund; sie sammelte bedeutende Menschen um sich und leitete selbst die Erziehung ihrer Kinder, des Prinzen Friedrich Wilhelm, des nachmaligen Kaisers Friedrichs III., und der Prinzessin Luise, der späteren Großherzogin von Baden. Aber schon damals begann man von ihr als von einer bedeutenden Frau zu reden, welche unablässig an sich selbst arbeitete in immer gesteigertem Drange nach jener höchsten Ausprägung des Menschlichen, wofür ihr Goethe, dessen Augen über ihrer Jugend geleuchtet hatten, ein Vorbild war.
Lange Jahre weilte sie am Rheine – ihr Gemahl bekleidete damals den Posten eines Gouverneurs der Rheinlande – und dort war sie ohne Zweifel die volksthümlichste Persönlichkeit. Koblenz ward ihr Lieblingsaufenthalt, und bis in ihr letztes Lebensjahr kehrte sie gern dahin zurück. Sie wohnte dann in den Räumen des Residenzschlosses, dessen stolzer Bau sich auf unserer Abbildung links vom Rheine nahe der Brücke erhebt. Sie hatte dieses Schloß geradezu ein zweites Mal geschaffen, den Kurfürstensaal darin einrichten lassen – ein Museum der Geschichte des Rheinlandes. Auf ihre Veranlassung war der Garten vor ihrer Wohnung angelegt worden, auf ihre Kosten entstanden die Rheinanlagen. In Koblenz begann sie auch zuerst in Bezug auf barmherzige Liebe schöpferisch vorzugehen. Sie rief wohlthätige Anstalten ins Leben, gründete und beförderte Stiftungen. Größere Reisen, namentlich auch nach England, erweiterten ihren Blick, und wenig beachtete sie es, daß ihre von Haus aus zarte Gesundheit immer schwächer wurde.
Die große Verehrung, die man in weiten Kreisen für die Prinzessin von Preußen zu hegen begann, zeigte sich zuerst deutlich bei der Feier ihrer silbernen Hochzeit. Zahllose Beweise des Dankes wurden ihr zu Theil, und ihr treues Koblenz ließ zum Andenken an den festlichen Tag eine Münze schlagen. Wenige Jahre darauf – ihre Tochter war schon vermählt – führte ihr zärtlich geliebter Sohn die älteste Tochter der Königin von England heim. Dann aber traten jene Ereignisse ein, die Erkrankung und schließlich der Tod des Königs Friedrich Wilhelm IV., welche den Prinzen von Preußen auf den Thron seines Bruders führten, die Prinzessin zur Königin erhoben.
Die erste Zeit ihrer neuen Würde war nicht leicht für die Königin; man kam ihr in ihrer Residenz mehr mit Achtung als mit Liebe entgegen. Der lange Aufenthalt am Rheine hatte sie [77] den Berlinern entfremdet, aber festen Schrittes ging sie ihren Weg; sie vertraute darauf, daß sie ihres Volkes Herz gewinnen würde, und sie gewann es.
Am 18. Oktober 1861 setzte König Wilhelm in Königsberg die alte Preußenkrone auf das Haupt seiner Gemahlin, und auf einem Feste, das die Stadt dem neugekrönten Fürstenpaare gab, ward ein Lied gesungen, dessen Strophen in ihren Anfangsbuchstaben die Namen Wilhelm und Augusta bildeten. Die zweite Strophe lautete:
„Auch neig’ Du, Königin,
Unserem treuen Sinn
Gnädig Dich zu!
Und an des Königs Hand
Sei Mutter Deinem Land,
Thronend in Volkes Lieb
Augusta Du!“
Dieser Wunsch ist reich in Erfüllung gegangen. Ihre volle Kraft setzte die Königin an die Aufgabe, ihrem Lande eine rechte Mutter zu sein, und sie konnte dies bald beweisen, als im Januar 1864 der fünfzigjährige Friede, dessen Preußen sich zu erfreuen gehabt hatte, zum erstenmal wieder durch Krieg und Kriegsgeschrei unterbrochen wurde. Wohl blühten Preußens Lorbeeren aufs neue, aber der Lorbeer wächst nur unter Blut und Thränen, und sie zu stillen, das war die vornehmste Sorge der Königin.
Zwar zeigte sich gleich beim Ausbruch des Krieges die Barmherzigkeit in allen Schichten der Gesellschaft; aber es fehlte die einheitliche organisirende Leitung, die Stellung zur Armee war keine klare, so daß allerlei Unzuträglichkeiten sich ergaben. Die Königin hatte das erkannt, sie einte durch die Stiftung des preußischen Centralkomitees die verschiedenen Vereine und trat an die Spitze der gesammten deutschen Krankenpflege, in den Dienst des Rothen Kreuzes der Genfer Konvention, das jetzt mit einem Male von allen Lazarethen, von allen Arbeitsstuben der Barmherzigkeit wehte. Das wiederholte sich, mit stetigen Verbesserungen, in den entscheidungsreichen Sommertagen des Jahres 1866. In diesem Kriege erwies sich von neuem die hohe Bedeutung einer richtig geleiteten freiwilligen Krankenpflege.
Wie das Reich alle Zeit gerüstet sein muß, einem Angriff von außen zu begegnen, so muß auch die Liebe gerüstet sein für den Tag, da die Wunden und Kranken ihrer Hilfe begehren. Das war der Gedanke der Königin, und ihre Pläne gewannen Gestalt zuerst durch die Stiftung des „Vaterländischen Frauenvereins“ unmittelbar nach dem Kriege von 1866. Der Zweck dieses Vereins war, in Friedenszeiten sich bereit zu machen auf den Krieg, im Kriege ergänzend neben den militärischen Organen für Krankenpflege und neben den Männervereinen zu arbeiten, aber auch im Frieden bei schwerem Landesunglück helfend einzutreten. Dabei mußte in erster Linie die freiwillige Krankenpflege herangezogen werden. Auf den Antrieb der Königin ging man an die Bildung und Schulung von Krankenpflegerinnen, Handbücher für dieselben wurden auf ihr Geheiß von berühmten Aerzten verfaßt, und noch in jüngster Zeit hat sie einen hohen Preis auf die beste Herstellung eines beweglichen Feldlazareths ausgesetzt.
Als wirklicher Nothhelfer erwies sich der neue Verein zum ersten Male im Jahre 1868 bei dem großen Nothstand in Ostpreußen, der bis zum Hungertyphus führte. Die Königin selbst veranstaltete einen großen Bazar zum Besten der Nothleidenden im Berliner Schlosse.
Und dann kamen die unvergeßlichen Tage, da auf den französischen Schlachtfeldern die Blume der deutschen Einigkeit erblühte. König Wilhelm richtete den Orden vom Eisernen Kreuze wieder auf. Fürst Pleß ward an die Spitze der freiwilligen Krankenpflege gestellt. Das Oberkommando aber sozusagen übernahm die Königin. Auch sie bot ihren Heerbann auf: der Vaterländische Frauenverein ging zum ersten Male an seine eigentliche Aufgabe. Und während der Gemahl und der Sohn abermals in den Kampf zogen, begab sich die Königin wieder an ihr stilles, unermüdliches Wirken für die Verwundeten und Kranken. Das von ihr erbaute und eben fertig gewordene Augusta-Hospital wurde zur Aufnahme für Verwundete eingerichtet, unter ihrer besonderen Leitung stand eine Abtheilung des großen Barackenlazareths auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin, und oft ging die Kaiserin von einem Bett zum andern.
Ja, die Kaiserin! Denn das war sie geworden in diesem großen Jahr. Aber diese Kaiserin saß anspruchslos belm Gottesdienst draußen in den Baracken mitten unter den Soldaten, die ihrem Gemahl geholfen hatten, mit ihrem Blute seine Kaiserkrone zu schmieden. Sie saß auch in den Lazarethküchen auf harter Holzbank und kostete das Essen. Auf Frankreichs Fluren aber spielte deutsche Militärmusik den „Kaiserin-Augusta-Marsch“, den sie selbst vor Jahren komponirt hatte.
Herrlich blühte das neue Reich auf, herrlich blühte auch auf, was die Kaiserin geschaffen hatte, namentlich ihre Lieblingsschöpfung: der Vaterländische Frauenverein. Einmal im Jahre, gewöhnlich im März, bald nach der Geburtstagsfeier des Kaisers, versammelte sie die Abgeordneten der Zweigvereine und die Mitglieder des Hauptvereins in einem der Ministerien um sich. Eine reiche Bauersfrau aus dem Magdeburgischen, die viel für den Verein gethan hatte, war einmal auch dabei, sie war in ihrer stattlichen Volkstracht erschienen, die der Kaiserin sofort auffiel. Sie lobte die Frau um diese Anhänglichkeit an ihre alte Sitte und schloß mit den Worten: „Ermahnen Sie auch die Jugend, festzuhalten an der Tracht ihrer Eltern. Es fällt mehr damit hin, als Sie glauben.“
Später verlegte sie diese Versammlungen in ihr Palais. Dabei richtete sie zum Schluß stets einige Worte an alle Anwesenden, und die leise Befangenheit, die sie beim Sprechen vor so vielen Zeugen nicht abstreifen konnte, der leise Anflug an den Dialekt ihrer thüringischen Heimath gaben diesen kurzen Ansprachen einen eigenthümlichen Reiz. Hing sie ja doch durch ihr ganzes Leben treu an der Stätte, wo ihre Wiege gestanden, wo sie ihre Jugend verlebt hatte. So lange ihre Mutter, die Großherzogin, noch lebte, kam sie jährlich mehrere Mal nach Weimar, und auch nach dem Tode derselben kehrte sie wenigstens einmal im Jahre im Schloß ihrer Väter ein. Mit ihrem Bruder, dem Großherzog Carl Alexander, war sie durch die zärtlichste Schwesterliebe verbunden. Auch ihren Jugendfreundinnen hat sie treue Freundschaft gehalten durch ihr ganzes Leben. Es waren deren vier, aber nur eine von diesen, Baronin von Gustedt, hat die Kaiserin überlebt, und sie bewahrt heute noch ihre jugendfrischen Erinnerungen an die Zeit, wo die damalige Erbgroßherzogin Maria Pawlowna mit ihren Töchtern Goethe allwöchentlich in seinem Heim aufsuchte. Frau von Gustedt hat Frau von Stein, freilich nur mehr als eine Greisin, noch am Fenster ihrer Parterrewohnung sitzen sehen. Als vor elf Jahren der Verfasser dieser Zeilen behufs eines biographischen Artikels über die Kaiserin Augusta in Weimar sich aufhielt, war Frau von Gustedt seine gütige Führerin. Sie ging mit ihm auch nach Belvedere und dort in einem der Gemächer der ersten Etage zeigte sie auf eine Ecke und sagte: „Sehen Sie, hier habe ich zum ersten Mal mit der Kaiserin – wir waren beide drei Jahre – gespielt, und zwar mit Bleisoldaten.“ Es war, als ob die Kaiserin Ihre Zukunft an der Seite eines Soldaten vorhergesehen hätte.
Einer der schönsten Züge im Charakter der Kaiserin war die unwandelbare Anhänglichkeit an diejenigen, welchen sie ihre Achtung und ihr Vertrauen geschenkt hatte. Nicht leicht konnte sie davon abgebracht werden, aber – es muß auch das gesagt werden – nicht leicht war es zu ermöglichen, ihr ein Vorurtheil zu nehmen, das sich in ihr gegen Dinge oder Personen festgesetzt hatte.
Reiche, schöne Jahre kamen nach dem Frieden für die Kaiserin. Sie sah die Vollendung des Kölner Domes, für die sie sich immer lebhaft interessirt hatte, sie wohnte der Hochzeit ihres geliebten Enkels, des Prinzen Wilhelm, des heute regierenden Kaisers, mit der Prinzessin Auguste Victoria von Schleswig-Holstein bei, die sie ganz besonders liebgewann, und dann kam Taufe um Taufe ihrer lieblichen Urenkel, in denen sie ein gesundes Geschlecht heranwachsen – in denen sie eine Bürgschaft für die Zukunft Deutschlands und Preußens sah. Die Kinder des Kaisers waren das Labsal ihres Alters. Jede Woche an einem bestimmten Tage kamen sie zu ihr, spielten um sie herum – und der Kinder höchste Freude war es, die Urgroßmama in ihrem Stuhle von Gemach zu Gemach fahren zu dürfen.
Das Jahr 1879 hatte sie im goldenen Hochzeitskranz gesehen. Es war ein Fest, an dem ganz Deutschland theilnahm. Dann kam 1883 die Silberhochzeit ihrer Tochter, der Großherzogin von Baden, die Vermählung ihrer Enkelin mit dem Kronprinzen von Schweden und die silberne Hochzeit des Kronprinzen, des späteren Kaisers Friedrich. Sie war die erste, die [78] dem geliebten Sohne ihre Segenswünsche brachte. „Ich war ganz starr,“ erzählte der Kronprinz, „als ich in aller Morgenfrühe schon den Wagen meiner Mutter erblickte.“
In den letzten zwanzig Jahren gestaltete sich das Leben der Kaiserin nach einem regelmäßig wiederkehrenden Turnus. Man kann nicht sagen, daß sie den Aufenthalt in Berlin demjenigen von Baden-Baden oder Koblenz vorgezogen hätte. Aber Berlin war ihr offizieller Wohnort, ihre Garnison als Offiziersfrau, wenn man so sagen darf. Hier im Palais pflegte sie, an der Seite ihres kaiserlichen Gemahls, jene großartige Geselligkeit zu üben, wie sie vielleicht an keinem europäischen Hofe mehr üblich ist. Wenn der Frühling kam, suchte die Kaiserin ihr geliebtes Baden-Baden auf, wo sie der Tochter nahe war. Dort pflegte sie bis Mitte Juni zu bleiben.
Sobald der Kaiser nach Gastein abgereist war, hörte man von der Kaiserin Augusta vier Wochen lang nichts mehr. Sie machte ihre Inkognitoreisen in die schweizer Berge, nach Ober-Italien, man sagte sogar, sie sei in den siebziger Jahren in das östliche Frankreich gegangen. Es war die Urlaubsreise der Kaiserin. Der Haushofmeister wurde als Kurier vorausgesandt, um Quartier zu machen für eine Gräfin v. Lingen; am Morgen ging sie oft allein mit dem Reisehandbuch unter dem Arme aus, und eines Tages – in Bologna im Campo Santo war es – sahen sie ihre Damen gar am Arme eines jungen Mannes daherkommen. Derselbe hatte die Kaiserin bei Besichtigung der Denkmäler angesprochen, sich von den feinsten Sitten und von der umfassendsten Bildung gezeigt und der Kaiserin dann den Arm geboten, den sie auch angenommen hatte. Auf diesen Reisen wußte sie ihr Inkognito so geschickt festzuhalten, daß sie nur selten erkannt wurde. Nur einmal in der französischen Schweiz geschah es doch. Sie kam auf einem Bahnhofe an, als eben der Zug, mit dem sie weiter fahren wollte, vorüber fuhr. Sie befahl, augenblicklich anzuhalten. „Das ist eine Königin!“ flüsterten die Bahnhofbediensteten sich zu. Die Endpunkte dieser Urlaubsreisen bildeten Besuche bei ihrer hochbetagten früheren Gouvernante in der französischen Schweiz und in Ouchy bei der Fürstin Wittgenstein. Sobald sie wieder auf deutschem Boden angelangt war, hatte das Inkognito ein Ende. In Freiburg erwartete ein Extrazug die Kaiserin und führte sie nach Baden-Baden, aber nur für kurze Zeit. Gegen den 10. August war der Kaiser von Gastein auf Babelsberg angekommen. Dorthin ging auch seine Gemahlin, um bis zur großen Herbstparade in Berlin an seiner Seite zu bleiben und dann mit ihm in die Provinz zu den Manövern zu gehen. Diesen folgte ein dreiwöchiger Aufenthalt des Kaisers in Baden-Baden, wo am 30. September der Geburtstag der Kaiserin gefeiert wurde, das letztemal im Jahre Jahre 1887. Damals war noch die Kaiserin von Brasilien dabei.
Gegen Mitte des Oktobermonats pflegte der Kaiser nach Berlin zu gehen; die Kaiserin blieb bis zu Ende in Baden-Baden, um dann noch vier Wochen nach Koblenz zu gehen und Ende November nach Berlin in das Palais zurückzukehren. So verlief das Jahr der Kaiserin.
Aber es kamen am Abend ihres Lebens auch noch schwere Prüfungen über sie. Mörderhände bedrohten wiederholt das Leben ihres Gemahls, und als kaum seine Wunden geheilt, da kam das Leiden über sie selbst. Mehrere Jahre war sie des Gebrauchs ihrer Füße gänzlich beraubt, und ein berühmter Arzt erklärte ihr rund heraus: „Euer Majestät werden nie wieder gehen können.“
„Wie Gott will, mein Lieber,“ entgegnete die Kaiserin wehmüthig. Und es kam anders! Langsam gewann sie den Gebrauch ihrer Füße wieder. Sie war fast genesen, als herberes Leid sie traf, die nagende Sorge um die Gesundheit ihres Sohnes. Die fürchterliche Wahrheit ließ sich nicht mehr verleugnen, daß dieser königliche Eichbaum krank sei bis ins Mark, und dann brachen sie herein, die furchtbaren Schicksalsschläge, einer um den andern, die erst den geliebten Enkel, dann den greisen Gatten, und endlich auch den todwunden Sohn von ihrer Seite rissen. Ihr, deren Leben es gewesen, Thränen zu trocknen, blieben die bittersten Thränen nicht erspart.
Und dann ein ruhiges, friedsames Ausklingen! In stiller Zurückgezogenheit lebt die kaiserliche Witwe ihren Erinnerungen und ihren alten Zielen; um das trauernde Haupt der Greisin aber webt eine scheidende Sonne noch manch goldenen Strahl, ausgleichend, versöhnend, verklärend. Dann sinkt sie hinab, die Sonne; das Haupt aber, dem noch ihr letzter Gruß gegolten, legt sich müde nieder – zum Sterben!
Und wie des Menschen Auge in wehmüthigem Sinnen auf der Stelle haftet, da der röthliche Glanz noch die Spuren des Tagesgestirns verräth, so bleibt des Volkes Gedenken ruhen auf dem Werke der Kaiserin Augusta.
Von der Thierwelt des Meeres ist uns naturgemäß derjenige Theil am besten bekannt, der sich an den Küsten niedergelassen hat; denn hier ist das Meer uns zugänglich. Es giebt namentlich in tropischen Gegenden klare Buchten, wo der Schiffer über der Fläche dahingleitend auf den Grund des Meeres schauen und das farbenprächtige Thierleben bewundern kann. Er gleitet über Korallengärten dahin, er sieht den weißen Sandgrund und vermag oft in der Tiefe von 20 und mehr Metern auf ihm den Schiffsanker zu unterscheiden, und zwar nicht nur im hellen Sonnenschein, sondern auch nachts bei dem matten Lichte des Vollmondes. Was er hier sieht, ist für ihn auch greifbar. Er kann bis auf den Grund tauchen, ja stundenlang auf ihm wandern, wenn er den Taucherapparat zur Hilfe nimmt. Solche Studien auf dem Meeresgrunde sind von eigenartigem Reiz umgeben; wer kennt nicht die farbenprächtigen Schilderungen, die Häckel von den Korallenhainen im Rothen Meere und an den Küsten von Ceylon entwirft? Solche Studien werden auch in den zoologischen Stationen an den Meeresküsten, wie z. B. in Neapel, häufig ausgeführt. Der Taucher weiß uns da viel Eigenartiges zu berichten.
Er vertieft sich in eine andere Welt; das beweist schon der Farbenglanz, in dem sie dem erstaunten Auge sich darbietet. Unbeschreiblich schön ist die Farbenpracht, die sich in geringen Tiefen bemerkbar macht. Im Mittelmeere erscheint alles blau; namentlich in 5 bis 6 m Tiefe ist alles vom herrlichsten Azurblau durchdrungen. Blau ist ja die Farbe des Meeres, aber nicht überall; dort, wo Ebbe und Fluth herrschen und das Wasser mit kleinen Schlammtheilchen mehr durchsetzt ist, herrscht unter dem Meeresspiegel die grüne Farbe vor; in dieser magischen Beleuchtung bieten sich z. B. dem Auge des Tauchers die berühmten Korallengärten von Ceylon dar. Die Beleuchtung in diesen geringen Tiefen ist auch genügend, um uns alles erkennen zu lassen; an klaren Tagen vermag man in den Gewässern von Neapel in 10 m Tiefe mit der Lupe zu beobachten und bei 20 m Tiefe zu lesen. Das Licht nimmt allmählich ab, je tiefer wir steigen, aber so weit der Taucher sich hinablassen kann, ist es noch stark genug, um ihn die nächste Umgebung erkennen zu lassen.
Freilich ist die Grenze unseres Vordringens in die Meeresgründe sehr eng gezogen. In 10 m Tiefe fühlt sich der Mensch noch wohl, und es giebt eine Anzahl von Forschern, die nach einiger Gewöhnung zwei Stunden lang sich auf dem Meeresgrunde aufhalten können, ohne besondere Beschwerden zu spüren. Dringt man aber tiefer in die Meeresgründe ein, so wird der Einfluß des zunehmenden Druckes empfindlicher. 20 m Tiefe erreichen nur bessere Taucher und halten darin in der Regel nur 15 bis 20 Minuten aus. Noch tiefer steigen nur Virtuosen hinab, und 60 m dürfte die äußerste erreichte Grenze sein. Schon bei 30 m stellt sich außer allerlei Schmerzen Nasen- und Ohrenbluten ein, und der Taucher Deschamp, der im Jahre 1866 sich zu einem gesunkenen Dampfer in die Tiefe von 70 m hinablassen wollte, wurde in 60 m Tiefe von Hallucinationen befallen und bewußtlos wieder heraufgezogen.
Durch eignen Augenschein können wir somit nur die oberflächlichste Schicht des Meeres kennen lernen. Und doch stellt die Wissenschaft eine ganze Reihe von Fragen, die sich auf die Physik und die Chemie der Meerestiefen beziehen und von deren Beantwortung unser Verständniß für das Thierleben der See abhängt!
[79] Dringt das Sonnenlicht noch in die tiefsten Abgründe oder herrscht dort ewige Finsterniß? Man hatte zunächst versucht, die Durchsichtigkeit des Meerwassers dadurch zu prüfen, daß man weiße oder gefärbte Platten in die Tiefe versenkte, bis sie dem Auge entschwanden. Für die Beantwortung unserer Frage sind diese Versuche von sehr geringem Belang. Wichtiger schon ist die Zuhilfenahme der Photographie. Der schweizer Forscher Forel hat zuerst diese Methode angewandt, indem er zur Nachtzeit Platten in den Genfer See versenkte und sie zur Nachtzeit wieder heraufholte. Er fand dabei, daß im Sommer schon in der Tiefe von 45 m und im Winter bei 100 m das Licht so schwach war, daß es gar keine Wirkung auf die photographischen Platten ausübte. Auf seine Anregung wurden derartige Beobachtungen auch im Mittelländischen Meere bei Nizza und Villafranca angestellt, Fol und Sarasin fanden dabei, daß in 260 bis 280 m Tiefe die Platten noch deutlich geschwärzt waren, bei 380 m war die Schwärzung kaum wahrnehmbar, die Lichtwirkung schwächer noch als in einer sternhellen, mondscheinlosen Nacht. Bei 405 bis 420 m zeigte sich nicht die geringste Spur der Lichtwirkung mehr. Zuletzt hat der Ingenieur der deutschen zoologischen Station in Neapel von Petersen einen sinnreichen Apparat hergestellt, der solche photographische Lichtmessungen auf offener See in beliebiger Tiefe ermöglicht, und mit diesem wurde auf der Höhe von Capri an einem sonnenhellen Novembertage noch in einer Tiefe von 500 bis 550 m nach halbstündiger Exposition eine deutliche Schwärzung der Platten gefunden.
Noch aus anderen Beobachtungen können wir auf die Verbreitung des Lichtes im Meere schließen. Das Leben der meisten Pflanzen ist an das Licht gebunden. Je tiefer wir aber in das Meer hinabsteigen, desto geringer wird der Pflanzenwuchs, bis endlich auch die schattenliebenden Algen verschwinden, unsere Scharrnetze nur Thiere an die Oberfläche bringen. Die „Challenger“-Expedition hatte unter 385 m keine Pflanzen gefunden; und abgesehen von parasitischen Pilzen, die sich ohne Licht entwickeln können, dürften im allgemeinen selbst in durchsichtigen Meeren unter 250 m keine Pflanzen mehr vorkommen.
Alle diese Thatsachen sprechen dafür, daß das Sonnenlicht das Meer in seiner ganzen Tiefe nicht durchleuchten kann, daß es einige hundert Meter mehr oder weniger unter der Oberfläche endlich eine Grenze geben muß, wo der Unterschied zwischen Tag und Nacht aufhört und eine völlige Finsterniß beginnt. Einige Forscher behaupten zwar, daß selbst in der Tiefsee am hellen Tage noch eine Dämmerung herrsche, welche dem Sternenschimmer gleich sei, oder daß grüne Strahlen das Meerwasser durchdringen können und ein wenn auch sehr schwaches grünes Licht die Tiefsee erhelle; aber diese Behauptungen sind wenig wahrscheinlich. Und doch leben dort neben blinden auch Thiere, die gut entwickelte Augen besitzen, was uns wieder zu der Annahme nöthigt, daß es in ihrem Wohngebiet Licht geben muß.
Das Meer hat nun sein eigenartiges Licht: das Meeresleuchten. Zahllose seiner Geschöpfe sind mit der Eigenschaft des Phosphoreszierens ausgestattet, und jeder Seemann kennt diese Erscheinung.
Das Meer leuchtet nicht nur in den Tropen, sondern auch im hohen Norden, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in seinen Tiefen, und die Stärke dieses Lichtes darf nicht unterschätzt werden. Nach Wyville Thomson, dem berühmten englischen Zoologen, leuchtete einmal während einer Fahrt von den Kapverdischen Inseln nach Südamerika das Meer so stark, daß der Glanz der strahlenden südlichen Sterne verdunkelt wurde und man an Bord die kleinste Schrift lesen konnte. Milne-Edwards berichtet dagegen, daß während der „Talisman“-Expedition das Schleppnetz einmal eine Menge von Tiefseekorallen heraufbrachte, die gleichfalls so stark leuchteten, daß man in der Nacht an Bord lesen konnte. Es ist darum nicht unmöglich, daß diese phosphoreszierenden Thiere die dunkeln Abgründe der Tiefsee erleuchten, und gewiß sehr anziehend, die untersten Räume des Krystallpalastes des Meergottes „künstlich beleuchtet“ und die phosphoreszierenden Tiefseethiere als Laternenträger sich zu denken; aber wir wissen so wenig von dem Wesen und Zweck dieser Erscheinung, daß auch in dieser Hinsicht nur Vermuthungen aufgestellt werden können.
Wir stehen hier erst am Anfang der Forschung und wissen nicht einmal, wie sich die Thiere des Meeres gegen das Licht verhalten, ob sie es fliehen oder von ihm angezogen werden, und ob dementsprechend die Eigenschaft zu leuchten dem Besitzer Nutzen oder Schaden bringt. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist noch nicht beantwortet; es muß noch mehr Licht in die Lichtverhältnisse der Meere gebracht werden.
Viel besser sind die Temperaturverhältnisse des Meeres erforscht. Das salzhaltige Seewasser wird von der Kälte anders beeinflußt als das Süßwasser unserer Flüsse und Seen. Der Gefrierpunkt des salzigen Meerwassers liegt nicht bei 0°, sondern je nach dem Salzgehalt mehr oder weniger tief unter demselben. Im Durchschnitt gefriert das Meerwasser im bewegten Zustande bei –2,55° C, im ruhenden aber bei –3,17° C. In der That findet man an der Oberfläche der Polarmeere Wassertemperaturen von –3° C, während in der Nähe des Aequators dasselbe bis zu +32° C, wie im Rothen Meere, erwärmt wird, also die Temperatur eines lauwarmen Bades erreicht. In den Tiefen der Oceane giebt es derartige große Wärmeunterschiede nicht. Die Temperatur des Wassers sinkt rasch, je mehr man sich dem Boden nähert, und der größten Bodenkälte an den Polen –3° C steht als die höchste Temperatur die von +2° C gegenüber.
So ist die Tiefsee nicht nur finster, sondern auch kalt. Es giebt nur wenige Ausnahmen von dieser Regel. Die unterseeischen Gebirgszüge, von denen wir im ersten Artikel sprachen, üben auf die Vertheilung der Bodentemperatur einen wichtigen Einfluß aus. Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Tiefenkärtchen des Atlantischen Oceans!
[80] Wir sehen, daß dort das Becken des südlichen Eismeeres freien Abfluß in das westliche atlantische Becken hat; die kalten Wasser dringen hier ungehindert ein und darum zieht sich am Grunde des Meeres längs der südamerikanischen Ostküste die sog. „kalte Rinne“, in welcher die Bodentemperatur des Wassers –0,6° C beträgt.
Das östliche Becken ist dagegen im Süden durch einen Querriegel, einen unterseeischen Gebirgszug, der von dem Challenger-Rücken nach dem afrikanischen Festlande streicht, von dem Eismeere getrennt und dieses Gebirge hält die kalten Wassermassen ab, so daß hier nördlich von dem Riegel das Meerwasser am Boden eine Temperatur von +1,9° C hat. Auch das Mittelländische Meer ist bei Gibraltar durch einen Querriegel, der sich bis 80 m dem Meeresspiegel nähert, von dem kalten oceanischen Grundwasser getrennt und darum hat sein Wasser von 300 m an bis zu seinen größten Tiefen, die über 3000 m betragen, eine gleichmäßige Temperatur von etwa +13,5° C, welche der jährlichen Durchschnittstemperatur der Oberfläche entspricht. Ebenso hat die Sulusee, die gleichfalls ein vom Ocean abgeschlossenes Becken bildet, eine gleichmäßige Temperatur von 10,3° C in einer Wasserschicht von 3700 m über dem Meeresboden.
Die Gesammtmasse der oceanischen Gewässer befindet sich in fortwährendem Kreislaufe; an den Polen sinkt das kalte Wasser zu Boden, dringt nach dem Aequator vor, wird durch die Erdwärme des Bodens allmählich wärmer und steigt empor, um wieder nach den Polen abzufließen. So hat das Meer, sowohl an der Oberfläche wie in der Tiefe, seine Klimaprovinzen, die für die Entfaltung des Lebens gleichfalls von Bedeutung sind. Daß die oberflächlichen Strömungen selbst das Klima des Festlandes beeinflussen können, ist jedermann bekannt, denn wer kennt nicht den Golfstrom und seine Wirkungen auf das Klima des westlichen Europas? – –
Der Taucher bildete den Ausgangspunkt unsrer Betrachtung. Kehren wir zu ihm zurück! Was ihn gehindert hat, tiefer hinabzusteigen, das war nicht die Kälte, nicht der Mangel an Licht, sondern der ungeheure Druck, den er
[81] nicht zu ertragen vermochte. Wir sind alle für einen gewissen Druck angepaßt und können nicht straflos uns einem zu niedrigen oder zu hohen Druck aussetzen. Wir wohnen auch auf dem Grund eines Meeres, des Luftoceans, und der Aufenthalt in der dünnen Luft unsrer hohen Bergspitzen behagt uns nicht. Schon Saussure, der zum erstenmal den König der europäischen Berge, den Montblanc, bestieg, berichtete von den Beschwerden, die ihm die dünne Höhenluft verursachte. Seit jener Zeit ist viel über die „Bergkrankheit“ geschrieben worden. Sie macht sich auch auf den sturmdurchtobten kalten Hochebenen von Tibet geltend, die in der Höhe des Montblancs liegen. Der russische Forschungsreisende Prschewalskij berichtet unter anderem, daß dort der Reisende beim Tragen einer kleinen Last oder beim Besteigen eines kleinen Hügels außerordentlich rasch ermatte, daß man dort wie ein Asthmatiker in sitzender Stellung schlafen müsse und durch Alpdrücken gequält, durch Athemnoth geweckt werde. Aber diese Hochebenen sind von zahllosen Herden der wilden Yaks, von Antilopen, Tabunen, von wilden Kulanpferden belebt, und alle diese Thiere befinden sich in jenen Höhen durchaus wohl, weil sie an den niederen Luftdruck gewöhnt sind.
Im Jahre 1875 traten die Luftschiffer Sivel, Crocé-Spinelli und Gaston Tissandier eine Ballonfahrt an, auf der sie möglichst hoch emporsteigen wollten. Sie erreichten annähernd die Höhe des Gaurisankars, des höchsten Berges auf Erden, aber Sivel und Crocé-Spinelli fanden dort den Tod, während Gaston Tissandier nur mit einer Ohnmacht davon kam. Und doch giebt es Vögel, wie z. B. der Kondor, die aus der Höhe von etwa 7000 m sich in wenigen Minuten zur Oberfläche der Erde ungestraft herablassen können!
Solche Wechselbeziehungen zwischen Druck und Leben sind auch in den Tiefen des Meeres vorhanden. Nur ist in den letzteren der Druck bei weitem bedeutender. Der Druck, den unsere Atmosphäre auf einen Quadratcentimeter ausübt, beträgt rund 1 Kilogramm; denselben Druck übt schon eine entsprechend dicke 10 m hohe Säule destillierten Wassers aus. Das Salzwasser ist noch etwas schwerer; man kann also sagen, daß der Druck in den Meerestiefen von 10 zu 10 m annähernd
[82] um eine Atmosphäre steige. In 1000 m Tiefe kommen bereits 10850 Kilogramm Wasserdruck auf 1 Quadratdecimeter. Das sind Zahlen, die wir uns schwerlich vorstellen können. Die Wirkungen dieses Druckes sind aber oft an den Geräthen des Tiefseeforschers bemerkbar. Korkscheiben, die an den Schleppnetzen der Talismanexpedition befestigt waren, wurden, wie dies auch aus unserer Abbildung S. 79 ersichtlich ist, von dem Druck der Tiefe auf etwa die Hälfte ihres Rauminhaltes zusammengepreßt und das Korkgewebe nahm die Dichte von Holz an. Darum wurden auch die Tiefseethermometer so hergestellt, daß sie den Druck von 70 Centnern auf einen Quadratzoll vertrugen. Dies genügte jedoch nur für die Tiefe von 4800 m und als der „Challenger“ einmal eine Tiefe von etwa 7000 m lothete, zog man zwei dieser Thermometer zerbrochen herauf. Die Walfischfänger erzählen, daß die harpunierten Wale oft tief im Meere ihr Heil suchen und daß alsdann die Holztheile an der Harpune derart vom Wasserdruck zusammengepreßt werden, daß sie, wenn die Wale wieder emporsteigen und erbeutet werden, schwerer geworden sind und nicht mehr schwimmen. Dies beweist uns aber, daß die Wale ungestraft Tiefen mit so ungeheurem Druck aufsuchen können; sie besitzen dieselbe Anpassung für das Meer wie der Kondor für den Luftocean. Dies ist aber durchaus nicht bei allen Thieren der Fall, namentlich der rasche Uebergang von dem hohen Druck der Tiefe zu dem geringen der Oberfläche wird vielen verderblich und sie gehen zu Grunde ebenso wie Sivel und Crocé-Spinelli bei ihrer Ballonfahrt. Unsre Abbildung S. 79 zeigt uns einen Tiefseefisch in dem jämmerlichen Zustande, in dem er aus der Tiefe von 1500 m heraufgeholt wurde. Ein Theil der Speiseröhre ist herausgepreßt, die Augen sind hervorgequollen, die Schuppen sind gelockert und fallen theilweise ab. Die Gase und die Gewebe des Thierkörpers dehnen sich beim Aufhören des Druckes plötzlich aus und führen die Katastrophe herbei. Ueberhaupt gelangen fast alle in der Tiefsee gefischten Thiere todt oder beschädigt und zerrissen an die Oberfläche. Im Bodensee fangen unsre Fischer die Kilche, die in bedeutenden Tiefen leben. Diese werden mit stark aufgetriebenem Leib aus dem Netze geholt; unter dem geringeren Luftdruck der Oberfläche dehnt sich die Luft in der Schwimmblase aus und die Fische müßten, sich selbst überlassen, absterben. Die Fischer „retten“ die Waare, indem sie die Kilche „stupfen“, d. h. die Schwimmblase durchstechen; die Luft entweicht alsdann mit pfeifendem Geräusch, die Fische werden wieder schlank und bleiben am Leben. Es handelt sich hier jedoch nur um Tiefen von 200 bis 300 m, während wir im Meere mit ebenso viel und noch mehr Tausenden rechnen müssen, wo der Druck nicht 20 bis 30, sondern 200 bis 300 und mehr Atmosphären beträgt. Ueber die Lebensäußerungen unter diesem Drucke ist noch sehr wenig bekannt.
Die Thiere der Tiefsee seufzen ebensowenig unter dem Wasserdruck wie wir unter dem der Atmosphäre; auch ist ihre Organisation derjenigen der Flachseethiere gleich. Sie sind nach demselben Muster gebaut. Ob allerdings alle chemischen und physiologischen Vorgänge im Thierkörper sich unter dem hohen Drucke ebenso abwickeln wie an der Oberfläche, mag fraglich erscheinen. Versuche, die in Laboratorien angestellt wurden, konnten nicht zur Lösung dieser Frage führen. Der Naturforscher Cailletet hat, um Gase flüssig zu machen, einen Apparat gebaut, in dem man auch Flüssigkeiten in einem geschlossenen Raum dem ungeheueren Drucke von 1000 Atmosphären aussetzen kann. Gase werden in diesem Apparate flüssig, das Wasser wird aber durch den Druck wenig verändert; es wird dichter, aber bei 159 Atmosphären erst um 1/144 seines Raumgehalts. In diesen Apparat wurden nun verschiedene Thiere gebracht. Ein Stutztopf (Dorade), dessen Schwimmblase zuvor entleert wurde, vertrug den Druck von 100 Atmosphären ohne Beschwerden; bei einem Druck von 200 Atmosphären war er betäubt, erholte sich aber bald, als man ihn wieder befreite, bei 300 Atmosphären war er dem Tode nahe, bei 400 todt und starr. Bei dem Druck von 400 Atmosphären, der einer Meerestiefe von 4000 m entspricht, wurde ein Frosch so starr, daß man ihn eher entzwei brechen, als eins seiner Glieder beugen konnte. Die Gewebe werden unter dem hohen Druck mit Wasser infiltriert, denn ein Froschschenkel, der ursprünglich ein Gewicht von 15 Gramm hatte, wog, nachdem er 5 Minuten lang einem Druck von 600 Atmosphären ausgesetzt worden war, 17 Gramm. Interessant ist in dieser Reihe von Versuchen die Prüfung einiger physiologischer Vorgänge. Gekochte Stärke wurde mit Speichel vermischt und dieses Gemenge einem Druck von 1000 Atmosphären ausgesetzt; der Speichel behielt seine Wirksamkeit und die Stärke wurde in Zucker verwandelt. Anders jedoch verhielt sich die Hefe. Dem ungeheuren Druck von 600 bis 1000 Atmosphären ausgesetzt, gährte sie nicht, verfiel in einen lethargischen Zustand; sie erholte sich aber, als man den Druck entfernte, und konnte dann die Gährung bewirken. Der hohe Druck hemmt also die Thätigkeit der Gährungserreger, und damit stimmt die Thatsache überein, daß man gährende oder in Zersetzung befindliche Stoffe aus großen Tiefen nicht heraufgeholt hat. Giebt es dort keine Fäulniß, hört dort der Machtbezirk der auf dem Festlande und in seichten Gewässern überall gegenwärtigen Bakterien auf?
Doch genug dieser Beispiele! Die Betrachtung der Tiefsee rollt eine ganze Reihe derartiger Lebensfragen auf.
Aus den Andeutungen, die wir gegeben haben, wird der Leser ersehen haben, daß die Lebensbedingungen für die Thierwelt der Tiefsee vielfach ganz andere sind als die für die Fauna der Oberfläche. Die unzähligen Geschöpfe, welche diese Abgründe bewohnen, sind auch in ihrer Ernährung in eine eigenartige Lage versetzt. Bevor wir jedoch diese erörtern, wollen wir einige der hervorragendsten Bewohner der Tiefsee in Wort und Bild vorführen.
Die Tiefsee ist eine in neuerer Zeit ersonnene Bezeichnung; ihre Grenzen lassen sich in Wirklichkeit nicht mit Bestimmtheit angeben; je nach der Vertheilung der Thiere, welche die Forscher als echte Tiefseebewohner ansehen, beginnt sie bald höher, bald tiefer unter der Meeresoberfläche. Im allgemeinen rechnet man Tiefen bis zu 200 m der Flachsee zu; dann aber kommt eine Uebergangsregion, bis in etwa 600 m Tiefe das eigentliche Reich der Tiefe, die „Abyssalzone“ beginnt.
Im Jahre 1818 brachte John Roß, der berühmte Nordpolfahrer, aus den Abgründen des Eismeeres den ersten Beweis für das Leben in der Tiefsee bei; aus einer Tiefe von fast 1000 Faden holte er einen Seestern herauf. Es war ein Zufallsfund, den man verschieden deutete. Zwanzig Jahre später wurde von Edward Forbes die Erforschung der unterseeischen Thierwelt systematisch betrieben, aber die Mittel, mit denen man arbeitete, waren noch unzulänglich und man gelangte zu der Ueberzeugung, daß das Meer unter 300 Faden nicht bewohnt sei. In den vierziger Jahren kam aus dem Norden durch die Arbeiten Lovens in Stockholm und Sars’ in Christiania wiederum bestimmtere Kunde von dem Vorhandensein des Lebens in bedeutenden Meerestiefen. 1854 bohrte die Brookesche Tiefensonde zum ersten Male in den Boden des Atlantischen Oceans ein und förderte in dem weißen Tiefseeschlamme und den in ihm erhaltenen Globigerinen einen neuen Beweis für die vielumstrittene Ansicht zu Tage. Rasch mehrten sich jetzt die glücklichen Fänge, bis ein einziger Zug mit dem Schleppnetze im Jahre 1869 in dem Golf von Biscaya aus der Tiefe von 2435 Faden zahlreiche Vertreter „aller fünf wirbellosen Königreiche“ heraufbrachte und es von nun an keinem Zweifel mehr unterlag, daß in der Tiefsee sogar ein reiches Leben vorhanden sei.
Man hat versucht, mit den einzelnen Fängen Gesammtbilder des Lebens in den Tiefen zusammenzustellen, und auch unsre Abbildungen stellen solche Versuche dar. Das erste Bild (S. 80) führt uns auf den Grund der Tiefsee, 1200 bis 1500 m unter den Meeresspiegel. Pflanzen fehlen hier, wie wir bereits wissen, vergebens würden wir hier nach unterseeischen Algenwäldern forschen; aber etwas, was uns an Haine und Wiesen erinnert, hat die Natur doch geschaffen. Hier haben sich jene Wesen niedergelassen, von denen man lange nicht wußte, ob man sie den Pflanzen oder den Thieren zuzählen soll, und die noch heute den Namen Pflanzenthiere führen. Da sind zunächst die Korallen, welche von den älteren Naturforschern als „Pflanzen ohne Blumen, von harter, fast steiniger Natur“ beschrieben wurden. Erst im Jahre 1723 entdeckte Peyssonel die thierische Natur derselben und reichte seine Abhandlung darüber im Jahre 1727 der Pariser Akademie ein. Was mußte er sich nicht gefallen lassen! Réaumur wurde zum Berichterstatter bestimmt und er bezeichnete die Entdeckung als „einen seltsamen Irrthum“! Diese Pflanzenthiere bilden die Haine der Tiefsee; da stehen dicht gedrängt aneinander die [83] Korallenstöcke, auf denen allerlei Krabben munter umherklettern. Sie sind zwar keine Edelkorallen, aber schön und beachtenswerth; sie sind mit dem Vermögen, zu leuchten, ausgestattet, und die einen schimmern in weißem, die andern in blauem oder violettem Lichte. Es leuchten dabei die Thierchen, die aus dem Korallenstocke hervorknospen, und es muß einen eigenartigen, feenhaften Anblick gewähren, wenn die farbigen Flämmchen an den Stämmchen und den Aesten der Stöcke auf und nieder zucken.
Dicht daneben sehen wir andere Vertreter der Pflanzenthiere; es sind Schwämme und zwar die an der Oberfläche so überaus seltenen Glas- oder Kieselschwämme. Wir haben schon von ihrer Bedeutung gesprochen. Sie gehören zu den „schönen“ Gebilden der Tiefsee, denn sie sehen aus, als ob sie aus Glasfäden gewoben wären, und einige von ihnen tragen den Namen „Euplectella“ d. h. „Schöngewobene“, oder „Venusblumenkörbe“. In den fernen Meeren von Japan und China werden sie öfters gefischt und bildeten noch vor wenigen Jahren eine große Seltenheit, heute kann man diese Blumenkörbe der schaumgeborenen Göttin schon für wenige Mark erstehen und sie in einem Glaskasten als Salonschmuck aufstellen. Auf unserm Bilde schauen aus den Höhlungen der Schwämme kleine Krebse hervor; das entspricht der Wahrheit, denn die Schwämme sind Krystallpaläste der Tiefsee, in denen sich junge Krebse gern niederlassen, in denen sie wohnen, oft so lange, bis sie zu groß werden, um durch die Oeffnungen wieder herauszuschlüpfen, und in den Schwämmen auch ihre kunstvollen Grabeskammern finden.
Auch ein Wiesenschmuck fehlt nicht diesen schlammigen Gefilden. Hier wachsen dicht aneinander jene Formen der Stachelhäuter, die unter dem Namen der „Seelilien“ bekannt sind; sie haben ein birnenförmiges Aussehen und sind bunt gefärbt, wie die Blumen auf sonnigen Fluren, purpurroth, gelb, weiß und auch grasgrün. Daneben ruhen ihre nahen Verwandten, die Seesterne, die ihr Licht leuchten lassen. Den Preis der Schönheit verdient unter ihnen die Brisinga, die schon Anfang der fünfziger Jahre von dem norwegischen Dichter Asbjörnsen in dem herrlichen Hardangerfjord gefischt wurde; der wunderbar schön geformte Stern leuchtet so herrlich, daß Asbjörnsen ihn Brisinga nannte, nach dem Brustschmucke der Göttin Freya, den Loki stahl und in der Tiefe des Meeres verbarg. (Die Brisinga elegans ist auf unserer Abbildung S. 81 rechts unten gezeichnet.)
Werfen wir noch einen Blick auf diese Haine, Wiesen und Krystallpaläste! Die Korallen und die Schwämme zeichnen sich durch eine große Regelmäßigkeit und Rundung der Formen aus, wie sie sonst an der Meeresoberfläche selten vorkommen. Sie gleichen den Bäumen eines stillen geschützten Thales, während die anderen, wie die Tannen und Föhren auf den Bergeshöhen von Sturmwinden, von der Brandung und den heftigen Strömungen der See gebeugt und gekrümmt werden. Denn die entfesselte Wuth der Elemente tobt nicht in der Tiefsee, der Aufruhr der Wogen, der die Schiffe verschlingt, dringt nicht in diese Abgründe; langsam, fast unmerklich vollzieht sich hier der Kreislauf der oceanischen Gewässer von den eiskalten Polen zum sonnenwarmen Aeguator. Aber Friede herrscht nimmer in diesen stillen Räumen; Krieg ist auch hier die Losung wie überall auf Erden, wo lebende Wesen ums Dasein ringen!
In fortwährenden Kämpfen muß sich jenes Krebsgeschlecht herangebildet haben, dessen Vertreter uns in dem Lithodes ferox entgegentritt. Leib, Beine, Scheeren sind mit Stacheln besetzt; er ist schier unangreifbar; selbst todte Exemplare muß man mit großer Vorsicht anfassen, wenn man sich nicht stechen will. Die Krabben, die gepanzerten Ritter des Meeres, zeichnen sich durch Rauflust aus, und da muß unter ihnen der Lithodes ferox ein furchtbarer Feind sein. Im Kampfe ums Dasein haben die Thiere der Tiefsee ihre Ausrüstung der Umgebung angepaßt. In dem Dunkel, das nur in bestimmten Fällen vom phosphorescierenden Glanze der Bewohner erhellt wird, schwindet die Bedeutung des Auges und der Tastsinn gewinnt an Zuverlässigkeit. Darum verkümmert bei vielen Tiefseethieren das Auge und die Tastwerkzeuge entwickeln sich in überraschender Größe. Die langen Scheeren fallen schon bei vielen Krebsarten auf, der Pachygaster formosus (auf der Abbildung Seite 81) ist damit ausgerüstet; als echtes Tiefseethier erweist sich aber der über dem letzteren schwebende Nematocarcinus gracilipes, dessen Beine eine ungeheure Länge erreichen. Mit ihnen kann der „Schlankfüßige“ einen weiten Raum in seiner Nähe durchforschen, den Feind wittern oder Beute erspähen. Wir bemerken unter den Gestalten unsrer Abbildung noch eine Krabbenspinne. Man nennt diese Geschöpfe auch Pantopoden, d. h. Ganzbeine, da sie anscheinend nur aus Beinen bestehen und der übrige Körper nur ein winziges Stückchen bildet. Es sind Thiere, die „ihren Magen in der Hosentasche tragen“, denn ein Theil ihres Darmapparates pflanzt sich in den Beinen fort.
Die Krabbenspinnen der Oberfläche sind klein, in der Tiefsee aber erreichen sie riesenhafte Größen. Die von uns abgebildete Colossendeis arcuata stammt aus einer Tiefe von 820 Faden uttd ist schon recht ansehnlich; an der Westküste von Nordamerika hat man in 500 bis 1500 Faden Tiefe eine Colossendeis colossea gefunden, deren Beine 1/3 m lang sind, während der eigentliche Körper nur wenige Millimeter breit ist.
Von den Tiefseekrebsen gelangen manche lebend an die Oberfläche. Sie stürzen alsdann verwundert aus ihren Krystallpalästen, den Glasschwämmen, hervor, rollen ihre rothen Augen und flüchten wieder in das Innere ihrer Behausung zurück. Der Tod ist für sie sicher eine Erlösung; denn welche Qual muß ihnen der jähe Uebergang aus den finstern stillen Tiefen zu der Oberfläche, dem blendenden Glanz der Sonne, dem betäubenden Lärm der Oberwelt, bereiten! Einige von diesen Krebsen sind auch mit dem Vermögen zu leuchten ausgestattet, und die französischen Forscher berichten von einer Art, die in einem Glase den Leuchtstoff von sich warf, ein förmliches Bombardement mit Leuchtkugeln eröffnete.
Derselben Art sind auch die Veränderungen, welche wir bei den Fischen der Tiefe beobachten.
Auch bei einigen von ihnen tritt der Stab der Blinden, der Tastsinn, in sein Recht. Da ist zunächst der Bathypterois longipes, ein Langbein, der mit seinen fühlerartigen Fortsätzen an den Flossen und hinter dem Kopfe die Nachbarschaft sondirt. Diese Tastwerkzeuge sind noch feiner bei dem Eustomias obscurus, dem dunklen aalartigen Wesen oben links S. 81, ausgebildet, an den Enden derselben ist ein Fühlapparat sichtbar. Das sind alles wunderbar feine Organe, die sich nur in den stillen Gewässern der Tiefsee entwickeln können, im bewegten Wasser beim Wellenschlag würde sie das Thier bald verlieren.
Aus der Klasse der Leuchtfische führen wir unseren Lesern zwei Vertreter vor: den Stomias boa mit Leuchtorganen am Bauch und den Malacosteus niger, der an den Kopfseiten je zwei Leuchtflecke besitzt, von denen der eine in goldigem, der andere in grünlichem Lichte strahlt. Es scheint, daß der letztere mit seinen Laternen wie eine Lokomotive die Bahn, die er durchmißt, beleuchten kann.
Abenteuerliche Fischgestalten treten uns in dem Eurypharynx pelecanoides und dem Melanocetus Johnstoni entgegen. Bei dem ersteren bildet der Rachen den Haupttheil des Körpers, der letztere hat dagegen am Schlunde eine sackartige Ausbuchtung, in welcher er die in glücklichen Tagen erhaschte Beute aufbewahren kann, um in Zeiten der Noth nicht fasten zu müssen. –
[84] Als man diese eigenartigen Thierformen kennen zu lernen anfing, hoffte man, daß die Tiefseeforschung uns uralte Arten enthüllen werde, die in früheren geologischen Epochen lebten, an der Oberfläche aber längst ausgestorben sind.
Bald gelangte man jedoch zu einer anderen Ueberzeugung; in der Finsterniß der Seetiefen keimte nicht zuerst das Leben, seine Wiege stand dort, wo der helle Sonnenschein die Welt verklärt; die Küsten- und selbst die Landfauna ist älter als die der Tiefsee; denn erst von der flachen Küste und der Oberfläche des Meeres wanderten allerlei Thiere nach der Tiefe und paßten sich den neuen Lebensbedingungen nach und nach an. In unvordenklichen Zeiten begann jene Einwanderung und sie geschieht noch heute. Darum finden wir auch in der Tiefsee neben echten Tiefseethieren allerlei Uebergangsformen, die uns an die Thiere der Flachsee gemahnen. Die einen sind längst erblindet, die anderen besitzen noch gut entwickelte Sehorgane. Die Eier der einen entwickeln sich im Dunkel der Tiefe, die Eier der anderen steigen noch nach altem Gesetz an die Oberfläche, um hier sich zu entwickeln, und erst die junge Brut kehrt zu den Vätern in der Tiefe zurück. Diese Mannigfaltigkeit der Uebergangsformen gebietet uns, in unseren Schlüssen vorsichtig zu sein; wir können nicht ohne weiteres aus dem Vorhandensein der Organe auf deren Zweckmäßigkeit in der Tiefe schließen, wir können nicht entscheiden, was den Bewohnern der tiefuntersten Gründe mehr frommt: Augen und Leuchtapparate, oder der Stab der Blinden! „Wie wenig wissen wir!“ Der Ausruf, den Linné vor mehr als hundert Jahren bei seiner Beschreibung der Natur des Meeres gethan hat, er paßt noch heute auf unser Wissen trotz der ungeahnten Ausdehnung unserer Kenntnisse. Als das englische Schiff „Challenger“ von seiner denkwürdigen Fahrt zurückgekehrt war, erschien der Reichthum an mitgebrachten Funden so groß, daß man behauptet hat: ein Mann, der die Kenntnisse von 20 Spezialisten besäße, müßte 75 Jahre angestrengt arbeiten, um das Material zu bewältigen. Viele Forscher haben sich in jene Arbeit getheilt; fünfundzwanzig stattliche Bände sind bereits über diese Expedition erschienen und das Material regt immer noch zu neuen Arbeiten an!
Wir haben bis jetzt nur die allgemein bekannten und dem bloßen Auge sichtbaren Seethiere berührt. Das Meer birgt aber noch einen ungeheuren Reichthum an winzig kleinen Lebewesen. Ihre Bedeutung im Haushalt der Natur ist uns bei der Betrachtung des weißen Tiefseeschlammes klar geworden; lernen wir jetzt, wenn auch flüchtig, einige Vertreter dieser winzigen Geschöpfe näher kennen! Wir haben hier die unterste Thierklasse vor uns, die Urthiere, die nur aus einer Zelle bestehen, die einfachsten Organismen ohne Organe. Alle Funktionen des Lebens werden hier von dem Protoplasma, der Zelle, besorgt. Dieses entsendet Fortsätze, Scheinfüßchen, welche die Bewegung und den Fang der Beute ermöglichen; es frißt und verdaut und fühlt. Die Foraminiferen oder Kammerlinge bilden eine Abtheilung dieser Klasse, auf unserer Abbildung S. 83 sehen wir in der Mitte ein einfaches Wesen dieser Art. Eine eiförmige Kalkschale fällt uns zunächst auf, sie hat eine einzige Oeffnung, aus der die vielen Scheinfüßchen hervortreten und netzartige Maschen bilden. Unsere Foraminifere hat soeben eine Diatomee erbeutet; rechts ist dieselbe von den Scheinfüßchen umstrickt; das Protoplasma der Foraminifere saugt aus der Alge allen Nahrungsstoff aus und läßt dann die leere Schale fahren.
Die Zahl der Foraminiferenarten ist eine ungeheuere; Hunderte sind bereits bekannt und die Mannigfaltigkeit der Formen ist eine außerordentliche, einige derselben, oder vielmehr deren Schalen finden wir auf unserer Abbildung rings um die oben beschriebene gruppirt. Fast alle diese Foraminiferen tragen eine Kalkschale, die je nach dem Kalkgehalt des Seewassers bald dünner, bald dicker ist. Andere Urthiere, die Strahlinge, zeichnen sich durch ihren Kieselpanzer aus.
Das Vorkommen dieser niedrigen und winzigen Thiere ist für die Fauna des Meeres von der größten Bedeutung. Man hat gesagt: „Wo der Globigerinenschlamm vorhanden ist, dort herrscht überall reiches Leben, wo er verschwindet und der rothe Tiefseethon auftritt, dort erstrecken sich die Wüsten des Meeresgrundes.“ Aber nicht allein an der Küste oder am Meeresgrunde können wir die Bedeutung dieser Wesen kennen lernen; wir müssen zu diesem Zwecke hinaussteuern auf das offene weite Meer, welches an seiner Oberfläche wieder eine andere, die pelagische Fauna beherbergt, aus dessen weiten Fluthen die Thiere in Scharen dahinziehen, wie die Herden der Steppe von Weide zu Weide wandern, oder willenlos umhergetrieben werden, ein Spiel von Wind und Wellen!
Quitt.
Alle Rechte vorbehalten.
Es vergingen, ohne daß auf seiten Lehnerts etwas geschehen wäre, gegen anderthalb Wochen, und wär’ auch wohl noch weiter so gegangen, wenn nicht die Plaudertasche, die Christine, gewesen wäre, die beständig alles, was drüben in der Försterei vorging, zu den Menzes hinübertrug. Unter den keinen Freiheiten, die sie sich regelmäßig nahm, war auch die, daß sie den Opitzschen Schreibtisch beim Aufräumen und Staubabwischen einer gründlichen Musterung unterzog, so daß sie jederzeit wußte, wie die Dienstsachen standen. War das nun schon ihr alltägliches Thun, so doppelt, seitdem Lehnert in Gefahr schwebte, der Gegenstand oder das Opfer einer Opitzschen Schreibübung zu werden. Eine ganze Woche lang hatte sich nichts finden lassen, heut aber, es war der Tag vor dem vierten Sonntage nach Trinitatis, war ihr der lang erwartete Bericht an den Grafen, in geschnörkelter Abschrift und sauber zwischen zwei Löschblätter gelegt, zu Gesicht gekommen, und ehe noch eine Viertelstunde um war, war sie schon drüben, um ihre Neuigkeit vor die rechte Schmiede zu bringen.
„Liebe Frau Menz, ich habe es nun alles gelesen. Es sind drei Seiten, alles fein abschrieben und unterstrichen, denn er hat ein kleines Pappelholzlineal, das nimmt er immer, wenn er unterstreichen will, und das sind allemal die schlimmsten Stellen.“
„Jesus,“ sagte Frau Menz und zitterte. „Sie können ihm doch nicht ans Leben, bloß um den Has’, und der war noch dazu so klein, als ob er keine drei Tage wär’, und ich hab ihn eigentlich nicht essen können vor lauter Angst, bloß einen Lauf und das Rückenstück, weil es doch zu schade gewesen wäre. Ach, du meine Güte, wenn er um so ’was sterben sollte, da wäre ja keine Gerechtigkeit mehr und der Kaiser in Berlin wird doch wissen, daß er ein so guter Görlitzer war und daß er’s beinah gekriegt hätte . . . “
„Gott, liebe Frau Menz, was Sie nur alles reden, so schlimm ist es ja nicht. Und wär’ überhaupt gar nicht so schlimm, wenn es nicht das zweite Mal wär’, oder was sie, die so ’was schreiben, den ‚Wiederbetretungsfall‘ nennen. Das ist das Wort, das drin steht. Und da machen sie denn gleich aus dem Floh ’nen Elefanten und thun, als ob es wunder was sei, nicht weil es wirklich was Großes und Schlimmes wäre, nein, bloß von wegen des zweiten Mals, von wegen des Wiederholungsfalls. Und da sind sie denn wie versessen drauf und das war auch die Stelle mit dem dicken Strich . .. Das heißt die eine.“
„Die eine? Aber Du mein Gott, war denn noch eine?“
„Gewiß war noch eine da, die war noch dicker unterstrichen, und das war die von seinem Charakter.“
„Ach, Du meine Güte! Von seinem Charakter! Und die hat Opitz auch unterstrichen? Ja, was soll denn das heißen? Ein Charakter is doch bloß wie man is. Und wie is man denn? Man is doch bloß so, wie einen der liebe Gott gemacht hat, und wenn man auch nicht alles thun darf, aber seinen Charakter, ja, Du mein Gott, den hat man doch nu mal und den wird man doch haben dürfen und den kann er nicht unterstreichen. Und ein Mann wie Opitz, den ich immer beknixt habe, wie wenn er der Graf wäre! Gott, Christine, sage, Kind, was steht denn drin und was hat er denn alles gesagt?“
„Er hat gesagt, ‚daß man sich jeder That von ihm zu gewärtigen habe‘, das steht drin, Frau Menz, und das Wort ‚jeder‘ ist noch extra roth unterstrichen und sieht aus wie Blut, so daß
[85] [86] ich einen richtigen Schreck kriegte und bloß nicht wußte, an wen ich dabei denken sollte, ob an Opitzen oder an Lehnert. Ja, liebe Frau Menz, ,jeder That’, so steht drin, und daß er aus diesem Grunde beantrage, die Strafe streng zu bemessen, und zweitens auch deshalb, weil er viel Anhang und Zuhörerschaft habe und überall in den Kretschams herumsitze und den Leuten Widersetzlichkeit beibringe, was um so thörichter und strafenswerther sei, als er eigentlich einen guten Verstand habe und sehr gut wisse, daß alles, was er so predige, bloß dummes Zeug sei. Er sei ein Verführer für die ganze Gegend, so recht eigentlich, was man einen Aufwiegler nenne, und rede beständig von Freiheit und Amerika und daß es da besser sei als hier, in diesem dummen Lande. Ja, Frau Menz, das alles hat Opitz geschrieben, und am Schlusse hat er auch noch geschrieben, daß man an Lehnert ein Exempel statuiren müsse, damit das Volk ’mal wieder sähe, daß noch Ordnung und Gesetz und ein Herr im Lande sei.“
„Das alles?“
„Ja, Frau Menz, das alles. Denn das weiß ich schon, weil ich öfter so ’was lese, wenn er erst mal im Zug ist, dann ist kein Halten mehr, und auf eine Seite mehr oder weniger kommt es ihm dann nicht an, schon weil er eine hübsche Handschrift hat und mitunter zu mir sagt: ,Nu, Christine, wie gefällt Dir das große H?’ und vor allem, weil er gerne so was schreibt von Ordnung und Gesetz und dabei wohl denken mag, so was lesen die Herren gern und halten ihn für einen pflichttreuen Mann.“
Christine hätte wohl noch weiter gesprochen, aber Lehnert, der schon von früh an oben im Dorf gewesen war, kam eben von Krummhübel zurück, wohin er eine Wagenachse abgeliefert hatte. Christine mocht’ ihm nicht begegnen, um nicht aufs neue in ein Gespräch verwickelt zu werden, oder vielleicht auch, weil sie die Wirkung der schlimmen Nachricht auf ihn nicht selber sehen wollte. So nahm sie denn ihren Weg über den nach der Waldseite hin gelegenen Brückensteg und kehrte auf einem Umwege und unter Benutzung einiger im Lomnitzbette liegender Steine nach der Försterei zurück.
Frau Menz hatte zu schweigen versprochen, aber sie war unfähig, etwas auf der Seele zu behalten, und so wußte Lehnert nach einer Viertelstunde schon, was Christine berichtet hatte.
„Laß ihn, er wird nicht weit damit kommen!“
Er sagte das so hin, um die Mutter, so gut es ging, zu beruhigen, in seinem Herzen aber sah es ganz anders aus, und er ging auf das Fenster zu, das er aufriß, um frische Luft einzulassen. Er hatte diesen Ausgang wohl für möglich, aber, bei der Fürsprache drüben, keineswegs für wahrscheinlich gehalten, und nun sollte doch das Schlimmste kommen, und wenn er sich diesem Schlimmsten entziehen wollte, so gab es nur ein Mittel und mußte nun das geschehen, womit er bis dahin in seiner Phantasie bloß gespielt hatte: Flucht. Ungezählte Male war es ihm eine Freude gewesen, von dem elenden Leben in diesem Sklavenlande zu sprechen, von der Lust, dieser Armseligkeit und Knechterei den Rücken zu kehren und übers Meer zu gehen, und doch – jetzt, wo die Stunde dazu da war, das immer wieder und wieder mit Entzücken Ausgemalte zur That werden zu lassen, jetzt wurd’ er zu seiner eigenen Ueberraschung gewahr, wie sehr er seine Heimath liebe, sein Schlesierland, seine Berge, seine Koppe. Das sollte nun alles nicht mehr sein! Um nichts oder um so gut wie nichts war er das erste Mal von Opitz zur Anzeige gebracht worden und um nichts sollt’ es wieder sein! Und wenn es etwas war, wer war schuld daran? Wer anders als „der da drüben“, der ihm den Dienst verleidet hatte, sonst war’ alles anders gekommen und er wäre, was eigentlich sein Ehrgeiz und seine Lust war, bei den Soldaten geblieben und hätte seinem König weiter gedient und hätte jedes Jahr Urlaub genommen und wäre dann mit dem Hirschfänger und dem Czako durch die Dorfstraße gegangen und alles hätte gegrüßt und sich über ihn gefreut. „Um all das hat er mich gebracht, weil er mir’s mißgönnte, weil er nicht wollte, daß einer neben ihm stünde. Ja, er ist schuld, er allein. Um das Kreuz hat er mich gebracht, aber mein Haus- und Lebenskreuz war er von Anfang an und hat mich geschunden und gequält, und wie damals, so thut er’s auch heute noch. Er hat mir das Leben verdorben und mein Glück und meine Seligkeit.“
Als er das letzte Wort gesprochen, brach er ab und sah vor sich hin. Alles was in Nächten, wenn er nicht schlief, ihm halb traumhaft erschienen war, erschien ihm in diesem Augenblicke wieder, aber nicht als ein in Nebelferne vorüberziehendes Bild, sondern wie zum Greifen nah’, und in seiner Seele klang es noch einmal nach „und meine Seligkeit.“
Es war Mittag und Frau Menz brachte die Mahlzeit. Aber Lehnert aß nicht, und als die Alte ihm zuredete, wies er es kurzer Hand ab, stand auf und ging in seine Kammer, um, was ihn peinigte, los zu werden und Ruhe zu suchen. Wenn er hätte schlafen können! Aber er fühlte nur, wies hämmerte. Mit einem Male sprang er auf. „Nein, ich bleibe. Nicht fort. Ich will nicht fort. Einer muß das Feld räumen, gewiß. Aber warum soll ich der eine sein? Warum nicht der andere? Mann gegen Mann . . . und oben im Wald . . . und heute noch. Ich sage nicht, daß ich’s thun will, ich will es nicht aus freien Stücken thun, nein, nein, ich will es in des Schicksals Hand legen, und wenn das es fügt, dann soll es sein . . . Und das Papier drüben und alles, was drin steht, das will ich schon aus der Welt schaffen . . . Und wenn ich ihm nicht begegne, dann soll es nicht sein und dann will ich mich drein ergeben und will ins Gefängniß, oder will weg und über See.“
Lehnert war klug genug, alles was in diesen seinen Worten Trugschluß und Spiegelfechterei war, zu durchschauen, aber er war auch verrannt und befangen genug, sich drüber hinwegzusetzen, und so kam es, daß er sich wie befreit fühlte, nach all dem Schwanken endlich einen bestimmten Entschluß gefaßt zu haben. Er wartete bis um die sechste Stunde, legte dann wie stets, wenn er ins Gebirge wollte, hirschlederne Gamaschen an und stieg, als er sich auf diese Weise marschfertig gemacht hatte, von seiner Bodenkammer wieder in die Wohnstube hinunter. Hier riß er aus dem unter der Jagdflinte hängenden Kalender ein paar Blätter heraus und wickelte was hinein, was wie Flachs oder Werg aussah. Alles aber that er in eine Ledertasche, wie sie die Botenläufer tragen, gab dann der Alten, unter einem kurzen „Adjes Mutter“, die Hand und ging auf das sogenannte „Gehänge“ zu, den nächsten Weg zum Kamm und zur Koppe hinauf. Drüben in der Försterei schien alles ausgeflogen. Nur Diana lag auf der Schwelle und sah ihm nach.
Lehnert verfolgte seinen Weg, der ihn zunächst an den letzten Häusern von Wolfshau vorüber führte. Von hier aus bis zu dem das gräfliche Jagdrevier auf Meilen hin einhegenden Wildzaun waren keine tausend Schritt mehr, ein mit Kusseln besetztes Waldvorland, auf dem sich in diesem Augenblick eine Krummhübler Kinderschar heranbewegte, lauter halbwachsene Mädchen, die, von ihrem Lehrer geführt, eine Tagespartie nach der Schwarzen Koppe hinauf gemacht hatten. Lehnert blieb stehen. Als sie näher kamen, sah er, daß sie Blumen in Haar und Hand trugen. Und dazu sangen sie:
Schlesierland! Schlesierland!
Du bist es, wo meine Wiege stand.
Wo die Schneekoppe hoch in die Wolken steigt,
Wo der Kynast grau die Zinnen zeigt,
Wo Rübezahl tief im Berge thront,
Wo Liebe, Frohsinn, Treue wohnt,
Schlesierland! Schlesierland!
Du bist es, wo meine Wiege stand.
Es war dasselbe Lied, das er in seinen Knabentagen und dann später, bei den Jägern, auf manchem heißen Marsch in Frankreich gesungen hatte. Wie das Lied ihn jetzt ins Herz traf! Er trat zurück, um den jungen Dingern, von denen die meisten ihn kannten, den Weg frei zu geben. Sie nickten ihm zu und eine gab ihm im Vorübergehen den Enzianenkranz, den sie hoch oben im Gebirge gepflückt und geflochten hatte. „Da, Lehnert!“ Und kaum, daß sie vorbei waren, so nahmen sie das Lied wieder aus und sangen die letzte Strophe:
Schlesierland! Schlesierland!
Du bist es, wo meine Wiege stand,
Ach, werd’ ich je Dich wiederseh’n,
Im Schatten Deiner Tannen geh’n.
Und sehen, wie die Wolken zieh’n’?
Auch in der Ferne knüpft mich ein Band
An Dich, geliebtes Heimathland.
[87] Lehnert hatte die Schlußzeilen unwillkürlich mitgesungen und wiederholte sie sich, als ob er in diesem Augenblicke schon ein tiefstes Heimweh in seinem Herzen empfunden hätte.
Dabei war er bis an den Wildzaun gekommen, bis an das Gatter, aus dem die Mädchen eine kleine Weile vorher herausgetreten waren. Er öffnete jetzt seinerseits das aus Holzstämmen zusammengefügte, schwer in den Angeln gehende Thor und ließ es wieder ins Schloß fallen, und der Ton, mit dem es einklinkte, durchfuhr ihn und ließ ihn zusammenschauern. Er war nun drin in dem Waldgehege. Was war geschehen? oder doch vielleicht, wenn er wieder heraustrat? Aber er entschlug sich solcher Gedanken und schritt die geradlinige, steile Straße hinauf, das „Gehänge“, das hier am Gatter seinen Anfang nahm und abwechselnd an hochstämmigem Wald und niedriger Kusselheide vorüberführte. Dann und wann kamen auch Wiesenstreifen und Streifen von Moorgrund. Es war jetzt um die siebente Stunde und hier oben herrschte schon Dämmer und abendliches Schweigen und nur dann und wann hörte man das Klucken und Glucksen eines bergabschießenden Wasserlaufes oder eine vereinzelte Vogelstimme. Kein Schmettern oder Singen, nur etwas, das wie Klage klang. Am Himmel, der hell leuchtete, wurde die Mondsichel sichtbar, ein blasser Ring, und einmal war es Lehnert, als ginge wer neben ihm her. Aber es war eine Sinnestäuschung, und wenn er seinen Schritt anhielt, schwieg auch der begleitende Schritt im Walde.
So war er, das „Gehänge“ hinauf, schon bis ziemlich hoch gekommen und durch eine bergan steigende Lichtung im Walde konnt’ er bereits den Gebirgskamm in aller Deutlichkeit erkennen. Er sah aber nicht lange hinauf, sondern setzte sich, plötzlich der Ruhe bedürftig, auf eine Bank, die man hier, wohl zu Nutz und Frommen bergansteigender Sommergäste, zwischen zwei dicht nebeneinander stehenden Tannen angebracht hatte. Das dachartig überhängende Gezweige war Ursache, daß es um die ganze Stelle her schon dunkelte, trotzdem war es noch hell genug, um alles Nächstliegende deutlich erkennen zu können. An der anderen Seite des Weges sprang ein Quell aus einer nur wenig übermannshohen Felswand, und der Umstand, daß man dem Quell eine zierliche Holzrinne gegeben und ihn in einen von Moos überwachsenen Steintrog geleitet hatte, gab diesem Rastplatz etwas von einem Waldidyll, An dem Steintroge vorbei zog sich, nicht allzu weit unter dem Kamm hin, ein dem Zuge desselben folgender Pfad, der zuletzt auf die Hampelbaude zulief.
Lehnert wußte hier Bescheid auf Schritt und Tritt und hatte manch liebes Mal auf dieser Bank gesessen und nach dem Quell hinübergesehen und gehorcht, ob vielleicht Opitz aus dem Unterholz heraustreten würde. Fast zu gleichem Zwecke saß er wieder hier, und als sich’s drüben einen Augenblick wie regte, schoß ihm das Blut zu Kopf und er griff unwillkürlich nach links, wie wenn er, der doch noch ohne Waffe war, das Gewehr von der Schulter reißen wollte. Rasch aber entschlug er sich seiner Erregung wieder und an ihre Stelle trat ein Lächeln.
Er wurd’ überhaupt wieder unsicher und verlangte, von der Begegnung ganz abgesehen, nach einem Zeichen, das ihm sage, was er zu thun habe. So brach er denn einen dürren Zweig ab und machte zwei Lose daraus, in Länge nur wenig von einander unterschieden, und that beide in seinen Hut. Und nun schüttelte er und zog und maß. Er hatte das etwas längere Stück gezogen. „Gut denn . . . es soll also sein . . . “ und mit einer Raschheit, in der sich die Furcht vor einem abermaligen Schwanken und Unschlüssigwerden aussprach, erhob er sich von seiner Bank und schlängelte sich mit einer Findigkeit, die deutlich sein Zuhausesein an dieser Stelle zeigte, durch allerhand dichtes Unterholz bis auf eine Waldwiese, die nach der einen Seite hin, ganz besonders aber in der Mitte mit, riesigen Huflattichblättern überwachsen war, während sie nach der anderen Seite hin in buschhohem Farrenkraut stand, das sich heckenartig an einer niedrigen Felswand entlang zog. In dieser Buschhecke war nirgends ein Einschnitt, weshalb Lehnert, der dies sehr wohl wußte, seinen Eingang von der Seite her nahm und sich zwischen dem Farrenkraut und der Felswand hindurchdrängte, mit seiner Rechten an dem Gesteine beständig hintastend. Als er bis in die Mitte gekommen, war auch die Felsspalte da, nach der er suchte, freilich nur schmal und eng. Er streifte deshalb den Aermel in die Höh’, um bequemer mit Hand und Unterarm hinein zu können, und nahm, als ihm dies gelungen, aus einer in der Felsspalte befindlichen Rische sein Doppelgewehr heraus, das hier, bis an den Kolben in ein Futteral von Hirschleder gesteckt, seinen Versteck hatte. Gleich danach hielt er auch Pulverhorn und Schrotbeutel in Händen, und abermals einen Augenblick später riß er von einem der von seiner Wohnung her mitgenommenen allen Kalenderblätter einen breiten Streifen ab, der als Schußpfropfen dienen sollte, lud beide Läufe, setzte die Zündhütchen auf und hakte das mit zwei Drahtösen versehene Stück Werg, das ein falscher Bart war, über die Ohrwinkel. Und nun wand er sich, wie vorher zu dem Versteck hin, so jetzt mit gleicher Raschheit durch Farrenkraut und Unterholz zurück und trat wieder auf die große Straße hinaus. Er war derselbe nicht mehr. Der flachsene Vollbart, der aus Zufall oder Absicht tief eingedrückte Hut, der Doppellauf über der Schulter – das alles gab ein Bild, das in nichts mehr an den Lehnert erinnerte, der vor einer Viertelstunde noch, schwankend und unsicher, auf der Bank am Quell gesessen hatte.
„Nun soll’s kommen,“ sprach er vor sich hin und stieg höher hinauf, auf den Grat des Gebirges zu.
Stiller wurd’ es und niemand begegnete ihm. Nur ein-! mal trat ein Rehbock auf eine Lichtung und stand und Lehnert griff schon nach dem Gewehr, um anzuschlagen. Aber im nächsten Augenblicke war er wieder anderen Sinnes geworden. „Nein, nicht so. Sein Schicksal soll über ihn entscheiden, nicht ich. Ich will ihn nicht Heranrufen; ich hab’ es in eine höhere Hand gelegt.“ Und sein Gewehr wieder über die Schulter hängend, schob er sich weiter an den Tannen hin. Aber es waren ihrer nicht allzu viele mehr, immer lichter wurd’ es zwischen den Stämmen, und kaum hundert Schritte noch, so lag der Wald zurück und ein breites Stück Moorland that sich auf, durch das jetzt mittenhindurch der Weg unmittelbar auf den Grat hinaufführte. Wo der Torf nicht zu Tage lag, war alles von einem gelben, sonnverbrannten Gras überwachsen, dazwischen aber blinkten Sumpf und Wasserlachen, auf deren schwarzer Fläche die Mondsichel sich spiegelte. Kein Leben, kein Laut. Aber während Lehnert dieser Lautlosigkeit noch nachhorchte, klang plötzlich durch die tiefe Stille hin ein helles Läuten herauf.
„Das ist das Kapellchen unten. Das fängt an und läutet den Sonntag ein.“
Und wirklich, ehe noch eine Minute vergangen war, fiel das ganze Thal mit all seinen Kirchen- und Kapellenglocken ein und wie im Wettstreit klangen die Tonwellen mächtig und melodisch bis auf den Koppengrat hinauf. Und nun war auch Lehnert oben und, sah hinab. Der Mond gab eben Licht genug, ihn unten im Thal, drin eben ein dünner Nebel aufstieg, alles wie in einem halben Dämmer erkennen zu lassen. Lange sah er hinab, bis das weite Thal unten nichts mehr als eine Nebelkufe war. Nur um ihn her war noch klare Luft und die Mondsichel blinkte.
„Wohin?“
Er sah nach links hin, den Grat entlang, und bemerkte das Licht, das oben auf der Koppe schimmerte.
„Wenn ich mich ’ran halte, bin ich in zwanzig Minuten oben . . . Und dann bin ich ihm nicht begegnet. Aber warum nicht? Weil ich ihm nicht begegnen konnte, weil ich ihm aus dem Wege gegangen bin. Ist das das Rechte? Heißt das sein Schicksal befragen? Ich darf ihm nicht aus dem Wege gehen, das ist kein richtig Spiel; ich muß dahin, wo sich’s begegnen läßt . . . Da ist mein Platz.“
Und rasch entschlossen, wandt’ er sich wieder und schritt denselben Weg zurück, auf dem er gekommen war.
So lang er das Moor und seine freie Fläche zu Seiten hatte, hing er allerhand Träumereien nach, kaum aber war der Hochwald wieder um ihn her, so schien auch sein Auge zwischen den Stämmen hin das Dunkel durchdringen zu wollen. Aber es blieb trotzdem wie’s war und er war schon wieder bis an jene Wegstelle gekommen, wo sich die Bank befand und der Quell in den Steintrog fiel, ohne daß sich etwas geregt oder ihm auch nur im geringsten die Gegenwart seines Gegners verrathen hätte. „Was soll er auch hier auf der großen Straße? Feigheit, nichts als Feigheit!“ Und sich von der Bank her, drauf er abermals eine kurze
[88][89] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [90] Rast genommen hatte, zum Weitergehen anschickend, bog er drüben in den am Steintroge vorüberführenden Querpfad ein, der in langer Linie, wagerecht und ohne jede Steigung, auf die Hampelbaude zuführte. „Da will ich hin. In der Hampelbaude will ich schlafen. Und hab’ ich ihn bis dahin nicht getroffen, so soll es nicht sein. Und ich muß ins Gefängniß oder in die weite Welt.“
Er konnte nicht anders sprechen, denn er wußte nur zu gut, daß er bis dahin mit der Begegnungsfrage bloß gespielt hatte; jetzt aber mußte sich’s zeigen. Und wunderbar, statt erregter zu werden, ward er mit jedem Augenblicke stiller und seine Seele ruhiger, vielleicht weil er jetzt ein Ende absah. Und ihn verlangte danach, so oder so. Nur eines war ihm lästig, die Mondsichel blinkte so hell, als ob Vollmond wäre. „Der Bart ist doch immer nur eine halbe Verkleidung. Und wenn die Todten auch schweigen .. . Es wäre besser, die Wolke drüben legte sich vor.“
Und wirklich, sie that’s. Und was jetzt niederflimmerte, war nur noch das matte Licht der Sterne . . .
„Steh!“
Opitz war um eine Weg- und Buschecke gebogen und hielt auf fünf Schritt.
Und Lehnert stand.
„Gewehr weg! Was ein Richtiger ist, der weiß, wie sich’s gehört. Aber Du bist wohl ein Böhmscher … Eins, zwei . . .“
Lehnert zögerte noch.
„Gewehr weg . . . Drei.“ Und im selben Augenblicke schlug der Hahn auf das Piston. Aber das Zündhütchen versagte.
Und nun schlug auch Lehnert an und zwei Schüsse krachten.
Opitz brach zusammen.
In engem Bogen an ihm vorbei ging Lehnert auf die Hampelbaude zu.
Zehn Uhr war durch, als Lehnert, der inzwischen sein Gewehr an einem anderen Versteckort wieder untergebracht hatte, bei der Hampelbande eintraf. Trotz später Stunde war noch Leben drin, sogar Tanz, zu dem zwei böhmische Harfenstimmen von mittleren Jahren und ein zwölfjähriger Geiger lustig aufspielten. Lehnert setzte sich und ließ sich ein Nachtessen geben, als es aber vor ihm stand, schob er, es wieder zurück und sprach nur dem Bier zu. Was um ihn her tanzte, waren Sommergäste, Berliner, darunter Mütter, die dicht vor der silbernen Hochzeit, und Töchter, die dicht vor der ersten Konfirmationsstunde standen. Auch die Väter waren, in Ermangelung anderen Tanzmaterials, mit herangezogen worden, behäbige Männer mit ängstlich kurzen Hälsen. Dazwischen trippelten die Backfische mit hohen Knöpfstiefeln und lang herabhängendem Haar, dessen letzte natürliche Welle dem vorausgegangenen sechsstündigen Marsch in der Julihitze längst zum Opfer gefallen war.
Lehnert sah auf das Treiben, und mitunter konnt’ es fast den Anschein gewinnen, als freue er sich darüber, am meisten wenn die jungen Dinger, von denen einige immer aus dem Takte heraus und andere noch gar nicht hinein waren, an ihm vorbeiwalzten. Dann aber schwand mit einemmal wieder alles, was um ihn her war, und er sah wieder Opitz um die Buschecke biegen, hörte, wie der Hahn aufschlug, und sah seinen Gegner zusammenbrechen. „Er hat es nicht anders gewollt . . . Ob er todt ist’? . . . er muß todt sein . . .“ Und während er noch so sann und in sich hinein redete, trat er aus dem heißen Saal ins Freie hinaus und sah nach dem Gehänge hinüber und dann hinauf in den gestirnten Himmel. Da stand die Sichel in aller Klarheit über ihm, aber über dem Todten am Wege stand sie auch.
Eine kalte Nachtluft ging und Lehnert trat wieder in den Saal, der sich allmählich zu leeren anfing.
Als die letzten fort waren, erschien Lissi, seine gute Freundin, auch eine Böhmin, in der Thür und sagte: „Nun, Lehnert, was meinst? Wenn ich der Bertha zurede, spielt sie noch einen Ländler auf, einen Ländler oder einen Schott’schen.“ Und die Harfenistin, die jedes Wort, das die beiden sprachen, gehört und guten Grund zur Freundschaft mit der Kellnerin hatte, fuhr auch gutwillig über die Saiten. Aber Lehnert wich aus und sagte, daß er die fremden Herrschaften, die gewiß sehr müde seien, in ihrem Schlafe nicht stören wolle.
„Was Du da nur redst, Lehnert. Du willst halt nit. Das is alles. Aber gieb acht, wenn Du willst, will ich nit.“ Und damit griff sie nach einer ganzen Anzahl von Seideln, die leer auf den Tischen umher standen, und ging spöttisch und hochmüthig an Lehnert vorüber. Zuletzt kam auch der Wirth. „Nu, Lehnert, ich sehe, Du willst zu Nacht bleiben. Schlimm; alles voll bis unters Dach. Aber komm nur, ich weiß schon, was Du gern hast.“ Und dabei ging er voran und stieg, während Lehnert folgte, draußen am Giebel eine Leiter hinauf, die zu nächst bis an eine Lukenthür und durch diese hindurch nach dem Heuboden führte.
Lehnert machte sich’s hier bequem und suchte zu schlafen. Aber es war zu schwül und der Heugeruch zu stark. So trat er denn wieder bis an die Lukenthür heran und riß einen der beiden Flügel auf. Aber eben so rasch schloß er ihn wieder. Schräg über ihm stand die Mondsichel und sah herab auf ihn und fragte.
Bald nach Tagesanbruch war Lehnert auf. Alles schlief noch und nur das hübsche böhmische Mädchen, das er am Abend zuvor durch sein „Nein“ erzürnt hatte, stand im Hof und spaltete Holz. Sie schien ihn nicht sehen zu wollen. Er trat aber an sie heran und sagte: „Laß gut sein, Lissi. Du weißt, ich bin kein Spielverderber und weiß, was sich paßt. Und wenn einem ein hübsches Mädel, und nun gar eins wie Du, einen Kuß oder einen Tanz anbietet, da soll man nicht nein sagen. Das weiß ich so gut wie einer. Und hab’ ich Dir schon was abgeschlagen? Nun, siehst Du, Du lachst! Also laß gut sein! Ich konnte nicht, mir war so schwindlig und ich hätte von dem Bier nicht trinken sollen. Und nun mache mir einen Kaffee, hörst Du? Und vergiß nicht, wer zuerst kommt, der mahlt zuerst. Für die Berliner ist das andere gut genug.“
„Pst!“
„Ach, die schlafen ja noch.“ Und damit ging er auf einen Vorplatz zwischen Stall und Giebel und setzte sich in eine Gitterlaube, die an der windgeschützten Seite mit Winden spärlich umwachsen war.
Und nicht lange, so kam der Kaffee mit Brot und Butter und einem Cognac; denn Lissi kannte seine Gewohnheiten. „Auf Dein Wohl, Lissi! Und das nächste Mal tanz’ ich, bis ich umfalle.“ Und als er das sagte, streckte er die Hand nach ihr aus. Aber sie gab ihm einen Klaps und sagte: „Du denkst halt, jede Stund’ ist gut zum Brezelbacken. Aber da irrst, das is nit wahr. ,Wer nicht kommt zur rechten Zeit’ . . . Und jetzt ist nicht rechte Zeit und morgens ist nicht abends . . . Aber mein Gott, da klingelt es schon und ruft auch schon. Ich wette, das ist die dicke Madame, die gestern tanzte, wie wenn ihre Hochzeit wär’.“
Wirklich, es war drinnen im Hause lebendig geworden, und Lissi ging hinein und überließ Lehnert seinem Frühstück und seinen Betrachtungen, die nicht freundlich, aber auch nicht traurig waren. Gestern, als er hier ankam, war er in einer vollständigen Erschöpfung gewesen und das Geschehene hatte noch mit all seinem Graus auf ihm gelastet. Das war aber über Nacht anders geworden, vier Stunden festen Schlafs hatten ihm seine Sprungkraft und Energie zurückgegeben und ließen ihn jetzt das Behagen an einem gut besetzten Frühstückstische voll genießen, was alles in allem überhaupt kein Wunder nehmen konnte; denn wenn er schon wie so viele andere die Fähigkeit hatte, sich die Dinge, auch die schlimmsten, nach seinem Wunsch und Bedarf zurecht zu legen, so war noch im besonderen alles, was sich gestern abend ereignet hatte, so wunderbar glücklich für ihn verlaufen, daß selbst ein zu Trugschlüssen und Spiegelfechtereien minder geneigter Charakter als der seine Veranlassung gehabt hätte, sich über Gewissensskrupel einigermaßen hinwegzusetzen. Was er vorgehabt hatte, nun, darüber mochte sich streiten lassen, was sich aber thatsächlich ereignet hatte, war nichts als ein Akt der Nothwehr gewesen Opitz hatte den ersten Schuß thun wollen, und wenn dieser Schuß versagt und ihm das Spiel in die Hand gegeben hatte, so war das so recht ein Zeichen, das ihn in seinem Gemüth beruhigen [91] durfte. Das Frühere mit der Begegnung oder Nichtbegegnung und dem Gottesurtheil darin, das war etwas Ausgeklügeltes gewesen, jetzt aber war das Schicksal aus freien Stücken für ihn eingetreten und hatte gegen Opitz entschieden. Er seinerseits war nur Werkzeug gewesen, dessen sich die Vorsehung zur Abstrafung eines bösen Menschen bedient hatte.
Dies waren so die Vorstellungen, in denen er sich erging und die so stark waren, daß selbst die Stimme des Mitleids darin erstickte. Nur an die Frau dacht’ er mit Theilnahme. „Sie war immer gut gegen mich; aber sie wird sich trösten und nach Jahr und Tag dem vielleicht danken, der’s that und sie mit befreite.“
Und nun war sein Frühstück beendet und er empfahl sich und ging auf die Riesenbaude zu. Hier angekommen, bog er in den Riesengrund ein, sich berechnend, daß er um Zehn in Trautenau sein könne. Da, das mußt’ er, fand er Freundschaft und Anhang und konnte leicht weiter, fort in die Welt, und war dann keine Noth und Gefahr mehr. Aber mußt’ er denn fort? Um was war denn überhaupt alles geschehen? Doch nur, um nicht in die Welt hinaus zu müssen. Wenn er aber umgekehrt Platz machen wollte, dann konnte ja „der andere“ bleiben und die Leute weiter quälen. Nein, er durfte nicht gehen! Wenn er ging, war alles umsonst gewesen. So sann er auf seinem Wege hin und her, und als er bis Johannisbad gekommen war, war er entschlossen, den Weitermarsch bis Trautenau aufzugeben und in seine Wolfshauer Stellmacherei zurückzukehren. Es zog ihn mit einemmal wieder heim und ein seltsames Verlangen regte sich in ihm, Zeuge zu sein, wie nun alles kommen werde.
Der Abstieg war bequem gewesen, jetzt aber ging es wieder steil bergan und von Bequemlichkeit war keine Rede mehr. Indessen er war ein guter Steiger und schon um Vier war er wieder auf dem Koppenkamm und um Sechs in Wolfshau.
Die Mutter, die die Siebenhaarsche Predigt unten in Arnsdorf nicht versäumt hatte, stand am Herd und hielt just einen Bunzlauer Kaffeetopf und ein Stück Streußelkuchen in Händen, als Lehnert unter Kopfnicken eintrat.
„Guten Tag, Mutter!“
„Tag, Lehnert!“
„Weiter nichts, Mutter? Du bist doch sonst nicht so kurz. Nichts Neues? Nichts vorgefallen? Keine Menschenseele dagewesen? Der Streußel da kann doch nicht durch den Schornstein gekommen sein, wie der Klapperstorch oder der Gottseibeiuns.“
„Ach, rede doch nicht von dem, der kommt doch, der kommt auch so.“
„Durch die Thür, meinst Du?“
Sie nickte, that einen Zug und starrte dann wieder schweigend vor sich hin, ohne Lehnert anzusehen. Der schwieg auch. Endlich sagte sie: „Opitz ist noch nicht da.“
„So?“
„Die Frau war hier und weinte.“
„Warum?“
„Weil sie glaubt, daß ihm was passirt sein könne.“
Lehnert lachte. „Dann muß eine Förstersfrau jeden Tag weinen.“
„Und dann fragte sie nach Dir . . .“
„So, so. Und was sagtest Du?“
„Daß Du nach dem ,Waldhaus’ gewollt hättest und vom Waldhaus nach Arnsdorf . . . vielleicht von wegen dem Hof’ . . . zum Grafen. Aber ich wüßt’ es nicht genau.“
„Das ist recht, Mutter, daß Du das gesagt hast, daß Du gesagt hast, Du wüßtest es nicht genau. Das ist immer das beste, das mußt Du immer sagen. Und nun gieb mir einen Schluck von dem Kaffee da. Nein, laß lieber, ein Teller Milch ist mir besser. Ich bin verhungert und verdurstet. Seit heute früh keinen Bissen und keinen Tropfen.“
Beide standen auf, Lehnert um sich umzuziehen und die Gamaschen abzuthun, die Mutter, um ihm die Milch zu holen, die nach Landesbrauch in einer vom Ufer aus vorgebauten Steinhütte stand, durch welche die Lomnitz hindurch schoß und Kühle gab.
Als Lehnert wieder treppab kam, sah er, daß die Mutter ihm das Abendbrot vor dem Hause hergerichtet hatte, neben dem Rosenbusch, unter dessen überhängendem Gezweig er am liebsten saß. Drüben aber, in der Hausthür der Försterei, stand die gute Frau Opitz und sah abwechselnd nach dem Gehänge hinauf und dann wieder in die tiefroth untergehende Sonne.
„Nicht hier, Mutter!“
„Aber es ist doch Deine Lieblingsstelle!“
„Ja, sonst. Aber heute nicht.“
Und er hieß sie den Tisch mit anfassen und beide trugen ihn mit leichter Mühe durch den Flur, bis vor die Küchenthür. Da nahm er nun Platz und aß.
Als er damit geendigt hatte, stand er auf und ging wieder in die Vorderstube, in der jetzt völlige Dämmerung herrschte. Die Mutter war noch draußen, und so schritt er auf und ab und überlegte, was werden würde. Mit einemmal aber war es ihm, als würde die Klinke leis geöffnet und wieder ins Schloß gedrückt, und als er sich umsah, stand Christine vor ihm.
„Da, Lehnert!“ Und sie hielt ihm bei diesen Worten ein nach Art eines amtlichen Schreibens zweimal zusammengefaltetes Papier hin. Als er es auseinandergeschlagen und, ans Fenster tretend, einen Blick hineingeworfen hatte, sah er, daß es der Bericht war, in dem Opitz seinen Strafantrag gestellt hatte.
„Zerreiß’ es!“ sagte Christine. „Ich hab’ es gefunden. Es lag auf seinem Schreibtisch.“
„Aber er wird es suchen, wenn er nach Hause . . . wenn er wieder kommt.“
„Er kommt nicht wieder.“
Und damit war sie fort, und er sah nur, wie sie rasch über den Steg hinhuschte, wieder der Försterei zu.
„Er kommt nicht wieder,“ hatte Christine gesagt; – sie konnte nicht wissen, was geschehen war, und sie wußt’ es doch! Daß er von ihr nichts zu befürchten habe, das bewies das Papier, das er in Händen hielt, und doch könnt’ er sich eines Gefühls banger Unruhe nicht entschlagen. Erst hatte die Mutter in Andeutungen gesprochen und nun Christine. Wenn er vor aller Welt der war, gegen den sich der Verdacht wie von selbst richten mußte, so war er verloren oder hatte doch auf lange hin einen schweren Stand. Er war müde von dem vielstündigen Bergauf und Bergab, aber seine Erregung war doch so stark, daß es ihn zu Hause nicht litt. Er mußte wieder hinaus, und die Frage war nur: „wohin?“
Am nächsten lag ihm Vater Brauner, in dessen Ausschank „Zur Rabenklippe“ die Holzknechte zu verkehren und sich bei einer Stonsdorfer oder einem Ingwer gütlich zu thun pflegten; aber das war keine Gesellschaft, die heute für ihn paßte. „Was macht Opitz?“ oder „ist Opitz noch immer gut bei Wege?“ Das waren Fragen, die sich hier in zurückliegender Zeit, und noch ganz vor kurzem, mehr als einmal und mitunter mit ganz besonderer Betonung an ihn gerichtet hatten, und er erschrak bei dem Gedanken, daß sie sich auch heute wieder an ihn richten könnten. Das sollte nicht sein, und so beschloß er denn, statt in die „Rabenklippe“ lieber ein paar tausend Schritte weiter bis zu Exners in die „Schneekoppe“ zu gehen und in der wohlbekannten niedrigen Gaststube mit Gebirgsführern und Sesselträgern oder vielleicht auch mit alten Kriegskameraden, was immer das beste war, eine Unterhaltung zu suchen. Denn er sehnte sich danach, eine Stimme außer seiner eigenen zu hören und von seiner Unruhe loszukommen. Er griff denn auch bald nach seiner Soldatenmütze, die neben dem Gewehr und dem alten Kalender am Riegel hing, und schritt auf Krummhübel zu. Halben Weges zwischen Brückenberg und der Obermühls trat er von dem tiefergelegenen Wolfshau her auf den eine lange Schräglinie bildenden Fahrweg und sah nun einerseits nach Kirche Wang hinauf und andererseits nach Dorf Krummhübel hinunter, dessen weiße Giebel, trotz der schon herrschenden Dämmerung, in aller Deutlichkeit aus den vereinzelten Baumgruppen hervorblinkten. Der am deutlichsten blinkende Giebel aber war der von Exners „Schneekoppe“, und das helle Licht, das er dicht über der Straße flimmern sah, kam aus eben der Gaststube, drin er sich gütlich thun und hören und sprechen und alles, was ihn quälte, nach Möglichkeit vergessen wollte. Zwischen ihm und Exner lag nur noch der Gerichtskretscham und das kleine katholische Kapellchen mit seinem Sparrenwerk und seinem rothgestrichenen Dache.
[92] Der Abend fiel rasch ein, und nur über Arnsdorf, tief unten im Thal, hing noch ein rothes Gewölk, vor dem der Schattenriß eines Kirchthurms aufragte. Rechts daneben zog sich ein langes schloßartiges, matt erleuchtetes Fabrikgebäude, dessen Fenster durch den Abendnebel hin gespenstisch flimmerten. Lehnert, der rüstig zuschritt, schickte sich eben an, die Fenster des obersten Stocks zu zählen, als er heftig zusammenschrak. Auf dem Kapellchen, an das er bis auf fünfzig Schritt heran war, begann es eben zu läuten und die zwischen dem Sparrenwerk hängende Glocke klang mit ihrem dünnen Tone hell und scharf durch die Luft. Es war dasselbe Läuten, das gestern, bald nach seiner Rast am Quell, vom Thale her zu der Kammhöhe hinaufgedrungen war, und unwillkürlich hielt er an und suchte, während er sich rückwärts wandte, die Stelle, drauf er gestern um eben diese Stunde gestanden hatte. Da war auch die Mondsichel wieder, und so schwach in diesem Augenblick ihr Licht war, so war es doch hell genug, den Weg am „Gehänge“ hin deutlich zu zeigen, auf dem er gestern um fast dieselbe Zeit emporgestiegen war. Und dort war die Stelle, wo der Seitenpfad, an dem Brunnen vorüber, in scharfer Krümmung abbog, und er mühte sich, ob er die nach der Hampelbaude hinüberführende Querlinie vielleicht verfolgen könne. Jetzt war sie da, die Linie, und jetzt wieder nicht, je nachdem die Phantasie mit ihm spielte, bis er mit einem Male einen Aufblitz und ein Rauchwölkchen sah und gleich danach den Widerhall eines Schusses durch die Berge rollen hörte.
Die Sinne vergingen ihm fast. Aber ein viel Erschütternderes harrte seiner im nächsten Augenblicke, denn ehe noch das Rollen von Schlucht zu Schlucht verhallen konnte, klang es deutlich vom Berge her zu Thal: „Hilfe!“
Lehnert hielt sich an dem das Kapellchen sammt seinem dazu gehörigen Schulhaus einfassenden Heckenzaun und horchte hinauf, ob sich der Ruf wiederholen würde. „Ja,“ „nein,“ und dann wieder „ja.“ Und von einer furchtbaren Angst geschüttelt, war er bald nur noch von dem einen Verlangen erfüllt, die Stimme von da oben nicht mehr zu hören, dem Hilferuf zu entfliehen. Aber wohin? Exner, das ganze Dorf, alles schien ihm noch im Bereich der Stimme zu liegen, im Bereich des Hilferufes da oben vom Gehänge her, und so lief er denn weiter bergab, um die Nacht in Arnsdorf oder wo’s sonst sei, nur weit, weit ab zu verbringen.
Er war schon halb bis nach Arnsdorf heran und wollte eben in ein Wäldchen einbiegen, das die Krummhübler das „Birkicht“ nennen, als er andern Sinnes wurde, plötzlich in seiner Flucht anhielt und sich auf einen der vielen Baumstämme setzte, die hier, am Waldsaume hin, aufgeschichtet lagen.
„Es geht nicht. Ich kann so nicht weiter. Er lebt, es war seine Stimme . . . Um Gottes Barmherzigkeit willen, vierundzwanzig Stunden . . . so viel tausend tausend Sekunden . . . Ich muß es anzeigen, daß ich einen Hilferuf gehört habe . . . bei Zoelfel oder Exner oder im Gerichtskretscham. Und sie müssen diese Nacht noch hinauf, diese Stunde noch.“
Und nun schwieg er, weil ihm mit einemmal der Gedanke kam, daß er sich, wenn er spräche, verrathen würde. Bald aber nahm er sein Vorhaben wieder auf.
„Nein, ich werde mich nicht verrathen. Gerade daß ich es sage, das wird mich retten und wird alle Welt glauben machen, daß ich schuldlos sei. Bin’s auch . . . Und wenn er mich erkannt hat? Er hat mich nicht erkannt. Und Vermuthung ist kein Beweis. Und wenn doch? Nun denn, dann mag mir das Messer an die Kehle gehen. Ich kann ihn nicht verkommen lassen in seiner Noth und seinem Blut.“
Und er wandte sich wieder und stieg die nach Krummhübel zurückführende Berglehne fast noch schneller hinauf, als er herabgekommen war, und es war noch nicht zehn Uhr, als er vor Exners „Schneckoppe“ hielt. Da wollt’ er hinein und sah durch die Fenster. Aber es waren zu viel Fremde da; so stieg er denn weiter hinauf, bis er an den Gerichtskretscham kam. Da war es stiller und nur Einheimische waren da, was ihm paßte. Vorher aber übersann er noch einmal in aller Vorsicht, was er sagen wolle. Da war denn das nächste, was ihm einfiel, daß er das Rufen nicht schon vor einer Stunde gehört haben dürfe, sondern in diesem Augenblick erst. Und nun trat er ein und machte Meldung und begrüßte Maywald und Neigenfink und den alten Gerichtsmann Klose, die sich eben zum Skat niedergesetzt hatten.
Aber keiner rührte sich und das Spiel ging weiter. „Grand mit vieren,“ sagte der alte Gerichtsmann. „Und nun komm, Lehnert, und sieh mit hinein, verstehst es ja, so was lernt man bei den Soldaten . . . Und gerufen hat es, sagst Du … Das sind Fremde … junge Leut’ … Heute früh kamen Breslauer hier durch, ein ganzes Rudel, Gymnasiasten, oder wohl gar welche von der Kunstschule. Das ist dann ein ewiges Singen und Rufen. Und das verdammte Schießen dazu . . . Soll eigentlich nicht sein . . . Und wenn Opitz ’mal einen packt, dann is er sein Terzerol tos oder auch seinen Revolver. Denn ohne Revolver geht es heutzutage nicht mehr . . . Du giebst, Maywald. Aber was Ordentliches . . . Dann is er sein Terzerol los, sag’ ich, und die Geldstrafe hat er dazu . . . Wetter, ist das ein Blatt! Aber das kommt von solchen Geschichten, da grault sich ’ne gute Karte . . . Nimm einen Stuhl und rücke ran, Lehnert, und hilf mir aus der Patsche!“
„Kann nicht, Gerichtsmann Klose,“ sagte Lehnert. „Ich war heute schon drüben und bin müde zum Auslöschen . . . Und Ihr meint also, es wäre nichts und man hätte keine Pflicht, hinaufzusteigen und nachzusehen? Von dem Schuß will ich nichts sagen, geschossen wird immer. Aber das Rufen. Es klang so, ja, wie sag’ ich, es klang so, wie wenn es was wäre.“
„Ja, wie wenn es was wäre,“ lachte Klose, während Maywald zustimmte, „was ‚sein‘ wird es wohl. Aber was? Ein Kommis, der seines Prinzipals Gelder zu früh einkassirt hat!“
Es war Lehnert nicht unlieb, die Skatherren, die zugleich zu den Dorfhonoratioren zählten (denn auch Neigenfink, der sich übrigens zurückhaltender verhielt, war Gerichtsmann), so leichthin sprechen zu hören. Es gab ihm einen Theil seiner Ruhe wieder. Sie haben am Ende doch recht. Und eigentlich kann’s auch nicht anders sein. Es ist schon zu lange her . . . Aber wenn es doch wäre . . . wenn es doch wäre . . . “
Draußen vor dem Kretscham stand ein Ackerwagen. Lehnert setzte sich auf die Deichsel und sah das Gehänge hinauf und horchte wieder mit gespanntem Ohr. Aber alles blieb still. So ging er denn zuletzt auf Wolfshau zu. Bei Frau Opitz war noch Licht, und als er vorüher ging, schlug Diana an. Sonst rührte sich nichts.
Und nun war er wieder auf dem Inselchen drüben und stieg in seine Kammer hinauf. Eine kleine Weile noch jagten sich allerlei Bilder und Gedanken durch seine Seele. Dann schlief er ein, fest und schwer und ohne Traum.
Die Skatpartie blieb zurück, war aber nicht bestimmt, ungestört zu gutem Ende zu kommen, denn wenig mehr als eine halbe Stunde nach Lehnerts Aufbruch hörte man draußen ein Sprechen und Weinen, und ehe die Skatherren noch fragen konnten, was es sei, trat Frau Opitz ein, um drinnen in der Stube zu wiederholen, was sie schon draußen im Flur der Kretschamwirthin erzählt hatte. Alles in ihrer Rede drehte sich um den Mann und sein Ausbleiben. Opitz habe gestern spät nachmittags die Försterei verlassen und sei nach der Hampelbaude hinaufgestiegen, um oben im Wald den Holzschlägern den Wochenlohn auszuzahlen. Das sei nun über vierundzwanzig Stunden und noch sei er nicht zurück, weshalb sie fürchte, daß ihm etwas zugestoßen sei. All das wurde vorwiegend zu dem Aeltesten, zu Gerichtsmann Klose gesprochen, einem rüstigen Fünfziger, der, weil er gerad’ im Verluste war, keine Lust hatte, das Spiel unterbrochen zu sehen. Er suchte deshalb der heftig schluchzenden Frau nach Möglichkeit zuzureden und dabei, so weit es ging, ohne geradezu zu verletzen, einen leichten und heiteren Ton anzuschlagen. Opitz werde gute Gesellschaft und vielleicht sogar eine Skatpartie gefunden haben, so was käme vor, wie Frau Opitz ja jetzt mit eigenen Augen sähe. Solch Ausbleiben sei nicht schlimm. Alle Frauen ängstigten sich, wenn die Männer nicht pünktlich zu Hause seien, aber das kenne man schon, mit der ganzen Angst sei’s nicht weit her und sei eigentlich alles bloß, um den Mann, dem man nie recht traue, hinterher desto fester am Bändel zu haben. Er sprach noch eine gute Weile so weiter, unter beständigem Niederlegen und Wiederaufnehmen seiner Karten, und schien ernstlich gewillt, sich durch diese „Habereien“ der guten Frau nicht stören zu lassen. Als Frau Opitz aber nicht nachließ und in ihrem Bitten und Drängen
[93][94] durch die zwei Mitspieler und zuletzt sogar durch die hinzugekommene Kretschamwirthin unterstützt wurde, gab er seinen Widerstand auf und sagte: „Gut denn, es kann am Ende so was sein, will’s nicht geradezu bestreiten. Ein Förster hat immer viel Feindschaft und Opitz nicht zum wenigsten. Und so wollen wir denn mit dem frühsten nach der Hampelbaude hinauf. Vorher aber ist nichts zu machen, trotzdem wir das bißchen Mondschein haben. Ich denk’ also, wir sind morgen in aller Frühe hier wieder beisammen, sagen wir um fünf, und nehmen dann mit uns, was wir von Mannschaften zu so früher Stunde, zur Hand haben können. Vor allem aber halten wir reinen Mund, daß die Fremden keinen Schreck kriegen und nicht etwa denken, unser altes Krummhübel sei über Nacht eine Mördergrube geworden.“
Alle waren einverstanden, und Frau Opitz, der die gutmüthige Kretschamwirthin eine von ihren Mägden als Begleitung mit nach Hause gab, stellte ihr Weinen und Schluchzen schließlich ein und beruhigte sich in dem Gefühl, daß, was es auch sein möge, der nächste Tag ihr jedenfalls Gewißheit bringen müsse. –
Auf dem Kapellchen läutete es zum ersten Mal, als man am anderen Morgen zwischen fünf und sechs vom Gerichtskretscham in einem starken Trupp aufbrach, denn es hatten sich ihrer erheblich mehr eingefunden, als anfänglich erwartet worden war. Außer den drei Herren vom Abend vorher, unter denen jetzt Gerichtsmann Klose den Skatspieler völlig abgestreift hatte, waren auch der Lehrer und ein junger Forstaspirant erschienen, findige Leute, die zu sehen und zu beobachten verstanden. Ebenso hatte sich ein Grenzaufseher, mit dem Gewehr am Bandelier, ihnen angeschlossen. Was sonst noch folgte, waren Führer und Dienstleute, mit allem ausgerüstet, was zu solcher Suche herkömmlich gehörte: Stricke, Leitern, Spaten und Aexte. Eine frische Brise kam von der Koppe her und erleichterte wenigstens einigermaßen das Steigen, das bei der trotz früher Stunde schon stechenden Sonne ziemlich beschwerlich fiel. Von Kirche Wang ab hatte man Waldesschatten, und als es unten im Thale sieben schlug, war man oben auf der Hampelbaude, wo zunächst Rast gemacht und nach Befund dessen, was man dort erfahren würde, der weitere Vormarsch verabredet werden sollte. Der Wirth wurde gerufen und bestätigte, daß Opitz, von den Holzschlägern kommend, am Sonnabend um die achte Stunde dagewesen sei und nach kurzem Aufenthalt seinen Weg nach der Riesenbaude zu genommen habe, vielleicht an den Teichen vorüber und dann über den Kamm hin, aber vielleicht auch den neuen schmalen Querweg entlang, der beim Quell und dem Steintrog in den großen Gehängeweg einmünde. Noch ein paar andere Fragen wurden gestellt, vor allem auch, wer sonst noch oben genächtigt habe, worauf der Wirth berichtete, daß nur Berliner oben gewesen seien und Lehnert Menz aus Wolfshau.
Dieser Name, wenn auch nur kurz hingeworfen, bewirkte doch, daß sich die Gerichtsmänner unter einander ansahen; aber kein Wort wurde laut, und nachdem man einen Imbiß genommen hatte, brach man wieder auf, um auf dem vom Wirthe bezeichneten schmalen Querpfade – denn daß Opitz auf die Teiche zugegangen sei, war nicht wahrscheinlich – den Weg nach dem Gehänge hin einzuschlagen. In einer Art Treiben ging man dabei vor, derart, daß der alte Gerichtsmann und drei, vier von den Gebirgsführern den eigentlichen Weg einhielten, während, was sonst noch verblieb, zu beiden Seiten des Weges ausschwärmte. Die Geduld einzelner – die hier oben, wo nur Kusseln standen, wieder arg von der Stichsonne zu leiden begannen – erschöpfte sich bereits, und schon hörte man, daß es eine nutzlose Quälerei sei, als Lehrer Lösche, der die rechte Seitenkolonne führte, plötzlich ein Volk Krähen auffliegen sah. Krähen! Das wäre an und für sich nichts Sonderbares gewesen, aber es waren ihrer zuviel, und so sagte denn Lösche: „Paßt Achtung, Kinder! Ich wette, da giebt es was.“ Und von einer starken Vorahnung erfüllt, daß sich ihm, auf zehn Schritt Entfernung, etwas Grausiges vor Augen stellen würde, schritt er jetzt langsam und zögernd weiter und suchte nach vorn hin mit seinen Blicken. Richtig, da lag jemand. Aber wer? War er es? Was man zunächst sah, war nur die Mütze, die das Gesicht halb zudeckte, daneben ein blinkender Gewehrlauf, alles andere barg sich noch hinter einem Busch, dessen blätterreiches Gezweigs den Todten wie hinter einem Schirm versteckte. Lösche wußte: noch drei Schritt, so mußte sich’s zeigen. Und sich einen Ruck gebend, trat er von links her um das Gezweige herum und sah nun den Todten ausgestreckt vor sich. Es war Opitz. Aber das Grauen, auf das sich Lösche gefaßt gemacht hatte, blieb aus und er empfing nur den Eindruck eines erschütternden Todesernstes. Wenn dieser Mann sich jahrelang durch mitleidslose Strenge vergangen hatte, so hatte sein Tod seine Strenge gesühnt und mehr noch die Art, wie er diesem Tod ins Auge gesehen und sich auf ihn vorbereitet hatte. Lösches Auge ging der Blutspur nach, die sich oben von dem Busch her, wo der Tobte jetzt lag, bis zu dem schmalen Querpfade hinabzog. Es war ersichtlich, daß sich der auf den Tod Getroffene nur mit höchster Anstrengung von dem kaum zehn Schritt entfernten Wege bis zu der ansteigenden Stelle hinaufgeschoben und hier, um gegen die Sonne oder vielleicht auch nachts gegen die Kälte geschützt zu sein, sich unter die Zweige des Busches gebettet hatte. Dann, als er sein herannahendes Ende gefühlt, hatte er sich zum Sterben zurecht gelegt, und so lag er nun da, die Jagdtasche unterm Kopf, das Gewehr links neben sich, die Hände gefaltet und im Antlitz die Ruhe des Todes, aber freilich auch die Spuren vorangegangenen Kampfes.
Inzwischen waren auch die anderen herangekommen, und da standen sie nun erschüttert und stumm. Zuletzt nahm Gerichtsmann Klose seine Kappe vom Kopf und sagte: „Beten wir!“ So verging eine Weile. Dann, als sich die Köpfe wieder bedeckt hatten, wurden auch einzelne Worte laut, und der Alte stellte nun zur Frage, wie man den Tobten am besten nach Wolfshau hinabschaffe. Einen Handwagen oder auch nur eine Karre von der Hampelbaude herbeizuholen, wurde, wegen zu weiter Entfernung, abgelehnt und statt besten beschlossen, zwei zusammengebundene Leitern als Tragbahre zu benutzen. Das geschah denn auch, und nun legte man den Todten hinauf und bedeckte sein Gesicht mit Zweigen desselben Busches, unter dem man ihn gefunden hatte. Gleich danach setzte sich der Zug in Bewegung und schritt auf den Punkt zu, wo der Querpfad in den breiten Gehängeweg einmündete. Hier endlich fand er Waldesschatten, und als man aus dem Quell getrunken und sich auf der Bank an der anderen Seite des Weges eine kleine Weile ausgeruht hatte, nahm man die Leiterbahre wieder auf und schritt das steile Gehänge weiter hinab. Die mit jeder Viertelstunde wachsende Gluth erschwerte den Abstieg, aber mit Hilfe häufigen Trägerwechsels war es doch möglich, in einem ziemlich raschen Marschtempo zu bleiben, und ehe es noch auf dem Kapellchen Mittag läutete, passierte man das Gatter und trat auf das mit Kusseln besetzte Waldvorland hinaus, darauf Lehnert zwei Tage zuvor den Schulkindern begegnet war und in ihren Gesang mit eingestimmt hatte. Die Straße lief von hier aus beinah’ geradlinig auf die Försterei zu; da man aber der armen Frau den Todten nicht unmittelbar vor Gesicht führen, sie vielmehr erst vorbereiten wollte, so bog man links in einen in mäßiger Schrägung wieder ansteigenden Querweg ein, der sich schließlich bis auf die hochgelegene Krummhübler Chaussee hinaufschlängelte. Die Stelle, wo der Querweg die Chaussee traf, hieß „der goldene Frieden“ und war ein hochgelegener Punkt, von dem aus man nicht nur das langgestreckte Dorf Krummhübel überblicken, sondern auch auf einem mäßig hohen Vorsprung den alten Gerichtskretscham deutlich erkennen konnte, zu dessen Häupten eben die Mittagssonne flimmerte. Das war das Ziel. Dort sollte der Todte zunächst niedergelegt und über alles weitere befunden werden.
Eine Viertelstunde später hatte man den Kretscham erreicht, aber nicht mehr allein. Alles, was in dem Oberdorfe wohnte, hatte sich angeschlossen und stand nun draußen und wartete der Dinge, die kommen würden. Am zahlreichsten waren natürlich die Wolfshauer erschienen, unter ihnen auch Lehnert. Er begrüßte diesen und jenen, und wiewohl ihn Blicke trafen, aus denen er einen Verdacht herauslesen konnte, so war doch niemand da, der ihm Wort oder Handschlag versagt hätte. Manche traten freilich bei Seit’, aber mehr um untereinander ihre Zustimmung zu dem Geschehenen, als ihren Abscheu davor auszusprechen.
„Er hat einen schweren Tod gehabt.“
„Und wir vorher ein schweres Leben.“
Gleich daneben stand eine zweite Gruppe, die noch leiser sprach.
„Wer’s ihm nur gegeben hat?“
„Wer? Das is gleich. Ob sie’s ihm beweisen können, das is die Frage.“
{{center|(Fortsetzung folgt.)
[95]In einem einzigen Siegeslaufe haben die Werke Fritz Reuters sich die Welt erobert und den Dichterruhm des mecklenburgischen Humoristen fest gegründet. Es that keinen Eintrag, daß die Dichtungen Reuters in dem wenig bekannten Dialekt des kleinen mecklenburgischen Landes geschrieben waren; an die kleine Gemeinde derer, die dieses Dialektes mächtig waren, schloß sich die große Gemeinde der Lernenden an, die sich gern mit der Mundart vertraut machten, um einzudringen in die wundervollen Schätze Reuterscher Poesie. Der Leser, der nie ein Wort des Mecklenburger Dialekts gehört hatte, fühlte sich unwiderstehlich angeheimelt von den „Läuschen un Rimels“, tief ergriffen von den ernsten Gestalten der „Stromtid“, überwältigt von den rührenden Bildern in „Kein Hüsung“ und den wechselvollen Schicksalen „Hanne Nütes“.
So sind auf Fritz Reuters Werke seit langem die Augen vieler Tausende gerichtet, und alles, was über den Entwicklungsgang des Dichters Licht zu verbreiten geeignet ist, begegnet einer um so lebhafteren Theilnahme, als es sich nicht verbirgt, daß durch die Gebilde seiner Phantasie seine eigenen persönlichen Erlebnisse mannigfach hindurchschimmern.
Wir sind in der erfreulichen Lage, die Beiträge zu der Kenntniß von Fritz Reuters Leben um eine Reihe interessanter Briefe zu bereichern, die bisher nur einmal für eine Biographie des Dichters, und zwar für diejenige aus der Feder seines berühmten Landsmannes Adolf Wilbrandt, herangezogen und zu einem kleinen Theile in der Einleitung zur Volksausgabe der Reuterschen Werke bekannt gegeben worden sind. Von der Wiederholung der dort abgedruckten Bruchstücke sehen wir an dieser Stelle ab; nur in einem einzigen Briefe, dem ersten von Stuer aus datirten, mußten die von Wilbrandt herausgehobenen Bruchstücke bleiben, weil sie zum Verständniß des Ganzen unentbehrlich sind. Sämmtliche Briefe sind an Reuters vertrauten Freund Fritz Peters gerichtet und von dessen Sohn in gerechter Würdigung des Anspruches, den die Freunde des Dichters an diesen Schatz zu erheben haben, uns zur Veröffentlichung übergeben worden.
Wir drucken die Briefe ab, so wie sie geschrieben sind, um ihnen nichts von ihrer lebendigen und liebenswürdigen Eigenart zu nehmen; nur hin und wieder, wo der Freund dem Freunde ganz intime Mittheilungen macht, deren Veröffentlichung nicht angezeigt erscheint, oder wo der Dichter sich wiederholt, haben wir uns zu unwesentlichen Auslassungen entschlossen.
Das Verständniß der einzelnen Briefe haben wir durch kurze Uebergänge und Anmerkungen möglichst zu erleichtern gesucht und die Briefe nach dem Leben des Dichters zwanglos gesondert.
Wir sind über die ersten Knaben- und Jünglingsjahre Reuters verhältnißmäßig gut unterrichtet, und dann wieder über die Zeit von Mitte der fünfziger Jahre bis zu seinem Tode, in welcher er als weithin bekannter Dichter sozusagen vor aller Augen lebte. Dazwischen liegt aber eine Zeit von mehr als zwanzig Jahren, die man mit Rücksicht auf die geringe Kenntniß, die man bisher von diesem Abschnitt hat, als die dunkle bezeichnen kann.
Die sieben Jahre der Gefangenschaft, beginnend mit Reuters Verhaftung im Oktober 1833, wirkten tief zerrüttend auf sein körperliches wie auf sein geistiges Leben. Unlust zu streng wissenschaftlicher Arbeit lähmte ihn, als er die Festung verließ, er war von tiefem Haß gegen viele Menschen und Dinge erfüllt, und es bedurfte langer Jahre der Genesung, bis er wieder zu jenem gemüth- und humorvollen Menschen wurde, der auch das Bitterste der Vergangenheit in heiterer Verklärung schaute und wiedergab. Diese Zeit der Genesung und Erstarkung ist es vor allem, die noch vielfach der Beleuchtung bedarf.
Als nach Reuters Entlassung von der Festung ein Versuch, die juristischen Studien wieder aufzunehmen, gescheitert war, wandte er sich der Landwirthschaft zu, und das war, wie der weitere Verlauf seines Lebens zeigt, zu seinem Heil. Die der Landwirthschaft gewidmete Zeit, die „Stromtid“, die Jahre der stillen ländlichen Zurückgezogenheit, der grübelnden Betrachtung seiner selbst und anderer, des nahen Umganges mit einfachen, gutherzigen Menschen, von denen er selber viel Gutes empfing, haben unendlich viel dazu beigetragen, den Mann in ihm heranzubilden, der mit so tiefer Empfindung und zugleich so heiteren Sinnes dichten und schreiben konnte.
Den bei weitem größten Theil dieser Zeit verbrachte Reuter auf dem Landgute Thalberg bei seinem Freunde Fritz Peters, ihn nach seinem Belieben in der Wirthschaft unterstützend. War der Freund auf Reisen abwesend, so vertrat er ihn vollständig in Haus und Hof, und solchen Gelegenheiten verdanken wir die Briefe, die hier zunächst folgen. Es werden auch diejenigen Stellen wiedergegeben, die sich auf wirthschaftliche Dinge beziehen, denn einerseits zeigen sie uns den berühmten Dichter in dem ungewohnten Lichte eines praktisch thätigen Landwirthes, andererseits sind auch sie meist in humoristisches, echt Reutersches Gewand gekleidet.
Zum Verständniß des ersten Briefes schicken wir die folgenden Erläuterungen voraus:
Peters ist acht Jahre jünger als Reuter, damals 29 Jahre alt und zeitweilig mit seiner Frau in Berlin. Der „Feind“ ist die Cholera. „Maus“ ist der Spitzname einer der kleinen Töchter, „Hanne“ ein empfindsames, häufig kränkelndes Dienstmädchen; „Adam“ der Hausarzt. „P.“ ist einziger Sohn, etwa ein Jahr alt, in welchem Frau Peters nach Art zärtlicher Mütter – und hiermit neckt Reuter sie – einen Engel zu erblicken glaubt, und der sich bis dahin in der That kräftig entwickelt hat.
Lieber Vater Papa Petersen!
Wunderschön ist nichts dagegen! Bonus vinus! Die Besatzung der Festung hält sich tapfer, hält sich meistens den Feind durch Schreien vom Leibe; eben quiekt die Maus. Die Blessirte, die Hanne, ist durch Adams Kamillenthee und gekochtes und geschmortes Obst, durch Wassersuppe in jeglicher Gestalt glücklich wieder in Aktivität gekommen, das heißt in keine plötzliche, sondern in eine ganz allmähliche, so ziemlich alles vergessende Aktivität. P. der II., der Große, der Einzige, kurz wie Madame[1] will, vielleicht auch P. der Engelländer (nicht Engländer), hat sich physisch wie moralisch sehr gebessert; das Kind sah bekanntlich nicht sowohl stets sehr, übel und unschön aus, sondern schien es auch darauf anzulegen, durch ungebührliches nächtliches Herumtreiben und Straßenspektakel das Leben, wenigstens die Nächte seiner biedern Eltern zu verbittern, vorzüglich seiner edeln Mutter; jetzt ist es ganz verändert, auf seiner klaren Stirn steht mit klaren Worten geschrieben: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, und nicht allein, daß er selbst diese Ruhe mit Heroismus ausübt, er sucht auch seine Geschwister mit Fischbeinstäbchen[2] sehr zu beruhigen; auch, wie gesagt, mit seiner physischen Beschaffenheit ist eine große Veränderung vorgegangen, das unruhige braune, brennende Auge[3] ist verschwunden, und aus einem Gesichtchen, dessen Rosen und Lilien vom Himmel stammen, blicken uns zwei klare, fromme, blaue Augen, wie ein Gruß des blauen, himmlischen Aethers, an; sein ins Bräunliche spielendes Haar hat sich in einer Nacht zu einem frommen Blond umgebleicht und fließt wie ein Sonnenstrahl auf dem kräuselnden Bach in lichten Locken auf die lieblich geschwellten Schulterblätter, zwischen denen sich plötzlich, wie durch Zauberschlag, ein Paar rundliche Erhöhungen gebildet haben[4], etwa wie beim Böckchen an der Stirn, wenn’s Hörner kriegt, aber unendlich viel reizender. Da stehen wir nun, wir armen unglücklichen Tröpfe, und bewundern dies liebliche Spiel einer überirdischen Natur: Großmama[5] schüttelt den Kopf und scheint unglücklich zu sein, daß ihr Enkel aus der Menschenart ausgeschlagen ist, Mutter Schultsch[6] sagt: ,Dat heff ich woll fegt!’ Adam will die Auswüchse operiren; Schoenermark,[7] der aussieht wie die Weisen Griechenlands zusammengenommen, sagt, indem er sein Heldenmaul[8] in Falten legt: ,Wenn der Junge ein Engel ist, dann ist’s kein Mensch, und ist er ein Mensch, dann ist’s kein Engel; es ist also alles Dummzeug; [96] übrigens ist dies noch gar nichts, ich habe einmal einen mit 10 solchen Knoten gesehen.’ E. und A.,[9] die beiden kleinen Menschenwürmer, sitzen hinterm Ofen und heulen, daß sich die Steine erbarmen mögten, über die unglückseligen Engelverpuppungs-Ideen ihres Herrn Bruders; und ich habe in aller Stille das Staknetz, worin wir die Karauschen fingen, vor dem Schlafstubenfenster aufstellen lassen; man kann ja nicht wissen, der Junge kann’s Burren[10] kriegen, und dann Adjes! –
Nun den Spaß bei Seite. Alle sind sehr wohl und der Junge ist die beiden letzten Nächte durchaus ruhig gewesen, er hat fast immerfort geschlafen, und so würde Madame einen bedeutenden Nebennutzen von ihrer Reise haben. Das Heu ist hinein (ich glaube 8 Fuder); die Rüben sind hinein und haben recht viel gebracht. Heute Mittag ist der Rappsweizen bei Seite. Es wird Dung aufs Grünfutter-Roggenland gefahren und ist heute mit dem Kartoffelaufnehmen mit 10 Mann angefangen; morgen mit 20. Auswärtige können wir nicht erhalten. Das Vieh ist gesund. Du siehst also, daß wir hier ganz gut aufgehoben sind und daß wir auch in der Wirthschaft weiter kommen. Nur daß die Kartoffeln so lange liegen, will mir nicht gefallen, denn wir haben ja auch noch die Runkeln; und daß der Roggen nicht vor dem Weizen besorgt werden konnte. Wir erwarten, daß Du uns den Tag Deiner Ankunft in Treptow meldest, damit wir des Abends um 10½ Uhr dorthin einen Wagen schicken können, oder sollen wir Dich von Neubrandenburg holen? Lebe wohl, mein bester Freund, und denke bei Deinen Herrlichkeiten
alten Onkel Ente[11].“
Zwei Jahre sind seitdem vergangen. Peters ist wieder mit seiner Frau abwesend und Reuter richtet den nachstehenden Brief an ihn:
Lieber Fritz!
Zuerst bitte ich Dich, ein ernsthaft Gesicht zu schneiden, denn zuerst denke ich von Geschäften mit Dir zu reden. – Gestern habe ich Rechnung gehalten und alle Sachen, wie ich hoffe, zu Deiner Zufriedenheit abgemacht. Dann an Geisler geschrieben und die 100 Thaler gegen Postschein abgesendet; darauf habe ich mich in Deinen Diensten den Sonntag Nachmittag auf meine eigene Hand recht plaisirlich gelangweilt, da ich nicht nach Tetzleben[12] gegangen bin, und heute habe ich einen unbefugten Eingriff in Deine Kasse und in Deine Rechte gewagt; in Deine Kasse, weil ich zu meinem eigenen Gebrauch 6 Thaler entnommen, in Deine Rechte, weil ich unberufen einen Brief erbrochen, der mir mit dem Poststempel Demmin von Schünemann herzurühren schien. Dies war denn auch so; er meldet, daß die Platten etc. fertig seien, auch daß er das alte Eisen annehmen wolle, schreibt aber nur von 20 Sgr. – 1 Thaler pro Centner. Da nun wir (,wir’ heißt in diesem Briefe immer ,Großmama und ich’) nicht genau wissen, was für altes Eisen dahin geschickt werden soll; ferner in Erwägung des schlechten Preises; ferner in noch fernerer Erwägung der Zweckmäßigkeit einer schleunigen Aufstellung des Heerdes, und endlich in noch fernerer Erwägung, daß Du doch wohl noch hinlänglich über Winter nach Demmin Gelegenheit haben wirst, und viel Aussicht dazu vorhanden, daß das alte Eisen durch den Verbrauch an Piken und Säbeln, auch anderem Kriegsmaterial in diesen eisernen Zeiten bedeutend ansteigen wird, so haben ,Wir’ beschlossen, uns mit sothanem Eisenhandel gar nicht zu bemengen und, weil ,Wir’ friedliche Leute sind, blos für das Essen und das Zustandekommen eines passenden Heerdes zu sorgen, und werden demnach morgen einen Wagen mit Begleitschreiben nach Demmin und eine Epistel an den Töpfer Erdmann in Neubrandenburg abgehen lassen und das sublime Vergnügen eines Handels mit altem Eisen für Deine Person aufsparen.
Das war die Geschichte vom Eisenhandel. – Nun kommt der Gerstenhandel. Darauf ist nur zu bemerken, daß heute eine Fuhr nebst einer Katze nach Brandenburg an Mohnke abgegangen ist; – ich meine aber eine Geldkatze. – Nun über unsern Gesundheitszustand: Sollte Dir beifallen zu glauben, daß wir Pflaumen äßen[13], so würdest Du Dich sehr irren, denn wir alle haben heute einige gegessen, mit Ausnahme der Kinder – daß dies Unsinn ist, weiß ich recht gut, schreibe es aber doch. Ich habe mir aber die möglichste Mühe gegeben, in den kleinen Würmern durch das Loben der Pflaumen, durch öfteres Vorzeigen und durch Essen in ihrer Gegenwart eine unwiderstehliche Neigung für diese verbotene Frucht hervorzurufen und bin nun fest überzeugt, daß ich das Mögliche gethan habe, sie in der Enthaltsamkeit zu üben. – Ihre Zunge, die sie mir alle halbe Stunde ein halbe Elle weit hinaus halten müssen, sieht noch sehr gut aus; und hoffe ich durch diese Glossarübungen den Kindern nebenbei eine größere Geläufigkeit im Sprechen beizubringen. P.[14] amüsirt sich sehr gut mit seinen Aussichten auf neue Hosen; ich fürchte aber, er geht nicht sehr räthlich und reinlich mit den schon vorhandenen Exemplaren um, weil ich ihn wieder mit jenen unnennbaren Unnennbaren umherlaufen sehe, die aussehen, als wäre ihr Vater mit ihnen auf der Kegelbahn zu schaden gekommen. Doch wer kann das wissen; dies mag ja wohl ein Charakterzug der Petersschen Familie sein. – Unsere Hanne hat es wieder; sie hat es wirklich wieder mit allen nicht näher zu beschreibenden Umständen; ich habe sie eigenhändig besichtigt und Großmama hat sie mit Eisentropfen traktirt und kredenzt ihr die nux vomica. – Auch unser komplaisanter Herr Bietz[15] hat sich gestern infolge – nicht der Cholera – sondern einer starken Cigarre heftig unwohl gefühlt, wobei er sich selbst tausendmal um Verzeihung gebeten hat, daß er seinen Gefühlen unumwunden freien Lauf ließe. – Großmama ist gesund, und was mich betrifft, so ist es am besten, davon zu schweigen, weil ich Dir sonst, Du Spitzbube, Gelegenheit geben könnte, den alten abgedroschenen Witz von dem nicht vergehenden Unkraut zu machen. – Schröder[16] ist gestern auf die Jagd gegangen und hat eine ganze Menge wilder Enten auf 200 Schritt – gesehen. Der Ebert[17] habe ich mit blutendem Herzen gestern morgen einen Verweis geben müssen; sie bot mir nämlich, gleich nachdem Ihr fortgefahren wart, die dritte Tasse Kaffee an, worauf ich sie auf ihre Pflicht verwies und fragte: ob sie glaube, daß es so nun losgehe. Morgen nachmittag werde ich aber wohl eine kleine Verschwendung in Kaffee machen müssen, weil ich den alten Leisten[18] zum Kaffee einzuladen gedenke, damit er mir einmal gründlich seine Proceßgeschichte erzähle, die leider immer im besten Zuge durch irgend etwas unterbrochen worden ist; ich denke, er bleibt dann auch wohl zum Abendbrot und wird sich gut amüsiren.
Heute ist eine Madame L. hier gewesen, um Dir ihren Herrn Sohn zu präsentiren, der bei O. in Leuschentin gewesen ist und nach dem Wunsche seiner Mutter hier seine landwirthschaftlichen Studien vervollständigen soll; der Herr Sohn ist ein langgewachsenes Menschenkind mit einem Flachskopf und sein Betragen erinnert stark an abgestandene Milchsuppe, auf der eine lederne Haut sich gebildet. Ich habe natürlich der Mutter gesagt, Du würdest Dich unendlich freuen u. s. w.
Weiter weiß ich nichts und – sei nicht unbescheiden – für einen Tag und eine Nacht ist dies genug. Sollte sich bis morgen mehr ereignen, so erfährst Du mehr, vorzüglich wenn es der Reaktion gelingen sollte, hier einzubrechen und mich todt zu schlagen. Bis dahin
augenblicklich im Begriff nach Tetzleben zu gehen.
Es ist alles beim Alten. Gestern hat Deine und meine Großmama[19] lauter Kartoffelmehl gemacht und hat sich gar nicht sehen lassen. Ich habe Schröder veranlaßt, sein Pfund nicht zu vergraben, d. h. sein musikalisches; derselbe ist ein großer Virtuose auf der Handharmonika. Wie muß der Mensch erst auf der Drehorgel sein. Jeden Ton begleitet er mit einem besonderen Gesicht, jeden Takt mit einer besonderen Bewegung, so daß er aussah wie eine illustrirte Zeitung für Musikliebhaber. – Es hat hier zwei Nächte scharf gereift und gefroren. Heute hoffen wir das Flachs hineinzubringen.
Dein F. Reuter.“
Blätter und Blüthen.
Lichtbilder aus dem Kriege von 1870. Schwer, unendlich schwer vollzieht sich die innere Annäherung zweier Völker, die sich einmal im heißen Ringen auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden haben, und es ist eine Thatsache, für welche die Geschichte der letzten zwei Jahrzehnte einen schmerzlichen Beleg bildet, daß mit dem Abschluß des dem Kampfe der
Waffen ein Ziel setzenden Vertrages erst ein verschwindend kleiner Theil des Friedenswerkes vollbracht ist. Um so freudiger wird der Menschenfreund alle Erscheinungen begrüßen, die geeignet sind, auf dem Wege der inneren Aussöhnung auch nur ein Schrittchen vorwärts zu führen, den trübenden Schleier, welchen die Leidenschaft wob, vom Auge der einstigen Gegner zu nehmen und auch im Feinde den Menschen, den guten Menschen zu zeigen.
Was diesem Zwecke in Rücksicht auf das Verhältnis von Franzosen und Deutschen dienen kann, das kommt - leider - auch heute noch nicht zu spät; dies gilt auch von dem Büchlein, in dem der württembergische Hauptmann der Landwehr Geyer seine Erinnerungen aus dem Kriege ausgezeichnet hat unter dem Titel "Erlebnisse eines württembergischen Feldsoldaten im Kriege gegen Frankreich und im Lazareth zu Paris 1870/71" (München, E. H. Becksche Verlagsbuchhandlung). Geyer, beim Ausbruch des Krieges Einjährig-Freiwilliger, machte den Feldzug als "Rottenmeister", d. h. als Gefreiter mit und gerieth am 2. Dezember in der Schlacht bei Champigny vor Paris infolge einer Verwundung am Beine in französische Gefangenschaft. Durch die freiwillige Verwendung eines französischen Arztes, Dr. Bitterlin, kam er in das Lazareth der Pariser Vorstadt St. Maur les Fosses, welches in den Räumen eines von dem Orden der „Religieuses du St. Sacrement“ geleiteten Mädchenpensionats eingerichtet worden war. Die Aufnahme, welche er dort nicht bloß bei den als Pflegerinnen zurückgebliebenen Ordensschwestern, sondern auch bei den durchweg dem französischen Heere angehörenden Leidensgenossen fand, war eine in jeder Beziehung musterhafte und man muß es in dem Büchlein selber nachlesen, wie der gefangene „Prussien“ nach wenigen Stunden mit seinem französischen „Kameraden“ auf so gutem Fuße stand, daß die pflegenden Schwestern dem dringenden Wunsche ihrer Landsleute nachgeben und den Landesfeind aus dem besonderen Zimmer, wohin er bereits verbracht worden war, wieder in den allgemeinen Krankensaal zurückführen mußten.
Insbesondere aber ist es eine dieser Ordensschwestern, die der Verfasser als seine „unvergeßliche, mütterlich besorgte Gönnerin und Pflegerin“ verehrt, die Madame Ste. Rosine, in Friedenszeiten Oberhausverwalterin der Anstalt. „Es gab nichts, womit sie nicht versucht hätte, mir eine Freude zu machen und mich aufzurichten. Wenn je einmal in der langen Zeit der Belagerung, so gänzlich vereinsamt, wie ich es war, mir Zweifel kommen wollten, ob denn auch alles ein gutes Ende nehmen würde, da las sie mir meine Sorgen vom Gesichte ab und verstand es immer, mich zu trösten.“ Auch um das leibliche Wahl ihres Pfleglings war sie mit rührender Sorgfalt bemüht. Aufs liebenswürdigste besorgte sie ihm Zeitungen, Schokolade, Brot, Lichter, Tabak und anderes; wenn auch nur eine kleine Heiserkeit eintrat, war sie alsbald mit Thee, Glühwein und allen möglichen Hausmitteln bei der Hand , und als nach Weihnachten die Barschaft des von dem Verkehre mit der Heimath fast gänzlich Abgeschnittenen zu Ende war, da nahm sie keinen Anstand, ihm „auf sein ehrliches Gesicht hin“ 40 Franken vorzustrecken. Es ist rührend, alle die kleinen Liebesthaten im einzelnen zu lesen, die, je weiter die Noth an Lebensmitteln fortschritt, mit um so größeren Schwierigkeiten verknüpft waren; wie die getreue Pflegerin am Christfest dem sehnsüchtig des heimatlichen Weihnachtsbaumes gedenkenden Deutschen einen Kirschlorbeerzweig mit einem Lichte davor am Bette befestigt und ihm ein „petit pain“, ein „Brötchen“, als besondere Weihnachtsgabe verabreicht; und wie sie in dem einzigen kritischen Augenblick, den die Erregung infolge der Beschießung für den deutschen Gefangenen brachte, ihm entschlossen zur Seite stand und ihn, ehe es zu schlimmen Gewaltthätigkeiten kommen konnte, rasch auf die Seite brachte. Man glaubt es dem Verfasser gern, daß ihm der Abschied aus diesem Hause nach Abschluß des Waffenstillstands, der ihm die Freiheit brachte, fast schwer wurde. Selbst der biederen Köchin des Hauses. Madame Pauline, ging die Trennung so nahe, daß sie das letzte Pferdefleisch-„Beefsteak“, in jenem Augenblick noch ein seltener und vielbegehrter Genuß, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit jämmerlich verbrennen ließ.
Es ist gewiß, nur mit aufrichtiger Hochachtung vor jenen vortrefflichen Menschen, die unter den erschwerendsten Umständen das Gebot der Nächstenliebe so glänzend erfüllt haben, wird der Leser die Aufzeichnungen des württembergischen Feldsoldaten aus der Hand legen und ein Strahl
von jener alle Völkerscheiden überwindenden Sonne der Humanität wird auf seinem Herzen ruhen. =
Falsche und wahre Prophezeiungen. Es ist eine im Leben bedeutender Männer nicht ungewöhnliche Erscheinung, daß sie in ihrer Jugend gründlich verkannt werden und ihre Umgebung ihnen keineswegs glänzende Aussichten für ihr späteres Leben eröffnet. Der Heimgang Karl Hases, des großen Kirchenhistorikers und liberalen Theologen, der am 3. Januar zu Jena starb, des „Burschenschafters auf dem theologischen Lehrstuhl“, dessen Bild und Lebensabriß die "Gartenlaube" im Jahrgang 1880 gebracht hat, erinnert an ein Geschichtchen, welches der Verstorbene selbst in seiner liebenswürdigen Jugenderinnerungen „Ideale und Irrthümer"“ erzählt. Hases Vater, Pfarrer zu Steinbach am Abhang des Sächsischen Erzgebirges, war gestorben, als der kleine Karl eben 2 1/2 Jahre alt war. Mit irdischen Gütern spärlich gesegnet, vermochte die Mutter ihre 7 Kinder nicht alle selbst heranzuziehen, und so nahm den Zweitjüngsten, eben unseren Karl, ein Freund des Vaters zu sich. Indessen auch dieser Pflegevater hatte kein Glück; er verlor in dem bösen Jahre 1806 sein Vermögen und so kam der Junge im 10. Jahre zu einem Bruder des Vaters nach Altenburg. Hier geschah es nun manchmal, daß Karl am Sonnabend eine schlechte Censur aus der Schule mit nach Hause brachte und bei dem guten Onkel und seiner Tochter, der wohlmeinenden, aber etwas rauh sich gebenden „Tante Fritzchen“ in den Geruch eines Nichtsnutzes kam. Als im November 1812 - Hase war damals 12 Jahre alt - der Onkel starb und für den Jungen abermals die Frage des Wohin? sich erhob, da meinte die Tante Fritzchen: „Siehst Du, nun ist der Vater todt: hättest Du etwas gelernt, so wärst Du was; so ist nichts aus Dir geworden.“
Besser schon wurde Hase erkannt, als er nach seiner Begnadigung vom Asperg - welche zugleich seine Ausweisung aus Tübingen und dem Königreich Württemberg in sich schloß - sich von dem Tübinger Kanzler Autenrieth verabschiedete. „Sie können noch einmal mein Nachfolger werden,“ meinte der freundliche Mann. Aber „so hoch gingen meine Gedanken nicht“, fügt der Erzähler dieser Erinnerung hinzu, „doch dachte ich: sie haben mich nun von drei Universitäten fortgejagt, sie sollen mich dafür auf drei berufen; was denn auch in nicht gar zu langer Zeit geschehen ist.“
Am besten aber traf es jene Zigeunerin, die ihm eines Tages weissagte: „Du wirst bald erhöht werden.“ Ein paar Wochen drauf saß der „Staatsverbrecher“ auf dem Hohenasperg.=
Strafjustiz und Menschenfreund. Fast über alle Begriffe geht das Elend und die sittliche und körperliche Verwahrlosung, welcher ein Gefangener in den Kerkern des Mittelalters und noch ein paar Jahrhunderte darüber hinaus preisgegeben war, gleichviel, ob er wegen schwerer oder leichter Vergehen verurteilt, kriegsgefangen oder politisch mißliebig, oder zur Untersuchung oder wegen Schulden eingesetzt war. Der Grundsatz der Abschreckung war so ausschließlich mächtig, daß darüber keine Forderung der Menschlichkeit zur Geltung kam. „Gegen das Gefängniß des Mittelalters ist der Galgen eine Barmherzigkeit,“ sagt der Berliner Strafanstaltsdirektor Krohne in seinem „Lehrbuch der Gefängnißkunde“
[98] (Stuttgart, Ferdinand Enke), und man mag dort im einzelnen die Darstellung der wahrhaft entsetzlichen Zustände nachlesen
Aber es kam das Jahrhundert der Aufklärung. Es lehrte die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz und bekämpfte die menschenvernichtende Grausamkeit der Strafen. Gleichzeitig trat von anderer Seite eine Bewegung für die Verbesserung der Gefängnisse auf, welche in dem Verbrecher nicht nur den Schädiger der Rechtsordnung, den Feind des Gemeinwesens, sondern auch den Unglücklichen erkennen lehrte.
Der Mann, welcher sich in erster Linie die Hebung des Gefängnißwesens zu seiner Lebensausgabe gemacht hat, ist der Engländer John Howard. Geboren 1726 als der Sohn eines Londoner Kaufmanns, streng puritanisch erzogen, ohne jegliche gelehrte Bildung, mit 17 Jahren durch den Tod seines Vaters Erbe eines Vermögens, das ihn unabhängig machte, bekundete er von früh auf einen lebhaften Trieb zur Verbesserung des Looses seiner Nebenmenschen.
Da hört er von dem furchtbaren Erdbeben zu Lissabon (1755). Sofort beschließt er, zu Hilfe zu eilen. Auf der Ueberfahrt fällt sein Schiff einem französischen Kaper in die Hände und nun lernt er als Kriegsgefangener den menschenunwürdigen Zustand der französischen Gefängnisse kennen, sein Blick ist zum erstenmal auf das Gefängnißelend gelenkt. In die Heimath zurückgekehrt, ruht er nicht eher, als bis er das Loos der Kriegsgefangenen in den beiden damals mit einander im Krieg liegenden Ländern, Frankreich und England, menschlicher gestaltet hat. 1773 zum Sheriff oder Richter seines Bezirkes gewählt, sieht er eines Tags, wie freigesprochene Gefangene ins Gefängniß zurückgeschleppt werden, weil sie dem Gerichtsschreiber und dem Gefängnißwärter die Sporteln nicht bezahlen können. „Er brachte diese Ungerechtigkeit vor den Gerichtshof und verlangte, daß man dem Gefängnißwärter Lohn zahle und den Gefangenen die Sporteln erlasse. Man fand seine Forderung gerecht, trug aber Bedenken, sie zu erfüllen, weil man keinen Vorgang, keinen 'precedent' habe, der Grafschaft diese Kosten aufzuerlegen. Da machte er sich auf den Weg, einen 'precedent' zu suchen; er wanderte von Grafschaft zu Grafschaft, voll Gefängniß zu Gefängniß und fand seinen 'precedent' nicht, aber überall denselben Schmutz, dieselbe Unordnung, dieselbe Zuchtlosigkeit, dasselbe Elend, dieselben betrügerischen, habsüchtigen Gefängniswärter.“
Das war für ihn der Anstoß, die Verbesserung des Gefängnißwesens mit allem Ernste und allem Nachdruck in die Hand zu nehmen. Noch mehrere Male hat er seine Wanderungen durch England wiederholt, weitreichende Studienreisen auch nach dem Festlande, ja bis in den Orient und nach der afrikanischen Küste gemacht. 42000 englische Meilen im Dienste seiner Sache zurückgelegt und 80000 Pfund Sterling von seinem eigenen Vermögen geopfert; er hat das englische Parlament für die Gefängnißreform zu erwärmen verstanden und in einem grundlegenden Werke („State of prisons in England und Wales“ 1777, d. h. „Zustand der Gefängnisse in England und Wales“) seine Erfahrungen und Vorschläge zusammengefaßt. Fernhaltung alles dessen, was dem Rechte und der Menschenwürde des Strafenden und des Bestraften widerspricht, das ist der Grundsatz, von dem er ausgeht und mit welchem er ein Vorbild für alle späteren Bestrebungen aus diesem Gebiete geworden ist.
Auf der letzten seiner großen Reisen ist er am 20. Januar 1790 zu Cherson in Südrußland infolge von Ueberanstrengung oder Ansteckung gestorben. Wohl war es die letzte Bitte des bescheidenen Mannes gewesen: „Setzt auf mein Grab eine Sonnenuhr, nichts weiter, und vergeßt mich!“ Aber er hat doch um seines edlen Wirkens willen in der Paulskirche zu London ein Denkmal erhalten und er ist es auch werth, daß heute noch, 100 Jahre nach seinem Tode, die Menschheit dankbar seiner gedenke. -
An südlichen Gestaden. (Zu dem Bilde S. 85.) Sie ist überall gleich, die stumme wortlose Sprache der Liebe, ob der dunstverhüllte kühle nordische Himmel sich über sie spannt, oder der Süden seine azurne Herrlichkeit über ihr leuchten läßt. Sie wird überall gesprochen und überall verstanden.
Im fernen Süden ist's, an wogenumspülter Küste. Ein schmales Vorgebirge zieht sich hinaus in das Meer und trägt auf seiner Spitze ein altes Tempelchen, das griechischer Schönheitssinn der meerentstiegenen Göttin erbaut. Hell und freudig sind die Töne dieser begnadeten Landschaft und nur vereinzelt dämpfen Oelbäume das helle Licht; düstere Cypressen ragen schlank zum Himmel empor, und aus ihren Zweigen rauschen ernste Gedanken.
Aber das Paar auf unserem Bilde, das versunken ist in die stumme Zwiesprache der Liebe, es schaut nicht hinauf zum blauenden Himmel, nicht auf die leuchtenden Töne der Felsen, es lauscht nicht dem Plätschern der Wogen und dem Säuseln des Seewindes, es verlangt nicht nach dem Schatten des Oelbaumes und hört nicht auf das ernste Flüstern der Cypressen. In stiller Frage reicht der Jüngling der Freundin die Blume und Antwort suchend hängt sein Auge an dem ihren - und alle Herrlichkeiten der Natur rings um sie her werden nur unbewußt von ihnen empfunden, sie sehen und zergliedern sie nicht, sie fühlen sie nur als ein Ganzes, als eine köstliche Harmonie, in der ihre Seelen voll Wonne sich wiegen und beglückt sich hingeben an den seligen Traum der Jugend und Schönheit.
Die hauswirthschaftliche Unterweisung armer Mädchen betitelt sich ein Buch von F. Kalle und Dr. D. Kamp (Wiesbaden, I. F. Bergmann), welches wir unseren Leserinnen um seines anregenden Inhalts willen empfehlen. Es behandelt in gründlicher und sachgemäßer Ausführung die große und brennende Frage des Arbeiterhaushalts, beziehungsweise seiner Vernachlässigung durch Frauen, die von der Wirtschaft nichts verstehen, weil sie aus der Volksschule in die Fabrik und von da in die Ehe traten. Bei den heutigen Löhnen kann auch der Arbeiter sich eines behaglichen und geordneten Heims erfreuen, falls er eine reinliche, ordnungsliebende Frau besitzt, welche zu kochen und zu flicken versteht; ihm diese zu verschaffen,
ist das Ziel, welches von einer großen Zahl von Vereinen in Deutschland bereits angestrebt wird. Die Verfasser führen im Eingang des Buches aus, wie das Dienen in „bessern Häusern“ mit seinem mannigfachen Verwöhnungen nicht die wünschenswerthe Vorbildung liefert, weil die Mädchen eben das, was sie künftig selbst brauchen, nicht darin üben. Ausdrücklich wird hierauf betont, daß jede Haushaltungsschule nur ein Nothbehelf ist
für die mangelnde Unterweisung durch eine tüchtige Mutter; dann kommt eine Uebersicht der überraschend großen Anzahl von praktischen Haushalts- Industrie-, Koch- und Flickschulen, die überall in Deutschland von Städten, Vereinen und Privaten bereits gegründet worden sind und sämmtlich segensreich wirken.
In Kassel, Mühlhausen, Rappoltsweiler und anderwärts hat man die Haushaltungskunde als neuen Gegenstand in die Volksschule eingeschoben, in vielen Städten (Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe) bestehen Tagesschulen, welche die aus der Volksschule abgegangenen Schülerinnen noch während einiger Zeit besuchen. All letzterem Ort hat die unermüdliche Großherzogin Luise Kochkurse gegründet, für die einfachsten Verhältnisse berechnet, welche im ganzen Lande Nachahmung finden. Ein Flickabend für Arbeiterfrauen in Frankfurt hat starken Zuspruch, ebenso steht es mit den vielen abendlichen Näh- und Flickschulen für Fabrikmädchen in der Rheinprovinz, in Dresden und Berlin. Kurz, es ist ein erfreuliches Bild sittlichen und wirtschaftlichen Fortschritts, welches uns aus diesen Blättern entgegensteht. Aber es bleibt noch unendlich viel zu thun, bis aus diesen Anfängen sich eine feste, ganz Deutschland umfassende Ordnung entwickelt. Dazu beizutragen sollten sich recht viele Frauen und Mädchen der oberen Stände entschließen. Ihnen vor allem sei das genannte Buch ans Herz gelegt als Anweisung zu eigener segensreicher Thätigkeit.
Neue Balladen von Heinrich Bierordt. Der Dichter, der sich aus dem Gebiete der Ballade einen Ruf verschafft und besonders dadurch Verdienste erworben hat, daß er an Stelle der alten Gespensterballaden oft zeitgeschichtliche gesetzt, hat jüngst „Vaterlandsgesänge“ herausgegeben (Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung). Die ersten derselben sind trauliche Idyllen, wie das Gedicht „Die Spieldose“ mit seinen Christfesterinnerungen und „Die Uhr der Großmutter“. Einem Loblied auf des Dichters engere Heimath Baden folgt eine Reihe geschichtlicher und litterargeschichtlicher Bilder, die in diesen vaterländischen Rahmen gefaßt sind. Auch werden uns Bilder der Verwüstung vorgeführt, von der jene schönen Lande durch die Einfälle der Franzosen zur Zeit des vierzehnten
Ludwig und der Revolution heimgesucht wurden. Die dichterische Sprache hat Fluß und Schwung ohne Ueberschwänglichkeit. Der Dichter huldigt dem Geist der Neuzeit:
"O neue Zeit, wo immerdar
Dein Rad beflügelt läuft,
Die Freiheit aus dem Schwingenpaar
In goldnen Tropfen träuft."
Eine an die nächtliche Heerschau von Zedlitz erinnernde Ballade, die ihren Stoff aus einem der neuesten Vorgänge entnimmt und ein Kaiserwort poetisch illustrirt, ist:
Die Todten von Samoa .
| |
|
"O klagt nicht, da so sanft wir ruhn 5 Und hielten wir auch nicht die WachtAm Rhein mit blanker Wehre, 10 Feind gegen Feind gefallen -Wir starben doch fürs Vaterland 15 Eh' uns die Fluth hinabgespült In mitternächt'ger Tücke. |
Ruft Kaiser Wilhelm einst sein Heer 20 Benetzt vom Schaum der Welle.
25 Mit Streitern von dem Strand des Rheins,Von Metz, von Gravelotte, 30 Im tiefen Oceane.Auf Meeresgrund noch wogt am Mast †
|
Philippine Welser vor Kaiser Ferdinand I.. (Zu dem Bilde
S. 93.) „Ihre Haut ist so zart, daß man den rothen Wein, den sie trinkt, durch ihren Hals gleiten sieht“, so rühmten die Zeitgenossen von der Augsburger Bürgerstochter Phillppine Welser, dem schönsten Mädchen der damaligen Welt. Und Kaiser Ferdinands I. Sohn, Erzherzog Ferdinand von Tirol, sah sie, als er mit seinem Vater und seinem Oheim, dem Kaiser Karl V., im Jahre 1547 einzog in die alte Reichsstadt, und es ergriff ihn
eine Liebe zu dem wunderbaren Mädchen, gegen die kein Bedenken und keine Furcht vor dem gestrengen Vater mehr aufkam. Wohl widerstand Philippine lange seinen glühenden Werbungen: erst 1550 ließ sie sich, wie es scheint, im Einverständniß mit ihren Eltern, heimlich zu Innsbruck mit dem Fürstensohne trauen. Aber über dem Glücke der Liebenden schwebte drohend der Zorn des kaiserlichen Vaters. Sechs Jahre lang blieb aller Verkehr zwischen ihm und dem Sohne unterbrochen: da endigte Philippine durch eine kühne That den unseligen Zwist.
Sie zieht mit ihren zwei Kindern nach Prag, wo der Kaiser sich aufhält. Unerkannt mischt sie sich bei der nächsten Audienz unter die Reihen der Bittenden, unter fremdem Namen trägt sie dem Herrscher das bittere Leid vor, das sie von einem harten Schwiegervater erdulde. Und sie entlockt dem alten Manne eine Thräne der Rührung, bei seinem kaiserlichen Worte verheißt er, ihr Recht zu schaffen - da giebt sich Philippine zu erkennen, und die gewaltige Macht ihrer engelgleichen Schönheit, die liebliche Unschuld ihrer reizenden Kinder siegen über den aufsteigenden Grimm des Getäuschten. Er weist die Versöhnung nicht mehr zurück und wenn auch die Ehe Ferdinands und Philippinens noch eine
[99] Reihe von Jahren geheim bleiben muß, so ist doch der schwere Bann von ihnen genommen, und in stillen Glück leben die Gatten fortan in den schönen Räumen des Ambraser Schlosses bei Innsbruck.
Der Maler hat den Augenblick dargestellt, in welchem der Kaiser, überwältigt von dem Anblick, der sich ihm bietet, und hingerissen von den Empfindungen, welche die holde Frau durch ihre Worte in ihm geweckt hat, tiefsinnend zurückgesunken ist auf seinen Stuhl. Scheu blicken die blühenden Enkelkinder empor zu dem erschütterten Manne, in welchem sie zum erstenmal den Großvater erschauen.
Erst 1654, nach dem Tode Kaiser Ferdinands I., wurde die Ehe auch öffentlich anerkannt und Philippine zur Markgräfin von Burgau ernannt, ein Name, der auch auf ihre Kinder überging.
Der älteste Blitzableiter. Das Jahr 1749 wird gewöhnlich als dasjenige angesehen, in welchem Benjamin Franklin den Blitzableiter erfunden hat. 1762 wurde dann der erste Blitzableiter in England, 1769 der erste in Deutschland zu Hamburg am Jakobithurm errichtet. Seltsamerweise wird aber schon im 14. Jahrhundert der Vorschlag gemacht, die angebliche
schädliche Einwirkung des Blitzes auf die Hühnereier durch einen aufwärts gekehrten spitzigen eisernen Nagel – also einen Blitzableiter – abzuwehren. In dem zwischen 1346 und 1349 geschriebenen „Buch der Natur“ von Conrad von Megenberg findet sich nämlich folgende Stelle:
„Ez verderbent auch die prutayer dicke (oftmals) von einen, gähen donr, oder von des habichs stimme. Jdoch hat man ein chunst dawider, daz in (ihnen) der donr iht (nicht) schad: der ainen spizzen, eysnen nagel nimmt, und legt in twehrs (quer) zwischen die ayr, oder inwendig (inmitten) setzet den nagel auf gerichtet: so schadet in (ihnen) der Toner nicht.“ Uebrigens sollen schon die alten Aegypter Kenntniß von Vorrichtungen zur Ableitung der Blitzgefahr gehabt haben.
Die ausstoßende Kraft des Gletschereises. Unter den Bergbewohnern besteht die Meinung, daß die Gletscher nichts Fremdes in sich dulden und alles Unreine ausstoßen. In der That ist es wahr, daß Gegenstände, die in Gletscherspalten gefallen oder absichtlich hineingeworfen worden waren, nach einiger Zeit an einer tieferen Stelle des Gletschers zum Vorschein kamen. Ein derartiger Fall erregte vor Jahren großes Aussehen. Im Jahre 1820 wollte der russische Naturforscher Dr. Hamel mit zwei englischen Forschern und vielen Führern und Trägern den Montblanc besteigen. Als sich die Gesellschaft nicht mehr weit von dem Gipfel befand, gerieth der auf dein Eise lose liegende Schnee ins Gleiten, stürzte als Lawine in die Tiefe und drei von den Leuten wurden verschüttet. Nach 41 Jahren gab der Bossongletscher an seinem unteren Ende einige Reste der Opfer wieder. Man fand hier Theile der Kleider der Verunglückten und den grünen Gletscherschleier des Dr. Hamel, der von den noch lebenden Führern wiedererkannt wurde. Ein Jahr darauf wurde eine Hand nebst anderen Resten gefunden. Man glaubte früher wirklich daran, daß dem Eise eine ausstoßende Kraft beiwohne. Der Vorgang erklärt sich jedoch anders. – Im Jahre 1827 war auf der Mittelmoräne des Aargletschers eine Steinhütte erbaut worden; drei Jahre darauf fand man, daß dieselbe um 100 m thalabwärts gewandert war. 1832 wurden auch die Reste einer Leiter gefunden, die Sauffure im Jahre 1788 auf dem „Mer de Glace“ (Eismeer) des Montblanc zurückgelassen hatte, und aus dem Fundorte wurde berechnet, daß jene Reste jährlich 114 m thalwärts zurückgelegt hatten. Seit jener Zeit wissen wir, daß die Gletscher langsam aber stetig zu Thal fließen. Infolgedessen gelangen sie in wärmere Regionen und schmelzen ab, so daß die Gegenstände, die in die Gletscherspalten gefallen sind, nunmehr auf der Oberfläche des Gletschers erscheinen.
E. Sch. Bremen. Ohne Besuch einer Kriegsschule können zur Offiziersprüfung nur diejenigen zugelassen werden, welche im Besitz eines vollgültigen Abiturientenzeugnisses eines deutschen Gymnasiums oder Realgymnasiums sind und mindestens ein Jahr auf einer deutschen Universität, technischen Hochschule, Berg- oder Forstakademie studirt haben, sowie die Offiziere des Beurlaubtenstandes, welchen die Erlaubnis, zum Uebertritt in den Friedensstand des Heeres ertheilt worden ist.
D. K. in Wels, Oberösterreich. Wir müssen Sie auf den Abschnitt über den Barometer in irgend einem physikalischen Lehrbuch verweisen. Innerhalb des Rahmens einer Briefkastennotiz läßt sich Ihre Anfrage nicht beantworten.
F. L. in Bordeaux. Die Romane E. Werners sind, mit Ausnahme der neuesten, ins Französische übersetzt worden, „Vineta“ ist im Verlage von W. Hinrichsen in Paris erschienen.
C. Sch. Frankfurt a. M. Durch die neuesten Veröffentlichungen ist allerdings der Name „Behrends“ als der richtige nachgewiesen werden. Bis dahin aber herrschte ein Schwanken in der Schreibung des Namens. Wir haben uns an die von Anastasius Grün, dem nahen Freunde Lenaus, gehalten, welcher in seiner biographischen Einleitung zu Lenaus Werken „Behrend“ schreibt.
E. B. Hemmerde. Ihrem Wunsche dürfte das Werk von Kugler, „Geschichte Friedrichs des Grossen“ entgegenkommen. Was Dickens’ ausgewählte Romane betrifft, so sind dieselben gewiß eine vortreffliche Lektüre. Im übrigen übernimmt bekanntlich die Redaktion und Verlagshandlung der „Gartenlaube“ für den Inhalt der Inseratbeilagen keine Verantwortung.
I. E. in Stadtilm. Die Form „Offiziersaspirant“ ist die richtige.
Waldrose in G. bei P. „Bitte um Antwort in der nächsten Nummer!“ Haben Sie noch nie eine Notiz in der „Gartenlaube“ gelesen, daß eine Antwort wegen der langen Druckzeit, welche die hohe Auflage unseres Blattes erfordert, frühestens in vier Wochen erfolgen kann? Dann bitten wir Sie, es sich jetzt freundlich zu merken! Halten Sie übrigens Ihren Namen etwas leserlicher geschrieben, so hätten wir Ihnen gern längst brieflich geantwortet Also Malstudien, „hübsche Vorlagen für eine fleissige Dilettantin“ wünschen Sie. Da Sie nicht näher angeben, welcher Art dieselben sein sollen, nennen wir Ihnen: „Rehwild“, 8 Blatt Naturstudien, und „An der See“, vier Studien vom holländischen Strande (beides Verlag von Willner u. Pick, Teplitz in Böhmen). Wenn sie im Zeichnen geübt sind, können Sie nach diesen Vorlagen recht hübsche Aquarellen ausarbeiten.
J. A. S., Tucson Nicht geeignet. Sie wollen freundlichst über das Manuskript verfügen
J. B., Amsterdam Wenden Sie sich an den „Deutschen Hilfsverein“ in Amsterdam. Derselbe erhält für seinen menschenfreundliche Thätigkeit Beiträge von seiten des Deutschen Reiches und der Einzelstaaten und hat im Jahre 1889 1200 bedürftige Deutsche unterstützt.
Junge Frau in Pl..n. Ein sinniges Gedenkbuch für junge Mütter erschien unter dem Titel „Mein Kind von der Wiege bis zur Schule“ bei Brachvogel und Ranft in Berlin. Dasselbe enthält vier reizvolle Bilder des häuslichen Glücks von Alexander Zick und daneben hübsch umrahmte leere Blätter für handschriftliche Aufzeichnungen. Wünschen Sie aber ein mehr allgemein gehaltenes Buch, so bietet derselbe Verlag in seinem „Gedenkbuch fürs Haus“ in einfach gediegener Ausstattung eine Chronik, in welche Sie alle die kleinen und großen Ereignisse des Familienlebens eintragen können.
Warnung vor Geheimmitteln.
Die Geheimmittelschwindler sind unermüdlich in der Erfindung immer neuer Mittel zur Ausbeutung der wirklichen oder eingebildeten Leidenden, denen die Zuversicht zu einem tüchtigen praktischen Arzte mangelt, die aber kein Bedenken tragen, ihr Geld wie ihre Gesundheit dem ersten besten Kurpfuscher in der leichtfertigsten Weise anzuvertrauen. Soviel auch gegen den Geheimmittelschwindel gekämpft wird, immer wieder treibt er neue Blüthen, und so sicher und einträglich ist das Geschäft, daß ein kostspieliger Reklameapparat in Bewegung gesetzt werden kann, durch marktschreierische, oft spaltenlange Annoncen und besondere „Beilagen“ zu den Tageszeitungen die Opfer aus nah und fern heranzulocken. Mittel, welche einen Werth von wenigen Pfennigen besitzen, werden vielfach um doppelt so viele Mark abgegeben und als „Universalmittel“ gegen alle möglichen Krankheiten angepriesen, während sie in der That nicht gegen eine einzige helfen. Dabei wird kein Alter verschont, vom Säugling in der Wiege an bis zum altersgebeugten Greise jeder bedacht; und kein Leiden irgend welcher Art giebt es, gegen das die Kurpfuscher nicht angeblich durchaus sichere Mittel gefunden hätten.
Einen interessanten Beleg dafür, wie vielseitig sich der Geheimmittelschwindel entwickelt hat und mit welcher Erfindungsgabe er ins Werk gesetzt wird, bieten wieder die jüngsten Bekanntmachungen des unermüdlich gegen das Kurpfuscherunwesen kämpfenden Ortsgesundheitsrathes zu Karlsruhe in Baden, denen wir hiermit zur allgemeinen Warnung weitere Verbreitung geben wollen. Berlin, Hamburg und Dresden können als Hauptsitze des hier in Frage kommenden Geheimmittelschwindels gelten, doch werden auch von kleineren Orten aus und von großen Städten des Auslandes, namentlich London, Paris, Budapest, Wien, Leichtgläubige mit Anpreisungen aller Art beglückt.
Der Ortsgesundheitsrath schreibt in den von ihm versandten besonderen Flugblättern:
1. „Als ‚Beruhigungsmittel für zahnende Kinder’ empfiehlt Marie von Schack durch besondere Reklamen der Niederlage von Karl Hoffmann, Berlin 8, Brandenburgstraße 19, Kräuter-Zahnsäckchen, welche die Kinder auf der Herzgrube tragen sollen. Die kleinen Säckchen aus farbigen, Stoff enthalten etwa 2 Gramm eines gröblichen aromatischen Pflanzenpulvers, hauptsächlich Steinklee, das die angepriesene Wirkung nicht ausübt. Der Preis von 1 Mark für zwei derartige Säckchen ist viel zu hoch, da der Werth nur wenige Pfennige beträgt.“
2. „G.H.Braun in Hamburg preist in einer Broschüre verschiedene Mittel gegen Kopf- und Nervenleiden marktschreierisch an. Das Braunsche Kopfwasser erwies sich als eine stark mit Wasser verdünnte weingeistige Lösung ätherischer Oele (sogen. Kölnisches Wasser), während in den mit geheimnisvollen Aufschriften versehenen homöopathischen Tropfen keinerlei wirksame Bestandtheile nachgewiesen werden konnten. Beiden Mitteln, welche zusammen für 2 Mark 30 Pfennig in jeder Apotheke gekauft werden können, während sich Braun 9 Mark dafür bezahlen läßt, kommt die angepriesene Heilwirkung nicht zu.“
3. „Ein Dr. Stark in Liebau in Schlesien preist in einer umfangreichen Schrift seine Mittel zur Heilung der Epilepsie an. Diese bestehen in „Krampfthee“ und „Krampfpulver“ (Antispasmodium). Ersterer ist zusammengesetzt aus Baldrianwurzel, Veilchenwurzel, Engelsüß, Faulbaumrinde, Arnicablüthen, Römischen Kamillen und Sennesblättern. Das Pulver enthält hauptsächlich pulverisirte Baldrianwurzel, welcher reichlich Zucker zugesetzt ist.
Beide Mittel sind völlig unwirksam gegen Epilepsie, kosten aber bei Stark zusammen 11 Mark 40 Pfennig, während ihr Werth nach der Arzneitaxe 3 Mark 75 Pfennig beträgt.“
4. „Unter dem Namen Altstädters ‚Phönix-Geist’ wird als Universalmittel gegen die verschiedenartigsten Krankheiten ein gewöhnlicher, mit Zimmet und Enziantinktur versetzter Getreidebranntwein marktschreierisch angepriesen.
Die Flasche einer solchen Mischung, die weder bei äußerlichem Gebrauch noch bei innerer Anwendung irgend welche Heilwirkungen hat, kostet bei dem Erfinder B. Altstädter, Budapest, 10 Mark, während sie in jeder Apotheke für 2 Mark zu bekommen wäre.“
5. „‚Taubheit endlich heilbar’ ist die Aufschrift einer Broschüre, in welcher auf marktschreierische Weise für den ‚Chinesischen Balsam’ von Dr. Mountain in London, Chancery Lane 64, Reklame gemacht wird und welche schwerhörigen Personen von London aus zugeht. Die Broschüre verspricht bei dem Gebrauch dieses ‚unfehlbaren Heilmittels’ nicht nur Erneuerung der Ohrtrommeln und Wiederherstellung der Gehörnerven, sondern sogar Heilung angeborener Taubheit. Der ‚Chinesische Balsam’ besteht aus einer Mischung von Mohnöl, Glycerin und Weingeist und hat bei den oben bezeichneten tieferen Erkrankungen des Ohres keinerlei Heilwirkung. Was den Preis betrifft, so würde eine derartige Mischung in jeder Apotheke nach der Arzneitaxe 70 Pfennig kosten, während für den Balsam die Summe von 4 Mark 50 Pfennig bezahlt werden muß, welche sich durch die Transportkosten (Zusendung durch die Apotheke zur Austria von A. Grohs in Wien) auf 6 Mark 28 Pfennig erhöht.“
6. „Paul Weidhaas, Dresden-Altstadt, Reißigerstraße 42, preist in Blättern und besonderen Broschüren marktschreierisch ein Heilverfahren gegen Asthma an.
[100] :Wer sich an Weidhaas wendet, erhält einen angeblichen Inhalationsapparat, aus dem durch eine schwache Lösung von übermangansaurem Kali und einem Wattefilter desinficierte Luft eingeathmet werden soll. Der Apparat ist werthlos, da der Patient ganz unveränderte Luft, außerdem auf sehr unbequeme Art, einathmet. Der Apparat hat den schwindelhaft hohen Preis von 16 Mark 80 Pfennig.
- Außer dem Gebrauch dieses Apparates verordnet Weidhaas noch sogenannten ‚Sternthee‘, zu beziehen durch die Annenapotheke in Dresden. Dieser Sternthee ist eine dem sogenannten Brustthee ähnliche Mischung, kostet bei Weidhaas 1 Mark, während das gleiche Quantum in jeder Apotheke für 50 Pfennig käuflich ist."
In einer Zuschrift an die Redaktion der „Gartenlaube“ giebt Weidhaas den Preis des „angezogenen Apparats“ abweichend auf 4 Mark an und bemerkt weiter, daß er „gegen den Ortsgesundheitsrath klagbar werden müsse“, wovon indeß nach der von uns erbetenen Auskunft dem Ortsgesundheitsrathe „bis jetzt nichts bekannt geworden ist.“ In einer zweiten Zuschrift an die Redaktion betont Weidhaas lediglich, daß der für Apparat und „Leitung der Kur“ berechnete Preis keineswegs stets die angegebene Höhe von 16 Mark 80 Pfennig erreiche.
Am besten wird aber das Geheimmittelunwesen gekennzeichnet durch eine letzte Bekanntmachung, aus der zugleich hervorgeht, wie die Kurpfuscher sich anscheinend wissenschaftlich gebildeter Helfershelfer zu bedienen wissen, und endlich, welchen ungeheuren pekuniären Erfolg sie sich zu schaffen verstehen. Das interessante Aktenstück hat folgenden Wortlaut:
- 7. „Ein gewisser Reinhold Retzlaff in Dresden kündigt periodisch in hiesigen (Karlsruher) Blättern ein unfehlbares Mittel gegen die Trunksucht an. Dasselbe kostet 9 Mark, besteht aus Enzianwurzelpulver und ist vollständig nutzlos. Die bekannten Helfershelfer des Geheimmittelschwindels: ‚Medizinalrath‘ Dr. Johannes Müller in Berlin, Dr. Heß daselbst und Dr. Theobald Werner in Breslau haben auch dieses Mittel in ‚wissenschaftlichen Gutachten‘ empfohlen.
- Wie große Summen von seiten des leichtgläubigen Publikums an solche Schwindelgeschäfte vergeudet werden, ergiebt sich daraus, daß die von besagtem Retzlaff in einem einzigen Jahre gemachten Einnahmen nach zuverlässigen amtlichen Erhebungen auf über 300000 Mark zu schätzen sind.“
So oft die „Gartenlaube“ bereits vor dem Geheimmittelschwindel gewarnt hat, immer wieder zeugen zahllose Zuschriften an die Redaktion, in welchen diese um Auskunft über die verschiedensten Mittel gebeten wird, davon, wie tief das Unwesen sich in den weitesten Kreisen eingenistet hat. Hoffen wir, daß die obigen deutlichen Gutachten von berufener Seite wiederum dazu beitragen, die Hilfsbedürftigen vor Ausbeutung zu schützen und sie Hilfe ausschließlich dort suchen zu lassen, wo sie allein zu finden ist: bei tüchtigen, wissenschaftlich gebildeten Aerzten! * *
Allerlei Kurzweil.
| Dechiffriraufgabe. | Scherzbilderräthsel | Aufgabe. |
| Daribubulere rohe dibuhalohiburiloli lehorilu ridu Buhodoholu, Redebodiho dohori rahe Bolurodehode Dihuhalohi; Roholulu roriho Bidehoheroho, roriho daride dihodoholu, Hiholidere rilu’le horodoluho Lihodera rahedehalohi. Duboderiho Lobobudu. Buchstabenräthsel. Was in Büchern man mit f Vorn stets suchen muß, Bildet, sieht man es mit h, Stets der Bücher Schluß. Logogryph. Was ein Erfolg dem Manne sei Mit u zu frischem Werke, Giebt ihm mit t, als Zeitvertreib, Geschicklichkeit und Stärke. |
||
| Die Buchstaben dieser Figur sind so zu ordnen, daß – ohne Fragezeichen – die obere wagerechte Reihe einen kaufmännischen Ausdruck, die senkrechte Reihe einen Kanton der Schweiz und die untere wagerechte Reihe ein Sternbild des Thierkreises bedeutet. Werden hierauf die beiden Fragezeichen durch bestimmte Buchstaben ersetzt, so nennen die Reihen in obiger Folge ein Gebirge in Europa, eine Stadt in Italien und einen Theil des Gesichts. A. St.
|
| Räthsel. | Homonym. |
Jedermann bin ich bekannt als Stadt im |
Was mit „der“ sich beim Essen und Sprechen |
| Anagramm. | [Verlagsreklame] |
| Erbsen, Paris, Granat, Regan, Dante, Anis, Penso, Banner, Alboin, Loch, Nimes, Erben. Aus jedem der vorstehenden Wörter ist nach dem Hinzufügen je eines Buchstabens durch Umstellen der Laute ein neues Wort zu bilden und zwar in der Weise, daß die hinzugefügten Buchstaben eine Dichtung R. Hamerlings ergeben. Bedeutung der Wörter (in anderer Reihenfolge): 1. Erdtheil, 2. griechische Ruinenstadt, 3. chemisches Element, 4. Stadt an der Weser, 5. Gruppe der Alpen, 6. Abschnitt des Kirchenjahrs, 7. Dorf bei Wien, 8. biblischer Name, 9. Gebirge in Palästina, 10. Stadt in Frankreich, 11. Edelstein, 12. Stadt in Indien. Auflösung der Dominoaufgabe auf S. 68: Im Talon lagen: C behielt:
|
- ↑ „Madame“ ist hier wie später immer Frau Peters.
- ↑ Indem er damit nach ihnen schlägt.
- ↑ Das Kind hatte in der That dunkle Augen und Haare.
- ↑ Ansätze zu Engelsflügeln.
- ↑ Mutter der Frau Peters, die bei ihrem Schwiegersohne wohnte.
- ↑ Alte Frau, die zur Wartung der Kinder angestellt war.
- ↑ Wirthschafter in Thalberg.
- ↑ Er war Soldat gewesen.
- ↑ Die beiden Töchterchen.
- ↑ Fliegen mit den Engelsflügeln.
- ↑ „Ente“ = kindliche Aussprache des Names „Reuter“, der von den Kindern stets als „Onkel“ angeredet wurde.
- ↑ Nachbargut, auf welchem damals Luise, Reuters spätere Frau, als Erzieherin thätig war.
- ↑ Wegen der herrschenden Cholera war das Obstessen vom Arzt untersagt.
- ↑ Der damals drei Jahre alte Sohn.
- ↑ Wirthschafter in Thalberg.
- ↑ Ebenfalls Wirthschafter in Thalberg.
- ↑ Küchenlehrling.
- ↑ Einen alten Bekannten, der in einen langwierigen Prozeß verwickelt war.
- ↑ Scherzhaft für Peters’ Schwiegermutter.