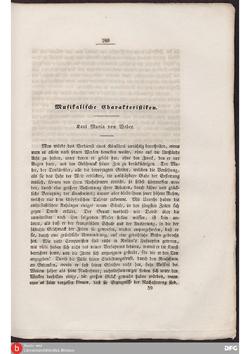Musikalische Charakteristiken – Karl Maria von Weber
Man würde das Verdienst eines Künstlers unrichtig beurtheilen, wenn
man es allein nach seinen Werken bemessen wollte, ohne auf die Umstände
Acht zu haben, unter denen er gelebt hat, ohne den Zweck, den er vor
Augen hatte, und den Geschmack seiner Zeit zu berücksichtigen. Der Maler, der Tonkünstler, alle die bevorzugten Geister, welchen die Vorsehung,
als sie das Licht der Welt erblickten, die unschätzbare Gabe der Erfindung
verlieh, können von ihren Nachahmern erreicht, ja selbst übertroffen werden, durch eine größere Vollendung ihrer Arbeiten, durch kühne und glückliche Benutzung der Kunstmittel; immer aber bleibt ihnen jener höhere Ruhm,
welcher nur dem schöpferischen Talente zukommt. Mit Unrecht haben die
enthusiastischen Anhänger einiger neuen Schule, in den jüngsten Zeiten sich
gegen David erklärt. Der Grund weshalb wir David über die
unmittelbar nach ihm folgenden Maler stellen müssen, ist kein anderer, als daß er der französischen Schule aus der Ausartung, in die der
schlechte Geschmack der Zeiten sie geworfen, wieder emporgeholfen, daß er
sie, durch eine gründliche Umwandlung, auf eine gedeihliche Bahn gebracht
hat. Wie viele Componisten sind nicht in Rossini’s Fußtapfen getreten,
wie viele haben sich nicht des neuen Verfahrens bedient, womit er die Kunst
bereichert hatte, und die Ideen sich anzueignen gestrebt, für die er den Ton
angegeben! Durch die Fülle seiner Einbildungskraft, durch den Reichthum
an Gedanken, worin er fast seines Gleichen nicht hat, steht Rossini bei
Weitem höher als seine Nachahmer; nichtsdestoweniger finden sich unter den
Werken derselben einige, die großes Glück gemacht haben würden, wenn
man es hätte vergessen können, daß sie Erzeugnisse der Nachahmung sind. In der Zukunft, wenn der Wechsel der Form, dem alle Künste und die
Musik ganz besonders unterworfen sind, Rossini und seine Schule in Vergessenheit gebracht haben wird, wann die Menge den Schöpfer des Wilhelm Tell so wenig kennen wird, wie sie jetzt von dem der Armida und
der Iphigenia weiß, dann werden diejenigen, denen die Geschichte der
Kunst am Herzen liegt, ein genaues Studium daran setzen müssen, um das
Originalwerk von der Nachahmung zu unterscheiden.
Um die Verdienste K. M. Weber’s im rechten Lichte zu würdigen, müssen wir uns erinnern, daß er das Haupt der neuen dramatischen Schule ist, welcher die deutsche Oper ihr heutiges Gedeihen verdankt, und daß Marschner, Spohr nebst vielen andern nichts als Nachahmer seines Styles sind. Weber ist nach Mozart der erste deutsche Componist, der die Opernmusik in ihrer Form und in ihrem Geiste wesentlich verändert hat. Gleichwie Rossini, ist er den übrigen Tonkünstlern seiner Schule, — ich rede nicht von Meyerbeer, der immer für die italienischen und französischen Theater geschrieben hat, — überlegen geblieben, sowohl hinsichtlich des Gedankengehaltes seiner Werke, als wegen des von ihm begründeten Systems der Instrumentation. Allein, nehmen wir auch an, daß er in der Anwendung gleicher Mittel übertroffen wäre, so bleibt ihm doch immer, vor allen andern, der Ruhm, der Erfinder derselben zu sein.
Unter allen Künstlern der Gegenwart ist mir keiner bekannt, dessen Leben und Wirken ein größeres Interesse erweckte, als die Geschichte K. M. Weber’s; nicht sowohl, weil dieselbe mit Ereignissen von allgemeiner Wichtigkeit in Berührung stände, als vielmehr wegen der inneren Bewegungen und Stürme, welche auf das seiner Natur nach reizbare Gemüth eines Künstlers heftiger wirken, als auf die Menschen der praktischen Welt.
Karl Maria von Weber ward bekanntlich zu Eutin, einem holsteinischen Städtchen, am 18ten November 1786 geboren. Sein Vater, ein ausgezeichneter Violinist, bemerkte die Anlage, welche der Knabe schon frühzeitig für die Musik an den Tag legte, und vernachläßigte nichts, sie auszubilden. Aber der junge Weber zeigte nicht allein für die Musik eine angeborne Neigung; er fühlte sich eben so sehr zur Malerei hingezogen, so daß man über die Laufbahn, der man ihn bestimmen sollte, in Zweifel war. Er schloß sich nicht näher an die Kinder seines Alters an, da die Gelegenheit dazu sich nicht darbot; denn die Familie lebte sehr zurückgezogen, und sah in ihrer Mitte nur eine geringe Anzahl Menschen, meist von ernstem Wesen, und fast alle durch irgend ein besonderes Talent ausgezeichnet. So lernte Weber in seiner Kindheit die Freuden nicht kennen, die man in jenen glücklichen Jahren zu genießen pflegt, oder richtiger gesagt, er hatte keine Kindheit. Genöthigt für sich allein zu leben, verschloß er sich in sein Inneres, und bildete sich in der Phantasie eine Welt, in der er seine Beschäftigung und sein Glück suchte. Malerei und Musik waren zu gleicher Zeit die Gegenstände seiner Thätigkeit; er zeichnete, malte in Oel und Aquarell, er fing sogar an, in der Kunst des Aetzens einige Geschicklichkeit sich zu erwerben. Aber welchen Reiz auch diese Arbeiten anfangs für ihn hatten, mit welchen, Eifer er auch sich ihnen hingeben wollte, dennoch trieb ihn eine täglich wachsende Neigung für die Musik, davon abzulassen; das Verlangen, sich ganz dieser Kunst zu widmen, gewann die Oberhand. Webers Vater wünschte nichts mehr, als dieser natürlichen Neigung die Hand zu leihen, aber er verstand es nicht, ihm eine strenge und methodische Anleitung zu geben. Zufällige Umstände, vielleicht auch Veränderlichkeit und Laune ließen ihn seinen Wohnort häufig wechseln, und die Folge davon war, daß sein Sohn immer neuen Lehrmeistern übergeben ward. Auf diese Weise mußte in seine Studien eine große Unsicherheit kommen, denn nicht selten verdammte ein Lehrer die Grundsätze, welche sein Vorgänger dem Knaben eingeprägt hatte. Aber grade der Widerspruch einer Methode gegen die andere spornte den jungen Schüler früh an, sich eigenem Nachdenken zu überlassen. Er wollte wissen, warum die Einen verwarfen, was den Andern gut schien, und woher es käme, daß man nicht allgemein über die Grundprincipien der Kunst einverstanden wäre. Eine jede Frage suchte er durch eigenes Urtheil zu entscheiden; er stellte Vergleichungen an, hielt die widersprechenden Ansichten, die man ihm fast zu gleicher Zeit vorlegte, gegen einander, und so gelang es ihm, sich eine Reihe natürlicher Grundsätze zur Theorie der Musik zu bitten. Von der Art war Webers erste Erziehung; freilich war sie nicht eben förderlich; sie würde bei jeder andern, minder sichern Natur fehlgeschlagen sein. Das Schwanken, die Unentschiedenheit, worin er durch den Widerstreit der Lehren, die man ihm beibrachte, lange Zeit gehalten wurde, hätte ihn allerdings irre führen können, aber die seltene Organisation seiner geistigen Natur bewahrten ihn vor dieser Gefahr. Wohl aber ist Grund vorhanden, zu glauben, daß die hastige Geschäftigkeit, der er sich überließ, den Keim zu körperlichen Uebeln legte, die seinen, Leben ein so frühes Ziel setzten.
Auf dem Clavier hatte Weber zum ersten Lehrer Hauschkel von Hildburghausen, einen vortrefflichen Mann, der zwar keine glänzende Ausführung besaß, den aber ein gesunder Geschmack von dem kleinlichen Charlatanismus freihielt, welchem oft große Meister sich nicht entziehen können. Er legte in seinen Zögling den Grund zu einem charakteristischen und kraftvollen Vortrage. Vor Allem bemühete er sich, ihm für beide Hände eine gleiche Fertigkeit zu geben, und Weber gestand in späterer Zeit gern ein, daß er diesem einfachen und verständigen Musiker alle Geschicklichkeit verdanke, die er auf dem Clavier besaß. Die stufenweise Ausbildung seines Talentes ließ bald in ihm den Wunsch rege werden, sich mit den Regeln der Composition bekannt zu machen; und er ging seinen Vater an, ihm einen Lehrer zu geben, der im Stande wäre, ihn in diesen höheren Theil der Kunst einzuweihen. Der gelehrte Musikkenner, Michael Haydn, ein Bruder des berühmten Verfassers der vier Jahreszeiten, schien der Mann zu sein, dessen man für diesen Endzweck bedürfte; und so ward der junge Kunstbeflissene nach Salzburg gebracht, um unter ihm zu studieren. Voll Eifer für die erwählte Kunst, und von tiefer Achtung gegen seinen Lehrer erfüllt, machte Weber alle möglichen Anstrengungen, um aus dem Unterrichte, dessen Werth er vollkommen zu würdigen wußte, den größten Nutzen zu ziehen. Aber der kenntnißreiche Michael Haydn war doch nicht der Mann dazu, um die Wissenschaft angenehm zu machen; schon bejahrt und von strengem, barschem Aeußern, ermangelte er jener Eigenschaften, welche dem Zöglinge Zuneigung und Vertrauen einflößen; und trotz dem ausgedehnten Wissen seines Meisters, zog Weber nur geringen Gewinn aus diesem Unterrichte. Um die nämliche Zeit ließ sein Vater, um ihn in seinen Studien zu ermuthigen, seine ersten Versuche, sechs kleine Fugen, durch den Druck veröffentlichen. Es geschah dies im Jahr 1798, und die musikalische Zeitung stattete einen günstigen Bericht darüber ab. Diese kleinen Fugen, in denen man freilich all die Trockenheit starrer Schulregeln bemerkt, zeichnen sich nichtsdestoweniger durch eine Reinheit aus, die zu den günstigsten Hoffnungen berechtigte.
Aber trotz der Freude, welche dieser erste Erfolg ihm bereitete, würde Weber vielleicht der Musik überdrüssig geworden sein, — so abstoßend wirkte auf ihn die übermäßige Strenge des alten Kapellmeisters von Salzburg, — wenn sein Vater, um dieser Gefahr vorzubeugen, ihn nicht, gegen Ende des Jahres 1798 nach München geschickt hätte. Sobald er daselbst angekommen war, nahm er Gesangunterricht bei einem Italiener, Namens Valesi, und übergab sich, für das Studium der Composition, der Leitung Kalchers, eines Mannes von gründlichen Kenntnissen, der es nicht verschmähete, die Wissenschaft dem jugendlichen Verstande zugänglich zu machen, und der, so viel an ihm lag, das Wohlwollen und Zutrauen unterhielt, welche zwischen dem gereiften Manne und dem Knaben, zwischen Lehrer und Schüler so nothwendig sind. Der einsichtsvollen und sorgfältigen[WS 1] Unterweisung dieses Lehrers verdankt Weber, wie er selber sagt, die gründliche Kenntniß des Tonsatzes und die Kunst, die allgemeinen Vorschriften zur Anwendung zu bringen. Es ist bekannt, wie zu einer Zeit, wo man in Frankreich der leichten Literatur, der leichten Malerei und der leichten Musik huldigte, das heißt zu einer Zeit wo die Geringschätzung alles Wissens als das Merkmal eines unabhängigen Geistes galt, wie damals junge Componisten sich als Gegner aller Wissenschaft aufthaten, und die Namen Weber und Beethoven auf ihre Paniere schrieben; Herr Berlioz, dem es an einer guten musikalischen Bildung gebricht, wovon man sich durch eine bloße Ansicht seiner Werke überzeugen kann, giebt sich die Miene, alle diejenigen, welche die Musik ernstlich studieren, mit Mitleiden anzusehen; er scheint sogar die Ueberzeugungzu hegen, daß talentbegabte Männer nichts von außen her bedürfen. Wenn uns unser Gedächtniß nicht trügt, so hat Herr Berlioz, der sich an die Spitze der leichten Tonkünstler gestellt hat, obschon er so schwere Partituren schreibt, daß man sie meistentheils gar nicht begreift, sich ebenfalls, wie Weber und Beethoven, für unabhängig erklärt, indem er ohne Zweifel der Meinung war, daß diese beiden Meister, als Neuerer der Tonkunst, gleich ihm aller Regeln und derjenigen welche sie befolgen, gespottet haben. Was Webern betrifft, so war er hierin so wenig der Ansicht des Herrn Berlioz, daß er vielmehr ausdrücklich sagt, die Gesetze des Tonsatzes müssen dem Musiker so vertraut sein, wie dem Schriftsteller die Regeln der Grammatik, aus dem einfachen Grunde, weil es gar kein anderes Mittel gebe, um dem Zuhörer seine Gedanken auf klare und verständliche Weise vorzutragen. Demnach darf man sich also nicht wundern, wenn Herrn Berlioz’s Gedanken sich auf eine so wenig einleuchtende Weise darstellen.
Weber benutzte mit seltener Beharrlichleit den Unterricht Kalchers; schon fing der Sinn für dramatische Musik an, sich in ihm zu entwickeln. Unter den Augen seines Meisters componirte er eine Oper: Die Macht der Liebe und des Weines, eine Messe, verschiedene Sonaten und Variationen für das Clavier, ferner Trios für die Violine; auch setzte er um dieselbe Zeit, Lieder in Musik, welche er jedoch den Flammen überlieferte. Damals wandte er sich auch der Zeichenkunst wieder zu, welche er seit langer Zeit hatte liegen lassen. Die ersten Versuche der Steinschneidekunst waren eben bekannt geworden. Angelockt durch diese sinnreiche Erfindung, fühlte er in sich eine Neigung für diese Kunst erwachen, die er sehr geliebt hatte. Auch begreift man leicht, daß die ungeduldige Thätigkeit eines jungen Kopfes begierig nach allem Neuen greift. Weber kam auf den Gedanken, der Nebenbuhler des Entdeckers der Lithographie zu werden; er verschaffte sich die nothwendigen Werkzeuge, und setzte sich eifrig an die Arbeit. Seine großen Anlagen für die Zeichenkunst, welche ihn lange Zeit zwischen der Malerei und der Musik hatten schwanken lassen, erwachten wie mit einem Schlage, und er machte reißende Fortschritte in der neuen Beschäftigung. Und wirklich kam er zu glücklichem Erfolg, er fand ein leichteres Verfahren, es gelang ihm eine bessere Druckmaschine zu verfertigen, und so weit trieb ihn der Enthusiasmus, daß er sich eine Zeitlang für den Erfinder des ganzen Systems hielt. Er überließ sich dieser Täuschung, und ganz erfüllt von dem Gedanken, seine Erfindung zu vervollkommnen, brachte er es bei seinem Vater dahin, nach Freiberg gehen zu dürfen, wo er die zur Lithographie tauglichen Steine leichter bekommen konnte. Aber diese Anfangs so lebhafte Leidenschaft war von kurzer Dauer; trotz des Gelingens seiner Versuche, verlor er die Lust an seiner neuen Beschäftigung. Das Mechanische dieser Arbeit, die Furcht seiner inneren Bildung dadurch Eintrag zu thun, bewogen ihn, dieselbe auszugeben. Es ist schwer zu sagen, ob die Kunst im Allgemeinen dabei betheiligt war, daß er die musikalischen Studien wieder ausnahm; denn wenn wir den Freischütz und den Oberon entbehren müßten, so hätten wir ohne Zweifel einige schöne Gemälde dafür zum Ersatz bekommen. Indessen, da es feststeht, daß man das Gewisse immer dem Ungewissen vorziehen muß, so haben wir Ursache, uns über Webers Entschluß Glück zu wünschen.
Sobald Weber sich entschieden hatte, die Steingrabekunst ihrem Schicksal zu überlassen, widmete er sich wieder der Musik, mit jenem Gefühl der Schaam und Ergebung gegen eine Herrin, zu der man zurückkehrt, um die Schuld der Untreue abzubüßen. Er verdoppelte seinen Eifer und seine Ausdauer. Sein erstes Unternehmen war, eine von dem Herrn von Steinsberg geschriebene Oper, das Waldmädchen, in Musik zu setzen. Dies Stück wurde im November des Jahres 1800 zum erstenmale gegeben. Weber war damals vierzehn Jahre alt. Der Erfolg des Stückes übertraf bei Weitem die Erwartungen des jungen Componisten, denn es wurde vierzehn Mal in Wien aufgeführt, ins Böhmische übertragen, und zuletzt auch auf dem Kaiserlichen Hof-Theater zu St. Petersburg gespielt. Zwischen dem Waldmädchen und Webers dritter Oper, Peter Schmoll und seine Nachbaren, welche im folgenden Jahre geschrieben wurde, liegt eine bemerkenswerthe Veränderung des Styles.
Eine in der musikalischen Zeitung befindliche Kritik, worin man die Compositionen der großen Meister im Einzelnen analysirte, hatte Webern bewogen, einen andern Weg einzuschlagen. Diese Thatsache ist ein neuer Beweis, für die Unbeständigkeit seines Charakters und für den Eifer, womit er alles Neue ergriff. In Salzburg, wohin ihn Familienverhältnisse gerufen hatten, componirte Weber den Peter Schmoll, welcher zuerst in Augsburg, im Jahre 1801, zur Aufführung kam. Doch machte diese Oper kein großes Glück, obschon der alte Michael Haydn, der endlich die seltenen Anlagen eines, noch vor wenig Jahren von ihm so streng getadelten Schülers anerkannte, dem Werthe der neuen Composition öffentlich Gerechtigkeit hatte widerfahren lassen; der Brief nämlich, welchen er an den jungen Künstler gerichtet hatte, ward in die Zeitblätter eingerückt, — ein sonderbares, aber echt deutsches Verfahren, wofür Weber um so größere Dankbarkeit zollte, als er sich von seinem ehemaligen Lehrmeister nichts der Art versehen hatte.
Abermals ward Weber von Unentschlossenheit befallen, auf einer Reise, die er 1802 mit seinem Vater unternahm. In Leipzig machte er die Bekanntschaft eines Arztes, der sich ein Geschäft daraus machte, an Allem zu zweifeln, und der mit seinen unseligen Ideen leider nur einen zu tiefen Einfluß auf den jungen Künstler ausübte. Weber verlor alles Zutrauen in seine Studien und Arbeiten, der Muth verging ihm, sowohl wenn er die Mittel als wenn er das Ziel bedachte. In dieser Stimmung wollte er eine Laufbahn nicht länger verfolgen, die ihm doch von der Natur vorgezeichnet zu sein schien, bevor er nicht all sein Wissen einer sorgfältigen Prüfung unterworfen, und die letzten Gründe und Ursachen sich klar gemacht hätte. Diese verderbliche Richtung hätte seine Ausbildung stören, seine geistige Kraft vernichten können, wenn sein Vater ihn nicht von dem gefährlichen Freunde entfernt und nach Wien geführt hätte. An dem neuen Aufenthaltsorte gewann Weber die zu seinen Arbeiten erforderliche Ruhe wieder. Ueberdies bot ihm Wien, welches er zum erstenmale sah, zu viel Zerstreuung, um noch länger an den Leipziger Arzt zu denken. Seine Unerfahrenheit ließ ihn Wien für die Hauptstadt Europa’s ansehen; nur wenn man nach Wien komme, rief er aus, könne man sagen, daß man in die Welt eingetreten sei. Etwas Wahres lag dem Enthusiasmus des Jünglings zum Grunde. Freilich war Wien nichts als die Hauptstadt von Oesterreich, die Mitte eines großen, aber damals überwundenen Landes; allein Wien war die Stadt der Musik. In Italien gab es keine Musik mehr, in Frankreich war sie noch nicht erwacht; das Reich der Musik war Deutschland, und nirgends in diesen ausgedehnten Landen stand sie in solcher Blüthe wie in Wien. Die große Zahl ausgezeichneter Männer, die dort versammelt waren, unter ihnen der weltberühmte Haydn, der Erzvater der deutschen Tonkunst, und der Abt Vogler, ein Mann von seltener Einsicht und ausgebildetem Wissen, boten ihm die kostbare Gelegenheit dar, sich jene edlere Bildung zu erwerben, welche man aus dem Umgange erleuchteter Männer schöpft. Weber versäumte nicht, sie aufzusuchen. Er schloß sich vorzugsweise dem Abt Vogler an, einem der gelehrtesten Musiker Deutschlands, und wurde zugleich mit Meyerbeer sein Schüler; mit Letzterm trat er in ein enges Freundschaftsverhältniß. Die Unterweisung eines erfahrenen Lehrers befreite Webern völlig von allen Vorurtheilen, die in sein unruhiges und unveränderliches Gemüth Eingang gefunden hatten. Zwei Jahre lang verlegte er sich ausschließlich auf das Studium des Tonsatzes; er las die Werke der großen Meister und bestrebte sich, durch eine besonnene Analyse ihrer Compositionen, ihre Methode sich anzueignen. Während dieser zwei Jahre gab er nichts heraus, mit Ausnahme zweier Werke ohne Bedeutung, die nur für’s Clavier geschrieben waren.
Die Stelle eines Musikdirektors war in Breslau erledigt worden; sie wurde Webern angeboten, der, in Betracht daß seine Studien bei dem gelehrten Abt vollendet waren, kein Bedenken trug, sie anzunehmen. Ein neues Leben ging für ihn auf; zwar ein mühevolles, aber er verdankte den Geschäften seines Amtes doch den Erwerb vielfacher Kenntnisse, die ihm später von großem Nutzen waren. Im Verlauf kurzer Zeit hatte er ein Orchester und Chöre ganz neu einzurichten, Stücke für Instrumentalmusik zu schreiben, und bei den häufigen Proben, die ihm untergebenen Musiker zu leiten. Diese praktische Bildungsschule, welche einer großen Zahl von Tonsetzern mangelt, verlieh ihm eine tiefe Einsicht in die Wirkung des Orchesters, in deren Anwendung er in seinen letzten Arbeiten so weit gegangen ist. Die vielfachen Geschäfte erlaubten ihm nicht, auf neue Schöpfungen, durch die er seinen Ruhm hätte vermehren mögen, allen Fleiß zu verwenden; er hielt es für wichtiger, seine Stellung zu benutzen, um in der kürzesten Zeit eine Masse von Kenntnissen zu sammeln, die eben so nothwendig als, unter andern Umständen, schwer zu erlangen sind. Indeß brachte er zu dieser Zeit den größten Theil einer Oper, Rübezahl, zu Stande, die er später unter einem fremden Namen aufführen ließ. Weber behielt seinen Platz als Musikdirektor zu Breslau nicht lange. Der Krieg in Preußen, welcher die Existenz vieler Künstler gefährdete, nöthigte ihn im Jahr 1806 sich zurückzuziehen, und die Einladung des Herzogs Eugen von Würtemberg anzunehmm, als Direktor der Hauskapelle sich an seinen Hof in Schlesien zu begeben. In dieser neuen Stellung konnte Weber mit größerer Freiheit über seine Zeit verfügen, und er fand Muße, um zwei Symphonien, mehrere Cantaten und verschiedene Stücke für Instrumentalmusik zu componiren. Aber die politischen Ereignisse ließen ihn nicht im friedlichen Genusse dieser günstigen Lage. Abermals drang der Krieg in seine Nähe; das schöne Theater, die prächtige Kapelle des Fürsten wurden geschlossen, und Weber sah sich genöthigt, seine Entlassung zu nehmen. Man kann sich die Verlegenheit vorstellen, in der er sich befand, da er nicht wußte, wohin er sich wenden sollte, um Arbeit für sein Talent zu finden. Einen Augenblick hegte er den Gedanken, Deutschland zu durchwandern, und in jeder einigermaßen bedeutenden Stadt Concerte zu geben; aber der unglückliche Zustand des Vaterlandes konnte ihn wenig zu diesem Vorhaben ermuthigen. Es blieb ihm keine andere Wahl übrig, als einstweilen Musiklehrer zu werden. Er entschloß sich dazu, und nahm seinen Wohnsitz in Stuttgart bei dem Herzoge Ludwig von Würtemberg. Freilich war die Stellung als Musikmeister in einer Stadt zweiten Ranges dem Geiste eines Weber nicht angemessen, ebensowenig entsprach sie dem Ruhme, den er bereits erlangt hatte; aber er befand sich in einer jener Lebenslagen, wo uns keine Wahl übrig bleibt. Während seines Aufenthaltes zu Stuttgart beschäftigte sich Weber vorzugsweise mit Instrumentalcomposition; er überarbeitete nochmals seine Oper: Das Waldmädchen, und richtete sie für einen andern Text, unter dem Titel: Silvane, ein. Auch setzte er die Partitur eines Stückes, welches unter dem Namen: Der erste Ton bekannt ist.
Um’s Jahr 1810, als die Zeitumstände eine günstige Wendung genommen hatten, beschloß Weber die musikalische Reise zu unternehmen, zu der er vor seiner Uebersiedelung nach Stuttgart den Plan gefaßt hatte. Er durchzog nacheinander die verschiedenen Theile von Deutschland, ließ seine Instrumentalstücke hören, gab Proben von seinen Opern und spielte mit bewundernswürdigem Talent seine herrlichen Sätze für’s Klavier. Erst seit dieser Zeit wurde er bekannt und nach Gebühr gewürdigt. Bis dahin war Weber nichts weiter, als ein ausgezeichneter Schüler des Abts Vogler und der namenlose Kapellmeister eines Würtembergischen Fürsten gewesen; von jetzt an ward er den ersten Künstlern Deutschlands beigezählt. Die bereitwillige Aufnahme, welche seine Produktionen fanden, die achtungsvolle Aufmerksamkeit, mit der man ihn hörte, waren der verdiente Lohn seiner Bemühungen. Trotz der Schwierigkeiten, welche die politischen Begebenheiten ihm in den Weg legten, trotz der Hindernisse, welche ihm einige neidische Seelen bereiteten, belebte dieser glückliche Erfolg alle seine Geisteskräfte, und flößte ihm Lust und Begeisterung für seine Kunst ein. Während der Zeit, in welche seine erste Reise fällt, wurden Weber’s Opern und Concerte in Frankfurt, München, Wien und Berlin gegeben. In Wien verweilte er länger als in den andern Städten, um einige Zeit dem Umgange mit dem Abt Vogler widmen zu können; denn von allen seinen Lehrern hatte er für diesen die größte Anhänglichkeit bewahrt. Meyerbeer und Gansbacher, seine ehemaligen Mitschüler, empfingen damals noch den Unterricht des trefflichen Meisters; Weber konnte dem Wunsche nicht widerstehen, die Freundschaft zu erneuern, welche ihn mit denselben verband. Da ihr Verhältniß auf innere Uebereinstimmung, auf gleiches Bestreben für die Kunst gegründet war, erlitt es niemals die mindeste Störung. Nur Eins konnte Weber in der Folge Meyerbeeren schwer verzeihen, nämlich, wie er es nannte, seinen Verrath an der deutschen Musik. Von der Ueberzeugung geleitet, daß der italienische Styl für die Opernmusik am besten passe, hatte Meyerbeer die strengen Vorschriften des gelehrten Abts Vogler verlassen, und war den glänzenden Fußtapfen Rossini’s nachgegangen, dessen Ruhm eben damals im Aufblühen war. Dieser Abfall verursachte Webern wahrhaften Kummer, den er auch seinem Mitschüler gar nicht verbarg; vielmehr that er alles Mögliche, um ihn auf die Bahn zurückzuführen, die ihm die einzig richtige zu sein schien. So oft ihm eine neue italienische Partitur Meyerbeer’s in die Hände fiel, suchte er Spuren der Rückkehr zu besseren Grundsätzen darin auf, und wenn er keine fand, versammelte er seine Freunde bei sich, um, wie er sagte, über die Verirrungen des Ueberläufers zu klagen. Jedoch muß man ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er alle Sorgfalt anwandte, um Meyerbeer’s Partituren in den Städten, wo er die Leitung des Orchesters hatte, auf’s Beste auszuführen. Obgleich er innerlich den Meyerbeer’schen Styl verdammte, ließ er sich doch keine Mühe gereuen, der Ausführung seiner Stücke die größte Vollkommenheit zu geben. Wenn man eine so edle Handlungsweise bedenkt, kann man Webern keinen Vorwurf daraus machen, daß er eine, wenn auch ungegründete, Abneigung gegen eine Schule empfand, welche so viele berühmte Künstler, so viele herrliche Werke hervorgebracht hat. Meyerbeer selbst ließ es sich nicht einfallen, ihn deßhalb anzuklagen, denn er war überzeugt, daß die übertriebene Strenge seines Richters einzig und allein in dem Kunstsinn, in dem unveräußerlichen Gefühl eines wahren Tondichters ihren Grund habe.
Von Wien begab sich Weber nach Darmstadt, wo er seine Oper: Abdul Assan schrieb. Dieses Werk enthält vortreffliche Stücke; man wird darin einen bedeutenden Fortschritt für die Theatermusik gewahr; man nahm es mit Beifall auf, ohne jedoch den Werth desselben recht zu schätzen. Weber ward dadurch etwas entmuthigt, und während einiger Zeit erschienen keine neuen Compositionen von ihm. Im Jahr 1813 wurde er nach Prag berufen, um die Oper zu dirigiren; er verweilte daselbst drei Jahre, fast ausschließlich mit der Leitung des dortigen Theaters beschäftigt. Denn mancherlei Arbeiten, die sein neues Amt erforderte, verhinderten ihn an solchen Unternehmungen, durch die sein Name als Componist hätte gewinnen können. Er stand seinen Amtspflichten mit jener bewundernswürdigen Gewissenhaftigkeit vor, welche die Deutschen in allen Dingen bewähren. Er gab der ihm anvertrauten Anstalt eine völlig neue Grundlage, führte in allen Geschäftszweigen eine Ordnung ein, die vor ihm dort unbekannt war; und nachdem er Alles so in Stand gesetzt hatte, daß auch ein Anderer der Erhaltung und ferneren Leitung Genüge thun mochte, besann er sich nicht, seine Entlassung einzureichen, um sich gänzlich der Ausübung einer Kunst zu widmen, für die er das Gefühl eines hohen Berufes in sich trug. Seine merkwürdigste Composition, welche in die Zeit seines Prager Aufenthalts fällt, war eine Cantate, welche den Titel: Kampf und Sieg trägt. Seit 1816, um welche Zeit er Prag verließ, bis zum Jahre 1821, wo er seinen bleibenden Wohnsitz in Dresden aufschlug, hatte Weber keine stehende Beschäftigung; er machte Reisen und ließ sich in Concerten hören; aber vor allem arbeitete er in der Stille an jenen großartigen Kunstschöpfungen, welche seinen Ruhm auf die Dauer begründeten. —
Die zweite Periode von C. M. Weber’s Leben, die wir vor uns haben, zeichnet sich durch einen mindern Grad von Arbeitsamkeit und weniger reichhaltigem Stoff von Begebenheiten aus. Wir erblicken den Künstler nicht mehr wie vorhin, der Musik mit einem Male Lebewohl sagend und sich der Malerei in die Arme werfend, um von dieser in der Zukunft Ruhm und zeitliche Glücksgüter zu erhalten, und bald nachher mit ähnlicher Leichtigkeit zu seinen Partituren zurückzukehren; er ist von nun an mit seiner Bestimmung im Reinen, und schreitet muthig dem Ziele entgegen. Was indessen dem letzten Theil seiner Lebensbeschreibung an Interesse in Hinsicht auf Abenteuerlichkeit abgeht, wird reichlich durch das vergütet, was auf sein musikalisches Genie Bezug hat, denn wir sehen ihn von nun an seine größten Meisterwerke schaffen und zu Tage fördern. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß der Freischütz das Resultat einer ganzen Folgereihe von Bemerkungen ist, und daß Weber sich lange vorher mit dem Gedanken an ein ganz neues Instrumentirungssystem herumgetragen haben muß, sowie er ihn in jener Arbeit kund that. Was ihm früher zu fehlen schien, war lediglich eine feste Stellung und ein sorgenfreier Geist, um sich mit Herz und Seele auf die Erfüllung seiner Lieblingsprojekte legen zu können.
Das ihm gemachte Anerbieten zur Gründung einer deutschen Oper in Dresden lächelte ihn genug an, um von ihm angenommen zu werden, zumal da man ihm zugleich Hoffnung machte, die Stelle eines Hofkapellmeisters mit der eines Theaterdirektors zu vereinigen. Er begab sich zu Anfange des Jahres 1821 dahin, um sein Amt anzutreten, und machte sich mit vollem Eifer an die ihm obliegende Arbeit, sah aber bald genug ein, daß er sich keine geringe Last aufgeladen hatte. Ihm blieb noch Alles zu thun und anzuschaffen. Schauspieler, Choristen und Musikanten fürs Orchester mußten engagirt, und sogar die Anordnungen zum Aufführen der Stücke und für ein ganz seiner Wahl überlassenes Repertorium noch gemacht werden. Weber handelte hier, wie er damals zu Prag gethan, als er dem dortigen Theater seinen längst eingebüßten Wohlstand wieder gab; mit unglaublichem, ihm ganz eigenen Diensteifer wußte er die Menge Einzelheiten, deren es noth that, herbeizuschaffen, und bald war die Oper in Dresden im Stande, Dinge zu leisten, wie man sie nur unter der verständigsten Leitung zu erwarten vermochte. Sobald seine Pflichten, deren Gebiet sein deutscher Biedersinn bedeutend ausgedehnt hatte, es ihm gestatten wollten, ließ er das Theaterwesen seinen von ihm gebahnten Weg fortschreiten, um sich selbst ganz dem Dämon der Musik, dem er sich auf immer und unwiderruflich verschrieben hatte, hinzugeben.
So geschah es denn auch in Dresden, zu einer Zeit, als Weber mit der ganzen Sorgenlast für die Leitung des dortigen Theaters beladen war, daß er die großartige Composition: der Freischütz, welche, nachdem sie ihm während seines Lebens nicht weniger heftige Widersacher als enthusiastische Freunde zugezogen hatte, bis auf den heutigen Tag den solidesten Grund zu[WS 2] seinem unsterblichen Ruhm gelegt, unternommen und vollständig durchgeführt hat. Er war so glücklich, in dem Texte dieser Oper einen Gegenstand zu finden, dessen mystischer Anstrich seinen eigenen Ideen ganz besonders zusagte, und seinen genialen Begriffen ein weites Feld eröffnete, wie er’s sich nur wünschen konnte. Es gibt wenig Opern, deren Musik sich den Worten so genau anschließt; man sollte meinen, sie wären beide für einander geschaffen und so mit einander verwebt, daß man sie in dem Gedanken nicht von einander zu trennen vermag. Die Elemente der Tonkunst sind an und für sich überaus in’s Wilde schweifend; man kann im Allgemeinen nicht leicht behaupten, diese oder jene Musik ist diesem oder jenem Texte eigen und könnte mit keinem andern verwechselt werden. Der Beweis hierzu ist, daß bisweilen zwei Componisten für den nämlichen Text die Noten gesetzt, und jeder für sich eine vortreffliche Arbeit geliefert haben. Die Musik des Freischützen hingegen ist so innig mit dem Gegenstand des Stückes verwoben, daß man sich keinen Begriff davon machen kann, man könnte ihr einen anderen unterschieben; sie enthält eine unzählige Menge von Instrumental-Combinationen, deren jede als ein gefundener Schatz gelten kann, und da man Deutscher sein muß, um für Schönheiten dieser Gattung den rechten Sinn zu haben, so folgt daraus, daß diese Musik nirgends, als jenseits des Rheines nach Würde geschätzt werden kann.
Nachdem Weber seine Partitur zu Ende gebracht hatte, sah er wohl die Nothwendigkeit ein, daß er, um sie gehörig auszuführen, zu größeren Künstlern, als die an seinem kleinen Dresdener Theater, seine Zuflucht nehmen müsse. Er begab sich mit seiner Arbeit nach Berlin, und in dieser Stadt war es, daß sie im Jahr 1822 für’s Erstemal gegeben wurde. Der Beifall war vom ersten Augenblick an entschieden, und der Name Weber, schon früher wegen mancher guten Compositionen vortheilhaft bekannt, ward von nun an einer der populärsten in ganz Deutschland. Ueberall spielte man den Freischütz und überall machte er den tiefsten Eindruck. Das Ausland ward bald von dem lebhaften Applaus erschüttert, welcher der Arbeit des Dresdener Tonkünstlers gezollt wurde, und mit der größten Eilfertigkeit sah man Uebersetzungen des Freischützen an’s Licht treten. Dies war die erste Nachricht, die man in Europa von der Existenz einer deutschen National-Oper bekam; denn Mozart galt beinahe für einen Italiener. Als man gesehen hatte, wie Deutschland sich dem Reiz der italienischen Melodieen und der französischen komischen Oper hingab, um den Partituren von jenseits der Alpen und des Rheines einen augenblicklichen Vorzug vor den einheimischen Musikprodukten einzuräumen, da war man voreilig genug, hieraus zu folgern, daß die Dramaturgie überhaupt ein Gegenstand sei, der in Deutschland nur äußerst selten bedeutende Resultate hervorgebracht habe und es nie zu einem populären Erfolg bringen dürfte. Die Ursachen für eine außerordentliche Fruchtbarkeit bestehen freilich dort nicht in eben dem Maaße, wie in Frankreich oder gar in Italien. Die Deutschen, welche alles ihrem analytischen Geiste unterwerfen wollen, und, um zu genießen, des Raisonnements bedürfen, fordern vom Texte einer Oper, daß er irgend ein Interesse darbiete; da nun die Verfasser der Operntexte auf den Erlös der Vorstellung keinen Anspruch zu machen haben, so findet man natürlich wenig Leute dazu geneigt, um ganz unnützerweise ein Talent zu vergeuden, das ihnen anderwärts so vorteilhaft wuchert. Hat andererseits ein Musiker sich dazu verstanden, seine Arbeit an einen Text zu wagen, welcher das Probestück eines Neulings ist, oder Jemandes, der nichts dabei zu verlieren hat, so bringt er fast immer einen, von der Menge unschätzbaren Kunstsystem ein Opfer. Ueberdieß darf man es fast allen deutschen Componisten zum Vorwurf machen, daß sie ganz ohne Rücksicht auf die besondern Stimmen ihre Musik niederschreiben,und dadurch die Aussicht auf einen guten Erfolg bedeutend einschränken. Erwägt man demnach alle Hindernisse, welche der deutschen Oper auf ihrem vaterländischen Boden im Wege stehen, so muß man über die Menge der Partituren erstaunen, welche jene Hindernisse besiegt haben. Es gibt deren in der That viele, die sehr geschätzt sind, und solche, die sich auf den Repertorien aller deutschen Schaubühnen in Concurrenz mit den Erzeugnissen der verschiedenen italienischen Schulen, und zumal mit der französischen komischen Oper zu behaupten gewußt. Die Deutschen vernachlässigen sie keineswegs, nur äußern sie für fremde Opern jenes eifrige Streben, das von den Umständen herrührt, die sich in allen Ländern zu Gunsten von Erzeugnissen eines ausländischen Bodens kundthun, indem man zu befürchten scheint, man möchte sie nicht immer in seinem Bereiche haben. — Der Freischütz erregte den deutschen Kunstsinn von neuem für ihre lyrische Nationalbühne, und bedeutete ganz Europa, wie wir bereits gesagt, daß die dramatische Tonkunst in Mozart’s Vaterland nicht ausgestorben sei.
Herr Castil-Blase, der noch neulich mehre Rossinische Opern übersetzt hatte, und es gar nicht zu verschmähen schien, sich beträchtliche Autorrechte auszahlen zu lassen für Werke, die er nicht verfaßt hatte, faßte den Entschluß, die deutsche Muse zu bearbeiten, nachdem er von der italienischen allen Nutzen gezogen, welchen er von letzterer erwarten zu dürfen glaubte. Er machte sich an eine Uebersetzung des Freischützen, und ließ ihn, Robin des bois getauft, im Jahre 1824 auf dem Odeontheater aufführen. Das französische Publikum sträubte sich anfangs etwas Weniges gegen die Neuerungen im Ausflüge des Weber’schen Genius, allein die unzähligen Schönheiten in der Partitur errangen endlich den Sieg, und zwar so, daß 150 fast ununterbrochene, auf einander folgende Vorstellungen die Zuhörerschaft des Odeon nicht zu ermüden vermochten. Man muß aber auch zugeben, daß Castil-Blase kein Mittel unversucht gelassen, ein solches Resultat zu erzielen. Als Redakteur einer sehr geistreichen und überaus geschätzten Musik-Chronik, für die das Journal des Débats volle 18 Jahre hindurch bereits seine Spalten offen gestellt hatte, wußte er mit vieler Gewandtheit seine Popularität als Kritiker zu benutzen, um seinen Uebersetzungen gut durchzuhelfen. Nachdem er Rossini und dessen Arbeiten bis zum Ermüden in den Himmel gehoben hatte, so lange er nämlich das Repertorium dieses berühmten Meisters benutzen konnte, warf er sich mit einem Male als dessen Gegner auf, um, sobald der Plan zur Uebersetzung des Freischützen in ihm reif war, Webern und den deutschen Styl an deren Stelle emporzuheben. In der Nähe beschaut, war die Spekulation gar nicht übel, und lohnte reichlich der Mühe, daß man mit sich selbst und Andern wegen ihrer Benutzung in Widerspruch gerieth.
Die Partitur des Barbier von Sevilla, welche der Theaterprinzipal zu Rom Rossini um 1800 Franken abgetauft hatte, brachte Hrn. Castil-Blase vermittelst den Vorstellungen auf den Bühnen in Paris und in den Provinzen über 50,000 Franken ein, mit Einbegriff nämlich des Debits der Musik vom Barbier; so hat denn auch der einzige Jägerchor in Robin des bois der mit den Worten: „Chasseur diligent“ anhebt, dem Uebersetzer mehr eingetragen, als unserm Weber seine ganze Partitur.
Weber’s erste Arbeit nach dem Freischützen war Preciosa, für welches Schauspiel er die Ouvertüre, eine Melodram-Scene und Chöre schrieb. Er war Willens, sich sofort an eine andere imposante Arbeit zu machen, allein durch den Tod Schubert’s, eines ausgezeichneten Musikers, der die Sorgen der Geschäftsführung am Dresdener Theater mit ihm getheilt hatte, wurden seine Beschäftigungen abermals vermehrt, und dies hinderte ihn an der Ausführung seines Vorsatzes. Schon schmeichelte er sich damit, daß er eine erwünschte Gelegenheit gefunden habe, Gansbacher, einem seiner früheren Mitschüler, zu der durch Schubert’s Ableben erledigten Stelle eines Musikdirektors verhelfen zu können, und er entschloß sich, bei dem König von Sachsen für ihn darum anzuhalten, da vernahm er zu seinem Leidwesen, daß Gansbacher den wichtigen Posten als Kapellmeister in der Hauptkirche zu Wien angenommen habe, wodurch Weber’s Hoffnung abermals getäuscht wurde. Erst ein Jahr später, als ihm etwas mehr Muße vergönnt war, verfertigte er seine Partitur zur Euryanthe. Seine über die Maaßen enthusiastischen Freunde thaten dadurch dem Gelingen dieser Oper Eintrag, indem sie ihr den Platz neben dem Freischützen einräumten, der jedoch weit geeigneter war, auf die Massen zu wirken und sie mit sich fortzureißen. Die drei ersten, von ihm selbst dirigirten Vorstellungen zu Wien wurden mit einem allgemeinen Enthusiasmus entgegen genommen; er wohnte der vierten Vorstellung in einer Loge bei, und so sehr er sich auch darin versteckt hatte, wurde er doch sobald erkannt und dreimal hervorgerufen; er sah sich genöthigt, aufzutreten und das Publikum zu grüßen. So ging es aber nicht an andern Orten zu; man fand da überall, daß die Wiener zu günstig über die Euryanthe geurtheilt hätten, und um dies wieder gut zu machen, affektirte man eine Kälte, die noch unbilliger war. Wien und Dresden blieben die einzigen Städte, wo die Euryanthe ohne Widerrede mit Beifall aufgenommen wurde.
Weber’s Pflicht erheischte es, nach Dresden zurückzukommen, um daselbst das Einstudiren der Olympia, die bei Gelegenheit der Heirathsfeierlichkeiten des sächsischen Kronprinzen gegeben werden sollte, zu betreiben. Seine Abneigung gegen italienische Musik und Künstler trat bei diesem Umstande wieder merklich hervor. Spontini’s Olympia war, trotz allen Schönheiten, welche sie auszeichnen, seinem Geschmacke noch nicht klassisch genug. Gerade zur nämlichen Zeit machte Meyerbeer’s Margarethe von Anjou bei ihrer Aufführung in Italien sehr großes Aufsehen, und Weber, dessen Widerwillen gegen italienische Musik ganz aufrichtig aus dem Herzen kam, schrieb damals wie folgt: „Meyerbeer hat sich ganz nach Italien hingewendet, er vertieft sich täglich mehr in den Schlamm jenes elenden Geschmacks. Was ist nun aus unsern schönen Jugendträumen geworden, und welche herrliche Blüthe ist da wiederum im Aufkeimen zerknickt worden! Seine neue Opern: Margaratha von Anjou und l’Esule di Gionata haben in Italien Succeß erhalten; er ist beschäftigt mit der dritten Oper für den Carneval zu Venedig, und soll später nach Berlin kommen. Wird er uns wohl besuchen? Ich glaub’s schwerlich; er scheut sich zu viel vor uns.“ — Wie dem auch sei, Weber ließ sich Alles daran gelegen sein, daß dieselbe Oper, Margaretha von Anjou, in der größten Vollkommenheit auf der Dresdener Bühne aufgeführt wurde, und man darf getrost behaupten, sie konnte bei den ihm zu Gebot gestandenen beschränkten Mitteln unmöglich besser gegeben werden. Meyerbeer kam zu Besuch bei seinem alten Schulfreund, um ihm dafür zu danken, und Weber, der von Ränkesucht in Musik nichts wußte, empfing ihn mit offenen Armen. In einem zu jener Zeit geschriebenen Briefe, drückt er sich, wie folgt, aus: „Verwichenen Freitag hatte ich, zu meiner großen Freude, Meyerbeer bei mir; das heiß ich mir einen Tag voller Wonne, eine Reminiscenz aus der herrlichen alten Zeit, wo wir miteinander unter des ehrwürdigen Abts Vogler trefflicher Leitung Fugen setzten. Wir schieden erst spät in der Nacht von einander. Meyerbeer geht nach Triest, um seine Oper: il Crotiato einstudiren zu lassen; ehe noch ein Jahr vergeht, wird er nach Berlin zurückkommen, wo er vielleicht eine deutsche Oper setzen wird. Gott gebe es; ich habe das Meinige gethan, es ihm aufs Gewissen zu legen.“
Abgesehen von seinen Vorurtheilen gegen die italienische Musik, war Weber ganz unpartheiisch und sogar wohlwollend in seinen Beurtheilungen fremder Musiksetzer unter seinen Zeitgenossen, die er gehörig zu schätzen wußte, indem er ihnen nicht nur Gerechtigkeit widerfahren ließ, sondern auch ihr Verdienst herausstrich. An diesem Wohlwollen, war nichts Erkünsteltes, denn er war eben so offenherzig und aufrichtig im Tadel. Er sprach nie anders, als mit dem größten Enthusiasmus von Beethoven, obgleich er nicht ohne Verdruß an die sonderbaren Abschweifungen dieses Meisters in seinen letzten Tagen dachte, welche Abschweifungen er dem widernatürlichen Zustand zuschrieb, in welchen ein unabänderliches Schicksal (Beethoven war bekanntlich taub) ihn versetzt hatte, wodurch sein Genie sich von all Demjenigen isolirt befand, das er bei seinen Berührungen mit der Welt hätte benutzen können, und welches seinen erhabenen Geist zu monstruösen Schöpfungen und Unbilden hintrieb. Als Weber sich zur Ausführung seiner Euryanthe nach Wien begab, stattete er bei Beethoven einen Besuch ab; diese Zusammenkunft nach so vieljähriger Abwesenheit, wirkte gewaltig auf Weber. Beethoven erkannte ihn sogleich nicht wieder, nachdem er ihn aber eine Weile lang aufmerksam betrachtet hatte, legte er ihm die Hände auf die Schultern, zog ihn zu sich hin, und nannte ihn bei seinem Namen.
Betrachtet man Weber während der noch übrigen Zeit seiner musikalischen Laufbahn, dann wird man in ihm leicht jenen wohlüberlegten Eifer, jene in sich verschlossene Wärme gewahr, die den Deutschen eigen ist, welche nicht in raschen Sprüngen vorwärts schreiten, und sich sogar bei der Ausführung der lebendigsten Gedanken nur durch einen anhaltenden, ausdauernden Fleiß kund thun. Wäre seine Zeit nicht so gar sehr in Anspruch genommen gewesen durch seine Berufsgeschäfte, welche ihm bei Weitem nicht so viele Muße für’s Componiren übrig ließen, als man glauben sollte, und er selbst es gewünscht hätte, so würde Weber sich selbst mit der Verfertigung von Texten zu Opern abgegeben haben; denn in allen seinen Discussionen über dramatische Poesie verräth er eine erstaunliche Gedankenfülle, und sein literarischer Nachlaß, so gering er auch an Umfang war, beweist hinlänglich, daß er Fähigkeiten genug besaß, um eine Oper mit dem schicklichen Text zu versehen. Man hörte ihn oft sich darüber beklagen, daß er diesen Vorsatz nicht in Ausführung bringen konnte.
Weber hatte fast gleichzeitig die Aufforderung erhalten, für London eine Oper zu schreiben und ebenso für Paris eine Opernpartitur zu setzen. Er entschied sich deshalb vorzugsweise für ersteres, weil er hoffte, dadurch in Stand gesetzt zu werden, den Grund zu einer dauerhaften Wohlhabenheit für seine Familie zu legen; denn seine 1800 Thaler Gehalt, die er zu Dresden bezog, reichten zwar hin, daß er behaglich leben konnte, es blieb aber nichts Gewisses davon für die Zukunft, und auf Vermehrung seiner diesseitigen Einkünfte hatte er keine Hoffnung. Er setzte sich demnach mit allem Eifer an seine Partitur von Oberon, die der Schauspiel-Director vom Covent-Garden ihm aufgetragen hatte. Zu gleicher Zeit lernte er die englische Sprache, nicht sowohl, als ob er deren für den gegenwärtigen Augenblick bedurft hätte, sondern des Nutzens halber, welchen diese Sprache ihm in der Folge für seine Arbeiten zu gewähren versprach. Sein Vorsatz war indessen, nicht mehr als Eine Oper für London zu setzen, und überhaupt nicht lange daselbst zu verweilen. Ueberlegt man nun, wie sehr sich dieser vortreffliche Mann angestrengt hat, mit welcher Ausdauer er arbeitete, und wie groß der innere Werth seiner Arbeit war, und erinnert man sich dabei an die Art, wie man ihn in London behandelt hat, und mit welcher Undankbarkeit er dort aufgenommen worden, so ist es einem unbegreiflich, wie die Engländer noch den Muth haben können, zu verlangen, daß ihre Generosität zum Sprichwort werde. Wiederholt war Weber genöthigt, in der Arbeit an seinem Oberon einzuhalten; er fühlte sich mit einer Heiserkeit behaftet, die ihm oft das Sprechen versagte, und von einem solchen Krampfhusten begleitet war, daß er eine Luftröhrenschwindsucht zu befürchten hatte. Seinem Versprechen gemäß sollte seine Partitur auf Ostern 1825 fertig sein, sie konnte es aber erst gegen November hin werden, und er verschob seine Abreise bis Anfangs 1826, um in London zu der Zeit anzukommen, die man die Saison nennt, und während welcher es allein möglich ist für einen Künstler, in dieser Stadt etwas zu leisten.
Weber reiste am 16. Januar 1826, in Begleitung eines seiner Freunde, der zu gleicher Zeit ein berühmter Flötenspieler und guter Tonsetzer war, von Dresden ab. Er hatte früher Paris noch nicht besucht, obschon er mit vielen seiner dortigen Landsleute in Verbindung stand. Die Beraubung seines Eigenthums, die er gewissermaßen durch Castil-Blase erlitten, hatte ihn gegen die Franzosen eingenommen; doch war dieß nicht das erstemal, daß er Gelegenheit fand, seine feindseligen Gesinnungen gegen diese Nation zu äußern. Aufgebracht über die Unterdrückung, welche sein Vaterland durch Napoleon’s Kriegsheere erdulden mußte, hatte er Volksgesänge verfertigt, welche dazu bestimmt waren, in Chören und ohne Musikbegleitung gesungen zu werden. Diese Lieder hatten gewissermaßen das Zeichen zum allgemeinen Aufstand der deutschen Jugend wider die französische Oberherrschaft gegeben, und die Wahrheit zu gestehen, war ihr Ausdruck so energisch, daß sie die bezweckte Wirkung hervorbringen mußten. Wie dem auch sei, er überwand seinen Widerwillen und nahm seinen Weg über Paris, wo er am 25. Februar anlangte. Er sah sich daselbst alsbald von einer Menge Bewunderer umgeben; Rossini, der bekanntlich in systematisch-musikalischer Hinsicht sein Gegner war, besaß Lebensart genug, um ihn aufzusuchen und mit der größten Herzlichkeit zu behandeln. Dies schien vorteilhaft auf ihn gewirkt und seine Vorurtheile etwas geschwächt zu haben; wenigstens schrieb er Folgendes an seine Frau: „Ich will’s nicht versuchen, Dir zu beschreiben, wie man mich hier behandelt; wollte ich Dir Alles melden, was mir die größten Künstler sagen, mein Papier selbst würde schamroth darüber werden müssen. Ich werde von Glück sagen müssen, wenn meine Eigenliebe diesen tüchtigen Stoß überstanden haben wird.“ — Obgleich Weber nun mit den seinem Talente gebührenden Huldigungen wie überschüttet wurde, und seine physischen Kräfte sich wieder herzustellen schienen, so wurde er doch von jener Melancholie verzehrt, die ihn so oft befiel, als er von den Seinen entfernt war, und er hatte es sich schon vorgenommen, in der Folge nie wieder eine so lange Reise außer in Begleitung seiner Familie zu unternehmen. Er reiste am 2. März von Paris ab, schiffte sich am 4. zu Calais ein und erreichte nach einer Ueberfahrt von wenigen Stunden die englische Küste zu Dover. Hier ward er auf’s ehrenvollste empfangen, man wollte ihm weder seinen Reisepaß abnehmen und bis zu seiner Rückkehr aufbewahren, noch bei der englischen Mauthbehörde sein Gepäck einer Inspektion unterwersen, welche Begünstigung nicht einmal Leuten aus den höchsten Ständen zu Theil wird. Einer jener eleganten öffentlichen Wägen, die nirgends ihres Gleichen haben, und die einander jeden Augenblick auf den englischen Heerstraßen durchkreuzen, brachte ihn von Dover nach London im Galopp mit vier trefflichen Rossen. Sir George Smart, der Director der Concerte, hatte ihn abgewartet, und führte ihn sogleich in seine eigene Behausung, wo Zimmer zu seiner Bewohnung in Bereitschaft waren. Schon vor seiner Ankunft waren viele Leute gekommen, sich zum Besuche bei ihm einschreiben zu lassen, unter andern waren die ersten Pianofabrikanten gekommen, und stritten unter einander um die Ehre, ihm ihre Instrumente während seines Aufenthalts anbieten zu dürfen.
Als Weber sich zum erstenmale in’s Coventgarden-Theater begeben hatte, erkannte man ihn in dem Augenblicke, als er sich über den Rand seiner Loge hinbog, um das Innere des Saales zu betrachten. Alsbald erhob sich von allen Seiten zugleich ein Beifallrufen, und er sah sich genöthigt, sich zu zeigen und wiederholentlich zu grüßen. Das Publikum verlangte nachdrücklich die Ouvertüre des Freischütz, und kaum vermochte das Aufziehen des Vorhangs dem Lärm ein Ende zu machen. Der arme Künstler war zu Dresden nicht daran gewöhnt, sich mit solcher Auszeichnung behandelt zu sehen, und war daher über den so unerwarteten Empfang recht inniglich gerührt. Bevor er seine neue Oper der Londoner Bühne zum Einstudieren gab, leitete Weber die Wiederaufführung des Freischütz, und sorgte selbst für’s Einstudieren der Rollen und überhaupt für die ganze Aufführung. Gleich bei seinem Eintritt in’s Orchester, gerieth der ganze Saal in Bewegung, die Ouvertüre ward wiederholt, und jedes Stück mehrmalen durch Beifallsbezeugungen unterbrochen. Nichts fehlte endlich mehr zu Webers Triumph, sogar das Herausrufen — welche Ehre bisher nie einem Componisten in England zu Theil geworden — nicht ausgenommen. Dies alles war freilich geeignet, ihn zu berauschen, und die Eitelkeit des Künstlers fand Stoff genug zur Zufriedenheit; allein noch war der Hauptzweck seiner Reise nicht erreicht. Es hing lediglich vom glücklichen Erfolg des Oberon ab zu bestimmen, in wie fern er Ursache habe, sich dazu Glück zu wünschen, sie unternommen zu haben. Der große Tag war endlich da; am 11. April hatte die letzte allgemeine Repetition Statt gesunden. Alle Abonnirte haben in den Londoner Bühnen Zutritt an den Tagen der Hauptrepetitionen; weshalb auch fast gar kein Unterschied zu bemerken ist zwischen dem letzten Versuch und einer gewöhnlichen Vorstellung. Der Saal des Coventgarden-Theaters war mit einem glänzenden Publikum angefüllt. Der erste Akt ward sehr gut ausgeführt; im zweiten aber, als grade die zwei Hauptschauspieler erscheinen sollten, blieb die Scene leer. Es ward angekündigt, daß die Schauspielerin Miß Paton durch das Niederstürzen eines Theils der Decoration verwundet worden sei. Dieser Zufall kam einigen abergläubischen Personen wie eine schlimme Vorbedeutung vor. Die Vorstellung ward demungeachtet nur um wenige Tage hinausgeschoben. Webers Arbeit ward überhaupt und im Ganzen sehr günstig aufgenommen, erhielt aber bei weitem den enthusiastischen Beifall nicht wie der Freischütz. Man war auf eine Musik gefaßt, die den nämlichen Charakter haben sollte wie diese Oper, und der Unterschied war auffallend. In der That ist überaus wenig Aehnlichkeit zwischen beiden Partituren zu bemerken. Die Musik des Oberon trägt nicht wie die des Freischützen den Stempel eines bisweilen wilden und großartigen Charakters, sie ist vielmehr in einem sanften, melancholischen Styl verfaßt, und ist reich an neuen Wirkungen von einer delikaten und gefälligen Gattung. Ueber mehre Stücke darin ist eine Färbung von außerordentlicher Originalität verbreitet, allein in einigen anderen Abtheilungen der Oper ist Schwäche und Monotonie zu verspüren. Betrachtet man das Ganze der Composition, so muß man sie unter der des Freischützen erkennen; demungeachtet sind die schönen Stellen, welche sich in großer Menge darin vorfinden, von einer neuen und so gefälligen Gattung, daß man nicht in Abrede stellen kann, die Arbeit sey ganz des Genies Webers würdig. Der einzige Fehler, den man ihm mit Grund vorwerfen kann, ist der, daß man keine große Entwickelung irgend einer Form darin antrifft. Die körperlichen Leiden des Künstlers haben ihre Spuren in seiner Arbeit hinterlassen. Vierundzwanzigmal ward Oberon unter Weber’s unmittelbarer Leitung aufgeführt, er hatte aber keine Ursache, mit seinen Zuhörern in dem Maaße zufrieden zu sein, wie er und seine Freunde es sich vorgestellt hatten.
Die zwei Theater Coventgarden und Drurylane sind fast immer in Opposition gegen einander; wenn eins von beiden etwas unternimmt, um das Publikum an sich zu locken, gleich wird dies vom Andern nachgeahmt. Der Direktor des letztbenannten Theaters trug unverweilt dem Componisten Bishop die Anfertigung einer neuen großen Oper auf, sobald er nur vernommen hatte, daß Weber seine Partitur des Oberon aus Deutschland mit sich bringen werde. Bishop, der als Musiker einiges Verdienst hatte, aber nie im Stande war, etwas zu erfinden, ward zum Nebenbuhler Weber’s erklärt, ungeachtet des himmelweiten Abstandes, der ihn von dem großen Künstler trennte. Freilich gab ihm seine Eigenschaft als geborner Engländer einen Vorzug, der dem Verdienste seines Concurrenten die Stange zu halten vermochte. Acht Tage nach der ersten Vorstellung des Oberon ward Bishop’s Oper: Aladin auf der Bühne des Drurylane gegeben; das Stück hatte einen unermeßlichen Zulauf und erweckte das lebendigste Interesse. Die Freunde des englischen Musikers machten ihre Sache so gut, daß dieser sich einbilden konnte, er habe den erlauchten Künstler, dessen würdiger Nebenbuhler er zu sein glaubte, aus dem Sattel gehoben.
Weber dachte nunmehr nur noch daran, sich seinen fernern Aufenthalt in London so einträglich als möglich zu machen, ohne jedoch die Erwartungen weiter zu nähren, welche er mit sich dahin gebracht hatte. Er beschäftigte sich mit der Organisation eines Concertes zu seinem Benefiz, welches in der That Statt fand, und in welchem mehrere neue von ihm verfertigte Stücke mit dem günstigsten Erfolg ausgeführt wurden. Dahingegen hatte sein körperliches Leiden erstaunlich schnell überhand genommen, und ließ ihm nicht mehr soviel Kraft, weder zu gehen, noch zu sprechen, so sehr hatte das ungesunde Klima Londons zu seiner Erschöpfung beigetragen. Er wollte sich selbst so gerne über seinen Zustand täuschen. Der Wunsch, sein Vaterland wieder zu sehen, war für ihn eine um so größere Qual, als seine Körperschwäche immer zunahm. Er hatte sich vorgenommen, am 6. Juni eine zu seinem Benefiz gegebene Vorstellung des Freischützen selbst zu leiten, und Tags darauf London zu verlassen. Dieser Vorsatz konnte aber nicht zur Ausführung kommen, denn bereits am 5. Juni hatte er aufgehört zu sein. Die angekündigte Vorstellung fand dennoch Statt zum Benefiz seiner Wittwe und Kinder, welche der geringe Erfolg seiner Reise nach England in wahrhaft kümmerlichen Umständen zurückgelassen.
Es gab Leute, welche vorgaben, Weber sei wohlhabend gewesen, seitdem er zu Dresden das doppelte Amt eines Kapellmeisters und eines Direktors des Theaters bekleidete. Der Verfasser eines vor einigen Jahren in einer französischen Zeitschrift eingerückten Briefs geht gar so weit, daß er behauptet, Weber sei während seiner letztern Jahre im Besitze eines eleganten Wagens und hübschen Gespanns gewesen. Wäre dies der Fall gewesen, würde Weber sich wohl je dazu entschlossen haben, seine Familie, seine Freunde zu verlassen, um drei Monate in einer Stadt zuzubringen, deren Klima seiner Gesundheit tödtlich werden mußte? Schon vor seiner Abreise war er so leidend, daß er oft seine Arbeiten einstellen mußte; nur ein großes Interesse vermochte ihn zu überwinden, sich in einem solchen Zustande zu entfernen. Dies Interesse war das seiner Frau und Kinder. Es ist allerdings ein großer Abstand zwischen einem ehrenvollen Auskommen von 1800 Thaler Gehalt und Nothleiden, aber bei Weitem nicht so groß als der, zwischen diesem Auskommen und der Wohlhabenheit oder gar brillanten Lage, die er nach jener Behauptung gehabt haben soll. Den Beweis dafür, daß Weber bei Weitem nicht die vorausgesetzte Wohlhabenheit besaß, mag übrigens der Umstand führen, daß man an vielen Orten die Nothwendigkeit einsah, mehre Benefiz-Vorstellungen für seine Wittwe und beide Söhne zu veranstalten.
Wir müssen bei dieser Gelegenheit ein Ereigniß erwähnen, das mit einer Fatalität viele Aehnlichkeit zu haben scheint. Die nämliche Oper Oberon, welche Weber’s Tod beschleunigte und einer Schauspielerin vom Coventgarden-Theater beinahe ein großes Unglück gebracht hätte, sollte zum ersten Mal in Dresden zum Vortheile der Familie Weber gegeben werden, als der erste Tenorsänger im Augenblicke, als er hervortreten sollte, von einem Schlagfluß getroffen wurde.
Weber hat einige Schriften hinterlassen, deren Herausgabe einer seiner Freunde, welchem sie anvertraut worden, besorgte. Diese Schriften enthalten einzelne Gedanken über die Musik, eine Auswahl Poesien und ein Werkchen, das den Titel führt: „Leben eines Musikers“, worin alle Wechsel, denen die Eristenz eines Tonkünstlers ausgesetzt ist, dargestellt sind. Man trifft darin fast auf jeder Seite Spuren von jener deutschen Schwärmerei, die auf die Arbeiten des Verfassers so vielen Einfluß gehabt.
Wie Salvator Rosa hatte Weber sich gleichzeitig mit der Literatur und seiner Kunst abgegeben; er starb, leider! in einem jüngern Alter, und hinterließ kein Vermögen.
Anmerkungen
[Bearbeiten]- ↑ Wir würden unsern deutschen Lesern gerne den Verfasser dieser mit eben so vieler
Gründlichkeit als Sachkenntnis geschriebenen Charakteristik mit dem vollen Namen nennen, wenn wir das Recht dazu hätten. Den belgischen Lesern ist der
treffliche Kritiker bekannt, der unter dieser Chiffer von Zeit zu Zeit den „Indepedant“
mit musikalischen Kritiken versieht, wie vielleicht nur wenige europäische
Blätter gleiche aufzuweisen haben. Umfassende Kenntnisse, Scharfsinn und Geschmack gehen in diesen Kritiken Hand in Hand, und wir wünschten, mancher
unserer hochgestrengen deutschen musikalischen Rigoristen könnte sich hier ein Beispiel nehmen, wie man bei der umfassendsten Kenntniß des historischen Materials,
bei der feurigsten Bewunderung der alten Meister, dennoch frei von Pedanterie
in der Mitte der Gegenwart stehen kann, das Bestehende genießend und das
Wertende errathend.
Die Redaktion.
Anmerkungen (Wikisource)