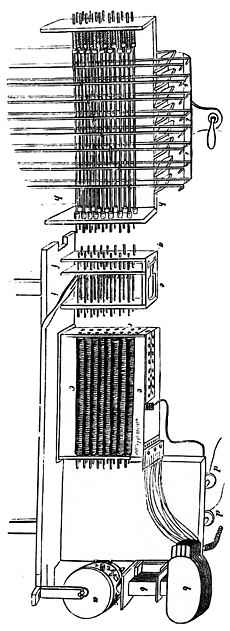Die Gartenlaube (1860)/Heft 34
[529]
| No. 34. | 1860. |
Das hohe Elbufer zwischen Hamburg, Altona und Blankenese bietet, vom Strome aus gesehen, eine der malerischsten Ansichten Deutschlands, ja der ganzen Welt dar. Von der Höhe bis zum Strande ist die zwei deutsche Meilen lange Strecke mit Landhäusern von allen Dimensionen und Geschmacksrichtungen buchstäblich wie übersät, und wir kennen keinen unter den vielen Genüssen, welche die große Handelsstadt uns bot, der das Herz mehr erweiterte und Phantasie und Gedanken mehr anregte, als den, uns bei schönem Wetter in einem Boote den Strom hinabschaukeln zu lassen, und mit den Augen der Seele wie des Körpers das reiche Panorama in uns aufzunehmen.
Auf den Höhen thronen die Paläste, bald in edelm griechischen Style, mit Säulenhallen und platten Dächern, bald als künstliche Ruinen oder Ritterburgen, einzelne auch als weitläufige ehrliche deutsche Häuser mehr solid und bequem im Innern, als schön von außen. Auch in den Parkanlagen, von denen alle umgeben sind, zeigt sich dieselbe Mannichfaltigkeit des Geschmacks. Hier der einfach edle der Engländer, dort der steife, schnörkelliebende aus der Zeit Ludwig XIV. wechseln ab mit dem überladenen bunten des Holländers, und selbst der des weit entfernten China ist hier vertreten. Auf den mittleren Abhängen finden wir meistentheils die bescheidneren Landhäuser mit zierlichen Blumengärten und schattigen Lauben, in denen man die Familien, beschäftigt oder sich geselligen Genüssen hingebend, erblickt. Saubere Dörfer mit Kirchen, Mühlen und Gasthäusern, Schiffswerften und Fischerhütten, Alles voll Leben und Bewegung, theilen und verbinden die einzelnen Niederlassungen von der Höhe bis zum Strande, an welchem zwischen den Hütten wir noch einzelne zierliche Häuser erblicken, die meist von Schiffscapitainen oder Handwerkern bewohnt sind. In dem ganzen großartigen Gemälde findet das Auge nichts, wodurch es getrübt oder beleidigt werden könnte. Kein Fleckchen Land ist unbenutzt geblieben oder unschön. Eine gewisse Wohlhabenheit bekundet selbst die kleinste Hütte; und auch an Obst- und Küchengärten fehlt es nicht, um dem Tadel derjenigen zu begegnen, die das Wort „Der Mensch lebt nicht vom Brod allein“ gern umkehren möchten.
Doch dies flüchtig skizzirte Landschaftsbild war es nicht, womit wir den Leser unterhalten wollten. Nur in einige dieser vielen Häuser führen wir ihn ein, und nur für das Schicksal zweier Familien unter den Tausenden, die hier wohnen, hoffen wir sein Interesse zu wecken.
Weder Palast noch Hütte, hat das Haus, in welches wir zunächst treten, sich auf einem Abhange zwischen den Parkanlagen des reichen Banquier Blenheim und einem Fischerdorfe auf das Lauschigste eingenistet. Im Süden ist es durch ein Tannenwäldchen von jenem getrennt und geschützt, durch ein von hohem Gebüsch überragtes Stacket von diesem geschieden. Liebliche Plätze im Garten, der es umgibt, gestatten den Blick auf den schiffbelebten Strom oder laden zu unbelauschtem Geplauder trauter Freunde ein. Nur drei Fenster hat das Haus in der Breite, von denen das mittlere die Thüre zu einem kleinen Salon bildet. Zur Linken desselben befinden sich zwei kleine Zimmer, die so ziemlich Alles enthalten, womit die Mode des Tages die Wohnung einer jungen gebildeten Frau, selbst schon des glücklichen Mittelstandes, zu schmücken pflegt. Rechts nimmt das Speisezimmer die ganze Tiefe des Hauses ein, und durch ein Fenster im Hintergrunde sieht man in einen kleinen Obst- und Gemüsegarten, dessen hohe Weinplanke sich an das Tannenwäldchen lehnt. Hinter dem Salon befinden sich die Treppen, die nach oben zu den Schlaf- und Fremdenzimmern, nach unten zu den Wirthschaftsräumen führen.
Der ganzen Einrichtung sieht man es an, daß sie mit Geschmack, von Wohlhabenheit unterstützt, ist beschafft worden, daß der Geist einer sorglichen Hausfrau darüber wacht, daß hier ein junges, Musik und Lectüre liebendes Paar wohnen muß, und daß diese stillen Räume ein Tempel häuslichen Glückes zu sein verdienen. Nur durch Etwas wird der harmonische Eindruck gestört. Die beiden einfachen, schlecht gemalten Portraits in schwarzem Rahmen, die zu beiden Seiten eines dritten über der Causeuse im Putzstübchen hängen, passen nicht hierher, und der Gesichtsausdruck einer jungen Frau von blendender Schönheit, die wir am späten Abend allein und in Betrachtung des mittleren Gemäldes versunken finden, fällt uns zu schmerzhaft auf.
Das Bild in der Mitte stellt einen jungen Mann von so glücklichem und gewinnendem Aeußeren dar, daß wir ihm den Vorzug vor den beiden andern gönnen, von der Hand eines Meisters gemalt zu sein und aus einem breiten Goldrahmen hervorzuschauen, den liebende Hände noch außerdem mit einem reichen Blumenkranze geschmückt haben. Ob die heitere Sorglosigkeit dieses blühenden Antlitzes auf Leichtsinn oder leichten Sinn deutet, wird unsere nähere Bekanntschaft mit dem Original des Bildes, dem jungen Schiffsmakler William Almis, lehren.
Allerdings läßt das in sorgenvolle und nachdenkliche Falten gezogene Gesicht des alten spießbürgerlichen Mannes zur Linken des Jünglings, in dem wir trotz dieser Verschiedenheit auf den ersten Blick den Vater des Letztern erkennen, uns Manches fürchten; allein schauen wir in das wohlbehäbige Antlitz der korpulenten Frau zur [530] Rechten, so beruhigen wir uns schnell. Sie scheint den alten Hypochonder auszulachen, und während seine strenggeschlossenen Lippen, ja selbst seine hagern, hochgezogenen Schultern zu fragen scheinen: „wie soll es nur werden?“ lächeln die ihrigen: „es wird schon noch Alles gut gehn.“
Die junge Dame scheint noch ebenso ungewiß über jenen Punkt zu sein, wie wir, wenngleich ihr rosiges, nur zu Glück und Freude geschaffenes Gesicht augenblicklich den Stempel des Schmerzes und der Verstimmung trägt. „Wenn ich nur wüßte, worüber ich mich ängstige und betrübt bin!“ rief sie endlich laut und unmuthig über sich selbst aus. „Ist William nicht der beste Mann unter der Sonne und der Liebenswürdigste? – Liebt er mich nicht noch ebenso heiß, als damals, als er mir Herz und Hand schenkte? – Und verlange ich mehr vom Schicksal, als seine Liebe und sein Glück? – O Gott, verzeihe mir! – Besitze ich denn nicht außerdem auch noch Alles, was meine kühnsten Mädchenphantasien sich jemals von irdischer Glückseligkeit träumen ließen? – Selbst die Einwilligung seines Vaters, der Segen meiner Mutter fehlen unserem Glücke nicht, und doch – – – –“ Sie schwieg einige Augenblicke, trocknete die feuchten Augen und schlug diese dann zu dem Bilde der alten Dame auf. Ihre Mienen erheiterten sich allmählich, und wehmüthig lächelnd sagte sie: „O du beste aller Tanten und Pflegemütter! daß du noch auf Erden weiltest! Dir würde ich meine kindischen Befürchtungen gern mitgetheilt, du würdest mich beruhigt haben. Denn schon vor deinem Bilde finde ich stets Muth und Trost, ja meinen Frohsinn wieder. Meiner Mutter kann ich meine Sorgen nicht anvertrauen, ich würde ihr damit nur Stoff zu tausend traurigen Vermuthungen geben und durch sie nur noch mehr entmuthigt werden. – –“
„Du guter, wunderlicher Vater,“ wendete sie sich zu dem Bilde des alten Griesgrams, „welche Liebe birgt sich hinter diesen finstern Zügen, die gewiß noch finsterer blickten, als dein einziger Sohn, der Stolz deines Lebens, eines Tages vor dich trat, und dir seine Neigung, nicht zur Tochter des reichen Blenheim, die schon alle Welt seine Braut nannte, weil alle Welt ihre Neigung zu William und ihre Macht auf das Herz ihres Vaters kannte, sondern zur armen Hermine gestand, der Waise eines Landpfarrers, die im kleinen Häuschen am Strande mit Handarbeiten sich und ihre Mutter ernährte. – O William! mein heißgeliebter William! Welch ein Jubel, als du am Abend zu uns hereinstürmtest, mir um den Hals fielst und jubelnd ausriefst: „Er hat eingewilligt!“ Selbst meine stets noch zweifelnde Mutter verjüngte sich mit uns, und als sie uns dann allein ließ, um statt meiner Anstalten zum Thee zu treffen: o Himmel, gebehrdeten wir uns da nicht wie zwei Kinder? und erhoben wir uns dann nicht wieder wie zwei selige Geister des Paradieses weit über die Erde hinweg?“
Hermine versank in Erinnerung an jene Zeit, bis sie plötzlich laut auflachte. „Nein, wie natürlich dem Schelme die Miene feierlichen Ernstes stand, als er nun von dem Gelübde anfing, mit dem er die Einwilligung seines Vaters hatte erkaufen müssen! „Ein Gelübde?“ rief ich erschreckt, und Gott weiß, was ich als die echte Tochter meiner ängstlichen Mutter mir davon vorstellte. „„Ja, denke nur, ich mußte sogar schwören.““ „Schwören? William, bester William! Ach sprich es doch mit einem Male aus, was verlangt Dein Vater von Dir? Ich sterbe vor Angst.“ „„Ja, umsonst kann mein Vater einmal Nichts weggeben, das wäre ganz gegen seine Natur. Bevor er also Ja sagte, mußte ich ihm eidlich, sage eidlich versprechen, zum Ersten –““ „Nun, William, was?“ „„Die drei Bilder, die in seiner Stube über dem Sopha hängen – ich erzählte Dir schon davon – als Geschenk von ihm anzunehmen und ihnen für alle Zeiten, so wie sie sind, im ersten Zimmer unseres künftigen Hauses denselben Ehrenplatz anzuweisen.““ „O, der gute, liebe Vater!“ unterbrach ich voll dankbaren Entzückens den Schelm, dessen Miene noch Nichts von ihrer Feierlichkeit verlor.“ „„Höre nur erst die zweite Clausel,““ sagte er ernst. „„Die erste sollte ein Recept gegen Eitelkeit und zu allerlei moralischen Betrachtungen sein. Aber die zweite! die furchtbare zweite!““ „O William, spanne mich nicht auf die Folter!“ „„Nun, also zum Zweiten habe ich geschworen, in den drei ersten Jahren, von diesem Tage an gerechnet, niemals des Abends ohne Deine Begleitung auszugehen.““ „Ha! dies furchtbare Gelübde auszusprechen, ist Dir gewiß recht schwer geworden?“ Er schloß mir den Mund mit Küssen, und es währte geraume Zeit, bis ich neugierig rief: „Nun, William, zum Dritten und Letzten?“ „„Ja, Hermine, ich habe auch die dritte Clausel beschworen. Der Preis war zu lockend,““ antwortete William, und sein liebes Gesicht nahm nun eine wirklich betrübte Miene an. „„Aber erst jetzt fühle ich, daß in dieser dritten Bedingung etwas sehr Beleidigendes für Deine Mutter und Betrübendes für uns Beide liegt.““ „Was kann Dein Vater gegen meine Mutter Beleidigendes haben?“ fragte ich bestürzt, während mir das Blut in das Gesicht schoß. „„Gegen sie persönlich gar Nichts; nur gegen Schwiegermütter überhaupt ist er aus Erfahrung eingenommen, und … nun ja, es muß heraus! Ich habe eidlich geloben müssen, Deine Mutter niemals als Hausgenossin bei uns aufzunehmen.““
„Laß Dich das nicht betrüben,“ sagte ich nach einer Pause. „Meine Mutter hat oft geäußert, daß, so lange sie lebte, sie das Häuschen nie verlassen würde, das das einzige Erbgut von ihrem Vater, dem Schiffscapitain ist. Sie fühlt sich in dessen Besitz so stolz und glücklich, wie der reiche Blenheim sich nur im Besitz seines Schlosses fuhlen mag.“ „„Aber,““ sagte William, schon wieder den Schelm im Gesichte, „„die beiden Leute, die, so Gott will, nächstens das hübsche Haus, das zwischen beiden liegt, beziehen werden, die nehmen es an Glück mit der ganzen Welt auf.““ „Wer sind sie, William?“ fragte ich, und mein Herz stand still vor freudiger Hoffnung und Spannung. „„Du und ich, mein Herz! Mein Vater hat es gekauft, und mit dem Gelde, das seine Schwester mir vermachte, wollen wir’s einrichten, so schön, daß eine Prinzessin drin wohnen könnte.““ „Ach ja, mein William! unser Glück nimmt es noch immer mit dem der ganzen Welt auf; wenn nur – –“ doch wo bleibt er heute wieder, der böse Mann, so weit hat er noch niemals in den ganzen zwei Jahren, die seit jenem Tage verflossen sind, die zweite Clausel umgangen. Der Abend ist fast zu Ende,“ rief sie erschreckt mit einem Blick auf die Pendule, deren Zeiger die zehnte Stunde wies, und rasch entschlossen eilte sie durch den Salon, wo der runde Tisch vergebens alle Anordnungen zum Thee zeigte, in den Garten hinaus, auf welchen eine milde, sternenhelle Juninacht herniederschaute. Auf und ab wandelnd, lenkte sie ihre Schritte immer wieder unwillkürlich zu einer Gitterthüre hin, durch die man auf einen breiten Kiesweg gelangte, der aus dem Tannenwäldchen kommend nach dem Strande führte, und der von dem schmäleren durchkreuzt ward, auf welchem Hermine ihren Gatten zurück erwartete.
Eine halbe Stunde mochte abermals verflossen sein, schon herrschte ringsum tiefes Schweigen, nur unterbrochen von dem fernen Plätschern der Wellen und dem leisen Säuseln der Bäume. Die Sehnsucht und Spannung, von denen Herminens Herz bewegt ward, hatten allmählich den Charakter der Angst angenommen. Konnte ihm nicht ein Unglück begegnet sein? Erst kürzlich war ein Mann, der in der Nacht den Arzt zu seinem kranken Kinde holen wollte, und der den Richtweg nach Altona über die Bleiche einschlug, von Hunden zerrissen worden. Gräßliches Bild! entsetzenvoller Gedanke! Wenn nun William, um schneller zu ihr zu gelangen, tollkühn denselben Weg einschlug?
Schon wollte Hermine die Pforte öffnen, allein ihre gewissenhafte Dienerin hatte dieselbe schon verschlossen. Noch stand sie überlegend, ob sie den Schlüssel holen und William entgegen gehen sollte, als leichte eilige Schritte nahten. Zwar kamen sie nicht von oben, sondern vom Strande her, allein Hermine überredete sich, William sei bei ihrer Mutter gewesen. Ihr Herz glaubte so leicht, was es hoffte, und bevor sie ihn sah, rief sie ihm freudig entgegen: „Nun endlich, endlich bist Du da!“
Sie lehnte sich dabei, so weit sie konnte, über das niedrige Gitter und glaubte wirklich den Ersehnten zu erblicken, als ein schlank gewachsener Mann mit anmuthiger Eile aus dem Gebüsch zu ihr herantrat. Allein kaum hatte derselbe ihr mit freudiger Ueberraschung und ebenso großer Ehrerbietung „Guten Abend, Madame Almis,“ zugerufen, als sie zu ihrem nicht geringen Schrecken den ihr vom Gerücht ebenso sittenlos als boshaft geschilderten Sohn des Banquiers erkannte, dessen Tochter einst ihre Nebenbuhlerin gewesen war. Im ersten Augenblicke wußte sie nicht, ob sie davon eilen oder bleiben sollte, um ihre so unvorsichtig in die Nacht hinausgerufene Begrüßung zu erklären, da Blenheims Bosheit sonst vielleicht gar eine Geschichte daraus schmiedete. Sein zweites Wort bewog sie zu dem letzteren.
„Ha, allerschönste Frau! niemals hätte ich mir das Glück [531] träumen lassen, von Ihnen so freundlich begrüßt zu werden. Oder sollten Sie mich mit Ihrem Gemahl verwechselt haben?“
„Das bezweifeln Sie gewiß nicht, Herr Blenheim,“ entgegnete Hermine mit ruhiger Würde.
„Wenn Sie es befehlen, muß ich gehorchen,“ entgegnete er mit einer Verbeugung.
Auch Hermine verneigte sich und wollte gehen. Allein mit Williams Namen hielt er sie zurück.
„Almis,“ sagte er, „wird sobald nicht kommen. Vor einer halben Stunde sah ich ihn noch vor dem Alsterpavillon, umgeben von Sängern und Schauspielern, hinter einer Batterie von Weinflaschen, in der allerheitersten Laune. Herrschte nicht seit längerer Zeit eine Spannung zwischen uns, an der ich in keiner Weise schuld bin, so hätte ich mich gerne zu dieser fröhlichen Brüderschaft gesellt. William wird Ihnen vielleicht erzählt haben, daß er bis zu seiner Verlobung mit Ihnen, schönste Frau, ein oft und gern gesehener Gast in meines Vaters Hause war.“
„Er hat es mir erzählt,“ entgegnete Hermine einsylbig, und er fuhr fort: „Daß William nicht versuchte, auch Sie bei uns einzuführen, entschuldige ich mit den Verhältnissen. Aber daß er mich seitdem nicht mehr zu kennen scheint –“
„Hierin irren Sie sehr, Herr Blenheim,“ unterbrach ihn Hermine, es ihm überlassend, in welchem Sinne er ihre Versicherung aufnehmen möchte. Doch wollte sie den gefährlichen Mann auch nicht unnützer Weise gegen sich aufbringen, und so fügte sie freundlicher hinzu: „Mein Mann hat die heitern Stunden nicht vergessen, die er bei Ihnen verlebte. Aber sehr richtig deuteten Sie selbst auf die Verschiedenheit unserer Verhältnisse hin. Schon die Lage unserer kleinen Wohnung spricht für unsern beiderseitigen Wunsch, bürgerlich still zu leben. Sie schienen eilig zu sein, Herr Blenheim, und ich finde, daß es kühl wird. Gute Nacht!“
„Ich war eilig: Jenny Lind singt heute Abend bei uns, und ich hätte schon seit zwei Stunden zuhören sollen. Aber in unserm Hause gibt es nur zu viel Musik, und die Leidenschaft dafür ist hinlänglich durch meine Schwester Nancy vertreten. Ich verspare mir daher gern den Genuß, etwas Außerordentliches zu hören, auf die morgende Oper und leiste Ihnen, wenn Sie es gütigst erlauben, bis zu Almis’ Rückkehr Gesellschaft.“ Er faßte bei diesen Worten den Drücker der Thüre an, als sehe er voraus, Hermine würde nicht das Herz haben, seine Zudringlichkeit zurückzuweisen. Doch er irrte sich.
„Sie sehen, Herr Blenheim,“ sagte sie, „in unserm Hause werden zu dieser Tageszeit keine Besuche mehr erwartet. Auch nehme ich nur solche Herren an, die mein Mann eingeladen. Noch einmal gute Nacht.“
Sie verbeugte sich und ging. Er aber rüttelte noch an dem Schlosse der Thür, und gewohnt, William dieselbe überspringen zu sehen, fürchtete sie schon, der Zudringliche könnte dasselbe thun. Herzhaft kehrte sie sich daher nach ihm um und rief zornig: „Unterstehn Sie sich nicht, den Fuß in unser Eigenthum zu setzen.“ Er aber schlug ein helles Gelächter auf und verschwand in dem Tannenwäldchen.
Unterdessen war William auf seinem gewöhnlichen Wege die Höhe herabgekommen und hatte in der Entfernung die Stimmen gehört und erkannt, ohne die Worte zu verstehen. Er erschrak heftig darüber. Denn obgleich bis heute nicht der kleinste Zweifel weder an Herminens weiblichem Takt, noch an ihrer Liebe und Treue aufgestiegen, fürchtete er doch Alles für ihren Ruf, wenn Jemand sie zu solcher Tageszeit und ohne ihn in einem Gespräch mit Eugen Blenheim bemerkt hätte. Er vergaß darüber, was er zur Entschuldigung seines späten Kommens hatte sagen, was er hatte thun wollen, um Hermine, wie gewöhnlich, bald wieder versöhnt und heiter zu sehn. Mit weiten Schritten strebte er dem Garten zu, allein jetzt war Alles still darin. Schnell übersprang er das Gitter, und bei seinem raschen Eintreten in den Salon entdeckte er sogleich eine große Verlegenheit und Aufgeregtheit sowohl in Herminens Antlitz, als in ihrem ganzen Wesen, die sie noch niemals gezeigt.
Aber sie befand sich auch in einem Seelenzustande, den sie nie zuvor gekannt. Denn die Nachricht, daß William mit Sängern und mit Schauspielern die Stunden hinbrachte, die sogar ein Eidschwur ihn zwang, ihr zu schenken, bestätigte alle schlimmen Ahnungen, die sie seit einiger Zeit hegte. Oft schon wie heute war er nicht zu Tisch nach Hause gekommcn, was er dann mit Geschäften im Comptoir und an der Börse zu entschuldigen pflegte, und was auch bei Kaufleuten, deren Familien weit ab von der Stadt wohnten, leider häufig sich ereignete. Im ersten Jahre ihrer Verheirathung war das indessen sehr selten geschehen, und dann hatte er sie stets durch den Laufburschen davon benachrichtigen lassen. Jetzt unterblieb dies gänzlich; „es nahm zu viel Zeit weg,“ und William hatte mit Herminen verabredet, nicht auf ihn zu warten, wenn er nicht zur bestimmten Stunde da sei. Vergeblich waren seitdem nur allzuoft ihre Bemühungen gewesen, durch ein Leibgericht oder zierliches Serviren des Tisches, wie sonst, ihm eine Freude zu bereiten, und gar oft blieben jetzt auch von ihr die sorgfältig bereiteten Speisen unberührt. Denn trotz Allem, was William und sie selbst aufboten, sie zu überreden, „dies könne einmal nicht anders sein, und das Geschäft sei jetzt um Vieles bedeutender geworden,“ stiegen ihre Besorgnisse mit jedem Tage.
Gegen seine letztere Behauptung sprach überdies noch so Manches. Nicht, wie im ersten Jahre ihrer Verheirathung, verschaffte William die Vorräthe im Haushalte auf wahrhaft verschwenderische Weise. Vielmehr sprach er schon zuweilen seine Verwunderung aus, „daß es schon wieder an Diesem und Jenem fehle,“ obgleich er Herminens Wirthlichkeit kannte. Auch überhäufte er ihre Mutter nicht mehr, wie früher, mit Aufmerksamkeiten und Geschenken, ihr seine Liebe und seinen Dank zu beweisen für das Opfer, als das er es ihr bis dahin anrechnete, sich von dem einzigen Kinde getrennt zu haben, durch dessen Fleiß und Geschicklichkeit die sehr kleine Pension vergrößert ward, von der die Wittwe lebte, die sich die größten Entbehrungen auferlegt hatte, während sie nichts an der Erziehung dieses Kindes sparte. Herminens Mutter war dies freilich sehr lieb, denn sie war zu stolz und zu genügsam. Dennoch war es dieser Punkt, der ihr den Mund verschloß, wenn sie der Tochter ihre Befürchtungen über Williams Lebensweise mittheilen wollte.
So hatte die arme Hermine Niemand, von dem sie Aufklärung hätte fordern oder anhören mögen. Denn ihr Schwiegervater würde der Allerletzte gewesen sein, dem sie Mißtrauen gegen den Sohn hätte einflößen mögen, und im heißen Gebete flehte sie oft zu Gott, daß er ihr in’s Herz geben möchte, auf welche Weise sie mit ihrem Manne selbst darüber reden könnte. Denn das Gefühl, ihm keine Mitgift zugebracht zu haben, welches sie bis dahin nur beglückt hatte, da sie seiner Liebe so gerne Alles, was sie besaß, verdankte, machte sie nun plötzlich verlegen und bange. Aber es handelte sich ja nicht nur um Güter der Erde, sondern um viel höhere, wenn ihr Gatte sich leichtsinnig in den Strudel von Vergnügungen und Verschwendung zurückstürzte, aus welchem, wie ihr Schwiegervater ihr einst gestanden hatte, die Liebe zu ihr ihn emporgezogen.
In diesen Betrachtungen unterbrach sie William, welcher nicht, wie sonst, mit einer heitern Entschuldigung und zärtlichen Liebkosungen, sondern mit einer kalten und strengen Miene eintrat und sich noch sehr zusammenzunehmen schien, als er gleichgültig fragte: „warst Du eben im Garten?“ Aus mehr als einem Grunde wollte Hermine ihm das Zusammentreffen mit Eugen Blenheim gern verschweigen, und indem sie einsylbig „ja“ antwortete, bedachte sie nicht, daß William sich während desselben schon mußte auf dem Wege befunden haben und leicht ihr Gespräch mit angehört haben konnte. Er schwieg eine Minute lang, indem er Hut und Handschuhe ablegte, um ihr Zeit zu lassen, ihm aus freien Stücken eine weitere Mittheilung zu machen. Allein ihre Gedanken weilten schon wieder bei dem Eingange zu ihrer kleinen Rede, mit der sie noch immer nicht auf’s Reine gekommen war. Er ging unterdessen in das Bilderzimmer und kehrte mit der halb verwundert, halb unmuthig klingenden Frage zurück: „Weshalb brennt die Lampe da noch ganz unnützer Weise? oder hast Du Besuch gehabt?“
„Nein, William, eben weil ich allein war, zündete ich sie an,“ entgegnetc sie sanft. „Du tadeltest früher oft meine „lächerliche“ Sparsamkeit, wenn ich es nicht that; aber ich hätte sie auslöschen sollen, als ich in den Garten ging.“
„Du bist also den ganzen Abend allein gewesen?“
„Gottlob nicht den ganzen Abend,“ entgegnete Hermine bewegt. „Sonst hättest Du einen Eid gebrochen.“ Sie sah dann zärtlich zu ihm auf und fügte scherzend hinzu: „Bis Mitternacht dürfen wir wohl noch „Abend“ sagen, und überdem war es neun Uhr Morgens, als Du ohne mich ausgingst.“
[532] „Hermine, ich bitte Dich, laß jetzt diese Anspielungen auf den ebenso lächerlichen als tyrannischen Einfall eines alten, halb kindischen Mannes,“ unterbrach William sie in einem Tone, den sie noch niemals von ihm vernommen und der sie ebensosehr erschreckte, als der durchbohrende Blick, mit dem er sie dabei ansah. Zornbebend, aber mit erzwungener Kälte stieß er die heisere Frage hervor: „Sprachst Du nicht vor zehn Minuten mit Eugen Blenheim?“
Jetzt ging Herminen plötzlich ein Licht über sein Benehmen auf. Natürlich hatte er ihr Gespräch mit dem abscheulichen Blenheim gehört und nicht verstanden, und was mußte er von ihr denken, daß sie darüber schwieg? Sie bedachte sich nun keinen Augenblick länger, ihm gewissenhaft mitzutheilen, wie sehnsuchtsvoll sie ihn erwartet, auf welche Weise sie Blenheim Veranlassung gegeben, sich ihr zu nahen, sowie jedes Wort, das sie mit ihm gewechselt hatte. Während dieser Mittheilung klärten Williams Mienen sich wieder auf, und Rührung trat an die Stelle finstern Verdachtes. Obgleich es ihn sehr verdroß, Herminen von der Art und Weise unterrichtet zu sehen, wie er den größten Theil des Abends hingebracht, maß er sich doch allein die Schuld davon bei. Traulich setzte er sich neben sie, die schon längst wieder versöhnt war, und liebenswürdig, heiter und offener als jemals erzählte er ihr, bevor sie danach fragen konnte, wie er seinen Tag hingebracht.
Sie wußte schon, morgen sang die Lind in „Robert der Teufel“. Wie gern William in Herminens Gesellschaft sie gehört, war nur zu natürlich. Allein morgen war der Geburtstag seines Vaters, den sie mit einem Familiendiner zu feiern beschlossen hatten, und wozu der Letztere sowohl, wie Herminens Mutter, schon eingeladen waren. Sie durften nicht daran denken, vor zehn Uhr Abends die Gäste gehen zu sehen; kein Wunder, wenn William die Einladung Wola’s, des Sängers am Stadttheater, angenommen hatte, der den Robert sang, ihn in die Generalprobe am heutigen Morgen zu begleiten. Hermine kannte Wola, der sie zuweilen besuchte, um mit William zu singen, und der als ein sehr gebildeter Mann in viele der ersten Häuser eingeladen ward. Sie mußte William beipflichten, daß es ein ganz unschuldiges Vergnügen war, sich am Abend mit einigen Flaschen Wein für die ihm erwiesene Auszeichnung und Gefälligkeit zu revanchiren. Daß davon noch einige Cameraden Wola’s Etwas abbekommen hatten, war zufällig geschehen.
William schilderte den Kunstgenuß am Morgen mit so glänzenden Farben, er war überhaupt jetzt wieder so ganz der Alte, daß Hermine sich nicht überwinden konnte, ihn heute mit ihren Besorgnissen noch einmal zu verstimmen. Hätte sie gewußt, daß er durch den Besuch der Probe die Kundschaft eines Schiffscapitains eingebüßt, der ihn mehrmals in seinem Comptoir und endlich noch an der Börse vergeblich aufgesucht und der seine Ladung nun einem andern Makler übergeben hatte, wodurch William allein für dies eine Mal mehr als tausend Mark verlor, so würde sie vielleicht dennoch ihren Entschluß verwirklicht haben. So aber gab auch sie sich dem Glücke des Augenblickes hin, und als sie eine Stunde später zusammen in das Bilderzimmer gingen, um die vergessene Lampe auszudrehen, warf sie ihrem Schwiegervater eine Kußhand zu, schlang den Arm um William und sagte: „Er ist wirklich auch heute nicht am Abend ohne mich ausgegangen.“
Man war nun schon in den blätterstreuenden Herbst gekommen, und die Familie Blenheim wollte morgen ihre Stadtwohnung beziehen. Die Börse war beendet, und die Hallen derselben entleerten sich. Der Banquier, ein kleiner dicker Mann mit hochgetragenem Haupte, stützte sich leicht auf den Arm seines Sohnes Eugen, wohl mehr, um ihn mit aus der Stadt zu entführen, als weil er einer Stütze bedurfte, und schritt seiner auf ihn wartenden Equipage zu. Ein stolzes Lächeln glänzte auf Stirn und Mund, und huldreich, hochmüthig oder vertraulich erwiderte er die vielen Begrüßungen, die ihm auf dem kurzen Wege zu Theil wurden. Der Hamburger beugt sich sonst nicht leicht vor einer Größe, mag sie geistiger oder politischer Art sein; aber vor dem Gelde und der Schönheit beugt er sich. Er lebt überhaupt mehr dem Augenblicke, kein Wunder, wenn er dem huldigt, was diesen am meisten zu schmücken vermag, wenn es auch ebenso vergänglich ist.
Der Vergänglichkeit war in der letzten Nacht erst wieder ein Opfer verfallen. Der König der Börse war gestorben, und nicht nur Blenheim selbst, sondern die öffentliche Meinung erhob ihn auf den verlassenen Thron. Zwar trat der Sohn des Verstorbenen in Haus und Firma ein, allein er besaß mehrere Geschwister und nicht das Genie seines Vaters. Blenheim dagegen war in den Büchern der Bank, nach denen der Werth des Kaufmanns abgeschätzt wird, der nächst größte Millionär, und er war noch ein Stamm, während jener reiche Erbe doch nur ein Ast, wenn auch der Hauptast, des gefällten Baumes war.
Mit welchem freudigen Stolze blickte der reiche Mann um sich, und mit welcher Bewunderung, mit welchem Neide blickte die Menge ihm nach! Ein Fürst träumte er sich zu sein, der so eben die Regierung angetreten, als Eugen ihn erinnerte, daß er den einen Fuß auf dem Wagentritt halte, und ihn bat, den andern doch endlich nachzuziehen, damit er und der Bediente, die vergebens bemüht waren, ihm hinaufzuhelfen, die nicht geringe Aufgabe leichter lösen könnten.
„Willst Du nicht mit nach Haus’?“ fragte Blenheim, als Eugen, den Hut lüftend, vom Wagen zurücktrat.
„Ich esse heute bei Reinville,“ war die trockne Antwort, die den ersten Gifttropfen in den Freudenbecher des Vaters fallen ließ, und mit Stirnrunzeln rief dieser dem Kutscher ein herrisches „Fort, nach Haus’!“ zu. Seine Miene hatte Vieles von ihrer stolzen Sicherheit verloren, als der Wagen funkensprühend durch die Straßen zweier großer Städte rasselte, die den Besitzer für den Beneidenswerthesten aller Sterblichen hielten. Aber ach! – –
Von Madame Blenheim konnte man nicht viel mehr sagen, als daß sie – die reiche Madame Blenheim und Mutter zweier Kinder sei, die ihr längst über den Kopf gewachsen waren. Wie ihr Gemahl, hatte sie, was man sagt, „von unten auf“ gedient; sie war Ladenmamsell gewesen, und er hatte sie geheirathet, als er seine Waaren noch mit der Elle maß. Aus der kleinen Bude, worin sie ihr Geschäft eröffneten, hatten sein Genie und ihre Wirthlichkeit sich so weit emporgearbeitet, und aus dem kleinen Krame war jetzt ein weltberühmtes Engros-Geschäft geworden, das der Vater dem Sohne zur Aussteuer versprochen, sobald dieser solide werde und eine vernünftige Heirath schließen würde, wozu Eugen jedoch bis jetzt noch wenig Neigung zeigte.
Seine Tochter Nancy war des Vaters Liebling; für die Mutter war sie eine Plage. An ihrer Erziehung war allerdings nichts gespart, und in ihrem sehr gescheidten Kopfe lagen große Schätze aufgehäuft, aber wirr und bunt durcheinander, und für das Leben fast nichts davon zu gebrauchen. Ihr Vater betete sie an, obgleich auch sie ihm manchen Kummer verursachte. Sie war ihm zu extravagant, sie haßte alle Geldmänner und sah dagegen fast in jedem Künstler und Literaten noch viel mehr, als er selbst in sich fand.
Dieser Eigenthümlichkeit war auch ihre kurze Liaison mit William Almis zuzuschreiben, dessen Tenorstimme sie bezaubert hatte, als sie ihn einst in einem Privatconcerte singen hörte. Seit er sie verlassen, hatten schon ein Portraitmaler, ein Geigenspieler, ein junger Dichter nach einander von ihrem leicht entzündlichen Herzen Besitz genommen, und augenblicklich kämpfte ihr Vater wieder gegen ihre Passion für einen Italiener an, der ein Graf sein sollte, obgleich er gegenwärtig Nancy’s und anderer junger Damen Sprachlehrer war.
Glücklicher Weise ist uns das erhebende Loos zu Theil geworden, in einer Zeit zu leben, in welcher durch das ganze deutsche Volk der Zug nach Einigung lebendiger geht und drängt, in welcher das Volk selbst sich wieder fühlt und seine Bedeutung wie seine Aufgabe zu begreifen beginnt. In diesem wiederauflebenden Volksthume liegt die sicherste Bürgschaft, daß über kurz oder lang
[533][534] der allgemeine Wunsch wirklich in Erfüllung geht, denn das deutsche Volksthum, das sich begreift und überall trotz aller dazwischen angebrachten Klüfte und Schranken als ein verwandtes und gleichheitliches erkennt, wird jene ausfüllen und diese brechen und über ihnen und trotz ihnen zusammenwachsen in das einige Ganze, das es gewesen in allen Zeiten seiner Macht und seines Glanzes. Deshalb ist es für alle Theile von Wichtigkeit und Bedeutung, wenn bei dem einen oder dem andern noch ein Ueberbleibsel, wie eine alte Kostbarkeit, ein Schatzstück entdeckt wird und Zeugniß gibt von jenen glorreichen Tagen volksthümlicher Selbstständigkeit.
Eine solche Kostbarkeit ist das sogenannte Passionsspiel in Oberammergau; es ist sogar eine der kostbarsten Kostbarkeiten, weil es nicht blos ein todtes Schaustück, sondern ein wunderbarer Weise lebendig gebliebenes Stück aus dem alten Volksleben ist. Eine Mittheilung darüber wird daher gewiß den Lesern der Gartenlaube zweifach willkommen sein, denn gerade sie hat vor Allem die Förderung deutschen Sinnes auf ihr Banner geschrieben, und sie werden daher nicht ungern zuhören, wenn ich von der Fahrt nach Ammergau und von dem Passionsspiele berichte.
„Der Passion“ – das Wort ist im Munde der Ammergauer Bevölkerung männlichen Geschlechts – wird nur alle zehn Jahre gespielt; die Nachrichten darüber wirken daher in langer Ueberlieferung fort und machen es durch die wachsende Ausschmückung jeder Ueberlieferung erklärlich, daß mit jedem Jahrzehent das Verlangen und die Neugier und mit ihnen der Andrang von Zuschauern wächst. Man weiß sich so viel von den Schwierigkeiten des Unterkommens zu erzählen, daß ich mir vornahm, schon Tags vorher dort einzutreffen – wollte ich mir doch vor dem Spiele erst Menschen und Ort ein wenig besehen. So eilte ich denn den Tag vor Pfingsten in prachtvoller Morgenfrühe dem Bahnhofe zu, aber leider hatte die Pracht nur zu bald ein Ende; kaum saß man im Wagen, als der Regen zu strömen begann, um nicht mehr zu enden. Man glaubte das aber nicht, sondern sah mit Zuversicht einer günstigen Aenderung entgegen. Unter Wettergesprächen und Regen sauste man Starnberg zu, ohne dem schönen Waldkirchlein zu Maria Eich oder dem romantischen Mühlthal Aufmerksamkeit schenken zu können, denn der Regen benahm die Aussicht bis auf wenige Schritte, und wir betraten trotz des wachsenden Regens das Dampfschiff.
Während der Fahrt über den so lieblichen Würmsee hatten wir Gelegenheit, durch die Cajütenfenster die interessantesten Bilder Grau in Grau zu studiren, und auch als in Seeshaupt das bequeme Dampfschiff gegen einen durchaus nicht bequemen Stellwagen vertauscht war, ergab sich durchaus keine Veranlassung, diese Studien zu unterbrechen. Unter stetem Regen erreichten wir Murnau, schmählich verkürzt um die sonst so anmuthige Fahrt zwischen den Wäldern und kleinen Seen des hügeligen Vorlandes und um den Anblick der dahinter immer näher ansteigenden Gebirgskette; unter stetem Regen fuhren wir auf der Partenkirchner Straße bis Oberau, wo die Straße nach Ammergau rechts abbiegt, schritten mit heldenmüthiger Ergebung durch den Wald, eine tief abstürzende Schlucht entlang, den Ettaler Berg hinan, natürlich im Regen, aber zur angenehmern Abwechslung mit etwas Sturm vermischt, und eilten endlich dem Ettaler Wirthshause zu, dessen bäuerliche Alterthümlichkeit schon darum anheimelte, weil sie Trockenheit und Wärme bot. Der Zufall hatte uns gut zusammengeführt: drei Studenten, darunter zwei Badenser, ein Consul der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Schreiber dieses Berichts – Elemente genug, den Abend angenehm und anregend zu verbringen.
Am andern Morgen machte kurzer Sonnenschein wieder dem beliebten Regen Platz, und nach einem flüchtigen Besuche der Kirche zu Ettal wanderten wir Ammergau zu. Der Weg nach Ammergau ist kurz und bei gutem Wetter sehr angenehm, denn er führt zwischen grünen Bergen dahin, läßt nach links einen Blick in das bereits tyrolische Graswangerthal thun und führt dann am Ufer der Ammer in angenehmer Windung in das Dorf. Ueber dem Flusse und neben ihm steigt ein seltsam geformter Felskegel, der Kofel genannt, empor, wahrscheinlich das einzige Denkzeichen, daß hier das Coveliacae der Römer gestanden, eine Station an ihrer Heerstraße von Verona nach Augsburg. Ueberhaupt wandeln wir auf einem Boden, der reich ist an weit hinaufreichenden geschichtlichen Erinnerungen, die uns aber vom Zwecke abführen würden und von denen wir daher nur die eine erwähnen, daß Ammergau (Villa Ambrigo) es war, wohin im 9. Jahrhundert Ethiko von Welf sich zu klösterlicher Abgeschiedenheit zurückzog, im Grimme darüber, daß sein Sohn sich so weit erniedrigt hatte, Lehensmann des Kaisers zu werden.
Oberammergau liegt in einer angenehmen breiten Thalebene und ist ein freundlicher Ort mit etwa 150 meist gemauerten, freundlich aussehenden Häusern, worin eine Bevölkerung von ungefähr 1000 Seelen wohnt. Schon beim Hindurchwandern zwischen denselben fällt die Sauberkeit der Häuser und noch mehr der Umstand auf, daß die meisten davon mit Zierrathen um Fenster und Thüren, dazwischen auch mit größern biblischen Schildereien im Geschmacke des vorigen Jahrhunderts bemalt sind. Der Beschauer gewahrt alsbald, daß da ein kunstsinniges Völkchen wohne, und findet das durch die Nachricht bestätigt, daß der größte Theil der Einwohnerschaft aus Holzschnitzern besteht, deren Bildwerke einen beträchtlichen Absatz nach allen Himmelsgegenden finden. Die Holzschnitzerei war hier schon zu Anfang des 12. Jahrhunderts in der Blüthe und wurde von hier aus mit Mönchen aus dem nahe gelegenen Kloster Rothenbuch nach Berchtesgaden verpflanzt. Ammergauer Holzschnitzer hatten noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts in diesem Handelszweige weltbekannte Firmen in Petersburg, Kopenhagen, Amsterdam, Cadix und selbst in Lima begründet, wurden aber in Folge ungünstiger Verhältnisse von den Grödnern in Tyrol überflügelt, als gerade damals die Holzschnitzerei auch dort eingeführt worden war und rasch eine fast wunderbare Ausbreitung fand. Jetzt sind dort wie in Ammergau die auswärtigen Firmen eingegangen, und der Betrieb geschieht durch sogenannte Verleger, welche den Schnitzern ihre Arbeiten abnehmen und bezahlen, und dafür den Verkauf besorgen. Beinahe in jedem Hause gewahrt man durch die Fenster die Schnitzbank, an welcher die Millionen von Heiligenfigürchen, Bauernhäuschen, Jägern, Gemsen u. s. w. entstehen, welche auf keinem Markt, wie in keiner Kinderstube fehlen. Ein kleinerer Bruchtheil besteht aus Landwirthen, mit vorwiegendem Betriebe der Viehzucht, aus einer beträchtlichen Anzahl von Gastwirthen und den nöthigen Gewerbsleuten. Es ist ein kräftiger, hochgewachsener und wohlgebildeter Menschenschlag, aus einer glücklichen Mischung von ursprünglich bayerischen, schwäbischen und tyrolischen Elementen entstanden, mit einem angenehm klingenden Dialekt, der ebenfalls diesem Mischcharakter entspricht. Es sind biedere, offene Leute, die den weit hergekommenen Gästen mit freundlicher Herzlichkeit entgegen kommen, und wenn dabei auch Manches auf Rechnung des Gewinnes gehen mag, den der Fremdenbesuch mit sich bringt, so bin ich doch überzeugt, daß der größte Theil der Freude und einem leichten Stolze gilt, ihren Heimathsort und seine Leistungen anerkannt und ausgezeichnet zu sehen.
Als wir das Dorf betraten, war es ziemlich menschenleer; die Einwohner waren noch in der Kirche, und des schlechten Wetters wegen noch nicht viel von fremden Besuchern zu bemerken. Wohlgemuth betraten wir daher ein Wirthshaus, dessen Erkerthürmchen mit einem gastlichen Stern prangte, und waren nicht eben angenehm durch die Mittheilung überrascht, daß weder hier noch anderwärts noch ein Unterkommen zu finden sei. Gleichwohl wußte der Wirth Rath zu schaffen und quartierte uns bei einem jungen Holzschnitzer ein, der uns als Junggeselle sein ganzes wundernettes und freundliches Häuschen förmlich abtrat, und uns mit Aufschluß und Rath aller Art an die Hand ging. Er konnte das, denn er gehörte selbst zum Passionspersonal und zwar zu den Musikern.
Während des Mittagessens, das uns der Sternwirth mit besonderer Artigkeit in seiner Prunk- und Prachtstube auftragen ließ, konnten wir uns überzeugen, wie „der Passion“ in Haus und Familie heimisch ist, denn hinter dem Kasten sahen Spieße und Turbane hervor, und wir erfuhren auch bald, daß die Tochter des Hauses, ein hübsches brünettes Mädchen mit schwarzen Locken, zu dem Sängerchore der Schutzgeister gehöre. So ward denn unsere Neugierde wieder gesteigert, und wir benutzten ein regenfreies Nachmittagsstündchen, um das Theater vorläufig in Augenschein zu nehmen.
Das Theater ist auf einer freien Wiese am Ende des Dorfes zwischen hohen Pappeln aus Bretern aufgebaut, und sieht von außen eben nicht einladender, aber nur bedeutend weitläufiger und solider aus, als offene Buden, wie man sie auf den Jahrmärkten großer Städte sieht. Beim Eintritt aber, den uns ein freundlicher junger Mann bereitwillig verschaffte, macht sich auf den ersten Blick [535] die Eigenthümlichkeit und Ausdehnung des Schauplatzes und der Bühne in überraschender Weise geltend. Man staunt über den wirklich außerordentlichen Umfang des hoch ansteigenden Zuschauerraumes und wird von der ungewöhnlichen Einrichtung des Theaters gefesselt. Dasselbe bildet auf einer etwa mannshohen Estrade zuerst ein Proscenium, das die ganze Breite des Raumes einnimmt und auf beiden Seiten mit Säulenreihen geschlossen ist. Links und rechts in der Tiefe von wohl zwanzig Schuh öffnen sich breite, mit Coulissen von Holz gebildete Straßen, welche, freilich in nicht sehr historischer Architektur, die Straßen von Jerusalem vorstellen und sich im Hintergrunde ringförmig gegen die Mitte wenden. Die Mitte selbst wird von einer ganz nach moderner Weise eingerichteten Bühne eingenommen, mit einem Giebel, in dessen Feld Glaube, Liebe und Hoffnung gemalt sind und mit einer Gardine in Faltenwurf. An jeder Seite der Mittelbühne erhebt sich ein ansehnliches Haus mit Thor und einem Altane vor dem Fenster des ersten Stocks und bildet den Anschluß an die schon erwähnte daneben hinziehende Straße. Die Bühne ist mit äußerster Sorgfalt zusammengeräumt, und nicht das kleinste Requisit läßt erkennen, daß schon Tags darauf eine so große Vorstellung stattfinden soll. Der junge Mann, dessen Freundlichkeit wir den Eintritt verdankten, schloß sich an uns an und wurde uns Führer und Erklärer. Sein sorgfältig gepflegter Bart und das Haar verriethen, daß er zu den Mitspielenden gehöre, und auf mein Befragen gab er sich als den Apostel Matthäus zu erkennen. Von ihm erfuhren wird denn, daß die Gemeinde mit unerbittlicher Strenge daran fest hält, daß die ganze Vorstellung und Alles, was dazu gehört, von Ammergauern ausgeführt und hergestellt wird. Nur wer im Orte geboren ist, kann als Darsteller mitwirken; selbst wer in die Gemeinde hinein heirathet, darf es nicht, sondern muß sich zu einem der zahlreichen Cassier- und Billeteur-Aemter bequemen. Die Zahl der Darsteller beträgt an redenden und singenden Personen 140, mit den nicht sprechenden und unter Einrechnung der Kinder bis hinauf zu den Greisen und Frauen gegen 500. Auch das Orchester besteht aus Ammergauern und ist etwa zwanzig Köpfe stark; Malereien, Anzüge, Alles wird in Ammergau gefertigt, und selbst für die Aufrechthaltung der Ordnung sorgen Ammergauer und bilden mit dem Stutzen über der Schulter eine Art Sicherheitswache. Daraus, daß der Text des Spieles in seiner jetzigen Gestalt sowie die Musik dazu von Ammergauern verfaßt sind, kommen wir noch zurück; wohl aber ist noch zu erwähnen, daß die nicht mitspielenden Ammergauer so bescheiden sind, dem Spiele gar nicht beizuwohnen, um ja den Gästen den Platz nicht wegzunehmen. Für sie ist die Hauptprobe bestimmt, welche ganz wie eine Aufführung abgehalten wird.
Ueber dem Beschauen war es Abend geworden, und bei etwas aufgeklärtem Himmel kehrten wir in das Dorf zurück, das nun eine ganz veränderte Gestalt hatte, denn es wimmelte von Menschen, der Mehrzahl nach Landleute in den verschiedensten Trachten von Tyrol, Bayern, Schwaben und Oesterreich; selbst die Walserthäler, das Etschland und das fernste Niederbayern hatten ihren reichlichen Zuzug gesendet. Trotz des schon vorhandenen Gedränges strömten von beiden Enden noch neue Schaaren und Karawanen herein, zu weitrer Wanderung aufgeschürzt, theilweise wie Wallfahrer gemeinsam betend, mitunter in höchst drolliger Weise unter das von der Weide heimkehrende Hornvieh gemengt. In den Gasthäusern war nirgends mehr Platz; selbst um zu essen und zu trinken, wurden die sonderbarsten Sitzplätze erfunden; zum Nachtlager belebten sich die Heuböden aller Häuser bis in’s Unglaubliche, und Viele waren froh, in einem auf der Straße bleibenden Wagen campiren zu dürfen.
Wie den Abend eine Art Zapfenstreich beschlossen hatte, indem die Musiker des Dorfs dasselbe mit türkischer Musik, einen festlichen Marsch blasend, durchzogen hatten, wurden wir am Morgen durch gleich kriegerische Reveille und Böllerschüsse geweckt. Es war 4 Uhr; der Himmel war während der Nacht spiegelheiter geworden, und in freudigster Stimmung verließen wir unser angenehmes Nachtquartier, um nach kurzem Frühstück der großen Arbeit des Tages entgegen zu gehen, denn so darf man es in gewissem Sinne wohl nennen, einem Schauspiele beizuwohnen, das nahezu zehn Stunden währt. Ich hatte Tags zuvor empfindlich vom Regen und von der Kälte gelitten, und trat also doppelt freudig in den frischen, Heiterkeit und Wärme verheißenden Morgen hinaus, aber – beim ersten Schritt erblickte ich ein Paar mächtige Regenwürmer, die sich gemächlich am Boden hinzogen. Mir fiel eine alte Wetterprophezeiung ein, besorgt sah ich um mich und erhielt auf Befragen den wenig tröstlichen Bescheid, daß das Wetter nicht verlässig sei, denn noch gehe der „untere oder schwäbische Wind“.
Kurz nach sechs Uhr saßen wir schon im Theater und keineswegs zu früh, denn obwohl die Aufführung erst um 8 Uhr begann, war das Haus schon in allen Theilen gefüllt und bot ein festliches, man kann sagen großartiges Bild mit der Bühne, über welche hinaus man die Berge, Dorf und Kirche von Unterammergau, und zur linken Hand den abenteuerlichen Felskegel des Kofel erblickte. Die Spannung wuchs, denn die unverkennbare Andacht, mit welcher der größte Theil der so weit herzugewanderten Zuschauer dem Beginne entgegensah, ließ erkennen, daß man etwas zu erwarten hatte, was mit unsern modernen Schauspielen nicht zu vergleichen ist. Leider zogen über Unterammergau bald immer dichtere und dichtere graue Wolken herein, es ward trübe und kalt, und das Spiel hatte nur kurze Zeit begonnen, als der Regen wieder anfing. Die verwünschten Regenwürmer hatten also doch Recht behalten!
Die Vorstellung wird von einer Ouverture eingeleitet, die eine weiche, fast wehmüthige Stimmung athmet und recht gut ausgeführt wurde, wenn auch die Tonmasse für den ungeheuren, unbedeckten Raum etwas dünn ist. Ihr Ende ist das Zeichen zum Auftreten der Schutzgeister, eines Chors, der singend und theilweise auch sprechend zur Erklärung und Betrachtung eingeflochten ist. Die ganze Vorstellung besteht nämlich aus drei vereinigten Theilen unsres modernen Bühnenwesens: sie ist Oper in den Arien, Duetten und Gesammtgesängen des Chors; sie ist Schauspiel in den gesprochenen Scenen der eigentlichen Handlung; und sie ist, so zu sagen, reine Mimik in den zwischen die Vorträge des Chors und die dramatischen Scenen eingeflochtenen lebenden Bildern aus der Geschichte des alten Testaments, welche deshalb angebracht sind, um deren innern allegorischen und prophetischen Zusammenhang mit der Passion zu zeigen. Der Chor der Schutzgeister besteht aus acht Sängern, acht Sängerinnen und einem Führer, welcher der Prolog heißt; er kommt in zwei Hälften hinter den Säulen des Prosceniums hervor, wobei sie einzeln hintereinander gehn und dann, nachdem sie sich gewendet, eine Reihe längs des Prosceniums bilden. In der Mitte steht der Prolog, die Uebrigen folgen nach der Größe, sodaß die kleinsten an die äußern Enden zu stehen kommen. Der Anzug der Schutzgeister besteht in einer langen weiten Tunika von rother, grüner oder blauer, immer sehr lebhafter Farbe; darüber fällt bis an die Kniee eine Art Spitzen-Ueberwurf mit Aermeln, einem Chorhemd ähnlich, und den Schluß bildet ein weiter Mantel, ebenfalls von einer der genannten Farben, immer aber von der des Unterkleides verschieden. Auf dem gescheitelten und in Locken getheilten Kopfe sitzt ein goldenes Stirnband.
Während des einleitenden Gesanges, der an das Opfer Abrahams auf Moria erinnert, tritt der Chor zurück, sodaß er die Mittelbühne frei werden läßt und sich zu beiden Seiten derselben wie ein schiefes Spalier aufstellt. Der Vorhang geht auf, und man erblickt als erstes lebendes Bild die durch den Engel unterbrochene Opferung Isaaks, während im Hintergrunde Adam und Eva aus dem verlorenen Paradiese fliehen. Der Chor nimmt dann wieder seine Reihenstellung ein, und das Hin- und Zurückgehen geschieht auf schwarzen Strichen, die auf dem Boden gezeichnet sind und radienförmig auseinanderlaufen. Durch die Einhaltung dieser Linien wird beim Zurückgehen das Umwenden erspart und überhaupt jede Hast, jede Unruhe, jedes Drängen vermieden, und die Bewegung nimmt einen vom gewöhnlichen Gange verschiedenen abgemessenen und würdigen Charakter an. Nach Beendigung seines Gesangs kehrt der Chor in derselben Weise, wie er aufgetreten, in die Säulen des Prosceniums zurück; und die erste Abtheilung des Schauspiels (es sind deren drei, welche wie der in je sieben und drei Vorstellungen zerfallen) beginnt.
Die erste Vorstellung stellt den Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag dar und bildet zugleich eines der großartigsten Bilder des Ganzen. Schon hinter der Bühne hört man den Jubel und Gesang des Volkes; der Zug erscheint auf der hierzu verwandelten Mittelbühne, bewegt sich quer über dieselbe, um in die eine Seitenstraße einzumünden und dann aus der entgegengesetzten Seite wieder zum Vorschein zu kommen, sodaß man Anfang, Mittel und Ende auf den vier gleichzeitig benutzten Schauplätzen [536] gleichzeitig übersieht. In Mitte des jubelnden und singenden Volks, der Kinder mit den Palmen, über den von den Männern ausgebreiteten Mänteln erscheint Christus, auf dem Eselsfüllen sitzend – eine wirklich edle Gestalt, der Ruhepunkt des so lebendig durcheinander fluthenden und sich doch nie verwirrenden Bildes. Die Anordnung ist scheinbar völlig kunstlos, verräth aber dem kundigen Auge nur zu wohl, welche Feinheit des Plans, welch’ pünktliche Genauigkeit der Ausführung dabei zu Grunde liegt. Man fühlt, daß das nicht blos eingelernt und eingeübt, sondern gewissermaßen natürlich entstanden und geworden ist, und man begreift, warum alle Aufzüge unsrer Bühnen davor zurückbleiben, weil man Schauspielern oder vielmehr Statisten von Fach einen wie hier zu Grunde liegenden gemeinsamen Aufschwung nicht geben und es ihnen auch kaum verdenken kann, wenn ihnen das, was hier das Landvolk alle zehn Jahre thut, was sie aber fast täglich thun müssen, mehr oder minder zum Geschäft wird. Man kann den Gesammteindruck nicht besser bezeichnen, als wenn man das Bild mit einem riesigen mittelalterlichen Glasgemälde vergleicht, das Stimme und Bewegung erhalten hat. Damit stimmt Stellung, Haltung, der Schnitt der Gewänder und ihre Farbenpracht ebenfalls überein.
Wir mußten bei dieser Scene ausführlicher verweilen, um mindestens eine derselben eingehender zu besprechen, da der Raum nicht gestattet, auf alle so einzugehen, wie sie zum größten Theile es wohl verdienten.
Bei der folgenden Scene zeigt sich der Vortheil der ganzen Bühneneinrichtung auf’s Glänzendste, denn einfach durch Verwandlung der Mittelbühne werden wir mit sammt dem ganzen Volke in die Straßen vor dem Tempel versetzt und sehen unter den Säulen der Vorhalle die Käufer und Verkäufer in sehr lebhafter Gruppe. Christus vertreibt sie, ganz wie es die Bibel erzählt, und macht sich dadurch die Kaufleute zu Feinden, die von da an auf sein Verderben sinnen. Mit seiner Rückkehr nach Bethanien schließt die erste Vorstellung. In der zweiten sehen wir während des Chorgesangs als lebendes Bild aus der alttestamentlichen Vorgeschichte die Söhne Jakobs, wie sie beschließen, ihren Bruder Joseph aus dem Wege zu räumen. Die darauf folgende Handlung führt uns in den innern Tempelraum in die Versammlung der Hohenpriester und Schriftgelehrten, welche darüber Rath halten, wie sie Christum in ihre Gewalt bekommen können. Sie bedienen sich dazu der wüthenden Krämer, die von einem unzufriedenen Jünger desselben sprechen und diesen zum Werkzeug gebrauchen wollen. Die Scene, im Dialog etwas matt und gedehnt, belebt sich durch das Feuer der Redenden und Spielenden, und ist ein hübsches Bild, lebhaft an jenen alten bemalten Holzschnitt erinnernd, welcher häufig an Thüren der Häuser im Gebirge angeklebt ist und diese Versammlung vorstellt, wobei zu den Füßen einer jeden Gestalt sich eine Art von Zettel befindet, worauf die von ihm abgegebene Abstimmung enthalten ist.
In der dritten Vorstellung, eingeleitet durch die Bilder, wie Tobias von seinen Eltern Abschied nimmt, und die Klage der Braut (aus dem Hohen Liede), schreitet die Handlung bis zu dem Mahle fort, wobei Magdalena dem Herrn die Füße salbt, während Martha bei Tische aufwartet, und Judas über die Verschwendung der Salbe, welche dreihundert Denare kostet, und über die Ungewißheit seiner künftigen Existenzmittel in Unmuth geräth. Christus nimmt dann einfachen, aber ergreifenden Abschied von seiner Mutter und den Freunden, um den verhängnißvollen Gang nach Jerusalem anzutreten. In dem die Bilder begleitenden Chorgesange zeichnet sich das Klageduett bei dem zweiten durch Einfachheit und Innigkeit aus. Der vierten Vorstellung geht das Bild von der Verstoßung Vasthi’s und Esther’s Erhöhung voraus; sie enthält die Wanderung nach Jerusalem, die Voraussendung der beiden Jünger, welche das Osterlamm bereiten sollen, und Judas’ wachsenden Seelenkampf. Die Krämer suchen ihn und bringen ihn durch das Versprechen reicher Geldbelohnung dazu, daß er in eine weitere Zusammenkunft willigt.
Von den der fünften Vorstellung vorausgehenden Bildern, die Speisung in der Wüste durch Manna und die Ueberbringung der großen Trauben aus Canaan, gehört das Erstere zu den gelungensten dieser Darstellungen, allerdings nicht in dem Sinne, wie man gewöhnlich lebende Bilder stellt, aber so, daß man ein mittelalterliches belebtes Altarbild zu sehen glaubt. Das Zusammendrängen so großer Massen in einem kleinen Rahmen, daß sie Kopf an Kopf ansteigen, ist gerade für diese sehr bezeichnend, und gerade in dieser Art der Aufstellung hat die Ueberlieferung unzweifelhaft das Alte am meisten erhalten. Ueber dem ganzen höchst figurenreichen Bilde, das von kleinern Kindern im Vorgrunde zu größeren hinter ihnen, dann zu Frauen und Mädchen und Männern aufsteigt, während Moses und Aaron im Vorgrunde stehen, fällt das Manna herab in Form eines silberblitzenden Regens, der von Allen in verschiedenen Arten und Gruppen aufgefangen wird. Daran reiht sich das Ostermahl mit der Fußwaschung und Einsetzung des Abendmahls in höchst feierlicher und bibelgetreuer Weise. – Die sechste Vorstellung bringt nach dem Bilde, wie die Söhne Jakobs ihren Bruder verkaufen, die Scene, wie Judas vor dem Synedrium verspricht, ihnen Jesum auszuliefern, wogegen ihm die gierig an sich gerissenen 30 Silberlinge aufgezählt werden. Das die siebente Vorstellung einleitende Bild, wie Adam sein Brod im Schweiße seines Angesichts essen muß, halten wir für das beste lebende Bild, seiner Einfachheit und malerischen Gruppirung wegen. Adam, völlig nackt, nur mit einem Lammfell um die Hüften, steht in der Mitte der kümmerlich gehaltenen Landschaft, den einen Fuß auf die Grabschaufel gestützt und das Antlitz in den Händen verbergend, während vor und neben ihm reizende Kinder spielen und etwas seitwärts im Hintergrunde Eva, ebenfalls mit einer Arbeit beschäftigt, sorgenvoll nach ihm blickt. Nach zwei weitern Bildern, die verrätherische Ermordung Amasa’s durch Joab und die Ueberwältigung Simsons, folgt die Scene am Oelberg, Judas’ Verrath und die Gefangennehmung Jesu, natürlich nicht ohne die Verwundung und Heilung des Malchus.
Vor Beginn der zweiten Abtheilung wird gewöhnlich eine Pause von einer Stunde gemacht; wir mußten darauf und auf das bestellte Mittagsmahl verzichten, denn der Prolog verkündigte, daß des schlechten Wetters wegen ohne Pause fortgespielt werde. Gegen diesen Grund war auch nichts einzuwenden, denn nach langem Zögern und Schwanken hatte sich der Himmel wieder für Regen entschieden, der unaufhörlich bald schwächer bald stärker floß, nicht ohne manchen heitern und naturwüchsigen Vorfall zu veranlassen. Das Herkommen duldet weder Hut noch Regenschirm, um die dahinter Sitzenden nicht in der Aussicht zu behindern; die Zuschauer mußten also Regen und Sonne schutzlos über sich ergehen lassen, und die hie und da auftauchenden Versuche, einen Regenschirm aufzuspannen, wurden von den Stöcken der Hinterleute auf ebenso kurze als nicht mißzuverstehende Weise gründlich beseitigt. Als das Unwetter gar arg wurde, halfen sich die letzten im Regen sitzenden Reihen sehr einfach dadurch, daß sie über die Schranke des hinter ihnen befindlichen und mit einer Plane überspannten Logenplatzes stiegen und in unbefangenster Weise neben dem päpstlichen Nuntius und andern vornehmen Leuten Platz nahmen, was während einer Pause von einigen Minuten ein höchst komisches Intermezzo gab. Zur Ehre der Eindringlinge aber sei es auch gesagt, daß, als der Regen wieder ein wenig nachließ, eine einfache Mahnung der Ammergauer Wache genügte, um sie auf demselben Wege zum Rückzuge zu veranlassen. Die Darstellenden hatten indeß Regen und Wind über sich ergehen lassen; nur als es gar zu grob anfing, entschlossen sich die Schutzgeister in aller Kürze und erschienen, wohl zur Schonung der reichen, durchaus neuen Gewänder, mit – Parapluies.
Die zweite Abtheilung umfaßt die Vorstellung Jesu vor dem Hohenpriester Hannas, welche auf dem rechts liegenden der schon erwähnten Balcone vor sich geht, mit dem Vorbilde, wie der Propbet Micha mißhandelt wird, weil er die Wahrheit gesagt hat; dann die Vorführung vor Kaiphas mit der Verurtheilung Naboth’s und der Verspottung Hiobs als Vorbildern; die Verhandlung vor Pilatus, der Christus für schuldlos erklärt und ihn zu Herodes führen läßt, mit dem Vorbilde Daniels, der in die Löwengrube geworfen wird. Dieser Scene, welche auf dem gegenüberliegenden Balcone vorgeht, folgt die Verspottung durch Herodes, eingeleitet durch das Vorbild, wie König Hanon die Abgeordneten Davids beschimpft; dann die wiederholte Vorführung vor Pilatus, die Geißelung und Dornenkrönung. Es liegt in der unvermeidlichen Gleichförmigkeit oder Aehnlichkeit der Vorgänge, daß dieser Theil an einiger Eintönigkeit und Länge leidet; desto mächtiger ist dagegen die Erhebung gegen den Schluß, wie Pilatus den gegeißelten und gekrönten Christus dem Volke von dem Altane zeigt, wie der trefflich gezeichnete und trefflich gespielte Römer die Wuth dieses Volkes gegen einen Mann nicht begreift, dem es erst wenige Tage zuvor mit Hosiannah entgegen gejauchzt, wie er ihnen die [537] Wahl läßt zwischen Christus und Barabbas, und wie die wüthende, von den Priestern gehetzte Menge die Freilassung des Letztern verlangt. Diese Scene, in welcher sich auch der Chor gewissermaßen handelnd einmischt, hat einen ungeheuren Schwung und eine Gewalt, die jede Vergleichung unzureichend erscheinen läßt.
Vor das Erscheinen bei Pilatus ist eine Scene eingeschoben, in welcher Judas verzweifelnd vor dem Synedrium erscheint, das Geld hinwirft und verhöhnt von hinnen eilt. Die Mittelbühne verwandelt sich rasch in eine wilde Gegend, Judas stürzt herein, reißt nach einem kurzen energischen Selbstgespräch den Gürtel vom Leibe, knüpft ihn an den Ast eines freistehenden Baumes, legt sich die Schlinge um den Hals, springt weg und – wird im Moment vom fallenden Vorhange den Augen entzogen.
Die Handwerker waren bekanntlich schon im Mittelalter freie Leute, und hatten daher eine innere Organisation, die ihren höchsten und gleichsam staatlichen Ausdruck in den Zünften fand. Allein dem aristokratischen und particulären Grundzuge jener Zeit gemäß waren die Zünfte nur Verbände für die selbstständigen, ansässigen Meister in jeder einzelnen Stadt. Wie gegen die Consumenten und auswärtigen Producenten, so waren sie auch gegen die Gesellen gerichtet, deren Lohn es niedrig zu halten galt. Aber die Gesellen, wenn auch vielfach belästigt und am Meisterwerden behindert, hatten doch eine ganz andere Stellung den Meistern gegenüber, als die Bauern gegen ihre Grundherren. Sie waren nicht nur in keinem Unterthänigkeits-Verhältniß, sondern sie konnten sich auch durch die Leichtigkeit des Wanderns der Ausbeutung von Seiten der Meister entziehen. Hauptsächlich aus dem Bedürfniß des Wanderns entsprang nun schon sehr frühzeitig eine Verbrüderung unter den Handwerksgesellen, der Compagnonnage, diejenige der gesellschaftlichen Institutionen aus dem Mittelalter, die sich von allen am festesten und reinsten erhalten. Obgleich in nahem Zusammenhange mit den Zünften, als deren Grundlage und Gegengewicht man sie zugleich bezeichnen kann, – hat sie sich dennoch sowohl den unzähligen Eingriffen der absoluten Monarchie, als dem Vernichtungsschlage der Revolution durchaus entzogen. Da sie keine Vorrechte nach außen in Anspruch nahm, so bot sie weder den Königen einen Anlaß zur Erpressung, noch den Demokraten einen Grund zur Aufhebung.
Aber dieselbe Unscheinbarkeit, welcher der Compagnonnage (den ich von jetzt an immer mit „Brüderschaft“ bezeichnen werde, so wie „Compagnons“ mit Genossen) seinen ungestörten Bestand durch die Jahrhunderte verdankt, hat ihn auch den Blicken der wissenschaftlichen Beobachter bis in die neueste Zeit entzogen. Eine Institution, die seit fünfhundert Jahren den größten Theil der französischen Handwerker in seinem wahren Lebenselemente beherrscht und wirklich einen Staat im Staate bildet, mit eigner Verfassung, Gerichtsbarkeit, Finanz- und Fehdegewalt – eine solche Institution wurde erst vor noch nicht zwanzig Jahren dem gebildeten Frankreich bekannt gemacht, und zwar durch einen einfachen Tischlergesellen aus Avignon, Agricole Perdiguier. Dieser tugendhafte und begeisterte Mann bezweckte eine Reform der Brüderschaft, und es gelang ihm wenigstens, mehrere angesehene Publicisten zu interessiren. Der Gegenstand veranlaßte unter anderm George Sand zu einem wohlgemeinten, doch etwas sentimentalen Romane „Le compagnon du tour de France“. Die Oekonomisten und Socialisten aber faßten selbst in Frankreich die Sache lange nicht mit dem Ernste und der Wichtigkeit auf, welche sie im höchsten Grade verdiente. In Deutschland ist sie ganz unbeachtet geblieben, und ich glaube daher eine empfindliche Lücke auszufüllen, wenn ich nach eignen Beobachtungen während einer Reise durch Frankreich, sowie nach dem vorhandenen, freilich sehr kärglichen Material eine getreue Schilderung und Beleuchtung des Compagnonnage unternehme.
Die Brüderschaft besteht aus einer großen Anzahl von Verbindungen unter Handwerksgesellen, die sich theils nach den vermeintlichen Gründen, theils nach den Gewerken scheiden. Aber niemals, und das ist sehr bezeichnend für die frühe National-Einheit der Franzosen, gehen sie nach Provinzen oder auch nur größeren Landestheilen auseinander, sondern umfassen sämmtlich ganz Frankreich, stehen dagegen mit dem Ausland in gar keiner Berührung. Es ist ferner ganz französisch, daß sie trotz der uralten und bittern Feindschaft, die zwischen ihnen besteht, in allem Wesentlichen übereinstimmen. Sie sind sehr enge Verbindungen für’s ganze Leben, bezwecken gegenseitige Unterstützung und Förderung jeder Art, besonders auch gesellige Zusammenkünfte, und hüllen sich in heimliche Ceremonien und Gebräuche. Der Eintritt ist freiwillig und erfordert eine, wie es scheint, ziemlich lange Probezeit.
Die sämmtlichen „Compagnons“ (Genossen) zerfallen zunächst in zwei Hauptclassen, die Compagnons du devoir (Genossen des Pflichtbundes) und die Compagnons de liberté (Genossen der Freiheit.) Innerhalb der ersteren besteht die Scheidung in „Enfants de Maître Jacques“ (Kinder des Meister Jacques) und „Enfants de Maître Soubise“ (Kinder des Meister Soubise), während die Genossen der Freiheit ausschließlich „Enfants de Salomon“ (Kinder Salomons) sind. Alle drei Verbindungen leiten nämlich ihren Ursprung nicht weiter her, als vom ersten Tempelbau zu Jerusalem. Unter den Handwerkern, welche mit dem phönicischen Baumeister Hiram den Tempel Salomonis erbauten, waren, so lautet die Ueberlieferung, auch zwei Meister aus Frankreich, Jacques, der Steinmetz, und Soubise, der Zimmermann. Um unter einem so großen Haufen Ordnung und Eintracht zu erhalten, hatte der weise Meister Hiram bestimmte Classen mit eigenthümlichen Gebräuchen und Losungsworten eingeführt. Aus der Ueberlieferung der Freimaurer ist bekannt, daß er der letzteren Einrichtung zum Opfer fiel: Gesellen, die von ihm das Losungswort der Meister erzwingen wollten, um höheren Lohn zu erhalten, erschlugen ihn bei Nacht und verschwanden in den Wäldern. Nach Vollendung des Tempels schifften Meister Jacques und Soubise nach ihrer Heimath zurück; der Erstere landete zu Marseille, der Letztere zu Bordeaux, wo sie nach dem Muster Hiram’s Verbindungen der Gesellen ihres Handwerks gründeten. Es konnte nicht anders sein, als daß diese weise und heilsame Einrichtung sich nicht nur erhielt, sondern über ganz Frankreich ausbreitete, und nach und nach außer den ursprünglichen Gewerken der Steinmetze und Zimmerleute sehr viele andere umfaßte. Meister Jacques und Soubise waren aber trotz der Landsmannschaft und des gemeinsamen Tempelbaus einander feindlich gesinnt; kein Wunder, daß sie mit ihrer Weisheit und Tugend auch ihren Haß den Schülern hinterließen. Er besteht noch heutzutage ziemlich ungeschwächt, und die Veranlassung, die ihn immer wieder anfacht, ist der Streit um das höhere Alter der Verbindung. Mit wahrhaft liebenswürdiger Naivetät datiren nämlich die Steinmetze ihre Gründung vom Jahre 558 vor Chr., die Gründung der Zimmerleute dagegen vom Jahre 550 nach Chr., und verlangen demnach für sich den entschiedensten Vortritt, als Erstgeborene von 1100 Jahren. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die Zimmerleute ihrerseits die allein Vorchristlichen sein wollen. Beide Parteien geben vor, Urkunden über ihre Entstehung zu besitzen, nur sind diese noch niemals zum Vorschein gekommen.
Die Eifersucht der beiden Abtheilungen der Genossen des Pflichtbundes, so stark sie auch sein mag, tritt jedoch weit zurück im Vergleich mit dem Hasse beider gegen die Genossen der Freiheit. Streiten sich die Steinmetze und Zimmerleute um das Alter und den Rang, so lassen sie sich doch die volle Ehre des rechtmäßigen Bestandes. Die Genossen der Freiheit aber gelten ihnen für anmaßende Empörer, für die Abkömmlinge jener Gesellen, die den Hiram freventlich erschlagen. Die Genossen der Freiheit werfen [538] nicht nur diesen Vorwurf auf ihre Gegner zurück, sondern sie halten sich für die älteste und ehrwürdigste Gesellschaft, als gegründet vom weisen König Salomon selber. Sie begreifen nur vier Gewerke in sich, die Steinmetze, Zimmerleute, Tischler und Schlosser, also die ersten und hauptsächlichen Bauhandwerker, und zwar besteht keine Eifersucht unter ihnen, wie unter den verschiedenen Gewerken der Genossen des Pflichtbundes. Diese letzteren umfassen im Ganzen achtundzwanzig Handwerke; davon sind drei, die Zimmerleute, Dachdecker und Gypser (plâtriers), Kinder des Meister Soubise; die übrigen, voran die Steinmetze, Tischler und Schlosser, Kinder des Meister Jacques. Herr Sciandro gibt in seinem Werkchen über die Brüderschaft eine vollständige Liste der verschiedenen Handwerksverbindungen des Pflichtbundes, nach den Aufzeichnungen der Steinmetze, zu denen er selber gehört. Sie sind nach dem Jahre ihrer Gründung geordnet, wie folgt: vor Christo 558 Steinmetze, nach Christo 550 Zimmerleute, 570 Tischler, 570 Schlosser, 1330 Gerber, 1338 Färber, 1407 Seiler, 1409 Korbmacher, 1410 Hutmacher, 1500 Schmal- und Sämischgerber, 1601 Gelbgießer, 1603 Nadler (dies Corps soll nicht mehr bestehen), 1609 Schmiede, 1700 Tuchscheerer, 1700 Drechsler, 1701 Glaser (gegründet durch die Tischler), 1702 Sattler, 1702 Poêliers (heißt zugleich Pfannenschmiede und Ofenmacher), den Gießern zugesellt, 1702 Hobler, gegründet durch die Tischler, 1703 Messerschmiede, den Gießern zugesellt, 1703 Blechschmiede, desgleichen, 1706 Kummetmacher, gegründet durch die Sattler, 1706 Stellmacher, gegründet durch die Schmiede, 1758 Nagelschmiede, gegründet durch die Hutmacher, 1759 Dachdecker, gegründet durch die Zimmerleute, 1775 Leinenhändler, 1797 Gypser, gegründet durch die Zimmerleute, 1795 Hufschmiede.[1]
Außer diesen 28 anerkannten Handwerken, und nach ihnen, haben sich die Schuster, die Bäcker, die Holzschuhmacher, die Ferrandinweber und sogar die Winzer von Burgund als Brüderschaft constituirt; allein sie sind von keinem ursprünglichen Corps anerkannt und leben in der vollständigsten Vereinzelung. Nur die Holzschuhmacher sind von einem älteren Corps, den Korbmachern, gegründet, und diese wollen sie von den übrigen Corps anerkannt wissen.
Inwieweit diese Liste, selbst abgesehen von den Gründungsjahren der vier ersten Handwerke, Glaubwürdigkeit verdient, wage ich nicht zu bestimmen, da es mir an allen andern Daten fehlt. Höchst auffallend ist jedenfalls diese langsame Verbreitung der Brüderschaft durch fünf Jahrhunderte; man sollte meinen, daß eine so nützliche und lockende Einrichtung sehr schnell alle bedeutenderen Gewerke ergreifen mußte. Die hauptsächliche Schuld mag wohl an der Eifersucht und Ausschließlichkeit der ursprünglichen Corps liegen, die ja noch heutzutage in der Nichtanerkennung der letztgebildeten Verbindungen stark genug hervortritt. Die vier Bauhandwerke betrachten sich noch immer als die bei weitem vornehmsten; die Schuster und Bäcker dagegen werden von allen übrigen wie Parias verachtet und auf jede Weise verhöhnt und verfolgt. Man sieht, wie tief noch immer, trotz „Gleichheit und Brüderlichkeit“, die Standesunterschiede selbst in den untersten Classen des französischen Volkes wurzeln. Den armen Schustern und Bäckern wird vorgeworfen, daß ihre Handwerke roh und gemein seien, und keine Geschicklichkeit erheischen. Vor allem aber wird es ihnen verdacht, daß sie sich „Compagnons“ nennen. Die gelehrten Leute leiten nämlich dies Wort von „compas“, d. i. Zirkel ab, und der Zirkel dient ihnen in der That als Insignie und Waffe zugleich. Die Verfolgungen wegen dieser lächerlichen Vorurtheile gehen so weit, daß die Bäcker z. B. das Stockfechten Tag und Nacht üben müssen, um ihres Lebens gegen die große Mehrzahl ihrer Feinde sicher zu sein. – Aber die gegenseitige Feindseligkeit, die allen mittelalterlichen Corporationen unauslöschlich innezuwohnen scheint (man denke nur an die deutschen Studenten-Verbindungen), herrscht selbst innerhalb der anerkannten Corps der Kinder des Meister Jacques. So verweisen die Steinmetze die Corps der Tischler und Schlosser dem Alter und Range nach unter das der Gerber, wogegen alle Wahrscheinlichkeit spricht, und erzeugen durch diese Ungerechtigkeit beständigen Hader.
Die Apostel der Freiheit und Gleichheit, die über fünfzig Jahre die Tribüne und die Presse von Paris von glänzenden Tiraden haben ertönen lassen, hätten vielleicht mehr und dauernder gewirkt, wenn sie statt dessen zuweilen in die Wohnungen und Herbergen der Arbeiter hinabgestiegen wären und diese Verblendeten über ihre wahren Interessen aufgeklärt hätten. Sie würden dann zu ihrem Erstaunen gefunden haben, daß ungeachtet der feierlichen und wiederholten Aufhebung aller Monopole mitten in der „Hauptstadt der Intelligenz“ die großartigste Gewerbsbeschränkung fortbesteht. Und zwar keineswegs zu Gunsten reicher, gewichtiger Unternehmer – wenigstens ergibt sie sich bei diesen mehr durch die Macht der Umstände – sondern zu Gunsten gewisser Corporationen des niedern Volkes, desselben, das von jenen Rednern als der Typus der Gleichheit und Brüderlichkeit betrachtet wird. Für die Zimmergesellen, etwa 4500 an der Zahl, trennt die Seine Paris in zwei abgeschlossene Reiche; auf dem rechten Ufer herrschen die Kinder von Soubise, auf dem linken die Kinder von Salomon. Mag auf dem rechten Ufer der Mangel an Arbeitern noch so groß sein, die „Genossen der Freiheit“ dürfen ihre Dienste dort nicht anbieten. Nur in den abgelegensten Stadttheilen kommt es vor, daß beide Parteien auf einem Zimmerhof arbeiten. Diese originelle Scheidung ist aber noch keineswegs das Schlimmste; im Gegentheil, sie ist das Ergebniß einer Verständigung und sicherlich erst nach langen, blutigen Kämpfen erreicht. Die Zimmergesellen, besonders die in Paris arbeiten, sind aber noch die Gebildetsten; die Steinmetze sind noch nicht so weit gekommen, sie liegen sich beständig in den Haaren.
Aus vielen Provinzialstädten aber, selbst aus dem großen Lyon, hat eine Partei die andere vollständig und für immer vertrieben. Dies geht folgendermaßen zu. Können sich die beiden Abtheilungen der Brüderschaft in einer Stadt durchaus nicht vertragen, so berufen beide, oder auch nur die eine von ihnen, alle Genossen aus den benachbarten Städten zusammen. Dann wird, entweder offen, oder durch Ueberfall, um die ausschließliche Herrschaft in der betreffenden Stadt gekämpft; und die besiegten Montecchi müssen vor den siegreichen Capuletti das Weichbild auf immer meiden. Ja, mitunter steigern sich diese Gefechte zu wahren Feldschlachten. Noch heute feiern beide Parteien die große Schlacht in der Ebene Crau, zwischen Arles und Salon, im Jahre 1730 (L. Say). Schaaren von Gesellen marschirten aus Marseille, Avignon, Montpellier, Nismes, und kamen am verabredeten Tage und Platze an; sie waren mit Zirkeln, Stöcken und Feuerwaffen gerüstet; das Handgemenge war lang und schrecklich, das Blut floß in Strömen, und Leichname in großer Zahl blieben auf der Wahlstatt. Eine ähnliche Scene ereignete sich 1816 zwischen Vergère und Muse, zwei kleinen Weilern in der Nähe von Lunel, veranlaßt durch die Eifersucht der Steinmetze. Zwanzig Meilen aus der Runde kamen die Krieger zusammen; und ein gewisser Sans-Façon von Grenoble, seit kurzem aus der kaiserlichen Garde entlassen, soll die Seinen mit einer Mistgabel zur Tapferkeit angetrieben haben. Es existiren eine Menge Gesänge, in denen die Barden der Brüderschaft ihre Siege verherrlichen; wobei das Komische ist, daß beide Parteien dieselben anstimmen, nur mit Veränderung der Namen und Attribute, welche für jede Partei feststehend sind.
Von 1825–42 berichtet Herr Egron in seinem Buche: „Le livre des ouvriers“ zehn Fälle von Tödtungen unter „Genossen“, und was das Schlimmste ist, diese Tödtungen sind zum Theil höchst schmachvoll, durch große Ueberzahl oder Hinterlist. Die bei weitem meisten davon sind im Rhone-Gebiet vorgefallen, in derselben Gegend also, wo seit den Zeiten der Albigenser die Religions- und Bürgerkriege stets am heftigsten gewüthet, und wo noch heutzutage die Katholiken und Protestanten einander feindlich gegenüberstehen.
Ein letztes Element des Zwiespalts liegt in dem Verhältniß der „Genossen“ zu den „Aspiranten“. Wenn sich ein junger Gesell der Brüderschaft anschließen will, so wird er nicht sogleich für würdig gehalten, in die vollen Rechte und Mysterien eingeweiht zu werden. Er muß eine Zeit lang Aspirant bleiben und mit seinen Schicksalsgefährten eine besondere, untere Classe der Verbindung bilden. Diese Aspiranten heißen bei den Steinmetzen Jeunes-Hommes (Junggesellen), bei den Tischlern und Schlossern Affiliés (Zugewandte), bei den Zimmerleuten endlich Renards (Füchse), eine höchst merkwürdige Uebereinstimmung mit den deutschen Studentenverbindungen. Wie bei den deutschen Studenten, so werden auch bei den französischen Gesellen die Füchse auf alle [539] Weise geneckt, heruntergemacht, ja sogar mißhandelt. Vor nicht gar langer Zeit ward es in einer großen Stadt (wahrscheinlich Paris) den Füchsen der Zimmergesellen zu arg; sie verlangten, in Zukunft wie freie Männer, und nicht wie Sclaven von ihren älteren Genossen behandelt zu werden. Und als diese, gestützt auf den uralten Brauch, nicht nachgeben wollten, erkühnten sich die Füchse, eine eigene Gesellschaft zu bilden, unter dem Schutze Salomons, und nannten sich Compagnons Renards de Liberté (Genossen Füchse der Freiheit). Sie sollen jetzt in Paris ebenso zahlreich sein, wie ihre Gegner, die Bon-Drilles (Guten Kerle). So wenigstens berichtet der sachkundige Sciandro. Es ist nur eine consequente Inconsequenz, daß diese Gesellschaft früherer Aspiranten jetzt selbst wieder eine Aspiranten-Classe unter sich hat, und es fragt sich sehr, ob sie dieselben nicht ebenso schlecht behandeln, wie sie einst von den „Guten Kerlen“ behandelt wurden.
So zerfallen denn die vier ersten Corps der Brüderschaft in nicht weniger als 18 gesonderte Gesellschaften, welche die verschiedensten und sonderbarsten Namen tragen. Die allgemeine Benennung Devoir (Pflichtbund) für Gesellen-Verbindung findet ihre Erklärung leicht in den Pflichten, welche den Genossen gegen einander obliegen. Auch die Kinder Salomons bilden ein Devoir, aber mit dem Zusatz de liberté, dessen muthmaßliche Bedeutung sich später ergeben wird. Doch werden, wie schon erwähnt, die Kinder von Jacques und Soubise insbesondere als Genossen des Pflichtbundes bezeichnet. Die Steinmetze von Jacques nennen sich Compagnons Passants (Passirende Genossen), und werden von ihren Gegnern als Loups-Garoux (Währwölfe) bezeichnet. Die Steinmetze von Salomon heißen dem entsprechend Compagnons Etrangers (Fremde Genossen) und Loups (Wölfe). Die Schimpfwörter „Wolf“ und „Währwolf“ sollen sich auf das Entlaufen in die Wälder nach dem Morde Hirams beziehen, den sich ja beide Parteien gegenseitig vorwerfen. Die Tischler und Schlosser von Jacques heißen Dévorants, (wahrscheinlich im Ursprung Devoirants, Glieder des Devoir, wie auch Sciandro es schreibt), die von Salomon hingegen Gavots (wahrscheinlich von Gaveaux, wie die Bewohner der Ober-Provence in Marseille und andern Städten heißen). Das Schimpfwort für alle Glieder des eigentlichen Pflichtbundes ist Chiens (Hunde), das der Genossen der Freiheit Loups (Wölfe), Dévorants heißen außer den Schlossern und Tischlern auch die Mitglieder aller später gegründeten Corps von Meister Jacques.
Es ist nun Zeit, uns mit der Organisation und den Gebräuchen dieser merkwürdigen Verbindungen näher bekannt zu machen. Ihre beständigen und oft blutigen Händel lassen sie in schlimmem Lichte erscheinen; ihr inneres Wesen aber ist zum Theil vortrefflich. Auffallend ist vor allen Dingen die vollständige Uebereinstimmung selbst der unbedeutendsten Gebräuche bei allen Gesellschaften, was sicher auf einen gemeinschaftlichen Ursprung hinweist. Die Schilderung ihrer Einrichtungen läßt sich also ganz allgemein erledigen.
Um als „Genosse“ aufgenommen zu werden, muß der junge Handwerker eine Probe seiner Geschicklichkeit ablegen. Die Aufnahme geschieht dann mit großer Feierlichkeit und geheimnißvollen Gebräuchen. Worin diese bestehen, ist natürlich nicht bekannt. Der Pater Héliot berichtet, daß den 29. September 1645 die Brüder Schuster und Schneider dem geistlichen Gericht von Paris angegeben wurden, weil ihre Gebräuche bei der Einweihung eines Lehrlings die hauptsächlichen Ceremonien des Katholicismus nachahmten. In Folge dessen verbot die theologische Facultät, unter Strafe der Excommunication, diese verderblichen Versammlungen der Gesellen. Daß die Aufnahme-Gebräuche den kirchlichen nachgebildet sind, ist um so annehmbarer, als die Brüderschaft einen halb kirchlichen Ursprung und Charakter hat, und als ferner auch in Deutschland bei der Aufnahme in den Gesellenstand viele Ceremonien vorkamen, die bei den frommen Leuten wegen ihrer Ähnlichkeit mit den kirchlichen noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts großes Aergerniß erregten.
Die Genossen behaupten, daß ihnen von ihren Stiftern gewisse Dogmen überliefert worden sind, welche nicht ganz mit den christlichen zusammenfallen, und den Neu-Eingeweihten gleich Flammen der Erkenntniß erheben und beseligen. Daß diese geheimnißvollen Dogmen tiefmetaphysische Wahrheiten enthalten, ist bei der geringen Bildung der Gesellen kaum anzunehmen. Die Mysterien, welche unter andern der Steinmetz Sciandro in den seinem Werkchen angehängten Liedern recht brav besingt, scheinen auf symbolische Darstellungen der Brüderlichkeit, ferner der Unsterblichkeit, der Tugend, der Kunst und der Gerechtigkeit hinauszulaufen. Wenn dieser nicht geistlose Mann den Eindruck, den die Einweihung auf ihn hervorgebracht, mit hochtrabenden Worten schildert, so ist dabei nicht zu vergessen, wie sehr alles Geheimnißvolle und Außergewöhnliche anregt, und daß für einen jungen, ganz ungebildeten Handwerker selbst jene einfachen, sittlichen Ideen, wenn sie ihm mit der Gewalt eines Dogmas, und unter der Heiligung des undenkbaren Alters entgegentreten, etwas höchst Erhabenes und Eindringliches besitzen müssen. Daß das Symbol vorherrsche, ist von vornherein anzunehmen. Die Entstehung der Brüderschaft aus den kirchlichen Bauten des Mittelalters, bei denen das Symbolische keine geringe Rolle spielte, spricht entschieden dafür; nicht minder die ewige Eigenthümlichkeit des ungebildeten Geistes, das Bild leichter aufzunehmen und tiefer zu bewahren, als den reinen Gedanken. Dem entsprechend müssen auch die vorkommenden Reden in alten, starren Formeln überliefert sein, was immer da stattfinden wird, wo der Geist sich nicht fortschreitend wiedererzeugt.
Die Genossen legen einen außerordentlich hohen Werth auf ihre Mysterien, und wenn dieselben auch mancherlei Phantastisches, Abergläubisches und Beschränktes enthalten, so haben sie sich doch im Ganzen als eine ebenso feste, als heilsame Grundlage des Gesellenlebens bewährt. Sie flößen den Gliedern streng sittliche Grundsätze ein, einen Halt, den ihr herumirrendes, familienloses, oft bedrängtes Leben doppelt nöthig macht. Es liegt in dem Wesen solcher Gesellschaften, daß sie sich selbst zum alleinherrschenden Elemente machen; daher nehmen nicht nur die Pflichten gegen die Verbindung, unverbrüchliche Treue, Verschwiegenheit, Brüderlichkeit, Aufopferung, selbst von Gut und Blut, den ersten Rang ein; sondern auch die allgemein menschlichen Obliegenheiten finden ihren Grund und Zweck in der Verbindung, in ihrer Ehre und ihrem Vortheil. Der „Genosse“ darf nicht liederlich sein, nicht stehlen oder betrügen, viel weniger, weil das allgemeine, absolute Sittengesetz diese Handlungen verbietet, als deshalb, weil der Bund dadurch beschimpft und schließlich aufgelöst würde. Auch die „Genossen“, obwohl auf der niedrigsten Stufe der gesellschaftlichen Leiter, haben ihre Standesehre, und sie wachen strenger darüber, als Adel, Geistlichkeit und hohe Bürgerschaft. Die Standesehre bewährt sich stets als solche, wenn deren Verletzung eben vom Stande gerügt und bestraft wird.
So haben auch die Gesellen-Verbindungen in Frankreich (wie nicht minder in Deutschland) eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit über ihre Mitglieder; sie legen eigenmächtig die härtesten Strafen auf, dagegen vermeiden sie die Gerichte des Staates, so sehr fühlen sie sich als besondere, unabhängige Körperschaft. Da ich das Nähere dieser Vorgänge in Frankreich nicht kenne, so werde ich zur Erläuterung einige Gebräuche der deutschen Zimmergesellen-Brüderschaft, wie ich sie von sehr glaubwürdigen Mitgliedern erfahren, später anführen.[2]
[540]
Die Liste der Wunder, welche die Elektricität bereits täglich vor unsern Augen verrichtet, ist schon ziemlich bedeutend und nimmt noch immer frisch zu. Wenn wir erst ordentlich dahinter kommen, was sie im Wachsthum und Leben der Pflanzen, in Gesundheit, Erkrankung und Genesung der Menschen wirken, schaffen und zerstören mag, wie die Wirkungen des Lichts, vielleicht dieses selbst, Sturm und Regen, Wärme und Kälte von ihr abhängen oder gar nur Erscheinungs- und Wirkungsformen derselben sein mögen, wird unsere Achtung für diese noch immer geheimnißvolle, allgegenwärtige, allwirksame, unkörperliche, geisterartige Naturkraft sich noch bedeutend steigern. Daß die Elektricität blitzt und donnert, portraitirt, schießt und schlägt, Unschmelzbares schmilzt, falsche Nachrichten feiger Potentaten und Börsen-Course über Land und Meere blitzt, versilbert und vergoldet, alle möglichen Münzen und Kunstwerke auf das Feinste modellirt etc., dies und manches Andere wissen wir. Neu ist aber noch, daß sie Weber geworden ist, Kunstweber erster Classe. Herr Bonelli in Turin hat ihr diese Kunst beigebracht, oder vielmehr wunderbare Mechanismen componirt, mit welchen die vereinigte Magneto-Elektricität die allerkünstlerischsten Werke des Jacquard-Webstuhles spielend und unendlich billiger verrichten muß.
Der vor sechzig Jahren erfundene Jacquard-Webstuhl hat das Gute, daß er die Muster, welche in einem Gewebe ausgeführt werden sollen, von durchlöcherten Karten, also auf eine sichere, mechanische Weise, vorgeschrieben erhält, während gewöhnliche Webstühle sich dazu entweder gar nicht eignen, oder durch kostbare, künstliche Menschenhand zur Ausführung des Musters gezwungen werden müssen. Aber auch die Anfertigung dieser Karten wird mühsam und kostspielig, wenn ein sehr reiches und verwickeltes Muster gewebt werden soll. Dann sind oft Tausende solcher „Muster-Karten“ nöthig. Ein mexikanischer Bischof ließ sich einmal in Lyon eine Robe weben, wozu nicht weniger als 52,000 Karten gezeichnet und durchlöchert werden mußten.
Bonelli in Turin fand ein Mittel und einen elektro-magnetischen Mechanismus, der diese Zeit und Geld raubenden Karten ganz ersetzt. Seine Maschine ist ein elektro-magnetischer Apparat, der webt, ein elektrischer Jacquard-Webstuhl, wo die durchlöcherten, das Muster bedingenden Karten durch eine immer wieder brauchbare, dauernde, durchlöcherte Metallplatte ersetzt werden. Den Jacquard-Webstuhl müssen wir als bekannt voraussetzen, und auch die Bonelli’sche Maschine können wir nur in ihren wesentlichen Zügen schildern. Die allgemeine Ansicht derselben, die wir geben, erklärt sich vermittelst einer Durchschnitts- oder Sectional-Zeichnung, wo wir mit Hülfe der mit Buchstaben bezeichneten einzelnen Haupttheile eine Vorstellung von ihrer Arbeit gewinnen. Um a ist ein sogenannter endloser Papierstreifen gewickelt. Dies Papier ist mit Zinkfolie, einem Leiter der Elektricität, bekleidet und enthält ein mit schwarzem Lack, einem Nichtleiter, aufgezeichnetes Muster. Das endlose Papier passirt unter einer Reihe dünner, metallener Zähne (bbb), deren jeder mit einem der kleinen Elektro-Magnete (cc) in Verbindung steht. Das Ganze wird in drehende Bewegung gebracht durch eine galvanische Batterie und durch Drähte (dd). Einer der letzteren steht in ununterbrochener Verbindung mit dem Zinkfolien-Papier, und der andere mit den Metallzähnen (bb), so daß der elektrische Strom von der Batterie durch solche Metallzähne passirt, welche die metallisirte Oberfläche des endlosen Papiers berühren, während die andern Zähne, die auf der Trommel ruhen, keine Elektricität aufnehmen. So wird bei jeder Bewegung des Papiers ein (elektrischer) Magnet nach dem andern, je nach den Formen des Musters, bald thätig, bald negativ. In einem beweglichen Rahmen (e) gegenüber den Enden der horizontal liegenden Elektro-Magnete (cc) befindet sich eine Reihe kleiner horizontaler Eisenstäbchen (f 1), die polirt leicht gleiten können und durch eine durchlöcherte Platte (g) passiren. Durch eine mechanische Einrichtung werden die Enden dieser Eisenstäbchen mit den Enden der Elektro-Magnete in Berührung gebracht, so daß nun die Stäbchen von den elektrisirten oder activen Magneten angezogen werden, während die nicht angezogenen Stäbchen mit dem Rahmen fortgezogen und durch die niederfallende Platte fixirt werden, so daß die betreffenden Löcher in letzterer sich füllen. So wird die Platte zum Ersatz der durchlöcherten Karten im Jacquard-Webstuhle und ordnet die Stahlnadeln (hh), welche die Fäden des Stuhles regieren und vertheilen.
Wenn uns auch durch diese Andeutungen die Einzelnheiten dieser feinen elektro-magnetischen Webe-Mechanik nicht klar werden, läßt sich doch leicht begreifen, daß der ganze Webstuhl nur ein angewandter elektro-magnetischer Apparat ist. Die Apparate, durch welche aus Elektricität Magnetismus oder aus Magnetismus Elektricität erzeugt wird, sind freilich auch nicht Jedem klar und in der Regel nur bei Chemikern und Physikern von Fach zu finden, aber wir müssen uns hier damit begnügen, daß wir an etwas in der Wissenschaft Bekanntes erinnern und auf dessen geniale praktische Verwerthung hinweisen. Diese Verwerthung ist allerdings sehr bedeutend, da nun mit Hülfe der elektrischen Muster diese nicht nur mit 90 Procent weniger Kosten hergestellt, sondern auch mit Leichtigkeit und Sicherheit geändert, verbessert und verschönert werden können, wobei die Gefahr eines Versehens oder des Ungeschicks eines Arbeiters vermieden wird.[3]
[541] .Wenn sich erst der Bonelli’sche Webstuhl ordentlich eingebürgert hat, werden die schönsten und bis jetzt kostbarsten Muster in Teppichen und Kleiderstoffen, Tüchern und textilen Zierrathen aller Art auch den Unbemittelten zugänglich, und so gewinnt das Schöne und Anmuthige in unserer Umhüllung und Umgebung eine unendlich weitere, bürgerliche Ausdehnung, der wir uns mit der Zeit Alle freuen können.
Der Präsident ließ die Anklageakte verlesen. Die Angeklagte, Henriette Grone, war beschuldigt, ihrer Schwester, der Wittwe Rother, von der sie aus Mitleiden in’s Haus genommen sei, gleich am Abend ihrer Ankunft aus einem unverschlossenen Secretair die Summe von dreihundert Thaler heimlich entwendet zu haben. Ein Gemurmel der Entrüstung ging durch den Saal. Aber wem galt es? Die Blicke richteten sich dabei nicht auf das arme Mädchen in der Anklagebank, sondern auf die reiche Dame der Zeugenreihe. Das Mädchen hatte das Gesicht mit beiden Händen bedeckt. Die Wittwe sah mit einem stolzen, harten Blicke vor sich hin. Das Mädchen mußte das Gesicht erheben.
„Angeklagte, bekennen Sie sich schuldig?“ fragte, wie es Vorschrift war, der Präsident sie.
Sie blickte aus ihren Vertheidiger.
Dieser nahm für sie das Wort. „Die Angeklagte war des Willens, sich schuldig zu bekennen. Ich habe ihr den Rath ertheilt, mir die Antwort zu überlassen. Meine Herren Geschworenen, Sie werden durch den Verlauf der Sache sich überzeugen, daß die Angeklagte zur Zeit der That in einem Zustande der Sinnenverwirrung war, der die Zurechnungsfähigkeit, also auch jede Schuld absolut bei ihr ausschloß. Sie kann sich daher nicht für schuldig bekennen, und meine Pflicht als Vertheidiger war es, einem Unrecht zuvorzukommen, das sonst dieser hohe Gerichtshof, wenn auch ohne Wissen und Willen, hätte begehen müssen. Ich bitte danach den Herrn Präsidenten, die Angeklagte von einer Beantwortung der gestellten Frage zu entbinden.“
Der Gerichtshof ging auf den Antrag ein. Die Zeugen wurden zur Beeidigung vorgerufen.
„Sind auch Sie bereit, den Zeugeneid zu leisten?“ fragte der Präsident die Wittwe Rother. „Nach dem Gesetze können Sie als Schwester der Angeklagten nicht dazu gezwungen werden.“
„Ich bin bereit,“ sagte sie mit fester Stimme.
Sie wurde mit den Anderen vereidigt. Die Zeugen mußten abtreten. Der Präsident begann das Verhör der Angeklagten.
„Was haben Sie auf die Anklage zu erwidern?“
Sie hatte nichts zu erwidern. Sie konnte nur einräumen. Und das that sie, offen, sie konnte frei den Richter ansehen. Es mußte doch ein höheres Bewußtsein sie beseelen, daß sie in solcher Weise ein schweres, ein gemeines, entehrendes Verbrechen auf sich nehmen konnte. Auch das Publicum schien Aehnliches zu fühlen.
„Ich habe die That verübt,“ antwortete sie auf die Frage des Präsidenten. „Ich war allein in der Stube meiner Schwester. In der Stube stand ein Secretair, in dem sie ihr Geld verwahrte. Der Schlüssel steckte im Schlosse. Ich schloß ihn auf und nahm die Summe von dreihundert Thalern heimlich zu mir.“
Kein Laut in dem weiten, dicht besetzten Zuschauerraume. Aber überall Blicke der innigsten Theilnahme, des Mitleides. Frauen weinten. Jeder fühlte klar und deutlich, nur ein großes, schweres Unglück könne die Arme bewogen haben, das Verbrechen zu begehen.
„Was haben Sie mit dem Gelde gemacht?“ fragte der Präsident.
„Ich habe es weggegeben.“
„An wen und zu welchen Zwecken?“
Sie antwortete nicht. Der Präsident wiederholte die Frage. „Ich kann Sie zu keiner Antwort zwingen,“ setzte er hinzu. „Aber sie dürfte in Ihrem eigenen Interesse liegen.“
„So werde ich schweigen,“ sagte das Mädchen fest.
Der Vertheidiger nahm wieder das Wort. „Ich darf in den Gang dieses Verhörs nicht eingreifen,“ sagte er. „Bei der Vernehmung der Zeugen werde ich dem Herrn Präsidenten die Antwort auf die Frage liefern.“
Der Präsident stellte noch einige unwesentliche Nebenfragen. Dann schritt er zur Vernehmung der Zeugen. Die Wittwe Rother mußte zuerst erscheinen, die Bestohlene, aber auch die Schwester der Angeklagten. Ihr strenger Blick nahm einen feindlichen Ausdruck an, als sie sich auf den Zeugenstuhl setzte.
„Erzählen Sie, was Ihnen von dem Diebstahle bekannt ist,“ forderte der Präsident sie auf.
Sie antwortete mit lauter, sicherer Stimme. „Ich verwahre in dem Secretair meiner gewöhnlichen Wohnstube mein Geld. Der Secretair ist unverschlossen, wenn ich in dem Zimmer bin. Er war auch unverschlossen, als am Abende des Diebstahls meine Schwester allein da war. Ich hielt sie für ehrlich. Sie war an demselben Tage erst bei mir eingetroffen. Ich hatte sie zu mir kommen lassen und wollte sie zu mir nehmen aus Mitleid. Sie war arm, sie sollte es gut bei mir haben. Als ich spät am Abend in mein Zimmer zurückkehrte und zufällig in dem Secretair nachsah, entdeckte ich, daß mir die Summe von dreihundert Thalern fehlte. Ich war darum bestohlen. Meine Schwester gestand den Diebstahl ein.“
„Hatten Sie mehr Geld in dem Secretair liegen?“ fragte der Präsident.
„Ja.“
„Wieviel?“
„Ungefähr fünftausend Thaler.“
„Sie sind reich?“
„Ich bin nicht arm.“
„Man schätzt Ihr Vermögen auf mindestens eine halbe Million Thaler.“
„Ich glaube nicht, daß mein Zeugeneid mich zu seiner Abschätzung hier verpflichtet.“
„Nein,“ sagte der Präsident. Dann fuhr er fort: „Sie haben der Polizei die Anzeige von dem Diebstahle gemacht?“
„Ja,“ mußte sie sagen.
Durch den ganzen weiten Saal lief wieder ein Gemurmel der Entrüstung, und die Blicke brauchten nicht erst zu zeigen, wem es galt. „Der Undank, die Frechheit hatten mich empört,“ wollte die Zeugin es beschwichtigen. „Es war eine Gewissenssache für mich.“
Da erhob sich der Vertheidiger. „Herr Präsident, ich versprach vorhin, Ihnen bei Vernehmung der Zeugen eine Antwort auf Ihre Frage zu liefern, was die Angeklagte mit dem Gelde gemacht habe. Darf ich jetzt bitten, an die Zeugin einige Fragen richten zu wollen?“
„Nennen Sie die Fragen,“ gestattete der Präsident.
„Sie betreffen einen Bruder der Zeugin und der Angeklagten. Er wollte sich selbst als Entlastungszeuge hier gestellen. Ich mußte ihn zurückweisen; die Angeklagte beschwor ihn, nicht zu erscheinen. Er würde sich noch hinterher unglücklich gemacht haben. Ich erreiche meinen Zweck durch wenige Fragen an die Zeugin. Der Gegenstand meiner ersten Frage an sie ist: Jener Bruder ist arm. Er war in großer Noth. Er war in der dringendsten Gefahr, entehrt, völlig brodlos zu werden, mit Frau und Kindern; er hat eine kranke Frau und drei kleine Kinder. In dieser Lage wandte er sich an seine Schwester, an die gegenwärtige Zeugin, die reiche Dame, deren Vermögen auf mindestens eine halbe Million geschätzt wird. Er stellte ihr seine trostlose Lage vor, er bat sie um dreihundert Thaler; so viel bedurfte er, um sich zu retten. Sie verweigerte ihm das Geld. Er beschwor sie, er fiel vor ihr auf die Kniee, für sein Weib, für seine Kinder. Sie verweigerte ihm das Geld. Sie hatte fünftausend Thaler in dem Secretair liegen, der neben ihr stand, für ihre Vergnügungen, für ihren Putz. Sie erklärte ihm, daß er keinen Groschen von ihr bekommen werde. So ließ sie ihn gehen, in Verzweiflung, in den [542] Tod der Verzweiflung. Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Zeugin zu fragen, ob diese Thatsachen richtig sind.“
Es gibt eine höhere Gerechtigkeit, als die, für die das weltliche Gesetz gemacht, der weltliche Richter gesetzt ist. Bei unseren unvollkommenen Zuständen kann das zum Theil nicht wohl anders sein. Verwerfliche politische Grundsätze thun leider oft genug Manches hinzu. In dem sittlichen und rechtlichen Bewußtsein des Volkes lebt und wirkt dennoch dieses höhere Recht lebendig und kräftig fort, und unter den vielen Vorzügen und Vortheilen der Oeffentlichkeit der Rechtspflege ist der erhabenste der, daß der Richterspruch dieser höhern Gerechtigkeit laut werden kann, und so wieder der sittliche Rechtssinn desto reiner und edler im Volke erhalten wird. Kurzsichtige Gesetzgeber, ja selbst nicht immer kurzsichtige, meinen dennoch oder wollen glauben machen, im Interesse der Ordnung und Sittlichkeit die Oeffentlichkeit der Rechtspflege beschränken und unterdrücken zu müssen!
„Sie haben die Fragen gehört, auf die Sie antworten sollen,“ sagte der Präsident zu der Zeugin. „Sind die vorgebrachten Thatsachen richtig?“
Sie brauchte nicht mehr zu antworten. Jedermann las die Antwort schon in ihrem Gesichte. Sie war glühendroth, dann leichenblaß geworden. Ihre Augen wußten nicht, wohin sie blicken sollten. Jenes sittliche Volksgericht war schon über sie hereingebrochen. Die Worte des Vertheidigers waren die Anklage gegen sie. Sie sollte sich dawider rechtfertigen, sie konnte es nicht. Vor ihr stand schon das Urtheil. Sie fühlte schon seine Wucht, seine Vernichtung. Das Urtheil des Gesetzes straft, das Urtheil des höheren Rechts vernichtet. Sie mußte sprechen, antworten. Ihre Stimme war unsicher geworden. Sie konnte keinen der Umstände bestreiten, die der Vertheidiger gegen sie vorgebracht hatte.
„Ich habe noch weitere Fragen zu stellen,“ sagte der Vertheidiger.
Sie erbebte. Sie kannte die weiteren Fragen.
„Reden Sie,“ gab der Präsident dem Vertheidiger wieder das Wort.
Der Vertheidiger fuhr fort: „Die Thatsachen, die ich bis jetzt erwähnt habe, hatten sich des Nachmittags zugetragen. Am Abende des nämlichen Tages geschah Folgendes: Den unglücklichen Bruder trieb die Angst und die Sorge um die Seinigen noch einmal zu der reichen Schwester zurück. Er wollte den letzten Versuch machen, das harte Herz zu erweichen. Er traf nicht die reiche Schwester, die er suchte, sondern die arme, die er nicht erwartet hatte.
Sie war wenige Stunden vorher angekommen. Er klagte ihr sein Leid. Doch sie war ärmer als er und konnte ihm nicht helfen. Die beiden armen Geschwister konnten nur zusammen weinen. Doch sie mußte ihm helfen. Sie bat die Schwester für ihn. Auch das war vergeblich. Aber sie mußte helfen, sie mußte retten. Sie mußte, aber sie wußte nicht wie. Da ergriff die Verzweiflung sie, auch sie. Und sie zeigte ihr ein Mittel. Das Mittel war ein Verbrechen. Sie kämpfte; sie war immer so ehrlich gewesen, sie war so unschuldig. Aber es gab kein anderes Mittel. Und sie wollte ja nur das Geld ihrer Schwester nehmen, ihrer reichen Schwester, und nur für den Bruder, gegen den Tod. Sie kämpfte, bis die Sinne sich ihr verwirrten. Dann nahm sie von dem Ueberflusse der Reichen und brachte es dem Armen. Er war gerettet, sie aber war eine Verbrecherin. War sie es? Vor dem Gesetze war sie es. Auch vor der Schwester? Die reiche Schwester, die hier gegenwärtige Zeugin, kam zehn Minuten später in ihr Boudoir. Sie trat an ihren Secretair und fand den Diebstahl. Sie schickte zur Polizei und ließ ihre Schwester als Diebin verhaften, die eigene Schwester, die sich ihr zu Füßen warf, die ihre Kniee umklammerte, die sie anflehete bei der Liebe, bei dem Andenken ihrer todten Eltern. Auch der Bruder hatte am Nachmittage vergebens zu ihren Füßen gelegen. Die Zeugin hat gesagt, auch das sei eine Gewissenssache für sie gewesen, die Schwester der Polizei zu denunciren. Nach unserer früheren, guten, ehrlichen deutschen Gesetzgebung hätte die Schwester wegen einer Entwendung gegen die Schwester nur dann zur Untersuchung und Strafe gezogen werden können, wenn die Bestohlene selbst und ausdrücklich bei Gericht einen Antrag darauf gestellt hätte. Wir haben seit Kurzem ein anderes, dem französischen nachgebildetes Recht. Nach diesem kommt es auf einen solchen Antrag nicht an. Aber eine Pflicht zum Denunciren legt auch dieses Recht nicht auf. Die Zeugin denuncirte gleichwohl. Ich bitte den Herrn Präsidenten, sie auch über diese Thatsachen zu befragen.“
In dem weiten Saale war wieder kein Laut zu vernehmen. Es war die tiefe Stille des tiefsten sittlichen Unwillens eingetreten. Das Urtheil wurde über die Verbrecherin auf dem Zeugenstuhle gesprochen, die das Urtheil des Gesetzes nicht erreichen konnte. Das Rechtsbewußtsein des Volks sprach das vernichtende Urtheil der allgemeinen sittlichen Verachtung über sie aus. Sie fühlte und erkannte es.
„Erkennen Sie die vorgetragenen Thatsachen für richtig an?“ fragte sie der Präsident.
„Ja,“ mußte sie sagen.
Dann – ihr Verhör war beendigt – schwankte sie, einem Gespenste gleich, auf ihren früheren Platz zurück und war vernichtet. Ihre arme Schwester auf der Verbrecherbank weinte laut – für sie.
Die Kammerjungfer wurde vernommen. Sie hatte nur Einzelnes über den Thatbestand des Diebstahls zu bestätigen.
Der letzte Zeuge war der Graf Ottomar von Hochstadt. Er war hauptsächlich nur auf Antrag des Vertheidigers als Entlastungszeuge geladen, und hatte die Angeklagte unmittelbar nach der That in jenem Zustande der höchsten Verwirrung aus dem Zimmer ihrer Schwester kommen sehen. Er hatte ferner, gleich am Tage nachher, als er von dem Diebstahle gehört, der Befohlenen die ihr entwendete Summe von dreihundert Thalern zugesandt, so daß sie keinen Schaden hatte. Er hatte sie freilich seitdem nicht wiedergesehen. Diese Thatsachen mußte er auf die Fragen des Präsidenten bestätigen. – Das Beweisverfahren war zu Ende.
Der Staatsanwalt mußte die Anklage aufrecht erhalten. Er habe es nie mit schwererem Herzen gethan, sagte er, und es war ihm zu glauben. Er stellte den Geschworenen anheim, ob sie mildernde Umstände annehmen wollten. Nach der früheren Gesetzgebung habe, wie schon der Vertheidiger richtig bemerkt, ohne einen ausdrücklichen gerichtlichen Strafantrag von Seiten der bestohlenen Schwester gar keine Untersuchung eintreten können. Um so mehr Grund dürfte zu einer milderen Beurtheilung der Sache vorliegen. Denn daß die Bestohlene einen solchen Antrag gestellt haben würde, daran möchte er doch zweifeln. Hatte der Staatsanwalt auch hierin Recht?
Auf den Grafen Ottomar von Hochstadt war schon der erste Anblick des einfachen, bescheidenen, schönen Mädchens nicht ohne Eindruck geblieben. Sie hatte dann am Arme des alten Grafen jenen öffentlichen Triumph gefeiert. Die Blicke des jungen Grafen auf sie waren der Wittwe bedenklicher geworden. Die Eifersucht ist eine furchtbar mächtige Leidenschaft. Eine bestrafte Diebin konnte nie die Gattin eines Grafen Hochstadt werden. Sie hatte noch jetzt in der Gerichtssitzung jenen feindlichen Blick auf das Mädchen geworfen. Der Graf Hochstadt hatte sie seit der Denuncirung des Mädchens nicht wiedergesehen.
Der Vertheidiger ergriff das Wort. Er schilderte den Kampf der Angeklagten mit sich selbst, bevor sie zu der That schritt, ihre Verzweiflung, die Verwirrung ihrer Sinne und ihres Bewußtseins. Er suchte sie danach als zur Zeit der That unzurechnungsfähig darzustellen, und trug in erster Linie darauf an, ein Nichtschuldig über sie auszusprechen. Sollte das nicht geschehen können, so rechnete er bestimmt auf den Ausspruch mildernder Umstände. Sie lägen in jener Verwirrung, wie in dem Motive der That.
Die Geschworenen zogen sich zurück. Sie kehrten zurück mit einem Verdict auf Schuldig, aber unter der Annahme mildernder Umstände. Sie hatten nicht anders gekonnt. Das Publicum hatte auch keinem andern Wahrspruche entgegengesehen. Das fast ehrerbietige Schweigen, mit dem die Rückkehr der Geschworenen erwartet war, zeigte es. Der Staatsanwalt beantragte die gelindeste Strafe, die das Gesetz zulasse. Der Vertheidiger stimmte bei. Der Gerichtshof trat ab, um das Strafurtheil zu finden. Er kam nach sehr kurzer Zeit zurück und konnte kein freisprechendes Urtheil verkünden. Eine Verwirrung, die das Bewußtsein der Angeklagten zur Zeit der That völlig unterdrückt hätte, mithin eine Unzurechnungsfähigkeit, war nicht anzunehmen gewesen. Dagegen hatte er, in Betracht der mehrfach vorliegenden mildernden Umstände. auf die möglichst gelinderte Strafe erkannt. Die Angeklagte war zu einer einfachen Gefängnißstrafe von vier Wochen verurtheilt.
Henriette Grone hörte die Verkündigung des Urtheils mit der [543] Ruhe jenes erhebenden Bewußtseins an, mit welchem sie die That hatte auf sich nehmen können; und zugleich mit der vollen Ergebung in die Strafe, die das weltliche Gesetz ihr hatte auflegen müssen. Es wurde ihr bekannt gemacht, daß ihr ein Rechtsmittel gegen das Strafurtheil zustehe.
„Ich verzichte darauf,“ erklärte sie, „und ich bin bereit, meine Strafe sofort anzutreten.“
Die Verhandlung war zu Ende. Der Gensd’arm, der die Angeklagte in den Saal hereingebracht hatte, trat an ihre Bank, um sie wieder hinauszuführen. Aber da erhob sich in dem Zuschauerraume eine hohe Gestalt. Der alte Graf Hochstadt war es, wieder einfach gekleidet, auf dem schwarzen Rocke nur den Johanniterorden und das große eiserne Kreuz, aber mit der ganzen hohen, ruhigen Würde, die dem Träger eines alten, ruhmreichen Grafennamens und dem tapferen General eigen war. Er durchschritt die Reihen der Zuschauer; ehrerbietig machte ihm Jedermann Platz. Er trat zu der Bank der Angeklagten. Verwunderte Blicke folgten und begegneten ihm. Dann klopften alle Herzen. Er trat vor die Angeklagte und verbeugte sich tief vor ihr. Er bot ihr seinen Arm.
„Ich werde Sie in Ihr Gefängniß führen. Eine größere Ehre ist mir noch nicht zu Theil geworden.“
Und stolz, als wenn er eine Königin zu ihrem Throne führe, verließ er mit dem demüthig und doch so glücklich weinenden Mädchen den Saal. Die Witwe Rother schlich allein und mit verhülltem Gesichte hinaus.
Und vier Wochen später, an dem Tage, an welchem Henriette Grone ihre Strafe verbüßt hatte, hielt vor dem Gefängnißhause eine Equipage. Das dunkle Thor des dunklen Gefängnißhauses öffnete sich. Ein einfaches Mädchen trat heraus, im ärmlichen Kleide von Kattun. Aber sie ging an dem Arme eines hohen, stolzen Greises. Der alte Graf Hochstadt führte sie, und er trug heute, wie an seinem feierlichsten Ehrentage, seine Generalsuniform mit allen Orden, die ihm von fast allen Souverainen Europa’s verliehen waren. An der rechten Seite des Mädchens ging der junge Graf Ottomar von Hochstadt. So wurde Henriette Grone aus ihrer Haft geführt. Ihr schönes Gesicht war verklärt von Glück, von Demuth und von Liebe. Das Gesicht des jungen Mannes an ihrer Seite strahlte. Glücklicher als Beide war der alte Graf.
„Ich hatte Dich in dieses Haus geführt,“ sagte er zu dem Mädchen, „an meinem Arme mußtest Du es wieder verlassen. Und nun gehörst Du einem Anderen an. Doch nein, immer auch mir. Ottomar, hebe Deine Braut in den Wagen. Unser altes Geschlecht hat nur edle Frauen gezählt, sie wird der Edelsten eine sein.“
Der Graf Ottomar von Hochstadt hob Henriette Grone, seine Braut, in den Wagen. Alle Drei fuhren sie hinaus zu dem Gute des alten Grafen, die feierliche Verlobung des jungen Paares zu begehen. Es war wirklich heute der feierlichste Ehrentag des alten Generals.
Die schöne Wittwe Rother war nicht bei der Verlobung, auch später nicht auf der Hochzeit.
Ueber das Alter des Menschengeschlechts. Im Jahre der Bildung 1860 muß man noch in den angeblich für das Volk und zu dessen Nutzen und Aufklärung geschriebenen Volkskalendern, welche in Süddeutschland in Millionen von Exemplaren über das Land verbreitet werden und fast in jeder Bürger- oder Bauernstube zu sehen sind, am Anfang einer stereotypen Uebersicht der größten Weltbegebenheiten, welche das Titelblatt zu zieren pflegt, die naive Bemerkung finden: 5618 (oder eine ähnliche Zahl) Jahre nach Erschaffung der Welt. In welche bodenlose Tiefe von Irrthum und Unwissenheit, in der man das Volk theils absichtlich, theils aus Nachlässigkeit immer noch zu erhalten liebt, läßt diese kleine, jedes Jahr wiederkehrende Zeile blicken! Nachdem die Wissenschaft mit Hülfe der großartigsten Anstrengungen nachgewiesen hat, welche endlosen Zeiträume unser Weltkörper in seiner Entwicklung bereits hinter sich hat, und wie gar, was das Weltganze betrifft, jedes Maß der Berechnung für dessen Dauer unsrem Geiste entschwindet, kann man doch gewiß ernstlich verlangen, daß solche Märchen, wie das einer Erschaffung der Welt vor fünf- oder sechstausend Jahren, dem Volke auch nicht einmal mehr symbolisch vorgetragen werden. Nicht nur, daß eine solche Zahl im Vergleich zu den unserer Berechnung zugänglichen Zeiträumen der Dauer von Welt oder Erde fast als verschwindend angesehen werden kann, drückt sie – was freilich sogar der Mehrzahl der Gebildeten unbekannt zu sein pflegt – nur einen kleinen Bruchtheil der Zeit aus, während welcher unser eignes Geschlecht seinen Wohnsitz im Weltraum, die Erde, bevölkert. Nur die sogenannte historische Erinnerung, des menschlichen Geschlechts, d. h. die Zeit, aus der wir bestimmte und glaubhafte geschichtliche Ueberlieferungen besitzen, wird ungefähr durch jene Zahl, also 5000–6000 Jahre ausgedrückt, während die mythische oder sagenhafte Geschichte der ältesten Völker der Erde noch um Vieles höher hinaufreicht. So beginnt die historische Erinnerung der Babylonier 2400 vor Chr., während ihre Sage nach Diodor’s Angabe behauptet, daß in Babylon der Himmel schon 473,000 Jahre vor Alexanders des Großen Zug beobachtet worden sei! Menes, der erste historische König der Ägypter, wird 5000–3000 Jahre vor Chr. gesetzt, während die sagenhafte Geschichte dieses Volkes noch 17,000 Jahre früher beginnt. Wollten wir demnach vorerst allein bei den geschichtlichen Zeugnissen stehen bleiben, so würden wir schon allein durch diese genöthigt sein, das Alter des menschlichen Geschlechts auf ungefähr zehntausend Jahre zu bestimmen. Denn schon 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung treffen wir zufolge der ausgezeichneten Untersuchungen der Orientalisten die Menschen auf einer so hohen Stufe der Cultur, daß man Herrn Prof. Schleiden vollkommen Recht geben kann, wenn er noch einen Zeitraum von weiteren 5000 Jahren hinzurechnet, welcher nöthig sein mußte, um die Menschen diese Stufe der Cultur erreichen zu lassen. Aber in der Wirklichkeit ist diese ohngefähre Schätzung eine viel zu geringe. Denn glücklicherweise sind wir in dieser wichtigen Frage nicht auf das Zeugniß der Geschichte beschränkt, sondern besitzen in den Durchforschungen der Tiefen der Erdrinde ein einfacheres und wirksameres Mittel, um die Wahrheit zu finden und unsere Kenntniß weit über jene geschichtlichen Anfänge hinaus auszudehnen. Bei Ausgrabungen im Nildelta entdeckte man 30 Fuß unter dem Nilschlamm Spuren menschlicher Civilisation und Kunstfertigkeit, welche die ägyptische Cultur 17 Jahrtausende vor unsere Zeitrechnung hinaufrücken. Pourtalès fand versteinerte Menschenknochen in einem Gestein, dessen Alter Agassiz auf 10,000 Jahre berechnet. In der Nähe des bottnischen Meerbusens grub man eine Fischerhütte aus, deren Alter auf 12,000 Jahre berechnet werden muß. Am berühmtesten jedoch sind die Funde der amerikanischen Geologen im Missisippidelta, welche beweisen, daß dort schon seit mindestens 57,000 Jahren Menschen wohnen!! Schon lange hatten die Geologen, auf solche und ähnliche Anzeichen gestützt, keinen Anstand genommen, das Alter des menschlichen Geschlechts auf gleiche Höhe mit dem Alter der letzten Erdbildungsperiode oder der sogenannten
Alluvialschicht zu berechnen, eine Periode, deren Dauer gemeiniglich zu 80–100,000 Jahren angenommen wird. Indessen ist auch diese Berechnung schon um deßwillen zu gering, weil die letztere Schätzung wahrscheinlich eine zu niedrige ist. Wenigstens muß nach Bronn aus Funden fossiler Baumstämme in Louisiana auf ein Alter der sogenannten Alluvion von 158,400 Jahren geschlossen werden.
Aber die ganze Berechnung nach der Dauer der Alluvion ist unnöthig geworden, seitdem fortgesetzte Entdeckungen kaum einen Zweifel mehr darüber lassen, daß es, was man bisher durchaus bezweifelt hatte, fossile oder sogen. vorweltliche Menschen gibt, d. h. daß Menschen schon in dem unserer jetzigen Erdbildungsperiode vorangegangenen Zeitabschnitt, also zur Zeit des sogen. Diluviums gelebt haben müssen. Dieser Schluß gründet sich darauf, daß man fossile Ueberreste des Menschen mit denen diluvialer Thiere unter Umständen zusammen gefunden hat, welche kaum einen Zweifel darüber gestatten, daß der Mensch gleichzeitig mit einigen derselben gelebt haben muß, wie denn überhaupt eine strenge Grenze zwischen Alluvium und Diluvium kaum mehr gezogen werden kann. Solche Funde sind von Lund und in Brasilien, von Castelnau in Peru, von Schmerling und Spring in Belgien gemacht worden. Am meisten Aufmerksamkeit haben übrigens neuerdings die Entdeckungen französischer Forscher auf sich gezogen. Boucher de Perthes und Prestwich haben in unversehrten Kieselbetten des nördlichen Frankreich bei Abbeville und Amiens steinerne, von Menschenhand gefertigte Geräthe, wie Beile, Speerspitzen, Aexte etc. in großer Menge, untermischt mit Resten vorweltlicher Thiere, angetroffen. Der berühmte englische Geolog Lyell ist selbst an Ort und Stelle gewesen und bestätigt das Erzählte! Er nennt das Alter der Kieselwerkzeuge von Abbeville und Amiens sehr groß im Vergleich zu den Zeiten der Geschichte und der Traditionen. Noch zu Ende vorigen Jahres hat A. Gaudry aus diesem Anlaß Nachgrabungen in der Umgegend von Amiens anstellen lassen und neun solcher Steinäxte mitten unter den Resten des fossilen Pferdes und einer von der unsrigen verschiedenen Rinderart gefunden. Aehnliche Funde sollen inzwischen auch an andern Orten, so in Hoxe in Suffolk, im Diluvium gemacht worden sein. Zu Lund in Schweden hat man das Gerippe eines Bos priscus ausgegraben, welches den leicht zu erkennenden Abdruck eines Pfeiles an sich tragen soll. In den Torfgruben in Irland fand man die Ueberreste eines (vorweltlichen) Riesenhirsches, dessen Rippe wie mit einem scharfen Werkzeug durchbohrt schien und zugleich Bildung neuer Knochensubstanz wahrnehmen ließ. In den uralten Pfahlbauten in mehreren Seen der Schweiz fand man ebenfalls Spuren, welche darauf schließen lassen, daß der Mensch ein Zeitgenosse des Riesenhirsches gewesen sein müsse. Ohne Zweifel wird man, einmal aufmerksam gemacht, immer mehr solcher Spuren entdecken, und wird sich wahrscheinlich schließlich ebenso von der Existenz fossiler Menschen überzeugen, wie man sich allmählich von der früher nicht geglaubten Existenz fossiler Affen überzeugt hat.
Die ganze Sache hat wegen ihrer hohen Wichtigkeit in der letzten Zeit die Aufmerksamkeit der Forscher, namentlich in England und Frankreich, in hohem Grade auf sich gezogen, und soll einen noch andauernden lebhaften Briefwechsel englischer und französischer Gelehrter hervorgerufen haben. Lyell hat im vorigen Jahre in Aberdeen in der geologischen Section der britischen Gesellschaft eine Rede über den Gegenstand gehalten, und [544] der französische Akademiker Littré in der Revue des deux mondes einen interessanten Aufsatz veröffentlicht, in welchem er die Frage, ob schon vor der letzten geologischen Epoche Menschen gelebt haben, behandelt. Die in den letzten Jahren gemachten Funde machen eine Bejahung der Frage nach ihm sehr wahrscheinlich und beurkunden zum Wenigsten ein sehr hohes, weit über die historische Zeit hinausreichendes Alter des menschlichen Geschlechts. Auch besteht nach ihm, trotz einzelner nicht übereinstimmender Thatsachen, ein Gesetz allmählicher Vervollkommnung und Stufenfolge, von welchem der Mensch keine Ausnahme gemacht haben wird.
Die interessanten Folgerungen, welche aus dieser wichtigen Entdeckung von dem hohen Alter des menschlichen Geschlechts im Verein mit anderweitigen Aufklärungen der Wissenschaft für die Culturgeschichte, wie für die Entwickelungsgeschichte des menschlichen Körpers und Geistes gezogen werden müssen oder können, sind theils zu offenkundig, theils schon früher oft genug geltend gemacht worden, als daß man nöthig hätte, näher darauf einzugehen. So sind diejenigen, welche sich auf das Zeugniß der Bibel für Adam als den ersten und ältesten der Menschen berufen, auch abgesehen davon, daß dieses Buch in wissenschaftlichen Dingen keine Autorität beanspruchen will, schon oft vergeblich darauf hingewiesen worden, daß das Zeugniß der Bibel selbst ganz im Gegentheil die Existenz von Menschen schon vor Adams Zeit bekundet, da dieselbe im vierten Capitel der Genesis selbst sagt, Kain (der Sohn Adams) sei aus dem Lande geflohen und habe ein Weib genommen, jenseit Eden, in dem Lande Nod! Aber wie oft mögen solche oder ähnliche Enthüllungen noch wiederholt werden, bis vor dem Zeugniß der Wahrheit die Nebel Jahrtausende alter Finsternisse oder Vorurtheile verschwinden werden?!
Aus dem Leben des Haushundes. Unter dieser Rubrik befindet sich in Nr. 19 der Gartenlaube ein Aufsatz, welcher in seiner Einleitung Aufforderung zu weiteren, entsprechenden Mittheilungen enthält. Ich liefere hiermit einen Beitrag zur Characteristik des Hundes, welcher in diesem Blatte, als Fortsetzung des von Herrn Dr. Brehm eingesandten Artikels, Aufnahme finden möge.
„Ich habe,“ erzählte mir der Besitzer eines bei Neustadt in Westpreußen gelegenen Gutes, bei dem ich zu Tische geladen, „lange Jahre einen Pudel besessen, den ich und meine Familie niemals vergessen werden. Die Treue und Anhänglichkeit, der bis zur menschlichen Vernunft heranstreifende Scharfsinn des Thieres überstieg Alles, was man bis dahin im Kreise meiner zahlreichen Bekanntschaft gesehen hatte. Früher in der Gegend von Garz in Pommern ansässig, wurde von mir auch jährlich der Stettiner Wollmarkt besucht, und auch dorthin begleitete mich stets mein Pudel, welcher zwar in der Jugend seinen Namen erhalten hatte, doch ersichtlich gern „Pudel“ genannt wurde.
„Pudel hatte sich einer großen Bekanntschaft zu erfreuen, und war zu einer gewissen Berühmtheit gelangt. Der Wollmarkt war in einem Jahre besonders glücklich für mich ausgefallen. Schon am ersten Tage war meine Wolle verkauft, und ich beschloß, die Zeit meiner Anwesenheit in Stettin lediglich dem Vergnügen zu widmete. In einer Weinhandlung, im Herzen der Stadt gelegen, hatte ich mit meinen Freunden beschlossen, meines Pudels Scharfsinn auf die Probe zu stellen. Zu dem Ende versteckte ich mein Taschentuch tief zwischen Sitz und Rückenkissen des Sophas, während Pudel Siesta hielt. Wir brachen auf, begaben uns auf manchen Umwegen nach dem Bahnhofe, und hier angelangt, sprach ich: „Pudel! mein Taschentuch ist fort, geh, hole es mir.“ Pudel zog unverweilt ab, doch setzte mich sein ungewöhnlich langes Fortbleiben in Besorgniß und wir begaben uns auf demselben Wege, welchen wir nach dem Bahnhofe eingeschlagen hatten, zur Stadt zurück, alle diejenigen Orte berührend, welche wir absichtlich das erste Mal betreten hatten. Pudel war richtig an jedem Orte gewesen, hatte Nachsuchung gehalten, das Vergebliche derselben aber erkennend, sich bald wieder auf die Socken gemacht. So erreichten wir denn die oben erwähnte Weinhandlung, woselbst Pudel mit Freudensätzen, mein Taschentuch zwischen den Zähnen, mir entgegen sprang. Die Frau des Weinhändlers aber erzählte: „Um Ueberzeugung zu gewinnen, wie weit des Hundes Scharfsinn reichen werde, hatte ich, nachdem Sie das Lokal verlassen, das Taschentuch aus seinem Versteck herausgezogen und in den im Gastzimmer befindlichen, mit einer Glasthür versehenen Eckschrank, und zwar hinter eine aufrecht stehende Porzellanschüssel gelegt. Pudel stürzte urplötzlich in’s Zimmer, sofort nach dem Sopha und von dort nach kurzer Absuchung aller Plätze mit einem Satze in den Glasschrank, wie denkbar, die große Glasscheibe und Porzellanschüssel zertrümmernd, aber ersichtlich ob der veranlaßten Zerstörung für seinen Buckel fürchtend, unter das Sopha flüchtend.“
„Zu meinem Gute gehörte ein etwa eine Achtelmeile entferntes Vorwerk. Hatte ich dort eine Anordnung zu treffen, so bedurfte es nur eines Zettels, welchen ich Pudel mit der Weisung übergab, alsbald dahin abzugehen. Pudel unterzog sich stets dem ihm ertheilten Auftrage unverweilt, hierbei den gradesten Weg über Wiesen, Gräben und Felder einschlagend, und es war ganz gleichgültig, ob ich mich in meinem Hause oder auf der entferntesten Feldmark befand. Pudel überbrachte stets die Bestellung dem Vogt, welcher das Vorwerk bewirthschaftete, und nur dieser empfing den Zettel. Es bedurfte dann nur der Weisung: „Du kannst gehen!“ oder: „Du mußt warten“ Im letzteren Falle erwartete Pudel jedesmal eine Schüssel guter Milch. welche er sehr liebte, und wankte und wich nicht von dannen, bevor ihm nicht sein Botenlohn, in Gestalt seiner geliebten Milch, gezahlt war. Daß seine Rückkehr zu mir dann aber in der kürzesten Zeit erfolgte, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Das meinem in Pommern gelegenen Gute anhängende große Dorf enthält zwei Wirthshäuser, deren Inhaber auch Materialwaarenhandel betreiben. Beide Handlungen führten diejenige Tabakssorte, welche ich stets zu rauchen pflegte, und ich entnahm grundsätzlich, gleich den anderen Waaren, meinen Tabak abwechselnd in der einen oder andern Handlung. Der Inhaber des einen Wirthshauses war Israelit und sein Name Abendroth. War ich des Tabaks bedürftig, so hatte ich an Pudel stets einen sichern Boten, und es bedurft nur der Weisung, zu Abendroth oder dessen Concurrenten zu gehen, um den Tabak von dem Händler zu erhalten, welcher diesmal beim Einkauf an der Reihe war, und niemals hat eine Verwechselung stattgefunden.
„Mit diesen Eigenschaften verband Pudel aber auch die eines trefflich geschulten Vorstehhundes, und es erregte häufig Heiterkeit, wenn ich auf Jagden in Gegenwart von Herren, welche Pudels Talent für einen dressirten Jagdhund noch nicht kannten, mit diesem auf dem Rendez-vous erschien. Dieses Talent führte des treuen Hundes klägliches Ende herbei. Eines Tages einen breiten, eben aufgeworfenen Graben besichtigend, entdeckte Pudel einen Hasen im Lager, und da in meine Küche schon mancher Lampe gewandert war, den Pudel gebracht hatte, so war ich weit entfernt, ihn abzurufen. Ich kehrte heim, doch von Pudel keine Spur. Der Tag verging, Pudel blieb aus. Boten wurden in alle Richtungen ausgesandt, sie kehrten ohne meinen geliebten Hund zurück. Erst am dritten Tage erschien Pudel, aber todesmatt und schwer verwundet. Er war von einem Jäger angeschossen, und trotz aller angewandten Heilmittel und Pflege starb das treue und seltene Thier.“
So unser freundlicher Wirth; die Mutter des Hausherrn konnte aber schon während dieser Mittheilungen den Thränen nicht mehr gebieten, und weinend verließ die würdige Matrone die Tafel. Wir aber saßen lange schweigend da. Die Rührung, welche sich unser Aller bemächtigt hatte, unterdrückte jedes Wort.
Auerbachs Volkskalender. Seitdem Schriftsteller von Bedeutung sich der Volkskalender angenommen, ist unbedingt ein edleres und würdigeres Streben in diesen wichtigen Zweig der Literatur gekommen. Statt der albernen Mord- und Scandalgeschichten, der vormeidinger’schen Anekdoten und Schwänke, wie sie leider noch in einigen stark verbreiteten österreichischen Kalendern erscheinen, ist ein mehr unterrichtender und in dem rein unterhaltenden Theile ein fast durchgängig anständiger Ton angeschlagen worden, der auf den Geschmack der Massen nicht ohne Einfluß bleiben kann. Den ersten Rang in dieser Beziehung stimmt zweifellos der Auerbach’sche Kalender ein, der namentlich in dem nächsten Jahrgang (erscheint den 1. September bei Ernst Keil in Leipzig) sowohl dem Inhalt wie der Ausstattung noch verdientes Aufsehen erregen wird. Auerbach selbst lieferte zwei Erzählungen: „Zwei Feuerreiter“ (aus Goethe’s und Karl August’s Leben) und „der Blitzschlosser von Wittenberg“, die erstere von Arthur von Ramberg, die zweite von Adolf Menzel sehr reich und ganz der beiden Meister würdig illustrirt. Die Holzschnitte, welche wir zu sehen Gelegenheit hatten, sind wahre Meisterstücke. Eine dritte, ebenso originelle wie schön durchgeführte Erzählung aus dem Schweizer-Leben lieferte Gottfried Keller (Verfasser des „grünen Heinrich“): „das Fähnlein der sieben Aufrechten“. Für den unterrichtenden Theil steuerte der bekannte Mediciner Professor Virchow in Berlin einen sehr interessanten Aufsatz mit 5 Abbildungen bei: „Wie der Mensch wächst“. Berth. Sigismund eine „Weltgeschichte im Dorfe“, A. Bernstein (der Redacteur der Berliner Volkszeitung) einen zeitgeschichtlichen Beitrag: „Alltägliches Gespräch“, Karl Andree einen nationalen Artikel: „Natürliche Grenze und was daran hängt“, und zum Schluß endlich ein Unbekannter: „Gut Heil! Briefe eines alten Turners aus Süddeutschland“. —- Sicher eine ebenso zeitgemäße wie reiche Auswahl, für deren innere Tüchtigkeit die bekannten Namen der Mitarbeiter die besten Bürgen sind.
Das Blut des heiligen Januarius. Bezüglich des in der letzten Nummer abgedruckten Aufsatzes: Das Mirakel des heiligen Januarius erhalten wir so eben von dem Verfasser in Neapel noch eine nachträgliche Einschaltung: Das silberne Gefäß, worin sich das angebliche Blut in zwei Phiolen befindet, hat ungefähr die Gestalt einer Wagenlaterne, ist doppelt so groß als die gegebene Abbildung, und ist an einer seidenen Schnur befestigt, die dem es zeigenden Priester um den Hals liegt, damit es ihm bei dem vielen, unaufhörlichen Umdrehen nicht zu Boden falle. An dem unteren Theile, da wo die Handhabe sich mit dem Mitteltheile verbindet, sind einige kreisrunde Löcher angebracht, wie mir scheint, um die erwärmte Luft desto besser in den innern Raum, wo die Fläschchen stehen, gelangen zu lassen. Zum Ornamente gehören dieselben entschieden nicht und umsonst werden sie wohl auch nicht da sein. In der Abbildung konnten sie natürlich nicht angedeutet werden.
Stellung: Weiß. K g 6. D b 7. S c 4, d 7. B c 2. Schwarz. K e 6. T c 6. B g 7. Matt in drei Zügen; vom Anonymus von Lille.
Plauen M–r. Das Problem ist richtig unter der Bedingung eines Bauermattes, welche freilich die Lösung leichter errathen läßt. Ohne solche Bedingung kann Weiß auch durch 3. S b 6 † S b 6 : 4. T c 5 † nebst 5. T c 5 † das Ziel erreichen. Mit nachträglichem S a 6 bleibt 3. S e 3. 4. T c 3 – c 5. 5 c 4 † möglich. — Leipzig. H. F. Richtig; wie aber lösen Sie die Aufgabe, wenn noch ein weißer Bauer auf g 5 steht? – Altona. J. H. E. Nicht richtig, da Schwarz T a 8 — a 1 † entgegnen kann. – Sebnitz. J. G. W. Das Zeichen o — o bedeutet die Rochade.
gingen bei Unterzeichnetem wieder ein: 2 Thlr. ein Verehrer Arndt’s in Fürth – 15 Thlr. 2 Ngr. Ertrag der auf dem Czernebock von den Sängervereinen aus Bautzen und Neusalza angestellten Sammlung – 3 Thr. 24 Ngr. der Sängerverein in Ilmenau 35 Thlr. einige Primaner und Lehrer des Gymnasiums zu Reval (Esthland), übersandt von M. Kimmel – 8 Thlr. Erholungsgesellschaft in Sebnitz – 11 Ngr. einige Mitglieder des Sebnitzer Liederbundes – 7 Thlr. 20 Ngr. (13 fl. 30 kr.) Dautenheimer (Großh. Hessen) Sängerbund mit dem Motto: „Wo man singt, da laßt Euch ruhig nieder.“
- ↑ Die Leinenhändler behaupten von den Tischlern, die Hufschmiede von den Schmieden gegründet zu sein; diese verleugnen sie aber vollständig.
- ↑ Vergl. Ch. L. Stock, Grundzüge der Verfassung des Gesellenwesens der deutschen Handwerker in alter und neuer Zeit. Magdeburg 1844. – Dies ist die einzige irgend brauchbare Schrift über den interessanten Gegenstand; aber auch sie gibt nur lückenhaftes Material und fast keine Verarbeitung. Ich gedenke daher, hauptsächlich nach mündlichen Quellen von der größten Ergiebigkeit, den Gegenstand demnächst neu zu behandeln. Es wird sich dann ergeben, daß allerdings nach Ursprung, Zusammenhang und Form die deutschen Brüderschaften sich sehr bedeutend von den französischen unterscheiden, daß aber beide den Kern der ganzen Bildung, die geregelte, gegenseitige Unterstützung und Beaufsichtigung, mit einander gemein haben. Was sich also hierauf bezieht, läßt sich ohne Bedenken im Wesentlichen von den deutschen auf die französischen Brüderschaften übertragen, zumal da die letzteren die bei weitem ausgebildeteren und innigeren sind.
- ↑ Die Karten für gewöhnliche Jacquard-Webstühle müssen nach Zeichnungen mühsam von Menschenhand gemacht werden, und sind nach einem Gebrauch nicht wieder benutzbar.