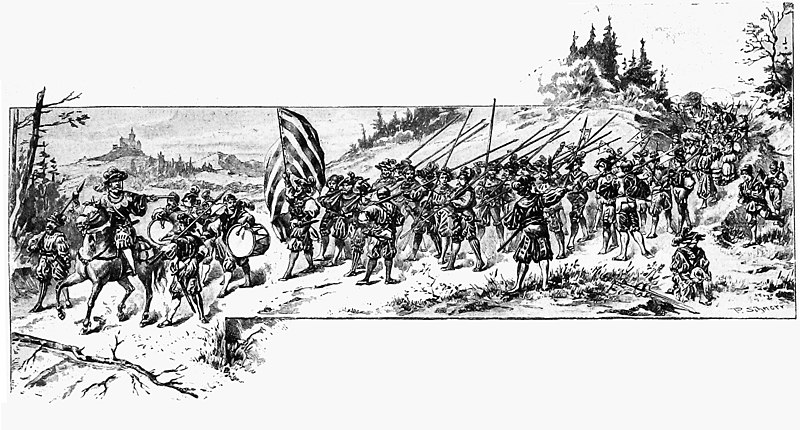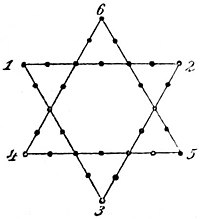Die Gartenlaube (1890)/Heft 11
[325]
| Halbheft 11. | 1890. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Der Zufall war Hudetz günstiger, als er es bei einer unbefangenen und nüchternen Abwägung aller Umstände hätte erwarten können. Wie er nach einem längeren Streifzug durch die Räume des Museums in den Oberlichtsaal zurückkehrte und einen vorsichtigen Späherblick zu dem Kabinett der Madonna im Rosenhag hinüberfliegen ließ, sah er mit einer Empfindung namenloser Freude, daß es ganz leer war. Das junge Pärchen, welches vorhin dort gestanden hatte, mochte seine geheimnißvolle Zwiesprache in irgend einem anderen Winkel fortsetzen – der Museumsdiener bemühte sich an der entgegengesetzten Seite des Saales, einem heftig gestikulirenden Herrn, der beständig auf seinen aufgeschlagenen Bädeker deutete, irgend etwas begreiflich zu machen, und die Malerin wischte mit hoch gerötheten Wangen in dem Antlitz ihres verunglückten Andreas herum.
Es war seltsam, daß Hudetz vor dieser harmlos aussehenden Dame bei weitem die größte Furcht empfand. Er konnte sich nicht viel Zeit lassen zu ihrer Beobachtung, aber nichtsdestoweniger prägte sich jede Einzelheit ihrer Erscheinung, von dem schlicht gescheitelten, stumpf braunen Haar bis herab zu den Falbeln an ihrem einfachen, schwarzen Wollkleide, unauslöschlich in sein Gedächtniß ein. Er hatte noch nie einem Menschen etwas Schlimmes gewünscht, jetzt aber durchzuckte es ihn wie ein inbrünstiges Verlangen: wenn sie doch vom Schlage getroffen würde und todt hinunter stürzte von ihrem Tische! Jetzt begriff er mit einem Mal, wie es möglich war, daß ein Mensch zum Mörder werden konnte.
Doch er hatte noch Besinnung genug, um zu erkennen, daß er auf den Eintritt eines so unwahrscheinlichen Ereignisses unmöglich warten durfte. Noch einmal warf er einen raschen, alles erfassenden Blick rings umher; dann ging er schnurstracks quer durch den Saal auf das Ziel seiner Wünsche los. Es war sicher, daß niemand auf ihn achtete. Er hätte einfach nach dem Bilde greifen und es herunter nehmen können; aber in einer jener sonderbaren Anwandlungen, die vielleicht schon die Ausführung manches Verbrechens noch im letzten Augenblick verhindert haben, fiel es ihm als eine vermeintliche Nothwendigkeit ein, sich zu überzeugen, ob die Gemälde denn auch wirklich nur lose an den Wänden hingen. Und er faßte nicht nach der winzigen „Madonna im Rosenhag“, sondern nach dem Christuskopf desselben Meisters, an dessen Entwendung er schon um seiner Größe willen unmöglich hätte denken können. Er rückte, er hob und rüttelte – aber der Rahmen bewegte sich nicht um eines Haares Breite von seinem Platze – es war kein Zweifel, daß das Gemälde durch Schrauben an
[326] der Wand befestigt war. Und obwohl ein einziger rascher Versuch hinreichend gewesen wäre, Hudetz zu dieser vernichtenden Erkenntniß zu bringen, setzte er doch sein unsinniges Bemühen minutenlang fort – kostbare, nie wieder einzubringende Minuten, innerhalb deren tausend Zufälligkeiten die für ihn eben noch so günstigen Umstände hätten in das Gegentheil verwandeln können.
Da schlug der Klang eines langsam näherkommenden Schrittes an sein Ohr, eines festen, männlichen Schrittes, der laut auf dem Parkettboden des hohen Saales hallte. Ohne Ueberlegung und ohne Besinnung, nur noch einem unwiderstehlichen blinden Antriebe gehorchend, streckte Hudetz seine Hände nach dem Madonnenbilde aus. Ein Druck – ein Heben – und es fiel ihm entgegen, so daß er nur mit Mühe durch rasches Zugreifen ein polterndes Niederfallen verhindern konnte. In der nächsten Sekunde war es unter dem fast bis zu den Hüften niederfallenden Kragen seines Mantels verschwunden, von dem linken, krampfhaft an den Körper gepreßten Arme festgehalten. Aber in der nämlichen Sekunde auch tauchte die breitschultrige Gestalt des Galeriedieners in der Thüröffnung auf, und sein Blick begegnete demjenigen des ehemaligen Studenten, der mit dem Trotz der Verzweiflung fest und gerade auf ihnn gerichtet war.
In dem Verlauf dieser furchtbaren Augenblicke lag die Entscheidung über sein Schicksal – das war der einzige Gedanke, in welchem sich das gesammte Geistesleben des Diebes zusammenschloß. Ein Zucken mit den Wimpern – eine hastige oder ungeschickte Bewegung konnte ihn verrathen – ganz abgesehen davon, daß selbst eine flüchtige Umschau in dem kleinen Raume dem Beamten das Fehlen des kostbaren Kleinods zum Bewußtsein bringen mußte.
Aber der Mann hegte offenbar nicht den geringsten Verdacht. Er gähnte hinter der vorgehaltenen Hand und ließ sich schwerfällig auf den Stuhl nieder, der wie gestern an der Schmalwand des Kabinetts aufgestellt war. Hudetz wagte wieder zu athmen; aber die Gefahr einer Entdeckung bestand unvermindert fort, so lange er das Dach dieses Hauses über seinem Haupte hatte. Nur nicht erwischen lassen – nur nicht erwischen lassen! summte es ihm unaufhörlich in den Ohren, und die Geister des Branntweins hatten noch Herrschaft genug in seinem Blute, um ihm die verwegene Dreistigkeit wiederzugeben, die seiner Natur sonst so fremd war, und die doch allein ein volles Gelingen seiner That möglich machen konnte.
Er blieb noch eine kleine Weile in dem Kabinett und ging dann ganz langsam – immer bemüht, seine Haltung so zwanglos als möglich erscheinen zu lassen – hart an dem Beamten vorüber in den Nebensaal, in welchenn sich jetzt sieben oder acht Besucher befinden mochten. Niemand achtete auf ihn – niemand außer der Malerin vor der „Auferweckung des Lazarus“, die ihn aufmerksam ansah und ihm mit den Blicken folgte, bis sich die geräuschlos zufallende Glasthür hinter ihm geschlossen hatte.
„Wie sonderbar das ist!“ dachte Hudetz. „Sie hat sich doch vorhin, als ich neben ihr stand, nicht im mindesten um mich gekümmert! Aber es ist unmöglich, daß sie etwas gesehen hat! Sie hätte sonst auf der Stelle Lärm geschlagen, das unterliegt gar keinem Zweifel!“
Dieser Selbstberuhigung ungeachtet fühlte er doch, wie seine Kniee zitterten, während er die Treppe hinabstieg. Auch begann ihm der Arm, unter welchen er das Bild geklemmt hatte, allgemach zu erlahmen; er hatte die Empfindung, als mußte die Tafel zu Boden gleiten, und es besserte nichts daran, daß er den Ellbogen mit Aufwendung seiner ganzen Muskelkraft an den Körper preßte.
In dem Skulpturensaal endlich wagte er seine Schritte zu beschleunigen, und schon hatte er mit der freien rechten Hand die Thür geöffnet, jenseit deren die Freiheit war und die Erlösung von dieser unnatürlichen Spannung, als ihn wie ein Messerstich der Klang einer Stimme durchzuckte, die hart hinter seinem Rücken rief: „He – Sie da! – Mein Herr! – Wollen Sie nicht die Freundlichkeit haben, auf einen Augenblick zurückzukommen?“
.Alles ist verloren!“ schrie es in ihm. Die Versuchung packte ihn, seinen Raub von sich zu werfen und in wilden Sprüngen die Treppe hinabzueilen, gleichviel wohin – am liebsten über das eiserne Geländer hinab in die Wellen des Flusses. Aber er kehrte nichtsdestoweniger in willenlosem Gehorsam um, das Bild an sich drückend und mit dem rechten Arme schlenkernd, als könnte er dadurch die steife Unbeweglichkeit des linken minder auffällig machen.
Einer von den Galeriedienern war es, der ihn gerufen hatte – derselbe, dessen zudringlich mißtrauischer Blick ihm vorhin so überaus belustigend erschienen war.
Er stand mit einem anderen Aufseher vor dem kleinen Verschlage, welcher zur Aufbewahrung der von den Besuchern abzugebenden Stöcke und Schirme dient. Auf seinem glatt rasirten, nichtssagenden Gesicht war ein Lächeln, welches Hudetz wie das höhnische Grinsen eines Teufels dünkte, der sich die Freude macht, noch ein wenig mit seinem unglücklichen Opfer zu spielen.
„Wollen Sie nicht gefälligst einmal nachsehen,“ fragte er, „ob Sie noch alles bei sich haben, was Sie vorhin mitbrachten. Es könnte doch wohl sein, daß Sie etwas verloren hätten.“
Hudetz rührte keinen Finger.
„Ich habe nichts verloren!“ erwiderte er, und seine Augen irrten umher, als wenn sie nach irgend einem unerhörten Rettungsmittel oder vielleicht auch nach einer Waffe zu Angriff oder Vertheidigung suchten.
„Na, wie können Sie das denn wissen, wenn Sie nicht einmal in Ihren Taschen nachfühlen,“ beharrte der Galeriediener in einem ziemlich unverschämten Tone. „Es ist doch wohl der Mühe werth, sich davon zu überzeugen.“
Es war kein Zweifel, man wollte ihn zwingen, sich selbst zu verrathen, denn er konnte den linken Arm ja nicht um einen Zoll bewegen, ohne daß das Bild zu Boden fiel. Aber gerade diese überflüssige Grausamkeit stachelte Hudetz’ verzweifelten Trotz.
„Ich habe nichts verloren!“ wiederholte er heftig. „Lassen Sie mich gehen!“
„Nun, nun, man wird Sie nicht zwingen, es anzunehmen. Aber ich muß gestehen, daß mir in meinem ganzen Leben etwas derartiges noch nicht vorgekommen ist. Es lag da auf der Erde – unmittelbar, nachdem Sie zur Thür hinaus waren, und ich könnte beschwören, daß es eine Minute früher noch nicht dagewesen ist. Es ist fast unmöglich, daß es ein anderer verloren habe.“
Die Zähne des ehemaligen Studenten schlugen hörbar auf einander; seine Gedanken fingen an, sich zu verwirren. Er fühlte, daß diese schreckliche Zwangslage ihn um seine Besinnung bringen müßte, wenn es ihm nicht gelänge, ihr auf der Stelle in der einen oder der anderen Weise ein Ende zu machen.
Wenn man nun in Wahrheit noch keinen Verdacht gegen ihn hatte? Es war fast unglaublich – aber gleichviel, in dem anderen Falle hatte er ja ohnedies nichts mehr zu wagen.
„So sagen Sie mir endlich, um was es sich handelt!“ fuhr er trotzig auf. „Ich bin nicht hier, um mich von Ihnen narren zu lassen.“
„Na, so zeig’s ihm doch!“ mahnte der andere Beamte seinen Genossen mit gedämpfter Stimme. „Er mag sich wahrscheinlich nicht dazu bekennen, weil so wenig darin ist.“
„Hier, mein Herr!“ sagte der erste mit komischer Feierlichkeit, indem er ein schmutziges, abgegriffenes Geldbeutelchen unter seinem Rock zum Vorschein brachte. „Gehört Ihnen dies oder gehört es Ihnen nicht?“
Auf den ersten Blick hatte Hudetz sein Eigenthum erkannt. Er zögerte noch mit der Antwort, aber seine Unentschlossenheit war nur von kurzer Dauer. Man muß jede Spur hinter sich vertilgen, raunte ihm eine innere Stimme zu, und wer weiß, ob nicht dies unscheinbare Ding eine solche Spur bedeuten würde.
„Ja, es gehört mir!“ sagte er entschlossen und streckte seine rechte Hand danach aus. Aber der Galeriediener, der eine unbezwingliche Neigung zu kleinen Späßen haben mußte, hielt seinen Fund noch zurück.
„Sachte, mein Lieber! Bei einem so verlockenden Anblick kann freilich jeder sagen: ‚Das gehört mir!‘ Wenn Sie wirklich der Eigenthümer sind, werden Sie mir ja auch angeben können, was darin ist – wie?“
Blitzschnell rechnete Hudetz nach, was er in dem Kaffeekeller verausgabt hatte.
„Zehn Pfennige!“ sagte er ohne jede Verlegenheit. „In zwei Fünfpfennigstücken.“
Der Spaßvogel lachte aus vollem Halse.
„Na ja, wenn Sie das so genau wissen, wollen wir von dem Pfandschein über eine silberne Spindeluhr mit Tombackkette und von dem Pferdebahnschein nach dem Weddingplatz nicht erst weiter reden. Hier, Herr Baron! Finderlohn wird nicht beansprucht. – Geben Sie es den Ar-, aber zum Teufel, was ist denn da los?“
[327] Die letzte Frage galt dem Anblick eines Kollegen, der mit kreideweißem Gesicht und in wahnsinniger Hast von oben herabgestürzt kam, gefolgt von einem eilig nachdrängenden Menschenhaufen.
„Gestohlen!“ keuchte der Mann, dem der Schrecken den Klang der Stimme geraubt hatte und dem die Angst um seine Zukunft in den Augen flimmerte. „Van Eycks ‚Madonna im Rosenhag‘ ist gestohlen! – Es darf niemand mehr hinaus – niemand, denn vor zehn Minuten war das Bild noch da!“
Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte Hudetz seinem wie versteinert dastehenden Gegenüber den Geldbeutel aus der Hand gerissen. Als er sich durch die schmale Spalte der halbgeöffneten Pforte drängte, hörte er den hellen Klang einer weiblichen Stimme, die laut über die lärmende Menge hinwegrief:
„Haltet ihn doch! – Das ist ja der Dieb! –“
Dann vernahm er nichts mehr, als das Geräusch der Straße, das ihn wieder umgab. Ihm war, als sei er auf Flügeln die große Freitreppe hinuntergetragen worden, und nun ging er weiter und weiter, mit vorgebeugtem Kopfe und weit ausgreifenden Schritten, unbekümmert um die Richtung seines Weges, aber innerlich ganz ruhig. Er fühlte die harten Kanten des Bildes an seinem Körper, und diese Berührung durchströmte ihn jetzt mit wunderbarer Kraft.
Es war sein Eigenthum; – mit Löwenmuth hatte er sich’s erkämpft – und nur mit dem Leben würde er es seinen Verfolgern lassen!
Aber man verfolgte ihn nicht, und von den Vorübergehenden beachtete keiner die unscheinbare Gestalt in dem weiten, grauen, fadenscheinigen Mantel, den der Wind zu so abenteuerlichen Formen aufblähte.
Die Mücke hatte ihren Stachel gebraucht – und man hatte nach ihr geschlagen – aber der Schlag war fehlgegangen, und unbehelligt flog sie davon! – –
„Was haben Sie denn da unter dem Mantel?“ fragte Frau Haberland, welche auf ihrem gewohnten Platz am Küchentisch vor dem räthselhaften, dickleibigen Buche saß, das sie bei dem Eintritt des Mieters noch jedesmal zugeschlagen hatte. Die tiefliegenden Augen des alten Weibes waren eben schärfer für solche Geheimnisse als diejenigen der Männer, die man zu Hütern der unersetzlichen Kunstschätze bestellt hatte.
Aber ihr Scharfblick bedeutete dem ehemaligen Studenten keine Gefahr.
„Ein altes Bild, das ich für sechs Groschen beim Trödler erstanden habe,“ log er „Ich kann es recht gut für meine Arbeit brauchen.“
Er hatte die kleine Tafel unter dem Mantelkragen hervorgezogen und hielt sie ihr entgegen. Wie er die Alte kannte, wußte er, daß jedes Heimlichthun nur ihr Mißtrauen geweckt haben würde. Sie betrachtete das Bild geraume Zeit, dann schüttelte sie den grauen Kopf.
„Der Rahmen mag das Geld ja allenfalls werth sein,“ meinte sie, „für die Schmiererei hätte ich keine fünf Pfennig gegeben.“
Hudetz hütete sich wohl, ihr zu widersprechen. Jetzt mochte sie immerhin in der Zeitung von dem Diebstahl lesen, niemals würde sie doch auf die Vermuthung kommen, daß sie selber den köstlichen Schatz in ihrer armseligen Behausung verberge.
Er ging in sein Zimmer und zündete ein Licht an, denn bis zum Einbruch völliger Dunkelheit war er in den Straßen umhergeirrt. Er rückte sein Kleinod in die beste Beleuchtung, soweit eben die jämmerliche Kerze eine solche zu gewähren vermochte; aber als er sich nun herabbeugte, um es mit dem seligen Behagen des Besitzers zu bekrachten, erfaßte ihn ein heftiger Schwindel, ein Schleier legte sich vor seine Augen, er griff mit den Händen in die Luft und stürzte lautlos zu Boden.
Die wunderthätigen Geister des Branntweins hatten ihn ermuthigt und beschützt bis hierher – nun aber war ihre Wirkung zu Ende, der Rückschlag trat ein.
„Nein, es ist unmöglich, Marie, ich kann nicht mehr,“ sagte Cilly von Brenckendorf zu ihrer Base, indem sie mit einer drolligen Gebärbe beide Hände auf das Herz drückte. „Jetzt weiß ich, wie dem Siegesboten von Marathon zu Muthe gewesen ist, als er in Athen ankam, – oder war es in Sparta? Jedenfalls würde ich todt hinfallen wie er, wenn ich diesen Dauerlauf nur noch fünf Minuten lang fortsetzen sollte.“
Sie hatten ein Putzgeschäft in der Jägerstraße besucht, und angesichts des herrlichen Winterwetters hatte Marie darauf bestanden, daß man den Heimweg zu Fuß mache. Nun aber sah sie wohl ein, daß es unmöglich sein würde, ihr verwöhntes Bäschen dazu zu zwingen.
„Ja, wir Mädchen aus dem Volke sind besser auf den Füßen als Ihr Prinzessinnen,“ erwiderte sie lächelnd, „und Deinen Tod will ich natürlich nicht auf dem Gewissen haben. – Komm’! – Wir sind ja in einer glücklicheren Läge als der bedauernswerthe Siegesbote von Marathon, denn ihm ist schwerlich eine leere Droschke über den Weg gefahren.“
„Wie? Diesem schrecklichen Henkerskarren zweiter Klasse sollen wir uns anvertrauen?“ rief Cilly entsetzt. „Siehst Du denn nicht, Marie, daß dem Pferde die Selbstmordgedanken förmlich auf dem Gesicht geschrieben stehen?“
Aber ihr Widerspruch war diesmal umsonst, denn schon hatte Marie das Gefährt herangewinkt und den Wagenschlag geöffnet.
„Nun, in Gottes Namen!“ seufzte die Tochter des Generals. „Man muß auch das einmal durchgemacht haben!“
Das Pferdchen, das mit seinen steifen Knieen und seinem niederhängenden Kopfe allerdings einigermaßen lebensüberdrüssig aussah, stolperte langsam vorwärts, unter den freigebigen Peitschenhieben seines Tyrannen gelegentlich die Ohren schüttelnd wie in schmerzlicher Verwunderung über die Unbilligkeit der Menschen, die keinen Unterschied zu machen wissen zwischen einem jungen Berberhengste und einem Veteranen, der alle Gebrechen des Alters in seinen Gliedern fühlt. In einer Gangart, welche die Geduld heißblütiger Fahrgäste allerdings hätte ziemlich hart auf die Probe stellen können, trottete es die Straße Unter den Linden hinab, beharrlich die Mitte des Fahrweges behauptend, wie rechtschaffen auch der Kutscher bemüht war, es nach der vorgeschriebenen rechten Seite hinüber zu steuern.
„Ich bin in einer Sturmnacht über den Kanal gefahren,“ klagte Cilly nach kurzer Zeit, „aber ich gebe Dir die heilige Versicherung, Marie, gegen diese Fahrt war es ein Ruhen in Abrahams Schoße.“
Eine laut scheltende Stimme, die in großer Nähe hinter ihnen vernehmlich wurde, und die vom Bock ihres eigenen Fahrzeuges herab nicht eben höflich Antwort erhielt, veranlaßte sie, das Köpfchen neugierig gegen das eine, herabgelassene Fenster zu neigen. Der reich betreßte Lenker eines sehr vornehmen, zweispännigen geschlossenen Wagens versuchte offenbar vergeblich, an der vorschriftswidrig fahrenden Droschke vorbeizukommen; er hatte Mühe, seine feurigen Graditzer Hengste zu zügeln, und es war begreiflich, daß er seinem Unwillen in ziemlich kräftigen Zurufen Luft zu machen suchte. Der vierbeinige Veteran jedoch kümmerte sich darum nicht im mindesten, und des Austausches von Höflichkeiten zwischen den beiden Kutschern wäre voraussichtlich kein Ende gewesen, wenn sich nicht plötzlich ein jugendlicher Männerkopf mit wasserblauen Augen und mit der weißen Mütze eines Kürassieroffiziers aus dem einen Wagenfenster gebeugt hätte, um mit schneidiger Kommandostimme zu rufen:
„Zum Henker, so fahr’ sie in Grund und Boden! Man wird mit dem Pack in einem solchen Karren doch keine Umstände machen!“
Und der betreßte Rosselenker mußte wohl an unbedingten Gehorsam gewöhnt sein, denn er ließ den beiden Graditzern die Zügel, und im nächsten Augenblick erfolgte ein markdurchdringendes Knirschen, Krachen und Klirren, wie wenn Eisen, Holz und Glas zerbricht – ein gellender Aufschrei aus weiblichem Munde – ein wirres Fluchen, Rufen und Schelten, – der vornehme Wagen sauste anscheinend unbeschädigt und unangefochten über den glatten Asphalt weiter, – die gebrechliche Droschke und das lebensmüde Pferdchen aber lagen auf dem Fahrdamm, als wenn sie sich nie mehr von diesem Sturze erheben sollten.
Ein dichter Menschenknäuel ballte sich alsbald an der Stätte des Unfalls zusammen. Auch die Helmspitze eines Schutzmannes blinkte dazwischen auf, und der Wächter der öffentlichen Ordnung schien sehr geneigt, mit dem Droschkenkutscher, der nach seiner Anschauung selbstverständlich der einzig Schuldige war, strenge ins Gericht zu gehen.
[328] Aber während er pflichteifrig mit Notizbuch und Bleistift herumfuchtelte, thaten einige der umstehenden Herren dasjenige, was dem wackeren Beamten offenbar minder wichtig schien, – das heißt, sie nahmen sich der bedauernswerthen Fahrgäste des verunglückten Fuhrwerks an. Es kostete einige Mühe, sie aus dem umgestürzten Wagen, in welchem sie wie in einem Käfig gefangen gehalten wurden, zu befreien, – um so mehr, als Cilly das Bewußtsein völlig verloren hatte und das Bemühen der Helfer somit nicht im mindesten zu unterstützen vermochte. Aber die im Grunde so liebenswürdige und hilfsbereite Natur der übel berufenen Berliner Bevölkerung weiß sich mit solchen Schwierigkeiten rasch und humorvoll abzufinden. Nur wenige bange und peinliche Minuten, dann hoben ein paar starke Männer die Ohnmächtige auf ihre Arme und trugen sie nach dem Bürgersteig hinüber.
In dem nämlichen Augenblick auch öffnete sich die verschlossene Thür des stattlichen Hauses, vor welchem der Unfall sich ereignet hatte, und barhaupt trat ein hochgewachsener, blondbärtiger Herr – von einem Diener in einfachem Dienstanzug gefolgt – auf die Straße hinaus.
„Wolfgang! Gott sei Dank. Nun sind wir geborgen!“
Mit einem Ausdruck fast jubelnder Freude hatte Marie das Erscheinen ihres Bruders begrüßt. Unter der ersten Wirkung des furchtbaren Schreckens hatte sie ja noch nicht einmal bemerkt, daß sie sich unmittelbar vor seiner Wohnung befanden.
Er war rasch auf sie zugetreten, hatte – unbekümmert um die gaffenden Zuschauer – seinen Arm um ihren Nacken gelegt und sein Antlitz voll liebevoller Besorgniß zu ihr herabgeneigt.
„Welch ein unglücklicher Zufall, mein armes Schwesterchen! Du bist doch unverletzt?“
„Ich denke, ja! Aber Cilly – Du mußt ihr helfen, Wolfgang! Sie ist ohnmächtig – gewiß nur ohnmächtig, denn es ist ja unmöglich, daß es etwas Schlimmeres sei!“
„Mit Ihrer Erlaubniß, meine Herrschaften – ich bin Arzt!“
Diese in der nöthigen Entschiedenheit gesprochenen Worte waren genügend, sofort die lebendige Mauer zu theilen, welche sich um die Bewußtlose gebildet hatte. Es hatte nicht den Anschein, als ob die junge Dame eine irgendwie erhebliche Verwundung davongetragen hätte, denn nicht einmal ihr niedlicher Straßenanzug war in Unordnung gerathen. Das sonst so heitere und lebensprühende Gesichtchen aber war marmorweiß, und es erschien so lieblich in dieser durchsichtigen Blässe, daß die lauten Ausrufe jammernder Theilnahme, in welchen sich einige mitfühlende weibliche Wesen aus dem Zuschauerkreise ergingen, nicht einmal den sonst allezeit bereiten Spott der minder zart besaiteten Seelen herausforderten.
Wolfgang hatte sein Ohr den halb geöffneten Lippen seiner jungen Verwandten ganz nahe gebracht; dann umschlang er plötzlich zur grenzenlosen Verwunderung der Umstehenden mit beiden Armen ihren schlanken Leib und hob sie leicht wie ein Kind empor.
„Platz da, wenn ich bitten darf! – Rintelmann, schließen Sie hinter mir die Thür!“
Und zum lebhaften Verdruß der zartfühlenden weiblichen Wesen, die sich plötzlich um die Fortsetzung und den Schluß des aufregenden Ereignisses betrogen sahen, verschwand der junge Arzt mit den beiden Opfern der Katastrophe im Innern des Hauses, dessen schwere Eichenpforte der Diener ebenso geräuschvoll als rücksichtslos hinter sich und ihnen zuwarf.
„Da geht sie hin und singt nicht mehr!“ meinte ein halbwüchsiger Bursche, und ein anderer fügte, zu den verblüfften Damen gewendet, hinzu:
„Sie können ganz ruhig sein – der wird sie schon kuriren – wenn er auch man bloß ein Zahnarzt ist!“
Er hatte auf das kleine, wenig in die Augen fallende Marmorschild gewiesen, in welches nichts als die Worte. „Brenckendorf, Zahnarzt“ eingegraben waren, und eine allgemeine Heiterkeit belohnte seine Entdeckung. Dann aber wandte sich die allgemeine Theilnahme in Ermangelung eines würdigeren Gegenstandes dem alten, lebensmüden Pferdchen zu, das noch immer auf dem Asphalt lag, allen kräftigen Versuchen, die seine Auferstehung herbeiführen sollten, einen nur leidenden, aber nichts destoweniger unüberwindlichen Widerstand entgegensetzend.
Auf ein Ruhebett in seinem Operationszimmer hatte Wolfgang seine reizende Bürde niedergelegt.
„Ich glaube nicht, daß diese Bewußtlosigkeit mehr ist als eine vorübergehende Folge des ausgestandenen Schreckens,“ sagte er zu seiner Schwester, „aber ich werde nichtsdestoweniger unverzüglich einen wirklichen Arzt herbeizuschaffen suchen. Du hast wohl die Güte, ihr während meiner Abwesenheit etwas Luft zu verschaffen und ihr mit dieser Flüssigkeit da“ – er hatte dieselbe bereits aus der Krystallflasche in eine silberne Schale gegossen – „die Schläfen zu waschen.“
Die Gelassenheit, mit welcher er ihr diese einfache Anweisung ertheilte, war am ehesten geeignet, auch Mariens Besorgnisse erheblich herabzumindern, und als sie sich nach Wolfgangs Entfernung kaum angeschickt hatte, den kleinen Samariterdienst zu verrichten, schlug Cilly auch wirklich schon ihre dunklen Augen auf.
„Was ist das, Marie?“ fragte sie, sich ungestüm in die Höhe richtend. „Wohin sind wir gerathen?“
Die Gefragte legte ihren Arm um die zierliche, bebende Gestalt und küßte sie auf die Wangen.
„Sage mir vor allem, ob Dir kein Leid geschehen ist, meine liebe, einzige Cilly! Befindest Du Dich denn nun wirklich wieder ganz wohl?“
Die Tochter des Generals ließ jetzt auch die Füßchen von dem persischen Teppich herabgleiten, der über das Ruhebett gebreitet war, und reckte sich zu ihrer ganzen, allerdings nicht sehr beträchtlichen Höhe empor.
„Gebrochen ist nichts, wie es scheint,“ meinte sie in einer bereits wiederkehrenden Anwandlung ihrer unverwüstlichen Spottlust, und mit einem kleinen Zucken der Lippen, das Marie nur für ein sehr begreifliches Zeichen nachklingender nervöser Erregung hielt, fügte sie nach kurzem Schweigen hinzu: „Ich glaube wahrhaftig, nicht einmal das Herz!“
„Ich habe mir bittere Vorwürfe gemacht während dieser schrecklichen Minuten, Cilly! Ich allein trage ja an allem die Schuld, denn es scheint in der That, als hättest Du das Pferd und seine Gedanken auf den ersten Blick nur allzu richtig beurtheilt.“
Heftig schüttelte Cilly das kurzlockige Köpfchen.
„Nicht Du trägst die Schuld und nicht das Pferd, sondern die Rohheit eines abscheulichen Menschen, der – den – doch gleichviel, es ist ja nun vorüber!“
Sie preßte die weißen Zähne aufeinander, als wollte sie dadurch ein unüberlegtes Wort gefangen halten, das sich ihr hatte über die Lippen drängen wollen. Noch einmal durchschweifte ihr forschender Blick das mit ausgesuchter Vornehmheit ausgestattete Gemach, dann fuhr sie, um weitere Fragen Mariens abzuschneiden, hastig fort:
„Aber wo sind wir? Was ist mit mir vorgegangen, daß ich gar nicht weiß, wie ich an diesen Ort gelangt bin? Ist es denn möglich, daß ich, Cilly Brenckendorf, die starknervigste meiner ganzen Bekanntschaft, in eine echte und wahrhaftige Ohnmacht fallen konnte?“
„Es muß wohl so sein, wenn Du gar nichts davon gemerkt hast, daß man Dich hier herauf getragen hat.“
„Wer hat mich herauf getragen? Du bist doch hoffentlich immer bei mir gewesen?“
Eine lebhafte Gluth erschien auf ihren eben noch sehr blassen Wangen, und lächelnd zog Marie die Freundin an sich, um sie zu beruhigen.
„Gewiß, mein Herz! Und bei allem Unglück hat doch noch ein glücklicher Zufall über uns gewaltet. Ich vermuthe fast, daß mein Bruder ein Augenzeuge des ganzen Vorganges gewesen ist; denn er hätte sonst kaum so schnell zur Stelle sein können, um uns beizustehen und Dich aus diesem entsetzlichen Menschengewühl hierher in seine Wohnung zu bringen.“
Cilly machte sich rasch aus den Armen ihrer Base los, und die verrätherische Gluth in ihrem Antlitz flammte noch höher auf.
„Dein Bruder also? Der Vetter Wolfgang? Und er wäre es gewesen, der – der mich –“
„Der Dich auf seine starken Arme hob wie ein Nordlandsrecke, der eine Königstochter entführen will!“ deklamirte Marie scherzend; aber ihr sonst so übermüthiges Bäschen, das jederzeit bereit war, auf eine harmlose Neckerei einzugehen, nahm diese Auskunft ersichtlich sehr übel auf. Ihre feinen Nasenflügel bebten und in ihren Augen schimmerten helle Thränen, als sie heftig erwiderte:
„Es ist wenig zartfühlend, sich über etwas derartiges obendrein lustig zu machen! Ich finde es abscheulich – dies und alles – ich – o, ich hasse die ganze Welt!“
[329]
[330] Sie stampfte mit dem Fuß auf den Boden und ließ sich dann wie erschöpft wieder auf das Ruhebett fallen. In wortlosem Erstaunen betrachtete Marie ihre unbegreifliche Erregung. Die Furcht, daß möglicherweise doch ein trotzig verschwiegener körperlicher Schmerz solchen Einfluß auf die Stimmung ihrer Verwandten ausübe, wollte sich von neuem ihrer bemächtigen.
Aber Cilly ließ es nicht erst zu einer dahin gehenden Frage kommen. Indem sie mit etwas nervösen Bewegungen die Falten ihres Kleides glättete, sagte sie, noch einmal umherschauend, in plötzlich verändertem, spöttischem Ton:
„Das also ist das Herrschgebiet Deines Bruders? – Vermuthlich befinden wir uns in seinem Allerheiligsten, da – wo er die Zähne auszieht.“
Es war ohne Zweifel eine boshafte Absicht in dieser Bemerkung, aber Marie war zu harmlos, um dieselbe zu verstehen.
„Ja,“ erwiderte sie, froh, daß der seltsame Zornesausbruch so rasch vorübergegangen war, „da ist der Operationsstuhl und dort der Schrank mit den Instrumenten. Möchtest Du sie einmal sehen, diese Marterwerkzeuge der Neuzeit?“
„Nein – um Gotteswillen! – Schon der Gedanke an diese erbaulichen Dinge könnte mich von neuem ohnmächtig machen. – Aber wo ist denn der Herr Vetter? Nimmt ihn sein Geschäft so sehr in Anspruch, daß ich nicht einmal die Vergünstigung genießen soll, ihm für seine Gastfreundschaft zu danken?“
„Er wollte sich bemühen, einen Arzt herbeizuschaffen.“
„Freilich – Ohnmachten und dergleichen gehören ja nicht in sein Gebiet! Aber, wie Du siehst, liebste Marie, bin ich schon wieder so frisch und munter, daß ich gar keines Arztes mehr bedarf, weder eines ganzen noch eines halben. Und ich empfinde ein lebhaftes Verlangen, nach Hause zu kommen.“
„Wenn Du gestattest, werde ich mich nach meinem Bruder umsehen. Er befindet sich wahrscheinlich ganz in der Nähe.“
Cilly sagte nichts, und Marie nahm dies Schweigen für eine Zustimmung. Sie ging hinaus und fand Wolfgang in dem zweiten der anstoßenden Zimmer anscheinend sehr ruhig an seinem Schreibtische sitzen.
„Nun?“ fragte er. „Es ist nichts, nicht wahr? Die Nervenschwäche einer verzärtelten jungen Dame. Aber der Arzt wird gleich da sein.“
„Es bedarf seiner nicht mehr. Bis auf eine gewisse Gereiztheit befindet sich Cilly wieder ganz wohl, und sie wünscht nur, sich von Dir zu verabschieden.“
Er erhob sich sofort von seinem Schreibsessel.
„Ich stehe zu Diensten! Doch, da uns der Zufall einmal zusammengeführt hat – eine beiläufige Frage, liebe Marie! Wie behagt es Dir im Hause des Generals?“
Sie sah voll zu ihm auf und ihre Augen leuchteten.
„O, gut, Wolfgang, sehr gut! Ich bin recht von Herzen glücklich!“
Es zeigte sich weder Freude noch Verstimmung auf seinem Gesicht, aber er strich zwei- oder dreimal seinen blonden Bart, ehe er erwiderte:
„Natürlich ist es mir sehr lieb, das zu hören! Hoffentlich wird weder jetzt noch künftig einer von unseren trefflichen Verwandten die Rücksichten außer acht lassen, welche er Dir schuldet.“
„Wie kannst Du daran zweifeln! Ich wäre entsetzlich undankbar, wenn ich nicht freudig anerkennen wollte, wie zartfühlend und liebevoll man sich gegen mich benimmt. Selbst der gestrenge Herr Assessor läßt es an der gebührenden Höflichkeit niemals fehlen, obgleich wir uns wie in stillschweigender Uebereinkunft gern aus dem Wege geben.“
„Das ist bedauerlich, denn die Menschen von den Charaktereigenschaften Lothars sind so selten, daß man diese wenigen viel eher aufsuchen als ihnen aus dem Wege gehen sollte. Aber ich denke nicht daran, Dich zu bevormunden oder väterlich zu berathen. Du mußt am Ende selbst wissen, wem Du zu vertrauen und vor wem Du Dich zu hüten hast. Da ist jede Einmischung nur vom Uebel.“
„Wenn Du eine so warme Freundschaft für Lothar empfindest, warum kommst Du denn niemals, ihn und seine Angehörigen zu besuchen? Ich muß Dir gestehen, Wolfgang, daß ich Dein beharrliches Fernbleiben einigermaßen befremdlich finde. Hoffentlich wirst Du doch wenigstens bei der heutigen Abendgesellschaft nicht fehlen.“
Er zuckte mit den Achseln und machte sich an den Papieren auf seinem Schreibtische zu schaffen.
„Meine Praxis gewinnt von Tag zu Tage so sehr an Umfang, daß mir für dergleichen wirklich keine Zeit bleibt, liebe Marie.“
Sie zögerte einen Augenblick, als ginge sie mit sich zu Rathe, ob sie einem ihrer geheimsten Gedanken Ausdruck geben dürfe; dann aber legte sie ihre Hand auf des Bruders Schulter und sagte sehr eindringlich und ernst: „Sei aufrichtig gegen mich, Wolfgang: hat man Dich zu dieser Abendgesellschaft eingeladen?“
Statt aller Antwort schob er einen Haufen von Briefen bei Seite und reichte ihr eine große, sauber gestochene Karte.
„Frau von Brenckendorf und der kommandirende General –“ begann Marie zu lesen, „ich danke Dir, Wolfgang. Es fällt mir ein Stein vom Herzen, denn diese thörichten Vermuthungen, denen ich doch gegen niemand Ausdruck geben konnte, fingen schon an, mich ernstlich zu beunruhigen. – Aber wenn man Dich so feierlich einladet, warum kommst Du nicht ein einziges Mal und wäre es auch nur der Form wegen auf eine Stunde? Ich glaube nicht daran, daß es Dir so ganz unmöglich ist – es sei denn, Du hättest besondere Gründe –“
„Und wenn ich nun wirklich solche besonderen Gründe hätte,“ unterbrach er sie ruhig, „würdest Du mir nicht auch ohne weitere Erklärung glauben, daß sie triftig genug seien? Du und ich, liebe Marie, wir sind ziemlich fertige Menschen, und wir wollen nicht versuchen, einander zu beeinflussen, nicht wahr? Aber nun dürfen wir Bäschen Cilly wahrhaftig nicht länger warten lassen, am wenigsten, wenn sie wirklich so reizbar ist, wie Du sagst.“
Cäcilie von Brenckendorf hatte in der That schon sehr oft mit allen Anzeichen großer Ungeduld das Operationszimmer durchwandert, und als nun die Geschwister eintraten, nahm sie eine steife und hoheitsvolle Haltung an, die gar nicht sonderlich zu ihrer Erscheinung und zu ihrem ganzen Wesen passen wollte.
„Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer Errettung und zu Ihrer raschen Wiederherstellung, verehrte Cousine,“ sagte Wolfgang in seiner angenehmen, ruhig heiteren Weise, „es hätte wahrhaftig ernst genug werden können.“
Er hatte ihr nicht die Hand geboten, weil sie die ihrigen mit ganz unverkennbarer Absichtlichkeit in ihrem Müffchen verborgen hatte.
„Marie sagt mir, daß ich Ihnen zu besonderem Dank verpflichtet sei,“ erwiderte sie, „und ich wollte natürlich nicht gehen, ohne diesem Dank Ausdruck gegeben zu haben. – Ist es wahr,“ fügte sie, als Wolfgang sich mit stummem Lächeln verbeugt hatte, in einem veränderten, natürlicher klingenden Tone hinzu, „daß Sie den Vorfall mit angesehen haben?“
„Ich stand gerade am Fenster, und ich würde dem armen Droschkenkutscher als Entlastungszeuge dienen können, wenn man etwa den unglücklichen Gedanken haben sollte, ihn zur Verantwortung zu ziehen.“
Cilly streifte ihn mit einem raschen, mißtrauischen Blick.
„So? – Sie sind sehr nachsichtig gegen den Menschen, dessen Fahrlässigkeit und Ungeschick Ihre Schwester in Lebensgefahr gebracht hat – von mir natürlich nicht zu reden! Es mag ja sein, daß auch ein unglücklicher Zufall dabei mitgespielt hat –“
„Gewiß! Der unglückliche Zufall nämlich, daß Seine Durchlaucht der Prinz Lamoral von Waldburg nicht ahnen konnte, wer die Insassen jener Droschke waren, die er mit so viel ritterlichem Muthe niederrennen ließ.“
Es war gut, daß das Müffchen seinen Blicken verbarg, wie sich die kleinen Hände darin zu Fäusten ballten.
„Ah, – Sie wollen ihn denunzieren!“ sagte Cilly nach einem tiefen Athemzuge.
„Ich muß gestehen, daß mich in der That vorhin ernstlich die Lust dazu anwandelte, denn es giebt eben Fälle, in denen selbst ein halb amerikanisirter Deutscher das lebhafte Verlangen fühlen kann, den Staatsanwalt in Thätigkeit treten zu sehen. Aber Sie mögen sich beruhigen, liebe Cousine! – Da alles so glücklich abgelaufen ist, und da man dem armen Manne hoffentlich den erlittenen Schaden ersetzen wird, mag Seine Durchlaucht in Frieden auf den Lorbeern dieses Heldenstückchens ruhen.“
Schmollend hatte Cilly die Lippen geschürzt. Die Gelassenheit, mit welcher der Zahnarzt ihre verletzende Bemerkung beantwortet hatte, brachte sie um den letzten Rest ihrer würdevollen Haltung.
[331] „Ich denke, Sie wissen recht gut, daß es nicht so gemeint war,“ sagte sie, zwischen Zorn und Verlegenheit schwankend. „Ob Prinz Lamoral zur Verantwortung gezogen wird oder nicht, ist mir höchst gleichgültig. Nicht an eine Anzeige beim Staatsanwalt dachte ich, sondern daran, daß es Ihnen augenscheinlich großes Vergnügen bereitet, mir gegenüber recht übel von ihm sprechen zu dürfen. Es ist ja auch so überaus wohlfeil – und erfordert sogar noch weniger persönlichen Muth, als ihn der Prinz soeben an den Tag gelegt hat.“
Wolfgang lächelte gutmüthig.
„Ich weiß nicht, warum Sie mich in einem so schwarzen Verdacht haben, liebe Cousine; aber wenn es mich in Ihren Augen reinwaschen kann, so erkläre ich gern, daß ich nicht einen Augenblick daran gedacht habe, Seine Durchlaucht aus dem Genuß Ihrer Freundschaft zu verdrängen. Da ich mich gar nicht der Ehre seiner Bekanntschaft erfreue, kann es mir wohl weder Vergnügen noch Mißvergnügen bereiten, von ihm zu sprechen.“
Cilly war von neuem sehr roth geworden, und sie wandte sich plötzlich ihrer Base zu.
„Würde es Dir jetzt genehm sein, Marie, daß wir uns auf den Heimweg machen? Man wird sich bereits in Sorge um uns befinden.“
Marie, die in wachsendem Erstaunen der kleinen Auseinandersetzung zugehört hatte, erklärte sofort ihre Bereitwilligkeit, und Wolfgang geleitete die beiden jungen Damen artig hinaus. Als sie schon auf dem Treppenflur standen, kehrte sich Cilly noch einmal hastig gegen ihn um:
„Wenn ich Sie verletzt haben sollte, so bitte ich um Entschuldigung, – ich hätte daran denken müssen, daß Sie mich aus einer sehr peinlichen Lage befreit haben! Nehmen Sie dafür noch einmal meinen Dank! – Adieu!“
Ohne ihm Zeit zu einer Antwort zu lassen, eilte sie leichtfüßig über den weichen Teppich der breiten Marmortreppe hinab. Wolfgang aber hielt seine Schwester noch für wenige Augenblicke zurück.
„Du wirst dafür sorgen, liebe Marie, daß man im Hause des Generals nichts von meiner Einmischung in diese Geschichte und von Eurem kurzen Aufenthalt in meinem Hause erfährt. Die Gründe dafür ein anderes Mal! Lebe wohl und unterhalte Dich königlich auf Eurem heutigen Feste, von dem Du mir später ausführlich erzählen mußt.“
„Marie!“ klang es etwas ungeduldig von unten herauf, und Wolfgang winkte der Zögernden lächelnd, sich zu beeilen.
Natürlich hatte Cilly unter dem frischen Eindruck der Katastrophe wenig Lust, ihr Leben abermals einer Droschke anzuvertrauen, und erklärte, sie könne den jetzt nicht mehr allzu langen Weg recht gut zu Fuß zurücklegen. So lange sie sich in der belebten Straße befanden, gingen sie schweigend neben einander her, als sie aber das Brandenburger Thor durchschritten hatten, konnte Marie sich doch nicht enthalten, zu fragen:
„Es war also wirklich der Wagen des Prinzen von Waldburg, der das Unheil angerichtet hat? Du hast ihn sogleich erkannt?“
Cilly blieb stehen und legte ihre Hand auf den Arm ihrer Begleiterin, daß diese den Druck fast als einen Schmerz empfand.
„Ich bitte Dich, frage mich nicht und sprich nicht mit mir davon! Wahrhaftig, es ist, als ob jeder ein besonderes Vergnügen darin fände, mich zu quälen.“
Ihre Stimme zitterte von verhaltenem Weinen; Marie aber fühlte sich durch dies unbegreifliche Benehmen endlich im Ernst verletzt und enthielt sich jeder Erwiderung. Nach einer weiteren Wanderung von fünf Minuten schien die Tochter des Generals denn auch zur Erkenntniß ihrer Unart gekommen zu sein. Sie schmiegte sich enger an ihre Begleiterin und sah ihr schmeichelnd ins Gesicht.
„Du mußt mir nicht böse sein, mein Herz,“ bat sie in jenem weichen Kinderton, der ihr in solchen Augenblicken eigen war und dem selbst ein wirklicher Groll kaum hätte widerstehen können. „Ich habe in der letzten halben Stunde so viel dummes häßliches Zeug geschwatzt, daß ich mich schäme, wenn ich nur daran denke. Du wirst Mühe haben, mir zu verzeihen, aber Du wirst es thun, nicht wahr? Es wäre schrecklich, wenn ich nun auch noch eine Einbuße an Deiner Freundschaft erleiden sollte.“
„Das ist eine unnöthige Besorgniß, meine liebe Cilly! Ich weiß ein in der Aufregung gesprochenes Wort recht gut von einer absichtlichen Kränkung zu unterscheiden. Aber wenn es mir gestattet ist, einen leisen Vorwurf auszusprechen, so meine ich, Du hättest meinen Bruder immerhin etwas freundlicher behandeln können.“
Es war doch schon wieder etwas von dem alten Trotz in Cillys Stimme, als sie erwiderte:
„Ich habe mich ja in aller Form bei ihm entschuldigt! Mehr kann ein junges Mädchen einem Herrn gegenüber doch nicht thun! Und bei ihm war es auch etwas anderes als bei Dir! – Er hatte die Absicht, mich zu ärgern und mir wehezuthun, als er sogleich von dem Prinzen zu sprechen anfing, und alle seine nachträglichen Versicherungen können mich nicht mehr vom Gegentheil überzeugen.“
„Aber wie in aller Welt sollte er dazu kommen? Ihr habt Euch, so viel ich weiß, seit seiner Rückkehr ein einziges Mal gesehen, und zu dem Prinzen unterhält er gar keine Beziehungen.“
„Ich habe auch keine Erklärung dafür,“ sagte Cilly, sehr angelegentlich nach der andern Seite blickend, „aber zuweilen genügt ja eine einzige Begegnung, um eine unauslöschliche Abneigung zwischen zwei Menschen zu erzeugen. Befindest Du Dich denn nicht Lothar gegenüber in der nämlichen Lage?“
„O, da möchte ich doch bitten!“ erwiderte Marie mit Lebhaftigkeit. „Von einer unauslöschlichen Abneigung ist – auf meiner Seite wenigstens – gewiß nicht die Rede. Dein Bruder und ich, wir haben vielleicht verschiedene Ansichten über manche Dinge und werden uns darin schwerlich jemals verständigen; aber das hindert mich nicht, seine vortrefflichen Eigenschaften rückhaltlos anzuerkennen.“
„Vergieb, wenn das Beispiel also ein schlecht gewähltes war. Aus Deinem bisherigen Benehmen gegen Lothar konnte ich eine solche Gesinnung ja wirklich nicht errathen. Ich aber habe nun einmal entschieden das Unglück, dem Herrn Zahnarzt zu mißfallen, und es wird mir doch wenigstens gestattet sein, mich gegen seine Spöttereien zu wehren. – Uebrigens – wir sind ja gleich zu Haus – habe ich noch eine große, eine sehr große Bitte auf dem Herzen! Du mußt mir im voraus versprechen, daß Du sie erfüllen wirst, und zwar ohne Wenn und Aber!“
„Da Du gewiß nichts Unmögliches verlangen wirst, sei dies Versprechen hiermit geleistet.“
„Du darfst weder meinen Eltern noch meinen Brüdern oder sonst jemand, der in unserem Hause verkehrt, ein Sterbenswörtchen von dem Vorgefallenen erzählen. Am Ende haben wir ja auch nicht einmal eine so glänzende Rolle dabei gespielt, daß uns an dem nachträglichen Erschrecken der Mama oder an den unvermeidlichen Neckereien Engelberts etwas gelegen sein könnte.“
Das war also der nämliche Wunsch, welchem vorhin schon Wolfgang Ausdruck gegeben hatte. Marie vermochte ihr Erstaunen über diese seltsame Uebereinstimmung nicht ganz zu verbergen.
„Ihr bringt mich fast zu dem Glauben, daß wir ein sträfliches Unrecht begingen, als wir uns umwerfen ließen,“ sagte sie. „Könntest Du es mir übelnehmen, Cilly, wenn ich zu erfahren wünschte, welches Deine eigentlichen Beweggründe für dies Heimlichthun sind?“
„Ich will mich nicht auslachen lassen! Ist das noch nicht Grund genug? – Und wenn ich nun wirklich noch eine andere Ursache hätte, würde es Dir schwer fallen, mir das kleine Opfer zu bringen?“
„Gewiß nicht! – Vermuthlich geschieht es aus Rücksicht für den Prinzen Lamoral, daß Du Deinen Eltern die Heldenthat seines Kutschers verbergen willst.“
Nur zwei Häuser trennten sie von der Villa des Generals. Cilly verlangsamte ihren Schritt, und indem sie das Köpfchen stolz erhob, sagte sie mit einem lebhaften Aufsprühen in den dunkeln Augen: „Ja – da Du es denn doch schon errathen hast! Es geschieht zum guten Theil auch um seinetwillen! Aber ich bitte Dich, daraus keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Heute abend wirst Du erfahren, wie es gemeint war.“
Sie traten in das Haus und konnten sich aus der Begrüßung, die ihnen zu theil wurde, leicht überzeugen, daß man ihretwegen ganz ohne Sorge gewesen war. Cilly bekundete im Kreise der Ihrigen sogleich eine Heiterkeit, welcher niemand anmerkte, daß sie nicht ganz natürlich war, und Marie hielt gewissenhaft das gegebene Versprechen. Keiner im Hause des Generals ahnte etwas von der Lebensgefahr, welcher sie kaum entronnen waren, und von dem unfreiwilligen Besuche, welchen Cilly dem Operationszimmer ihres zahnärztlichen Vetters abgestattet hatte.
[332] Der reich geschmückte Festsaal der Villa und die behaglichen Räume, welche sich unmittelbar an denselben anschlossen, wurden aus Gaskronen, Wandleuchtern und Kandelabern bereits mit einem Meer von Licht überfluthet; aber von den erwarteten Gästen war noch keiner vorgefahren. Bis auf die Generalin, die schon seit geraumer Zeit in einem moosgrünen Sammetkleide mit unendlicher Schleppe umherrauschte, um die Anordnungen an den Büffetts wieder und wieder mit Kennerblicken zu prüfen und hier und da einige auf die leiblichen Bedürfnisse der Gäste bezügliche Anweisungen zu ertheilen, – und bis auf den Assessor, der in seinem Arbeitszimmer über einem Aktenbündel saß, als hätte er von den festlichen Vorbereitungen in seinem Elternhause überhaupt keine Ahnung – befanden sich sämmtliche Mitglieder der Familie noch in ihren Zimmern, mit ihrem Anzug beschäftigt.
Cilly war bei ihren Angehörigen ein wenig dafür verrufen, daß sie mit dem wichtigen Geschäft des Ankleidens trotz aller Hilfe der Zofe niemals rechtzeitig fertig werden könne. Sie hatte um dieser leidigen Gewohnheit willen schon unzählige Neckereien Engelberts über sich ergehen lassen müssen, und vielleicht nur, um ihr für den heutigen Tag eine Wiederholung derselben nach Möglichkeit zu ersparen, beeilte Marie ihren eigenen Anzug so sehr, daß sie noch Zeit genug behielt, auch ihrer Base Beistand zu leisten. Sie selber hatte jede Hilfe abgelehnt, ja, sie hatte trotz alles Zuredens nicht einmal die weitberühmten Frisirkünste von Cillys Jungfer in Anspruch genommen, da sie ihr prächtiges Haar durchaus nicht anders zu tragen wünschte als an jedem sonstigen Tage. Und ein Blick in den Spiegel konnte sie belehren, daß sie recht daran gethan hatte. Die einfache Anordnung der dicken, lichtblonden Zöpfe, in denen einige frische Blumen als einziger Schmuck befestigt waren, stand ihr ohne Zweifel ungleich lieblicher zu Gesicht als irgend ein kunstreicher Aufbau, wie ihn die an der Seine geschulte Phantasie der Mademoiselle Chériette zu erfinden liebte. Und dieselbe anmuthige Einfachheit hatte sie auch in Bezug auf all ihren sonstigen Festschmuck walten lassen. Ein weißes Kleid von schlichtem Faltenwurf, durch eine zarte, schön gezeichnete Stickerei belebt und hier und da mit einer kleinen, duftigen Ranke lebendiger Blumen verziert, überließ den edlen Linien und den weichen Formen ihrer vollkommen ebenmäßigen Gestalt den wesentlich größten Theil der Aufgabe, sich im Wettstreit mit den weiblichen Schönheiten, die man heute erwarten durfte, zu behaupten.
Von kindlicher Freude über das liebliche Bild erfüllt, das ihr der hohe Ankleidespiegel zurückgeworfen hatte, verließ Marie ihr Stübchen, um sich zu dem in demselben Stockwerk gelegenen Zimmer ihrer Base zu begeben. Sie hatte nur den langen Gang zu durchschreiten, um dahin zu gelangen, und sie war so wenig darauf gefaßt gewesen, anderen Personen als etwa einem der Dienstboten zu begegnen, daß ihr ein Ausruf der Ueberraschung entschlüpfte, als sie plötzlich Engelberts schlanke Gestalt wie aus dem Boden gewachsen vor sich stehen sah.
Auch er erschien, in seinem Paradeanzuge stattlicher, glänzender und siegesgewisser als je, und obwohl Marie während der letzten Stunden gar nicht an ihn gedacht hatte, war es ihr doch nun mit einem Mal, als ob sie sich nur für ihn geschmückt hätte und als ob eine Aeußerung des Wohlgefallens aus seinem Munde ihr Lohns genug wäre. Und sie brauchte nicht lange auf eine solche Aeußerung zu warten. Nachdem Engelbert sie eine Sekunde lang mit brennenden Blicken betrachtet hatte, beugte er sich plötzlich nieder und preßte seine Lippen leidenschaftlich heiß auf ihren schönen Arm.
„Marie – meine Herzenskönigin!“ flüsterte er. „Du weißt nicht, Mädchen, wie berauschend schön Du bist!“
Das Lob war unzweideutig; aber es war vielleicht anders, als Marie es ersehnt und erwartet hatte. Sie wich zurück und legte die Hände auf den Rücken, als ob sie damit eine Wiederholung der stürmischen Liebkosung verhindern wollte.
„Du bist unartig, Engelbert,“ sagte sie schmollend. „Würdest Du gegen eine andere junge Dame Eurer Gesellschaft etwas derartiges wagen?“
Aber der Dragoneroffizier ließ sich jetzt nicht mehr so leicht aus der Fassung bringen wie damals im Gewächshause nach dem ersten Mittagessen. Seinen martialischen Schnurrbart zwischen den Fingerspitzen wirbelnd, sagte er mit dem zuversichtlichen Lächeln eines Mannes, der nicht einen Augenblick an die Ernsthaftigkeit des ihm ertheilten Verweises glaubt: „Gewiß, mein Herz – vorausgesetzt natürlich, daß ich ihr so gut wäre wie Dir! – Und nur, weil diese Voraussetzung in das Gebiet der unmöglichen Dinge gehört –“
Marie unterbrach ihn durch eine abwehrende Gebärde.
„Wie soll ich solchen Versicherungen Glauben schenken? Ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß Du gestern irgend einer Cirkuskünstlerin dasselbe gesagt hast?“
Engelbert legte die Linke auf die Brust und nahm eine feierliche Haltung an.
„Haben Cillys Lästerungen mehr Gewicht für Dich als mein Manneswort? Was soll ich thun, Dich von der Aufrichtigkeit meiner Liebe zu überzeugen?“
Seine Worte durchströmten sie mit einer süßen Empfindung des Glückes; aber sie fühlte trotzdem ein leises Bangen unter dem heißen Blick, der so verzehrend auf ihr ruhte. Sie hätte laut aufjubeln mögen in dem Bewußtsein, geliebt zu sein, und doch peinigte es sie, sich mit dem Manne allein zu wissen, in dessen Blute diese leidenschaftliche Liebe loderte. Nur um einen Vorwand zur Flucht zu finden, suchte sie das Gespräch ins Scherzhafte zu wenden.
„Beweise sie mir, indem Du jetzt ganz artig hinuntergehst und indem Du mich künftig nicht mehr mit einer Kammerzofe verwechselst, wenn der Zufall uns abermals auf einem Treppenflur zusammenführen sollte. Das ist doch gewiß ein bescheidenes und leicht zu erfüllendes Verlangen.“
Sie wollte an ihm vorüberhuschen, doch Engelbert vertrat ihr den Weg. Er hatte sie nie schöner gesehen als in diesem duftigen Gesellschaftsgewande.
„Warum mußt Du mir immer unter den Fingern entschlüpfen, wenn sich uns einmal Gelegenheit bietet, ernsthaft mit einander zu reden? Geschieht das nicht ohnedies leider selten genug?“
Schelmisch und doch nicht ohne geheimes Zagen sah sie zu ihm auf.
„Ernsthaft?“ fragte sie. „Hier? Zwischen sechs Thüren, von denen in jedem Augenblick eine aufgehen kann? Nicht nur Deine Geschwister würden Gelegenheit haben, uns zu überraschen, sondern sogar die Dienstboten.“
„Nun, wenn es durchaus nicht sein soll, so zahle mir wenigstens ein Lösegeld dafür, daß ich Dich freigebe! Gieb mir ein Unterpfand, daß Dein Herz nur mir gehört, damit mich nicht die bloße Vorstellung rasend mache, Dich nachher mit anderen plaudern oder gar tanzen zu sehen!“
Eines ernstlichen Widerstands kaum gewärtig, machte er den Versuch, sie wie damals an sich zu ziehen und zu küssen; doch Marie entzog sich ihm sehr entschieden, und ihre Haltung wie ihre Miene ließ ihn nicht im Zweifel über die Aufrichtigkeit ihres Unwillens.
„Nein!“ sagte sie, „nur in Gegenwart Deiner Eltern werde ich Dir das zum zweiten Mal gestatten!“
Sie verschwand in der Thür von Cillys Zimmer, ehe sich Engelbert über eine passende Erwiderung klar geworden war. Er spitzte die Lippen und pfiff leise ein paar Takte aus der Melodie des neuesten Gassenhauers vor sich hin.
„Das war deutlich!“ meinte er, während er die Treppe hinabstieg und langsam die weißen Handschuhe anzog. „Nun – warum auch nicht? Ich für meine Person hätte verteufelt wenig dagegen einzuwenden!“ –
Auch der General stand jetzt bereits in seiner gestickten Uniform und im blinkenden Schmuck seiner vielen Orden inmitten des Empfangszimmers, vollkommen bereit, sich der sauren Pflicht einer liebenswürdigen Bewillkommnung der zahlreichen Gäste zu unterziehen, von denen die ersten nunmehr jeden Augenblick eintreffen konnten.
„Meine theuren Angehörigen lassen mich allem Anschein nach wieder recht hübsch im Stich,“ sagte er, als Engelbert eintrat. „Die Mama ist plötzlich unsichtbar geworden, Cilly ist natürlich noch nicht mit dem Anziehen fertig, und Lothar – hast Du überhaupt etwas von Lothar gesehen?“
„Soll ich meines Bruders Hüter sein, Papa? – Wahrscheinlich brütet er über einem Mord oder einem schweren Diebstahl mit Dietrichen und Brecheisen. Seitdem er sich der Kriminaljustiz in die Arme geworfen hat, ist er für mich so gut wie unsichtbar geworden.“
[333] „Nun, ich werde einen Diener hinaufschicken, um ihn an seine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu erinnern. Uebrigens – auch Dir habe ich noch etwas zu sagen, Engelbert! Du hast neulich auf dem Essen bei Rochlitz den deutlichen Wink sehr rasch vergessen, welchen ich Dir gegeben hatte.“
„Einen Wink, Papa? – Ich weiß wirklich nicht. – Ah, – etwa wegen der kleinen Gräfin Hainried?“
„Du mußt ein schlechtes Gewissen haben, da Du sogleich erräthst, was ich meine. Dein nachlässiges Benehmen gegen die junge Dame streifte in der That beinahe an Unhöflichkeit.“
„Wie genau Du solche Kleinigkeiten doch beobachtest, Papa!“ meinte Engelbert heiter, indem er vor einen Spiegel trat und sich wohlgefällig in allen Muskeln reckte. „Es ist möglich, daß sie mir an jenem Tage nicht recht gefiel. Sie hatte den Schnupfen, und niemand wird im Ernste bestreiten wollen, daß selbst die Venus von Milo mit einem Schnupfen aufhören würde, begehrenswerth zu sein.“
„Das sind Albernheiten, mein lieber Engelbert, und ich deutete Dir schon an jenem Tage an, daß es mir lieb wäre, wenn Du die Sache gerade diesmal von einer etwas ernsteren Seite nähmest. Reckenstein macht kaum noch ein Geheimniß daraus, daß die Reibungen nach unten und oben, die bei seiner knorrigen Natur von vornherein unvermeidlich waren, ihn bereits herzlich amtsmüde gemacht haben, und daß er das Kriegsministerium lieber heute als morgen verließe, wenn nur das Kommando eines Armeecorps frei wäre, das ihm versprochen worden ist. Darüber aber, daß kein anderer als Hainried, der unermüdliche Arbeiter und ausgezeichnete Redner, sein Nachfolger auf dem Ministersessel werden wird, waltet in eingeweihten Kreisen längst nicht mehr der geringste Zweifel.“
Engelbert drehte sich auf dem Absatz herum und schnitt eine drollige Grimasse des Entsetzens.
„Heirathspläne also, Papa? Schauderhaft!“
„So hoch versteigen sich meine Hoffnungen gar nicht! Ehe da vom Heirathen die Rede sein könnte, müßtest Du einem halben Dutzend von Nebenbuhlern den Rang ablaufen, die ihr Rößlein allem Anschein nach besser zu tummeln verstehen als Du.“
„Oho, wenn es nur darauf ankäme! Ich wollte ihnen zwanzig Längen vorgeben und sie doch noch alle mit einander um eine Nase, und zwar um eine recht lange, schlagen. Aber wenn es Dir wirklich Spaß macht, Papa, mich als girrenden Täuberich um dies verschnupfte Täubchen stolzieren zu sehen, so will ich Dir als guter Sohn mit Vergnügen gehorsam sein. Ich werde der Gräfin Hainried auf Tod und Leben den Hof machen, sollten sich auch die beiden Rochlitz darüber grün und gelb ärgern.“
Rasch nach einander rollten draußen die ersten Wagen vor; der General seufzte ein wenig und legte dann sein lebhaft gefärbtes, fast jugendlich frisches Gesicht in die verbindlichsten und liebenswürdigsten Falten. –
In einer Gesellschaft, die zum weitaus größten Theile aus Offizieren und ihren Damen bestand, nahm man es mit der Pünktlichkeit des Erscheinens ziemlich genau. Im Verlauf einer kurzen halben Stunde hatten sich die erhellten Gemächer mit einer sehr glänzenden Versammlung in bunten, blitzenden Uniformen und kostbaren, über Parkett und Teppiche rauschenden Gewändern gefüllt.
Da man unter einander fast durchweg gut bekannt war, herrschte von vornherein eine sehr angeregte Stimmung, das Geräusch einer allgemeinen, lebhaften Unterhaltung schwirrte durch die Säle, und namentlich den heiteren Mienen der Jugend beiderlei Geschlechts war es unschwer anzusehen, daß man sich äußerst vergnügliche Stunden versprach.
Sollte es doch auch eine rechte Tanzgesellschaft werden, bei welcher die junge Welt nicht durch die Marter eines stundenlang ausgedehnten Abendessens zur Verzweiflung gebracht werden würde. Auf den ersten Walzer sollte eine Erfrischungspause folgen, während der an kleinen Tischchen zu verspeisen war, was die aufgestellten Büffetts in verschwenderischer Fülle an auserlesenen Leckerbissen boten. Es war darum natürlich, daß derjenige Kavalier, welchem eine Dame diesen Walzer gewährte, auch ihr Ritter während der Erfrischungspause blieb, und jeder, dem es darum zu thun war, sich die Gunst irgend einer holden Ballelfe zu gewinnen, beeilte sich deshalb, seinen Nebenbuhlern für den bedeutsamen Tanz den Vorrang abzulaufen.
Der Zug gegen Rom. – Frundsbergs und Bourbons Ende. – Erlebnisse eines Leichnams.
Nicht bunt genug kann man sich den Heereszug denken, welchen Frundsberg nach Italien führte. Zwar es fehlten ihm manche Bestandtheile einer „wohlbestellten Armada“. Es war November; die Südausgänge der Alpen waren von den Feinden wohl verwahrt, und so galt es, in ungünstiger Jahreszeit auf wenig betretenen Wegen über das Gebirge zu kommen, um auf weitem Umweg durch das feindliche Venetien sich mit dem in Mailand bedrängten Bourbon zu vereinigen. Es fehlten also die prunkenden Ritterkompagnien, es fehlte die damals noch überaus schwerfällige Artillerie. Geschütze gedachte Frundsberg in Italien zu erobern oder von dem Kaiser zugewandten Fürsten zu entlehnen.
Aber schon der Landsknechte Aufzug allein mußte den wunderbarsten Anblick gewähren. Vor den größeren Abtheilungen ritten im prachtvollen Harnische, umgeben von Trabanten, die höheren Offiziere – Frundsberg, der Kommandirende, allerdings auf einem bedächtig schreitenden Maulthier. Vor jedem Fähnlein schritt der möglichst in die Farben des Regenbogens gekleidete Fähndrich mit der gewaltigen, „thurmhohen“ Fahne, hinter ihm kamen die Pfeifer und die Trommler mit Trommeln, groß wie Weinfässer, die Hälfte des „Gespiels“ vor den Hakenschützen, die andere Hälfte vor den langen Spießen. An sie schloß sich dann der Haufe der Landsknechte, jeder nach Laune und Umständen bewehrt, mit Sturmhaube, geschlossenem Helm, hohem Filzhut, Federbarett, in ganzen und halben Panzern; manche mit vollem Harnisch bis zum Knie, andere in Lederkollern, Kettenhemden und Kragen, gefältelten, geschlitzten, zerhackten, in grillenhaften Farben durcheinander schillernden Wämsern, mit dem ausschweifendsten Schnitte der Hosen, von den bis zum Knöchel [334] sich bauschenden Pluderhosen bis zu der aufs engste von der Hüfte bis zum Knöchel sich anschmiegenden Reiterhose; wieder andere – was für besonders stutzerhaft galt und auch von Hauptleuten geübt wurde – den einen Strumpf herabgestreift, so daß das eine Bein nackt war. Diese Sitte erregte namentlich am französischen Hofe, wo aus Gründen das Wattiren im Schwange war, weidliches Aufsehen. Dazu kam noch die verschiedenste Tracht der Haare und des Bartes. An Waffen endlich führte jeder, was von Väter Zeiten zu Hause aufgehängt gewesen war oder die Beute früherer Kriege ihm in die Hand gespielt hatte: Federspieße mit buntem Schmucke, lange Spieße mit verschiedenst geformten Spitzen, Hellebarden, Partisanen, schwere Hakenbüchsen, Schlachtschwerter, daneben Kolben, Fausthämmer, die kurzen breiten Landsknechtsdegen, verschieden geformte Dolche. Hinter dem Gewalthaufen endlich folgte der Troß der Weiber und Buden, geführt von einem eigenen Weibel, der außer den Waffen noch einen etwa armlangen „Vergleicher“ zur Schlichtung von Streitigkeiten führte.
Schwer lag der gefährliche Zug auf Frundsbergs Seele. Von seiner Stimmung mag ein Traum zeugen, den er zu Botzen hatte. Er glaubte im Traume seinen vor etlichen Jahren verstorbenen Bruder Adam zu sehen, welcher zu ihm sprach: „Bruder Georg, es ist ein schwerer Zug, Du wirst schwerlich über die Pässe und über die Furthen der Wässer kommen und Du wirst den Haufen führen, daß kaum tausend Mann überbleiben werden.“ Dieses Gesicht hatte er, wie bezeugt, schon früher in gefährlichen Kriegsläuften gehabt. Schon in Trient von Geldnoth bedrängt, stieg er doch muthig am 17. November auf engem, steilem Bergpfad drei deutsche Meilen hinan. Die Rosse und Maulthiere mußten einzeln geführt werden; neben ihm selbst, dem schweren Manne, hielten Landsknechte lange Spieße auf der Seite des Abgrunds als Geländer; er faßte wohl auch einen starken Knecht von hinten am Koller, der ihn zog, während ein anderer schob. So kamen sie auf einem Weg, wo kein Italiener sich eines Feindes versah, auf venetianisches Gebiet. Ein armseliges Bergdorf wurde zu des Feldherrn großem Unwillen als der Republik gehörig alsbald verbrannt wie ein Vorzeichen der bösen Art, welche der Krieg annehmen sollte. Wie ein die Zukunft verhüllender Vorhang lagen die Nebel vor der italischen Ebene, welche am 19. November unweit Brescia, bei Gavardo an der Chiese, erreicht wurde.
Als Karl v. Bourbon das Herannahen Frundsbergs vernahm, tauchte in ihm, welcher nur durch außergewöhnliche Unternehmungen seine innere Unruhe zu betäuben, aus unbefriedigender Stellung und getäuschten Hoffnungen heraus zur Höhe seiner ehrgeizigen Pläne sich emporzuschwingen hoffen konnte, allerdings der kühne Plan auf, Rom selbst zu nehmen. Wenn aber einzelne Zeitgenossen, wie z. B. der Augenzeuge der Plünderung von Rom, Cäsar Grollier, behauptet haben, unter den 18000 Mann, welche Frundsberg schließlich gegen Rom führte, seien 14000 Anhänger der verfluchten lutherischen Sekte und außerdem noch 4000 von besonders teuflischem Hasse gegen den heiligen Vater beseelte Juden gewesen, die Plünderung Roms sei von Anfang an der Zweck des Feldzugs gewesen, so kommt darin lediglich die Stimmung der Päpstlichen nach dem Falle Roms zum Ausdrucke.
In der italienischen Ebene fand Frundsberg die verworrensten Verhältnisse vor. Die verschiedenen kleinen Gewalthaber in stetem Gedränge zwischen dem Kaiser, den Eroberungsgelüsten der Päpste und der Republik Venedig, meinten es mit keinem Theile ehrlich, haßten aber jedenfalls am meisten – und wer wollte es ihnen heute verdenken? – die Fremden von jenseit der Alpen. Wurde hierdurch Frundsbergs Lage schon schwierig, so that in den sumpfigen Niederungen Norditaliens die winterliche Jahreszeit das Uebrige. Der gerade Weg nach Mailand war dem kaiserlichen Feldherrn, der an Bourbons Oberbefehl gewiesen war, durch feindliche Streitkräfte verlegt; die gebotenen Umwege zwangen also zur Ueberschreitung zahlreicher winterlich geschwellter Flüsse, während man im übrigen auf schmale Dammstraßen angewiesen war. Auf diese Umstände baute der Herzog von Urbino mit Giovanni de’ Medici, dem Führer der „schwarzen Banden“, von dessen fast im Jünglingsalter erworbenem Feldherrnruhme die Italiener die Schöpfung einer den deutschen Landsknechten gewachsenen nationalen Wehrkraft erhofften, einen Plan, die Deutschen sicher zu verderben. Der Markgraf von Mantua, von jenen ins Einvernehmen gezogen, lud den bei Borgoforte am Po angelangten Frundsberg, welcher sehr ungehalten war, weder Schiffe noch Brückenmaterial vorzufinden, mit seinen höheren Offizieren zu einem ausgesucht köstlichen Abendessen, indem er zugleich die betrügliche Mittheilung machte, daß der Papst mit dem Kaiser Frieden geschlossen habe. Auch die Knechte wurden reichlich bewirthet. Es sollte, so hatten die Italiener gerechnet, „den Barbaren das letzte Nachtmahl gereicht werden“. Mit Bestimmtheit erwarteten die freundlichen Gastgeber, die Deutschen vom Vornehmsten bis zum Niedrigsten würden sich im Trinken dergestalt übernehmen, daß sie zur Ernüchterung bis spät in den nächsten Tag hinein des Schlafes benöthigen würden. In der Zwischenzeit sollten ihnen alle Brücken über den Po und Mincio, sowie alle Dämme verlegt werden; dann wollte man sie mit Feldschlangen, Büchsen und Hellebarden aufwecken.
Aber die Welschen hatten wohl den Durst der Deutschen, nicht deren Leistungsfähigkeit erkannt. Frundsberg hielt sich, so wohl er es sich auch schmecken ließ, nüchtern und wußte obendrein den ihrer Sache sicheren Italienern noch so geschickt allerhand Andeutungen zu entlocken, daß er sie überlistete. Als die Feinde anrückten, dem deutschen Bären das Fell über die Ohren zu ziehen, war dieser durch einen nächtlichen Gewaltmarsch bereits außer Gefahr und über dem Mincio. Nur die Nachhut vermochten die Italiener noch zu bedrängen; aber als sie auch am Mincio den Deutschen noch keine Ruhe ließen, da richtete Frundsberg selbst die beiden Falkonetlein, welche gerade in dieser Stunde als Geschenk des damals dem Kaiser zugewandten Herzogs Alfons von Ferrara angekommen waren, und die zweite Kugel, welche er den Italienern als Quittung für ihr Abendessen zusandte, zerschmetterte dem Giovanni de’ Medici die Kniescheibe, an welcher Verwundung der junge Kriegsmann, die Hoffnung des damaligen Italiens, fünf Tage später verstarb.
Noch länger als zwei Monate, bis zum 7. Februar 1527, währte es, ehe Bourbon und Frundsberg südlich des Po ihre Vereinigung bewerkstelligen konnten, während welcher Zeit Frundsberg, vom Kaiser anscheinend vergessen, vom Herzog von Ferrara nur widerwillig und durchaus ungenügend mit Geld unterstützt, häufige Kämpfe zu bestehen hatte und das gerechte Verlangen der Knechte nach Sold nur zum kleinsten Theile befriedigen konnte. Inzwischen war Bourbon in Mailand aber auch nicht auf Rosen gebettet gewesen. Nicht aus bösem Willen hatte er gezögert, Frundsberg entgegenzuziehen, vielmehr war der auch ihn drückende völlige Geldmangel es gewesen, der ihm jede planvolle Bewegung unmöglich gemacht hatte. Während die deutschen Landsknechte in Mailand unter Frundsbergs Sohn Melchior, obgleich auch sie keinen Sold zu sehen bekamen, doch noch willig blieben, weigerten sich die Spanier, Mailand überhaupt zu verlassen, ehe sie bei Heller und Pfennig bezahlt wären. In seiner Bedrängniß schritt Bourbon zu den gräulichsten Mitteln; er preßte den Bürgern Mailands, zum Theil unter Anwendung der Folter, ihr letztes Geld aus und schenkte u. a. dem wegen Hochverraths zum Tode verurtheilten Hieronimo Morone in der Nacht vor der angesetzten Hinrichtung das Leben, nachdem der geizige Italiener nicht ohne langes Feilschen, sozusagen angesichts des Richtblocks, sich seufzend bereit erklärt hatte, 20000 Dukaten, aber auch nicht einen Pfennig mehr, zu bezahlen. Nun aber machten die Spanier, denen dieses Aussaugungssystem zusagte, neue Schwierigkeiten, und Bourbon hatte sie noch aufs beweglichste zu bitten, bis sie sich bequemten, wieder von seinen Befehlen Notiz zu nehmen.
Als sich die beiden Feldherren unweit Piacenzas trafen, war eine Streitmacht, wie sie der Kaiser selten beisammen gesehen hatte, 32000 Mann Fußvolk und Reiterei, unter seinen tüchtigsten Generalen vereinigt. Insbesondere war das Heer jetzt auch ausgiebiger mit Feuergewehren versehen, denn Frundsberg hatte nur 1500 Hakenschützen mit sich geführt. Das erste, was der Oberbefehlshaber Karl v. Bourbon nunmehr that, war, den Herzog von Ferrara um weitere Geldunterstützung und namentlich um Geschütz zu ersuchen, aber der entzog seine Person den Bedrängern und hinterließ ihnen den Rath, nur schnurstracks nach Rom zu ziehen und dort an den Anstifter des ganzen Krieges ihre Forderungen zu richten.
Schon zehn Tage nach der Vereinigung beider Heere meuterten die Spanier wieder um Sold, und nun folgte die Katastrophe. Nach langem Hin- und Herverhandeln bewog der über die Anwesenheit des kaiserlichen Heeres an seinen Grenzen erschrockene Papst den auf der Seite des Kaisers kämpfenden Vicekönig von Neapel Lannoy zum [335] Abschlusse eines Waffenstillstandes, ohne daß dieser vorher Bourbons Einwilligung eingeholt hätte, unter Bedingungen, welche auch nicht entfernte Aussicht auf die Befriedigung der Sold heischenden kaiserlichen Knechte gaben. Alsbald entließ der Papst sein Heer, in der Ueberzeugung, daß das kaiserliche Heer ohne Waffengewalt durch Meuterei sich auflösen und so seine Bestandtheile der Vernichtung preisgeben würde. Päpstliche Sendlinge waren es, welche unter die bei schlechtem Wetter, abgerissen, zum Theil ohne Schuhe und ohne Geld zwischen S. Giovanni und Bologna lagernden Kaiserlichen die Nachricht von jenem Waffenstillstand trugen. Alsbald erhoben sich die Spanier. „Wie Bettler,“ schrieen sie, „sollen sie durch den Verrath des Vicekönigs aus Italien verstoßen werden,“ und mit dem aufreizenden Rufe: „Lanz, Lanz (Landsknechte)! Geld, Geld!“ steckten sie schließlich auch die ruhigeren Deutschen an. Brüllend wälzte sich der Haufe nach dem Zelte Bourbons, an dessen Eingang ein ruhegebietender Diener niedergestochen wurde. Aber der Oberfeldherr hatte sich schon zu Frundsberg, seinem „lieben Vater“, geflüchtet und dort unter dem Stroh des Stalls ein Versteck gefunden, nur an seinem Waffengeräth, seinem goldgestickten Waffenrocke, den man anderen Tages im Stadtgräben von S. Giovanni fand, konnten die Rasenden ihre Wuth auslassen.
Da berief Frundsberg am 16. März die Landsknechte zur Gemeinde und redete „mit großem Ernste, beweglich, wie noch nie ein Mensch geredet, daß es einen Stein sollte bewegt haben“, zu ihnen. Aber zum ersten Male hörten die Verwilderten nicht auf die Worte ihres „allzeit lieben Vaters“, ja, einige Wüthende ließen sogar die Spieße gegen ihn nieder. Da drängte sich ob dem Unerhörten Frundsberg das Blut nach dem Kopfe, Kraft und Sprache verließen ihn, und er sank auf eine Trommel, die ein Landsknecht schnell ihm unterstellte. Noch erholte er sich auf kurze Zeit, ohne jedoch die Sprache wieder völlig zu gewinnen; aber als er nach dem mit seinen Hauptleuten genommenen Morgenmahl sich an den Kamin zum Feuer stellte, überfiel Lähmung seine Glieder, und er mußte zu Bett getragen werden. Nun besannen sich die Wüthenden, um so mehr, als der Herzog von Ferrara doch einiges Geld schickte. Frundsbergs kriegerische Laufbahn aber war zu Ende, keine Klage, keine Thräne konnte den bösen Schlagfluß wieder von ihm nehmen. Er verordnete noch Konrad v. Bemmelberg zu seinem Stellvertreter, dann ließ er sich am 22. März nach Ferrara bringen, dessen Herzog auch später, nachdem er aus dem Lager des Kaisers in das der Feinde übergegangen war, ihn mit ritterlicher Freundlichkeit pflegte. Bezeichnend bleibt es, daß Ariost, welcher alle romanischen Helden seiner Zeit im „Rasenden Roland“ geschildert hat, seiner nicht erwähnt. Im Frühjahr 1528 ließ Frundsberg sich weiter nordwärts bringen, um endlich am 12. August desselben Jahres nach Mindelheim zu gelangen und acht Tage später dort zu sterben.
Mit Frundsbergs Erkrankung war Karl von Bourbon auf sich selbst angewiesen; er stand an der Spitze eines Heeres, welches der Kaiser anscheinend vergessen hatte, das daher, wenn der Papst sich nicht zur Abkaufung des Aeußersten bewegen ließ, geradezu gezwungen war, in räuberartiger Weise sich seinen Unterhalt zu verschaffen. Der Feldherr wußte, daß seine Scharen im Felde den Feinden mehr als gewachsen und zu jeder kühnen, abenteuerlichen That, wenn sie nur Beute verhieß, bereit waren; er wußte auch, daß sein und der Offiziere Leben stündlich in Gefahr schwebte, sobald den wilden Gesellen der Mangel wieder auf den Leib rückte oder die Zügel straffer gezogen wurden. So war er denn darauf angewiesen, auf irgend eine große, reiche Beute verheißende Stadt loszugehen, ehe noch das Heer in den fortwährenden Feindseligkeiten mit den schwärmenden Reitern der Liga und dem verzweifelnden Landvolke, dessen Dörfer, Flecken und Höfe tagtäglich hinter den breit daherziehenden Haufen in Rauch aufgingen, allzusehr zusammengeschmolzen war. Die Verhandlungen des Papstes mit dem Vicekönig von Neapel, die immer nur zu Geldversprechungen führten und von seiten des ersteren lediglich dem Zwecke dienen sollten, Bourbons Heer durch ungewisse Hinzögerung zur Auflösung zu bringen, zwangen diesen vollends, dem ungewissen Hin- und Herziehen ein Ende zu machen, auf ein bestimmtes Ziel zuzustreben. Nachdem er einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, Florenz zu überrumpeln und an dieser Stadt ein Exempel zur Warnung des Papstes zu statuiren, eilte er geradeswegs auf Rom zu.
In dieser Stadt war man des Entsetzlichen nicht gewärtig; obgleich der Vicekönig Lannoy von Neapel, als er mit karger Abschlagssumme sich in das Lager Bourbons gewagt hatte, von dort nächtlicher Weile hatte fliehen müssen, um sein Leben vor den wüthenden Knechten zu retten, obgleich ein Bußprediger in härenem Gewande auf den Straßen Roms den Untergang der Stadt prophezeite, hofften Papst und Bürgerschaft immer noch, Karl von Bourbon werde wie einst Attila, vom Schrecken Gottes ergriffen, angesichts der heiligen Stadt umkehren.
Rom bildete damals noch zwei völlig getrennte und besonders befestigte Städte, die „Leoninische Stadt“ mit dem Vatikan und das „Trastevere“ um den Janiculus. Der niedrige Thalgrund zwischen beiden war noch wenig bebaut und lag offen da.
In diese Lücke drang Bourbon mit seinem Heere ein, nachdem er demselben vom Monte Mario aus die herrliche Stadt gezeigt hatte. Er mußte rasch handeln; des Kaisers Schweigen legte er nicht unrichtig als Einwilligung aus; seine Aufforderung zur Uebergabe oder um Durchlaß nach Neapel wurde von beiden Städten kurz abgewiesen, und dabei zogen sich von allen Seiten ligistische Heerscharen heran, dem Papste trotz seines Austritts aus der Liga Beistand zu bringen. Die Werke Roms waren verfallen und schlecht mit Geschütz versehen, die Bürgerschaft als unkriegerisch bekannt. In der Abenddämmerung des 5. Mai 1527, versammelte Bourbon in dem düsteren gothischen Gewölbe der Kirche zu S. Onofrio die Obristen, Hauptleute, Fähndriche und Doppelsöldner und kündigte ihnen seinen Entschluß an, die Stadt mit stürmender Hand zu nehmen, da eine Beschießung nicht thunlich sei, hätten sie ja doch das Geschütz auf ihrem Zuge längst dahintengelassen. Die gleichzeitigen romanischen Chronisten lassen ihn eine Rede im Stile der alten römischen Imperatoren oder vielmehr in dem eines Livius halten; die deutschen Berichte wissen nur vom Tagesbefehl für das Unternehmen zu berichten. Aber im Innersten tief bewegt mag der heimathlose, jetzt noch mit dem Bann belegte Fürst in dieser Stunde gewesen sein. Er versprach den Knechten, im Sturm voranzugehen. Die Deutschen lehnten dies Anerbieten ab, die Spanier ließen ihm den Vortritt auf der Todesbahn.
Die in der Stadt hatten die Nacht über, so gut es in der Eile ging, geschanzt und die Werke ausgebessert. In der nebligen Morgenfrühe des 6. Mai begann der Sturm an verschiedenen Stellen. Karl von Bourbon, in glänzender Rüstung den Spaniern voranschreitend, ward, als er eben eine von ihm selbst angelegte Sturmleiter hinaufklomm, von einem römischen Schützen trotz des Nebels bemerkt, und im nächsten Augenblick stürzte er, getroffen von zweilöthiger Kugel da, wo Schenkel und Unterleib sich zusammenschließen, zurück. Noch wird die Stelle, wo er gefallen ist, bei der Villa Barberini gezeigt. Er selbst ließ sich in die nahe Kapelle des Campo santo tragen, wo er einige Stunden später starb. Die Kunde seines Falles hatte nur die Wirkung, die Stürmenden zur äußersten Wuth zu reizen, und bald darauf gelang es den Deutschen, bei S. Spirito die Mauer zu übersteigen. Niklas Seidensticker, Hauptmann und Profoß, war der erste, welcher auf der Mauerkrone stand und mit seinem mächtigen Zweihänder die Vertheidiger von den Brustwehren trieb. Wenige Stunden nach Bourbons Tode war Rom in den Händen der Kaiserlichen.
Von den gräßlichen Scenen der Plünderung, welche dem Sturme folgten, von der Belagerung des Papstes in der Engelsburg, seinem Entweichen nach geschlossenem Vergleich, von den furchtbaren Leiden der Stadt unter der Herrschaft der zuchtlosen Horden durch das ganze Jahr 1527, von den blutigen Aufständen der letzteren gegen ihre Hauptleute können wir hier nicht erzählen. Es genüge die Bemerkung, daß alle gleichzeitigen Schriftsteller zugeben, die Deutschen, so roh und wild sie sich zeigten, seien an Geld- und Blutdurst sowie an Grausamkeit und wilden Begierden von den Spaniern weit in Schatten gestellt worden. Endlich, im Februar des Jahres 1528, zogen die Deutschen aus der „stinkenden Mördergrube“, noch 5000 Mann stark, nach Neapel, wobei sie unterwegs, allen Lebensunterhaltes baar, noch die Stadt Narni erstürmten und plünderten. Etwa 1500 kamen Ende des folgenden Jahres noch nach Deutschland zurück.
Etwas später erst folgte, von der größeren Beute beschwert, der Ueberrest der Spanier. Es umgiebt selbst diese blutigen Scharen mit dem Abglanze kriegerischen Heldenthums, daß sie bei ihrem Abzuge des todten Feldherrn nicht vergaßen. Seine [336] einbalsamirte Leiche hatte bis dahin in der sixtinischen Kapelle gestanden. Nach dem Abzuge der Seinen wäre sie jedenfalls schimpflich von dort entfernt worden. Als kostbare Bürde führten sie daher den Leichnam mit sich nach der Felsenfeste von Gaeta. Dort, in der kleinen Kapelle am Eingang der Citadelle, errichteten sie dem todten Feldherrn von ihrer Beute ein prächtiges Grabmal. Den künstlich gemeißelten Grabstein bedeckte ein goldenes Tuch mit dem Wappen der Bourbons, jedoch ohne den französischen Orden des h. Michael und das goldene Vließ. Darüber hing eine Fahne von gelbem Taffet, mit schwarzen und weißen Streifen, geflügelten, Flammenschwerter tragenden Hirschen und den Worten „Espérance, Espérance“ (Hoffnung) bestickt.
Aber die Rache Roms fand die Leiche des Gebannten auch in dem festen Gaeta. Das tridentinische Konzil ließ das Grabmal abbrechen und den Sarg in einem Gewölbe verstecken. Dort fand 150 Jahre später, also nach dem spanischen Erbfolgekrieg, der kaiserliche Gouverneur von Gaeta, Graf Prampero, die ausgedörrte Mumie. Eine rohbarockere Art als diejenige, in welcher dieser Haudegen nun seine Verehrung für die Ueberreste „eines früheren hohen Kameraden“ glaubte ausdrücken zu müssen, läßt sich nicht denken. In der vorhin erwähnten Kapelle ließ er 1719 einen Glasschrank anbringen, und in diesen stellte er – der scheußlichste und zugleich lächerlichste Anblick – das geschwärzte Skelett, dessen fehlende Kinnbacke durch eine hölzerne ersetzt war. Der Leichnam wurde dann völlig bekleidet, nicht etwa mit ritterlichem Schmucke, sondern mit der militärischen Stutzertracht damaliger Zeit. Den Schädel bedeckte, als Joh. G. Keyßler 1730 die Citadelle besuchte, ein Federhut nebst Allongeperücke, um die dürren Gebeine schlotterte ein blauer Rock mit silbernen Knöpfen; ein Stock, auf welchen die eine Knochenhand sich stützte, ein Degen nebst Schärpe, gelbe Stiefeln mit rothen Hacken und über dieselben herabhängende, spitzenbesetzte Strümpfe vervollständigten die unglaubliche Ausstattung. Zwei spanische Verse über dem Schrein, in denen der Todte selbst redend eingeführt wurde, zeichneten in Kürze das unruhige Leben des Bourbon, das ihn von Frankreich schließlich an diese Stätte gebracht hatte. Zur Seite des Schreins standen zwei gleichlautende weitläufigere Inschriften, italienisch und französisch, in welchen Graf Prampero nicht vergaß, sich als den Urheber dieses „Denkmals“ zu rühmen, das er errichtet, „um den Dienern des sehr gerechten Kaisers Karl VI. ein bewunderungswürdiges Beispiel zu gehen“, nämlich wie treue Dienste noch nach dem Tode kaiserlich belohnt werden.
Die Offiziere der Besatzung trieben ihre „Verehrung“ noch weiter; wenn ihnen bei ihren Gelagen der Wein die Köpfe erhitzt hatte, ließen sie sich den Schädel Bourbons aus der Kapelle holen, um aus demselben rundum Gesundheiten zu trinken. „Als aber dabei etliche Male Verdrießlichkeiten und Unglück unter den Zechern entstanden, ist solche Unordnung gänzlich untersagt worden.“ Wann die barbarische Ausstellung aufgehört hat, und was weiter mit den Ueberresten geschehen ist, habe ich nicht erforschen können.
So fand Karl von Bourbon, der Landflüchtige, vom Ehrgeiz Gehetzte, auch im Tode noch keine Ruhe; Feind und Freund vereinigte sich, ihn in seiner Gruft aufzustören, und die täppische Verehrung, welche ein Prampero ihm bezeigte, gestaltete sich geradezu zum Hohne, ganz entsprechend damit allerdings dem Ende, welches der Heerzug selbst genommen hatte, auf dessen Gelingen Bourbon nochmals alles gesetzt, um sich den Namen des Helden seiner Zeit zu ertrotzen, und der ihm den Tod gebracht. Und dieser Heerzug selbst war typisch für das ganze System, welches den Kriegsdienst auf das freie Belieben des einzelnen stellte. Der vergleichende Rückblick auf jene Zeit ist gerade gegenwärtig nicht ohne ganz besonderen Werth.
Warum sie sich doch gar so feind waren, die zwei jungen Leute! Sie lebten nicht beisammen, sie waren nicht miteinander verwandt, sie hatten miteinander nichts zu thun, sie waren sich ganz fremd, ja miteinander nicht einmal verheirathet – und doch die große Feindseligkeit! Er war der Jungbauer des Zeiselhofes und ging sie nichts an; sie war Wiesendirn beim Teutbauer und ging ihn nichts an. – Daß beide jung, sauber und frisch, ist denn das eine Ursach, sich spinnefeind zu sein?
Der Zeiselhof und das Teutbauernhaus lagen weit voneinander ab, es zog sich zwischen beiden eine tiefe Schlucht, in welcher Dornsträucher wuchsen, gleichsam, als wollte die Natur selbst mit scharfen Ruthen winken: Jungleute! bleibt euch einander vom Leibe! Doch am Sonntage kamen die Leute zusammen auf dem Dorfplatze und in der Kirche – und da war der Teufel los.
Das einemal drängte der Gregel, der Zeiselsohn, sich wie zufällig an der Susi, der Teutbäuerischen, vorüber und trat ihr wie zufällig auf die Zehen. „Auweh!“ fühlte sie, „Auweh!“ dachte sie, aber „Auweh!“ schrie sie nicht. – Wart’ nur, mein lieber Gregel, es kommt der zahlende Tag! – Einstweilen hing sie ihm Spottnamen an, und das sei ein jämmerlicher Zwerg, der den armen Mädeln auf die Zehen steigen müsse, um in die Welt gucken zu können. Ein anderes Mal versetzte er ihr einen gelinden Ellbogenstoß, der zwar nicht wehthat und doch wieder wehthat, weil er höchstwahrscheinlich in der Absicht gegeben war, daß er wehethun sollte. Im Gedränge erwischte sie seinen Hut, that heimlich die Hahnenfeder herab und steckte dafür eine Brennessel hinauf. Der Gregel sah die Missethäterin nicht, ahnte sie aber, und bei einer nächsten Gelegenheit steckte er ihr eine handvoll Sägespäne am Nacken hinter das Kleid hinab.
„Zeiselbua! Zeiselbua!“ schrie sie ihm zornglühend ins Gesicht. – Zeiselbua! Zeiselbua! hallte es noch lange nach in ihrem bitteren Herzen. Und auf einmal wurde in der Gegend folgendes Liedchen gesungen:
„Zeiselbua! Zeiselbua!
Zeiselbua Gregel!
Er spannt drei Paar Ochsen zsamm’,
Fahrt um zwei Vögel!“
Und wie nach solchen Tücken und Torten ihre Blicke sich begegneten! Herrgotts Kreuz! War das ein Feuer in den Augen! Wenn das nicht gut bewacht wird, wenn es jählings losbricht …!
[337]
[338] Einmal war im Sternstammhofe ein Brechelfest. Von der Nachbarschaft waren die jungen Leute zusammengeladen worden zum Flachsbrecheln und zu einem Tanz am Abende. Vor dem Tanz war eine Mahlzeit, bei welcher Weinbeersterz aufgetragen wurde. Die Wiesendirne Susi war auch anwesend und der Zeiselhofer Gregel war ebenfalls vorhanden, und der Gregel wußte, daß die Susel den Weinbeersterz so gern esse. Vor dem Essen entwendete er ihr den Blechlöffel, feilte ihn heimlich am Halse zum größten Theile durch, und als sie nachher ihren Löffel zur Hand nahm und harmlos mit demselben in die Weinbeersterzschüssel fuhr, hatte sie auf einmal nur den Stiel in der Hand und die Schaufel stak losgebrochen im Sterz. Das Gelächter war erschütternd, die Tischnachbarn wollten sie entschädigen und ihr mit den eigenen Löffeln Sterz in den Mund führen. Die Susi aber sagte trotzig, sie könnte sich schon selber ernähren, nahm einen andern Löffel, that, als kümmerte sie sich nicht um den Spott, der ihren Schaden begleitete, aß tapfer drauf los und dachte: „Weiß es recht gut, wer mir’s gethan hat. Wir wollen schon einmal abrechnen, falsches Bübel!“
Nicht lange hernach war Kirchweih. Der Gregel stand in Hemdärmeln, denn so einem Burschen ist immer warm, vor einer Bude und feilschte um eine Tabakspfeife; das Rauchen thut ihm zwar nicht gut, aber endlich wird es doch gelernt werden müssen, sonst glauben die Weibsbilder, er könne nichts vertragen. Das Gedränge war groß, und als der Bursche sich aus demselben hervorgewunden hatte, um ins Wirthshaus zu gehen, merkte er auf einmal, daß ihm sein Beinkleid niederwärts rutschte. Waren ihm unversehens die Hosenträger abgezwickt worden, und nun mußte er zum Gaudium der Leute das flüchtige Kleidungsstück mit den Händen halten, bis die Wirthin ihm mit frischen Banden zu Hilfe kam.
Der Gregel ahnte den Feind sofort. Und zum Ueberfluß rief ein Kamerad: „Du, das schaut der Teutbauerndirn gleich! Willst Du Dir das gefallen lassen? Der wollen wir aber doch auch einmal etwas anthun, komm!“
„Was geht Dich die Teutbauerndirn an!“ brauste der Gregel auf. Mit funkelndem Auge und mit geballten Fäusten stand er vor dem unternehmungslustigen Kameraden, daß dieser schwieg und sich verzog.
Wenige Monate später war Nikolausabend. Als die Susi in ihre Kammer ging und sich ins Bett legte, that sie einen Schreckruf. Im Bette raschelte es, Knoten und Knollen rollten durcheinander, und bei Lichte zeigte sich’s, das Bett war voller Nüsse. Jetzt, das war eigentlich kein Unglück, Nüsse naschen, das that sie gerne, und den Nikolo, der ihr sie gebracht hatte, glaubte sie auch zu errathen. Sie untersuchte nur noch die Kammer, ob sich am Ende nicht auch etwas anderes vorfinde – gottlob, das war nicht. Auch vor ihrem Dachfenster keine Leiter. Sie verschloß sorgfältig die Thür, begann Nüsse zu knuspern und schmiedete Rachepläne gegen den muthwilligen Störer ihrer nächtlichen Ruhe.
Die Leser bangen wohl nicht mit Unrecht davor, daß aus solchem Verhältnisse sich allmählich eine förmliche Blutrache herausbilden werde. Und in der That, die Susi wie der Gregel hatten kaum mehr einen andern Gedanken als den, was sie einander zufügen könnten. Den Winter über war wenig Gelegenheit, nur daß bei dem Faschingball der Gregel die Susi auf der Bank sitzen ließ und mit einem alten Weibe tanzte. Dafür schickte sie ihm nachher ein schön rothgefärbtes Osterei, dessen Inhalt aber schlotterte, weil es vom vorigen Jahr war. Am ersten Mai schickte ihr der Gregel einen großen Maibuschen; aber anstatt Bänder und Blumen waren dürre Besen dran.
Nun kamen die Pfingsten. Und da giebt es im Lande einen wunderlichen Brauch. Wer an Pfingstmorgen den Sonnenaufgang verschläft, dem setzen die Dirndeln einen Strohkranz aufs Haupt und rufen ihn als „Pfingstkönig“ oder „Pfingstlucken“ oder „Pfingstnudel“ aus.
Die Susi, der keine Schwäche ihres Feindes entging, wußte auch, daß der Gregel an Sonn- und Feiertagen, wenn er sein eigener Herr war, gerne ein Stündchen über die Zeit im Bette duselte, um sich zu entschädigen für das Frühaufstehen an Werktagen. Also blieb die Susi in der Pfingstnacht wach und flocht einen schönen Strohkranz. Und als er fertig war, rief sie mehrere Genossinnen zusammen und ging mit ihnen im Morgengrauen hinüber zum Zeiselhof. Eine Dienstmagd dieses Hofes übte Hochverrath, und sie schlichen sich vorsichtig in das Gelaß, in welchem der Gregel thatsächlich noch süß schlief. Ganz sachte, sachte legte sie ihm den Strohkranz aufs Haupt und befestigte ihn noch mit einem Bändchen. Dann zog die Susi eine Schere hervor und schnitt dem schlummernden Burschen den Schnurrbart weg, aber nur auf der einen Seite, auf der andern ließ sie ihn stehen.
Als solches vollbracht war, schlichen sie kichernd wieder davon. Und als sie vor dem Hause standen und die Sonne emporstieg über den waldzackigen Bergen, huben sie an zu rufen: „Pfingstlucken! Pfingstlucken!“ Und um die Wette mit ihnen schrieen, sangen die Vögel in den blühenden Kirschbäumen und auf den Giebeln des Hofes.
Jetzt erwachte der Gregel. Er richtete sich auf, da gewahrte er den Strohkranz; den riß er rasch vom Haupte, und sein erster Gedanke war: „Das hat sie mir gethan!“ Wollte trotzig den Schnurrbart spitzen und fand nur mehr die eine Hälfte. – „Susi, Susi, diese Ernte wird Dir theuer zu stehen kommen!“ – Er schnitt sich die andere Hälfte seiner Manneszier weg, zog sein Feiertagsgewand an, ging in die Kirche und that, als ob nichts geschehen wäre.
Unter solchen und ähnlichen Begebenheiten verging die Zeit. Der Zeiselhofersohn aber hegte unheimliche Pläne. Was geschieht, wenn am Pfingstsonntage der Knab zu lange schläft, das haben wir gesehen. Wie aber, wenn das Dirndl den Sonnenaufgang verduselt in seinen Kissen? Giebt es dafür kein Gericht? O ja, ein noch viel strengeres. Uralter Brauch in der Gegend ist folgender: wenn am Pfingstsonntage das Dirndel den Sonnenaufgang verschläft, so kommen die Nachbarsburschen mit einer aus Stroh und Lappen hergestellten Puppe, die einem zerfetzten Vagabunden ähnlich sieht und lebensgroß ist. Diese Gestalt, der „Pfingstlotter“ genannt (Lotter bedeutet auch so viel als wilder Liebhaber), hängen sie vor dem Fenster der Langschläferin an einen Baumast zum ewigen Spotte. Denn heilig ist die Morgenstunde der Pfingsten, sie ist voller Herrlichkeit und voller himmlischer Gnaden – kein Sterblicher sollte sie verschlafen! Und wer sie verschläft, für den hat das Volk Hohn und Spott, und der Gregel ergreift freudig diese Sitte, um an seiner so bösartigen Gegnerin die Schmach des Strohkranzes zu rächen.
Als wieder Pfingsten kam, trug sich folgendes zu: in der Nacht ging der Gregel gegen das Teutbauernhaus, lehnte eine Leiter an das Dachfenster, hinter welchem die Susi schlief, und verhüllte das Fenster behutsam mit einem alten Lappen. Dann lud er mehrere Kameraden ein, ihm den „Pfingstlotter“ herstellen zu helfen. Fleisch und Blut und Knochen aus Holzstangen und Stroh, Kleidung aus alten Lumpen, so erschufen sie den Lotter und hingen ihn an den Lindenbaum, der vor dem Fenster Susis stand. Den Nachbarsburschen und -dirnen blieb das Unternehmen nicht unbekannt, sie standen früh auf und versammelten sich um den Teutbauernhof.
Die Susi war zeitig erwacht und wunderte sich, daß noch nicht der Tag hereinleuchtete zum Fenster. Sie legte sich auf die andere Seite und dachte, so könne man ja noch ein Schläfchen machen im süßen Frieden. Aber aus diesem Schläfchen im süßen Frieden ward sie grausam geweckt. Plötzlich erhob sich vor ihrem Fenster ein ohrenzerreißendes Johlen: „Pfingstlucken! Pfingstlucken!“ Sie sprang aus dem Bette. Da wurde vom Fenster auch schon mittels einer Stange der Lappen weggerissen und blendender Pfingstsonnenglanz schlug in ihr zuckendes Auge. Und jetzt bemerkte sie auch schon an dem Lindenast den Popanz baumeln, schauderhaft zu sehen. Der Pfingstlotter! – Das arme Dirndel brach am Bettstufen zusammen und hub an, herzzerreißend zu schluchzen.
Des befriedigten Rachegefühles voll, guckte der Zeiselhofersohn schon zur Kammerthür herein. Doch als er sah, wie sie im Winkel kauerte und weinte, da kehrte er zurück zu den anwesenden Burschen und sagte, des Uebermuths wäre nun genug, sie sollten nach Hause gehen.
„Aha!“ spotteten sie, „jetzt will er sie versöhnen. Dabei sind wir überflüssig. Der Pfingstlotter ist halt doch auch zu etwas gut!“ Sie begriffen die Wendung früher als er selbst und verloren sich.
Der Gregel hatte sich schier artig wieder zur Susi geschlichen, doch das erste, was er nun erfuhr, war ein herber Ellbogenstoß, und dabei hub die Susi an, nach kläglicher zu weinen. Er stand eine Weile neben ihr und wußte weder, was er sagen, noch was er thun sollte.
„Bist harb auf mich?“ war endlich das Wort, welches er an sie richtete.
Sie antwortete nicht, sondern weinte.
Ein echter Mann kann alles, nur ein Weib kann er nicht weinen sehen, das heißt, wenn er glaubt, daß es wirklich und herzlich weint, und wenn er es – lieb hat.
Und in beinahe schrecklicher Klarheit stand es plötzlich vor dem Burschen, daß er die Susi liebhatte. Aller Haß, den er bisher gegen sie gefühlt, war eigentlich Liebe, alle Neckerei nur eine andere Art von Zärtlichkeit gewesen. Nun aber hatte es sich herausgestellt, daß er mit seiner Zärtlichkeit ein wenig zu dick aufgetragen hatte.
„Das hast Du mir angethan!“ stieß das Dirndel endlich unter Schluchzen hervor.
Er legte seine Hand auf ihre Achsel, sie stieß ihn nicht zurück.
„Susanna,“ sagte er, und seine Stimme war nicht so klingend wie sonst. „Susanna, so schlimm war es nicht gemeint. Es ist ja nur ein Scherz, den auch andere erleben – ein Pfingstlotter.“
„Mir liegt ja nichts an dem Pfingstlotter,“ antwortete sie; „aber daß Du, gerade Du …“
„Ja – liegt Dir denn an mir was?“ fragte er.
Ihr Weinen wurde noch heftiger. „So weh! So weh thut es mir,“ stammelte sie nachher, „daß gerade Du mir alles Schlechte anthust!“
„Und Du?“ fragte er, „treibst es Du anders mit mir?“
„Weil ich Dich gern hab’!“ stieß sie hervor.
„Du hast es arg mit mir getrieben,“ sagte der Gregel, „es ist Dir alles verziehen. Der Pfingstlotter wäre nicht gekommen, wenn Du mir nicht den Schnurrbart hättest abgeschnitten!“
„Aber der ist Dir ja längst wieder gewachsen!“ rief sie. „Die Schande, die Du mir heut’ hast angethan, wird nimmer aus.“
„Wär’ nit übel!“ lachte der Bursche. „Die Schande ist morgen schon aus, wenn wir zwei zum Pfarrer gehen und uns miteinander versprechen. Ja, Dirndel, ja, es ist mein Ernst! Immer hab’ ich an Dich müssen denken und nie hab’ ich gewußt, wie ich mit Dir dran bin. Aber jetzt, wie ich Dich weinen sehe, jetzt weiß ich’s, jetzt spüre ich’s, wie lieb ich Dich hab’ – Dirndel, lieber als alle Leut’ auf der ganzen Welt …“
Im Augenblick waren ihre Lippen beisammen. Eine geraume Zeit währte es, bis sie sich wieder voneinander lösten.
Und am nächsten Tage waren sie richtig beim Pfarrer. Zwei Wochen später zog die Susanna mit Ehren ein in den Zeiselhof.
Ob sie sich auch in der Ehe gegenseitig so viel geneckt haben wie vor derselben, wollt ihr wissen? Mein Gott, nein! Jetzt hatten sie andere Mittel, um einander ihre Liebe anzuzeigen. Doch das eine muß der Gregel sich gefallen lassen – der Pfingstlotter wird er genannt in der ganzen Gegend, und auch sein Weib nennt ihn so in ihren zärtlichsten Stunden. Nur daß er nicht auf dem Lindenast hängt vor ihrem Fenster, sondern einen wesentlich besseren Platz innehat.
Ins Riesengebirge.
Wahrhaftig, hätte ich einen Gewinn in der Lotterie gemacht, hätte mir die unliebenswürdige Fortuna endlich einmal gelächelt, ich hätte mich nicht glücklicher fühlen können als in dem Augenblick, da ich in den Bahnzug gestiegen war. Freiherr, Gebieter über meine Zeit, kein Sklave des Berufes mehr, saß ich in meiner Ecke – ein geller Pfiff, das eherne Dampfroß bewegte sich, keuchend, schwerfällig zuerst, und schnaubte dann in beflügelter Eile zum Bahnhofe hinaus, um mich nach Hirschberg zu bringen.
Nach Hirschberg – das bedeutet eine fröhliche Wanderfahrt ins Riesengebirge, den Stolz des Schlesierlandes, in Rübezahls wunderreiches, weltabgeschiedenes Revier, in die schöne, waldumrauschte Einsamkeit, wo sich der Tag so reizend verträumt, wo man das Leben, und wenn es auch nichts weiter ist als Mühsal, Arbeit und wieder Arbeit, so von Herzen lieb hat, wo man sich seiner so unendlich freut wie sonst niemals, ausgenommen mit den Kindern unter dem leuchtenden Weihnachtsbaum.
Bald hatte ich mein Ziel erreicht. Einen lachend blauen Himmel über mir, umfächelt von frischer, kräftiger Bergluft, zog ich mit einem lärmenden Touristenvölkchen in die alte, entzückend gelegene, gemüthliche Stadt ein, die sich durch die Anlage zahlreicher geschmackvoller Villen so hübsch modisch herausgeputzt und ihrem steinernen Antlitz einen freundlich ansprechenden Ausdruck verliehen hat. Ihre nächste Umgebung, so reizvoll wie nicht bald eine zweite Stadt sie aufzuweisen vermag, bietet namentlich auf dem Kavalierberge und dem Hausberge einen hochlohnenden Blick auf das liebliche Thal, das Boberkatzbachgebirge und den mächtigen Wall des Riesengebirges.
Nachdem ich lieben Freunden, die in der alten Leineweberstadt wohnen, die Hand geschüttelt, reite ich auf Schusters Rappen nach Warmbrunn (der Leser wolle von jetzt ab die Wanderung auf den Bildern unseres künstlerischen Mitarbeiters begleiten), nach dem altberühmten Bade, das ungezählten Tausenden schon das leicht verlorene, kostbare Gut der Gesundheit wieder verliehen hat. Wie sehr es einst in Blüthe stand, mag u. a. die fast märchenhaft klingende Thatsache bezeugen, daß im Jahre 1687 die Gemahlin des Königs Johann Sobieski von Polen mit einem Gefolge von 1000 Personen in dem Kurorte weilte. Nun, wer weiß, ob nicht ein neuer Glücksstern dem schönen Sudetenbade leuchtet, wenn erst die geplante Zahnradbahn, die von ihm aus nach der Schneekoppe geführt werden soll – zum Schmerze freilich mancher feinfühliger Naturschwärmer – ihre Verwirklichung gefunden hat. – Von Warmbrunn, dessen segensreiche schwefelhaltige Quellen vor kurzem um eine sehr ergiebige vermehrt worden sind, führt mich mein Weg nach Hermsdorf. Ueber diesem Dorfe erhebt sich auf gewaltigem Unterbau der Kynast, die sagenumsponnene Ruine jener berüchtigten Burg, wo so viele ritterliche Thoren, verblendet von der Schönheit eines wahnwitzigen Weibes, um die Ringmauer geritten und in den tiefen. schauerlichen „Höllenschlund“ hinabgestürzt sind. Die ziemlich mühsam zu erklimmende, melancholisch düster ins Land schauende Burg, die einst der Blitz mit seinem vernichtenden Feuer getroffen hat, gewährt eine ungemein fesselnde Aussicht von der Zinne ihres Thurmes herab. Wir erblicken den Riesenkamm in seiner ganzen Ausdehnung; die [340] stolze, hoch zum Himmel aufragende Koppe, das Hohe Rad, die Schneegruben – und zu unseren Füßen den schreckhaft gähnenden Abgrund, in dem Kunigundens waghalsige Freier ihr elendes Ende gefunden haben. Ein biederer Schuster hat darauf einen Vierzeiler gedichtet, welcher lautet:
„Das Weibsbild kunnde
Uf Knie’n mich bitten –
Ich wär’ mit da Rittern
Ni mitte geritten.“
Es war bereits dämmerig geworden; feuchte Schleier umwoben Thal und Gebirg, als ich wieder ins Dorf hinabschritt. In den alten, trübsinnig dreinschauenden Nadelbäumen flüsterte es seltsam, und es war schier, als ob der ruhelose Geist des stolzen, grausamen Edelfräuleins, das einst da oben sich gesonnt im Glanze seiner Schönheit, leise an mir vorüberschwebe. –
| * | * | |||
| * |
Der Morgen ist thaufrisch und sonnig. Ein fröhliches Wanderlied klingt mir durch den Sinn, indem ich auf Petersdorf, die stattliche, obstgesegnete, industriereiche Ortschaft, zumarschire. Nachdem ich dieselbe erreicht, muß ich mehrmals den Zacken überschreiten, in dessen Bett sich noch immer die Spuren der letzten Ueberschwemmung zeigen. Am Ende des Dorfes nimmt die Landschaft ein völlig anderes Gepräge an; eine kühle, erfrischende Waldluft weht mir aus der engen Felsenschlucht, die ich betreten habe, entgegen. Langsam, in gleichmäßiger Steigung, geht’s bergan. Der üppigste Pflanzenwuchs gedeiht in dem feuchten Grunde; Birken, Buchen, Ahornbäume und Fichten, nur hin und wieder dem nackten Stein Raum lassend, sich vorzudrängen, heben ihre Gipfel empor; unzählige Wasserstürze schäumen an mir vorüber. Hier ist ein wahres Wunderland für Maler, jeder Schritt bietet ein neues, herrliches Bild. Aber die Krone von allem ist der Kochelfall, der einige hundert Schritt von der Straße in tiefster Waldeinsamkeit von hundertjährigen Bäumen beschattet, mit seinem goldbraunen Wasser in eine rief eingewaschene Felsenrinne hinabstürzt.
Wenn man dann auf die Straße zurückkehrt und noch eine halbe Stunde am Zacken aufwärts gewandert ist, so erweitert sich mit einem Male die dunkle Schlucht, und Schreiberhau, die bestrickend schöne Sommerfrische des Riesengebirges, liegt vor unsern Augen. In bunter Abwechslung grüßen uns freundliche Häuser und prachtvolle, vornehme Villen, auf blumenreichen Wiesen verstreut, über denen der Reifträger emporsteigt und die Felsenrippen der Schneegruben sich erheben.
In kurzer Zeit gelangt man nach der Josephinenhütte, einer weitberühmten Glashütte, die vorzugsweise Luxusglaswaren erzeugt, und von da geleitet uns ein wundervoller Waldweg nach dem Zackenfalle, der 26 Meter hoch, freilich nicht ohne künstliche Spannung wie alle Wasserstürze des Riesengebirges, in die Tiefe tost. An granitenen Wänden, wo üppiges Moos, Lattichblätter und Farnkräuter wuchern, über sich hochanstrebende Tannen und Fichten, stürzt er in blendender, diamantenstäubender Pracht hinab in sein nächtliches Bett, in Schaum und Gestrudel.
Vom Wassersturz des Zacken führt der Weg allmählich auf den Kamm des Gebirges, das wie eine granitene Mauer Schlesien, mein schönes Heimathland, von Böhmen trennt. Der Wald wird, je höher man steigt, immer niedriger, die Fichten schrumpfen mehr und mehr zusammen und das Gebiet des Knieholzes, der Zwergkiefer, die ohne eigentlichen Stamm buschartig ihre Aeste an der Bodenfläche ausstreckt, beginnt. Auf meiner Wanderung begegne ich der ersten „Baude“, der „Neuen Schlesichen Baude“. So werden die auf Stein ruhenden Blockhäuser genannt, in welchen die gutmüthigen, treuherzigen Gebirgsbewohner hausen und auch der müde Bergsteiger labende Erfrischung, Atzung und Herberge findet. Diese Bauden, die ohne Ausnahme von einer üppigen, sorgfältig gepflegten Wiese, dem „Garten“, umgeben sind, werden in Sommer- und Winterbauden geschieden, d. h. in solche, deren Insassen mit ihrem Vieh im Winter in die Thäler ziehen, und in solche, die das ganze Jahr bewohnt bleiben. Früher ließen sie manches, oder sagen wir lieber: vieles zu wünschen übrig; die fortschreitende Zeit hat
[341]sie aber nicht unberührt gelassen, so daß sie nun, völlig in ihrer inneren Einrichtung umgewandelt, eine auch für anspruchsvollere Touristen recht behagliche Unterkunft gewähren können. Leider ist die Reihe der Tage, da es sich fröhlich leben läßt in diesen Behausungen, gar kurz; bald tanzen die weißen Schmetterlinge des Winters ihren wilden Reigen auf den Bergen, und dann wird’s dem armen Gebirgsbewohner, der da oben ausharren muß, zuweilen recht schwer, den Gleichmuth zu bewahren. Seine Hütte, die eisiger Sturm mit zornigem Geheul umbraust, liegt verschneit bis über die Fenster, durch die Thür kann er nicht mehr hinaus, er muß durch das Dach oder durch einen Stollen, wie ihn die Bergleute bauen, ins Freie zu gelangen suchen. Und wenn nun gar ein Mitglied der Familie in dieser Zeit stirbt, da ist des Elends kein Ende. Der Abgeschiedene kann nicht beerdigt werden, seine Ruhe auf dem Friedhofe nicht finden, bis es Frühling geworden ist.
Aber, wie rauh auch das Dasein des Baudenbewohners im fortwährenden Kampf mit den unfreundlichen Elementen sich gestalten mag, die Liebe zu seinen Bergen überwindet alles, das Schwerste und Bängste, und sie bleibt ihm unerschütterlich, unausrottbar bis zu seinem letzten Athemzuge. Er hadert mit seinem Geschick nicht. Er ist schlicht, bescheiden, genügsam und leicht zu harmlosem Frohsinn geneigt; er ist, damit ich’s richtig sage, der echte Urschlesier, wie er leibt und lebt.
Nach dieser kleinen Abschweifung wandere ich am Reifträger, an den Sau- und Quarksteinen, sowie an der Kesselkoppe vorüber nach der Grubenbaude, hinter der sich, wie ich gleich hinzufügen will, die Rübezahls- oder Teufelskanzel, eine mächtige Steinmasse, erhebt. Nachdem ich ersehnte Rast gehalten und meinem leiblichen Menschen Genüge gethan, schreite ich zur Besichtigung der Schneegruben, die zu den gewaltigsten und eigenartigsten Schöpfungen der Riesengebirgsnatur gehören. Es graut dem Blicke fast, sich hinabzusenken in diese wüsten, schauerlichen Abgründe, in denen oft der Schnee den ganzen Sommer lang liegen bleibt, und mancher Schönen, die dieser grausigen Steinwildniß gegenübertritt, klopft das kleine Herz angstvoll, als ob sich eine Geisterhand leise nach ihr ausstrecke, um sie hinab zu ziehen. Die Große Schneegrube, die von der Kleinen durch einen nackten Grat getrennt ist, hat mächtigere, seltsamer gestaltete, zerklüftetere Wände als diese, die nicht so steil abfällt und vermöge der in ihr wachsenden, farbenfrischen Pflanzen, die von Botanikern vielfach gesammelt und ihren Herbarien einverleibt werden, einen viel weniger wilden Eindruck macht. Sie ist übrigens wichtig durch eine geologische Merkwürdigkeit insofern, als eine ziemlich starke Basaltader in eine ihrer granitenen Wände eingesprengt ist.
Ein Abstecher, den ich von der Grubenbaude aus unternehme, führt mich alsdann zu dem großartigen Wasserfalle, den die jugendmuthige Elbe bildet. In kurzer Entfernung von ihrer steinumfaßten, von einem saftiggrünen Anger umgebenen Quelle stürzt sie 50 Meter hoch über wunderlich gezackte Felsblöcke wie in rasendem Zorn in den Elbgrund hinunter. In ihrem Laufe aufgehalten, verspritzt sie ihren weißen Gischt in langen Strähnen, kämpfend, ringend, tobend und brausend, bis sie in dem ausgewaschenen Granitgeröll, das ihr Bett bildet, endlich zur Ruhe kommt. Die waldlose, finster dreinschauende Umgebung verstärkt den Eindruck des Schauspiels in hohem Grade, das nur leider zu kurze Zeit den Beschauer fesselt. In der Nähe dieser Riesenkaskade befindet sich noch ein Wasserfall, der der Pantsche, der sogar 250 Meter erreicht, aber an Mächtigkeit weit hinter dem des schönen deutschen Stromes, der in Rübezahls Bergen entspringt, zurückbleibt.
Um den von der Elbe gebildeten Fall in seiner ganzen Großartigkeit und Schönheit würdigen zu können, muß man eigentlich aus dem romantisch reizvollen Grunde, den sie durchschäumt, emporsteigen. Diesen nach ihr benannten Elbgrund zu durchwandern, bietet einen überaus köstlichen Genuß. Es wechselt in ihm Nadel- und Laubwald in prächtigstem Farbengemisch. Zwischen düster ernsten, wie in Traum und beschauliches Nachsinnen versunkenen Tannen erhebt die Buche ihre glänzende Blätterkrone, recken der Ahorn und die Birke ihre Aeste, während unten auf dem feuchten, triebkräftigen Boden hoch aufgeschossene Farne ihre anmuthigen Fächer ausbreiten und manche liebliche Blume gedeiht. Der Grund ist von dem Krokonosch und dem [342] schlesischen Hauptkamme eingeschlossen, in welchen letzteren die als die „Sieben Gründe“ bezeichneten Thäler eindringen, deren Wasser zum Theil der Elbe und zum Theill dem Weißwasser zugeht.
Wer nach Spindelmühl, dessen älterer Theil St. Peter genannt wird, gelangen will, den führt der Weg durch diesen stillen, schattigen Grund. Die beiden Orte an der Stelle, wo das Klausenwasser in die Elbe mündet, sind der Glanzpunkt auf der böhmischen Seite des Riesengebirges und, wie bekannt, alljährlich von einer wimmelnden Anzahl von Sommerfrischlern besucht. Eingeschlossen vom Ziegenrücken, Planur und Ausläufern des Krokonosch, mit ihren zum Theil sehr hübschen Häusern sich an saftigen Wiesenmatten hinziehend, liegen sie da wie ein entzückendes Idyll, ein friedliches Eden, in das kein mißtönender Laut von dem wirren Getriebe der Welt dringt – und nur schwer nimmt der Wanderer, der es mit seinen Augen geschaut, von seinem wunderbaren Frieden gekostet hat, wieder Abschied von ihm.
Vom Elbfalle zurückkehrend, überrascht mich ein Unwetter, das Rübezahl, das „neckrige Gespenst“, wie ihn die Leute nennen, beschert hat. Der Donner rasselt über meinem Haupte, der Blitz macht die Berge leuchten mit elektrischem Lichte, der Sturm durchjagt sie in wüthender Eile, die Regentropfen wie kleine spitze Nadeln in mein Gesicht treibend, und ich bin froh, in der Grubenbaude eine gastliche Herberge für die Nacht zu finden.
Noch heult und pfeift er, der unwirsche Sturm, als wollte er mir gruselig machen, wie ich schon schlafensmüd’ mich niedergelegt habe. Glücklicherweise schwimmt am frühen Morgen die ganze Bergnatur in eitel Glanz und Sonnenschein, und mit frischem Muth in der Brust und neuer Kraft in den Beinen wandere ich, mir den Hut mit einem blühenden Habmichlieb schmückend, über das Hohe Rad und die Große Sturmhaube, an den Gruppen der Manns- und Mädelsteine vorbei nach der geräumigen, nett eingerichteten Petersbaude und von da nach der Mädelwiese, von deren Einsattelung der schlesische Kamm in zwei Flügel getheilt wird. Versehen mit einem kräftigen Imbiß aus der Spindlerbaude, in welcher man die alte Eigenart des Baudenwesens noch ganz unverfälscht vorfindet, steige ich über die öde Kleine Sturmhaube, oft in die lachende Ebene des Thales schauend, nach dem Mittagssteine zu, einer wunderlich geformten, an der einen Seite einem angelehnten Menschen ähnlichen Felsmasse, um endlich bei dem Gegenstück der Schneegruben, den Teichen, ersehnte und wohlverdiente Rast zu halten.
Eine böse Strecke Weges habe ich hinter mir, erschöpft und schweißtriefend verlange ich nach Erfrischung, und mit Freuden begrüße ich das tüchtige neue Gasthaus, die Prinz-Heinrich-Baude, bei der unser Prinz gleichen Namens Pathe gestanden hat. Ein stattlicher, von Meister Kahl vortrefflich ausgeführter Bau, der nur mit unsäglichen Mühen und Beschwerden unter Dach zu bringen war, steht es an einem der wundervollsten Punkte, an dem Rande des Kessels, von welchem man auf den Wasserspiegel des Großen Teiches hinabsieht.
Daß es da steht, daß man in seinen schönen, stilvollen, mit Bildern und Kunstwerken gezierten, selbst mit einem Pianino versehenen Räumen Einkehr halten kann, verdanken wir dem Riesengebirgsverein, der sich schon so unendliche Verdienste um unser schlesisches Hochgebirge erworben und den Natursinn, das Naturgefühl in immer weiteren Kreisen geweckt und gepflegt hat. Vor allen anderen aber verdanken wir es einem überaus thatkräftigen Manne, dem Dr. Baer in Hirschberg, der unerschütterlich blieb, wenn sich auch der Unternehmung thurmhohe Schwierigkeiten entgegenstellten, und immer wieder das Feuer des Eifers anfachte, wenn es schier in Asche begraben schien. Ihm bringe ich einen herzhaften Schluck aus meinem Glase, mit ihm singend:
„Unten brüten Sorgen,
Oben sind geborgen
Wir vor aller Erdennoth und Qual –
Unten schrei’n die Spötter,
Oben laden Götter
Uns zu ihrem hohen Freudenmahl.
Unten wohnt das Grauen,
Oben dürfen schauen
Wir, soweit der Horizont sich spannt –
Drum in allen Jahren
Laßt zu Berg uns fahren
In dem lieben, schönen Schlesierland!“
Doch nun zu den Teichen! Wie die Schneegruben sind auch sie zwei so erhabene Naturbilder, daß sie all unsere Gedanken zu lebhaftester Bewunderung hinreißen. Namentlich am Großen Teiche, vom Volke der „Schwarze See“ genannt, ist das der Fall. Starr, unheimlich, unbeweglich, in finsterem Schweigen schaut er zu uns herauf aus seiner von hohen Steinwänden und übereinandergeschichteten Trümmern umschlossenen Vertiefung. Wir meinen, in seinem Wasser könne kein Wesen gedeihen. Und doch regt sich auch in ihm, wie Dr. Zacharias bewiesen hat, ein Gewimmel von Geschöpfen, kleinen Krebsen, Würmern, Käfern und Alpensalamandern.
Der Kleine Teich, über dessen Wände wie über die des Großen Teiches nicht selten eine Lawine hinabdonnert, hat ein ganz anderes Gepräge als dieser. Schon seine nächste Umgebung ist viel anmuthender durch die frische Wiese, die um die Teichbaude sich ausdehnt. Sodann blickt dieses Bergauge nicht so eisig starr, so finster zu uns auf wie der todtöde Große Teich; im Gegentheil, es ist reges Leben in diesem Wasser, es bewegt sich, es bildet Wellen, und wenn die Sonne freundlich darauf scheint wie heut, so können wir die flinksten aller Fische, die Forellen, sich munter in ihm tummeln sehen. Der Kessel des Teiches ist an der einen Seite offen und gestattet dem Wasser einen Abzug, welcher mit dem aus dem nachbarlichen See vereinigt nachher die Große Lomnitz, im Volksmunde „Lunze“ genannt, bildet. Die Länge des Kleinen Teiches beträgt 240, seine Breite 150 Meter, während der Große Teich eine Länge von 550 und eine Breite von 160 Metern hat.
Ich setze den Wanderstab weiter, noch ganz von dem tiefen Eindruck befangen, den ich gehabt, und gelange endlich auf den Koppenplan, eine feuchte sumpfige Hochebene, auf der das Knieholz, das nur leider stark ausgerottet wird, vortrefflich gedeiht.
Ich pflücke wie fast alle Koppenwanderer Anemone alpina, nach ihren langhaarigen Früchten. „Teufelsbart“ genannt, stecke mir auch einen Veilchenstein in die Tasche und schaue mir die Koppe, die sich wie eine kahle, riesenhafte Pyramide vor mir erhebt, erst einmal gründlich von unten an. Dann rüste ich mich zum Aufstieg, nachdem ich noch kurze Rast in der freundlich einladenden Riesenbaude gehalten habe. Der Herr der Berge scheint nicht bei bester Laune; unten im Melzergrunde hat er einen Sturm losgelassen, der das ohnehin beschwerliche Klimmen nach dem Ziele noch beschwerlicher macht. Ich stemme mich, soviel ich kann, gegen seinen brausenden Anprall, den Blick zur Kräftigung meines Willens immer auf das mächtig lockende Koppenhaus gerichtet, das über dem nach ihm emporführenden Zickzackwege in 1601 Meter Meereshöhe sich erhebt. Endlich habe ich’s, mit über das Gesicht rieselndem Schweiß, trotz der mich umwehenden, keineswegs mailauen Luft, erreicht! Lustiges Musikantenvolk, das sich da oben eingenistet hat mit einer ebenso lustigen, bunt zusammengewürfelten Gesellschaft, empfängt mich mit einer Millöckerschen Operetten-Melodie und frischt mir den Humor, der schon bedenklich zu ermüden begann, wieder auf – selbstverständlich in Verbindung und unter Mithilfe eines guten Tropfens. Ich bin so glücklich, ein Bett für die Nacht zu erobern; aber von Schlafen ist nicht viel die Rede. Das junge Volk in dem Hospiz, in dem ich übrigens auch den unvermeidlichen Skat spielen sah, schwingt, wer weiß wie lange, das Tanzbein. Frühzeitig schon ruft mich Glockenschall aus den Federn. Die Sonne geht auf! Ich bin einer von den wenigen Glücklichen, denen es vergönnt ist, zu schauen, wie das Licht des königlichen Tagesgestirnes von der Koppe nieder rosig von Berg zu Berg gleitet und dann in die Thäler hineinleuchtet, ein so über alle Beschreibung schöner, großer, wunderbarer Vorgang, daß sich kaum etwas mit ihm vergleichen läßt.
Wie gebannt stand ich ihm gegenüber und wie ich über die Berge hinsah, über diese stille, einsame Welt, in der die Seele sich, um mit der Königin Luise zu reden, Gott näher fühlt, da grüßt’ ich begeistert mein herrliches, schlesisches Land!
Allmählich kam die Zeit zum Abstieg. Noch einmal ließ ich an der kleinen, runden Laurentiuskapelle mein Auge umherschweifen weit in die Ferne, dann nahm ich Abschied von der erhaben thronenden Koppe, um noch einen Abstecher nach dem Riesengrunde, der vielleicht die großartigste Partie der Sudeten bildet, zu machen. Wenn ein Maler ihn durchwandert, muß er in Wonne schwelgen; denn soviel fesselnde Vorwürfe zu wirkungsvollen Bildern findet er nicht bald wieder beisammen.
[343] In verwirrendem Wechsel hat die bildende Hand der Natur in diesem Grunde – von dem unser Künstler als überaus lauschigen Punkt den an der Bergschmiede festgehalten hat – das Erhabene mit dem Lieblichen, das Düstere mit dem Heitern, das Farbenüppige mit dem Farbenstumpfen, das Todte, Oede mit sprudelnder Lebensfrische zu einer phantastischen Dichtung verschmolzen. Das kann man nicht schildern, mit keiner Feder, das muß man sehen!
Meinen Heimweg nehme ich über die Hampelbaude nach Krummhübel, durch die Gegenden, welche den Lesern der „Gartenlaube“ ja aus den meisterhaften Schilderungen Fontanes in seinem Roman „Quitt“ noch wohl vertraut sind. Auf diesem Wege berühre ich einen wundervollen Punkt, den ich mit ein paar Zeilen noch erwähnen muß. Ich meine das Kirchlein Wang, das die Gemeinde Brückenberg dem kunstsinnigen Könige Friedrich Wilhelm IV. verdankt. Gar traulich grüßt es mit seinem abseits stehenden Glockenthurm von Bergeshöh’ herunter, äußerlich wie innerlich mit einer Menge alterthümlicher Schnitzereien geziert. Die Lage des kleinen hölzernen Gotteshauses, das ursprünglich in Norwegen gestanden hat, ist eine ungemein anmuthige, zu träumerischer Rast unwillkürlich einladende.
Ich steige hinab nach Krummhübel. Das Dorf, wo einst die Laboranten ihre. Heilsäfte bereitet haben, liegt bezaubernd schön in einem tief eingeschnittenen Thale des Kammes, an der Großen Lomnitz, in deren Bett eine wahre Steinwüste sich aufgethürmt hat. Hier, in dieser gemüthlichen Sommerfrische, raste ich, im Angesicht der Koppe, und danke dem freundlichen Leser, daß er mich auf meiner Geist und Gemüth erfrischenden Bergfahrt bis hierher begleitet hat.
„Du hast den Herzog also vorbereitet auf das, was ich ihm bringe?“
fragte Falkenried, auf einen ganz anderen Gegenstand überspringend,
nach kurzer Pause seinen Schwager. „Wie stellt er sich dazu?“
Das war wieder die alte eiserne Undurchdringlichkeit, die sich jedem Forschen verschloß, aber dem Gesandten schien dies jähe Abbrechen willkommen zu sein. Er war auch hier wie überall der Diplomat, der nichts so sehr scheute als ein öffentliches Aufsehen, und der nie daran gedacht hätte, Hartmut entgegenzutreten, wenn er nicht gefürchtet hätte, man könnte ihm später bei einem zufälligen Bekanntwerden der Wahrheit und seiner Kenntniß derselben sein Schweigen sehr verübeln. Jetzt konnte er sich im schlimmsten Falle mit dem Worte decken, das er dem Vater gegeben hatte. Sogar der Herzog hätte es einsehen müssen, daß man einen Jugendfreund schonen mußte. Der „kluge Herbert“ verstand auch hier zu rechnen. –
Der Aufenthalt Oberst Falkenrieds war nur kurz bemessen, und er kam in dieser Zeit kaum zu Athem. Audienzen bei dem Herzog, Besprechungen mit hohen militärischen Persönlichkeiten, Verhandlungen mit der eigenen Gesandtschaft, das alles drängte sich in den Raum von wenigen Tagen zusammen. Wallmoden war kaum weniger in Anspruch genommen, bis endlich alles erledigt war. Der Gesandte und besonders Oberst Falkenried hatten Grund, mit dem Erfolge zufrieden zu sein, denn es war alles erreicht worden, was von seiten ihrer Regierung gewünscht und erwartet wurde, und sie konnten daheim der vollsten Anerkennung gewiß sein.
Allerdings wußten nur die eingeweihten Kreise, daß etwas Wichtiges vorging, und selbst in diesen Kreisen kannten nur wenige die volle Tragweite jener Verhandlungen. In der Oeffentlichkeit merkte man kaum etwas davon und beschäftigte sich um so angelegentlicher mit dem gegenwärtigen Lieblinge, dem Dichter der „Arivana“, welcher der ganzen Stadt um so interessanter war, als sein Benehmen ganz unbegreiflich schien.
Fast unmittelbar nach jenem glänzenden Triumphe seines Werkes hatte er sich allen Lobeserhebungen und Huldigungen entzogen und war „in die Wildniß gegangen“, wie Fürst Adelsberg lachend auf jede Anfrage erklärte. Wo diese Wildniß lag, erfuhr aber niemand; Egon behauptete, er habe sein Wort gegeben, den Aufenthalt seines Freundes nicht zu verrathen, der nach all den Aufregungen der Ruhe bedürfe und schon nach einigen Tagen zurückkehren werde. Es wußte in der That niemand, daß Hartmut Rojanow sich in Rodeck befand.
An einem trüben, kalten Wintermorgen hielt vor dem Palast der preußischen Gesandtschaft der Wagen des Herrn von Wallmoden. Es schien sich aber diesmal um einen weiteren Ausflug zu handeln, denn die Diener trugen Pelze und Reisedecken in den Wagen, während sich oben in dem Zimmer, wo man soeben das Frühstück eingenommen hatte, der Gesandte von Oberst Falkenried verabschiedete.
„Also auf Wiedersehen morgen abend!“ sagte er, ihm die Hand reichend. „Bis dahin sind wir jedenfalls zurück, und Du bleibst ja noch einige Tage hier.“
„Da der Herzog es ansdrücklich wünscht, allerdings!“ bestätigte der Oberst. „Ich habe das bereits nach Berlin gemeldet und mein Bericht ist ja gleichzeitig mit dem Deinigen abgegangen.“
„Jawohl, und ich denke, man wird zufrieden sein mit diesen Berichten; aber das war eine heiße Zelt, man kam ja kaum zur Ruhe in den letzten Tagen! Jetzt ist, Gott sei dank, alles geordnet, und nun kann ich es mir auch erlauben, einmal vierundzwanzig Stunden abwesend zu sein und mit Adelheid nach Ostwalden zu fahren.“
„Ostwalden heißt Dein neuer Landsitz? Ich erinnere mich, Du sprachst gestern davon. Wo liegt er denn eigentlich?“
„Etwa zwei Meilen von Fürstenstein entfernt. Als wir dort waren, machte mich Schönau auf das Schloß aufmerksam, und ich habe es schon damals besichtigt. Es ist eine ziemlich umfangreiche Besitzung, in dem berühmten ‚Walde‘ sehr schön gelegen, aber der Preis war anfangs zu hoch, und deshalb zogen sich die Verhandlungen hin. Erst jetzt nach meiner Rückkehr wurde der Kauf endgültig abgeschlossen.“
„Ich glaube, Ada ist nicht ganz einverstanden mit Deiner Wahl, sie scheint irgend etwas gegen die Fürstensteiner Gegend zu haben,“ warf Falkenried ein; der Gesandte zuckte gleichgültig die Achseln.
„Eine Laune, nichts weiter! Adelheid war anfangs ganz entzückt von Ostwalden, und später erhob sie alle möglichen Einwendungen dagegen; aber ich kann darauf keine Rücksicht nehmen. Ich werde voraussichtlich längere Zeit auf meinem hiesigen Posten bleiben und liebe es nicht mehr, im Sommer weite Reisen zu machen. Da ist mir ein Landsitz, der in vier Stunden von der Stadt zu erreichen ist, von großem Werthe. Das Schloß ist allerdings in seinem jetzigen Zustande ziemlich vernachlässigt, aber es läßt sich etwas daraus machen. Mit einem entsprechenden Umbau kann man es zu einem wahren Prachtsitze umwandeln, und das beabsichtige ich zu tun. Ich will es deshalb noch einmal eingehend besichtigen, damit die Baupläne möglichst bald festgestellt werden können, und überhaupt bin ich ja noch gar nicht als Besitzer dort gewesen.“
Er verbreitete sich mit großer Behaglichkeit über seine Pläne und Absichten. Herbert von Wallmoden, der ursprünglich nur ein geringes Vermögen besaß und sich sehr hatte einrichten müssen, fand es jetzt auf einmal für nöthig, sich an einem Orte anzukaufen, wo er doch nur vorübergehend weilte, und für seinen Sommeraufenthalt einen fürstlichen Landsitz zur Verfügung zu haben, aber er fand es nicht für nöthig, dabei auf die Wünsche seiner Frau Rücksicht zu nehmen, deren Reichthum es ihm ermöglichte, den Großgrundbesitzer zu spielen.
Falkenried mochte beim Zuhören wohl solche Gedanken hegen, aber er äußerte nichts. Er war seit den letzten Tagen womöglich noch starrer und finsterer geworden, und wenn er wirklich im Gespräch eine Frage that oder eine Bemerkung machte wie vorhin bei dem Gutskaufe, so hörte man es seinem Tone an, daß das eben nur mechanisch geschah, weil er doch irgend etwas sprechen mußte. Nur als Adelheid jetzt eintrat, schon vollkommen reisefertig, ging er mit einiger Lebhaftigkeit auf sie zu, um ihr den Arm zu bieten und sie zu dem Wagen zu führen. Er hob sie hinein, und Wallmoden, der ihr folgte, beugte sich noch einmal aus dem Schlage.
„Wir kommen jedenfalls morgen zurück – auf Wiedersehen!“
[344]
[345] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [346] Falkenried grüßte und trat zurück – ihm war es sehr gleichgültig, ob er den Jugendfreund überhaupt wiedersah oder nicht, auch das war längst erstorben. Aber als er die Treppe wieder hinaufstieg, murmelte er doch halblaut:
„Arme Ada – sie hätte auch ein besseres Los verdient!“
In Fürstenstein ging inzwischen alles seinen gewohnten,
ruhigen Gang. Willibald befand sich seit einer Woche dort. Er
war allerdings zwei Tage später gekommen, als er ursprünglich
beabsichtigt hatte; aber daran trug die Verletzung an seiner Hand
schuld, die er sich, seiner Erklärung nach, durch eigene Unvorsichtigkeit
zugezogen hatte und die jetzt bereits in voller Heilung
begriffen war. Der Oberforstmeister fand, daß sein künftiger
Schwiegersohn sich in der kurzen Zeit sehr zu seinem Vortheil
verändert habe, daß er viel ernster und bestimmter geworden sei,
und äußerte hochbefriedigt zu seiner Tochter:
„Ich glaube, der Willy fängt an, menschlich zu werden! Man merkt es auf der Stelle, wenn die Frau Mama einmal nicht an seiner Seite steht und kommandirt.“
Im übrigen hatte Herr von Schönau nicht viel Zeit, sich um das Brautpaar zu kümmern, da er gerade jetzt mit Amtsgeschäften überhäuft war. Der Herzog hatte bei seinem Aufenthalt in Fürstenstein allerlei Aenderungen und Neuerungen in der Forstverwaltung angeordnet, auf die Vorschläge des Oberforstmeisters selbst, und dieser war nun mit vollem Eifer dabei, das alles vorzubereiten und auszuführen. Er sah und hörte es ja täglich, daß Antonie sich mit ihrem Bräutigam im besten Einvernehmen befand, daher überließ er die beiden meistentheils sich selber.
Inzwischen war in Waldhofen im Hause des Doktors Volkmar Angst und Sorge eingezogen. Die Krankheit des Doktors, die anfangs zu keinen Besorgnissen Anlaß gegeben hatte, nahm plötzlich eine sehr gefährliche Wendung, und bei dem Alter des Kranken erschien der Zustand mehr als bedenklich. Da er dringend nach seiner Enkelin verlangte, so wurde sie telegraphisch herbeigerufen; sie hatte auch sofort den erbetenen Urlaub erhalten, ihre Rolle in „Arivana“ wurde anderweitig besetzt, und sie selbst eilte unverzüglich nach Waldhofen.
Bei dieser Gelegenheit nun zeigte Antonie eine wahrhaft rührende Anhänglichkeit an die Jugendfreundin. Tag für Tag ging sie nach dem Volkmarschen Hause, um Marietta, die mit ganzer Seele an ihrem Großvater hing, zu trösten und aufzurichten. Willibald schien zu diesen Tröstungen gleichfalls nothwendig zu sein, denn er ging regelmäßig mit, und der Oberforstmeister fand es natürlich, daß man sich des „armen kleinen Dinges“ nach Kräften annahm, um so mehr, als es in seinem Hause eine unverschuldete Kränkung erlitten hatte, die er noch heute seiner Schwägerin nicht vergeben konnte.
Endlich, nach drei bangen Tagen und Nächten, siegte die kräftige Natur Volkmars, die Gefahr war gehoben und sichere Hoffnung auf Genesung vorhanden. Herr von Schönau, der dem Doktor freundschaftlich zugethan war, freute sich aufrichtig darüber, und so schien alles wieder in bester Ordnung zu sein.
Da zog ein dräuendes Ungewitter von Norden heran. Urplötzlich, ohne jede Anmeldung erschien Frau von Eschenhagen in Fürstenstein; sie hatte sich nicht einmal Zeit genommen, in der Stadt anzuhalten, wo ihr Bruder lebte, sondern kam geradeswegs von Burgsdorf und brach nun wie ein wirkliches Ungewitter bei ihrem Schwager ein, der eben ganz behaglich in seinem Zimmer saß und die Zeitung las.
„Alle guten Geister – Du bist es, Regine!“ rief er erschrocken. „Das nenne ich eine Ueberraschung; aber Du hättest uns doch wenigstens eine Nachricht schicken können.“
„Wo ist Willibald?“ fragte Regine statt aller Antwort in einem unheilverkündenden Tone. „Ist er in Fürstenstein?“
„Natürlich, wo sollte er denn sonst sein? Er hat Dir doch seine Ankunft hier gemeldet, so viel ich weiß.“
„So laß ihn rufen – auf der Stelle!“
„Was machst Du denn eigentlich für ein Gesicht?“ fragte Schönau, der jetzt erst die Aufgeregtheit seiner Schwägerin bemerkte. „Brennt es in Burgsdorf oder was ist sonst los? Auf der Stelle kann ich Dir übrigens Deinen Willy nicht herbeischaffen, denn er ist augenblicklich in Waldhofen –“
„Bei dem Doktor Volkmar vermuthlich! Und sie ist wohl gleichfalls dort?“
„Welche ‚sie‘? Toni ist allerdings mitgegangen, sie besuchen jetzt täglich das arme kleine Ding, die Marietta, die anfangs ganz verzweifelt war. In dem Punkte habe ich übrigens noch ein Wort mit Dir zu reden, Frau Schwägerin. Wie konntest Du das Mädchen so tief kränken, noch dazu in meinem Hause? Ich habe es erst nachträglich erfahren, sonst –“
Ein lautes, grimmiges Auflachen der Frau von Eschenhagen unterbrach ihn. Sie hatte Hut und Mantel auf den ersten besten Stuhl geworfen und trat jetzt dicht vor ihren Schwager hin.
„Willst Du mir vielleicht noch Vorwürfe machen, weil ich versuchte, das Unheil abzuwehren, das Du selbst auf Dein Haus herabgezogen hast? Freilich, Du bist ja stets blind gewesen, Du hast auf meine Warnungen nicht hören wollen – jetzt ist es zu spät!“
„Ich glaube, Du bist nicht recht bei Troste, Regine,“ sagte der Oberforstmeister, der wirklich nicht wußte, was er davon denken sollte. „Wirst Du mir endlich sagen, was das alles heißen soll?“
Regine zog ein Zeitungsblatt hervor und reichte es ihm, während sie mit dem Finger auf eine Stelle deutete:
„Lies!“
Schönau begann zu lesen, und jetzt allerdings wurde auch sein Gesicht dunkelroth vor zorniger Ueberraschung. Die betreffende Stelle, die aus der süddeutschen Hauptstadt datirt war, lautete folgendermaßen:
„Wie wir erst jetzt erfahren, hat am letzten Montage in dem entlegensten Theil unserer Anlagen in früher Morgenstunde ein Pistolenduell stattgefunden. Die Gegner waren ein in der hiesigen Gesellschaft wohlbekannter Herr, Graf W., und ein junger norddeutscher Gutsbesitzer, W. v. E., der sich augenblicklich hier zum Besuch befindet bei seinem Verwandten, einer hochgestellten diplomatischen Persönlichkeit. Als Veranlassung des Streites, der zum Duell führte, wird ein Mitglied unseres Hoftheaters genannt, eine junge Sängerin, die sich übrigens des besten Rufes erfreut. Graf W. wurde an der Schulter verwundet, Herr von E. trug nur eine leichte Verletzung an der Hand davon und ist sofort abgereist.“
„Da schlage doch der Donner drein!“ brach der Oberforstmeister wüthend los. „Der Bräutigam meiner Tochter schlägt sich um Mariettas willen! Daher stammt also die Verletzung, die er mitgebracht hat, das ist ja allerliebst! Was weißt Du davon, Regine? Meine Zeitung hat die Notiz nicht gebracht.“
„Aber die meinige! Die Nachricht stammt aus einem Eurer Blätter, wie Du siehst. Gestern las ich sie und bin sofort hierhergeeilt; ich habe nicht einmal Herbert aufgesucht, der noch nichts von der Sache wissen muß, sonst hätte er mich unterrichtet.“
„Herbert kommt heute mittag,“ sagte Schönau, indem er die Zeitung heftig auf den Tisch warf. „Er ist mit Adelheid in Ostwalden und hat mir geschrieben, daß er den Rückweg über Fürstenstein nehmen und einige Stunden hier bleiben werde. Möglicherweise kommt er deswegen, aber das ändert nichts an der Geschichte selbst. Ist der Junge, der Willy, denn toll geworden?“
„Ja, das ist er!“ fiel Frau von Eschenhagen mit der gleichen Empörung ein. „Du hast mich ja verspottet, Moritz, als ich es Dir vorhielt, daß Du Dein Kind nicht dem Umgange einer Komödiantin preisgeben dürftest. Daß die Sache eine solche Wendung nehmen könnte, ahnte ich allerdings nicht, bis zu dem Augenblick, wo ich entdeckte, daß Willy, daß mein Sohn, verliebt war in diese Marietta Volkmar. Ich entriß ihn augenblicklich der Gefahr und kehrte mit ihm nach Burgsdorf zurück, das war der Grund unserer plötzlichen Abreise, den ich Dir verschwieg, weil ich Willys Zustand für eine flüchtige Verirrung hielt. Der Junge schien ja auch vollständig wieder zur Vernunft gekommen zu sein, sonst hätte ich die neue Reise nicht zugegeben, und der Sicherheit wegen stellte ich ihn unter den Schutz meines Bruders. Er kann nicht länger als drei oder vier Tage in der Stadt gewesen sein, und nun müssen wir das erleben!“
Sie warf sich ganz erschöpft in einen Lehnstuhl, der Oberforstmeister dagegen begann stürmisch im Zimmer auf und nieder zu schreiten.
„Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste!“ rief er. „Das Aergste ist die Komödie, die der Junge mir und seiner Braut hier vorgespielt hat. Da läuft mein armes Kind Tag für Tag nach Waldhofen und tröstet und hilft, wie es nur weiß [347] und kann, und der Herr Bräutigam läuft immer mit und benutzt das zu den Zusammenkünften, das ist ja himmelschreiend! Du hast etwas Schönes erzogen an Deinem Mustersohne, Regine!“
„Denkst Du vielleicht, ich werde ihn entschuldigen?“ fuhr Regine auf. „Er soll mir, uns beiden, Rede stehen, deshalb bin ich gekommen. Er soll mich kennenlernen!“
Sie hob wie zu einem Racheschwur die Hand empor, und Schönau, der noch immer durch das Zimmer stürzte, wiederholte zornschnaubend: „Ja, er soll uns kennenlernen!“
Da öffnete sich die Thür, und mitten in diese Aufregung hinein trat die verrathene Braut, Fräulein Antonie von Schönau, ruhig und bedächtig wie immer, und sagte im harmlosesten Tone: „Ich höre eben von Deiner unvermutheten Ankunft, liebe Tante – herzlich willkommen!“
Sie erhielt keine Antwort, statt dessen schallte ihr von zwei Seiten die grimmige Frage entgegen:
„Wo ist Willibald?“
„Er wird sogleich, kommen, er ist nur auf einige Minuten zu dem Schloßgärtner gegangen, da er noch nichts von der Ankunft seiner Mutter wußte.“
„Zum Schloßgärtner? Wohl wieder, um Rosen zu holen wie damals?“ brach Frau von Eschenhagen los; der Oberforstmeister aber breitete die Arme aus und rief in erschütternden Tönen:
„Mein Kind, mein armes verrathenes Kind, komm zu mir! Komm in die Arme Deines Vaters!“
Er wollte die Tochter an seine Brust reißen, aber da kam Regine von der anderen Seite und riß sie gleichfalls an sich, indem sie ebenso erschütternd rief:
„Fasse Dich, Toni, Dir steht ein furchtbarer Schlag bevor, aber Du mußt ihn tragen. Du mußt Deinem Bräutigam zeigen, daß Du ihn und seinen Verrath verabscheust in tiefster Seele!“
Diese stürmische Theilnahme hatte etwas geradezu Beängstigendes, aber zum Glück besaß Antonie starke Nerven; sie machte sich los aus der doppelten Umarmung, trat zurück und sagte mit ruhiger Entschiedenheit:
„Das fällt mir gar nicht ein, der Willy fängt jetzt erst an, mir eigentlich zu gefallen.“
„Um so schlimmer!“ fiel Schönau ein. „Armes Kind, Du weißt ja noch nichts, ahnst noch gar nichts! Dein Bräutigam hat sich geschossen, hat ein Duell gehabt um einer anderen willen!“
„Das weiß ich, Papa.“
„Um Mariettas willen!“ erläuterte Frau von Eschenhagen.
„Das weiß ich, liebe Tante.“
„Aber er liebt Marietta!“ schrieen jetzt die beiden einstimmig.
„Weiß ich alles!“ erklärte Toni mit überlegener Miene. „Schon seit acht Tagen.“
Die Wirkung dieser Erklärung war eine so niederschmetternde, daß die beiden wüthenden Herrschaften verstummten und sich ganz verblüfft ansahen. Inzwischen fuhr Toni mit unzerstörbarer Gelassenheit fort:
„Willy hat mir gleich nach seiner Ankunft alles gesagt; er sprach so schön und herzlich, daß ich weinte vor Rührung, und gleichzeitig traf ein Brief von Marietta ein, in dem sie mich um Verzeihung bat, das war noch viel rührender. Da blieb mir doch nichts anderes übrig, als meinem Bräutigam sein Wort und die Freiheit zurückzugeben.“
„Ohne uns zu fragen?“ fuhr Regine auf.
„Das Fragen hätte in diesem Falle gar nichts genützt,“ sagte Antonie ruhig. „Ich kann doch nicht einen Mann heirathen, der mir erklärt, daß er eine andere liebt. Wir haben deshalb in aller Stille unsere Verlobung aufgehoben.“
„So, und das erfahre ich jetzt erst? Ihr seid ja sehr eigenmächtig geworden!“ rief der Oberforstmeister gereizt.
„Willy wollte schon am nächsten Tage mit Dir sprechen, Papa, aber nach einer solchen Erklärung hätte er doch nicht länger hier bleiben können, und nun kam gerade die schwere Erkrankung des Doktor Volkmar und Mariettas Ankunft. Sie war ganz verzweifelt, die arme Marietta, und dem Willy brach fast das Herz darüber, daß er sie in dieser Angst allein lassen und abreisen sollte, ohne zu wissen, welche Wendung die Krankheit nahm. Da schlug ich ihm vor, einstweilen noch zu schweigen, bis die Gefahr vorüber sei, aber ich ging täglich mit ihm nach Waldhofen, damit er Marietta sehen und trösten konnte. Sie waren mir so dankbar, die beiden, sie haben mich den Schutzengel ihrer Liebe genannt!“
Die junge Dame schien das wiederum sehr rührend zu finden, denn sie führte ihr Taschentuch an die Augen. Frau von Eschenhagen stand starr und steif wie eine Bildsäule, Schönau aber faltete die Hände und sagte mit einem Stoßseufzer: „Nun, Gott segne Deine Gutmüthigkeit, mein Kind! So etwas ist denn doch noch nicht dagewesen! Aber gemüthlich habt Ihr die Geschichte abgemacht, das muß man zugestehen. Du hast also ganz ruhig dabei gesessen und es mit angesehen, wie Dein Bräutigam einer anderen schön that?“
Antonie schüttelte unwillig den Kopf. Sie gefiel sich offenbar sehr in der Rolle eines Schutzengels und fand sich ohne große Schwierigkeit darein, da ihre Zuneigung zu dem Verlobten von Anfang an eine sehr kühle gewesen war.
„Von Schönthun war gar keine Rede, dazu war der Doktor viel zu krank,“ versetzte sie. „Marietta weinte fortwährend, und wir hatten genug zu thun, sie nur zu trösten. Ihr seht jetzt doch ein, daß ich ganz und gar nicht verrathen bin und daß Willy offen und ehrlich gehandelt hat. Ich selbst habe ihn aufgefordert, noch zu schweigen gegen Euch, und im Grunde geht die Sache doch auch nur uns beide an –“
„Findest Du das? Uns geht sie also gar nichts an?“ warf der Oberforstmeister zornig dazwischen.
„Nein, Papa! Willy meint, man dürfe sich in solchem Falle gar nicht um die Eltern kümmern.“
„Was meint Willy?“ fragte Frau von Eschenhagen, die bei dieser unerhörten Behauptung die Sprache zurückgewann.
„Daß man sich lieben muß, um zu heirathen, und da hat er recht,“ erklärte Toni mit ungewohnter Lebhaftigkeit. „Bei unserer Verlobung ist nicht die Rede davon gewesen, wir sind eigentlich gar nicht gefragt worden, aber zum zweiten Male lasse ich mir das nicht wieder gefallen. Ich sehe erst jetzt, was es heißt, wenn zwei sich von ganzem Herzen liebhaben, und wie merkwürdig Willy sich dabei verändert hat. Jetzt will ich auch so geliebt werden wie Marietta, und wenn ich nicht einen Mann finde, der mich ganz genau ebenso liebt, dann heirathe ich überhaupt nicht!“
Und mit dieser Erklärung, die an Entschiedenheit nichts zu wünschen übrig ließ, schritt Fräulein Antonie hochgehobenen Hauptes aus dem Zimmer, Vater und Tante in einer ganz unbeschreiblichen Stimmung zurücklassend.
Der Oberforstmeister faßte sich zuerst; allerdings verrieth sich noch ein mühsam unterdrückter Aerger in seiner Stimme, als er sich an seine Schwägerin wandte und sagte: „Dein Junge hat etwas Hübsches angerichtet, Regine! Jetzt will Toni auch geliebt sein und fängt an, sich romantische Grillen in den Kopf zu setzen, und Willy scheint in dem Punkte schon ziemlich weit zu sein. Ich glaube wahrhaftig, er hat die zweite Liebeserklärung allein zustande gebracht.“
Frau von Eschenhagen beachtete die bittere Anspielung auf ihr damaliges Eingreifen nicht, ihr Gesicht hatte einen Ausdruck, der nichts Gutes verhieß.
„Du scheinst die Angelegenheit von der komischen Seite zu nehmen,“ versetzte sie. „Ich fasse sie anders auf.“
„Das wird Dir nicht viel helfen,“ meinte Schönau; „wenn ein solcher Musterknabe erst einmal anfängt zu rebelliren, dann ist die Geschichte meistentheils hoffnungslos, besonders wenn er verliebt ist. Aber ich bin doch neugierig, wie der Willy sich eigentlich als Liebhaber ausnimmt, das muß ein ganz merkwürdiger Anblick sein!“
Seine Neugier sollte auf der Stelle befriedigt werden, denn jetzt erschien Willibald. Er hatte inzwischen schon die Ankunft seiner Mutter erfahren, war also einigermaßen vorbereitet, denn daß es etwas Besonderes sein mußte, was sie so unerwartet nach Fürstenstein führte, konnte er sich sagen. Der junge Majoratsherr wich aber diesmal nicht ängstlich zurück wie vor zwei Monaten, wo er die Rosen in der Tasche versteckt hatte, sondern seine Haltung verrieth, daß er entschlossen war, den nun einmal unvermeidlichen Kampf aufzunehmen.
„Da ist Deine Mutter, Willy,“ begann der Oberforstmeister.
„Du bist wohl recht überrascht, sie hier zu sehen?“
„Nein, Onkel, das bin ich nicht,“ lautete die Antwort; der junge Mann machte aber keinen Versuch, sich seiner Mutter zu [348] nähern, denn diese stand da wie eine dräuende Wetterwolke, und in ihrer Stimme grollte es auch wie ferner Donner, als sie fragte:
„So weißt Du also, weshalb ich gekommen bin?“
„Ich errathe es wenigstens, Mama, wenn ich auch nicht begreife, wie Du erfahren hast –“
„Die Zeitungen bringen es ja bereits – da steht es!“ unterbrach ihn Frau von Eschenhagen, indem sie auf das Zeitungsblatt deutete, das noch auf dem Tische lag, „und überdies hat uns Toni alles gesagt – hörst Du, alles!“
Sie sprach das letzte Wort in einem geradezu vernichtenden Tone aus, aber Willibald wurde dadurch kaum aus der Fassung gebracht, sondern versetzte ganz ruhig:
„Nun, dann brauche ich es Euch nicht erst zu sagen! Sonst hätte ich noch heute mit dem Onkel gesprochen.“
Das war zu viel! Jetzt brach die Wetterwolke los mit Blitz und Donner, sie entlud sich mit einer solchen Heftigkeit über dem Haupte des jungen Majoratsherrn, daß diesem eigentlich nichts anderes übrig geblieben wäre, als schleunigst in den Erdboden zu versinken, der einen Menschen seiner Art nicht mehr tragen durfte; aber er versank durchaus nicht, er beugte nur den Kopf vor dem daherstürmenden Ungewitter, und als es endlich nachließ – Frau Regine mußte doch nothgedrungen einmal Athem schöpfen – richtete er sich auf und sagte:
„Mama – jetzt laß mich einmal reden!“
„Du willst reden? Das ist ja merkwürdig!“ warf Schönau ein, der an solche Leistungen von seiten des Bräutigams seiner Tochter allerdings nicht gewöhnt war, aber Willibald fing wirklich an zu reden, anfangs noch etwas stockend und unsicher, dann aber mit sichtlich zunehmender Festigkeit in Sprache und Haltung.
„Es thut mir leid, wenn ich Euch kränken mußte, aber ändern ließ sich das nicht. An dem Duell bin ich ebenso unschuldig wie Marietta; sie wurde von einem frechen Menschen mit Zudringlichkeiten verfolgt, ich nahm mich ihrer an, züchtigte den Unverschämten und er schickte mir eine Herausforderung, die ich nicht ablehnen konnte und durfte. Daß ich Marietta liebe, dafür habe ich nur Toni allein um Verzeihung zu bitten, und das that ich gleich nach meiner Ankunft. Sie erfuhr alles und gab mir mein Wort zurück. Wir haben allerdings eigenmächtig unsere Verlobung aufgehoben, viel eigenmächtiger, als wir sie geschlossen hatten.“
„Oho, geht das etwa auf uns?“ rief der Oberforstmeister ärgerlich. „Wir haben Euch nicht gezwungen, Ihr konntet Nein sagen, wenn Ihr Euch nicht haben wolltet.“
„Nun, das thun wir jetzt noch nachträglich,“ gab Willibald so schlagfertig zurück, daß Schönau ihn ganz verblüfft ansah. „Toni hat es auch eingesehen, daß die bloße Gewohnheit zu einer Ehe nicht ausreicht, und wenn man das Glück überhaupt erst einmal kennengelernt hat, dann will man es auch besitzen.“
Frau von Eschenhagen, die noch immer nicht ihren vollen Athem zurückgewonnen hatte, fuhr bei dem letzten Worte auf wie von einer Schlange gestochen. Es war ihr noch nicht in den Sinn gekommen, daß der ersten, nunmehr aufgehobenen Verlobung eine zweite folgen könnte, – an diese furchtbarste aller Möglichkeiten hatte sie noch gar nicht gedacht.
„Besitzen?“ wiederholte sie. „Was willst Du besitzen? Soll das etwa heißen, daß Du sie heirathen willst, diese Marietta, dies Geschöpf –“
„Mama, ich bitte Dich, in einem anderen Tone von meiner zukünftigen Frau zu sprechen,“ unterbrach sie der junge Majoratsherr so ernst und entschieden, daß die erzürnte Frau in der That verstummte. „Toni hat mich frei gegeben, also ist kein Unrecht mehr in meiner Liebe zu Marietta, und Mariettas Ruf ist tadellos, davon habe ich mich überzeugt. Wer sie kränkt oder beleidigt, der bekommt es mit mir zu thun – und wenn es meine eigene Mutter wäre!“
„Sieh, sieh, der Junge macht sich!“ murmelte der Oberforstmeister, bei dem das Gerechtigkeitsgefühl den Aerger schließlich überwog. Aber Frau von Eschenhagen war weit entfernt, der Gerechtigkeit Gehör zu geben. Sie hatte geglaubt, schon durch ihr bloßes Erscheinen ihren Sohn zu zerschmettern, und nun bot er ihr in dieser unerhörten Weise Trotz. Gerade sein mannhaftes Auftreten brachte sie zum äußersten, denn sie erkannte daraus, wie tief und mächtig das Gefühl war, das ihn so verändern konnte.
„Ich will es Dir ersparen, gegen Deine eigene Mutter das geltend machen,“ sagte sie mit grenzenloser Bitterkeit. „Du bist mündig, bist der Majoratsherr von Burgsdorf, ich kann Dich nicht hindern, aber menn Du diese Marietta Volkmar wirklich dort einführst – dann gehe ich!“
Die Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Willibald zuckte zusammen und trat einen Schritt zurück.
„Mama, das sprachst Du im Zorne!“ rief er heftig.
„Das spreche ich im vollen Ernste! Sobald eine Komödiantin als Herrin das Haus betritt, wo ich dreißig Jahre lang in Ehrbarkeit gelebt und gewaltet habe, wo ich mein Haupt zur letzten Ruhe niederzulegen hoffte, verlasse ich dies Haus auf immer. Dann mag sie dort herrschen – Du hast die Wahl zwischen ihr und Deiner Mutter!“
„Aber Regine, so treibe doch nicht alles gleich auf die Spitze,“ suchte Schönau zu beschwichtigen. „Du folterst den armen Jungen ja mit diesem grausamen Entweder – oder.“
Regine hörte nicht auf die Mahnung, sie stand da, bleich bis an die Lippen, das Auge unverwandt auf ihren Sohn gerichtet, aber sie wiederholte unbeugsam:
„Entscheide Dich – sie oder ich!“
Auch Willibald war bleich geworden, und um seine Lippen zuckte es bitter und schmerzlich, als er leise sagte:
„Das ist hart, Mama! Du weißt, wie lieb ich Dich habe und was Du mir anthust mit Deinem Fortgehen. Wenn Du aber wirklich so grausam bist, mich vor eine solche Wahl zu stellen, nun dann,“ er richtete sich entschlossen auf, „dann wähle ich meine Braut!“
„Bravo!“ fiel der Oberforstmeister ein, der ganz vergaß, daß er doch eigentlich der Mitbeleidigte war. „Willy, es geht mir wie der Toni, Du fängst jetzt erst an, mir zu gefallen. Es thut mir wirklich leid, daß Du nicht mein Schwiegersohn wirst!“
Frau von Eschenhagen mochte einen solchen Ausgang doch wohl nicht erwartet haben; sie hatte auf ihre alte Macht gebaut, die sie nun in Trümmer gehen sah, aber sie war nicht die Frau, nachzugeben. Wenn es ihr Leben gegolten hätte, sie hätte ihren Starrsinn nicht gebeugt.
„Gut – so sind wir fertig miteinander!“ sagte sie kurz und wandte sich zum Gehen, ohne auf die Einrede ihres Schwagers zu achten, der ihr folgte. Aber ehe sie noch die Thür erreichte, wurde diese geöffnet und der Diener des Oberforstmeisters trat ein mit der hastigen Meldung:
„Der Schloßverwalter von Rodeck ist draußen und bittet –“
„Ich habe jetzt keine Zeit!“ fuhr Schönau unwillig auf. „Sagen Sie dem Stadinger, ich könnte ihn jetzt nicht sprechen, ich hätte Wichtiges vor, Familienangelegenheiten –“
Er konnte nicht ausreden, denn Stadinger, der dem Diener auf dem Fuße gefolgt war, stand bereits auf der Schwelle und sagte in einem eigenthümlich gepreßten Tone:
„Ich komme auch in einer Familienangelegenheit, Herr Oberforstmeister, aber es ist eine traurige. Ich kann leider nicht warten, sondern muß Sie auf der Stelle sprechen.“
„Was giebt es denn?“ fragte Schönau betroffen. „Ist etwa ein Unglück geschehen? Der Fürst ist doch nicht in Rodeck, so viel ich weiß?“
„Nein, Durchlaucht ist in der Stadt, aber Herr Rojanow ist hier und schickt mich. Er läßt den Herrn Oberforstmeister und den Herrn von Eschenhagen bitten, augenblicklich nach Rodeck zu kommen, und die gnädige Frau –“ Stadinger warf einen Blick auf Frau von Eschenhagen, die er von ihren Besuchen in Fürstenstein her kannte – „die thäte wohl am besten, auch gleich mitzukommen.“
„Aber weshalb denn? Was ist denn eigentlich vorgefallen?“ rief der Oberforstmeister, der jetzt ernstlich unruhig wurde.
Der Alte zögerte mit der Antwort, man hatte ihm offenbar eingeschärft, seine Nachricht vorsichtig anzubringen. Endlich sagte er:
„Excellenz von Wallmoden ist bei uns im Schlosse – und die Frau Baronin auch.“
„Mein Bruder?“ fiel Regine ahnungsvoll ein.
„Ja, gnädige Frau, der Herr ist aus dem Wagen gestürzt, und nun liegt er da, besinnungslos, und der Arzt, den wir in der Eile gerufen haben, meint, die Sache wäre sehr bedenklich.“
„Um Gotteswillen!“ rief die erschrockene Frau. „Moritz, wir müssen sofort hinüber!“
Schönau hatte bereits die Klingel ergriffen und läutete.
[349]
[350] „Anspannen, so rasch als möglich!“ rief er dem wieder eintretenden Diener zu: „Wie ist das gekommen, Stadinger? So sprechen Sie doch!“
„Der Herr Baron kam mit der gnädigen Frau von Ostwalden und wollte nach Fürstenstein,“ berichtete Stadinger. „Der Weg führt ja durch Rodecker Gebiet, nicht weit vom Schlosse vorüber. Unser Förster, der mit dem Forstgehilfen im Walde ist, giebt dort ein paar Schüsse ab und ein angeschossener Hirsch jagt in wilder Flucht über die Fahrstraße, gerade an dem Wagen vorbei. Die Pferde scheuen und gehen durch, der Kutscher kann sie nicht mehr halten. Die beiden Jäger, die das sehen, stürzen hinterdrein, sie hören noch, wie die Frau Baronin ihren Mann bittet: ‚Bleib sitzen, Herbert! Um Gotteswillen, nein, nicht hinaus!‘ – Aber der Herr scheint ganz den Kopf verloren zu haben, er reißt den Schlag auf und springt hinaus. Bei der rasenden Jagd stürzt er natürlich mit voller Gewalt nieder und wird gegen einen Baum geschleudert. Nicht weit davon an einer Biegung des Wegs bringt der Kutscher endlich die wildgewordenen Thiere zum Stehen. Die Frau Baronin, die unverletzt war, eilt so rasch als möglich zu der Unglücksstätte und da findet sie den armen Herrn schwer verletzt, bewußtlos. – Die Forstleute brachten ihn nach Rodeck, das am nächsten lag. Herr Rojanow hat für alles gesorgt, was für den Augenblick nöthig war, und nun schickt er mich, um Ihnen die Nachricht zu bringen.“ –
Es war selbstverständlich, daß unter dem Eindruck dieser erschütternden Nachricht der eben noch so heftige Familienstreit sofort aufhörte. In Hast und Eile machte man sich zum Aufbruch fertig, Antonie wurde gerufen und benachrichtigt, und sobald der Wagen angespannt war, eilte der Oberforstmeister mit seiner Schwägerin hinunter. Willibald, der mit Stadinger folgte, hielt diesen auf der Treppe noch einen Augenblick zurück und fragte halblaut:
„Wie hat der Arzt sich ausgesprochen? Wissen Sie Näheres darüber?“
Der Alte nickte traurig mit dem Kopfe und antwortete, gleichfalls in gedämpftem Tone: „Ich stand dabei, als Herr Rojanow ihn im Vorzimmer fragte. Es ist keine Hoffnung mehr – der arme Herr wird den Tag nicht überleben!“
Das kleine Jagdschlößchen von Rodeck, das in dem Schnee
der ersten Dezembertage so winterlich einsam dalag, hatte selten
solche Aufregung gesehen wie heute. Es war um die Mittagsstunde, als die beiden Forstleute, deren Schüsse die unschuldige Ursache des Unglücks gewesen waren, den verwundeten Gesandten brachten.
Sie hatten wohl gesehen, daß eine Ueberführung nach Fürstenstein unmöglich war, und wandten sich daher nach Rodeck, das kaum eine Viertelstunde von der Unglücksstätte entfernt lag. Hartmut Rojanow, der sich im Schlosse befand und den man sofort herbeirief, hatte mit rascher Umsicht die nöthigen Anstalten getroffen.
Die Zimmer, die sonst Fürst Adelsberg bewohnte, wurden zur Verfügung gestellt, die erste, dringendste Hilfe geleistet und ein reitender Bote zu dem nächsten Arzte gejagt, der glücklicherweise leicht zu erreichen war.
Dann, als der ärztliche Ausspruch keine Hoffnung mehr ließ, war Stadinger nach Fürstenstein gesandt worden, um die Verwandten herbeizurufen, die auch bald darauf eintrafen, aber nur, um einen Sterbenden zu finden. Wallmoden erwachte nicht wieder aus der Besinnungslosigkeit, in der man ihn nach jenem schweren Sturz gefunden hatte. Betäubt und regungslos lag er da, ohne jemand von seiner Umgebung zu erkennen, und als der Tag sich neigte, war alles vorüber.
Gegen Abend kehrte der Oberforstmeister mit Willibald nach Fürstenstein zurück. Er hatte schon bei der Abfahrt von dort ein Telegramm abgeschickt, um die Gesandtschaft von dem schweren Unfall zu unterrichten, der ihren Chef betroffen hatte, jetzt mußte er die Todesnachricht folgen lassen.
Frau von Eschenhagen war in Rodeck geblieben bei der Witwe ihres Bruders. Man konnte erst morgen Anstalten treffen, um den Todten nach der Stadt zu überführen, und bis dahin wollten die beiden Frauen an seiner Seite bleiben. Adelheid, die sich bei der Gefahr selbst so muthig gezeigt und so unermüdlich ihre Pflicht am Sterbebette des Gatten gethan hatte, schien jetzt, wo diese Pflicht zu Ende war, auch die Kraft zu verlieren; sie war halb betäubt von dem jähen, furchtbaren Ereigniß. –
Am Fenster seines Wohnzimmers, das im oberen Stock lag, stand Hartmut und blickte hinaus in den öden, nächtlichen Wald, der so gespenstig weiß schimmerte in dem matten Sternenlichte. Der gestrige Tag hatte den ersten Schneefall gebracht, und nun starrte alles ringsum in dem eisigen Gewande. Der große Rasenplatz vor dem Schlosse war tief verschneit, die Bäume trugen schwer an ihren weißen Lasten, und die breiten Aeste der Tannen senkten sich tief zur Erde nieder. Nur dort oben, an dem dunklen Nachthimmel, leuchtete Stern an Stern in klarer ruhiger Pracht, und fern am nördlichen Horizont dämmerte ein leichter, rosiger Schein wie der erste Gruß der Morgenröthe. Und doch war es Nacht, kalte, eisige Winternacht, in die noch kein Strahl des neuen Tages fallen konnte.
Hartmuts Augen hingen unverwandt an jenem räthselhaften Schimmer, auch in seinem Inneren war es dunkel, und doch dämmerte etwas auf, fern und leise, wie erwachendes Morgenlicht. Er hatte Adelheid von Wallmoden nicht wiedergesehen seit jener verhängnißvollen Stunde auf der Waldhöhe, erst heute traf er sie wieder, an der Seite ihres Gatten, der blutend, bewußtlos – sterbend in das Schloß getragen wurde. Der Anblick verbot jede Erinnerung und forderte gebieterisch die Hilfe, die auch im vollsten Umfange geleistet wurde, aber Rojanow hatte das Sterbezimmer nicht betreten und sich nur durch den Arzt Bericht erstatten lassen.
Auch bei der Ankunft der Frau von Eschenhagen hatte er sich nicht gezeigt, sondern erst später mit dem Oberforstmeister und mit Willibald gesprochen. Jetzt war alles entschieden, Herbert von Wallmoden weilte nicht mehr unter den Lebenden und seine Gattin war Witwe – war frei!
Ein tiefer Athemzug hob Hartmuts Brust bei dem Gedanken, und doch lag nichts Freudiges darin. Wohl war seine Empfindung eine andere geworden, eine ganz andere seit jener Stunde, wo er das höchste Spiel gewagt und – verloren hatte gegen die Frau, die er liebte. Aber diese Stunde hatte ihm auch die tiefe Kluft gezeigt, die zwischen ihnen aufgähnte, auch jetzt noch, wo das Band von Adelheids Ehe zerrissen war. Ihr „graute“ ja vor dem Manne, der an nichts mehr glaubte, dem nichts mehr heilig war, und er war derselbe noch, der er damals gewesen.
Er hatte ihr eine wortlose Abbitte geleistet, als er in seiner „Arivana“ die Gestalt schuf, die jetzt ihren Namen trug, aber jene Ada entschwebte wieder zu der Höhe, aus der sie gekommen war mit ihrem Warnungsruf, und die Menschen blieben auf der Erde mit ihrem glühenden Hassen und Lieben. Hartmut Rojanow konnte nun einmal das heiße, wilde Blut, das in seinen Adern rollte, nicht in einen ruhigen Kreislauf zwingen, er konnte sich nicht einem Leben voll strenger Pflichten beugen – und er wollte es auch nicht. Wozu war ihm denn die geniale Begabung zu theil geworden, die ihm überall siegreich Bahn brach, wenn sie ihn nicht hinaushob über die Pflichten und Schranken der Alltäglichkeit? Und er wußte es doch, daß jene großen blauen Augen ihn unerbittlich diesen so gehaßten Weg wiesen – das ging nimmermehr! –
Der rothe Schimmer dort über dem Walde war dunkler geworden und höher emporgestiegen. Es sah aus, wie der Widerschein eines mächtigen Brandes, aber dies ruhige, stetige Licht entstammte keiner Feuersgluth. Unverrückbar stand es im Norden, geheimnißvoll, hoch und fern – ein Nordlicht in aufdämmernder Herrlichkeit.
Das Rollen eines Wagens, der in aller Eile näher kam, riß Hartmut aus seiner Träumerei. Es war neun Uhr vorüber, wer konnte zu so später Stunde noch anlangen? Vielleicht der zweite Arzt, zu dem man am Nachmittag gesandt hatte, der aber nicht zu Haus gewesen war, vielleicht auch jemand von Ostwalden, wo man die Nachricht schon erfahren haben konnte. Jetzt bog der Wagen um den Rasenplatz, die Räder knirschten auf dem schneebedeckten Boden, und gleich darauf fuhr er am Haupteingange vor, der an der Rückseite des Schlosses lag. Rojanow, der heute nun einmal den Herrn des Hauses vertrat, verließ seinen Platz und ging hinaus, um zu hören, was es gebe.
Er hatte bereits die große Treppe erreicht, die hinunter in die Eingangshalle führte, und setzte den Fuß auf die oberste Stufe, als er plötzlich zusammenbebte und wie gebannt stehen blieb. Da unten klang eine Stimme, die er seit zehn langen Jahren nicht gehört hatte, – sie sprach gedämpft, halblaut, und doch erkannte er sie wieder im ersten Augenblick.
„Ich komme von der Gesandtschaft. Wir erhielten am Nachmittage das Telegramm und ich habe den ersten Zug benutzt, um [351] hierherzueilen. Wie steht es? Kann ich Herrn von Wallmoden sehen?“
Stadinger, der den Ankömmling empfing, antwortete in leisem Tone etmas Unverständliches, das wohl die Wahrheit verrathen mochte, denn der Fremde fragte hastig: „Ich komme doch nicht zu spät?“
„Ja, mein Herr, heut nachmittag starb Herr von Wallmoden!“
Es folgte eine kurze Pause, dann sagte der Fremde dumpf, aber fest: „So führen Sie mich zu seiner Witwe – melden Sie ihr den Oberst von Falkenried!“
Stadinger schritt voran, und ihm folgte eine hohe Gestalt im Mitärmantel, von der man in der halbdunklen Eingangshalle nur die Umrisse erkennen konnte. Die beiden waren längst in den unteren Zimmern verschwunden, und noch immer stand Hartmut, auf das Geländer der Treppe gestützt, und starrte hinunter. Erst als Stadinger allein zurückkam, raffte er sich zusammen und kehrte in sein Gemach zurück.
Wohl eine Viertelstunde lang schritt er hier ruhelos auf und ab. Es war ein stummer, schwerer Kampf, den er kämpfte: er hatte ja nie seinen Stolz beugen, nie sich unterwerfen können, und er mußte sich tief beugen vor dem schwerbeleidigten Vater, das wußte er. Aber dann kam wieder die heiße, brennende Sehnsucht über ihn und wuchs übermächtig an und behielt schließlich den Sieg.
Er richtete sich entschlossen auf. „Nein, jetzt will ich nicht feig zurückweichen! Jetzt sind wir unter einem Dache, dieselben Mauern umschließen uns, nun sei es auch gewagt! Er ist ja doch mein Vater und ich bin sein Sohn!“ –
Die Schloßuhr von Rodeck verkündete in langsamen, dumpfen Schlägen die zehnte Stunde. Es war todtenstill draußen im Walde und ebenso still drinnen in dem Hause, wo ein Todter lag. Der Schloßverwalter und die Dienstleute hatten sich zur Ruhe begeben, ebenso Frau von Eschenhagen. Auch bei ihr forderte die erschöpfte Natur endlich ihr Recht, sie hatte ja ohne Unterbrechung die weite anstrengende Fahrt von Burgsdorf gemacht und dann den heutigen schweren Tag durchlebt. Nur wenige Fenster waren noch matt erhellt, sie gehörten zu den Zimmern, die man Frau von Wallmoden und dem Oberst Falkenried eingeräumt hatte, und die nahe bei einander lagen, nur durch ein Vorgemach getrennt.
Falkenried wollte die junge Frau morgen nach der Stadt zurückgeleiten. Er hatte sie und Regine noch gesprochen und dann lange vor der Leiche des Jugendfreundes gestanden, der ihm gestern noch ein so zuversichtliches „Auf Wiedersehen!“ zugerufen hatte, der damals noch so voll gewesen war von Plänen und Entwürfen für seine Zukunft und seinen neu erworbenen Besitz. Nun war das alles zu Ende! Kalt und still ruhte er auf der Bahre, und kalt und düster stand Falkenried jetzt am Fenster seines Gemaches. Selbst dies furchtbare Ereigniß vermochte es nicht, seine eisige Ruhe zu erschüttern, denn er hatte es ja längst verlernt, den Tod als ein Unglück anzusehen. Das Leben war schwer – nicht das Sterben!
Er blickte schweigend hinaus in die Winternacht und auch er sah den seltsam geisterhaften Schimmer, von welchem das Dunkel draußen erhellt war. Fern am Horizont brannte jetzt dunkelrothe Gluth und der ganze nördliche Himmel erschien wie durchlodert von unsichtbaren Flammen. Röthlich, wie durch einen Purpurschleier, blinkten die Sterne – jetzt zuckten einzelne Strahlen auf, immer zahlreicher, immer höher emporsteigend bis zum Zenith, und unter diesem flammenden Himmel lag kalt und weiß die schneebedeckte Erde – das Nordlicht leuchtete in vollster Pracht.
Falkenried war so versunken in den Anblick, daß er es nicht vernahm, wie die Thür des Vorzimmers geöffnet und wieder geschlossen wurde. Leise öffnete sich nun die nur angelehnte Thür seines eigenen Zimmers; aber der Eintretende machte sich nicht bemerklich, sondern verharrte regungslos auf der Schwelle.
Der Oberst stand noch immer am Fenster, zur Hälfte abgewandt; aber das flackernde Licht der Kerzen, die auf dem Tische brannten, ließ doch deutlich sein Gesicht erkennen, die scharfen, tiefen Linien der Züge und die finstere, gramdurchfurchte Stirn unter dem weißen Haar. Hartmut schauerte unwillkürlich zusammen – so schwer und furchtbar hatte er sich die Veränderung nicht gedacht. Der Mann, der noch in der Vollkraft der Jahre stand, sah ja wie ein Greis aus, und wer hatte ihm dies frühe Alter geschaffen?!
Einige Minuten vergingen in tiefem Schweigen, dann klang ein Ton durch das Gemach, halblaut, flehend, und doch voll mühsam zurückgehaltener Zärtlichkeit, ein einziges, inhaltsschweres Wort:
„Vater!“
Falkenried fuhr zusammen, als habe eine Geisterstimme sein Ohr berührt. Langsam wandte er sich um mit einem Ausdruck, als glaubte er, es sei wirklich Geisterspuk, der sich da vernehmen lasse.
Hartmut that rasch einige Schritte vorwärts und blieb dann stehen.
„Vater, ich bin es! Ich komme –“
Er verstummte, denn jetzt begegnete er den Augen seines Vaters, diesen Augen, die er so sehr gefürchtet hatte, und was darin stand, raubte ihm den Muth, weiter zu sprechen. Er senkte das Haupt und schwieg.
Aus dem Antlitz des Obersten schien jeder Blutstropfen gewichen zu sein. Er hatte nichts erfahren, er ahnte nicht, daß sein Sohn sich unter demselben Dache mit ihm befand, das Wiedersehen traf ihn völlig unvorbereitet; aber es entriß ihm keinen Ausruf, kein Zeichen des Zornes oder der Schwäche: Starr und stumm stand er da und blickte auf den, der einst sein Alles gewesen war. Endlich hob er langsam die Hand und deutete nach der Thür:
„Geh!“
„Vater, höre mich an!“
„Geh’, sage ich!“ Der Befehl klang diesmal drohend.
„Nein, ich gehe nicht!“ rief Hartmut leidenschaftlich. „Ich weiß, daß an dieser Stunde allein die Versöhnung hängt. Ich habe Dich gekränkt, wie schwer und tief, das fühle ich erst jetzt; aber ich war ein Knabe von siebzehn Jahren, und es war meine Mutter, der ich folgte. Bedenke das, Vater, und verzeihe mir, verzeih Deinem Sohne!“
„Du bist der Sohn der Frau, deren Namen Du trägst, nicht der meine!“ sagte der Oberst schneidend. „Ein Falkenried hat keinen Ehrlosen zum Sohn!“
Hartmut wollte auffahren bei dem furchtbaren Worte, das Blut stieg ihm wieder heiß und wild in die Stirn da sah er auf jene andere Stirn unter dem zu Schnee gebleichten Haar, und gewaltsam bezwang er sich.
Die beiden glaubten allein zu sein bei dieser Unterredung in der Stille der Nacht, es schlief ja schon alles im Schlosse, sie ahnten nicht, daß sie einen Zeugen hatten. Adelheid von Wallmoden war nicht zur Ruhe gegangen, sie wußte, daß sie doch keinen Schlaf finden würde nach dem Tage, der sie so jäh und schreckensvoll zur Witwe gemacht hatte. Noch in dem dunklen Reiseanzuge, den sie bei der Unglücksfahrt getragen hatte, saß sie in ihrem Zimmer, als auf einmal die Stimme des Oberst Falkenried an ihr Ohr drang. Mit wem konnte er denn noch sprechen zu so später Stunde? Er war ja ganz fremd hier, und die Stimme klang so seltsam dumpf und drohend! Unruhig erhob sich die junge Frau und trat in das Vorgemach, das die beiden Zimmer voneinander schied, nur auf einen Augenblick, wie sie meinte, nur um zu hören, ob dort drüben nichts geschehen sei. Da vernahm sie eine andere Stimme, die sie kannte, vernahm das Wort: „Vater!“ und wie ein Blitz zuckte die Wahrheit vor ihr auf, die ihr schon die nächsten Worte enthüllten. Wie an den Boden gefesselt blieb sie stehen, aber durch die nur halb geschlossene Thür drang jeder Ton an ihr Ohr.
„Du machst mir diese Stunde schwer,“ sagte Hartmut mit mühsam erzwungener Fassung. „Sei es, ich habe nichts anderes erwartet. Wallmoden hat Dir alles gesagt, ich kann es mir denken; dann konnte er Dir aber auch nicht verschweigen, was ich erreicht und errungen habe. Ich bringe Dir den Lorbeer des Dichters, Vater, den ersten Lorbeer, der mir zutheil geworden ist. Lerne mein Werk kennen, laß es zu Dir sprechen, dann wirst Du es fühlen, daß sein Schöpfer nicht leben und athmen konnte in dem Zwange eines Berufes, der jede Poesie ertödtet, dann wirst Du den unseligen Knabenstreich vergessen.“
Das war wieder Hartmut Rojanow, der jetzt sprach, mit seinem übermüthigen Stolze, seinem hochmüthigen Selbstbewußtsein, das ihn selbst in dieser Stunde nicht verließ, der Dichter der „Arivana“, für den es keine Pflichten und Schranken gab; aber hier fand er einen Fels, an dem er scheiterte.
„Den Knabenstreich?“ wiederholte Falkenried ebenso herb wie vorhin. „Ja, man hat es so genannt, um mir das Verbleiben im Dienste zu ermöglichen; ich nenne es anders, und jeder meiner Kameraden mit mir. Du standest vor dem Fähnrich, in wenigen Wochen wäre es auch vor dem Gesetze schmachvolle Fahnenflucht gewesen, ich habe es nie anders angesehen. Du warst [352] in den strengen Ehrbegriffen unseres Standes auferzogen und wußtest, was Du thatest, Du warst kein Knabe mehr. Wer dem Waffendienste, den er seinem Vaterlande schuldet, heimlich entflieht, der ist ein Deserteur, wer ein gegebenes Wort bricht, der ist ein Ehrloser! Du hast beides gethan! Aber freilich, über solche Dinge kommst Du und Deinesgleichen leicht hinaus.“
Hartmut biß die Zähne zusammen, er bebte am ganzen Leibe bei diesen schonungslosen Worten, und seine Stimme klang dumpf, halb erstickt, als er antwortete:
„Hör’ auf, Vater, das ertrage ich nicht! Ich habe mich beugen, habe mich unterwerfen wollen, aber Du treibst mich selbst von Dir. Das ist dieselbe grausame Härte, mit der Du auch einst meine Mutter von Dir getrieben hast, ich weiß es aus ihrem eigenen Munde. Wie sich auch später ihr Leben gestaltet hat, wie sich das meine gestaltete durch sie, diese Härte allein hat es verschuldet.“
Der Oberst kreuzte die Arme und ein Ausdruck unsäglicher Verachtung zuckte um seine Lippen.
„Aus ihrem eigenen Munde weißt Du das? Möglich! So tief ist ja keine Frau gesunken, daß sie nicht versuchen sollte, ihrem Sohne eine solche Wahrheit zu verschleiern. Ich wollte Dein Ohr damals nicht entweihen mit dieser Wahrheit, denn Du warst noch schuldlos und rein. Jetzt wirst Du mich ja wohl verstehen, wenn ich Dir sage, daß jene Trennung ein Gebot der Ehre war. Der Mann, der meine Ehre befleckt hatte, fiel von meiner Kugel, und sie, die mich verrieth – sie stieß ich von mir.“
Hartmut erbleichte bei dieser Enthüllung. Das hatte er nicht gewußt, nicht geahnt, er hatte in der That geglaubt, daß nur die Härte, die in dem Charakter des Vaters lag, die Trennung verschuldet habe. Immer tiefer und tiefer sank ihm das Bild der Mutter, die er doch so heiß und leidenschaftlich geliebt hatte wie sie ihn, wenn er es auch bisweilen fühlte, daß sie sein Verderben war.
„Ich wollte Dich behüten vor dem Gifthauche dieser Nähe und dieses Einflusses,“ fuhr Falkenried fort. „Thor, der ich war! Auch ohne das Eingreifen Deiner Mutter warst Du verloren für mich; Du trägst die Züge Deiner Mutter, es ist ihr Blut, das in Deinen Adern rollt, und das hätte sich früher oder später sein Recht erzwungen. Du wärst doch geworden, was Du jetzt bist – ein heimathloser Abenteurer, der kein Vaterland und keine Ehre mehr kennt!“
„Das ist zu viel!“ schrie Hartmut jetzt mit rasender Wildheit auf. „Beschimpfen lasse ich mich von keinem, auch von Dir nicht! Ich sehe es jetzt, daß keine Versöhnung zwischen uns möglich ist; ich gehe, aber die Welt wird anders urtheilen als Du. Sie hat bereits mein erstes Werk gekrönt, und ihr werde ich die Anerkennung abzuzwingen wissen, die der eigene Vater mir versagt.“
Der Oberst sah seinen Sohn an, es lag etwas Furchtbares in diesem Blick; dann sagte er frostig und langsam, aber jedes Wort schwer betonend: „Dann sorge auch dafür, daß die Welt nicht erfährt, daß der ‚gekrönte Dichter‘ vor zwei Jahren in Paris noch – Spionendienste geleistet hat!“
Hartmut zuckte zusammen wie von einer Kugel getroffen.
„Ich, in Paris? Bist Du von Sinnen?“
Falkenried zuckte verächtlich die Achseln.
„Auch noch Komödie? Gieb Dir keine Mühe, ich weiß alles! Wallmoden hat mir die Beweise geliefert für die Rolle, die Zalika Rojanow und ihr Sohn in Paris spielten, ich weiß den Ursprung jener Mittel, mit denen sie das gewohnte Leben fortsetzten, als ihr Vermögen verloren war. Sie waren sehr gesucht von ihren Auftraggebern, denn sie waren äußerst geschickt, und wer ihre Dienste kaufte – der hatte sie!“
Hartmut stand wie entgeistert da. Das also war die furchtbare Lösung des Räthsels, das ihm Wallmoden mit jener Andeutung aufgegeben hatte. Er hatte den Sinn damals nicht verstanden, hatte die Lösung in einer ganz anderen Richtung gesucht; das war es gewesen, was die Mutter ihm verhehlte, wovon sie ihn mit Küssen und Schmeicheln ablenkte, wenn er einmal irgend eine argwöhnische Frage that. Auch zu diesem Letzten, Schmachvollsten war sie herabgesunken, und ihr Sohn war mit ihr geächtet!
Das Schweigen, das nun eintrat, hatte etwas Entsetzliches – es dauerte minutenlang, und als Hartmut endlich wieder sprach, hatte seine Stimme jeden Klang verloren, die Worte kamen abgebrochen, kaum hörbar von seinen Lippen.
„Und Du glaubst – daß ich – daß ich darum wußte?“
„Ja!“ sagte der Oberst kalt und fest.
„Vater, das kannst, das darfst Du mir nicht anthun, die Strafe wäre zu furchtbar! Du mußt mir glauben, wenn ich Dir sage, daß ich keine Ahnung hatte von dieser Schmach, daß ich glaubte, es sei noch ein Theil unseres Vermögens gerettet worden, daß – Du wirst mir glauben, Vater!“
„Nein!“ erklärte Falkenried ebenso starr und unbewegt wie vorhin. Hartmut stürzte außer sich auf die Kniee nieder.
„Vater, bei allem, was Dir heilig ist im Himmel und auf Erden – o, sieh mich nicht so entsetzlich an, Du treibst mich zum Wahnsinn mit diesem Blick! Vater, ich gebe Dir mein Ehrenwort –“
Ein furchtbar wildes Auflachen des Vaters unterbrach ihn.
„Dein Ehrenwort – wie damals in Burgsdorf! Steh’ auf, laß die Komödie, mich täuschest Du nicht damit! Mit einem Wortbruch bist Du von mir geschieden, mit einer Lüge kehrst Du zurück, Du bist der echte Sohn Deiner Mutter geworden. Geh’ Du Deinen Weg, ich gehe den meinen. Nur eins fordere ich, befehle ich Dir! Wage es nicht, den Namen Falkenried neben dem geschändeten der Rojanow zu nennen, laß die Welt nie erfahren, wer Du bist! Geschieht es dennoch, dann kommt auch mein Blut über Dich, denn dann – mache ich ein Ende!“
Mit einem Aufschrei des Entsetzens sprang Hartmut empor und wollte auf den Vater zustürzen, aber dieser wies ihn mit einer gebieterischen Handbewegung zurück.
„Denkst Du vielleicht, daß ich das Leben noch liebe? Ich habe es ertragen, weil ich mußte, weil ich es für Pflicht hielt. Es giebt aber einen Punkt, wo diese Pflicht aufhört, Du kennst ihn jetzt – richte Dich danach!“
Er kehrte seinem Sohne den Rücken und trat wieder an das Fenster. Hartmut sprach kein Wort mehr, stumm, ohne einen Laut wandte er sich zum Gehen.
Das Vorzimmer war nicht erleuchtet, aber es war erfüllt von dem Wiederschein des glühenden Himmels da draußen, und in diesem Scheine stand eine Frau, todtenbleich, die Augen mit einem unbeschreiblichen Ausdruck auf den Nahenden gerichtet. Er sah auf, und ein einziger Blick zeigte ihm, daß sie alles wußte. Das war das Letzte! Vor dem Weibe, das er liebte, hatte er diese tödliche Demüthigung empfangen, vor ihr war er niedergeworfen in den Staub!
Hartmut wußte nicht, wie er das Schloß verlassen hatte, wie er in das Freie gelangt war, er fühlte nur, daß er ersticken müßte in diesen Mauern, daß es ihn hinausjagte mit Furiengewalt. Er fand sich erst wieder am Fuße einer Tanne, die ihre schneebedeckten Aeste auf ihn niederneigte. Es war Nacht im Walde, kalte, eisige Winternacht; aber droben am Himmel leuchtete fort und fort das geheimnißvolle Licht mit purpurner Gluth, mit zuckenden Strahlen, die sich hoch oben im Zenith zu einer Krone einten – ein loderndes Flammenzeichen!
Es war wieder Sommer geworden, der Juli hatte bereits
seinen Einzug gehalten, und in den heißen, sonnendurchglühten
Tagen lockte das Waldgebirge unwiderstehlich mit seinen kühlen
Schatten und der grünen, duftigen Pracht seiner Thäler und Höhen.
Ostwalden, die Besitzung, die Herbert von Wallmoden noch unmittelbar vor seinem Tode gekauft hatte, ohne daß es ihm vergönnt gewesen war, sie auch nur einen Sommer lang zu bewohnen, hatte seitdem vereinsamt gelegen, aber vor einigen Tagen war die junge Witwe in Begleitung ihrer Schwägerin, der Frau von Eschenhagen, dort eingetroffen. Sie hatte bald nach dem Tode ihres Gemahls die süddeutsche Hauptstadt verlassen, um mit ihrem Bruder, der auf die Trauernachricht sofort zu ihr geeilt war, nach der Heimath zurückzukehren. Ihre kurze Ehe hatte nur acht Monate gewährt, und jetzt trug die noch nicht zwanzigjährige Frau die Witwentrauer.
Regine ließ sich leicht bestimmen, ihre Schwägerin zu begleiten. Die einst so unumschränkt herrschende Gebieterin von Burgsdorf war bei ihrem „Entweder – oder“ geblieben, und da sich Willibald ebenso hartnäckig zeigte, hatte sie ihre Drohung wahr gemacht und war nach der Stadt übergesiedelt, noch während der ersten Trauerzeit um ihren Bruder.
Frau von Eschenhagen täuschte sich aber, wenn sie glaubte, mit diesem letzten Mittel noch eine Wirkung zu erzielen. Sie hatte gehofft, ihr Sohn werde es auf eine wirkliche Trennung doch nicht ankommen lassen, aber es war vergebens, daß sie ihn die ganze Bitterkeit dieser Trennung durchkosten ließ. Der junge [353] Majoratsherr bekam vollauf Gelegenheit, zu zeigen, daß seine erwachende Selbständigkeit und seine Liebe nicht nur flüchtige Aufwallungen gewesen waren. Wohl versuchte er alles, um die Mutter umzustimmen, als es aber nicht gelang, da zeigte auch er den gleichen Trotz, und Mutter und Sohn hatten sich seit Monaten nicht mehr gesehen.
Noch war allerdings seine öffentliche Verlobung mit Marietta nicht erfolgt. Er glaubte seiner früheren Braut und deren Vater die Rücksicht schuldig zu sein, der ersten aufgehobenen Verbindung nicht sofort eine zweite folgen zu lassen. Ueberdies war Marietta durch ihren Vertrag noch volle sechs Monate an das Hoftheater gefesselt, und da ihre Verlobung vorläufig noch Geheimniß blieb, so war eine frühere Lösung dieser Verpflichtungen nicht zu erreichen gewesen. Das junge Mädchen kehrte erst jetzt in das Haus des Großvaters zurück, wo auch Willibald erwartet wurde. Frau von Eschenhagen wußte selbstverständlich nichts davon, sonst hätte sie schwerlich eine Einladung angenommen, die sie in die Nähe von Waldhofen brachte.
Der Tag war sonnig und heiß gewesen, erst die späteren Nachmittagsstunden brachten einige Kühlung, aber die Fahrstraße nach Ostwalden war größtentheils schattig, da sie durch die Rodecker Forsten führte. Auf dieser Straße trabten zwei Reiter dahin, der eine, in grauer Joppe und Jägerhut, war der Oberforstmeister von Schönau, der andere, eine schlanke, jugendliche Gestalt in einem sehr gewählten Sommeranzuge, der Fürst Adelsberg. Sie hatten sich zufällig auf dem Wege getroffen und bei der Begrüßung erfahren, daß sie beide das gleiche Ziel hatten.
Johann Nepomuk von Nußbaum.
Wenn man die Namen der bedeutendsten Aerzte und Chirurgen der Gegenwart aufzählt, muß wohl Geheimrath und Universitätsprofessor Dr. von Nußbaum zu München, dessen Ruhm weit über die Grenzen von Deutschland gedrungen ist, in vorderster Reihe genannt werden.
In Nachstehendem wollen wir versuchen, mit kurzen Strichen das Bild des Lebens und Wirkens des Mannes zu entwerfen, dem die ärztliche Wissenschaft so viel verdankt, und der sein Dasein unablässig dem Wohle der Menschheit weiht.
Geboren am 2. September 1829 zu München, bezog Nußbaum 1849 die Universität seiner Vaterstadt, um sich nach philosophischer und naturwissenschaftlicher Ausbildung der Heilkunde zu widmen. Auf Grund tüchriger anatomisch-physiologischer Studien erlangte er ausgezeichnete chirurgische Kenntnisse, die er an den Universitäten Würzburg und Berlin erweiterte, und zu deren praktischer Ausübung ihm 1851 als Assistent im Dr. Haunerschen Kinderspitale, dann von 1852 ab auf der chirurgischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses zu München, sowie durch seine rasch angebahnte Privatpraxis reichliche Gelegenheit geboten war. 1853 verfaßte er eine Abhandlung über künstliche Hornhaut, der er 1855, in welchem Jahre er promovirte, eine größere Arbeit über Hornhauttrübungen folgen ließ. 1857 habilitirte er sich als Privatdocent an der Universität München für Chirurgie und Augenheilkunde; auch wurde ihm um diese Zeit die Stelle als operirender Arzt in dem oben genannten Kinderspitale übertragen, woselbst er zahlreiche Operationen aller Art mit meist glücklichem Erfolge ausführte. Nachdem er Ende Dezember 1859 eine Berufung an die Hochschule Zürich abgelehnt hatte, wurde er anfangs 1860 zum ordentlichen Professor der Chirurgie zu München ernannt und mit der Leitung der chirurgischen und der damals noch damit verbundenen Augenklinik betraut.
Seitdem unermüdlich thätig, erwarb er sich durch seine glänzenden Eigenschaften als Arzt und Operateur, durch Forschungen auf dem Gebiete seiner Wissenschaft und durch seine anregenden, geistsprühenden und dabei theoretisch wie praktisch höchst lehrreichen Vorträge im Hörsale und am Krankenbette den Ruhm als Chirurg und Kliniker ersten Ranges. Hiermit verbindet er vermöge seiner idealen Auffassung der Heilkunde, die der Philosoph Schelling als die Krone und Blüthe aller Naturwissenschaften bezeichnet, die größte Humanität, und er bethätigt in seiner Person den von Galenus aufgestellten Satz, daß nur der das Ziel der Wissenschaft erreichen kann, welcher sie erlernt, um ein Wohlthäter der Menschheit zu werden. Wer Nußbaum je auf seinen Gängen durch die Krankensäle begleitet oder ihn sonst in seiner Berufsthätigkeit beobachtet hat, konnte wahrnehmen, wie außerordentlich liebevoll er auf das Wohl seiner Patienten ohne Unterschied des Standes bedacht und für deren Bedürfnisse besorgt ist. In seinem Ordinationszimmer drängt sich täglich während der Sprechstunden eine große Anzahl unbemittelter Kranker, welchen er, obwohl mit Berufsgeschäften überhäuft, Zeit und Arbeitskraft opfert und denen er häufig auch Verbandstoffe, orthopädische Apparate, Arzneien und Lebensmittel spendet.
Schreiber dieser Zeilen war Zeuge, wie Nußbaum zur Weihnachtszeit arme Pfleglinge in seiner Privatheilanstalt und im Kinderspitale aufs freigebigste mit Erquickungen, Kleidungsstücken, Unterhaltungsbüchern und allen möglichen Spielsachen beschenkte, die er in seinem Wagen und in seinen weiten Taschen mitgebracht hatte. Ohne den Dank abzuwarten für die Freude, die er bereitet hatte, fuhr dann der Vielbeschäftigte wieder davon.
Leute aus den verschiedensten, den höchsten wie den niedersten Gesellschaftskreisen, welche mit dem edlen Manne in nähere Berührung kamen, rühmen seine seltene Herzensgüte, seine Uneigennützigkeit und seine bis zur Selbstverleugnung gehende Bescheidenheit. Durch sein allzeit liebenswürdiges Entgegenkommen hat er sich die unbegrenzte Verehrung und Zuneigung seiner Fachgenossen und Schüler erworben, durch seine werkthätige Betheiligung an allen menschenfreundlichen Bestrebungen und seine Bereitwilligkeit, jedem zu nützen, die Liebe der ganzen Bevölkerung seiner Vaterstadt gewonnen.
Nur kurze Zeit unterbrach Nußbaum im Jahre 1866 die Friedensthätigkeit, um seinen unter den Waffen stehenden Mitmenschen seine Dienste zu widmen. Bei Beginn des Feldzuges veröffentlichte er „Vier Briefe an seine in den Krieg ziehenden ehemaligen Schüler“, welche die Grundsätze der damaligen Kriegschirurgie enthalten. Er selbst eilte nach dem Gefechte von Kissingen auf den Kriegsschauplatz und übernahm aus den dortigen Spitälern eine größere Anzahl Schwerverwundeter, die er durch geeignete Verbände beförderungsfähig machte und dann in fünfzehn von ihm zweckmäßig eingerichteten Wagen nach München verbrachte, um daselbst ihre weitere Behandlung zu besorgen.
Eine ungleich größere Thätigkeit entfaltete Nußbaum im deutsch- französischen Kriege, in welchem er vom Ausmarsche an dem Führer des 1. bayerischen Armeecorps General von der Tann als Oberstabsarzt beigegeben war; an dessen Seite hat er mit eiserner Ruhe und Unerschrockenheit an allen Schlachten und Gefechten theilgenommen. Rastlos arbeitete er im Wetteifer mit den Militärärzten auf den Verbandplätzen und in den Feldspitälern, in denen er als konsultirender Arzt wirkte.
Augenzeugen wissen zu erzählen, wie er in den Tagen von Sedan, keine Ruhe sich gönnend, zu Remilly und in dem in Brand geschossenen
[354] Bazeilles viele auf Aeckern und in Gärten liegende Verwundete, die wegen Ueberfüllung der wenigen belegbaren Gebäulichkeiten nicht mehr untergebracht werden konnten, untersuchte, mit Verbänden versah, dann deren Verbringung an gesichertere Orte veranstaltete und unter den erschwerendsten Umständen die nöthigen Operationen vornahm. Die gleiche aufopfernde Thätigkeit entwickelte Nußbaum bei und nach den Kämpfen um Orleans. „Den Tapfersten der Tapfern“ nannte einst Napoleon I. seinen obersten Wundarzt Larrey; auch Nußbaum war eines solchen Ehrentitels würdig.
Vom Kriegsschauplatz zurückgekehrt, setzte Nußbaum seine Fürsorge für die in seine Privatheilanstalt aufgenommenen Schwerverwundeten fort; noch vor wenigen Jahren haben einige daselbst unentgeltlich in Pflege und Behandlung gestanden.
Daß Nußbaum unermüdlich an der Vervollkommnung seiner Wissenschaft arbeitete und alle Fortschritte derselben kennen zu lernen trachtete, darf uns bei einem Manne wie er nicht wunder nehmen. Aus seinen vielfachen wissenschaftlichen Forschungen und den Ergebnissen seiner praktischen Thätigkeit, die er in fruchtbarster Weise litterarisch verwerthete, entstanden über hundert Abhandlungen und Monographien, welche die verschiedensten Zweige der medizinischen Wissenschaft betreffen; viele Verbesserungen von Heilverfahren und Operationsmethoden hat darin Nußbaums schöpferischer Geist zu Tage gefördert, Erfindungen, die zum großen Theile für den Stand der ärztlichen Kunst bahnbrechend geworden sind.
Ein großes Verdienst hat sich Nußbaum als einer der ersten festländischen Anhänger und Verfechter der von dem Engländer Lister ersonnenen „antiseptischen Wundbehandlung“ erworben; trotz der vielen dagegen erhobenen Bedenken hat er diese Methode in richtiger Erfassung ihres unschätzbaren Werthes am 1. Januar 1875 auf eigene Kosten in ausgedehntestem Maße in seiner Klinik eingeführt; der Erfolg war geradezu verblüffend. Operationen, deren Ausführung ehedem wegen ihrer Lebensgefährlichkeit für tollkühn oder gar für verbrecherisch gegolten hätte, konnten nunmehr gefahrlos vorgenommen werden, die Wundkrankheiten wurden fast vollständig gebannt, die Sterblichkeitsziffer sank bedeutend, der Heilungsprozeß ward wesentlich beschleunigt, sodaß sich die Aufnahmefähigkeit der Krankenhäuser entsprechend steigerte. Nußbaum war es auch, der sofort den hieraus entspringenden gewaltigen Nutzen für die Behandlung der im Felde Verwundeten erkannte.
Zur rascheren Verbreitung des antiseptischen Verfahrens, welches heute zum Gemeingute aller Aerzte geworden ist, hat Nußbaum wesentlich beigetragen, nicht nur durch seine klinischen Vorträge, sondern auch durch eine ganze Reihe von Schriften, darunter das prächtige Buch „Leitfaden für antiseptische Wundbehandlung“, welches bereits in fünfter Auflage erschienen und in fünf Sprachen übersetzt worden ist.
Als Lister im gleichen Jahre, in dem sein Verfahren zum ersten Male im Krankenhause zu München in Anwendung gekommen war, diese Stadt besuchte, wurde zu Ehren dieses Mannes eine Festversammlung veranstaltet, und Nußbaum war es, der in einer glänzenden Rede den hochverdienten Gast feierte.
Dem Bestreben, gemeinnützig zu wirken, entstammen Nußbaums mit größtem Beifall aufgenommene, echt volksthümliche Vorträge, die er in Volksbildungs- und in anderen Vereinen gehalten hat, sowie seine sonstigen Veröffentlichungen über Gesundheitspflege und verwandte wissenschaftliche Stoffe, Aufsätze, die zum Theil auch in der „Gartenlaube“ erschienen sind.
Die von ihm verfaßte, bereits in mehreren Auflagen erschienene „Kleine Hausapotheke“ ist ein wahres Schatzkästlein goldener Lehren der Gesundheitspflege; vor kurzem ist sogar in Amerika eine Ausgabe davon veranstaltet worden, wodurch das gediegene, auf neuester wissenschaftlicher Grundlage beruhende Werk auch über dem Meere gar vielen zu Nutz und Frommen dienen wird.
Alle seine Schriften zeichnen sich durch Schärfe der Auffassung, Klarheit und Deutlichkeit der Darstellung und einen bei aller Einfachheit reizvoll schönen, fesselnden Stil aus.
An Auszeichnungen und öffentlichen Ehrungen der verschiedensten Art hat es Nußbaum nicht gefehlt. Den höchsten Lohn jedoch sieht er in der Liebe und Verehrung seiner Mitbürger, seiner Amtsgenossen und Schüler und in der Dankbarkeit der vielen Tausende, denen er Helfer und Retter geworden ist.
Und sie alle sind es, die heute mit uns das gütige Schicksal preisen, welches diesen seltenen Mann von schwerem Krankenlager wieder erstehen ließ zum Heile der Wissenschaft und zum Segen seiner Mitmenschen; die mit uns bewundernd aufschauen zu dem Menschenfreunde, der stets sein ganzes Glück in der Beglückung anderer gesucht und gefunden hat. M. N.
Wieder einmal der Kuckuck.
Beobachtungen über vereinzelt vorkommendes Selbstbrüten des Kuckucks sind in früheren Jahren schon verschiedentlich zur Veröffentlichung gebracht worden; aber diese Mittheilungen drangen über einen engeren Kreis von Fachgelehrten nicht hinaus, da ihre Zuverlässigkeit von anerkannten Gewährsmännern auf dem Gebiete der Vogelkunde in Zweifel gezogen wurde. Im Mai 1888 hatte nun der bekannte Naturforscher Oberförster Adolf Müller das seltene Glück, ein brütendes Kuckucksweibchen während der ganzen Dauer des Brutgeschäftes zu beobachten. Müller hat seinerzeit in der „Gartenlaube“ (1888, S. 413) zuerst über seine Entdeckung Bericht erstattet. Beim Lesen seines Aufsatzes drängten sich mir nun unwillkürlich folgende Fragen auf: „Giebt es einzelne Individuen dieser Vogelart, welche, einem mächtigen Bruttriebe nachgebend, jedes Jahr selbst brüten? Oder besorgt der Kuckuck nur unter dem Zwang äußerer Umstände das Geschäft des Brütens selbst und huldigt zu anderen Zeiten wieder der bequemen Weise seiner Artgenossen?“
Obwohl ich mir sagen mußte, daß es schwerlich jemals gelingen dürfte, unanfechtbare Beweise für die eine oder andere Annahme beizubringen, so war ich doch geneigt, die erste Frage zu bejahen, also als Grund des Selbstbrütens einen individuellen Bruttrieb anzunehmen. Man hat bereits in den Nestern von mehr als 70 Vogelarten Kuckuckseier entdeckt. Der Fall, daß der Kuckuck unter Umständen kein fremdes Gelege, auf dem er sein eigenes reifes Ei ablegen könnte, zu finden vermöchte, dürfte also wohl kaum eintreten; ebensowenig habe ich früher beobachtet oder gelesen, daß sich Nistvögel dem Mißbrauch ihres Nestes seitens desselben mit Erfolg widersetzten. Während des letzten Sommers aber hatte ich Gelegenheit, einen Fall zu beobachten, in welchem letzteres thatsächlich stattfand. Da ich der Ansicht bin, daß das Dunkel, in welches das Leben und Weben des Kuckucks noch immer gehüllt ist, in absehbarer Zeit nur dann gelichtet werden kann, wenn sich neben berufenen Forschern auf dem Gebiete der Thierkunde auch Naturfreunde an der Lösung dieser Frage betheiligen, so bringe ich den erwähnten Vorgang hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
Am Nachmittage des 4. Juni vergangenen Jahres machte ich mit meiner Frau einen Spaziergang nach einem in der Gemarkung von Hagen (Westfalen) gelegenen Walde. Wir durchschritten zunächst einen jungen Eichenbestand, der wie im vorangegangenen so auch in diesem Sommer durch die Raupe des Eichenwicklers stark geschädigt wurde. Hier hielten sich seit Wochen einige Kuckucke auf, und ich hatte dieselben durch Nachahmen ihres Rufes und des sog. Kuckucksgelächters zu verschiedenen Malen in meine Nähe gelockt. Ich machte auch an diesem Tage einen Versuch, der aber erfolglos blieb. Wir kamen bald auf eine abschüssige Lichtung. Vor uns lag niedriges Buchen- und Erlengestrüpp, im Rücken hatten wir den erwähnten Eichenbestand; rechts grenzte die Lichtung an einen Wiesengrund, während die letzterem gegenüberliegende Seite mit jungen Buchen und Birken bewachsen war. Plötzlich wurde durch lautes Vogelgeschrei meine Aufmerksamkeit erregt, und ich gewahrte an der höchsten Stelle der Lichtung, am Rande des Buchen- und Birkenbestandes, in einer Entfernung von etwa 60 Metern einen größeren und zwei kleinere Vögel. Da ich glaubte, dieselben würden alsbald im nahen Eichenwalde verschwinden, so beeilte ich mich, meinen Feldstecher, den ich bei meinen Ausflügen in den Wald fast immer bei mir trage, nach der betreffenden Stelle zu richten. Doch meine Besorgniß war grundlos; die Vögel hielten sich hin- und herkreisend längere Zeit auf der Lichtung. Hatte ich im ersten Augenblick den größeren derselben für einen die kleineren verfolgenden Sperber gehalten, so erkannte ich in demselben jetzt deutlich einen Kuckuck und ebenso, daß er nicht der Verfolger, sondern der Verfolgte war. Obwohl sich die Farbe seines Gefieders vor meinem Glase sehr matt darstellte, so war ich doch noch nicht überzeugt, daß ich in demselben ein weibliches Individuum vor mir hatte. Nach einer Weile fußte der Kuckuck auf einer jungen Eiche, hart am Rande der Lichtung, und das Geschrei der kleinen Vögel verstummte während dieser Ruhepause. Auch auf die Gefahr hin, die Gruppe zu verscheuchen, näherte ich mich eiligen Schrittes. Doch das Gefürchtete trat nicht ein. Der Kuckuck, den ich jetzt mit bloßem Auge ganz deutlich als ein Weibchen erkannte, erhob sich zwar, von den kleinen Vögeln, einem Paar Rothkehlchen, mit zornigem Geschrei eifrig verfolgt, strich aber nicht ins Dickicht ab. Es fiel mir auf, daß sich der Kampfesmuth der Verfolger immer steigerte und ihr Geschrei jedesmal heftiger gellte, wenn der Kuckuck an einer bestimmten Stelle dicht an der Erde hinstrich, und ich konnte deutlich bemerken, wie sie bei dieser Gelegenheit einige Male in sein Gefieder bissen. An dem betreffenden Platze glaubte ich das Rothkehlchennest, in welchem der Kuckuck wahrscheinlich sein reifes Ei abzulegen beabsichtigte, mit einiger Gewißheit vermuthen zu dürfen. Des Kuckucks weit aufgesperrter Schnabel, sowie die Dreistigkeit, mit welcher er, seine sonstige Scheu vergessend, fortwährend so dicht an mir vorbeistrich, daß ich das Rauschen seiner Flügelschläge deutlich hören konnte, schien mir mit Bestimmtheit auf ein solches Vorhaben hinzudeuten. Der Leser kann dasselbe Gebaren bei unsern weiblichen Hausvögeln beobachten, wenn dieselben einen geeigneten Platz zum Ablegen eines nahen Eies suchen. Thatsächlich fand ich denn auch an der erwähnten Stelle unter dem Schutze eines morschen Buchenstumpfes in einer Erdvertiefung das Nest, welches ein Gelege von vier Eiern barg. Letztere erkannte ich an der zart gelblichweihen Färbung, den rothen Spritzen und Punkten und dem Kranze von bräunlichen Flecken am stumpfen Ende als sämmtlich vom Rotkehlchen herstammend. Ich zog mich wieder auf einige Entfernung ins Gebüsch zurück und sah, wie das Kuckucksweibchen noch zwölfmal am Neste vorbeistrich. Doch alle Bemühung, auf dasselbe zu gelangen, scheiterte an der Tapferkeit der Eigenthümer, welche ihren Feind immer wieder in das nahe Dickicht trieben. Die Sonne stand bereits tief am Himmel, als der Kuckuck verschwand. Während der folgenden Zeit besuchte ich fast täglich das Nest. Die Zahl der Eier stieg auf sechs, es befand sich aber unter denselben kein Kuckucksei.
Wenn ich den Vorgang richtig aufgefaßt habe, was ich nicht im mindesten bezweifle, so dürfte das Kuckucksweibchen, dank der Wachsamkeit der kleinen Nistvögel, in vereinzelten Fällen die Nöthigung erfahren, sein reifes Ei in irgend einer Vertiefung des Bodens – auch die Brutstätte des von Müller beobachteten selbstbrütenden Kuckucks war eine Bodenmulde – ablegen zu müssen. Sollte es in einem solchen Falle nicht unter Umständen sich entschließen, die übrigen Eier beizulegen und das Gelege selbst zu bebrüten? Ferner halte ich auf Grund des geschilderten [355] Vorganges die Ansicht, daß die kleinen Vögel, welche man häufig im Gefolge des Kuckucks findet, denselben neckisch umschwärmen, für eine irrige, vielmehr wird der Kunckuck als der bestgehaßte Feind, als der Verderber ihrer Brut von ihnen verfolgt. –
| * | * | |||
| * |
Anmerkung der Redaktion. Zu den vorstehenden Beobachtungen macht uns Adolf Müller folgende Mittheilungen: „Die Bebrütung des Kuckucksgeleges außerhalb eines fremden Nestes durch den weiblichen Kuckuck ist eine Ausnahmeerscheinung, deren Ursache schwer zu ergründen sein wird. Es mag ein Rückschlag zu der ursprünglich dem Kuckuck ebenfalls eigenthümlichen Gewohnheit des Brütens sein. Die zuerst aufgeworfene Frage des Verfassers, die er selbst fallen läßt, möchte mit Nein zu beantworten sein, weil Einzelwesen die Eigenthümlichkeit der Art schwerlich so vollständig durchbrechen. Eher liegt ein Grund für die Bejahung der zweiten Frage in der Gegnerschaft des Rothkehlchenpaares gegen das Kuckucksweibchen. Vollkommen bestätigt finden wir hier aber unsere eigenen Beobachtungen an Rothkehlchen, welche sich gegen die Absicht des Kuckucks, das Ei in ihr Nest einzuschmuggeln, nachdrücklich wehren, wie es ja andere Vogelarten ebenfalls thun. Wir begrüßen freudig die mit der unsrigen übereinstimmende Beobachtung, daß gerade die streitbaren, unter Umständen todesmuthigen Rothkehlchen den Kuckuck vom Neste fern zu halten suchen; nur gelang es nach unseren Erfahrungen doch jedesmal dem Kuckuck, sein Ei anzubringen, und die tapferen Streiter ergaben sich schließlich in ihr Schicksal. In dem von Störmer beobachteten Falle kann allerdings der Kuckuck vom starken Legedrang bewogen worden sein, sein Ei auf dem Boden abzulegen. Dasselbe mag bei anderen Verhinderungen und Störungen oder bei dem Mangel an den nöthigen Bedingungen geschehen. Ob aber daraus auch das Bebrüten sich folgern läßt? Die Mögllchkeit möchten wir nicht bezweifeln; bloße Vermuthungen aber lösen die Ursache des Brütens in der Lebensgeschichte unseres geheimnißvollen Vogels keineswegs.
Inzwischen möge hier noch eine Beobachtung angefügt werden, welche ein Licht wirft auf die Erregung der Rothkehlchen in der Brutzeit und auf die veränderlichen Schicksale, welchen der junge Kuckuck ausgesetzt ist. Dieselbe ist mir im August v. J. von Frau Professor Neubaur aus Berlin mitgetheilt worden.
Frau Neubaur begab sich eines Morgens in Begleitung eines Jägers in den Park auf dem Gute ihres Oheims bei Hamburg und hörte dort zankende Vogelstimmen. Sie schlich näher und entdeckte ein Rothkehlchennest, auf dessen Rande die beiden Nistvögel sich gegenübersaßen, das Weibchen in trotziger, das Männchen in zorniger, gleichsam herrischer Stellung. Die Ursache des Streites war ein Kuckucksei, welches bei drei bebrüteten Eiern des Rothkehlchens in dem Neste lag. Von einem nahen Verstecke aus konnte weiter beobachtet werden, daß der weibliche Vogel dem Drängen des Gatten nachgab und das Brutgeschäft fortsetzte. Nach acht Tagen schlüpften drei Rotkehlchen aus, die von den Eltern sorgsam gepflegt wurden. Am dreizehnten oder vierzehnten Tage kroch zur großen Aufregung des Rothkehlchenpaares auch der junge Kuckuck aus. Bald zeigte sich aber, daß er die Nestlinge sehr bedrängte und in stete Gefahr brachte, so daß die Rothkehlchen endlich den Kuckuck mit den Schnäbeln arg bearbeiteten und aus dem Nest zerrten, vor dem er starb. Das Paar pflegte und zog sodann seine Jungen sorgsam groß.“
Blätter und Blüthen.
Kleine Gesundheitslehre von Bock. Kein gemeinverständliches medizinisches Werk hat eine so große Verbreitung erlangt wie Bocks „Buch vom gesunden und kranken Menschen“. Auch nach dem Tode des Verfassers erfreut es sich in mustergültiger Bearbeitung Dr. v. Zimmermanns des altbewährten Rufes: es umfaßt aber einen starken Band von über 60 Druckbogen, und das ist für viele zu viel. Es giebt Leute, die aus Rücksicht auf die Anschaffungskosten so umfangreichen Werken bündigere Darstellungen vorziehen müssen, ebenso wie es andere giebt, die möglichst wenig lesen und dabei möglichst viel erfahren möchten. Professor Dr. Bock, ein Meister der volksthümlichen Darstellung, kannte seine Leute, und so hat er neben dem „großen Bock“ eine „kleine Gesundheitslehre.“ geschrieben, ein kleines Büchlein, in dem das Wichtigste und Nöthigste von allgemein faßbarem medizinischen Wissen mitgetheilt wurde. Die wiederholten Auflagen haben den Beweis geliefert, daß damit auch das Richtige getroffen wurde. Heute liegt uns die „Kleine Gesundheitslehre“, die zum Kennenlernen, Gesunderhalten und Gesundmachen des Menschen dienen soll, in neuer Bearbeitung durch Dr. v. Zimmermann vor. Das etwa 12 Druckbogen umfassende Buch kostet gebunden 1 Mark.
Alle Fortschritte der Medizin in der neuesten Zeit sind von dem Bearbeiter berücksichtigt worden, und so ist die „Kleine Gesundheitslehre“ in ihrem neuen Gewande wieder ein trefflicher praktischer Rathgeber, aus dem jedermann Belehrung in Gesundheitsfragen schöpfen kann. Besonders vortheilhaft sind die Abschnitte, welche die erste Hilfe bei Unglücksfällen betreffen, ausgezeichnet ist aber der Anhang „Garstige Übel und häßliche Angewohnheiten“, in welchem alle die kleinen Leiden und Fehler erörtert werden, die im gesellschaftlichen Leben Anstoß erregen. Freimüthig wird darin erörtert, was an unserm Körper den Geruchsinn, das Gehör oder das Auge unserer Nächsten verletzen kann, und es werden dabei auch die Mittel angegeben, wie man solche Fehler und häßliche Angewohnheiten beseitigen kann.
Mitesser, Sommersprossen, geröthete Nasen, Hühneraugen u. dergl., das sind ja alles Themata einer gewissermaßen „kleinen Medizin“, für die auf eigene Faust leider oft sehr unnütz viele Mark geopfert werden. Die „Kleine Gesundheitslehre“ ist auch auf diesem Gebiete ein ersprießlicher Rathgeber und ein ehrlicher dazu, welcher den Beutel des unter solchen geringfügigen Leiden Seufzenden zu schonen weiß. *
Das Koller Gustav Adolfs, des Königs von Schweden, welches derselbe trug, als ihn in der Schlacht bei Lützen am 16. November 1632 der Tod ereilte, ist heute noch vorhanden. Das merkwürdige Stück befindet sich in der Waffensammlung im k. k. Artilleriearsenal zu Wien. Das Koller ist von schwerer Elenhaut, innen vollständig zuerst mit starker Leinwand, darüber mit grünem Atlas gefüttert. Die Brusttheile sind zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit noch mit fünffachem abgestepptem Zwilch unterlegt. Von Reliquiensammlern sind das Futter und einzelne Theile des Kollers selbst stark mitgenommen worden. Trotzdem sämmtliche einst dicht aneinander gereihte Knöpfe fehlen – sie waren wahrscheinlich von Silber und wurden als gute Beute betrachtet – wiegt das Koller jetzt noch gegen 3½ Kilogramm. Die erste Verwundung erhielt Gustav Adolf am linken Ellenbogen; das Stück mit dem durch die Kugel verursachten Loch ist aus dem Aermel ausgeschnitten, doch sind Blutspuren noch deutlich erkennbar.
Die zweite, jedenfalls tödliche Kugel traf den Schwedenkönig im Rücken; das durch die Kugel erzeugte Loch hat einen Durchmesser von 15 bis 18 mm, die Ränder desselben sind ganz verbrannt, so daß kein Zweifel besteht, daß der Schuß auf geringe Entfernung abgegeben wurde. Auf der linken Brustseite findet sich ein Loch, das offenbar durch den Stich eines vierseitigen Panzerstechers erzeugt wurde. An der Echtheit dieses Rockes ist nicht zu zweifeln, denn erstens findet sich ein Zettel in der Handschrift der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit der Bestätigung derselben an der merkwürdigen Reliquie; zweitens meldet schon Khevenhiller in seinen „Annales Ferdinandei“, daß der Rock auf dem Schlachtfelde von einem kaiserlichen Soldaten erbeutet und vom Generalfeldwachtmeister Duca Oktavio Piccolomini „noch ganz blutig dem Kaiser nach Wien übersendet“ worden ist.
Die Opfer des Leuchtthurmlichtes. Man hört oft von den Verheerungen, welche die Leuchtthürme unter der Vogelwelt anrichten, namentlich während der Zugzeit, so wird erzählt, sollen unzählige Vögel auf das Licht losfliegen und an den dicken Glasscheiben der „Laterne“ sich Hals und Flügel brechen. Die Thatsache ist an und für sich wahr, nur die Massenhaftigkeit der auf diese Weise zu Grunde gegangenen Vögel wird von Fachleuten in Abrede gestellt. Man hat die Leuchtthurmwächter zur genaueren Beobachtung veranlaßt und die Ermittelungen des Oberwächters Gaebel an dem Leuchtthurm in Horst bei Treptow an der Rega sind neuerdings von H. Röhl in einem Fachblatte veröffentlicht worden. Die Zahl der umgekommenen Vögel schrumpft danach bedeutend zusammen, von Tausenden todter Vögel, die in einer Nacht gesammelt werden sollten, ist darin keine Rede. Die Zahlen stellen sich erfreulicherweise viel niedriger; so wurden im Jahre 1885/1886 nur 190 todte Vögel an dem genannten Leuchtthurm gefunden; im nächsten Jahre 158; im Jahre 1887/1888 140 und im Jahre 1888/1889 nur 62.
Durch diese Beobachtungen wird die schon früher aufgestellte Annahme bestätigt, daß die Vögel sich mit der Zeit an das Hinderniß gewöhnen und es zu meiden lernen; denn nicht das Licht zieht die Vögel in ihr Verderben hinein, sondern die meisten werden an die Leuchtthürme in stürmischen Nächten angetrieben. Die älteren Vögel, welche die bestimmte Straße schon öfters gezogen sind, warnen alsdann die Jüngeren, und so wurde auch wiederholt bei größeren Zügen bemerkt, daß sie sich, sobald sie in die Nähe der Leuchtthürme kamen, hoben und jenseits sich senkend ihre Straße weiter zogen.
Dasselbe, bemerkt dazu Röhl, trifft bei unseren Telegraphendrähten zu. Wie viele Vögel gingen früher an ihnen zu Grunde! Jetzt wird das höchst selten oder gar nicht mehr beobachtet. Im vorletzten Jahre allerdings fand man viele Steppenhühner durch sie beschädigt oder getödtet, weil sie ebenfalls diese Drähte nicht kannten. Wären sie bei uns geblieben, so hatten sie sich auch daran gewöhnt wie alle unsere Vögel.
So steht auch zu erwarten, daß die Leuchtthürme mit der Zeit immer weniger Opfer fordern werden. „Aber jene Opfer,“ schließt Röhl, „sind nicht umsonst gefallen: durch sie sind die für die Wissenschaft so wichtigen Zugstraßen der einzelnen Vogelarten festgestellt worden.“ *
Des deutschen Reiches Zuckerbüchse. Oestlich von der rührigen Handelsstadt Nordhausen, an der Unstrut und der thüringischen Saale entlang bis hinab zur Elbniederung und dann weiter auf dem linken Elbufer an dem ehrwürdigen Magdeburg vorbei bis in die Gegend von Wolmirstedt – und nun in scharfer Biegung westlich bis nach Braunschweig und Seesen hin schmiegt sich um den Felsenleib des Harzgebirges herum ein fruchtbarer Ländergürtel, in welchem die „goldene Aue“ und die „Magdeburger Börde“ als leuchtende Perlen erglänzen: das ist der „Zuckerboden“, das vorzüglichste Rübenland Deutschlands. Nicht weniger als 201 Fabriken und Raffinerien, fast die Hälfte der Zuckerfabriken des ganzen Reiches, sind hier auf einem kleinen Fleck vereinigt. Auf Preußen entfällt der Löwenanteil mit 133 Fabriken, dann folgt Braunschweig mit 38 und Anhalt mit 30 Fabriken.
Spärlich sind dagegen die Zuckersiedereien in den übrigen Theilen Deutschlands zerstreut; auf die drei Königreiche Bayern, Württemberg und Sachsen entfallen beispielsweise nur je 5 Fabriken, und so ist in der That das Vorland des Harzes die Zuckerbüchse des Deutschen Reiches.
Ein deutscher Nationalhort. Wenn die natürlichen Schätze an Kohle und Eisen der Gradmesser für den Reichthum eines Landes sind, so ist Deutschland nach dieser Seite hin in einer glücklichen Lage; es hat, was das Eisen anbetrifft, durch die Erwerbung von Lothringen zu seinen alten Schätzen an Eisenerz ein neues fast unerschöpfliches Eisenerzlager [356] gewonnen: die lothringischen Minettegruben. Auf französischem Boden bei Nancy beginnend, erstreckt sich diese ungeheuere Schatzkammer am linken Moselufer entlang über Pagny, Novéant, Ars, Metz, Amanweiler bis Diedenhofen, geht dann weiter in das Luxemburger Ländchen hinein bis Düdelingen und tritt dann bei Longwy und Longuyon nach Frankreich zurück. 60 km von 100 km entfallen davon in ihrer größten Mächtigkeit auf Deutschland. In zahlreichen Seitenthälern, von Novéant nach Gorze, von Ars nach Gravelotte, von Moulins nach Amanweiler, im Bronvauxthale westlich von Maizieres tritt das Erz zu Tage.
Das lothringische Erzlager ist das mächtigste in Europa nächst dem englischen von Cleveland. Man hat dasselbe auf 2 Milliarden Tonnen geschätzt; die Förderung von 1888 mit nahezu 3 Millionen Tonnen zu Grunde gelegt, würde es noch über 700 Jahre vorhalten.
So haben wir alle Ursache, das mit dem Blute der Edelsten unseres Volks erworbene Land eifersüchtig zu hüten als einen Hort unseres Wohlstandes.
Doppelempfindung. Nicht von der romanhaften Doppelempfindung, wo man den Verlust des Liebsten „doppelt schwer“ – oder „doppelt leicht“, je nach Umständen, empfindet, soll hier die Rede sein, sondern von durchaus wirklichen und rein sinnlichen Empfindungen, von jenen Fällen, wo ein Reiz zwei Empfindungen hervorruft.
Wir wissen schon seit geraumer Zeit, daß es solche Fälle giebt. Nußbaumer hat zum ersten Mal ausführlicher darüber berichtet. Er selbst war nicht musikalisch veranlagt und konnte, wenn a oder g angeschlagen wurde, den Ton nicht wiederfinden; aber der Ton erregte in ihm nicht allein Tonempfindung, sondern auch Farbenempfindung und vermöge der Farbe, die er dabei wahrnahm, konnte er den Ton wiedererkennen. Sein Bruder hatte ein feines Gehör, aber Toneindrücke riefen auch bei ihm Farbenempfindungen hervor; das Fahren eines Wagens war von Eindrücken grüner Farbe begleitet, beim Anschlagen eines musikalischen Accordes pflegte er ein lebendig wechselndes Farbengemisch und bei längeren Musikstücken eine Menge farbiger Blitze innerlich aufleuchten zu sehen. Doppelempfindsam in dieser Art war auch der Komponist Franz von Holstein. Seine Farbenempfindung bezog sich auf Vokale: a rief bei ihm die Empfindung einer weißen Farbe hervor; e war ihm grün, i gelb, o purpurroth, u braun. In allen diesen Fällen hat ein Sinnesreiz – der Ton – nicht nur Gehörsempfindung, sondern auch Farbenempfindung zugleich hervorgerufen, und diese Form der Doppelempfindung ist die am meisten verbreitete.
Es giebt auch andere Formen, wo Farben bei Geruchs- und Geschmacks-, bei Tast-, Schmerz- oder Temperatureindrücken empfunden werden. Diese kommen jedoch selten vor, noch seltener aber findet das Umgekehrte statt, daß z. B. Töne bei Reizen auf den Sehnerv wahrgenommen werden.
Der berühmte Psychologe Fechner beschäftigte sich besonders mit diesen seltsamen Erscheinungen, deren Wesen endgültig noch nicht erklärt ist, und hatte Fragebogen ausgesandt. Dr. Steinbrügge war nun in der Lage, das eingegangene Material zu prüfen und hat dasselbe vor kurzem veröffentlicht. Danach wurden die früheren Beobachtungen bestätigt und außerdem konnte festgestellt werden, daß die Doppelempfindung keineswegs selten ist, denn von Farbenassociationen allein konnten durch Steinbrügge 442 Fälle nachgewiesen werden. *
Kleiner Briefkasten.
Stammtisch bei Schr., Mülheim a. R. Wir schließen aus Ihrer Zuschrift zweierlei: erstens, daß sich kein Arzt in Ihrer Tafelrunde befindet, zweitens, das Sie allesammt ordentliche Leute sind, von denen noch keiner ein weibliches Herz krank gemacht hat. Sonst könnten Sie über die Deutung des Bildes „Herzkrank?“ nicht im Zweifel sein. Trinken Sie eine Flasche „Besseren“ miteinander und dann besinnen Sie sich noch einmal.
M. A. R. in Konstantinopel. Besten Dank für Ihr freundliches Zutrauen. Wir sind indessen der Ansicht, daß der Gegenstand für die „Gartenlaube“ sich nicht eigne.
G. G. W., Toronto Von einer Gesammtausgabe der Werke Johannes Scherrs ist uns bis jetzt nichts bekannt geworden. Aus der großen Zahl seiner Werke empfehlen wir Ihnen hauptsächlich die litteratur- und kulturgeschichtlichen Schriften.
C. M. in Chemnitz. Die von Ihnen angeführten Buchstaben sind ohne Zweifel als Jahreszahl MDXCII. d. h. 1592 zu lesen.
J. H. in Karlsbad. Wir haben mit Bewunderung die wackere That des Zinngießermeisters Josef Hofmann vernommen, der, ein würdiger Nachfolger von Bürgers „bravem Manne“ ein junges Menschenleben aus der Gefahr des Ertrinkens errettet hat. Indessen eignet sich Ihr Gedicht schon um seiner großen Ausdehnung willen nicht zur Veröffentlichung in der „Gartenlaube“.
J. P., St. Louis. Der Gegenstand auf dem Umschlag, welcher Ihnen so viel Kopfzerbrechen gemacht hat, ist eine Mandoline.
D. Sch. in U. Ihren Wünschen dürfte das Universalsprachenlexikon in der neuen (7.) Auflage des Piererschen Konversationslexikons am besten entsprechen. Lassen Sie sich einmal von Ihrem Buchhändler einen der bis jetzt erschienenen Bände vorlegen.
B. in Z. Goethe hatte als Kind schwarze Augen, später wurden sie braun. Was aber Faust für Augen hatte? Wir wollen Ihnen die Antwort in Form eine guten Rathes geben: nehmen Sie Ihren Goethe vor und lesen Sie den „Faust“ von Anfang bis zu Ende mit Aufmerksamkeit durch! Vielleicht finden Sie darin, welche Farbe Fausts Augen hatten, – jedenfalls aber haben Sie einen höheren Gewinn davon, als wenn wir Ihnen das Geheimniß hier verriethen.
Allerlei Kurzweil.
Charade. Fehlt es an einem Munde Auch meiner Ersten zwar, Bringt sie dir dennoch Kunde Aus fernen Landen dar. Von meiner Zweit’ und Dritten Ein alter Sang erzählt, Daß sie im Reich der Briten Zum König einst erwählt. Mein Ganzes hat erhalten Der Farben viel und bunt, In allerlei Gestalten Weilt’s auf dem Erdenrund. Die Erste eilte nimmer Hin durch die ganze Welt, Wenn nicht das Ganze immer Ihr wäre zugesellt. Oscar Leede. Logogriph. Wer’s ist mit n, der meide Den Tummelplatz der Freude; Doch stelle er getrost sich ein, Wenn er’s versteht, mit r zu sein. Emil Root. |
Anagramm mit Akrostichon.
|
| Mai, Seni, Ostern, Kreta, Talon, Enge, Haken, Regan, Latte, Jdar, Schrei, Delos, Modena, Hain, Arles. Aus jedem der obigen Wörter ist durch Umstellen der Buchstaben und Hinzufügen eines neuen Lautes als Anfangsbuchstaben ein anderes bekanntes Wort zu bilden. Beispiel; Train + g = Granit. In anderer Reihenfolge bedeuten die zu suchenden Wörter: 1. einen deutschen Aesthetiker und Dichter, 2. eine Stadt in Südamerika, 3. einen Fluß in Syrien, 4. eine Stadt an der Elbe, 5. ein Hochland in Ostindien, 6. ein umherziehendes Hirtenvolk, 7. einen biblischen Namen, 8. ein Metall, 9. ein Reich in Asien, 10. Göttertrank, 11. einen weiblichen Vornamen, 12. eine Stadt in Italien, 13. einen Nebenfluß der Donau, 14. eine Frucht, 15. eine Farbe (auch eine Frucht). Ist alles richtig gefunden, so nennen die Anfangsbuchstaben dieser Wörter einen berühmten Maler. A. St. |