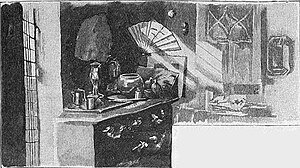Die Gartenlaube (1891)/Heft 36
[597]
| Nr. 36. | 1891. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Alle Rechte vorbehalten.
Ein Götzenbild.
„Wohin denn in solcher Eile? Brennt’s irgendwo?“
„Das nicht! Aber in der Via Sardegna soll ein Haus zusammengestürzt sein, eben jetzt, vor etwa zehn Minuten, mein Laufjunge hat mir’s erzählt – ich bin auf dem Weg dorthin!“
„Nehmen Sie mich mit! Via Sardegna? Es wird doch nicht – Dummheit! Was einem im ersten Schrecken für Gedanken aufsteigen … Wenn wir nur rasch hinkämen! Fährt dort nicht eine Droschke? Vetturino! Halt! Gottlob, er hat es gehört und kommt heran! Via Sardegna! Aber schnell, so schnell Ihr könnt!“
Die beiden Herren waren eingestiegen und rasselten nun durch die Straßen von Rom.
Sie waren nur oberflächlich mit einander bekannt, der behäbige Kaufmann und der bewegliche junge Maler; sie tauschten auch während der raschen Fahrt nur kurze Bemerkungen aus –
[598] ob es wirklich wahr sein werde, ob sich der Laufbursche nicht geirrt haben könne – in dem Viertel am Monte Pincio werde so viel gebaut, das Unglück könne ebensogut in einer anderen Straße geschehen sein, als in der Via Sardegna. Aber bei alledem war der junge Maler von Unruhe erfüllt, er hob sich fast jede Minute von seinem Sitz empor, um die Straße entlang zu sehen, und feuerte den Vetturino in einem ziemlich fließenden Italienisch, dem man jedoch ohne jede Mühe die deutsche Zunge anhörte, zu einem noch schnelleren Tempo an.
Jetzt endlich! Sie bogen in die Via Sardegna ein.
Schon während ihrer Fahrt liefen aufgeregte Menschen aus verschiedenen Richtungen herbei. Sie riefen einander zu und zeigten besorgte Gesichter; von allen Seiten, vom Corso d’Italia, an der Via Sicilia und Via Boncompagni, strömten neue Gruppen herbei, sie stießen einander beiseite, sie liefen sich athemlos, jeder wollte zuerst an der Stätte des Unglücks sein.
Der Vetturino sah sich mit fragender Miene nach seinen beiden Fahrgästen um und wies auf eine brausende wimmelnde dunkle Menschenmasse, welche die halbe Straße einnahm und sich von Minute zu Minute vergrößerte.
„Vorwärts! Vorwärts!“ befahl der Maler ungeduldig.
Die Pferde gingen noch ein paar hundert Schritte, dann verbot sich das Weiterfahren von selbst.
Der junge Mann sprang hastig auf das Pflaster, ohne an die Bezahlung zu denken, ohne sich nach seinem Gefährten umzusehen. Seine Augen gingen nach der Richtung, die ihm die vielen erhobenen Arme wiesen, und sein Gesicht wurde fahl vor Schreck.
„Also doch! Um Gotteswillen!“
Er versuchte, vorwärts zu dringen. Aber wie ein brandendes Meer umgaben ihn diese wild durcheinanderschreienden, aufgeregten Menschen, die sich rückwärts stauten, ungestüm vorwärts drängten und den Einzelnen wie einen wehrlosen Strohhalm hin- und herschleuderten. Gestikulierende Hände, gen Himmel geballte Fäuste hoben sich zuweilen aus diesem Getümmel hervor – ein Jammern und Fluchen, daß die Lüfte schallten – kreischende Kinder, die fast zertreten wurden, und dazwischen die Schutzleute zu Fuß und zu Pferd, bis jetzt ohne jeden Erfolg bemüht, Ordnung zu schaffen.
„Welches Haus ist’s?“ stieß der junge Maler mit Anstrengung heraus und faßte seinen nächsten Nachbar unsanft am Aermel; er hoffte noch, er könne sich dennoch geirrt haben – der Lärm, das Getümmel hatte ihn betäubt, es war gewiß ein anderes Haus …
„Casa Bortenyi!“ Der Angeredete riß sich unwillig los und stieß mit den Ellbogen, um weiterzukommen.
„O über das Unglück, das Unglück!“ jammerte eine durchdringende Weiberstimme. „Mein Mann wird noch drin gewesen sein und ist nun auch verschüttet – o Jesus Christus! Er hat es immer zu mir gesagt, der Palazzo wird zu schnell gebaut, alles soll wie durch ein Wunder fertig werden, so hat’s der reiche ungarische Graf, der sich den Palazzo aufbauen ließ, bestimmt! Ja, die Reichen, die herzlosen Kreaturen! Was fragen die nach ein paar Dutzend Menschenleben, wenn sie nur ihre verrückten Einfälle erfüllen können!“
„Schämt Euch doch, Frau!“ sagte eine rauhe Baßstimme in ihrer Nähe. „Der Graf kann nichts dafür, was versteht der von einem Bau! Er ist eben verlobt mit einer schönen Sieneserin und hat deshalb mit der Hochzeit und mit der Fertigstellung des Hauses geeilt. Aber den Ciorboso von Mailand, den Schuft von einem Architekten, der schon mehr solcher Bauten ‚über Nacht‘ ausgeführt hat – den könnt Ihr verfluchen!“
Sie waren während dieser Reden, die in dem wüsten Lärm um sie her niemand hörte und beachtete, der Unglücksstätte näher gekommen – das arme Weib, der Maler und der dicke Bürgersmann, der den Grafen vertheidigte. Und jetzt sah man eine ungeheure Wolke von Schutt und Kalk, welche die Luft erfüllte und die Sonne verdunkelte, sah in dem trüben Licht eine große feste Masse in sich zusammengesunken daliegen und daraus einzelne Balken und Trümmerstücke hervorragen, die sich wie zeigende Finger emporhoben.
Bereits war die Feuerwehr zur Stelle. Die wackeren Männer arbeiteten nach Kräften, unbekümmert um die eigene Lebensgefahr, die das unaufhörlich nachstürzende Gebälk ihnen brachte, unbekümmert auch um den immer wachsenden Tumult der Volksmenge, die sie umtoste, um die angstvollen Fragen, die man ihnen zuschrie, die Jammerrufe, die zu ihnen drangen. Sie konnten aber mit dem Werk, das ihnen oblag, allein nicht fertig werden und riefen den das Publikum abhaltenden Polizeisoldaten zu, man möge ihnen so rasch als möglich Verstärkung schicken – Sachverständige – von den Pionieren.
Die Erregung im Volk wuchs bei dieser Kunde ins unendliche, man wollte selbst Hand anlegen, wollte helfen; sollte man hier unthätig zuschauen, wie die Leute da drinnen sich abmühten, während unten im Schutt die Väter, die Brüder, die Gatten ersticken mußten? Warum war man denn nicht sofort auf den Gedanken gekommen, die Pioniere zu Hilfe zu holen, weshalb mußten erst die Männer, die schon bei der Arbeit waren, um die nothwendige Unterstützung bitten?
Umsonst suchten die Polizeisoldaten den Leuten begreiflich zu machen, daß dies sofort geschehen sei, daß die verlangte Hilfe sich schon auf dem Wege zur Via Sardegna befinden und jeden Augenblick eintreffen müsse, umsonst trieben sie die vorwärtsstürzenden Massen mit der flachen Klinge zurück, während die berittenen Schutzleute mitten hinein in die Volkshaufen ritten – es half alles nichts! Das südliche heiße Blut litt es nicht, daß die römische Bevölkerung thatenlos ausharrte und Vernunft annahm, die Leute wollten weder hören noch fühlen! Die schützende Postenkette wurde durchgerissen, wie eine mächtige Meereswoge wälzte sich der Menschenstrom unaufhaltsam vorwärts und ein unabsehbares neues Unglück wäre eingetreten, wenn nicht plötzlich, schon aus nächster Nähe, der taktmäßige Schritt einer großen Soldatenabtheilung und der knappe, laute Kommandoton einer durchdringenden Stimme dem wilden Durcheinander Einhalt geboten hätte.
„Die Pioniere!“
Ebenso rasch wie zuvor das Sturmlaufen fand jetzt das Zurückweichen statt. In wildem Eifer, in überstürzender Hast fluthete die Riesenwelle rückwärts, alles mit sich reißend, was sie auf ihrem Wege fand.
„Platz für die Pioniere! Laßt sie durch, die braven Leute! Zurück – zurück!“
Brausender Lärm erfüllte die Luft, man schrie und beglückwünschte einander, als sei das Werk der Rettung bereits geschehen. Die Helfer in der Noth wurden beinahe geschoben bis zur Casa Bortenyi; sie hatten ihre Werkzeuge zur Hand genommen und verschwanden unter den betäubenden Zurufen des Volks in den beständig aufwirbelnden Schuttwolken.
Der junge blonde Maler war ein paarmal in Gefahr gewesen, erdrückt und zertreten zu werden. Man hatte ihm den Hut vom Kopf geworfen, hatte ihn niedergerissen, wieder aufgerafft und wie ein willenloses Ding an eine Mauer geschleudert. Hier stand er nun, ein wenig abseits, und spähte umher, ob er niemand finden könne, der ihm Rede stehe. Da fiel sein Blick zufällig auf den dicken römischen Bürger, der vor einer Weile den ungarischen Grafen gegen die Anklagen der weinenden Frau vertheidigt hatte. Der brave Mann hatte sich gleichfalls mühsam aus dem Getümmel gerettet, man hatte auch ihm übel mitgespielt, athemlos stand er da und trocknete sein schweißtriefendes Gesicht. Der Maler kannte ihn von Ansehen und trat auf ihn zu.
„Entschuldigung, Signore! Seid Ihr nicht der Besitzer der hübschen römischen Weinschenke da drüben, gerade gegenüber der Casa Bortenyi?“
„Der bin ich, zu dienen. Und der Signore hat mir sicher einmal die Ehre angethan, ein Gläschen Chianti bei mir zu trinken!“
„Gewiß, ganz gewiß! Aber ich wollte Sie fragen: Sie kennen doch sicher einen jungen Bildhauer, der täglich in die Casa Bortenyi kommt, um zu arbeiten, ein schöner junger Mensch mit schwarzen Angen – –“
„O, Signore Troost, Werner Troost! Ob ich ihn kenne! Meiner Frau und Tochter ganzer Liebling, und bei Gott der meinige auch! Immer heiter und freundlich und schön, wie ein Maientag! Wißt, er kommt jeden Morgen zu mir, ehe er da drüben arbeiten geht, und stärkt sich mit einem Glas herben Rothweins –“
„Aber heute, heute!“ unterbrach ihn der Andere, zitternd vor Ungeduld. „Ist er heute gekommen, um zu arbeiten?“
[599] „Ach, Signore, das ist es ja! Ich hasse jedes Gewühl, solch ein Stoßen und Drängen, das ist nichts für mich! Aber meine Luisella behauptet, sie habe unsern Signore Troost vor ein paar Stunden da hineingehen sehen –“ er wies nach der Dunstwolke hinüber – „und er sei nicht wieder herausgekommen, und sie hat scharfe Angen, die Luisa! Sie hat mir keine Ruhe gelassen und meine Frau auch nicht, und so bin ich herübergelaufen und beinah in Stücke gerissen worden und konnte doch nichts Genaues erfahren; denn natürlich von denen, die in der Casa Bortenyi drinnen sind, haben sie noch keinen gefunden!“
Da erschütterte ein neuer Lärm, stärker noch als zuvor, die Luft, und die beiden drängten näher hinzu und fragten, was es gebe.
„Sie haben einen herausgebracht – einen Maurer, dort bringen sie ihn!“
Es waren schon Tragbahren, Seile, gerollte Decken zur Stelle, auch ein paar Aerzte aus dem nächsten Hospital mit Heilgehilfen, die Verbandzeug bereit hielten. Die Soldaten und Feuerwehrleute arbeiteten mit Heldenmuth weiter. Zerschunden und blutend, von herabfallenden Trümmerstücken getroffen, geblendet von dem scharfen feinen Kalkstaub, der ihnen das Sehen erschwerte und den Athem nahm, gruben und hoben sie unaufhörlich; sie ließen sich an Seilen herab und krochen durch Spalten und Risse, sie schleppten die schwersten Lasten, wanden sich unter schief übereinandergethürmten Quadern und Deckentrümmern hindurch, die jeden Augenblick von neuem einzustürzen drohten, und retteten so mit eigener Lebensgefahr die leblos daliegenden Arbeiter aus dem noch immer nachstürzenden Hagel von Mauerstücken und Steinen.
Die achte Tragbahre wurde soeben fortgetragen. Der Arbeiter, dessen Leiche darauf ruhte, war ein fleißiger. tüchtiger Mann gewesen, Vater von fünf hilflosen Kindern. Seine Frau war an der Bahre in die Kniee gesunken und erfüllte mit ihrem Wehgeschrei die Luft, während ein anderes Weib stumpfsinnig auf die formlose, unkenntliche Masse starrte, die man zu ihren Füßen niedergelegt und die sie an den Kleidern als ihren Mann erkannt hatte.
Und über all diesen Jammerscenen lächelte der mildeste Himmel, athmete der holdeste Vorfrühlingstag. Weich fächelte ein lindes Märzlüftchen, das einen deutschen Maiwind hätte beschämen können, über die vielen erhitzten, verweinten Gesichter, spielte mit den Haaren der Kinder und suchte die schweren Thränen zu trocknen, die in zahllosen Augen standen. Wie so oft, so war auch diesmal die heiter lachende Natur im schroffsten Widerspruch zu dem Elend der Menschen.
Der dicke Weinwirth hatte sich von seinem Kellner, der sich das seltene Schauspiel ebenfalls ansehen wollte, einen Schemel aus seinem Hause herbeischleppen lassen, auf diesen war er mit einiger Mühe hinaufgestiegen und konnte nun von seinem erhöhten Standpunkt so ziemlich alles übersehen, was bei der zerstörten Casa Bortenyi geschah. Sowie ein neuer Toter oder Verwundeter herbeigetragen wurde, berichtete er dem neben ihm stehenden Maler: „Es ist wieder nicht Werner Troost!“
Endlich, bei der zehnten Tragbahre, stutzte er, reckte sich hoch empor, um noch besser zu sehen, und sprang dann mit dem Ausruf: „Eccolo!“ von seinem Schemel herunter, so gewandt wie ein Jüngling.
„Schnell, schnell, Signore!“ rief er und zog den Maler an der Hand mit sich. „Raum für uns! Nur ein wenig Raum für uns!“ fuhr er zu der Menge gewendet fort und suchte sich einen Weg zu bahnen. „Wir haben einen Freund dort entdeckt – man bringt ihn soeben!“
„Macht Platz!“ – „Sie haben einen Freund gefunden!“ – „Laßt sie durch!“ hieß es von allen Seiten, und der Menschenschwarm theilte sich wie durch ein Wunder.
Blaß und leblos hingestreckt, die eine Hand wie im Krampf geballt, die andere lässig geöffnet, lag der kaum fünfundzwanzigjährige Mann auf der Tragbahre. Sein flottes samtenes Künstlerröckchen war zerrissen und befleckt, der rechte Aermel aufgeschlitzt und blutgetränkt – das feingeschnittene Antlitz aber mit dem schwarzen Bärtchen und dem gelockten Haar ganz unversehrt und mit den friedlich geschlossenen Augen einem Schlummernden täuschend ähnlich.
Die Leute drängten von allen Seiten herzu. „O, der schöne junge Mann.“ – „Wie schade!“ – „O, Jammer!“ – „O, der arme Junge!“ – „Ist er tot?“ – „Lebt er?“
Sie klagten alle durcheinander, Weiber, Männer und Kinder, und einer erzählte es dem andern: das sei der deutsche Bildhauer, dem der Graf Bortenyi Auftrag gegeben habe, seinen Musiksaal und seine Bibliothek mit Bildwerken zu schmücken, wunderschön habe er alles gemacht und gewiß wäre der unbekannte junge Mensch bald ein berühmter Meister geworden – und nun?
Der blonde Maler kniete indessen neben der leblosen Gestalt nieder und sah ihr angstvoll ins Gesicht. Die Züge schienen sich zu bewegen. Ein ganz leises, zitterndes Seufzen, ein Zucken der Wimpern, dann ein kurzer Aufblick von zwei großen dunkeln Augen, verständnißlos, nebelumsponnen …
Auch das hundertstimmige Aufschreien: „Er lebt! Er lebt!“ mußte dem jungen Bildhauer nicht zum Bewußtsein kommen, seine Augen fielen von neuem zu, und aus der Wunde am Arm tröpfelte es roth und langsam auf den Boden und bildete dort eine kleine dunkle Lache.
„Ich vermag noch nichts zu sagen!“ erwiderte der Arzt, ein älterer Mann, auf die zahllosen aufgeregten Fragen. „Aeußerlich scheint er mir unverletzt, denn die Wunde am Arm ist nicht bedenkich – aber ich kann hier nicht feststellen, ob nicht innerliche Verletzungen stattgefunden haben, und welcher Art sie sind. Weiß jemand zufällig die Wohnung des jungen Mannes, oder soll ich ihn ins Hospital schicken?“
„Nein! Nicht ins Hospital!“ Der blonde Maler hob sich von den Knieen empor. „Via del Babuino! Dort wohnt er und hat eine sehr brave Wirthin, die gut für ihn sorgen wird, und wir alle, seine Freunde, werden helfen – er soll die beste Pflege haben!“
„Gut also!“ Der Arzt wandte sich einem andern Hilflosen zu.
„Ich leite den Transport!“ sagte der Maler und winkte ein paar Leute heran, die müßig herumstanden. „Dann muß ich aber zu Andree,“ fuhr er halblaut mit sich selbst sprechend fort. „Herrgott, was wird Andree sagen? Wie werde ich’s dem nur beibringen? – Hier faßt an – so! Langsam, vorsichtig! Ich komme mit Euch!“
Die Leute mit der Tragbahre schreiten langsam davon, zu Anfang noch von zehn, zwölf Neugierigen begleitet, die sehen möchten, wie es dem schönen jungen Menschen weiter ergeht, ob er noch einmal erwacht, ob das Bewußtsein ihm zurückkehrt. Da sie während einer ganzen Weile nichts anderes an ihm bemerken können, als daß er die Augen nach wie vor geschlossen hält und unbeweglich in derselben Lage bleibt, erlahmt ihre rasch aufgeflammte Theilnahme ebenso rasch, sie bleiben zurück und lassen den blonden Maler allein neben der Bahre.
Dessen offenes, ein wenig unbedeutendes Gesicht trägt einen sehr ernsten. nachdenklichen Ausdruck. Seitdem er in Rom ist – und das ist schon länger als zwei Jahre – kennt er niemand von der ganzen deutschen Künstlerkolonie, der ihm soviel Hochachtung als Mensch und soviel Bewunderung als Künstler abzugewinnen weiß als der Maler Andree. Alle, die ihn kennen, achten und loben ihn. Andree aber hat nur einen einzigen wahren Freund unter all den guten Bekannten, das ist Werner Troost, der hier durch die Straßen getragen wird, jedenfalls schwer, vielleicht tödlich verletzt! –
Die Freundschaft der beiden war sprichwörtlich geworden. Den jungen schwärmerischen Bildhauer verwöhnten sie alle, keiner jedoch trieb diesen stillen Kultus mehr mit ihm als Andree. Dieser äußerte sich zwar nie darüber, aber man hätte blind und taub sein müssen, um es nicht zu merken, wie er, der soviel ältere berühmte Maler, nicht ohne Werner Troost leben konnte, wie ihm der Bildhauer einfach unentbehrlich war. Kein Tag verging, ohne daß er Troost so oder so zu treffen wußte, sei es in der Casa Bortenyi, sei es in Werners Atelier in der Via del Babuino oder in dem Restaurant, das die deutschen Künstler sich zu ihren Zusammenkünften auserwählt hatten. Einer von ihnen, ein ausgelassener Oesterreicher, hatte den Witz gemacht, eine niedliche Tafel zu malen, auf deren einer Seite mit großen Goldbuchstaben zu lesen stand: „Ich bin bei Troost“, während die andere Seite die Worte wies: „Ich bin nicht bei Troost!“ Dies Täfelchen [600] wurde Andree eines Abends feierlich mit einer Ansprache überreicht und ihm gerathen, es jederzeit, so oder so, an seiner Atelierthür zu befestigen, damit man wisse, ob er „normal oder nicht normal“ sei. Er hatte den Scherz mit seinem herzlichen Lachen aufgenommen. Alle Neckereien und geflügelten Worte hatten übrigens nicht den geringsten Einfluß auf ihn, er lachte und fuhr fort, den jungen Bildhauer aufzusuchen, ihn in seinen Arbeiten nach Kräften zu fördern und vor schlechtem Umgang zu bewahren, dem eine so feurige Natur wie die Werners leicht hätte zum Opfer fallen können, zumal sich ihm bei seiner Schönheit und Liebenswürdigkeit Thür und Thor überall aufthaten.
Mit Recht sah es daher Paul Hartwich – allgemein der „kleine Hartwich“ genannt, obgleich er Mittelgröße hatte – als eine schwere Aufgabe an, Andree auf das Unglück vorzubereiten, das sich heute in der Via Sardegna zugetragen hatte. Um diese Zeit pflegte Werners Freund in seinem Atelier zu arbeiten; Hartwich wollte nur den Kranken nach Hause schaffen, ihn seiner Wirthin auf die Seele binden und dann zu Andree eilen.
Bis zur Via del Babuino ist’s kein weiter Weg, und die Träger kamen mit ihrer Last ungehindert zum Ziel. Hier und da stand jemand still und fragte, ob das auch ein Opfer des Unglücks in der Via Sardegna sei; andere wußten noch von nichts und wünschten Auskunft zu haben, aber im ganzen ging alles ohne Zeitverlust von statten.
Signora Marchini, Werner Troosts Wirthin, mit dem Körperumfang und dem Doppelkinn einer echten alternden Römerin, verließ ihren Risotto, den sie gerade zubereiten wollte, und eilte mit Geschrei auf die Straße, als ihre kleine Dienerin ihr mit aufgeregter Wichtigkeit die Kunde überbrachte, der Signore Tedesco werde soeben tot dahergetragen. Als die Matrone aber von dem kleinen Hartwich vernahm, wie es stand und was man von ihr erwartete, da hörte sie auf zu schreien und traf mit Umsicht ihre Maßregeln. Sie ließ das Bett ihres Miethers in sein Atelier bringen, einen großen luftigen Raum, sie holte alle ihre Vorräthe an altem weichen Leinen hervor, schickte das kleine Dienstmädchen zum nächsten Arzt und zu einem zuverlässigen Krankenwärter, den sie kannte, und schwor, ihren Posten nicht früher zu verlassen, als bis die beiden bei ihr eingetroffen seien. Dann verhängte sie mit allen möglichen Stoffen die breiten Fenster, daß die blendende Sonne keinen Zutritt hatte, rückte sich einen Stuhl neben das Krankenlager und flüsterte: „Mio povero! Carissimo!“ denn auch sie liebte Werner Troost, wie alle ihn liebten!
Er hatte ein paarmal geseufzt, als sie ihn betteten, und mit der linken Hand abzuwehren versucht – jetzt lag er wieder leblos da, geisterhaft bleich inmitten des weißen Linnens.
Und Hartwich bat noch einmal Signora Marchini, den Armen gut zu hüten, denn er müsse nun fort, und sie fragte: „Zu Signore Andree? Heilige Jungfrau, was wird der sagen, wenn er es hört?“ –
Waldemar Andrees Atelier lag am Ende der Via Margutta – „ein beneidenswerthes Nest“ sagten die Künstler und mit vollem Recht, denn es war ein hoher, kühler, ausgedehnter Raum mit prachtvollem Oberlicht und einer einfachen gediegenen Ausstattung, die dem Geschmack des Besitzers alle Ehre machte. Andree war bekannt dafür, daß er mit unglaublicher Ausdauer und ebensoviel Glück allerlei Raritäten aufspürte und ankaufte, alte Bilder, Stickereien, Waffen, Gobelins – alles gut und echt.
Hartwich hatte seinen Gang in die Via Margutta im Sturmlauf begonnen, so stand er in kürzester Zeit vor Andrees Atelier. Er klopfte, alles still. Der Besucher ließ sich aber nicht irre machen und klopfte zum andern Mal. Andree mußte ja um diese Zeit zu Hause sein. Drinnen rührte sich nichts.
Jetzt fing Hartwich an, an der verschlossenen Thür zu rütteln, und bedachte sie sogar mit einem leichten Fußtritt.
Endlich ertönte eine tiefe Stimme von innen: „Ruhe, zum Teufel – ich komme schon!“
Die Thür wurde aufgerissen und ein auffallend hochgewachsener Mann, der einen grauen Malerkittel trug und einen nassen Pinsel in der Rechten hielt, sah unter ärgerlich zusammengezogenen Brauen auf den Eindringling herab, der ihm knapp bis an die Schulter reichte.
„Paolo Hartwich,“ sagte er strafend, „Ihr gehört doch wirklich zu der verruchten Menschengattung, der nichts auf Gottes Erdboden heilig ist, nicht einmal eine fruchtbare Malerstimmung. Warum in aller Welt sitzt Ihr um diese Stunde nicht in Eurer eigenen Klause und frevelt in Oel, anstatt hier andere Leute durch Euer Philistergesicht aus allen Himmeln zu reißen?“
Trotz des scherzenden Tons war Andree wirklich geärgert, das fühlte Hartwich heraus; um so schwerer fiel es ihm, sein Anliegen vorzubringen und eine passende Einleitung zu finden.
„Bitte, seid nicht böse …“ fing er an.
„Ich bin aber böse, zum Henker, warum soll ich lügen? Nun denn herein mit Euch, Ihr Störenfried!“
„Eine verbindliche Aufforderung!“ versuchte Hartwich zu scherzen, während er neben Andree ins Atelier trat.
Andree hatte indessen seinen Pinsel fortgelegt und kramte etwas verdrossen in einer Mappe herum. Endlich hob er ungeduldig den Kopf.
„Nun?“
Hartwich seufzte. „Lieber Freund, ich bin in einer ernsten Angelegenheit hergekommen!“
„Hm! Braucht Ihr Geld? Wieviel denn?“
„Diesmal nicht, danke, bin so noch in Eurer Schuld! Ich wollte, es wär’ bloß Geld, aber leider – ich komme eben aus der Via Sardegna!“
„Und?“
„Ja – es wird mir furchtbar schwer, so damit herauszuplatzen, doch am Ende – wie will ich es denn machen? Es hat ein Unglück gegeben, die Casa Bortenyi ist eingestürzt!“
Er wagte nicht aufzusehen, während er dies sagte; es blieb eine Zeitlang still in dem schönen freundlichen Atelier, nur draußen vor dem Fenster sang eine Amsel.
Hartwich hätte getrost aufblicken können – Andrees Züge waren unverändert, er war nicht einmal bleich geworden, nur seine dichten dunkeln Brauen waren noch näher aneinandergerückt, und das Sprechen schien ihm schwer zu werden. Erst nach einer Weile fragte er:
„Ist Werner tot?“
„Nein, der Arzt wußte nicht einmal, ob schwer verwundet; es konnte keine gründliche Untersuchung stattfinden. Er lebt, liegt aber ohne klares Bewußtsein da. Ich ließ ihn nach seiner Wohnung schaffen –“
„Warum nicht zu mir?“
„Erstens hätte ich zu Euch weiter gehabt und zweitens hättet Ihr ihm, bei aller Freundschaft, nicht die vortreffliche weibliche Pflege der braven Signora Marchini ersetzen können, die wie eine Mutter für ihn besorgt ist.“
Andree nickte ihm nur zu, was bedeuten sollte: Du hast recht gethan! Dabei riß er den Kittel herunter und suchte seine Sachen zum Ausgehen zusammen. Aus einem kleinen geschnitzten Schränkchen holte er eine handvoll Banknoten heraus und schob sie, ohne zu zählen, in seine Brieftasche, dann winkte er Hartwich, schloß anscheinend kaltblütig das Atelier ab und steckte den Schlüssel zu sich.
Draußen vor dem Hause kam ihnen eben eine Droschke in schläfrigem Trabe entgegen. Andree rief sie an und ein paar Worte von ihm belebten Kutscher und Pferde alsbald in merkwürdiger Weise, sodaß sie die Via del Babuino wie im Fluge erreichten.
Als sie an Troosts Wohnung ausgestiegen waren, merkte Hartwich, daß Andree gesonnen sei, allein hineinzugehen und ihn draußen zu lassen. Das befremdete ihn und er äußerte, er sei gespannt zu hören, was der Arzt inzwischen angeordnet habe und wie es stehe. Darauf nickte Andree nur, meinte: „Ich lasse Euch Bescheid heraus sagen – in spätestens fünf Minuten sollt Ihr ihn haben!“ und ging ins Haus, seinem Gefährten einfach die Thür verschließend. Der Andere hätte dies übel aufnehmen können, allein er ahnte, wie schwer dem Freund Werners die Unglücksnachricht auf der Seele lag, und so geduldete er sich.
Ja, Waldemar Andree hatte ein schweres Herz – drinnen in dem dämmerigen, mit Ziegelsteinen gepflasterten Flur lehnte er sich einen Augenblick gegen den Thürpfosten und drückte die Augen zu. Da nebenan, nur durch eine dünne Wand von ihm getrennt, sollte Werner Troost schwerkrank, vielleicht gar sterbend,
[601][602] liegen. Sein Liebstes auf der Welt – er machte sich’s klar in dieser trostlosen Minute – sein Liebstes auf der Welt wollte ihm das Schicksal nehmen! Es war ja nicht möglich, es durfte nicht sein!“
Die gegenüberliegende Thür öflnete sich, und heraus schoß das kleine Bedienungsmädchen der Signora Marchini, ein flinkes braunes Ding mit unruhigen Augen.
„Mein Gott, der Signore! Ist das aber gut. Er hat nach dem Signore gefragt – ja – und ganz bei Besinnung ist er, und der Doktor hat ihn genau untersucht, und ich habe Eis holen müssen und jetzt laufe ich und bestelle noch mehr. Und der Wärter sitzt bei ihm, weil die Signora auch krank geworden ist vor Schreck, und aus der Apotheke habe ich etwas holen müssen, das hat ihm der Arzt eingegeben, damit er keine Schmerzen bekomme, denn Signore Troost hat gesagt, Schmerzen dürfe er für die nächsten Stunden nicht haben. Und in der Apotheke haben sie mir gesagt, das sei ein sehr scharfes Mittel und der Signore müsse sehr krank sein.“
Andree hört nicht weiter.
Er schiebt stumm das Kind beiseite, um vorbeizukommen, dann geht er leise an die hellgestrichene Thür. Die Hand zittert ihm. Er tritt ein.
In dem ziemlich geräumigen Atelier hat man alles, was umherstand, hart an die Wände gerückt, um möglichst viel Raum zu gewinnen. Gestalten und Köpfe von Gips und Marmor stehen aufgereiht nebeneinander. Hohe Gestelle, ein menschliches Gerippe, das einen Leuchter sammt Kerze in der Hand trägt, Nachbildungen menschlicher Arme und Beine aus Gips in verschiedenen Größen, Modellierhölzer, Zahneisen, hängende Bretter mit winzigen Köpfchen und kleinen Statuetten aus rothem Thon – dies bildet die Umgebung für den Kranken, dessen breites Bett man in die Mitte des Raumes gebracht hat, sodaß er das große, mit leichten Stoffen verhängte Fenster vor Augen hat.
Neben dem Bett sitzt auf einem Strohsessel ein hagerer, muskulöser, still vor sich hinblickender Mann, zu seinen Füßen einen großen Eimer voll Eis, über dessen Rand feuchte Tücher hängen.
In den weißen Decken und Kissen liegt Werner Troost, ein Bild von Kraft und Jugendschönheit; alles leuchtet und lebt an ihm, vor allem die feuchtglänzenden dunkeln Augen, die ihm schon so viele Herzen gewonnen haben, die Augen, die nichts von Uebersättigung wissen, sondern jung und freudig erwartungsvoll in die Welt hineinsehen, als wollten sie fragen: was wird es mir bringen, das Leben?
Wie Andree ihn so sieht, blühend und rosig und schön, will er aufathmen aus tiefster Brust, allein es liegt ihm wie ein Alp auf dem Herzen, und er kann es nicht!
„Nun, gottlob, da wärst Du ja!“
Troosts Stimme klingt ein wenig matter als sonst, oder kommt es seinem Freunde nur so vor?
„Wart’, ich will meine linke Hand heraussuchen und Dir reichen, die rechte ist verwundet – nur eine ganz leichte Schramme! Sie haben mich in Binden gewickelt wie eine ägyptische Mumie und ganz in Eis gepackt, daß ich mich kaum rühren kann. Setz’ Dich da auf den Stuhl zu mir! Der gute Freund dort, der mich pflegt, geht derweilen zu Signora Marchini hinüber, sie sind alle schon verständigt. Ich hab’s dem Arzt gesagt, ich müsse Dich sprechen – – so bloß für alle Fälle, weißt Du!“
Er lachte leichthin, aber es ist sein altes Lachen nicht und es ist auch nicht sein früheres Gesicht. Etwas ist fremd darin, irgend ein Zug, der sonst nicht da war; Andree hat keine Muße, darüber nachzusinnen, was es sein kann, doch er fühlt die Veränderung ganz deutlich. Er hat die feine, biegsame Linke seines Freundes behutsam in seine beiden nervigen Hände genommen und sitzt stumm am Bett, bis der Wärter, der noch dies und jenes ordnet, zur Thür hinaus ist. Nun beugt er sich tief über den Kranken, sieht ihm liebevoll ins Gesicht und fragt mit gedämpfter Stimme:
„Um Gotteswillen, Werner, wie hat solch ein Unglück geschehen können?“
„Du meinst, daß die Casa Bortenyi zusammengestürzt ist? Ja, mein Alter, sie haben es ja alle gesagt, die etwas davon verstanden, das Ding werde viel zu rasch und leicht aufgebaut und müsse uns eines schönen Tages über dem Kopf zusammenkrachen. Wer jedoch ein Bruder Leichtsinn und ein Glückskind dazu ist, der glaubt solchen Unglückspropheten nicht – nun, und ich bin beides gewesen!“
„Wie kam es denn – ich meine, wie meldete sich’s an? Aber darfst Du auch so viel sprechen?“
„Soviel ich will – zwei, drei Stunden in einem Zug, solange das Mittel vorhält! Die Brust ist übrigens ganz frei, am Oberkörper kann mir jedenfalls nichts geschehen sein. Freilich, alles andere ist wie tot, als gehörte es nicht mir, ich habe auch nicht das geringste Gefühl darin. Das mag alles von dem Gebräu kommen, das mir Weber – unser deutscher Arzt, den Du ja auch kennst – eingegeben hat. Doch es hat nichts zu bedeuten. Ich möchte nur wissen, ob von meinen Arbeiten in der Casa Bortenyi irgend etwas gerettet ist; mein Kinderfries – er schritt so unglaublich rasch vorwärts und ist mir auch geglückt, ich weiß es –“
„Rege Dich nicht auf! Ich gehe noch heute hin, um mich zu erkundigen, und lasse Dir Bescheid sagen oder bringe ihn Dir selbst!“
„Vielen Dank! Gottlob, die Statuen für die Bibliothek habe ich hier bei mir, sie sind ein Stück gediehen, seit Du sie zuletzt gesehen hast. O, ich war so froh, als Graf Bortenyi mir durch Deine Vermittlung die Bildhauerarbeit in seinem Palazzo übertrug, endlich einmal ein Auftrag, bei dem etwas zu gewinnen war, Anerkennung und Geld, vielleicht ein Name! Und nun baut dieser Mailänder Pfuscher ein solches Papierhaus hin!“
„Wie ging es denn zu, daß – aber nein, denke jetzt nicht mehr daran!“
„Keine Sorge! Ich bin ganz ruhig, will Dir alles erzählen! Also ich stehe oben auf meiner handfesten Leiter und arbeite, bin so im Eifer, daß ich mir nicht ’mal Zeit nehme, den Sammetrock auszuziehen, mag er verderben, denk’ ich, Sammetröcke findest du mehr in der Welt, aber sobald nicht wieder diese günstige Stimmung. Und ich putze liebevoll herum an so einem pausbackigen Kindchen, das mit vollem Athem in seine Trompete stößt, während vor meinen Fenstern die gewaltige Winde auf und niedergeht, welche die eisernen Träger, Säulen und Stützen in die Höhe befördert. Mit einem Male hör’ ich dicht neben mir in der Mauer ein eigenthümlich rieselndes Geräusch wie von rinnendem Sand, wie ich aber genauer zuhorche, ist’s auch schon wieder still. Ich also wieder an meinen blasenden keinen Schlingel heran … da kommt es wieder, diesmal jedoch mit einem dumpfen, scharrenden Ton, dem ein lauter Knall folgt, etwa als wenn eine Kanone abgeschossen wird. Entsetzt dreh’ ich mich herum und werde gewahr, daß die gegenüberliegende Mauer schräg durchgespalten ist; und nun kommt mir zum Bewußtsein, was geschieht, und ich will von der Leiter herunter, so schnell als möglich! Allein das Zerstörungswerk ist noch rascher als ich, es ist mir, als rücke die ganze Mauer mir entgegen. Ich werfe mein Werkzeug fort und hebe meine Arme hoch querüber, zum Schutz für das Gesicht – alles ganz mechanisch natürlich – dann schlägt die Leiter um, und die Masse stürzt über mich hin. Den einen Gedanken, den ich noch hatte, den letzten, wie ich glaubte, denn ich dachte natürlich, es sei alles für immer zu Ende, den will ich Dir später sagen. – Die Leute, die mich fanden, haben meiner Wirthin gesagt, die schwere Arbeitsleiter und ein paar herabgestürzte Dachbalken hätten hohl über mir gelegen und mich auf diese Weise geschützt, ich wäre sonst unfehlbar von dem massenhaft nachstürzenden Trümmerwerk erschlagen worden!“
Andree hatte mit erregten Zügen zugehört, er sah das Ganze vor sich. Er versuchte zu reden, aber seine Stimme gehorchte ihm nicht; wie ärgerlich über seine Weichherzigkeit schüttelte er den Kopf und wandte sich ab.
Der Bildhauer verstand ihn und tastete mit seiner Linken nach Andrees Hand. „Mein guter Alter!“ murmelte er gerührt. Nach einer kleinen Pause raffte er sich auf.
„Du siehst, da bin ich noch, im Jenseits wissen sie entschieden noch nichts mit einem solchen Taugenichts anzufangen – die Erde hat mich wieder! Allein da man nie wissen kann, wie lange sie einen noch behält, so möcht’ ich Dir Einiges sagen, Dich um Einiges bitten. Ich weiß ja, Du gehörst zu den wenigen Menschen, auf die man sich fest verlassen kann!“
Alle Rechte vorbehalten.
Gut verwendete Millionen.
In keinem Zeitalter hat es so viele und so vielfache Millionäre gegeben wie in dem unsrigen. Sie sind eine neuzeitliche Gesellschaftserscheinung geworden und sowohl durch ihre Art wie durch ihre verhältnißmäßige Menge wohl von den durch Erbschaft Reichen der früheren Zeit zu unterscheiden. Im allgemeinen sind sie als rührige praktisch strebende Menschen durch die neuen Hilfsmittel der Industrie, durch die vielfältigen Erfindungen, den weiter erschlossenen und mächtig geförderten Weltverkehr und durch die damit wachsenden Bedürfnisse des öffentlichen wie des privaten Lebens schnell – oftmals aus Niedrigkeit und Armuth – zu außerordentlichem Kapitalreichthum gelangt.
Ist nun damit zugleich der Gegensatz von arm und reich, der allerdings immer bestanden hat und immer bestehen wird, ein größerer und härterer geworden, so ist doch auch die Zahl jener Millionäre gewachsen, welche diesem Gegensatz seine Bitterkeit zu nehmen suchten, welche für ihr äußeres Glück sich in hervorragenden Werken der Wohlthätigkeit und Gemeinnützigkeit dankbar erwiesen und sich damit Ehrendenkmäler gesetzt haben, die zugleich stolze Marksteine einer in der Richtung auf das Gute fortschreitenden Kultur bedeuten.
Viel gefeiert wurden ihrer Zeit die Stiftungen des 1869 in London als Bankier gestorbenen Amerikaners Georg Peabody. Er schenkte der Stadt Baltimore und dem Staate Maryland nach und nach 21/2 Millionen Mark zur Gründung und Unterhaltung einer Volksbildungsanstalt und erbaute für dieselbe ein prächtiges Heim. Er stiftete ferner für öffentliche Schulen in den südlichen Staaten Nordamerikas mit ihrer zahlreichen, früher von der Bildung gänzlich ferngehaltenen Negerbevölkerung 14 Millionen Mark und 10 weitere für Arbeiterwohnungen in London, der Großstadt auch hinsichtlich des proletarischen Elends. Es seien diese Millionenschenkungen deshalb wieder hervorgehoben, weil sie ein Beispiel sind für die Eigenart, welche diese Großthaten des Gemeinsinns von seiten der heutigen Industriemillionäre fast durchweg tragen. Es sind keine Almosen, keine Geldvertheilungen an die „Klasse der Enterbten“; sondern es sind Stiftungen, welche die sittliche und wirthschaftliche Hebung des Volkes durch Förderung seiner Bildung zu erreichen streben. Peabody war aus der Armuth heraus zu seinem riesigen Vermögen gelangt; er betrachtete sein äußeres Glück wie eine Schuld, die er an die Armen abzutragen habe. Der letzte Zweck seines Lebens war, als ein Menschenfreund dem Stand der Besitzlosen und Arbeitsamen dauernde Wohlthaten zu erweisen, um „Gott vor ihnen zu rechtfertigen.“
Peabody steht nicht allein da mit solcher Gesinnung, und er ist weder der erste noch der letzte, der die Welt mit seiner Freigebigkeit für Werke der allgemeinen Wohlfahrt in Erstaunen setzte. Der Amerikaner, welcher vermöge der eigenthümlichen Kulturentwicklung der neuen Welt leichter als der Angehörige irgend eines anderen Volkes in den Besitz von Millionen gelangt, zeigt fast immer einen Wohlthätigkeitssinn, der sich mit vollbewußter Absicht auf Gründungen von bleibender Nützlichkeit und auf die geistige Förderung der vermögenslosen Klassen seines Vaterlandes richtet.
Eine hervorragende Stelle unter diesen Männern, wenigstens durch die Größe seiner Schenkungen, nimmt Stephan Girard in Philadelphia ein, der sich im Anfang dieses Jahrhunderts durch kühne Handelsunternehmungen in der Kriegszeit von 1811 und 1812 ein solches Vermögen erwarb, daß er in der großen Republik der reichste Mann seiner Zeit wurde. Er war zu Périgueux in Frankreich geboren und von Jugend auf von dem Streben beseelt, sich Reichthümer zu erwerben. Als alter Mann gab er geradezu all sein Erworbenes für die Bedürftigen her und gründete mit 8 Millionen das Waisenhaus in Philadelphia, in dem er sich ein bescheidenes Gemach vorbehielt, um dort in fast dürftiger Einfachheit seine letzten Tage zu verbringen. Er starb, ein Einundachtzigjähriger, im Jahre 1831.
In neuerer Zeit haben sich unter den amerikanischen Millionären besonders Astor, Smith und Vanderbilt durch die Großartigkeit ihrer Gaben ausgezeichnet.
John Astor besaß durch seine Landspekulationen soviel an Vermögen, daß es in Zahlen schwer anzugeben war. Man schätzte seine jährlichen Einkünfte auf 12 Millionen. Er gab mit vollen Händen und mit einer förmlichen Verachtung des Geldes, wenn er einzelnen dazu verhelfen konnte und wollte, Unternehmungen auszuführen und es damit gleichfalls zu Reichthum zu bringen. Als einmal ein Freund, der allerdings auch einer der glücklichsten Landspekulanten in New-York war, bei Astor anfragte, ob ihm dieser 250 Millionen Dollars, also über tausend Millionen Mark, leihen könne, da antwortete Astor damit, daß er am nächsten Tage die Bankanweisungen über die geforderte Summe vor den Bittenden hinlegte. Dieser große Schuldner Astors war Peter Smith, ein Millionär, der in wenigen Jahren das Vorgestreckte bar zurückzahlen konnte. Alle beide klagten sich dabei die Noth, die sie mit ihrem Reichthum hatten.
„Der meine,“ sagte Astor, „bereitet mir gar keine Freude. Andere Leute haben nur Behagen und Genuß davon. Ich selbst kann nicht mehr als das brauchen, was mir zum Leben nöthig ist, und das ist wenig. Mein Geld macht mir Schererei und haftet an mir wie mit Krallen, die mich Tag und Nacht keine Ruhe finden lassen.“
Und Peter Smith, erkenntlicher für sein äußeres Glück im Hinblick auf den Segen, den er damit bereiten konnte, äußerte zu dem Freunde: „Seit Jahren bin ich ein Landkäufer. Ich meine, jeder Mensch habe ein Recht auf ein Stück Erde, um eine Farm betreiben zu können. Mehr braucht er nicht, um sich weiter zu bringen. Da kann ich wenigstens mit meinem Gelde Gutes stiften.“
Dem entsprechend schenkte Smith Farmen in Unmasse. Geschah das nicht unmittelbar aus seinen erworbenen Ländereien, so gewährte er Geldbeträge für Landankauf. Zunächst erhielt jede Witwe und jede alte Jungfer, die es im Staate New-York gab, 200 Mark für diesen Zweck. Nach dem Bürgerkriege überwies er dreitausend Farmen im Gebietsumfang von je 15 bis 75 Acres (1 Acre = 401/2 Ar) an ebensoviele durch den Krieg heimgesuchte oder ihres Ernährers beraubte Familien. Für gewöhnlich vertheilte er außerdem noch hunderttausend Dollars im Jahre an milde Stiftungen. 1874 starb er und hatte in der angegebenen Weise den größten Theil seiner Millionen wieder hergegeben, zweckbewußt, um die Ansiedlungen in seinem Vaterlande zu fördern, der Kultur neue Wege zu bahnen und vielen Armen einen festen Grund für ihr Fortkommen zu bieten.
Es scheint diesen Millionären ein inneres Bedürfniß zu sein, zur ausgleichenden Gerechtigkeit einen Theil von ihrem irdischen Ueberfluß zu opfern, um zur Verringerung des sozialen Elends nach ihren Kräften beizutragen. Auch der große Eisenbahnkönig Cornelius Vanderbilt, der als Stifter eines in seinem Vermögen gar nicht abzuschätzenden Millionärgeschlechts vor vierzehn Jahren starb, folgte diesem Zuge des Guten und Schönen im Menschen. Er muß als einer der verdienstvollsten Vorkämpfer der Civilisation in Nordamerika geehrt werden, und als er sich wirklich den reichsten Mann der Welt nennen durfte, sagte er sich wie zum Trost: „Habe ich in jedem Jahre seit meiner Geburt durchschnittlich eine Million Dollars verdient, so befriedigt es mich noch mehr, daß ich jedes Jahr dreimal so viel meine Mitbürger verdienen lassen konnte.“ Er hinterließ seinem ältesten Sohne 400 Millionen Mark und vermachte, ungerechnet alle anderen Stiftungen, noch 60 Millionen für verschiedene gemeinnützige Zwecke. Als nicht lange danach sein Sohn ebenfalls starb, hinterließ dieser die fabelhafte Summe von 400 Millionen Mark für wohlthätige Stiftungen und eine gleiche Summe seinen beiden Söhnen. New-York betrauerte diesen großartigen Menschenfreund in gebührender Weise. Niemals hatte in der That ein Privatmann solch ein Vermächtniß gemacht; die Phantasie verwirrte sich fast vor dem Strom von Gold, der hier zur Linderung und Beseitigung der Noth sich ergoß.
Wesentlich amerikanisch kann man die Größe dieser Werke der Menschenliebe von seiten industrieller Geldfürsten nennen. Allein England hat sich in solchen Leistungen nicht viel weniger ruhmwürdig gemacht, ja es ist hierin Amerika vorangegangen, wie denn wohl in dem wohlthätigen Amerikanerthum ein englischer Charakterzug sich äußert.
Jedediah Strutt erfand im vorigen Jahrhundert den Webstuhl für gerippte Strümpfe und legte damit den Grund zu einem großen Vermögen. Wie er, so suchten auch seine immer wohlhabender werdenden Nachkommen die sittliche und gesellschaftliche Stellung der Arbeiter in ihrer Fabrik zu verbessern und sich für edle Zwecke jederzeit freigebig zu zeigen. Joseph Strutt schenkte [604] seiner Vaterstadt Derby einen herrlichen Park mit den Worten: „Da das Glück mir mein Leben lang günstig gewesen, so wäre es undankbar von mir, wollte ich nicht einen Theil meines Vermögens dazu verwenden, das Wohlbefinden meiner Mitbürger zu fördern, durch deren Fleiß ich im Erwerben so sehr unterstützt worden bin.“
Robert Barclay, der 1830 starb, war der Gründer eines großen Hauses in London, das hauptsächlich mit Amerika Handel trieb. Als er sich vom Geschäft zurückzog, geschah es nur, um durch erneute Thätigkeit sich seinen Nebenmenschen nützlich zu machen. Er fühlte sich verpflichtet, mit seinen reichen Mitteln der Gesellschaft ein gutes Beispiel zu geben. In der Nähe seines Wohnsitzes gründete er ein Arbeitshaus und unterhielt es mehrere Jahre lang mit großen Kosten, bis es ihm endlich gelang, auf diese Weise ordentlichen, aber armen Familien der Umgegend eine unabhängigere und sorgenfreiere Existenz zu schaffen. Solche zielbewußte Wohlthätigkeit ist eine Großthat der Menschenliebe, die dauernden Segen bewirkt und höher zu werthen ist als ein allgemeines Almosen, welches flüchtige und oft zweifelhafte Bedeutung hat. Barclay war es auch, der, nachdem ihm eine Erbschaft in Jamaica zugefallen war, sofort allen Sklaven auf seinen dortigen Gütern die Freiheit schenkte, obwohl ihn das um etwa 10 000 Pfund oder 200 000 Mark jährlicher Einkünfte brachte. Er ließ die Neger außerdem auf eigenem Schiff nach einem der freien Staaten Nordamerikas schaffen, wo sie eine besondere Gemeinde bilden sollten. In der That gelang es seiner Fürsorge, die Niederlassung der Neger zu gedeihlicher Entwicklung zu bringen. Bei der Vertheilung seines großen Vermögens machte er sich selbst zum Testamentsvollstrecker und gewährte seinen Verwandten schon bei seinen Lebzeiten großartige Unterstützungen, statt sie ihnen erst nach seinem Tode durch Erbschaft zukommen zu lassen. So sorgte er durch Rath und That für ihr Fortkommen und begründete dadurch nicht nur einige der größten und blühendsten Geschäfte Londons, sondern erlebte noch persönlich die gesegnete Wirkung seiner Wohlthätigkeit.
William Baß war der Ausfahrer einer Brauerei zu Burton. Mit seinem Ersparten fing er dann selber eine Brauerei an, die sich zu einer der ersten und berühmtesten Englands aufschwang und unter seinem Sohne Michael Thomas einen ungeheuren Absatz auch im Ausland erlangte; heute versendet sie etwa hundert Millionen Flaschen. Als Michael Thomas Baß achtzig Jahre alt geworden war, übergab er – im Jahre 1880 – sein Riesengeschäft einer Gesellschaft und widmete den kurzen Rest seines Lebens dem Wohlthun in großem Stile. Er stattete seine Geburtsstadt mit öffentlichen Anlagen und gemeinnützigen Anstalten aus, die eines Peabody würdig waren: mit einem Museum, einer Bibliothek, mit öffentlichen Bädern und dergleichen mehr. Seinem Beispiel folgte ein anderer reicher Brauer, Edward Guinneß in Dublin, der nicht weniger als 250 000 Pfund Sterling (5 Millionen Mark) für Errichtung von Arbeiterwohnungen in Dublin und London stiftete.
Wir haben bisher ausschließlich verweilt bei jenen Bethätigungen einer großartigen Opferwilligkeit für das allgemeine Wohl, welche in Amerika und England zutage getreten sind. Es geschah das nicht deshalb, weil andere Länder, Deutschland besonders, arm sind an Männern, welche die geistige und materielle Hebung der weniger oder gar nicht mit Glücksgütern Gesegneten durch Schenkungen und Vermächtnisse sich angelegen sein ließen. Welche Summen sind nicht in Belgien, in Frankreich, in Oesterreich und Deutschland von einzelnen aufgewendet worden, um ihren Arbeitern ein sorgenfreies Dasein zu verschaffen als gerechten Lohn für deren Mithilfe an ihren Unternehmungen; wie ist nicht in der Schweiz die Stadt Genf überreich mit Millionen zu öffentlichen Zwecken bedacht worden: erst kürzlich hat ihr der in Kairo verstorbene Professor Gustav Revillod sein Museum in der Nähe von Genf vermacht, das einen Werth von vier Millionen Franken darstellt, ferner sein Landgut im Werth von 600 000 Franken und eine Million in Werthpapieren. Allein bei dem weitaus größeren Reichthum Amerikas und Englands vermag sich naturgemäß auch die Wohlthätigkeit dort in größeren Bahnen zu bewegen als in anderen Staaten, und die Beispiele, die man von dorther nehmen kann und durch deren Anführung wir gern eine gesteigerte Nachahmung hervorrufen möchten – sie sind schlagender und boten sich so für unseren Zweck in erster Linie dar.
Zum Schlusse nun seien einige von jenen Stiftungen und Veranstaltungen erwähnt, in welchen deutsche Menschenfreundlichkeit nicht weniger sich ein hervorragendes Denkmal gesetzt hat; wir können sie nicht alle erwähnen, nur da und dort einen Fall herausgreifen.
In Kippenheim bei Lahr in Baden steht das Denkmal eines Mannes, das ihm zum Dank für seine große Wohlthätigkeit seine Landsleute errichtet haben; es gilt dem Gedächtniß des Schneidermeisters Georg Stulz, der in London sein Glück machte und 1832 in Hyères bei Toulon starb. Er hatte in seiner kleinen Geburtsstadt ein Hospital und eine Kirche bauen lassen, dem polytechnischen Institut in Karlsruhe, dem Schullehrerseminar und anderen Stiftungen daselbst, ferner dem Kloster Lichtenthal bei Baden-Baden Hunderttausende gegeben. Um dieser fortgesetzten Ehrenthaten willen verlieh ihm der Großherzog von Baden einen altadeligen Stammsitz im Lande, nach dem er sich Ritter von Ortenberg nennen durfte.
Würdig neben die Gründungen von Stulz stellen sich die großartigen Krankenhausstiftungen des Bankiers Salomon Heine und neuerdings des Kaufmanns van Danner in Hamburg, die Leipziger Stiftungen des Rentiers Grassi im Betrag von über zwei Millionen und die des Buchhändlers Tauchnitz im Betrag von vier Millionen.
In Köln bewirkte 1855 der reichgewordene Lederhändler Johann Heinrich Richartz aus eigenen Mitteln den Aufbau eines Museums für seine Vaterstadt und bot auch 100 000 Thaler für den Bau eines neuen Theaters an; eine gleiche Summe vermachte er zur Errichtung einer Irrenanstalt, außerdem bedeutende Geldstiftungen für die Musikschule und den Ankauf von Gemälden für die städtische Sammlung. „Köln hat schon große Männer zu seinen Mitbürgern gezählt,“ sagte einmal der Oberbürgermeister zu den Stadtverordneten, „einen Richartz hatte es bisher noch nicht.“
Der Berliner Maschinenbauer Borsig hinterließ dreißig Millionen Thaler; bei Lebzeiten war er der Vater seiner Arbeiter, die nach Tausenden zählten. Nicht weniger hervorragend sind die nach Millionen zählenden Stiftungen, welche Alfred Krupp in Essen und nach dessen Tod sein Sohn und Nachfolger zur Errichtung von gesunden Arbeiterwohnungen und von öffentlichen Anlagen zum Besten ihrer Angestellten aufgewendet haben. Ein berühmter Vorgänger in dieser Beziehung ist der große Fabrikant Dollfus in Mülhausen im Elsaß; er hat tausend von einem Garten umgebene Häuschen – jedes für eine Arbeiterfamilie – gebaut und die Sache so eingerichtet, daß alle schon längst durch bloßes Miethebezahlen zum Eigenthum der Arbeiter geworden sind. Hier sei auch noch der allgemeinen Uhrmacherschule in Glashütte im sächsischen Erzgebirge gedacht, welche Adolf Lange begründete und womit er, wie durch die ganze Einrichtung seiner groß gewordenen Uhrenindustrie, für diesen einst fast gänzlich verarmten Landbezirk zum größten Segen wurde. Es ist dies in der „Gartenlaube“ schon 1879 von Karl Bruhns des Näheren geschildert worden.
Endlich hat der Schluß des vorigen Jahres noch die Nachricht von einem großherzigen Vermächtniß gebracht, das der verstorbene Oekonomierat Gustav Dippe in seinem Testament der Stadt Quedlinburg bestimmt hat. Neben verschiedenen anderen Legaten zu gemeinnützigen Zwecken setzte er die Summe von 845 000 Mark zu einer Unterstützungskasse aus, durch welche treue Beamte, Arbeiter und Arbeiterinnen im Alter oder nach Bedürfniß auch früher Hilfe erhalten sollen. – –
So weitgehend und so mannigfach nun auch einzelne eingetreten sind, um Quellen der sozialen Noth zu verstopfen – dieser letzteren ganz ein Ende zu bereiten, wird leider nicht gelingen. Wir können die Nacht erhellen, allein wir können sie nicht in Tag verwandeln. Doch schon das wiegt unendlich viel, daß sich an jenen Thaten der Opferwilligkeit Unglück und Leid von Tausenden aufrichtet, daß an ihnen der Glaube erstarkt, noch sei das Gute eine Macht im Menschen, noch lasse viele Herzen der Reichthum nicht hart werden. Diejenigen aber, welche im Ueberfluß über jene Mittel verfügen, mit denen so manche Noth gelindert werden kann, mögen im Anblick der Dürftigkeit und der sozialen Bedrängniß um sie her, angesichts des Dranges nach Bildung, welcher in vielen lebt und keine Befriedigung findet, ihre Hände weit aufthun. Wohl ist jede, auch die kleinste Gabe von Werth, welche Menschenliebe der Armuth reicht: wer selbst nicht viel besitzt und doch einspringt, wo er kann, hat sittlich betrachtet nicht weniger gethan als jene Millionäre mit ihren ungeheuren Schenkungen. Allein große Noth erfordert auch große Hilfe, erfordert „gut verwendete Millionen“. Schmidt-Weißenfels.
Alle Rechte vorbehalten.
Das Los des Schönen.
Die Dämmerstunde ist gekommen. Feierabend gebieten das Glöckchen und die eintretende Dunkelheit. Allmählich hüllt sich der ehrwürdige Hausrath, unter dem kein Stück ist, das nicht von einer Familienerinnerung umrankt würde, in graue Schleier. Nur zuweilen schimmert noch einmal ein Bronzebeschlag mit seiner verschobenen Rokokomuschel auf. Kein Laut ist zu vernehmen als das einförmige Ticken der alten Uhr, die mir die Zeit ebenso gelassen zumißt wie einst meinen Urgroßeltern.
Nun steigt der Mond gemachsam über den Dächern empor. Er lugt zwischen den Fensterbehängen durch; ein blauer Strahl fällt bis in die Tiefe des Zimmers und haftet dort, als deute ein lichter Geisterfinger auf den kleinen Krimskrams, der im verschnörkelten Glasschränkchen aufbewahrt wird.
Ueber abgeblaßten Nadelkissen, deren aufgesticktes „Pensez à moi!“ vergeblich an längst Vergessenes mahnt, über Bonbonnièren mit schnäbelnden Täubchen breitet sich ein Fächer aus von der zierlichen Form, wie sie die Damen des achtzehnten Jahrhunderts liebten. Aber kein gepudertes Schäferpaar, auf Seide gemalt, schmückt ihn. Die feinen braunen Holzstäbchen überzieht schlichtes grünes Papier, und vergilbte Schriftzüge bedecken dasselbe. Der Fächer ist eine Art Stammbuch aus der guten alten Zeit.
Und wie der Mondstrahl ihn erhellt, ist es, als würden die verblichenen Buchstaben wieder frisch und lebendig. Ich vermag die Worte zu lesen. Ach, nun verstehe ich den alten Schäker; er zeigt mir das Lied, das ihn feiert wie kein anderes unter den unzähligen, die auf ihn gedichtet worden sind: „Guter Mond, du gehst so stille.“
Aber nein! Die Strophe, auf welcher der Geisterfinger am leuchtendsten ruht, ist mir unbekannt.
„Schaust in meiner Lida Kammer,
Wo ihr Liebe, Furcht und Jammer
Am gepreßten Herzen nagt.
Send’ ihr mit der Morgenröthe,
Vor dem frommen Frühgebete,
Ein erquickend Traumgesicht.
Sag’ ihr, daß ihr Heinrich lebet
Und vergißt sein Mädchen nicht.“
Jetzt weiß ich, was er mir sagen will, der Allerweltsliebesbote. Alte Erzählungen wachen in meiner Erinnerung auf, längst zur Ruhe Eingegangene erheben sich verklungene Stimmen reden wieder.
| * | * | |||
| * |
Der Fächer hat die Tage seines Glanzes an einer Stätte verlebt, die nach den Begriffen jener Zeit weit von dem Ort gelegen ist, wo er nach länger als einem Jahrhundert zur Ruhe kam.
Seine Glanzzeit spielte in einem ehemaligen herzoglichen Schloß, das um seiner schlichten Bauart und Einrichtung willen zum Amtshaus herabgesetzt worden war. Ein Justizamtmann hauste darin mit seinem ganzen Anhang: dem studierten Sekretarius, dem Schreiber, Gefangenenmeister und dem „Steckenknecht“.
In einem früheren Bankettsaal saß der Herr Justizamtmann auf erhöhtem Stuhl mit schicklich gekreuzten Beinen, den rothen Mantel, das Zeichen seiner Würde, umgeschlagen, und hielt Gericht über Missethäter, sprach das Urthel zwischen streitigen Parteien und ließ unnützen Herumstreichern auf der Bank im Hof wohlverdiente Plätzer aufzählen. Ihm war der herzogliche Landestheil untergeben, soweit sein Blick nach drei Seiten von dem alten grauen, noch mit tiefen Wassergräben umzogenen Steinhause schauen konnte.
Nur gen Abend sah er in fremdes Gebiet hinein. Die Mauern und Thürme einer kleinen Grenzfestung des benachbarten Landgrafenthums schlossen am Horizont die Aussicht ab.
Aber so respektvoll seine Bauern mit den Füßen ausscharrten, wenn sie ihm begegneten, so demüthig die Bürger des kleinen Amtsstädtchens Kappen und Hüte vor ihm zogen – es trug doch kein armer Teufel Bedenken, über die hohe Schwelle des Gerichtssaales zu schreiten, um sich eines Rathes zu erholen.
„Wie der Herr, so das Gescherr“ sagt ein Sprichwort dort zu Land. Und der Herr war eine Herrin, die als Vormünderin ihres Sohnes mild, wenn auch fest die Zügel des Herzogthums führte.
Wer nun vollends einen Blick in die Amtswohnung gethan hatte, der dachte nicht daran, daß es Galgen und Rad in der Welt gebe. Da regierte die stattliche Frau Amtmännin, eine Superintendententochter, übte gegen die Honoratioren des Städtchens und der Umgegend freigebige Gastfreundschaft und ließ denen, die auf der Gerichtsbank im Hof etwas „Warmes“ bekommen hatten, ebenfalls etwas Warmes in einer Schüssel verabreichen, auf daß in ihrem Haus die Barmherzigkeit so wenig wie die Gerechtigkeit zu kurz käme.
Und wem das Herz bei der feinen und doch wirthlichen Hausfrau ungerührt blieb, dem that es sich gewiß auf, wenn er die beiden Töchter sah, wie sie jung, blühend, lächelnd dem Leben entgegengingen, immer so harmlos fröhlich, so innig Arm in Arm, wie sie jetzt an einem schönen Frühlingstage in den ehemaligen Schloßgarten hinauswandelten. Sie freuten sich über alles: über die goldene Sonne, über die in den Stachelbeerbüschen summenden Bienen und die grünen Blattspitzen der Narzissen und Maiblumen, welche wie neugierige Ohren aus der feuchten dunklen Erde der schnurgeraden Rabatten aufstiegen.
Heute war es jedoch kein müßiger Spaziergang, den sie auf den von Buchsbaum eingefaßten Kieswegen unternahmen; sie wollten häuslich thätig sein. Lotte, die Aelteste, hatte einen Korb am Arm und ein blankes Messer in der hübschen runden Hand, sie gedachte Spargel zu stechen. Die Jüngere trug einen Glaskrug mit fest schließendem Deckel. Sie hatte sich vorgenommen, einen „Potpourri“ anzulegen, [606] ein langwieriges Werk! Denn den ganzen Sommer hindurch mußte von jeder duftenden Blumenart ein Theil in den Topf gesammelt werden, damit man dann im Winter durch Lüften des Deckels die feinsten Wohlgerüche im Zimmer verbreiten konnte. Mit den Veilchen wollte Lida heute den Anfang machen.
Am Spargelbeet schürzte Lotte sorgfältig den strohgelben Rock, zog die Bänder der weiten hellen Schürze fest um das dunkelgrüne mit großen Stahlknöpfen besetzte Kamisol und begann so emsig die weißen Köpfchen in der dunklen Erde zu suchen und heraus zu graben, daß ihr das blonde, gepuderte und zu hohem Toupet gethürmte Haar in die Stirn rutschte.
„Nichts lustigeres giebt es als Spargel stechen und Eier abnehmen, immer hat man eine Ueberraschung!“ sagte sie.
„Soll ich Dir helfen?“ fragte Lida.
„Ach, das bringst Du mit Deinen Fingerchen doch nicht fertig,“ meinte lachend die Schwester. „Pflücke Du nur Deine Veilchen!“
Lida ließ die großen Augen, die, so dunkel sie waren, doch eitel Licht auszustrahlen schienen, über die Beete gleiten. Sie war schlanker, zarter als ihre Schwester, und so erschien auch ihre Tracht feiner, obgleich das blaßblaue Miederchen, der Rock von geblümtem Kattun nicht kostbarer waren. Auf dem schwarzen hochfrisierten Haar lag der Puder wie ein zarter Reif, und die zwei dadurch versilberten langen Locken, die auf das fein gefältelte Halstuch herabfielen, stachen wundersam ab gegen das nur leise gefärbte jugendliche Gesichtchen.
„Ach! alles ist umgegraben und mit Kohl bepflanzt, mit Erbsen und Bohnen besteckt!“ seufzte sie.
Lotte richtete sich auf. „Wie es in einer ordentlichen Wirthschaft vonnöthen ist.“ „Hüh! Hott!“ – Peitschenknallen schallte über die altersgraue Mauer. Sie horchte. „Da kommt der Herr Nachbar vom Markt zurück,“ fuhr sie dann fort. „Wie wohl sein Geschäft mit dem Roggen ausgefallen ist? Er hatte eine große Geldkatze umgeschnallt, als er wegritt.“
Lida lächelte. „Hast Du auch das gesehen? Natürlich, was den Herrn Domäneninspektor angeht, das muß Amtmanns Lotte wissen.“
Die Schwester antwortete nicht. Einen raschen Blick warf sie in die Runde, dann sprang sie nach der Leiter, die der Vater beim Anbinden der Weinstöcke gebraucht hatte und die noch an der Mauer lehnte. Im Vorbeilaufen pflückte sie von einem Beet ein rothes Tulipänchen und ein gelbes Himmelschlüsselchen und steckte sie auf die höchste Spitze ihrer Frisur, so daß beide keck herabnickten. Jetzt klommen die Stöckelschuhe die Leitersprossen hinauf, und ihr frisches Apfelgesicht erschien über der Mauer.
„Zu Ihren Diensten, Demoiselle,“ ertönte im selben Augenblick drüben eine kräftige Männerstimme; der Besitzer derselben mußte die Mauer scharf im Auge gehabt haben, während er vorüber ritt.
„Sehr obligiert, Herr Nachbar!“ antwortete sie und musterte die geleerten Wagen, welche nebenan in den Wirthschaftshof der herrschaftlichen Domäne einfuhren. „Nun, ist der Handel gut gegangen?“
„Wie die Demoiselle sieht. Der Proviantmeister drüben“ – er deutete nach der am Horizont aufsteigenden Festung – „hat alles aufgekauft. Es soll viel Soldatenbrot gebacken werden.“ Er zuckte die Achseln. „Na meinetwegen! Es ist ja nicht bei uns. Und die herzogliche Kammer wird zufrieden sein, wenn sie den Erlös einstreicht.“ Er schlug auf die umgeschnallte Geldkatze, daß es klirrte.
„Da springt wohl auch für den Herrn Inspektor ein Vortheil heraus?“ fragte Lotte gespannt.
„Wie sich’s gebührt!“
„Vielleicht bewilligt der Herr Kammerpräsident als Recompense für das klug ausgeführte Geschäft ein Stück Weizenland zur Nutznießung?“ meinte Lotte.
„Als Recompense,“ entgegnete der junge Landwirth bedächtig, „werde ich mir etwas anderes ausbitten: das Stück sandigen Boden droben vor dem Wald.“
Dem Mädchen blieb der kleine hübsche Mund mit dem Grübchen auf der Unterlippe offen stehen. „Ehrhardt!“ stieß sie endlich heraus.
„Ja, ja!“ bekräftigte er gelassen. „Dort würde die neue Frucht aus Amerika, der Erdapfel, gut gedeihen; und auf den setze ich ein großes Vertrauen. Die Demoiselle versteht das nicht. Die Erdäpfel tragen reichlich Frucht, nehmen mit schlechtem Boden fürlieb und reifen zur rechten Zeit. Wie oft fällt in den Waldbergen der Schnee auf den Hafer und verdirbt die liebe Feldfrucht! Die Erdäpfel könnten wohl den ewigen Hungersnöthen steuern.“
„Für arme Leute will der Herr Inspektor das seltene Gartengewächs ziehen?“ fragte Lotte und lachte unmuthig auf. „Für dieses Geschäft bedanke ich mich, wie für die ganzen Erdtoffeln.“ Sie kletterte so rasch herab wie ein Eichhorn.
„Dazu hat die Demoiselle auch Ursache,“ war die ruhig gegebene Antwort von jenseit der Mauer; dann trabte der schwere Gaul draußen weiter.
Lida hatte lächelnd zugehört. „Wenn Ihr Euch immer so zankt, wird es lange dauern, ehe ich Dir von meinem Myrthenbäumchen den Brautkranz schneiden darf. Mir wäre es zwar schon recht, wenn Du immer bei uns bliebest.“
Lottes große blaue Augen hefteten sich mit unendlicher Zärtlichkeit auf die jüngere Schwester. „Ich gehe ja nur ein paar Schritte weit von Dir weg,“ tröstete sie. „Aber sieh!“ fuhr sie in belehrendem Tone fort, „einmal will jede heirathen, und der Inspektor Ehrhardt ist ein Mann in Amt und, wenn nicht gerade in Würden, so doch in Brot, in vorzüglichem Brot. O, er kann’s auch weiter bringen! Er kann Domänenrath werden! Wenn ich ihm nur erst die verrückten Erdtoffeln ausgeredet hätte!“
Lida lachte, aber Lotte fuhr eifrig fort: „Zu nächstem Quatember kommt der Herr Kammerpräsident hierher; da denkt Ehrhardt, daß er sich verbessern wird, und dann können wir dem Vater unser Vorhaben kundthun und um seinen Segen bitten.“
Lida sah sie erstaunt an. „Wann habt Ihr das beredet?“
„Gestern,“ murmelte Lotte und bückte sich tief auf ihr grabendes Messer. „Ich holte die Milch selbst, und dann sah ich mir den Kuhstall an – weißt Du, ich habe die vielen bunten Kühe so gern – und da kam er und erzählte mir die Geschichte. Aber sage kein Wort zu Hause! Sonst spricht der Vater von allem, was möglich sein könnte, und sucht unter jedem Versprechen eine Fallthür und in jedem Wort einen Haken, an dem man vielleicht hängen bleibt. Ach, die Justiz ist ein schreckliches Ding. Ich lobe mir den Landbau.“ Das Spargelbeet war abgesucht und nun witterte Lotte förmlich mit ihrem Stumpfnäschen in die Luft. „Ich möchte doch noch einmal sehen, was Ehrhardt thut – ob er böse ist.“ Und sie kletterte abermals die Leiter hinauf.
„Lotte, was ist das für eine Aufführung! Gehört ein Mädchen auf eine Leiter?“ Die Mutter war unbemerkt herangekommen.
„Ich – ich wollte,“ stotterte die Ueberraschte verlegen. „Da drüben von der Festung kommt nämlich eine Chaise herüber. Es ist der hochräderige Rumpelkasten des Platzmajors, und er ist voller Hüte mit Plumagen.“
„Es werden Offiziere sein, die auf der Gutskegelbahn Kaffee trinken wollen. Steig herab! Das Soldatenvolk braucht Dich nicht anzugucken.“
„Ach, Sie können ruhig sein, Mama,“ meinte Lotte, „die Lieutenants, die zuweilen herüberkommen, haben anderes zu thun, als mich anzugaffen. Den einen plagen seine sechs Kinder, den andern zwickt das Zipperlein in seinen sechzigjährigen Beinen.“
„Solche Leute sind gar nicht der Rede werth,“ entschied die Mutter. „Ich wollte Dir sagen, Lotte, daß der Herr Inspektor einen Korb voll Erdäpfel geschickt hat. Es wären die letzten vom vorigen Jahr. Wir wollen sie zum Abendbrot verspeisen.“
„Erdäpfel?“ rief Lotte. „Da muß ich gleich in die Küche; die kann niemand kochen als ich, das sind eigensinnige Gewächse. Gießt man das Wasser zu früh ab, so bleiben sie hart wie Seifenstückchen, sieden sie zu lange, so zerfallen sie.“ Und sie eilte der Mutter voraus zu ihren Erdtoffeln, den gefüllten Spargelkorb am Arm. Ihr Geschäft war gethan; die Schwester hatte noch nicht ein einziges Veilchen gepflückt.
Lida ging dem großen Grasgarten zu, dessen blühender Weißdornzaun sich an die zerfallende Mauer anschloß. Dort waren vielleicht die bescheidenen Blümchen zu finden, allein sie entdeckte nur wenige kaum erschlossene Knospen, während sie über die Hecke weg am Rain draußen Blüthe an Blüthe bemerkte. Rasch entschlossen schlüpfte sie durch eine Lücke des Geheges, und als sie erst im Freien war, wandelte sie die Lust an, am Garten entlang ein bißchen zu promenieren. Sie kam bis ans große geschlossene Gartenthor, da hielt sie plötzlich an. Auf dem Pfade, der von der Kegelbahn heraufführte, schritt leichten Ganges ein junger schlanker Mann. Sah der nicht aus wie ein Märchenprinz? Sein pfirsischblüthenfarbener Rock mit Silberstickerei und veilchenblauen Aufschlägen zeigte militärischen Schnitt; für diesen Stand sprachen auch die hohen weißen Gamaschen, und die Schärpe bezeichnete ihn als Offizier. Auch sein Degen war eine ernsthaftere Waffe als die Galadegen der anderen Standespersonen, welche von diesen selber spöttisch [607] „Bratspieße“ genannt wurden. Und wie er das Haupt hob, so leicht und trotzdem nicht übermüthig! Und welch ein liebes schönes Gesicht er hatte! Sie war stehen geblieben und blickte ihm entgegen wie einer Erscheinung aus einer anderen Welt.
Dann aber erröthete sie tief über diese Bewunderung des Fremden, sie drehte sich wie der Wind und war auf dem alten Weg schon wieder jenseit der Hecke, als der junge Mann in ihre Nähe kam. Allein dieser hatte die lichte Erscheinung schon bemerkt. Er zog den dreieckigen Hut von dem gepuderten Haar, das in einen langen Zopf endigte, und sprach: „Wollen Mademoiselle verzeihen, wenn ich sie anrede? Und darf ich helfen den ‚Potpourri‘ füllen? Der Rasen hier außen erscheint gleich einem blauen Tuch, so dicht stehen die Veilchen!“
„Wenn Monsieur so gütig sein will,“ flüsterte sie mit einer Verneigung.
Er blickte sie noch einmal an, als könne er sein Auge nicht abwenden von der reizenden Gestalt, die auf dem mit Maßliebchen bedeckten Rasenteppich stand wie eine Dryade so zart, so schön. Dann zog er den Stulphandschuh aus und pflückte Veilchen. Zuerst sammelte er sie in seinen kleinen Hut und reichte diesen über den mit Blüthenschnee bedeckten Weißdorn hinüber, und während sie die Blumenköpfchen herauslas, um sie in den Glaskrug zu streuen, sah er sie unverwandt an. Dann pflückte er ein Sträußchen und, den Hut unter dem Arm, bot er dasselbe ihr mit lächelnder Verbeugung an. Sie nahm es aus seinen Fingern, die Spitzen berührten sich und beide wurden roth, beide schauten zugleich auf und in die Augen ihres Gegenübers.
Wie sanft waren seine Augen! Das schwarze kecke Schnurrbärtchen, die hochgeschwungenen dunklen Brauen, die dem Gesicht ein so vornehmes Gepräge gaben, konnten den Eindruck nicht aufheben von einer tiefen fast wehmüthigen Herzenswärme, die aus den großen blauen Sternen strahlte.
„Nun, was beliebt dem Monsieur?“ ertönte eine frische Stimme, und Lotte kam eilig aus dem Spalier von Quitten heraus, das den Weg nach dem Amtshaus einfaßte.
„Ich erlaubte mir, Mademoiselle Veilchen zu sammeln, da sie hier außen häufiger blühen als im Garten,“ sagte der Fremde, sich abermals verbeugend.
Lotte faßte ihr Kleid an beiden Seiten, setzte einen Knix in das junge Gras und erwiderte: „Natürlich; dort ist mehr Sonne. Aber woher kommt der Monsieur?“
„Aus der Festung.“
Sie schüttelte den Kopf. „Die Offiziers dort haben doch andere Röcke?“
„Excusez, Mademoiselle,“ sagte er. „Ich bin Lieutenant bei der Leibgarde des Herrn Landgrafen und nur für einige Zeit aus Hochdesselben Residenz mit meinem Obersten nach der Festung kommandiert, um das dortige Regiment zu inspizieren und zu kompletieren.“
„Gehört zu dem Regiment auch unser Amt?“ lachte Lotte.
Eine Röthe stieg in sein Gesicht. „Um Vergebung, ich bin wohl lästig gefallen,“ sagte er betreten. Und mit einem letzten halb schüchternen, halb sehnsüchtigen Blick auf Lida und einer höflichen Verbeugung wollte er zurücktreten.
Lida hatte unbewußt die Hand ausgestreckt, als wolle sie ihn halten. Sie blickte ihre Schwester vorwurfsvoll an.
„So war es nicht gemeint,“ lenkte diese ein, da sie nun einmal daran gewöhnt war, der schwachen zarten Schwester jeden Wunsch an den Augen abzusehen. „Ich fragte nur: ‚Woher? Wieso?‘ Das ist in Amtshäusern Brauch.“
„O, Mademoiselle sind ganz in Ihrem Recht,“ entgegnete er rasch, wenn auch immer noch eine Röthe auf seinen Wangen lag. „Ich bin sehr dreist gewesen. Allein es war staubig und öde auf der Kegelbahn, wohin die Kameraden gingen. Ich rauche nicht gern Tabak und goutiere das Bier nicht; der Weg am Garten hin erschien in der Abendsonne so verlockend. Dann sah ich Mademoiselle und glaubte, ihr einen kleinen Dienst leisten zu können. Noch einmal: ich bitte um Vergebung!“
„Da ist nichts zu vergeben,“ entschied Lotte. „Ja, in der inneren Wirthschaft da drüben ist nicht alles, wie es sein sollte, man spürt, daß keine Frau da ist. Na, die bekommt etwas aufzuräumen! Aber da Monsieur nicht bis dahin warten kann, so lade ich ihn ein“ – sie machte nochmals ein Knixchen – „zu einem Gericht Erdäpfeln. Haben Sie schon die neue Frucht aus Amerika gespeist?“
Der Offizier zögerte einen Augenblick; doch als Lida ihn gespannt ansah, nahm er mit einem, wie Lotte sich gestand, sehr feinen „très humle“ die Einladung an. Er schaute sich nach einem Eingang um, indessen das große Thor war fest geschlossen. Lida bekam schon Angst, daß bei einem Umweg nach dem Eingang die Kegelbahngesellschaft den Offizier abfangen könne; doch Lotte half.
„Dort ist ja das Loch im Weißdorn, wo ein Mann schon durchkriechen kann,“ sagte sie und wurde dunkelroth. Sofort schlüpfte der Fremde wie ein Aal herein.
„Du kannst ja den Monsieur einstweilen an Dein Lieblingsplätzchen führen,“ fuhr Lotte fort, „während ich die Eltern benachrichtige, daß wir heut einen Gast haben – und“, setzte sie in Gedanken hinzu, „wenn es Schelte giebt, sie auf mich nehme.“ Sie eilte zurück.
Alle Rechte vorbehalten.
Tragödien und Komödien des Aberglaubens.
Es giebt kein fruchtbareres Feld für den Aberglauben als die Gebiete, auf denen die menschliche Abhängigkeit von den unwandelbaren Gesetzen der Natur so recht eindringlich zum Ausdruck kommt. Was vermag der Landmann, der für seine Ernte bangt, über Wind und Wetter, über Regen und Sonnenschein? Nichts! Was vermag der geschickteste Arzt gegen die tödliche Krankheit? Wenn es viel ist, eine kurze Fristverlängerung für das kämpfende Leben. So alt aber die Sorge um das Gedeihen des Ackers, des Fruchtbaums, so alt das Bangen vor dem Tode, so alt ist das Suchen nach übernatürlichen, abergläubischen Mitteln, um auf die Geister des Regens und des Sonnenscheins Einfluß zu gewinnen, das bleiche Gespenst des Todes von der Schwelle des Hauses zu bannen. Und hier wie überall gilt es: je größer die Noth, je unbedingter die Ohnmacht des Menschen, desto krasser die Mittel, desto toller das Aufbäumen gegen den unfaßbaren, unheimlichen Gegner; und hier wie überall gilt es: je tiefer der
[608][609] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [610] Bildungsstand eines Volkes, desto trauriger die Erscheinungen, die der Wahn zu Tage fördert.
Belege für diese Behauptung bieten nicht nur die aller Kultur fernstehenden „Naturvölker“, sondern ebenso andere, die mit der Gesittung in nahe Berührung gekommen sind. Aus Rußland und Indien greifen wir unsere Beispiele heraus.
In den russischen Gouvernements Saratow, Orenburg, Kasan u. a. herrscht der Glaube, daß der infolge starken Branntweingenusses erfolgte Tod eines Menschen Dürre im Gefolge habe, welcher nur dadurch vorgebeugt werden könne, daß man die Leiche ausgrabe und in den Fluß oder in einen Sumpf werfe. In einem großen Dorfe des Gouvernements Kasan führte diese Einbildung vor einigen Jahren zu einem entsetzlichen Drama. Dort lebte mit seiner einzigen Tochter Grunja ein Bauer, der wegen seiner Zurückgezogenheit im Dorfe den Ruf eines Hexenmeisters genoß. Er war ein gutherziger, liebevoller Mensch, den aber verschiedene Schicksalsschläge menschenscheu gemacht hatten. Im Dorfe mied ihn jeder, und als seine schöne Tochter einen Bauernburschen liebgewonnen hatte, da wollten die Eltern des Burschen, der das Mädchen ebenfalls liebte, von dieser Heirath nichts hören. Der Bauer und seine Tochter, von dem Dorfe in die Acht erklärt, zogen sich noch mehr zurück. Da starb der Alte eines Tages eines plötzlichen Todes; aus Gram und Kummer hatte er zuviel getrunken und dadurch sein Ende herbeigeführt.
Als der Mann starb, begann im Dorfe eine große Dürre. Die Bauern waren nun davon überzeugt, daß der „Herenmeister“, welchem man im Leben so viele Unbilden zugefügt hatte, sich jetzt räche und den „Himmel versperrt“ habe, damit kein Regen komme. Eine Anzahl der Bethörten begab sich deshalb des Abends auf das Grab des Verstorbenen, um, dem Aberglauben treu, seine Leiche auszugraben und sie mit Eschenpfählen an die Erde anzunageln. Zur selben Zeit aber war die arme, verlassene Grunja auf das Grab ihres Vaters gegangen, das sie bei Tag nicht zu besuchen wagte, aus Furcht, ebenfalls der Hexerei beschuldigt zu werden. Als die Bauern ein lebendes Wesen am Grabe des „Hexenmeisters“ erblickten, geriethen sie in Schrecken und versicherten einander, dies sei eine Hexe, die gekommen sei, um den alten „Zauberer“ vor der gerechten Strafe zu retten. Flugs schlugen sie auf das unglückliche Mädchen mit einem Beil los, bis das arme Geschöpf ihrer Wuth erlegen war. Sie erkannten dann wohl, daß sie die Tochter des Verstorbenen getötet hatten, kehrten sich aber nicht daran, sondern meinten, „der Teufelsbrut sei recht geschehen,“ verrichteten ihr unheimliches Geschäft und gingen nach Hause.
Wie harmlos klingen nach solchen Vorfällen die anderen „Mittel“ der Bauern gegen die Dürre, wenn man im Gouvernement Tula, um Regen herbeizuführen, einen lebenden Krebs feierlich in die Erde vergräbt, oder wenn man im Gouvernement Minsk mit einem von Weibern gezogenen Pflug den „Fluß ackert“, damit Regen komme!
Aber nicht die Dürre allein kehrt hier die traurigsten Seiten des Aberglaubens hervor. Im Dorfe Tawuschi im Suchumer Gebiet wohnte eine ältere Bäuerin, eine Witwe mit zwei Söhnen. Von diesen erkrankte der jüngere und starb bald eines jähen Todes; einige Zeit später erkrankte auch der ältere Sohn. Die Nachbarn riethen dem Leidenden, sich an die im Dorfe lebende „Wahrsagerin“ zu wenden, um von ihr die Ursache des Todes des Bruders und seiner eigenen Erkrankung zu erfahren. Die Wahrsagerin, reichlich bezahlt, bezeichnete nun die Mutter der beiden Brüder als „Urheberin“ des plötzlichen Todes des einen und der Erkrankung des andern; sie bestand darauf, daß man die „Hexe von einer Mutter“ dem Volke vorführe und sie zwinge, entweder „ihre Sünden zu bekennen“ oder „einer Prüfung mit glühendem Eisen“ zuzustimmen. Der kranke Sohn gestattete den Nachbarn, sich bei ihm abends zu versammeln und das unglückliche Weib der schrecklichen Tortur zu unterwerfen. Nach dem Abendessen, das von der Alten zubereitet war, legten die Nachbarn neben dem Hause des Kranken einen großen Scheiterhaufen an und wendeten sich alle in einer Stimme an die Mutter mit der Aufforderung, entweder ihre Sünden zu bekennen oder sich freiwillig dem Verbrennungstode zu überliefern. Die Bäuerin erschrak darüber so heftig, daß sie die Sprache verlor. Die Unmenschen aber faßten ihr Schweigen als Zeichen der „Bekennung ihrer Sünden“ auf und fielen mit einem glühenden Bügeleisen und glühendem Kupfer- und Messinggeräth über sie her. Als sie trotzdem kein Wort sprach, banden die Barbaren sie an einen langen Pfahl und, die entgegengesetzten Enden des Pfahls in den Händen drehend, begannen sie die Unglückliche über dem Scheiterhaufen zu rösten … Nach kurzer Zeit gab sie den Geist auf. Die Mörder aber begruben sie in aller Eile und Stille.
Am unheimlichsten indessen wirkt ein Vorfall, der sich von den bisher erzählten hauptsächlich auch dadurch unterscheidet, daß in ihm keinerlei selbstische Zwecke die treibende Kraft bilden. Er spielte im Gouvernement Ufa. Dort starb kürzlich ein Bauer eines unvermutheten Todes; die Angehörigen desselben weinten ein wenig um ihn, und am zweiten Tage nach dem Tode fand das Leichenbegängniß statt. Die gesammte Bevölkerung des Dorfes war versammelt. Als man aber den Sarg eben in die Gruft hinabgelassen hatte, sprang der mit Holznägeln befestigte Deckel plötzlich ab und im Grabe richtete sich, zum Entsetzen der Anwesenden, der in Weiß gekleidete Scheintote auf. Die Bauern, mit dem Pfarrer an der Spitze, ergriffen angsterfüllt die Flucht; der angeblich Tote, der bei dem herrschenden Winterfrost vor Kälte zitterte, folgte ihnen. Er lief ins Dorf, um Obdach flehend; aber alle Bauern schlossen sich in ihre Hütten ein, und nur zufällig gelang es dem Armen, in die Hütte einer alten Bäuerin zu dringen, der es nicht mehr gereicht hatte, ihre Thür zu verschließen. Dies rettete jedoch den Wiederauferstandenen nicht; die Dorfinsassen beschlossen, ihm den Garaus zu machen. Sie bewaffneten sich mit gespitzten Holzpfählen, umringten die Hütte und bemächtigten sich nach kurzem Kampfe des angeblichen „Hexenmeisters“. Erbarmungslos metzelten sie ihn nieder und nagelten ihn mit den Pfählen an den Boden. Der Pfarrer kam dann wohl zur Besinnung; er begriff, daß der arme Bauer einfach einen Starrkampf gehabt hatte und vom „Dorfarzt“ irrtümlich als Toter bezeichnet worden war. Allein als er die Polizei holen ließ, da war es schon zu spät: der Mann war jetzt wirklich tot und die Menge auseinander gegangen, nachdem sie beschlossen hatte, die gräßlich verstümmelte Leiche abends in einen Sumpf zu werfen.
An diese Fälle grausiger Begriffsverwirrung möge sich noch eine Geschichte anschließen, die insofern mit den bisher erzählten sich berührt, als auch sie die unheimliche Macht des Aberglaubens über halb oder ganz ungebildete Völker erläutert: es ist die Geschichte von den Jalwallahs, dem gefürchteten Britenregiment in Indien.
Dieses Regiment, seiner Nummer nach das hundertfünfzigste, ist eins der ältesten und berühmtesten in der britischen Armee. Unter Marlborough kämpfte es 1706 mit großer Tapferkeit bei Ramillies gegen die Franzosen; so blutig hatte es sich da auf dem Blachfeld seine Ehren erworben, daß jeder seiner Soldaten die Auszeichnung erhielt, eine breite rothe Schärpe von der linken Schulter über die Brust zu tragen.
Das Regiment kam dann nach Indien, wo seine wilden, verwegenen Gesellen wegen ihrer Schärpen von den Eingeborenen „Jalwallahs“ genannt wurden. Wie Teufel wütheten sie und keine Heerschar der Inder hielt ihren Angriffen stand. Sie schafften Ruhe im Lande; die von ihnen überwältigten Stämme wagten nicht mehr, der englischen Herrschaft offenen Widerstand zu leisten. In Azimpore, ihrer Garnisonsstadt, ruhten die Jalwallahs dann von ihren Kriegsfahrten aus; aber weit und breit im Lande blieb der Schrecken ihres Namens lebendig. Da kam die Cholera nach Azimpore und raffte so viele vom Regimente dahin, daß dieses nach dem vierzig Kilometer entfernten Ingradar verlegt wurde und dort auch fortan seinen Standort behielt. Die zahlreichen Opfer, welche die Seuche von den Jalwallahs gefordert hatte, waren eine halbe Stunde von Azimpore auf einem Felde an der Heerstraße begraben worden. Eine weiße Mauer wurde um die Begräbnißstätte errichtet, daneben eine Kapelle erbaut und von den abziehenden Kameraden den Gestorbenen auch ein Denkmal geweiht.
Ein Jahrhundert und mehr verfloß, ohne daß sich bei den nördlichen Hindostanern der Ruf der Jalwallahs verlor, obwohl keine ernsteren Kämpfe mehr zwischen beiden zu führen waren und die gefürchteten Truppen ihr Leben in Ingradar meist recht friedlich und bequem zubrachten. Vor allem vererbte sich im Volke die abergläubische Furcht vor dem Kirchhof bei Azimpore. Die Einwohner mieden diese Stelle, von der nach ihrer Einbildung Noth und Tod über sie ausging, und die eigenthümlichen, unverändert gebliebenen Signale des Regiments, welche die Hornisten mit ihren hellen, weithindringenden Trompeten gaben, klangen nicht an ihre Ohren, ohne sie zittern zu machen. Sie schwuren, [611] daß sie diese Töne oft von der Gräberstätte her vernehmen könnten und dazu Waffengeräusch, rohes Gelächter und derbe Flüche. Im Glauben an diesen Geisterspuk blieben sie befangen, und keiner der Sepoys – so nannte man die aus Indern gebildeten Truppen, welche die Engländer in ihre Armee eingereiht hatten – ging ohne Grauen an der Mauer des Kirchhofs der Jalwallahs bei Azimpore vorüber.
Im Mai 1857 brach in Delhi der Aufstand der Sepoys aus. Unter den 250 000 Soldaten, die damals von der ostindischen Compagnie unterhalten wurden, gab es nur 30 000 Briten, die übrigen waren Eingeborene. Die letzteren bemächtigten sich in Delhi der 150 vorhandenen Kanonen, unermeßlicher Kriegsvorräthe und eines Schatzes von zwei Millionen Pfund Sterling. Die englische Besatzung ward überwältigt und die gesammte europäische Bevölkerung der großen Stadt meist unter gräßlichen Martern umgebracht. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich der Aufstand über Nordindien. Die Grausamkeit, mit der die Sepoys dabei gegen die Engländer verfuhren, trug Entsetzen in ihre bedrohten Garnisonen. Wochenlang währte es, bis sie sich aufraffen konnten, um ihren Feinden die Stirn zu bieten und den Widerstand gegen sie planmäßig aufzunehmen.
Ein Stützpunkt der englischen Militärmacht war unter anderem Azimpore. Oberst Prendergast stand da mit 800 Mann, großentheils Reiterei. Schon schlugen die Wogen der Empörung auch an diesen Platz und jeden Tag war ein Angriff zu befürchten. Die Stadt war daher nach Möglichkeit verbarrikadiert worden; draußen vor den Thoren hatte man Schanzen aufgeworfen und mit Wachen besetzt; Reiterpatrouillen streiften zur Vorsicht Tag und Nacht in der Umgegend umher. Es war außerdem zwischen der Garnison von Ingradar, der nächstgelegenen, und der von Azimpore vereinbart worden, daß man sich gegenseitig zu Hilfe kommen werde, wenn eine von ihnen durch den feindlichen Vorstoß in Gefahr gerathe. So hofften die Engländer, hier sich behaupten zu können, und waren entschlossen, in jedem Fall ihr Leben theuer zu verkaufen.
Am 19. Juli meldeten die Streifpatrouillen, daß ein großer feindlicher Heerhaufen sich auf dem Marsch gegen Azimpore befinde. Sofort ließ Oberst Prendergast zwei Reiter nach Ingradar abgehen, um vom 150. Regiment die verabredete Unterstützung zu erbitten. Der Angriff der Indier war für die Nacht vorauszusehen und nur bei höchster Eile vermochten die Jalwallahs noch rechtzeitig einzutreffen. Ihr Weg war lang und bei der schwülen Julihitze überaus beschwerlich. Aber bis zum Morgen hoffte sich die Mannschaft von Azimpore noch hinter den Schanzen und Verhauen halten zu können. Alles wurde zur Vertheidigung gerüstet; ernst und schweigend blieb alles unter Gewehr, die Reiterei hielt sich fertig im Sattel. In höchster Spannung standen die Offiziere um den alten Oberst und horchten in die heiße, finstere Nacht hinaus; schwere Wolken bedeckten den Himmel und schon grollten die Donner eines aufsteigenden Gewitters.
Auf der Ebene vor dem Jalwallahkirchhof rückten währenddem zu Tausenden die Indier heran. Mir Khan, der gefürchtesten einer vom Mahrattenstamm, ritt auf feurigem Roß in prächtiger Kriegskleidung an der Spitze seiner Scharen. Als diese beim Flammen der Blitze der weißen Mauer des Totenfeldes ansichtig wurden, da erlahmte ihr Schritt und ihr Muth, der Marsch gerieth ins Stocken. Gemurre drang zu den Ohren der Anführer und sie wußten, aus welchem Grunde. Die Sepoys hatten Angst vor den Gespenstern, die an den Gräbern der Jalwallahs ihr Wesen trieben. Mir Khan aber ließ sich nicht einschüchtern; größer als sein Grauen vor dem Spuk war seine Rachelust, welche er im Blut der Engländer zu stillen gedachte. Und anders war nicht nach Azimpore zu gelangen, als auf der Straße, die an der Kirchhofsmauer vorüberführte. Darum befahl er herrisch den Weitermarsch.
Trotzdem rührte sich keiner; der Mann, der hinter dem Khan die Fahne des Aufruhrs trug, senkte sie wie unter Einwirkung einer höheren Macht zu Boden. Die Leibwächter um Mir her wurden verwirrt; seine Offiziere aus vornehmen Mahrattengeschlechtern verweigerten laut den Gehorsam, da sie selber so sehr von abergläubischer Angst befallen waren, daß sie beim Leuchten der Blitze über der Kirchhofsmauer die Köpfe der weißen Soldaten vom 150. Regiment und ihre rothen Schärpen gesehen haben wollten. In wildem Zorn schoß der Khan mit seiner Pistole einen dieser Widerspänstigen nieder und befahl seiner Wache, mit den anderen ein Gleiches zu thun. Mit bebenden Händen gehorchten diese; die Schüsse knallten durch die düstere Nacht und streckten ein paar andere der aufsässigen Anführer nieder.
Im selben Augenblick jedoch riß der Khan vor Entsetzen sein Roß zurück, die Truppen um ihn warfen die Waffen weg und wollten fliehen. Die abgefeuerten Schüsse waren vom Kirchhof her erwidert worden. Das Echo hatte die Indier getäuscht.
„Halt!“ schrie Mir Khan, der sich schnell wieder gefaßt hatte, den Fliehenden zu, und sie standen unter der Wucht seines Rufes.
Er ließ sie sogleich auf die Kirchhofsmauer schießen und minutenlang krachten die Salven in betäubendem Lärm; dazu der Donner des mit Macht sich jetzt entladenden Gewitters. Wie wahnsinnig gebärdeten sich die Sepoys; immerfort mußten sie schießen und dabei stieg von Sekunde zu Sekunde ihre Angst, denn das ungewöhnlich starke Echo warf die Salven und die Donnerschläge von der Mauer zurück, und die armen Gesellen dachten nicht anders, als daß sie hier ihr Ende finden müßten. Sie sahen die Träger der rothen Schärpen sogar leibhaftig vor sich und fielen in Massen zur Erde, in dem Wahn, von einer Kugel getroffen zu sein.
Endlich zwang sich Mir Khan zu dem Entschlusse, gegen das eiserne Gitterthor des Kirchhofs vorzurücken, er zwang auch seine Scharen, ihm zu folgen, wie sie auch widerstreben mochten. Das Gewehrfeuer durfte nicht aufhören, es mußte eine förmliche Schlacht gegen die toten Jalwallahs geliefert, die Geister mußten getötet, die Gräber vernichtet, der Kirchhof mit Mauer, Kapelle und Denkmal der Erde gleich gemacht werden. Mir Khan befahl den Sturm, er sprengte voran …
Da tönte ihm das helle, langgezogene Hornsignal des 150. Regiments von der Kapelle her entgegen. Er kannte es wohl, so gut wie seine Leute. Ein Grausen erfaßte ihn; seine Soldaten standen wieder wie erstarrt. In ihrem Entsetzen wähnten sie die Jalwallahs zwischen den Gräbern, an der Mauer, hinter dem Gitterthor stehen zu sehen und das Klirren ihrer Waffen, ihre Kommandorufe zu hören. Und noch einmal tönte das schreckliche Signal des 150. Regiments ihnen entgegen; ein langhin über die Gräber wegzüngelnder Blitz erhellte zugleich den Kirchhof und schien die Kapelle zu treffen. Ein Donnerschlag, unter dem die Erde erbebte, folgte ihm nach.
Nicht der Ruf eines Gottes hätte jetzt noch die Sepoys gehalten. In wildem Entsetzen warfen sie die Waffen weg und flohen wie besessen über das Feld zurück. Mir Khan wurde mit fortgerissen, selbst fast besinnungslos vor Schrecken. Sein über Stock und Stein hinjagendes Roß schleuderte ihn aus dem Sattel, im Falle brach er das Genick. Ein furchtbares Geschrei erfüllte die Luft; von Angst überwältigt brachen viele der Fliehenden zusammen, herrenlose Pferde stürmten über ihre Leiber weg, brachen in die Knäuel der Flüchtigen. Blitz und Donner dabei ohne Aufhören, um die Raserei der Massen noch zu mehren!
Endlich stieg im Osten der Tag empor, das Gewitter hatte ausgetobt, die Sonne vergoldete den Horizont. Von Azimpore kam ein Reitertrupp an den Kirchhof, die Recognoszierungspatrouille, welche Oberst Prendergast endlich dahin ausgeschickt hatte, weil er sich das wahnwitzige Schießen nicht erklären konnte; denn ein Zusammenstoß der Sepoys mit dem 150. Regiment war um diese Zeit so nahe bei Azimpore noch unmöglich. Die englischen Reiter sahen nun zu ihrem höchsten Erstaunen auf ein seltsames Schlachtfeld. Da lagen in Massen die Indier, tote und noch mehr lebende durcheinander, die ganze Ebene war bedeckt mit Waffen aller Art, und in der Ferne gewahrte man die letzten der Fliehenden. Die Aussagen der Gefangenen belehrten sie endlich, was geschehen war. Man meldete es ins Hauptquartier zurück und nun sprengte der Oberst selbst mit seiner Reiterei herbei. Wie er am Kirchhof ankam, da tönte auch hell und lang das Signal des 150. Regiments durch die klare, sonnige Luft. Ueber eine letzte Bergkuppe stiegen zweihundert Schärpenmänner, welche von Ingradar im Eilmarsch abgegangen waren. Eine Stunde vorher hatte ihr Signal, das sie von einer Höhe aus auf gut Glück nach Azimpore hin gegeben hatten, mit seinem Echo an der Kirchhofsmauer den abergläubischen Feind in die Flucht getrieben.
[612]Blätter und Blüthen.
Eine elsässische Bauernhochzeit. (Zu dem Bilde S. 601.) So verschiedenartig unter unseren deutschen Volksgenossen die Sitten und Gebräuche bei Hochzeiten sind, gewisse Züge, solche, die weniger auf Aeußerlichkeiten, als auf dem rein menschlich-natürlichen Empfinden beruhen, die kehren überall wieder. Den glückstrahlenden Bräutigam, die sittig verschämte Braut, die herzlich sich mitfreuenden Verwandten und Freunde, die jubelnde Jugend, die zwischen Trennungsschmerz und Mutterstolz schwankende Brautmutter, den behäbig ernsten Brautvater, sie finden wir auf allen deutschen Hochzeiten und überall da, wo der Kern der Bevölkerung ein dentscher ist. So auch auf unserem Bilde, das uns eine elsässische Bauernhochzeit aus den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts darstellt. Schon sind sie alle bei einander, die Freunde und Gevattern, und harren in heiterer Unterhaltung unter der mächtigen Holzgalerie des Hofes der Dinge, die da kommen sollen. Jetzt tritt er heran an die Treppe, der festlich geputzte Bräutigam, und die zierliche Braut legt, die Augen schüchtern niederschlagend, ihre Linke in seine dargebotene Rechte, damit er sie zur Kirche führe. Die Mutter hält zwar noch ihr Sacktüchlein in der Hand, mit dem sie sich an diesem Tage wohl schon mehr als einmal über die Augen gefahren ist, aber aus diesen Augen blitzt jetzt doch ein befriedigter Blick über das Töchterlein hin, welches sie heute hinausgiebt aus ihrem mütterlichen Schutze. Der junge Bruder unter dem Fenster erhebt ein solch tosendes Jubelgeschrei, daß die Schwester drinnen sich die Ohren zuhalten muß, draußen im Hofe aber ruht, offenbar in sachverständiger Verwaltung, ein stattliches Stückfaß Wein, den Hahn im Spundloch, Gläser, Becher und Krüge daneben – also auch an diesem „deutschen Zug“ fehlt es nicht.
Der Spion. (Zu dem Bilde S. 608 u. 609.) Der Krieg ist furchtbar grausam! Wohl hat das Völkerrecht der Gegenwart ihm allmählich manche Milderung aufgezwungen, die vordringenden Heeressäulen sind keine Banden von Räubern und Mordbrennern mehr, der friedliche unbewaffnete Bewohner ist vor Gewaltthat sicher, Plünderung wird nach Kriegsrecht strenge bestraft. Der uniformierte Soldat, der mit List und Gewandtheit sich an die feindliche Linie heranschleicht, ihre Stellung erforscht, ihre Pläne erlauscht, er ist, wenn entdeckt, einfacher Kriegsgefangener und wird als solcher mit allen Ehren behandelt.
Aber der Krieg kennt noch eine andere Klasse von Kundschaftern als diese. Unter tausenderlei unverdächtigen Vorwänden, in immer wechselnder bürgerlicher Verkleidung treiben sie sich zwischen den kämpfenden Gegnern hin und her, um werthvolle Nachrichten zu erhaschen und sie ihrem Auftraggeber zu hinterbringen. Nicht immer ist schnöder Eigennutz die Triebfeder ihres Gewerbes. Oft sind es glühende Patrioten, die auf diesem gefährlichen Wege ihrem Vaterlande Dienste zu leisten suchen. Ja, es ist ein gefährlicher Weg. Denn ihnen bietet das Völkerrecht keinen Schutz, rechtlos und vogelfrei sind sie, wenn sie dem Gegner in die Hände fallen, auf ihrem Gewerbe steht der Tod – und es wird ihnen noch ein gutes Ende, wenn mitleidige Kugeln ihn vollstrecken und nicht der Strick.
Und das weiß auch der Mann auf unserem Bilde, das eine Episode aus dem letzten Deutsch-französischen Krieg darstellt. Als ein bedauernswerthes Opfer seiner Vaterlandsliebe ist er den deutschen Truppen in die Hände gefallen. Fröstelnd sitzt er da, während der Schein der Laterne seinen Schatten gespenstisch groß an die Wand des kalten Kellergewölbes wirft, in das man ihn verbracht hat und an dessen einziger Thür zwei deutsche Ulanen ihn bewachen. Starr blicken seine Augen gerade aus. Hinter seiner gefurchten Stirn stürmen und toben die trüben Gedanken, die Bilder von Heimath, von Weib und Kind, die er verlassen muß, vom Vaterlande, dem nun auch sein Tod nichts helfen soll.
Und draußen in der Stube sitzen die Offiziere und prüfen mit Spannung die Papiere des Gefangenen: oft ist ja schon durch abgefaßte feindliche Spione der eigenen Heeresleitung wichtige Kunde zugekommen. Dann aber wird ein Kommando von ein paar Mann den Unglückseligen nach dem nahen Hauptquartier verbringen – ein Kriegsgericht tritt zusammen, um das Urtheil zu sprechen über den Spion.
Das Scheffel-Denkmal in Heidelberg. Fünf Jahre sind es her, seit Scheffel dahingegangen ist, der feinsinnige Dichter, welcher es verstand, den Ernst wie den Humor deutschen Gemüthes in seinen Werken wiederzuspiegeln und einen feuchtfröhlichen Klang bei gutem Trunke dreinzugeben. Seinen Tagen war keine allzulange Dauer beschieden, aber im „Ekkehard“ und im „Trompeter“, in seinen Liedern lebt er fort; in den dankbaren Herzen derer, die ihm so manche Stunde poetischen Behagens und gehobener Jugendlust verdanken, erneut sich seine Muse.
Es war keine leichte Aufgabe, diesen Mann mit der ausgeprägten Eigenart des Wesens und Schaffens in einem Denkmal treffend darzustellen: da durfte nichts von jener steifsinnigen Art zu bemerken sein, in der nicht wenige Dichterdenkmäler gehalten sind; frisch wie tiefes Jugendempfinden und frei wie tüchtige Manneskraft, so mußte Scheffel in seinem Standbild uns entgegentreten, wenn wir in ihm den wiedererkennen sollten, dessen geistige Gestalt uns vor der Seele schwebt. Das am 11. Juli dieses Jahres auf der Schloßterrasse zu Heidelberg enthüllte Denkmal überzeugt uns, daß die Lösung jener Aufgabe der künstlerischen Hand von Professor Heer in Karlsruhe auf wohlthuende, charakteristische Weise gelungen ist. Als Wanderer hat Scheffel so gern das Land durchzogen, da sind vor ihm die poetischen Pläne und Gestalten aufgestiegen, da hat er gefühlt, was er im Lied der fahrenden Schüler zu übermüthigem Ausdruck brachte – die deutsche Lust an sonniger Pirsch durch Berg und Wald. Als Wanderer ist er darum auch vom Künstler dargestellt worden: kraftvoll steht er vor uns in der derben Tracht, und doch gemahnt die ganze Haltung, daß dichterische Träume mit dem Wanderer ziehen.
Die Stadt, deren Bild und Zauber Scheffel so gerne genoß und dankbar durch seine Dichtung verklärte, hat in diesem Denkmal sein Andenken aufs anziehendste verkörpert. Und wenn in lauer Frühlingsnacht die Geister aus ihrem Schlaf erwachen, wenn Perkeo im Schloßkeller drunten seine tiefe Weisheit hören läßt und der Trompeter seine kecke Huldigung singt zu Ehren der Markgräfin, der „schönsten der Frauen“, wenn von unten her aus studentischem Mund das Lied erklingt:
„Alt Heidelberg, du feine –“,
dann geht wohl auch ein Hauch vom Geiste des Dichters durch das noch in der Zerstörung stolze Schloß, wo sein Standbild ragt.
Der Gartenlaube-Kalender für das Jahr 1892 erscheint demnächst, Bestellungen darauf werden schon jetzt in den meisten Buchhandlungen angenommen. Dieser neue, siebente Jahrgang des Kalenders wird sich den früheren würdig anreihen. Die beliebten Erzählerinnen der „Gartenlanbe“, W. Heimburg und Stefanie Keyser, zu denen sich A. G. v. Suttner gesellt, sorgen für anmuthige und spannende Unterhaltung. Belehrende Beiträge aus der Feder anerkannter Autoritäten sollen die Aufmerksamkeit des Lesers fesseln, dessen Auge überdies durch zahlreiche Illustrationen von hervorragenden Künstlern erfreut wird. Die vielen als werthvoll erprobten Tabellen zum Nachschlagen für das praktische Leben fehlen ebenfalls nicht und auch dem Humor ist es vergönnt, sein närrisches Scepter zu schwingen. Nach außen hin zeigt sich der Kalender wiederum in dem bekannten hübschen rothen Röcklein, in dem er sich die Jahre her so viele treue Freunde erworben hat.
Inhalt: Ein Götzenbild. Roman von Marie Bernhard. S. 597. – Verheißungsvolle Sprößlinge. Bild. S. 597. – Eine elsässische Bauernhochzeit. Bild. S. 601. – Gut verwendete Millionen. Eine Mahnung zur Linderung sozialer Noth. Von Schmidt-Weißenfels. S. 603. – Das Los des Schönen. Erzählung aus dem achtzehnten Jahrhundert. Von Stefanie Keyser. S. 605. Mit Abbildungen S. 605 und 607. – Tragödien und Komödien des Aberglaubens. 607. – Der Spion. Bild. S. 608 und 609. – Blätter und Blüthen: Eine elsässische Bauernhochzeit. S. 612. (Zu dem Bilde S. 601.) – Der Spion. S. 612. (Zu dem Bilde S. 608 und 609.) – Das Scheffel-Denkmal in Heidelberg. Mit Abbildung. S. 612. – Der Gartenlaube-Kalender für das Jahr 1892. S. 612.