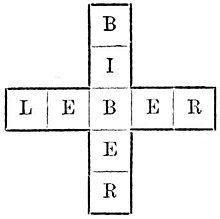Die Gartenlaube (1890)/Heft 18
[549]
| Halbheft 18. | 1890. | |
Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.
Ein Mann.
Graf Utzlar, der sehr gespannt auf den Ausgang der Verhandlungen in Snarre war, ließ Tromholt, als derselbe nach Limforden zurückkehrte, sogleich zu sich bitten. Nochmals versuchte es Tromholt, des Grafen Forderung herabzustimmen, aber das Ergebniß war nur eine heftige Auseinandersetzung, infolge welcher der Graf Tromholt im höchsten Zorn die Thüre wies und letzterer erklärte, den Grafen mit Gewalt aus Limforden entfernen zu lassen. Unter dem Eindruck dieses Auftritts schrieb Richard noch am gleichen Abend nach Kiel an Frau Ericius und meldete ihr seine Ankunft dort für den folgenden Tag. Er wollte ihr alles klarlegen, auch aus Snarres Anerbieten – das hielt er für seine Pflicht – kein Geheimniß machen und, indem er ihr die freie Wahl der Entscheidung ließ, die Sache zu Ende führen. Ausdrücklich betonte er in dem Brief, daß ihm aus verschiedenen Gründen eine Besprechung unter vier Augen und ohne weitere Zeugen erwünscht wäre. Er fürchtete sich vor einer neuen Begegnung mit Susannen, die, wenn ihn der Graf recht berichtet hatte, morgen gleichfalls in Kiel eintreffen mußte. Und noch eine weitere Absicht verband er mit dieser Reise. Die alte Wirthschafterin in Trollheide war gestorben und der dadurch freigewordene Posten eignete sich um so mehr für Ingeborg, als diese mit den dortigen Verhältnissen schon von früher her vertraut war. Demgemäß wollte er das Mädchen, das sich immer noch in Kiel im Haus der Frau Ericius aufhielt, von dort abholen und selbst in die neue Stellung einführen. Und dann, so sagte er sich, war für sie alle gesorgt, er konnte ruhig im Bewußtsein vollster Pflichterfüllung sein Amt niederlegen; ein Lebensabschnitt ging für ihn zu Ende, ein neuer, noch ungewisser konnte beginnen, aber gleichviel, er hatte seiner Ueberzeugung genügt wie ein Mann, er fühlte die Kraft, ihr auch ferner zu folgen.
Frau Ericius, auf welche die Ereignisse der letzten Zeit schwer gewirkt hatten, glaubte in Tromholts Entschluß, seine Stellung auf den Limforder Werken aufzugeben, ein neues Glied in der Kette von Unglücksfällen erblicken zu müssen, von denen die Familie in so rascher Aufeinanderfolge heimgesucht worden war. Und doch konnte sie, als eine feinfühlende Frau, seinen Ausführungen nicht widersprechen, zumal sie die tieferen Beweggründe, die Tromholt leiteten, wohl ahnte. Das Angebot Snarres wies sie nach kurzer Rücksprache mit ihrer Tochter entschieden zurück. „Alles andere, lieber als diese drückende Verpflichtung!“ hatte Susanne
[550] gesagt, und Richard mußte sich mit Beschämung bekennen, wie schweres Unrecht er ihr mit seinem Verdacht gethan hatte. Allein seinen Entschluß vermochte auch diese Einsicht nicht mehr zu erschüttern. Was den Gutsverkauf betraf, so sah die Witwe wohl ein, daß die Weiterführung des großartigen Betriebs ohne Tromholts Hilfe für sie eine Unmöglichkeit sei, zugleich war ihr die Freude an dem einstigen Familienbesitz durch die Erinnerung an die letzten Ereignisse völlig verleidet. Auch sie war müde, und so hatte sie, wenn Graf Snarre den Kauf zu angemessenen Bedingungen einging, gegen Tromholts Vorschläge auch in dieser Richtung nichts mehr einzuwenden.
Nachdem sich Richard von der Witwe mit einem Händedruck, dessen warme Erwiderung ihm mehr als alle Dankesworte bezeugte, was er ihr gewesen war, verabschiedet hatte, stieg er zu Ingeborg empor, die im oberen Stock ein Zimmerchen bewohnte. Er traf sie mit Dina und sah sich von beiden aufs herzlichste begrüßt. Zwischen den beiden Mädchen hatte sich in der kurzen Zeit ihres Zusammenlebens ein überaus inniges Verhältniß gebildet, und als Dina nun hörte, daß er gekommen sei, ihr die Freundin zu nehmen, gab sie ihrem Kummer Ausdruck. Ingeborg, welcher der Abschied gleichfalls nicht leicht wurde, hatte alle Mühe, sie zu trösten. Aber so angenehm der Aufenthalt im Hause der Frau Ericius für Ingeborg auch gewesen und so gütig die Aufnahme war, die sie dort gefunden hatte, widerstrebte es ihr doch, das fremde Gastrecht ohne Gegenleistung länger zu genießen. Sie sehnte sich nach einer Thätigkeit, wie sie sich ihr in Trollheide bot, und nur der Gedanke, daß Larsen sie dort aufs neue mit seiner gewaltthätigen Zudringlichkeit verfolgen könnte, machte ihr bang. Allein in dieser Hinsicht beruhigte sie Tromholt, der seine letzten Pläne vor dem Mädchen noch geheim hielt, und so reiste sie noch am gleichen Abend, nachdem sie ihre Habseligkeiten zusammengepackt und sich von der Familie verabschiedet hatte, mit ihrem Beschützer nach Limforden zurück.
Graf Snarre hatte sein Möglichstes gethan, Susanne zu bewegen, daß sie ihre Abreise noch einige Tage aufschiebe, und auch seine Tante hatte sich diesen Bemühungen angeschlossen, aber Susanne bat, nicht in sie zu dringen. Ihr Benehmen war seit der Unterredung mit Tromholt so verändert, daß es den Hausgenossen auffallen mußte; sie war ernster, stiller als zuvor, und vergebens mühte sich Snarre, ein Lächeln auf ihre Züge zu rufen, vergebens mühte er sich auch, zu errathen, was zwischen ihr und Tromholt vorgefallen sein möchte.
Mit ruhigem Ernst reichte sie ihm beim Abschied die Hand, und aus ihren Dankesbezeigungen sprach wohl warmes Gefühl, aber auch nicht mehr, nichts, was seine Hoffnungen irgend hätte ermuthigen können, ja, selbst seine Begleitung hatte sie abgelehnt.
Snarre war zornig bald über sich, bald über Tromholt, er suchte sich in dem Schmerz über Susannens Kälte die ganze Angelegenheit aus dem Kopf zu schlagen, aber die Folge war, daß er sich nur immer leidenschaftlicher in die schöne Frau verliebte, immer ernster über die Mittel nachdachte, sie ganz zu besitzen.
Gleich nach Susannens Abreise hatte er einen Boten zu Tromholt nach Limforden geschickt, von dort aber die Nachricht erhalten, daß der Direktor in Geschäften nach Kiel gereist sei. Nun erwartete er voll Ungeduld Tromholts Zurückkunft, und er stand schon im Begriff, selbst nach den Werken hinüberzureiten, als sich der Heimgekehrte bei ihm melden ließ.
„Ah, mein verehrtester Herr Direktor!“ rief Graf Snarre mit sichtbarer Freude. „Ich bin sehr glücklich, Sie zu sehen, ja, ich muß sagen, ich stand schon mit dem Fernrohr auf meinem Schloßthurm und schaute nach Ihnen aus! Nun, ich bitte, was bringen Sie Neues? Nehmen Sie gütigst Platz! Sie waren in Kiel?“
Tromholt nickte.
„Ja, Herr Graf! Ich komme mit viel Neuem, und da Sie in erster Linie daran betheiligt sind, gestatten Sie, daß ich Ihre Aufmerksamkeit dafür in Anspruch nehme. Um zunächst kurz die Sachlage zu erörtern: Sie haben mich bezüglich Ihres neulichen großmüthigen Angebots um Verschwiegenheit gegenüber jedermann und besonders gegenüber den Damen Ericius ersucht. Leider war es mir nicht möglich, dieses Versprechen in seinem ganzen Umfang zu erfüllen.“
„Ah!“ machte Snarre und seine Züge verfinsterten sich.
„Es mußte sich mir,“ fuhr Tromholt fort, „nachdem ich mich von dem ersten Erstaunen über Ihr Gebot erholt und die Sache näher überlegt hatte, die Frage aufdrängen, ob ich ein derartiges, einem Geschenk gleichkommendes Anerbieten allein auf meine Verantwortung annehmen dürfe, so lange noch irgend eine Möglichkeit vorhanden war, die bestehenden Wirrnisse in anderer Weise zu lösen, ob ich nicht verpflichtet sei, diejenigen, die mich mit ihrem Vertrauen beehrten und denen das Geschenk zugute kam, davon in Kenntniß zu setzen. Nun, Herr Graf, Pflicht und Gewissen sagten mir, daß die Unterlassung einer solchen Mittheilung einem Vertrauensmißbrauch viel schwererer Art gleichgekommen wäre, als Sie ihn in dem Bruch meines Schweigens erblicken mögen. Pflicht und Gewissen sagten mir ferner, daß ich erst mit allen Mitteln die Möglichkeit einer andern Lösung suchen und, nachdem ich sie gefunden, nicht der Gräfin Susanne, obwohl sie die Nächstbetheiligte ist, aber doch ihrer Mutter, der Witwe Ericius, von Ihrem Angebot vertrauliche Mittheilung machen und ihr die freie Wahl des nunmehr einzuschlagenden Weges überlassen müsse. Und so habe ich gehandelt.“
Der Graf hatte der überzeugenden Sprache Tromholts nichts entgegenzusetzen.
„Sie haben recht gethan wie immer,“ sagte er ohne Zögern. „Aber nun, wofür hat sich die Dame entschieden?“
„Frau Ericius,“ erwiderte Tromholt, „glaubt unter tiefempfundenem Danke für solche Güte Ihr großherziges Anerbieten dennoch ablehnen zu müssen, Herr Graf. Sie hat sich überzeugt, daß Frau Susanne ein solches niemals annehmen würde, und hält eine Verheimlichung der Sache für ebensowenig angängig. Ihrer Tochter ausgeprägter Unabhängigkeitssinn würde sich dagegen auflehnen. Ich theile diese Ansicht, ja, bin schon kurz nach unserer Unterredung – wie ich offen bekennen muß – zu derselben Einsicht gelangt. Wir griffen, um den Wünschen der Gräfin schnell und sicher zu entsprechen, zu einem Mittel, das sich doch bald genug als ein unausführbares herausstellte. Wer irrte nicht einmal? – Ich komme aber nun mit einem anderen von Ihnen ursprünglich angeregten Vorschlage, hochgeehrter Herr Graf, und diesem bitte ich freundlich Gehör schenken zu wollen.
Es ist mir doch schließlich klar geworden, daß es nur einen Weg giebt, um all der vorhandenen Schwierigkeiten Herr zu werden, und er besteht in dem Verkauf der Ericiusschen Besitzungen. Ich bitte deshalb, Sie fragen zu dürfen, ob Sie Limforden und Trollheide erwerben wollen, und bin beauftragt, im bejahenden Fall sofort mit Ihnen abzuschließen. Daß Sie ein solides, ja vortheilhaftes Geschäft machen, dafür bürge ich Ihnen. Ist genügendes Betriebskapital vorhanden, so kann der Besitz schon in wenigen Jahren eine Goldgrube werden.
Die genaueren Nachweise vermag ich Ihnen jederzeit vorzulegen; alle auf die Werke bezüglichen Papiere: die Abschätzungen und Ertragsberechnungen liegen vor, und bei den letzteren ist mit der größten Vorsicht verfahren worden. Im allerschlechtesten Falle werden Sie mit Ihrem Gelde sechs Prozent machen, wahrscheinlich aber ist, daß sich der Gewinn dauernd auf das Doppelte stellen wird.“
Snarre nickte mit dem Kopf. Alles, was Tromholt zuletzt gesprochen, hatte seinen Ohren sehr wohl geklungen. Die Erwerbung von Limforden und Trollheide paßte in seine Pläne, und sie würde – es sagte ihm das ein unbestimmtes, sicheres Gefühl – seinen geheimen Wünschen nützlich sein.
„Ich danke Ihnen für Ihre Mittheilungen,“ entgegnete er – die guten Eindrücke, die er empfangen hatte, als kluger Geschäftsmann äußerlich verbergend – „und will Ihnen gern gestehen, daß auch in mir inzwischen wegen der Hergabe des Geldes Bedenken aufgestiegen sind. Betrachten wir also diesen Punkt als erledigt! – Was nun den Ankauf von Limforden anbetrifft, so möchte ich, bevor ich eine Meinung äußere, mich über zwei sehr wichtige Punkte unterrichten. Erstens: wie viel fordern Sie, und zweitens – werden Sie, Herr Direktor Tromholt, den Werken auch ferner Ihre Thätigkeit widmen?“
Snarre schaute Tromholt bei diesen Worten mit großer Spannung an und erhob sich dann, um nach einer neuen Cigarre zu greifen und auch Tromholt eine solche anzubieten.
Und während der blaue Rauch durch das hohe, mit schweren Seidentapeten ausgestattete Gemach schwebte und den Weg durch die geöffneten Fenster nahm, sagte Tromholt mit seiner ernsten, vertrauenerweckenden Miene:
„Der Preis der Gesammtbesitzungen stellt sich mit Aktiven [551] und Passiven auf rund eine halbe Million Thaler, Herr Graf. Was meine Person anbetrifft, so möchte ich zurücktreten. Jeder andere geschäftskundige Mann kann jetzt – nachdem die ersten schweren Jahre vorüber sind – die Werke ebensogut leiten wie ich und ist wesentlich billiger zu haben. Ich hatte die Absicht, Ihnen im Fall der Uebernahme Herrn von Alten zu empfehlen. Mich leiten dabei in keiner Weise verwandtschaftliche Rücksichten, obgleich ich ihm natürlich alles Gute wünsche, sondern lediglich die Interessen des künftigen Besitzers. Sie werden übrigens, wie ich hervorheben möchte, die Verwaltungskosten noch sehr einschränken können, Herr Graf, und wenn Sie – ich bitte um Verzeihung! – meinen Vorschlägen folgen wollen, bin ich sicher, Sie werden den Ankauf nie bereuen!“
„Ist es unbescheiden, nach den Gründen Ihres mich allerdings sehr überraschenden Entschlusses zu fragen, Herr Direktor? Nicht Neugierde treibt mich, sondern aufrichtige Theilnahme für Sie. Ich muß Ihnen bekennen, daß ich die Erwerbung der Besitzungen ohne Sie niemals ins Auge gefaßt habe. Gerade Ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten und die Sicherheit, daß die Dinge unter Ihrer Leitung einen durchaus erwünschten Fortgang nehmen würden, ließen den Gedanken in mir aufsteigen, dem ich ja Ihnen gegenüber auch früher schon Ausdruck verlieh.“
Diese Frage brachte Tromholt in große Verlegenheit, was dem scharf beobachtenden Blick Snarres nicht entging. Richard zögerte mit der Autwort, die Lüge widerstrebte ihm, und die volle Wahrheit zu sagen, konnte er sich doch auch nicht entschließen. Endlich, da er fürchten mußte, sein Schweigen könnte von dem Grafen mißdeutet werden, vielleicht sogar den ganzen Kauf in Frage stellen, erwiderte er mit einer Offenheit, die ihn immerhin schwere Ueberwindung kostete:
„Die Gründe, die mir den Aufenthalt in Limforden unmöglich machen, sind rein seelischer, von dem Gang der Werke völlig unabhängiger Natur; sie Ihnen des näheren auseinanderzusetzen, hieße ein Geheimniß preisgeben, das nicht mir allein gehört. Die Erinnerung an ein sehr ernstes, für mein Leben entscheidendes Ereigniß verleidet mir den Ort; ich kann sie bei aller Thätigkeit nicht abstreifen. Lange habe ich dagegen gekämpft, eine Zeitlang glaubte ich, ihrer Herr geworden zu sein, allein sie kehrt wieder, sie würde mich aufreiben, wenn ich ihr nicht entflöhe. Was ich suche, ist Vergessen, und das kann ich, wenn überhaupt, nur in einem fremden Land, in neuen Verhältnissen, in einer andern Lebensstellung finden. Forschen Sie nicht weiter, Herr Graf, lassen Sie sich an diesen Andeutungen genügen, die ich Ihnen gebe und auch Ihnen nur, um jeden Zweifel zu beseitigen, als ob irgend welche andere, vielleicht geschäftliche Gründe meinen Entschluß beeinflußt hätten.“
Snarre horchte hoch auf. Hatte ihm nicht Susanne dasselbe oder doch etwas Aehnliches gesagt, als er sie nach ihren Plänen für die Zukunft gefragt hatte? Ja, sie hatte unverhohlen auf Tromholt als den Mann hingewiesen, dessen Nähe ihr eine Quelle bitteren Selbstvorwurfs sei, den sie gegen ihre bessere Ueberzeugung gekränkt, dessen Achtung sie verscherzt zu haben fürchte. Er erinnerte sich noch genau jedes Wortes, er entsann sich der seltsamen Veränderung in Susannens Wesen nach ihrem letzten Gespräche mit dem Direktor, und es ward ihm klar, daß zwischen ihr und Tromholt irgend welche Beziehung bestehen müsse, und daß Tromholts Entschluß damit zusammenhänge. Er ahnte etwas von einem hochherzigen Verzicht, zu dem eben nur dieser Mann fähig war, und wie er ihn dafür bewunderte, so sagte ihm seine vorurtheilsfreie Einsicht, daß er ihm auch zu Dank verpflichtet sei, daß die Frucht dieses Verzichts ihm, Snarre, zugut komme.
„Tromholt!“ sagte er plötzlich unter dem Eindruck dieser Gefühlsmischung – „Erlauben Sie, daß ich das ‚Herr‘ weglasse und Ihnen die Hand reiche als Ihr Freund! – Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen! Folgen Sie Ihrem Drang, der nur ein edler sein kann! Ich kaufe die Werke und das Gut, und wenn es Ihnen draußen in der Welt einmal, was nie eintreten möge! schlecht gehen sollte, so erinnern Sie sich, daß Ihre Stelle frei ist, und daß Sie mir jederzeit willkommen sind!“ –
Vier Tage nach dieser Unterredung trafen bereits Graf Snarre und Tromholt in Kiel ein und schlossen bei dem Advokaten Justizrath Rendtorff den Kaufvertrag über Limforden und Trollheide ab. Nach den geschäftlichen Auseinandersetzungen hatte Frau Ericius die Herren zu Tische eingeladen. Tromholt lehnte wegen eines leichten Unwohlseins ab, aber Snarre erschien und sah bei dieser Gelegenheit Susanne nach längerer Zeit zum ersten Male wieder. Ihre Begegnung hatte einen sehr herzlichen Charakter. Doch blieb Susanne während des ganzen Essens ernst, obwohl der Graf alle seine Liebenswürdigkeit entfaltete und besonders Frau Ericius ganz für sich einzunehmen wußte.
Er erzählte von seinen Erlebnissen und Reisen in einer eigenthümlichen und von der Vortragsweise der meisten anderen Menschen abweichenden Art, war voll guter Laune und erhob gegen Schluß der Tafel das Champagnerglas, indem er die Bitte aussprach, es möge der Familie gefallen, ihn baldigst in Snarre mit einem Besuch zu beehren, damit die gut begonnene Freundschaft mit dieser Begegnung nicht ihr Ende erreicht habe. Seine Tante, die Gräfin, sei äußerst begierig, auch die gnädige Frau und Fräulein Dina kennenzulernen, und wolle zu diesem Zweck ihren Aufenthalt in Snarre verlängern.
Am andern Tage traten die Betheiligten nochmals zu einer geschäftlichen Rücksprache zusammen, und es wurde die Abrede getroffen, über den geschehenen Verkauf zunächst völliges Stillschweigen zu beobachten, damit nicht Utzlar, wenn er davon erfahre, seine Ansprüche erhöhe. Auch wurden die Einleitungen zu der unmittelbar vorzunehmenden Scheidung zwischen den Ehegatten am folgenden Tage vom Justizrath getroffen und Utzlar ward von letzterem brieflich verständigt, sich unverzüglich in Kiel wegen der damit verbundenen Förmlichkeiten einfinden zu wollen.
Vierzehn Tage später hatte Tromholt sich bereits von allen Beamten, Arbeitern und sonstigen Insassen Limfordens und Trollheides, woselbst Ingeborg von ihm in ihre neue Stellung eingeführt worden war, verabschiedet und seiner Schwester in Hamburg die frohe Nachricht verkündet, daß Alten in seine Stelle getreten sei und ihrer Vermählung nichts mehr im Wege stehe.
Gesegnet von allen, die ihn kannten, betrauert, fast beweint von seinen Untergebenen, ging er von dannen und verließ seinerseits schweren Herzens die Schöpfungen, die unter seiner thatkräftigen und umsichtigen Leitung sich so vorteilhaft entwickelt hatten. Der letzte Gruß, den die Familie Ericius erhielt, kam aus dem hohen Norden, wohin sich Tromholt vorläufig gewandt hatte.
„Ich bleibe zunächst drei Jahre fort,“ hatte er seiner Schwester gesagt, „und wenn Du nichts von mir hörst, denke, daß es mir gut geht! Leb’ wohl! Ich weiß, Ihr werdet glücklich werden!“
Reichlich ein Jahr nach den vorstehend geschilderten Ereignissen saß Dina Ericius vormittags in der inzwischen von ihrer Mutter bezogenen neuen Wohnung am Düsternbroker Weg und vollendete eben einen Brief mit den laut gesprochenen Worten „Gezeichnet: Dina Ericius.“ Sie lachte lustig, dann las sie alles, was sie geschrieben hatte, noch einmal durch und fügte – bisweilen sehr zweifelhaft bezüglich der Richtigkeit und mehr nach Gutdünken als nach Regeln verfahrend – einige Interpunktionszeichen hinzu. Der Brief aber lautete folgendermaßen:
Endlich, endlich komme ich dazu, Dir den versprochenen Brief zu schreiben! Aber Du glaubst nicht, wie viel ich um die Ohren hatte, und wie oft ich mich daran zupfte wegen der Schande, ein so schlechter Kerl gegen Dich zu sein! Aber gewiß, nun geht’s los, und ich erwarte, daß Du genau aufhorchst, Du ungewöhnlich prachtvolles Mädchen! Erfahre denn, daß in Kiel im Grunde ganz und gar nichts passirt, daß höchstens die an den Kriegsschiffen aufgehängte Wäsche einmal bei starkem Ostwind stärker flattert als gewöhnlich – und o Emma, süßes Kind, laß mich’s Dir gestehen, lange kann ich diese Wäsche nicht mehr aushalten! – Auf dem Düsternbroker Wege bis Bellevue begegnen einem morgens nur der leere Pferdebahnwagen und nachmittags immer dieselben unausstehlichen Menschen, und in der Holstenstraße riecht es meistens so nach Käse, – ich weiß nicht, guter Kakadu, weshalb es gerade immer nach Käse riecht! – daß ich es nicht ertragen kann. Da war es denn zunächst eine artige Einrichtung des Himmels, daß mein Geburtstag kam, an dem denn ja auch Du Deine zierlichen Schwingen regtest und mir Deine Zeilen mit den allerliebsten beiden Tintenflecken sandtest. Daß Du übrigens noch auf dem alten Standpunkt der Briefschreiberei stehst, Anreden machst, wie ‚Meine furchtbar nette Dina‘, Grüße zum Schluß bestellst (Du, dies Grußbestellen kann ich, kann ich, kann ich nicht mehr aushalten) und Tintenklexe entschuldigst, finde ich – gelinde ausgedrückt – empörend. Doch nun wieder zu meinem Geburtstag, ungeduldiges Mädchen! –
[552]
[553] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [554] Von Mama bekam ich ein prachtvolles Sommerkostüm, Kleid, Jackett, Sonnenschirm, Handschuhe, alles in den Farben zusammenpassend, ferner ein Armband, das ich mir schon seit den Zeiten Noahs gewünscht hatte, und einige reizende Nippes nebst Geld. Von Susanne, geschiedener Gräfin von Utzlar, einstens äußerst melancholisch, kopfhängerisch und durchschnittlich unausstehlich, jetzt aber wieder nett, flott und lebenslustig, zwei Gesellschaftsvögel in einem entzückenden Käfig. Höre, furchtbar nette Emma, ein Paar solcher Thiere müßten alle Eheleute im Zimmer haben, damit sie sehen, wie sich ein vermähltes Paar noch nach einundachtzig Jahren benehmen soll. Sie sind von einer Liebenswürdigkeit mit einander, die Amor und Psyche beschämen könnte. Nun, waren Amor und Psyche etwa nicht musterhaft zärtlich, unwissendes Kind? Am Tage darauf machten wir einen Ball beim Oberpräsidenten mit, wo wir auch den berühmten Grafen Esbern-Snarre trafen. Du weißt, den enorm reichen Gutsbesitzer aus Nordschleswig, der unsere Limforder Besitzungen vor einem Jahre gekauft hat und zu dem Susanne damals sich vor Utzlar flüchtete. Er mag, glaube ich, die geschiedene Gräfin sehr gern, wenigstens zeichnete er sie riesig aus, aber er ist auch famos. Höre, Du: den würde ich auch heirathen, sofort, ohne Bedenken, plötzlichst!
Wir sollten schon im vorigen Herbst nach Snarre zum Besuch, da wollte die quesige Susanne nicht. Nun hat uns der Graf, der übrigens einige Male bei uns zu Besuch war, nach unserer Badereise – wir gehen nach Föhr – eingeladen, und ich glaub’, es wird was daraus. Der Ball verlief prachtvoll, fünfzehn Bouquets bekam ich beim Cotillon, aber mein neues Barège war völlig, völlig, völlig hin. Also dreimal hin! –
Mama geht es jetzt wieder sehr gut; nach allen Aufregungen, die nach Papas Tode eintraten, ist es nicht zu verwundern, daß sie sehr angegriffen war.
Unsere Wohnung ist himmlisch, Blick auf den Hafen, alles sehr bequem und macht sich bei Gesellschaften äußerst elegant. Ich habe mein Zimmer nach hinten links; rechts residirt Sannchen, wie der abscheuliche Utzlar mein schönes Schwesterlein immer nannte. Sannchen fährt auf dem Wasser, malt, spaziert, liest, musizirt und ist – ich wiederhole es – zwar viel ernster als früher, aber doch ein lieber, drolliger Kerl. So, nun weiß ich nichts mehr. Schreibe ‚postwendend‘, wie der alte Acht bei Papa immer sagte, und bemühe Dich, so vollkommen zu werden, wie es einer Person angemessen ist, welche die Ehre hat, Freundin genannt zu werden von
Postsciptum (NB. Jedes vernünftige Mädchen in der Welt macht ein Postscriptum). Ingeborg Elbe hat mir mehrmals geschrieben. Ich freue mich diebisch, sie in Trollheide aufzusuchen. – Direktor Tromholt ist augenblicklich in Island, hat in Kopenhagen ein großartiges Exportgeschäft angefangen.“ –
Was Dina Ericius in dem vorstehenden Briefe ihrer Freundin gemeldet hatte, bestätigte sich, und auch ihre Voraussetzung traf zu, daß die Familie nach Snarre gehen werde. Mitte August, vierzehn Tage nach der Rückkehr von Föhr, befanden sich alle drei auf dem Gute des gastlichen Grafen.
An demselben Tag war in Limforden ein Brief von Richard Tromholt aus Kopenhagen eingelaufen. Während sich Herr von Alten und seine junge Frau noch über dessen im allgemeinen erfreulichen Inhalt unterhielten, traf der alte Peter Elbe schier athemlos und in größter Erregung mit der Nachricht bei ihnen ein, daß seine Tochter Ingeborg seit gestern von Trollheide verschwunden und trotz aller Nachforschung weder dort, noch in der näheren Umgebung zu finden sei. Seine letzte Hoffnung sei gewesen, dieselbe möge nach Limforden geflohen sein, da sie schon seit einiger Zeit durch die Nachricht von Larsens Rückkehr in große Angst versetzt wäre. Nun aber könne er nur einen neuen Gewaltstreich des Kapitäns als die Ursache ihres plötzlichen Verschwindens vermuthen, zumal dieser, wie er, Peter Elbe, erfahren, geschworen habe, sich an dem Mädchen rächen zu wollen. Alten war selbst tief bestürzt, da ihm sein Schwager vor seiner Abreise das Wohl des Mädchens noch ganz besonders ans Herz gelegt hatte, aber er verbarg die eigene Sorge, um den Alten, den Schmerz und Angst ohnehin ganz kopflos gemacht hatten, nicht noch mehr aus der Fassung zu bringen. Vielmehr sprach er ihm Muth zu, und beide machten sich sofort auf den Weg, um mit Hilfe der Behörden die Spur der Vermißten weiter zu verfolgen.
Die Ursachen dieses rätselhaften Verschwindens waren folgende:
Ingeborg wußte seit acht Tagen, daß Larsen wieder in Kiel sei. Eine beständige Unruhe quälte sie seitdem, das unheimliche Gefühl einer ihr drohenden Gefahr. Bis dahin jedoch war alles ruhig geblieben. Da, während die Arbeiter und auch ihr Vater draußen in den Mooren beschäftigt waren und sie selbst in ihrem Stübchen an dem auf den Garten gehenden Fenster saß, hörte sie plötzlich drunten eine flehende Stimme: „Ingeborg!“ Er war es, der unter den Bäumen stand, aber ehe er noch ein weiteres Wort sagen konnte, hatte sie, von namenlosem Entsetzen erfaßt, das Fenster zugeschlagen, die Hausthür verriegelt und sich auf den obersten Boden des Hauses geflüchtet, von wo sie durch eine Dachluke den weiteren Unternehmungen des Kapitäns mit steigender Angst zusah.
Larsen, der vergeblich an der Thür gerüttelt und seinen Ruf erst demüthig flehend, dann immer zorniger wiederholt hatte, schlug zuletzt das Fenster ein. „Nun, kommst Du?“ rief er nochmals, „oder soll ich zu Dir kommen?“
Sie sah sich verloren, in seiner Gewalt, wenn er sein Vorhaben durchsetzte. Nur eine Rettung noch gab es für sie. „Nun gut; ich komme,“ rief sie hinunter, und dann blitzschnell die Treppe hinabeilend, öffnete sie eines der nach dem Hof gehenden Fenster, schwang sich hinaus, erreichte glücklich den Boden und eilte nun mit Sturmeseile dem Hauptgebäude des Gutes und, als auch dort alles öd und verlassen war, weiter durchs Thor, auf dem Fahrweg den Mooren zu. Gott sei Dank, da stand ein Wagen!
„Retten Sie mich!“ schrie Ingeborg, auf den Fuhrmann zustürzend.
„Guten Abend, Fräulein Elbe! Wohin denn so eilig?“ hub dieser an. Es war kein anderer als der rothe Jeppe, den man eben, da ihm die Brandstiftung schließlich doch nicht sicher nachzuweisen gewesen war, aus längerer Untersuchungshaft entlassen hatte.
Während er sprach, reichte er ihr scheinbar gutmüthig die Hand hin, in die sie vertrauend und nur auf ihre Rettung bedacht einschlug.
„Fahren Sie mich nach den Mooren!“ hauchte sie, „aber schnell, ehe – –“ In diesem Augenblick stürzte jedoch Larsen, durch einen Pfiff Jeppes aufmerksam gemacht, herbei. „Halte sie nur fest, Jeppe!“ schrie er schon von fern. Ingeborg sah zu spät, daß sie in eine Falle gerathen war; ein sehr ungleiches Ringen begann, denn der Mann war stärker als sie und umspannte mit eisernem Griff ihre Handknöchel.
„Nur ruhig!“ höhnte Jeppe, als sie verzweifelt um Hilfe schrie, „das Schreien nützt Ihnen nichts!“ Und im nächsten Augenblick hatte ihr Larsen ein Tuch um den Mund gebunden und ihre Hände geknebelt. Nun schleppte er die völlig Wehrlose in den Wagen hinein, Jeppe sprang auf den Bock, und davon ging’s in sausendem Galopp.
Ueber die Moorheide goß eben die Abendsonne ihre letzten Strahlen und gab der Gegend ein tief melancholisches Gepräge. Aus einem Wiesensumpf am Wege ertönte das Quaken der Frösche, dazwischen ein heimliches Zirpen kleiner in dem Grase und Moose verborgener Geschöpfe. Leichte Dämmerung lag wie ein zarter Nebelrauch zwischen dem silbernen Monde und der schlummernden Erde. Der stille Friede der Natur stand in seltsamem Gegensatz zu dem in rasender Hast dahinrollenden Fuhrwerk und den von Angst oder Leidenschaft bewegten Herzen seiner Insassen.
Nachdem sie eine Stunde gefahren waren, ließ Larsen halten, löste das Tuch, das er um Ingeborgs Mund geschlungen hatte, und redete auf sie ein.
„In kurzer Zeit sind wir am Heidekrug,“ hub er an. „Wir kehren dort ein und ich will mit Dir reden ohne Zeugen. – Ich habe nur zwei Fragen an Dich, und hast Du sie beantwortet, gebe ich Dich frei. Vorher aber verpfände mir Dein Wort, daß Du niemand mittheilen wirst, was geschehen ist, weder denen im Wirthshaus, noch Deinem Anhang in Trollheide.“
Ingeborg lag da mit ihren großen, schmerzbewegten Augen wie ein Schlachtopfer. Am liebsten hätte sie dem Menschen, der es nun zum zweiten Male gewagt hatte, sie wie ein Thier zu knebeln, ein Messer in die Brust gestoßen. Sie haßte ihn mit der ganzen Kraft ihrer Seele, aber sie setzte die Klugheit über ihr heißdrängendes Blut und sagte mit finsterem Blick:
„Schwören Sie mir, daß Sie Ihr Wort halten – dann will ich thun, was Sie fordern.“
Ich halte mein Wort, eines Schwurs bedarf es nicht. So, ich löse Dir die Hände. Setze Dich zu mir auf den Sitz und gieb [555] Dir das Ansehen, als reisten wir als gute Kameraden!“ Und weich fügte er hinzu: „Ich bitte Dich, Ingeborg, thu’, wie ich Dir sage, und vertraue mir! Du sollst Dich nicht in mir täuschen!“
Ingeborg hatte von dem Augenblick an, da ihre Bande gelöst waren, nur den einen Gedanken – Flucht! – Sie wußte, was sie von Larsens Versprechungen zu halten hatte, und daß auch bei den Bewohnern des einsamen Heidekrugs, selbst wenn es ihr gelang, sich diesen heimlich anzuvertrauen, auf Hilfe schwerlich zu rechnen war. In ihr aber stand es fest, daß sie lieber sterben als sich der rohen Gewalt Larsens fügen wollte. Sie suchte seine Wachsamkeit zu täuschen, indem sie scheinbar seinen Worten Vertrauen schenkte und auf seine Vorschläge einging. Wie er sich nun aber während des Weiterfahrens zu dem kutschirenden Jeppe vorbeugte, um ihn zu einer Beschleunigung der bisher eingehaltenen Gangart der Rosse zu veranlassen, benutzte sie diesen Augenblick, um sich mit tollkühnem Sprung von dem Fuhrwerk herabzuschwingen. Sie stürzte zu Boden, raffte sich auf, und noch ehe Jeppe die Pferde zügeln und der wild emporschnellende Kapitän abspringen konnte, war sie schon in dem dichten Nebel, der jetzt weithin die Heide bedeckte, verschwunden.
Nur eine kurze Strecke war ihr Larsen nachgeeilt, dann stand er, die völlige Aussichtslosigkeit weiterer Verfolgung einsehend, still, ballte die Faust und schrie ihr nach in den wogenden Nebel: „Das bezahlst Du mir, Ingeborg Elbe! Ein drittes Mal sollst Du mir nicht entwischen!“
Dann kehrte er bebend vor Wuth zu Jeppe zurück und fuhr mit ihm nach dem Heidekrug. In seiner maßlosen Erregung überhäufte er den Dänen mit Vorwürfen und Beschuldigungen, und darüber geriethen die beiden Spießgesellen in einen heftigen Streit, von dessen Lärm noch lange die Wände des einsamen Gehöfts widerhallten.
Inzwischen rannte Ingeborg wie ein gehetztes Wild über die Heide; erst ziel- und planlos, dann, wie sie glaubte, die Richtung nach Trollheide einschlagend.
Freilich ängstigte es sie, daß plötzlich der Mond verschwand, der Abend gleich einem dunklen Leichentuch herniedersank und bald nur noch der Instinkt ihre Schritte lenken mußte. Sie hoffte, in kurzer Zeit einen Landweg zu erreichen, der nach Trollheide führte, und wenn sie zu diesem gelangte, war alles gut.
Aber während sie nun dahinflog, sank plötzlich ihr Fuß tief in den Erdboden. Sie war auf einen Streifen sogenannten wandernden Moorlandes gerathen. Sie zog den Fuß mühsam wieder heraus, änderte die Richtung, wollte zurück, aber immer weicher wurde unter ihren Füßen der Grund, und plötzlich sank sie tief bis an die Hüften in die tückische schwarze Erde.
Ein Schrei wahnsinniger Angst drang durch die Nacht, ein so furchtbarer Schrei, daß zwei in der Nähe hockende Krähen mit lautem Gekrächze aufflogen.
Ingeborgs Bemühungen, sich wieder herauszuarbeiten, ließen sie nur immer tiefer einsinken. So blieb ihr, als sie endlich doch auf etwas Festes stieß – es mochte wohl der Stumpf einer alten, im Moor begrabenen Eiche sein – nichts übrig, als regungslos auf dem so gewonnenen Stützpunkt zu verharren, mit der schwachen Hoffnung, daß der Zufall ihr eine Hilfe schicke.
Und der Abend senkte sich immer tiefer herab, die Nacht kam; kühle Luft umwehte ihre Stirn; auf ihre Brust drückte die schwere Moorerde wie Centnerlast, und ihr über alle Maßen erregtes Gehirn schuf ihr die entsetzlichsten Vorstellungen. Im Moor versunken! Vielleicht nach langen, langen Stunden Erlösung! Aber auch eben nur vielleicht! Hier wohnten keine Menschen, ihr Ruf verhallte in der Oede. – Und dann blitzte doch wieder ein Schein von Hoffnung in ihr auf. – War sie nicht eben noch auf festem Grunde gewesen, war nicht plötzlich die Erde gewichen? Würde sie nicht, durch das helle Tageslicht unterstützt, die Möglichkeit gewinnen, sich aus dem fürchterlichen Zustande zu befreien?
Aber konnte sie die Nacht überleben? Bisweilen war’s ihr schon, als ob die Lunge den Dienst versagte, und ein Gefühl von Schwere hatte sich ihrer Glieder bemächtigt, als sei Blei hineingegossen. Ja, das Schicksal war gegen sie! Es wollte ihr Verderben!
Die Unglückliche erhob die Augen zum Himmel. Der Mond lag noch immer hinter den aufgestiegenen Wolken versteckt, und nur hier und dort schimmerte ein Stern, gleichsam furchtsam, aus dem Dunkel hervor. Ein scharfer, modriger Geruch peinigte das gequälte Weib; eine grenzenlose Abspannung ohne Schlaf bemächtigte sich ihrer – und nun – nun fuhr gar ein harter, rauher Stoßwind daher und schnob und pfiff über Heide und Moor. – Es rasselte und stöhnte in der Luft, als ob böse Geister losgelassen wären.
„Barmherziger Gott! Erbarme dich meiner!“ Ingeborg schrie’s durch Wind und Sturm und wußte doch, daß keine Wunder mehr geschehen. Und durch ihr Gehirn zog alles in raschem bunten Wechsel. Das Bild ihres Vaters stieg vor ihr auf – Larsen – Ericius – ihre verstorbene Tante, viele Einzelheiten ihres Lebens – zuletzt Tromholt. Gewiß, wenn er auf Limforden geblieben wäre, der Schurke hätte nicht gewagt, sich ihr zu nahen. – Tromholt, Tromholt! Er würde sicher herbeieilen, wenn er wüßte, daß sie hier unter entsetzlichen Qualen dem Tode verfiel. – Ja – Tod! Hu – hu – – Nun fegte der Wind wieder und löste ihr Haar und wirbelte Staub auf, der in ihre Augen flog. Und die Arme waren gefangen, und wenn sie sie hervorzog, war’s ihr, als ob sie tief und tiefer sinke. – Zuletzt verlor sie die Besinnung, während über ihr in der Luft abermals die unheimlichen schwarzen Vögel krächzten. –
In Snarre saßen die Herrschaften beim Abendessen. Der Graf hatte es an nichts fehlen lassen, seinen Gästen den Aufenthalt möglichst angenehm zu machen, und die Gräfin Snarre, eine alte Dame von vornehmem Aussehen, mit dunklen Augen und weißem, unter einem schwarzseidenen Spitzentuch, das sie stets trug, silbern hervorschimmerndem Haar, unterstützte ihn dabei in liebenswürdigster Weise. Zwischen ihr und Frau Ericius fanden sich manche Berührungspunkte aus früherer Zeit, die den Verkehr zwischen ihnen besonders lebhaft machten; Dina gab sich der Freude hin, das Landleben, für welches sie immer geschwärmt hatte, endlich in vollen Zügen genießen zu dürfen, und nur Susannens Wesen war in dem Jahr, das seit ihrer Trennung von Graf Utzlar vergangen war, womöglich noch ernster und gemessener geworden. Graf Snarre mußte sich zu seiner großen Enttäuschung überzeugen, daß sie seinen zärtlichen Bemühungen, sie aufzuheitern, nur ein zerstreutes Ohr lieh, oft in plötzliche Träumerei versank und bei aller Höflichkeit, die sie ihm als Gast schuldig war, die Unterhaltung der beiden älteren Damen der seinigen vorzuziehen schien. Diese Wahrnehmung verstimmte ihn um so mehr, als er gerade auf Susannens Anwesenheit in Snarre all seine Hoffnung gesetzt hatte. Eine um so aufmerksamere Zuhörerin fand er an Dina, die auf seine Neckereien und Vergnügungsvorschläge bereitwillig einging und verständnißvoll bemüht war, das einsilbige Wesen der Schwester durch ihre lustige Plauderhaftigkeit wieder gutzumachen. Ihr gelang es auch wirklich, den Mißmuth, der sich Snarres bemächtigen wollte, zu dessen eigenster Ueberraschung in kurzer Zeit zu bannen; ihr drolliges Wesen belustigte ihn ungemein, so daß er darüber Susannens Zurückhaltung mehr und mehr vergaß und sich ganz dem Zauber des sonnigen Humors ihrer Schwester hingab.
Eben da die Unterhaltung in lebhaften Fluß kam, wurde Alten gemeldet. Nachdem alles Nachforschen nach Ingeborg auf Limforden vergeblich geblieben, war er nach Snarre hinübergeritten, hatte aber schon auf dem Gutshof zu seiner Enttäuschung erfahren, daß Ingeborg auch hier, wie er bei ihrem freundschaftlichen Verhältniß zu Dina einen Augenblick gehofft hatte, nicht anwesend sei.
Die Nachricht von dem Verschwinden des Mädchens erregte natürlich auch in diesem Kreis die allgemeinste Bestürzung. Graf Snarre war bereit, die zu Ingeborgs Wiederauffindung zu unternehmenden Schritte aufs wirksamste zu unterstützen, ja, auf Dinas inständige Bitte entschloß er sich sogar, selbst mit den Suchenden aufzubrechen, um der Freundin womöglich heute noch eine beruhigende Nachricht über das Los Ingeborgs zu bringen.
„Ich werde kein Auge zuthun, bis Sie zurück sind, Herr Graf!“ rief sie ihm noch nach, als er mit Alten und Elbe, die ihre todmüden Pferde hier zurückließen, den eigenen Wagen bestieg und in die Nacht hinausfuhr. Sie hatten beschlossen, zunächst nach Trollheide und von da nach Mückern zu fahren, um zu sehen, ob an einem dieser beiden Orte nicht inzwischen eine Kunde von der Verschwundenen eingetroffen sei, die ihren ferneren Nachforschungen die Richtung wies. Aber schon in Trollheide erfuhren sie, daß der Doktor von Mückern gleich nach Elbes Fortgang angefahren sei und die Nachricht gebracht habe, daß das Mädchen schwerkrank im Heidekrug liege, wohin man denn auch auf seine Anordnung das nöthige Bettzeug geschickt habe. Als er am Morgen, so habe der Doktor erzählt, sehr früh von [556] Foßwinkel, wo er die Frau des Amtsvorstehers entbunden habe, nach Mückern zurückgefahren sei, habe er schon aus den Moorstrichen verzweifelte Schreie wie von einem Sterbenden gehört; darauf sei er mit seinem Knecht sofort der Stelle zugeeilt, habe aber bei dem tiefen Nebel und da jetzt plötzlich alles wieder ganz still geworden, nicht gleich finden können, was es sei, und sei erst nach längerem Suchen auf Ingeborg Elbe gestoßen, die bis unter die Arme im Morast gesteckt und kein Zeichen von Leben mehr gegeben habe. Die Arbeit, sie aus dieser Lage zu befreien, sei keine leichte gewesen, endlich sei es ihnen aber doch mit eigener Lebensgefahr gelungen; sie hätten dann Ingeborg auf den Wagen getragen und nach dem zunächst gelegenen Heidekrug gebracht, wo sie unter der Pflege der Wirthsleute im heftigsten Fieber liege, demnach auch über die Art, wie sie in solche Gefahr gerathen, nicht die mindeste verständliche Angabe machen könne. Doch sei aus ihren Fieberphantasien zu schließen, daß Larsen und der rothe Jeppe, den man wieder habe laufen lassen, die Hand dabei mit im Spiel gehabt haben, und es sei dies um so wahrscheinlicher, als die beiden am Abend vorher mit einem Wagen ganz erhitzt im Heidekrug angekommen, dort in Streit gerathen und spät in der Nacht wieder abgefahren seien.
Im übrigen habe der Doktor gemeint, das starke Mädchen werde sich von dem Anfall schon wieder erholen, man möge sie nur ruhig drüben lassen, ihr das Nöthige, das er selbst mitnehmen wolle, hinüberschicken und abwarten, bis ihr Zustand die Ueberführung nach Trollheide gestatte.
Mit diesem Trost kehrte Snarre zurück, während der alte Elbe es sich nicht nehmen ließ, sofort nach dem Heidekrug zu seinem kranken Kinde zu eilen. Herr von Alten begleitete ihn dorthin, nachdem er Bianca entsprechende Botschaft gesandt hatte.
| * | * | |||
| * |
Es war dunkle Nacht. Draußen am Himmel schoß gedankenschnell eine Sternschnuppe durch die unendlichen Räume. Auf den Feldern und Wiesen und Mooren lag’s wie unheimliches Grauen; die Ruhe der Natur hatte etwas Furchterregendes, als müßte plötzlich alles sich verwandeln, die Stille tobender Gewalt weichen, der Himmel sich verfinstern, die Sterne verschwinden und der Sturm hereinbrechen über die von zitternden Ahnungsschauern ergriffene Erde.
Bisweilen nahm wirklich der Wind einen stoßweisen Ansatz, verfing sich mit unheimlichem Rauschen in den Weiden am Uferrand der Moorlachen und stürmte durch die kahlen, gespensterhaft um das Heidewirthshaus aufragenden Bäume. Und wenn er wieder innehielt, ging’s erst wie leises Beben durch die Natur, und dann war’s, als ob sie zuckend den Athem anhielte, das Entsetzliche, das noch kommen werde, erwartend.
Zuletzt brach’s wirklich los. – Ein Gewitter entlud sich, erhellte meilenweit die Gegend mit seinen Blitzen, und in dem fahlen, elektrischen Lichte glichen die Regenfäden einer straff gespannten Riesenharfe.
Die Fluth nistete sich ein in die Felder und Moore, füllte die Tümpel und Ausstichseen und knickte die letzten Halme auf der nackten, armseligen Flur.
Drinnen im Heidewirthshaus aber lag in einem Hinterzimmer Ingeborg Elbe und schrie wie von Furien gepeinigt durch die Nacht, wollte aus dem Bett und zurück in das Moorgrab, aus dem sie wie durch ein Wunder errettet worden war.
Die Wirthin, eine hagere Frau mit strohgelbem Haar, großen wasserblauen, dummen, aber guten Augen und langen, mageren, knochigen Händen, saß, vom Wachen erschöpft, neben der Kranken und rührte sich auch dann kaum, wenn jene ihre Fieberphantasien laut austobte. Sie war müde zum Umfallen, und nach Art dieser Leute nahm sie das Schreckliche eben nur als etwas Unabänderliches, und ihre Gedanken gingen mehr auf ein „sanftes Ende“ als auf Genesung.
„So wat fleit up de Nerfen un grippt an’t Hart“, hatte ihr Mann gesagt, der auf der anderen Seite des Hauses in einem kleinen, viereckigen, kahlen Raume mit kleinen Fenstern ohne Vorhänge sich niedergelegt hatte. Er schlief, als gäbe es weder Unwetter draußen, noch einer Sterbenden Wehruf in seiner Kate.
Endlich schlummerte auch die Frau ein. Wie durch Bleigewichte herabgezogen, sanken ihre Lider; sie würde diesem Naturtrieb erlegen sein, selbst wenn Kanonen draußen ihre Schlünde geöffnet hätten.
In ihrem Bett jedoch richtete sich Ingeborg Elbe auf, suchte ihre Gedanken zu sammeln und schaute mit irren Augen um sich.
Und da öffnete sich die Thür und es erschien Larsen mit seinem furchtbaren Gesicht, – und als sie unter dem Leuchten des Blitzes entsetzt den Blick fortwandte, stieg er neben ihrem Bett aus dem Fußboden empor, streckte die Arme aus und suchte sie zu würgen. Und da schrie die Fieberkranke so fürchterlich auf, daß die Bäuerin wieder erwachte.
Nun erhob sich das Weib, drückte mit ausdruckslosem Gesicht die Kranke tief in die Kissen, ging in die Küche, holte Wasser und benetzte der Fiebernden Stirn, Wangen und Schläfen. Auch feuchtete sie ein Handtuch an und legte es der Stöhnenden in den Nacken. Und nachdem dies geschehen, trat sie ans Fenster und spähte hinaus, bis ein jäher Blitz, der das Gemach erhellte, die mit einem unwillkürlichen Schreckensruf Zusammenfahrende zurücktrieb. Es brüllte der Donner und heulte der Sturm und dem Weibe schauderte es; sie schob den Stuhl hinter das Bett der Kranken, dehnte die Glieder, gähnte, zog ein Tuch dicht über Kopf und Augen und schlief von neuem ein. –
Alten und Peter Elbe hatten Mühe, sich Einlaß in das einsame Gehöft zu verschaffen, denn die Wirthsleute waren mißtrauisch, und erst nachdem sie sich genau über die Personen der späten Ankömmlinge vergewissert hatten, öffneten sie ihnen das Thor. Ingeborg war jetzt etwas ruhiger geworden, und Alten ließ Peter Elbe, der von Schmerz überwältigt an dem Lager seiner Tochter lautlos zusammengesunken war, bei ihr und fuhr, nachdem er noch befohlen hatte, daß der Arzt von Mückern ihm morgen in Limforden selbst näheren Bericht über den Zustand der Kranken erstatte, etwas beruhigter nach dem Gute zurück, wo Bianca in großer Angst seiner harrte.
Am kommenden Tage fand sich auch der Doktor dort ein und erzählte ausführlich, wie und wo er Ingeborg gefunden habe. Bianca wohnte diesem Gespräch bei, und als der Arzt, ein Mann, der, unter dem Seevolk aufgewachsen, auch das Aussehen eines Seemannes besaß und durch auffallend blondes Kopf- und Barthaar und hellblaue Augen den Bewohner des Nordens verrieth, geendigt hatte, erbot sie sich sogleich, selbst nach dem Heidewirthshaus zu fahren und nach Ingeborg zu sehen.
Diesem Vorschlag stimmte der Doktor, in aufrichtiger Sorge um die Kranke, lebhaft zu und empfahl sich mit dem Versprechen, jeden anderen Tag nach der Leidenden zu sehen.
Zum Glücke erwiesen sich seine weiteren Besuche bald als überflüssig. Nach wenigen Tagen schon hatte die Kranke sich unter Biancas Pflege soweit erholt, daß sie nach Trollheide gefahren werden konnte, wo ihre Besserung rasche Fortschritte machte.
Die Nachrichten, die über Ingeborgs Befinden einliefen, wirkten sichtlich erheiternd auf die Stimmung in Schloß Snarre. Namentlich gewann Dina, welcher der Kummer um die Freundin am nächsten gegangen war, rasch ihren früheren Frohsinn wieder und wurde nicht müde, des Grafen Kavalierdienste in Anspruch zu nehmen.
Das Leben, das Graf Snarre seinen Gästen bereitete, war das denkbar angenehmste. Morgens richtete sich jeder nach seiner Bequemlichkeit ein und nahm das erste Frühstück in seinem Zimmer. Das zweite aber fand an gemeinsamer Tafel statt, und bei dieser Gelegenheit wurden die Pläne des Tages besprochen.
Um das Mißverhältniß in der Anzahl von Herren und Damen auszugleichen, lud Graf Snarre Bekannte aus der Umgegend zu mehrtägigem Besuch ein, sorgte für stete Abwechselung und hielt namentlich darauf, daß sich abends fast immer ein gewählter Kreis zusammenfand. Um zwölf Uhr morgens ward das zweite Frühstück, um halb fünf Uhr das Mittagessen aufgetragen; um neun Uhr folgte Thee und ein Nachtmahl, und vor zwölf Uhr ging man selten zur Ruhe. Niemals aber übte Graf Snarre Zwang auf seine Gäste aus. Wollte der eine oder andere sich ausschließen, so war ihm dies durchaus freigestellt, und es kam auch einigemale vor, daß die alte Gräfin und Frau Ericius abends nicht mehr erschienen.
Dina konnte sich kein größeres, kein „himmlischeres“ Vergnügen denken, als vormittags auszureiten. Wenn sie die gesattelten und den Erdboden mit den Hufen scharrenden Pferde vor dem Schloß erblickte, klopfte ihr das Herz, und wenn gar Graf Snarre sich ihr anschloß oder sie ein bißchen „pachtete“, wie sie sich ausdrückte, war sie überglücklich. Es kam ihr trotzdem gar nicht in den Sinn, daß sie irgend einen Eindruck auf ihn machen könnte, da ihre schöne, kluge Schwester auf der Welt war. Aber warum sollte nicht von den Huldigungen, die jener zugedacht waren und von ihr – Dina ahnte wohl, warum – verschmäht wurden, ein Stückchen für sie abfallen!
[557] [558]
An einem Vormittag der zweiten Woche nach dem Eintreffen der Familie Ericius machte sich Alten, um geschäftliche Angelegenheiten mit dem Grafen zu ordnen, nach Snarre auf den Weg. Seine Frau sollte auf des letzteren Wunsch später nachfolgen. Es waren Anfragen wegen sehr bedeutender Bretterlieferungen aus Hamburg eingegangen, und ein Zwischenhändler wünschte in Anbetracht des ungewöhnlich großen Postens eine Ermäßigung des angesetzten Preises. Auch hatte ein Geschäftsmann in Fünen wegen Lieferung von einigen Millionen Trollheider Torf angefragt, und es schien vielleicht erforderlich, mit diesem persönlich zu verhandeln.
Graf Snarre, der einen stark ausgeprägten Erwerbssinn besaß, nahm dergleichen Meldungen stets mit sehr willigem Ohr auf.
Als Alten auf den Schloßhof von Snarre fuhr, sah er vor der Schloßtreppe zwei gesattelte Reitpferde, die der Stallknecht langsam auf und ab führte, und nun eben trat Graf Snarre mit Dina Ericius aus der Halle heraus.
„Ah, lieber Direktor!“ rief der Graf freundlich, als er Altens ansichtig wurde. „Ich hole Ihre Verzeihung ein, daß ich gegen unsere Abrede nicht gleich zu Ihrer Verfügung sein kann. Bitte, machen Sie sich’s in der Bibliothek bequem, Morten wird Frühstuck auftragen – gestatten Sie, daß ich nach der Rückkehr mit Ihnen über unsere Geschäfte plaudere. Ich muß“ – dieses Wort betonte Snarre und sah lächelnd auf Dina, die mit erwartungsvollen Augen dastand – „mit Fräulein Ericius nach der Kegler Höhe reiten. Sie will’s, sie hat’s befohlen, und da ist nichts, nichts zu machen!“
Mit einem schelmischen Seitenblick belohnte das junge Mädchen Snarres artige Rede, auf welche Alten mit einem ehrerbietigen: „Ich bitte gehorsamst, Herr Graf,“ erwiderte. Und nun fügte auch Dina eine von einem warmen Händedruck begleitete Entschuldigung wegen der durch sie hervorgerufenen Aenderung der Abrede hinzu.
Als jene fortgeritten waren, erfuhr Alten von Morten, daß Susanne wegen einer Unpäßlichkeit das Zimmer hüten müsse, und daß sie am heutigen Tage vielleicht überhaupt nicht erscheinen werde.
Inzwischen trabten Graf Snarre und Dina über den guterhaltenen Landweg ihrem Ziele zu. Das Mädchen sah mit ihren gesunden Farben reizend aus. Die Freude an dem Ausflug strahlte aus ihren Augen und Mienen, und je schärfer die Thiere ausholten, desto größeres Vergnügen legte sie an den Tag.
„Ah!“ rief sie. „Reiten, Reiten ist himmlisch! – Ich möchte schon deshalb immer auf dem Lande leben!“
Bei diesen Worten ging ein lebensprühender Athem aus ihrem Munde, und ihre leichten, elastischen Bewegungen verriethen die Gesundheit ihres Körpers und die unverdorbene Fröhlichkeit ihrer Seele.
Snarre sah auf seine vergnügte Nachbarin und fühlte sich in besonderer Weise von ihr angezogen. Und weil er das Bedürfniß fühlte, ein längeres Gespräch zu beginnen, schlug er vor, das Tempo zu mäßigen und die bereits warm gewordenen Thiere im Schritt gehen zu lassen.
„Sie würden aber doch mancherlei entbehren –“ begann er, an das früher Gesagte anknüpfend – „wenn Sie den Aufenthalt in der Stadt gegen das Land vertauschten. Rechte Abwechselung kann nur jener bieten, und ich denke mir, daß eben Sie sich nicht in einem einförmigen und geräuschlosen Leben glücklich fühlen würden.“
„Doch – wenn ich liebe Menschen um mich hätte, wäre mir jeder Ort recht. Nur einigen kleinen Liebhabereien vermag ich nicht zu entsagen; die kann ich nicht entbehren. Ich liebe leidenschaftlich Hunde, Apfelsinen und, recht lange in einem weichen, warmen Bette zu schlafen.“
Snarre lachte über diese sonderbare Zusammenstellung laut auf, aber dies Durcheinander und die kindliche Art, in der es vorgebracht wurde, machten ihm außerordentliches Vergnügen.
„So? Also das würde genügen?“ forschte er neckend. „Welche Hunderasse, wenn ich bitten darf – und welche Apfelsinen?“
„Ich schwärme für Teckel – und die Apfelsinen müssen in Messina, gleich links auf dem Berge der Glückseligen, gewachsen sein.“
„Hm! –“ machte Snarre, sichtlich belustigt. „Und wie müßten die Menschen aussehen? Welche Eigenschaften wären an ihnen erforderlich?“
„Natürlich müssen sie,“ ging’s rasch aus Dinas Munde, „in erster Linie gut und lustig sein und, wenn möglich, auch hübsch. Ich kann mir nicht helfen: für häßliche Menschen vermag ich mich nun einmal nicht zu begeistern.“
„Da werden Sie also Ihre Frau Schwester sehr lieb haben?“
„Ja –! Nicht wahr, sie ist sehr hübsch, die verflossene Utzlar?“ platzte Dina drollig heraus.
„Wie Sie das sagen! Ich sehe schon, daß Ihnen sehr viele Kobolde im Nacken sitzen. Man muß sich vor Ihrem Spott hüten!“
„Nein!“ entgegnete Dina treuherzig. „Ich mag niemand wehethun, und wenn ich einmal jemand liebhabe, wie zum Beispiel die arme Ingeborg Elbe, bringe ich ihm gern jedes Opfer.“ –
„Beneidenswert also, von Ihnen geliebt zu werden!“
Dina bewegte verlegen den Kopf und suchte mit der Reitgerte ihrem Fuchs eine Fliege zu verscheuchen. Dann sagte sie:
„Nein – ich glaube nicht, denn ich bin sehr anspruchsvoll. Ich gebe alles was ich zu geben vermag, aber ich verlange auch viel!“
„Eigentlich ganz in der Ordnung!“
„Ja, so sollte man meinen. Aber ich sah’s doch bei Susannen, wie schwer es ist, daß Menschen zusammenpassen. – Ich begreife nicht, daß sie Utzlar nicht schon früher durchgebrannt ist.“
Dies Wort befremdete Snarre, und doch fand er, daß es ganz zu Dina passe. In der Anwendung solcher burschikosen Redensarten, die sie auf den Bällen von den Studenten gehört haben mochte, lag noch etwas Unverdorbenes, das ihn anzog. Aber er sagte doch: „Das ist kein hübsches Wort, mit Verlaub, Fräulein Dina!“
„Ne! Ist’s auch nicht“ – gab sie kurz und harmlos zurück. „Mama schilt fortwährend, daß ich noch – wie sie sagt – so jungenhaft bin. Ich möchte manches gern abstreifen, aber ich habe so wenig Talent zu gewissen Tugenden. Danke übrigens, Herr Graf, daß Sie mich ein wenig erziehen! Von Ihnen mag ich’s gern hören.“
„Das ist ja eine große Schmeichelei für mich! Ich stand eigentlich unter dem Eindruck, daß Sie nur Ihrer Schwester zu liebe mit nach Snarre gekommen seien.“
Dina sah den Grafen mit großen Augen an. „Der verflossenen Utzlar zuliebe –?“ stieß sie dann mit spitzem Munde und mit ihren reizenden Schmolllippen heraus. „Ne – ich kam doch, weil – weil –“
„Nun?“
„Weil Sie uns alle in so liebenswürdiger Weise eingeladen haben und weil …“ Jetzt erröthete sie.
„Weil –?“ fragte Snarre eindringlich und im Augenblick ganz bezaubert von dem Wesen des Kindes.
Dina zuckte die Schultern und hielt die Augen gesenkt. Es stand darin: „Bitte, frage mich nicht!“
Nun ritten sie eine Weile stumm neben einander her. Aus dem Gebüsch der Wälle drängten sich die anmuthig geformten Blüthen des Geißblatts, und zahlreiche schon zur Härte ansetzende Haselnüsse kämpften sich auf den grünen Kelchen hervor. Ein Rothkehlchen saß auf einem schwankenden Zweige, und zwischen dem Laub haschten sich mit zankendem Zwitschern andere kleine Vögel.
Da der Weg eben eine Biegung machte, befanden sich Snarre und Dina hier gleichsam abgeschlossen von der Welt. Die hohen Knicke verhinderten einen freien Blick über die Gegend.
Jetzt hob Snarre wieder an und sagte: „Sie äußerten vorhin, daß Sie gute und lustige Menschen besonders lieben. Ich kenne zwei Personen, von denen ich weiß, daß Sie beiden sehr zugethan sind, und die doch sehr ernste Naturen sind. Also die fröhliche Laune muß nicht allein den Ausschlag geben!?“
„Nun, und wen, Herr Graf?“
„Tromholt und Ingeborg Elbe.“ –
„Ja, Sie haben recht. Aber eben diese Eigenschaft entbehre ich auch an ihnen. Freilich –“
„Freilich?“
„Beide haben Ursache, ernst zu sein. Wenn die Verhältnisse anders liegen würden, wären sie auch gewiß lebensfroher. Tromholt liebte meine Schwester, und sie ließ ihn ablaufen – ah, da brauche ich wieder einmal einen so häßlichen Ausdruck; verzeihen Sie! – und Ingeborg Elbe – na, bei der ist’s doch auch etwas mit dem Herzen. Der Larsen muß ein gräßlicher Mensch sein!“
Snarre, der absichtlich dem Gespräch diese Wendung gegeben hatte, hörte die ersten, aber kaum die letzten Worte, nickte mit dem Kopfe und sagte dann, gleichsam nur um etwas zu erwidern:
„Und Ihre Schwester hat ihre Ablehnung nie bereut – glauben Sie?“
[559] „Ja, ich weiß nicht; ich werde aus Susanne nicht recht klug,“ gab Dina treuherzig zurück. „Neuerdings“ – nun stockte sie, da sie sich der Bedeutung ihrer Worte bewußt wurde – „neuerdings kommt’s mir so vor, als ob sie – ob, sie –“ Und dann fügte sie mit fast kindlicher Auflehnung hinzu: „Ach, das kann ich Ihnen ja nicht so sagen.“
„Weshalb nicht, da mich doch alles, was die Ihrigen betrifft, sehr lebhaft berührt, Fräulein Dina?“
„Nun ja – ich meine – ich glaube, daß Susanne jetzt bereut, daß sie Tromholt nicht geheirathet hat, daß sie ihn – jetzt – obgleich –“
„Sie wollen mir nicht alles sagen?“ forschte Snarre und griff, da in diesem Augenblick zufällig Dinas Fuchs mit den Vorderbeinen stolperte und den Staub der Landstraße hoch aufwirbelte, dem Pferde mit rascher Bewegung in den Zügel.
Aber durch diesen Zwischenfall ward das Gespräch unterbrochen, und es fand sich später keine rechte Gelegenheit, es wieder auf das Gebiet vertraulicher Eröffnungen zurückzuführen.
Snarre aber sah bestätigt, was er gefürchtet hatte: Susanne war mit ihren Gedanken bei Tromholt, und er hatte nichts von ihr zu hoffen. –
Als Snarre und Dina auf das Gut zurückkehrten, wurde dem ersteren mitgetheilt, daß Frau von Alten schon eingetroffen sei und sich mit den übrigen Damen zu Susanne begeben habe, die Herren aber im Billardzimmer bei einer Partie beschäftigt seien.
Morten hatte jedoch noch etwas anderes mitzutheilen, und dies erregte den Grafen im höchsten Grade. Aus Trollheide war die Nachricht eingetroffen, daß der alte Elbe mit Larsen in Mückern zusammengetroffen sei, und daß zwischen ihnen ein Kampf auf Leben und Tod stattgefunden habe. Elbe liege schwer verwundet danieder, und sein Zustand gebe zur größten Besorgniß Veranlassung.
Snarre schüttelte mißmuthig den Kopf. Immer war etwas, jeden Tag! Seitdem er die Ericiusschen Besitzungen übernommen, hatte es kaum eine Woche gegeben, in der Alten nicht über Widerspenstigkeit oder Krankheit der Arbeiter, Beschädigung und dadurch hervorgerufenen zeitweiligen Stillstand der Maschinen, Ungelegenheiten bei den Frachtverladungen, geschäftliche Verdrießlichkeiten mit der Kundschaft oder sonstige Unliebsamkeiten zu berichten gehabt hatte.
Freilich, das war einmal nicht anders in großen Geschäftsbetrieben, aber Snarre stand doch bisweilen unter dem Eindruck, als ob er besser gethan hätte, sich auf die ganze Sache nicht einzulassen. Zudem wurden seine eigentlich und ursprünglich damit verbundenen Zwecke nicht erreicht!
Durch das Gespräch mit Dina war’s ihm nun beinah zur Gewißheit geworden, daß Susannens Liebe zu erwerben ein ganz vergebliches Bemühen sein werde.
So kam er denn in recht gedrückter Stimmung zu Tisch, die noch verschlimmert wurde, als sich Susanne auch für den übrigen Theil des Tages entschuldigen ließ. Die Fröhlichkeit in dem kleinen Kreise war künstlich, ja, es ruhte ein so ungemüthlicher Druck auf der Gesellschaft, daß Alten nach Tisch und nach Erledigung seiner Geschäfte mit dem Grafen Bianca beiseite zog und ihr zuflüsterte, sie möge ein Kopfweh vorschützen, damit sie sich entfernen könnten.
„Eine verdammt hochmüthige Art ist einmal diesen Hochgebornen eigen und von ihnen unzertrennlich –“ stieß er, seiner leichtbereiten scharfen Kritik nachgebend, heraus. „Snarre macht mich fast verantwortlich, daß der alte heißblütige Elbe Larsen an die Kehle gesprungen ist, auch benutzte er die Gelegenheit, sich über die ‚fortwährenden Verdrießlichkeiten‘, die ihm die Werke bereiteten, auszulassen. Wenn ich nicht auch gute Nachrichten in der Tasche gehabt hätte, würde er mir womöglich schon heute einen Vierspänner zur Verfügung gestellt haben, um anderweitig mein Glück zu versuchen.“
Aber Bianca redete ihrem leicht aufbrausenden Manne zu: „Ueberall ist etwas, Lieber! Beruhige Dich! Morgen wirst Du die Dinge in einem anderen Lichte ansehen, und wer weiß, was den Grafen beschäftigt! Vielleicht hängt’s mit Susanne zusammen! Ja, ich glaube es fast. – Denke also, Du seiest gar nicht gemeint, und nimm die Sache unpersönlich. – Im großen und ganzen mußt Du doch einräumen, daß der Graf in Anbetracht der Standesvorurtheile, in denen er aufgewachsen ist, ein unbefangen denkender und liebenswürdiger Mann ist. Er giebt sich, wie er ist, und hat niemals Hintergedanken.“
Aber Alten bestand doch auf seinem Willen. „Glaube mir, Bianca, es ist besser, wir gehen! Ich kenne den Grafen. Gerade, weil ihn möglicherweise diese Dinge beschäftigen, möchte er mit sich allein sein. Wenn wir gehen, ziehen sich die übrigen sicher schon vor dem Abendessen zurück, und das entspricht seinen Wünschen.“
Und so geschah’s denn, wie Alten wollte, und Graf Snarre machte auch nur äußerlich Einwendungen.
| * | * | |||
| * |
Zu Snarres Freude war Susanne schon am nächstfolgenden Tage wiederhergestellt und schien sogar an guter Laune gewonnen zu haben. Die nächste Zeit verlief in angenehmster Weise, und gegen Ende der Woche entsprachen Susanne und Dina auch einer Einladung Altens zu einem Besuch in Trollheide, wohin sich derselbe wegen der eingetretenen Vorkommnisse begeben hatte. Die Ericiusschen Damen kannten den Besitz eigentlich nur vom Hörensagen und waren sehr gespannt, das frühere Eigenthum ihres Vaters kennenzulernen. Dina ward noch von dem besonderen Wunsch geleitet, ihre arme, inzwischen aus dem Heidewirthshaus nach Trollheide hinübergeschaffte Freundin Ingeborg wiederzusehen. Deren Zustand war indessen noch immer derart, daß man ihr das in Mückern Vorgefallene hatte verheimlichen müssen.
Graf Snarre benutzte die Abwesenheit der jungen Damen, um selbst in die Umgegend zu fahren und eine Anzahl befreundeter Familien zu einem Balle einzuladen. Mit einem solchen wollte er Susanne und Dina überraschen. Er hatte deshalb auch den Wünschen seiner Gäste ein bereitwilliges Ohr geliehen, und es war die Abrede getroffen, daß die Rückkehr am Spätnachmittage des zweiten Tages erfolgen und der Graf die Damen aus Limforden abholen sollte.
Alles verlief nach Abrede. Mit einem Vierergespann fuhren Susanne und Dina morgens in der Frühe nach Limforden ab und machten sich, nach einem dort eingenommenen Frühstück, in Begleitung Biancas nach Trollheide auf den Weg.
Als sie durch die sonnenbeleuchtete Herbstlandschaft fuhren, wurden Biancas Erinnerungen an ihren Bruder sehr lebhaft; sie erzählte auch viel von ihm und dem damaligen Aufenthalt, und Susanne hörte ihrem Bericht mit größter Aufmerksamkeit zu. Neben dem Bedürfniß, über Richard zu sprechen, leitete Bianca heute einmal der Wunsch, den Eindruck ihrer Worte auf Susanne zu beobachten, und sie erreichte, was sie beabsichtigte.
Kurz vor Mittag und noch vor Ankunft der Damen in Trollheide trat eine unerträglich schwüle Luft ein. Am Himmel thürmten sich dunkle Wolkengebilde auf, und ein heißer Wind fuhr in kurzen Absätzen über die langgedehnten Moorstrecken.
Da Bianca einen stärkeren Regenniedergang fürchtete, hieß sie den Kutscher möglichst schnell fahren, und es gelang auch, Trollheide ohne Fährlichkeiten zu erreichen.
Alten stand bei ihrer Ankunft auf dem Hofe und schwenkte ein weißes Tuch:
„Willkommen, willkommen in Trollheide, meine sehr verehrten Damen!“ rief er fröhlich. „Ihr Erscheinen vertreibt mit einem Schlage alle Trübsal. Bitte, die Zimmer im Hause sind in stand gesetzt, und das Essen wird sogleich aufgetragen werden. – Der Himmel? Nein, der thut uns heute nichts, denke ich. Ich rechne sogar sehr darauf, daß wir am Nachmittage auf die Moore hinausfahren, und Fräulein Elbe – allerdings, es geht etwas besser, wenigstens so gut, daß sie für kurze Zeit Menschen sehen kann, – hofft sehr auf Ihren freundlichen Besuch.“
Nach dem Mittagessen begaben sich die Damen zunächst zu Ingeborg. Das Wiedersehen mit der Kranken, die matt und bleich im Lehnstuhl saß, war ein sehr bewegtes.
Dina ward durch das veränderte Aussehen der Freundin so ergriffen, daß ihr wiederholt Thränen in die Augen traten. Es schien, als sei das arme Mädchen völlig geknickt; von der schönen Ingeborg war nur der Schatten zurückgeblieben.
Noch immer stand Larsens Bild wie ein Schreckgespenst vor ihrer Seele, ja neuerdings trat es sogar zeitweise wie körperhaft vor ihr Auge, sodaß sie plötzlich laut aufschrie und nach Hilfe für sich und ihren Vater begehrte. Diese Anfälle schrieben sich von dem Tag ihres ersten auf Anraten des Arztes unternommenen Ausganges her. Nur wenige Schritte hatte sie ohne Begleitung im Garten gemacht, als sie bleich und zitternd zurückkehrte, [560] ohne indessen einen Grund für diese plötzliche Beunruhigung angeben zu können. Doch war sie seitdem durch kein Zureden mehr zu bewegen gewesen, das Haus zu verlassen, und ihre durch furchterregende Vorstellungen gehobene Seelenangst kehrte wieder, sobald sie allein war.
Daß Larsen sich jetzt noch in der Gegend befinde, hielten die Gutsleute, soviel sie auch sonst dem gewaltthätigen Kapitän zutrauten, einstimmig für eine Unmöglichkeit. Der rothe Jeppe war von den Gendarmen bald nach dem Anschlag auf Ingeborg gefaßt worden, hatte erst alles geleugnet, dann aber sich als das unschuldige Opfer von Larsens Verführung hingestellt und dessen Versteck in Mückern dem Gericht verrathen. Dort wäre dieser auch zweifellos festgenommen worden, hätte nicht des alten Brausekopfs Elbe eigenmächtiges Eingreifen die Vorsicht der Gendarmerie durchkreuzt und Larsen in dem Augenblick aus der Schlinge befreit, als sie sich eben um seinen Hals zusammenzuziehen drohte. Nun hatte aber Larsen auch den Alten, aus dessen noch immer kräftigen Fäusten er sich durch einen Messerstich gelöst, auf dem Gewissen, und die Strafe, die auf diese That stand, war eine weit schwerere, als er sie für sein erstes Verbrechen zu gewärtigen hatte. Seine Spur war seitdem verloren; zwar hatten die Behörden Beschlag auf sein Schiff gelegt und sein Signalement nach den benachbarten Hafenplätzen, wo er etwa fremden Dienst hätte suchen können, gesandt, aber trotzdem zweifelte niemand daran, daß es dem geriebenen Fuchs doch noch gelungen sei, sich ein Loch offen zu halten, und daß er jetzt wohl schon weit draußen auf hoher See schwimme, um nicht so bald wieder in sein Vaterland zurückzukehren.
Ingeborgs Angst aber erklärte der Arzt für eine Folge der furchtbaren Nervenerregung, die sich ihrer in jener Nacht im Moor bemächtigt hatte. Nur mit der Zeit und unter dem Einfluß einer anderen Umgebung werde sie sich legen.
Wer aber in Ingeborgs Herz hätte sehen können, der wäre wohl zu anderen Schlüssen gekommen. Sie hatte einen guten Grund für ihre Angst, den sie jedoch, da sie von den jüngsten Ereignissen in Mückern nicht unterrichtet war, aus Besorgniß für ihren Vater den andern verschwieg. –
Larsens Leidenschaft für das Mädchen war durch das Mißlingen seiner Anschläge nur gesteigert, ja bis zur Raserei entfacht worden. Nachdem er einmal den Weg der Gewaltthat betreten hatte und, von den Gerichten verfolgt, als Geächteter herumirrte, bebte er auch vor dem Aeußersten nicht mehr zurück. Das Mädchen war sein Eigenthum, ihm von Jugend aus zugesprochen, daran klammerte er sich mit der ganzen Zähigkeit seines Charakters, und daß ein anderer ihm dieses Eigenthum rauben könnte, erhöhte ihm nur dessen Werth und erfüllte ihn mit namenlosem Ingrimm. Sein Schiff, sein Vermögen konnten sie ihm nehmen, aber sie nicht. Er mußte fliehen in ein anderes Land, einen andern Welttheil, ja, das wollte er, aber nicht ohne sie, nicht, wenn sie hier lebend zurückblieb. Daß ein anderer sie, sie einen anderen lieben könnte, der Gedanke hatte wie ein Blitzstrahl sein arbeitendes Gehirn erleuchtet. Lange hatte er über die erst kaum begriffenen Gründe ihrer Entfremdung von ihm nachgegrübelt; seine Untreue konnte ihr verrathen worden sein, wohl; aber dieser Umstand war in seinen Augen nicht bedeutend genug, um ihre plötzliche Flucht am Hochzeitstag zu erklären. Er vergegenwärtigte sich noch einmal die Ereignisse dieses Tages, und da erkannte er die Wahrheit. Waren denn nicht an jenem Morgen mit dem alten Elbe der Direktor von Limforden und dessen Schwester als unerwartete und ungebetene Gäste zu Mückern im Hause seiner Mutter eingetroffen, hatten sie nicht Blicke mit einander gewechselt, sonderbare Blicke, die er damals nicht verstand und auch nicht weiter beachtete, und hatte nicht während eines Gesprächs über das Seemannsleben, in das ihn, Larsen, der Direktor verflochten, Ingeborg ihre Flucht bewerkstelligt? – Ja, so war es, und das alles war ein abgekartetes Spiel zwischen ihnen gewesen, seine Wachsamkeit zu täuschen, ein Spiel, dem sogar der alte Elbe, der seines gegebenen Worts gern auf irgend eine Weise quitt geworden wäre, nicht fern stand. Auch über die Richtung ihrer Flucht hatten jene ihn getäuscht, zu Tromholt nach Trollheide war sie geflohen; natürlich, sie kannte ja den Weg dorthin oder nach Limforden, sie hatte ihn früher schon gemacht, früher – ja – und von daher kam ihre Entfremdung. Wie hatte er, Larsen, nur so blind sein können! Tromholt hatte sie ihm entrissen, Tromholt liebte das Mädchen, und sie liebte ihn lange schon. Er wollte sie heirathen, das gefiel natürlich dem alten Elbe, und weil es in Limforden, wo sie Wirthschafterin und Tromholt Direktor gewesen war, doch nicht wohl anging, deshalb hatte dieser jetzt den Posten angegeben und war ins Ausland, nach Kopenhagen, gereist. Auch das war nur eine Komödie, um ihn, Larsen, zu täuschen. Ingeborg wartete nur, bis jener kommen würde und sie hinüberholte als sein Weib. Nun glaubte er, alles zu durchschauen, aber lange genug war er das Opfer ihres Betrugs gewesen, ein grimmiger Haß erfüllte ihn gegen Tromholt und Elbe, selbst gegen Ingeborg, ein Haß, der seine Begierde nach ihrem Besitz nur noch heftiger anfachte.
Markgröningen und der Schäferlauf.
Es hat allhiesig gemeine Stadt Marggröningen vor andern und alleinig von uralt und urdenklichen Zeiten an das gnädigste Spezial-Privilegium, daß alle Schäfere dieses hochlöblichen Herzogthums alljährlich auf den Feyertag Bartholomäi allhier eine Zusammenkunft halten und dabei dem gewohnlichen Lauff abwarten, auch ihre Meister- und Leggelder gebührend entrichten müssen. Bei welchem Lauff Stadt wegen demjenigen Schäfer, der nach dem vorgesteckten Zihl den Hammel erstens erreichet, dieser ohnentgeltlich zukommt, denen Schäferinnen aber etlich Ehlen Barchet oder sonst etwas dafür zu verlauffen und ein Seckel zu vertanzen angeschaffet, sofort nachmals ein freyer Tanz auf offentlicher Gassen anzustellen erlaubt, und endlich noch denen ältesten Meistern etlich Duzend Nestel präsentiert werden … welch alles altem Herkommen gemäß Stadt wegen aus dem Burgermeister Amt bestritten wird.“
Also steht in dem „Saal- und Lagerbuch“ der Stadt Markgröningen, einem 583 Blätter umfassenden Schweinslederband, der von Johann Eberhard Paulus, einem Vorfahren des bekannten freisinnigen Theologen, 1751/54 „mit Fleiß zusammengetragen“ worden ist, auf Blatt 318 verzeichnet. Wenn ich aber den freundlichen Leser heute einlade, mit mir nach Markgröningen, dem uralten schwäbischen Landstädtchen, zu pilgern, so geschieht das nicht zu dem Zweck, daß wir miteinander in vergilbten Urkunden blättern, so treuherzig sie abgefaßt sein mögen, sondern wir wollen uns die Stadt selbst, wie sie heutzutage besteht, und ihr Fest, den „Schäferlauf“, wie er in der Gegenwart abgehalten wird, miteinander ansehen.
Wir steigen aus der Eisenbahnstation Asperg (zwischen Bietigheim und Ludwigsburg) aus. Den massig aufgebauten Hohenasperg mit seinem über Schubarts Kerkerzelle neu aufgeführten Wasserthurm lassen wir zur Rechten liegen und befinden uns, nachdem wir die Stadt Asperg durchschritten haben, in einer behaglichen, fruchtbaren, ziemlich ebenen Landschaft. Zur Rechten begleitet uns ein niedriger Höhenzug, der als westlicher Ausläufer des Aspergs allmählich sich abdacht, um dort, wo die fast bis auf die letzte Spur verwischten Trümmer der „Schlüsselburg“ liegen, noch einen steilen Vorsprung gegen das Glemsthal zu bilden.
Es ist frühmorgens im Spätsommer, am 24. August. Das Getreide ist eingeheimst, und neben dem Stoppelfeld, oder, um [561] mit dem alten Lagerbuch zu reden, dem „Stupfelfeld“, gedeihen die herbstlichen Futtergewächse.
Zur Linken haben wir Wiesen, durch welche der erlenumbuschte Leudelsbach sich der Glems zuschlängelt. Die Gegend athmet behäbigen Frieden; sie ist fast zu anspruchslos, als daß man sie träumerisch nennen könnte. Es ist die echte Hirtenlandschaft; wir befinden uns mitten in der Idylle.
Die Straße, die sonst nicht zu den betretensten des Schwabenlandes gehört, wiewohl der Postwagen täglich dreimal zwischen Markgröningen und Asperg hin- und herfährt, ist heute ungewöhnlich belebt. Die Schäfer im landesüblichen „blauen Hemd“, die Schäfermädchen in weißem Mieder, weißer Schürze und vielgefälteltem grünem, rothem oder
blauem Wollrock schreiten singend oder plaudernd die gerade Straße dahin. Sie haben das erste Anrecht auf das Fest, das zu Ehren der Treue eines ihrer Berufsgenossen gestiftet worden ist, wie wir später erfahren werden. Neben ihnen bewegen sich in größeren oder kleineren Gruppen die biederen Landleute der näheren oder ferneren Umgebung: der unternehmende landeskundige Metzger, der Bauer, den nebelspaltenden „Dreimaster“ auf dem würdigen Haupt, in straffgespannten, gelben hirschledernen Hosen; die Bäuerin im Sonntagsstaat mit der Haube und den langflatternden breiten Bändern. Auch der vornehmere Städter, der weiter her kommt, „das Volk zu studieren“, oder vielleicht, wie Richard Weitbrechts „Stadtjompfer“ – das Volk zu „geniren“, ist nicht daheimgeblieben.
Nach etwa fünfviertelstündiger Wanderung haben wir „Gröningen in der Mark“, wie die Stadt zum Unterschied von andern gleichnamigen Orten genannt wird, erreicht. So wehrhaft, wie Merians Kupferstich vom Jahre 1643 die Stadt darstellt, sieht sie heutzutage nicht mehr aus. Doch ragen die beiden, übrigens nicht ausgebauten Thürme der geräumigen gothischen Stadtkirche würdig über die Dächer empor, die sich im Eirund um sie her lagern. Die Häuser haben sich in festlichen Schmuck, in Tannenreis und Heidekrautgewinde gekleidet. Durch bescheidene, doch nicht drückend enge Gassen führt unser Weg auf den Marktplatz, wo das hochgiebelige, mit einem fast verschwenderischen Reichthum von Eichenbalken ausgeführte Rathhaus unsere Blicke fesselt.
Hier nimmt gegen elf Uhr vormittags die eigentliche Festlichkeit ihren Anfang. Schäferjünglinge und Schäfermädchen sammeln sich auf dem Rathhaus. Zunächst werden aus einer milden Stiftung zehn Neue Testamente unter sie verlost. „Ansonsten ist die christlöbliche Ordnung, daß die Schäfere von dem Rathaus aus mit Fahnen, Trommeln und Pfeiffen in einer wohleingerichteten Procession in die Kirchen ziehen zur Anhörung der ihnen besonders zu haltenden Predigt unter obrigkeitlichem Präsidio“.
In alten Zeiten wurde statt der Verlosung der Neuen Testamente das Leggeld von „denen Schäferen“ entrichtet, nämlich so lange noch Markgröningen die „Hauptlade“ oder der Vorort der Schäferzunft so ziemlich für alle Städte und Bezirke des württembergischen Unterlandes war. Dies ist aber nicht mehr der Fall, da im Jahre 1828 die Schäferzunft sich aufgelöst hat. Ihr Vermögen ist an die Stadtpflege Markgröningen übergegangen, von welcher demgemäß auch die Kosten der allgemeinen festlichen Veranstaltungen bestritten werden.
Betrachten wir uns nun die „wohleingerichtete Procession“, welche sich zu ordnen beginnt, etwas näher im einzelnen. Voran schreiten die Trommler und eine Abtheilung der Feuerwehr mit Fahnen. Eine Stadt wie Markgröningen, welche zwar von größeren Feuersbrünsten verschont blieb, aber im Jahr 1634 also ausgeplündert worden ist, daß mehr als die Hälfte der Häuser nach dem Dreißigjährigen Krieg in Trümmern lag, wird den Werth dieser neuzeitlichen Einrichtung wohl zu schätzen wissen. Es folgen die „Festreiter“, von welchen einer auf dem Festplatz außerhalb der Stadt seine Rolle zu spielen hat. An dem Festreiter bemerken wir, wie übrigens auch bei andern Festgästen, die „Nestel“ in gelben, rothen, grünen, blauen Farben.
Die „Nestel“, dünne, lange, bunte Bänder, aus Schafleder geschnitten, oder auch aus Florettseide oder Baumwolle geflochten, sind das Wahrzeichen des Schäferlaufs, wenn man auch jetzt kein „Koller“ und keine „Schnallenschuhe“ mehr damit zu knüpfen hat. Trägt doch auch der steinerne Herzog, der dort auf der Brunnensäule des Markplatzes steht, neben dem Herrscherstab in seiner Rechten jahraus jahrein seine Nestel, welche lustig im Winde flattern. – Den „Festreitern“ folgt die Musik. Daß sich ohne Sang und Klang ein Volksfest und vollends ein Schäferfest gar nicht denken läßt, versteht sich von selbst. Am Gasthaus „Zur Krone“ ist ein Gemälde angebracht, allwo drei Musikanten auf Dudelsack, Klarinette und Flöte muntere Weisen blasen, indeß sich im Hintergrund Hirt und Hirtin im Reigen drehen. Unsere Musikanten sind, seitdem sich vor noch nicht gar langer Zeit die Neuerung anläßlich eines Stuttgarter Schützenfestes bewährt hat, mit einer besonderen Tracht ausgestattet, welche der bekannten Betzinger oder auch der Steinlachthaler Volkstracht ähnelt.
Nunmehr kommen die zum Feste besonders eingeladenen „Ehrengäste und die Mitglieder der Kollegien“. Hier bemerken wir den Oberamtmann von Ludwigsburg oder den Stellvertreter, den er entsendet hat. „Von Ludwigsburg!“ – Früher war Markgröningen selbst eine Oberamtsstadt, wie Heyd in seiner vortrefflichen „Geschichte der vormaligen Oberamtsstadt Markgröningen“ gleich auf dem Titelblatt und auch sonst nachdrücklich der Welt zum Bewußtsein bringt. Die Wunde schmerzlicher Erinnerung, daß Markgröningen eine Oberamtsstadt gewesen ist – sie ist vielleicht jetzt noch nicht ganz vernarbt! – Hier bemerken wir den Stadtschultheißen, der uns einen Blick in das „Saal- und Lagerbuch“ verstattet hat; hier den Stadtpfleger, der das Jahr über die im Eigenthum der Stadt befindlichen Festkeidungen verwahrt und bei den Anordnungen zu würdiger Begehung des Bartholomäustages alle Hände voll zu thun hat. Hier schreiten die Männer vom Gemeinderath und vom Bürgerausschuß, die das Fest seit den Tagen ihrer Kindheit schon so oft mitgefeiert haben.
Hinter ihnen folgt die Schäfermusik. Sie stimmt den „Schäfermarsch“ an, welcher, wenigstens nach Heyds Versicherung, auf das Gemüth des echten und gerechten Markgröningers denselben Zauber ausübt wie der Kuhreigen auf das Herz des Schweizers. Die rührend einfache Weise theilen wir am Schlusse unseres Artikels mit.
Nun zwei Kronenträger. Der Schäferbursche und das Schäfermädchen, welche aus den Wettkämpfen des Tages als [562] Sieger und Siegerin hervorgehen, sind berechtigt, für diesen Tag eine messingene, mit rothem Tuch ausgefütterte Krone zu tragen.
Hierauf die älteren Schäfer, welche sich am Wettkampf des Tages nicht betheiligen, mit Fahnen, Schippen (Hirtenstäben) und denjenigen Preisen, welche, abgesehen von der „Krone“, den glücklichen Siegern zutheil werden sollen. Diese Schäfer führen in ihrer Mitte den bekränzten Preishammel und das ebenfalls festlich geschmückte Preismutterschaf, denen wir hernach auf dem Festplatz wieder begegnen werden.
Jetzt aber naht die Hauptsache, die „springenden Schäfer und Schäferinnen“, d. h. die etwa 25 Burschen und ebensoviele Mädchen, welche beim Wettlauf um die verschiedenen Preise ringen. Nur wer Schäfer beziehungsweise Schäferin ist, oder wenigstens einen Schäfer seinen Vater nennt, hat das Recht, bei den Wettspielen sein Jahrhundert in die Schranken zu fordern.
Nun folgen die Lateinschüler – Markgröningen hält seit alten Zeiten etwas auf klassische Bildung – dann wieder zwei Preisträger, welche die für die „Wasserträgerinnen“ bestimmten Preise an Stangen oder Rechen tragen. Alsbald erscheinen auch die wassertragenden, mit ihren „Gölten“ (hölzernen Eimern) ausgestatteten Jungfrauen.
Endlich die „Sackläufer“, von denen noch die Rede sein wird. Dann der Kriegerverein. Eine zweite Abtheilung der Feuerwehr schließt die „wohleingerichtete Procession“ ab, welcher wir nunmehr als „Volk“ im allgemeinen uns anreihen.
Wir ziehen in die eine Anzahl denkwürdiger Alterthümer in ihren Hallen bergende Stadtkirche, welche den Namen des heiligen Bartholomäus trägt.
Lassen wir während des Orgelspiels uns die Sage künden, welche der Volksmund vom geschichtlichen Ursprung des Festes zu berichten weiß!
Es war einmal ein Graf zu Gröningen, der hatte einen Schafknecht namens Bartholomäus. Dieser Knecht ward bei dem Grafen verleumdet, daß er Schafe aus der Herde heimlich verkaufe und das Geld für sich behalte. Um die Treue des Knechtes zu erproben, zog der Graf fern über Land und kam, als Metzger verkleidet, nach einiger Zeit zurück. Er ging zu Bartholomäus hinaus auf das Feld und wollte sehen, ob er für Geld und gute Worte Schafe von ihm bekäme. Er bat und schmeichelte als Händler, bot viel Geld und griff, da der Knecht auf den Handel nicht eingehen wollte, nach einem Stück der Herde. Da ergrimmte der Knecht und schlug den frechen Metzger mit seinem Schäferstecken. Nun gab sich der Graf zu erkennen, lobte die Treue seines Dieners, schenkte ihm einen Hammel und befahl, daß an seinem Namenstag die Schäfer alle Jahre ein Fest der Freude und der Erinnerung an diese That feiern sollten.
Das ist die Geschichte „vom treuen Barthle“. –
Inzwischen hat, nachdem einige Verse eines Kirchenliedes gesungen worden sind, der zweite Geistliche der Stadt die Kanzel betreten. Er knüpft an das an, was die heilige Schrift von der Hirtentreue oder vom Laufen in den Schranken und vom Erlangen des Kleinods sagt, und hält eine Predigt, für welche schon der alte Heyd den Rath giebt, daß sie nicht allzulang sein solle! Es ist inzwischen Mittag geworden!
Von der Kirche aus bewegt sich der Festzug in der oben erwähnten Ordnung auf den Festplatz. Dieser liegt vor dem „oberen Thor“ und ist ein ebenes, abgeräumtes Stoppelfeld. Landschaftlich betrachtet, ist er recht gut gewählt: im Süden erblickt man das Schloß Solitude, östlich den Asperg. Besonders malerisch ist der Blick gegen Westen über das tiefeingeschnittene Glemsthal auf waldige Anhöhen, an welche sich vereinzelte Bauernhöfe schmiegen. Südöstlich hat man die Stadt vor sich, aus welcher besonders das weit ausgedehnte Lehrerinnenseminar und Waisenmädchenhaus hervortritt.
Am westlichen Ende des Stoppelfeldes ist eine mit Tannenreis, Blumen, Heidekraut, Obst, Feldfrüchten, buntem Tuch (Blau-gelb sind die Stadtfarben) recht hübsch geschmückte Tribüne errichtet, auf welcher das „obrigkeitliche Präsidium“ Platz nimmt. Nördlich und südlich ziehen sich vier lange Bankreihen für das zuschauende Volk hin.
Auf diese Weise ist eine Rennbahn, ungefähr 25 Schritte breit und 260 Schritte lang, hergestellt. Auf der Ackerkrume stehen noch die Stoppeln, auch macht sich da und dort eine Distel breit, was für die nackten Füße, welche diese Rennbahn durchmessen sollen, dem Vergnügen ein Körnlein Salz beimengt. In der Mitte der Bahn ragt ein Kletterbaum mit einem stattlichen grünen Kranz und verschiedenen aus Kleidungsstücken etc. bestehenden Gaben, welche dem unverdrossenen Ueberwinder jetzt schon verlockend winken.
Oestlich wird der Anfang der Rennbahn mit einer ein Schäferbild tragenden Standarte bezeichnet. Hier sammeln sich die „springenden Schäfer und Schäferinnen“ und entledigen sich ihres Schuhwerks. Zuerst kommen die Mädchen an die Reihe. Der Festreiter giebt, indem er ein weißes Tuch schwenkt, das Zeichen, daß der Lauf beginne, und jagt den Läuferinnen voraus der Tribüne zu. Welche der Läuferinnen zuerst das Ziel, einen an der Tribüne befestigten hölzernen Widderkopf berührt, setzt sich die dort für sie bereitliegende Krone aufs Haupt und hat den ersten Preis, das Mutterschaf, gewonnen. Die übrigen vier oder fünf Preise – Kleidungsstücke – werden an die der Reihe nach zuerst Ankommenden der etwa 20 Wettläuferinnen vertheilt.
Ganz ähnlich gestaltet sich der Wettlauf der Schäferburschen. Hier ist ein Hammel der erste Preis. Manchmal giebt es freilich auch Streitigkeiten zu schlichten. Als ich etliche Tage vor dem letzten Feste nach Markgröningen kam, weidete ein Münchinger Schäfer auf dem Stoppelfeld. Er erzählte mir, vor Jahren sei er auch einmal wettgelaufen und vorn dran gewesen, aber im letzten entscheidenden Augenblick von einem tückischen Mitbewerber am Rockzipfel erfaßt und zu Fall gebracht worden. – Wackerer Münchinger, solches kommt auch anderswo vor als auf dem Stupfelfeld! –
Friedlich beschließt übrigens diesen Theil der Festlichkeit ein gemeinsamer Tanz der wettlaufenden Paare.
Eigenartiger ist das „Wassertragen“ der Mädchen. Die Mädchen nehmen einen mit Wasser gefüllten Kübel auf den Kopf und laufen, ohne das Gefäß zu berühren, dem Ziel, einer großen am Ende der Rennbahn aufgestellten Kufe, zu. Bei dieser Gelegenheit gilt es, nicht bloß flink zu sein, sondern auch mit stetiger Sicherheit seine eigene Person und den Kübel im Gleichgewicht zu halten. Die erste Jungfrau, welcher es gelingt, ihren Kübel, ohne daß sie Wasser verschüttet hat, in die Kufe zu leeren, hat wiederum einen ersten Preis gewonnen. Und so noch etliche andere der Reihe nach.
Nun folgen die Belustigungen für die männliche Schuljugend; das Sacklaufen oder Sackhüpfen, das wohl allerwärts bekannt ist. Es ist an die Stelle des früher üblichen Hahnentanzes getreten, wobei es darauf ankam, daß von einem tanzenden Paare ein auf einen hohen Pfahl gestelltes Glas Wasser geschickt heruntergenommen wurde. Rüstige Kletterer holen sich im Schweiß ihres Angesichtes – zuweilen brennt am 24. August die Sonne recht heiß auf das Stoppelfeld, zuweilen wird aber auch das Fest gründlich verregnet – ihre Preise vom Kranze des Kletterbaums.
Endlich geht der Zug in die Stadt zurück, woselbst in dem Rathhaussaale und in den verschiedenen Herbergen bis zum hereinbrechenden Abend lustig getanzt wird, während die Gassen und Gäßchen munteres Jahrmarkttreiben erfüllt. – Wir haben noch reichlich Zeit und Gelegenheit, uns leiblich zu stärken und uns etwas aus der alten Geschichte Markgröningens, von den Grafen von Calw, den Welfen, den Hohenstaufen, in deren Besitz die Stadt früher war, von den Grüningern und den Schlüsselburgern, vom Reichsadler und von der Reichssturmfahne, welche die Stadt bis heute im Wappen führt, erzählen zu lassen. Oder wir können die eine und andere bauliche Merkwürdigkeit, die Stadtkirche mit ihren Chorstühlen und ihren alten Grabmälern, das Rathhaus mit seinen Eichenbalken und seiner künstlichen Uhr, die Trümmer der frühgothischen Spitalkirche im Garten des 1297 gegründeten Heiliggeistspitals besichtigen.
Das ist Markgröningens „Schäferlauf“, welcher urkundlich bis ins 15. Jahrhundert hinauf nachzuweisen ist, indem er in Spitalrechnungen vom Jahr 1443 erwähnt wird.
Das Fest hat noch tiefe Wurzeln im Volksgemüth, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß es gegenüber früheren Zeiten, da die württembergischen Herzöge und ihre Gemahlinnen die Feststadt mit ihrem Besuch beehrten – 1444 Graf Ludwig, 1484 Graf Eberhard im Bart – und da eine einzige vornehmere Markgröninger Familie 70 – sage und schreibe siebzig – Festgäste beherbergte, an Glanz und Bedeutung verloren hat.
[563] Vielleicht könnte das Fest belebt und veredelt werden, wenn man sich entschließen würde, mit dem „Lauf“ eine dramatische Aufführung zu verbinden.
Ich meine, die Geschichte „vom treuen Barthle“ wäre ein dankbarer Stoff für ein Volksschauspiel!
Wer wagt sich daran? –
![{
\new PianoStaff <<
\new Staff \relative c'' { \clef "treble" \key d \major \time 4/4 \override TupletBracket #'direction = #1
\repeat volta 2 { \partial 4 \times 2/3 { a8( b cis) } | \grace e16 d8.[ a16] d8[ e] \grace e16 d8.[ a16] d8[ e] | \grace g16 fis8.[ e16] fis8[ g] \grace g16 fis8.[ e16] d16[( e fis g)] \noBreak | a8.[ gis16] a8.[ d16] a4 \times 2/3 { a8( g fis) } | \grace fis16 e8.[ d16 e8 fis] e4\fermata | } \break
d16( e fis g) | a8.[ b16] \times 2/3 { a8( g fis) } e4 \times 2/3 { e8( fis g) } | \grace b16 a8.[ g16] fis8.[ e16] d4 \times 2/3 { e8( fis g) } | fis8.[ e16 d8. cis16] b8.[ cis16 d8. fis16] | e8.[ d16 cis8. b16] a4\fermata a'8.[ d16] \break
\grace b16 a4 \times 2/3 { a8( g fis) } e4 \times 2/3 { e8( fis g) } | \grace g16 fis8.[ e16 fis8 g] a4 d,8.[ e16] | \grace e16 d8.[ a16] d8[ e] fis4 fis16[ e d cis] | d2 r4 \bar "|." s4 \bar "" s1 \bar ""
}
\new Staff { \clef "bass" \key d \major
\repeat volta 2 { \partial 4 r4 | <d fis a> q q q | q q q q | q q q q | <a, cis e a> q q\fermata | }
r4 | <cis e> a <cis e> a | <d fis> a <d fis> a | <fis a d'>2 <g b d'>4 r | <a, cis e a> q q\fermata r |
<cis e> a <cis e> a | <d fis> a <d fis> a | <d fis> a <d fis> a | <d fis a>2 r4 | s4 \bar "" s1 \bar ""
}
>>
}](http://upload.wikimedia.org/score/2/q/2qti4h94b58fw96tqn35ytuh5ib2qal/2qti4h94.png)
Mit der Rettung Ertrinkender hat sich die „Gartenlaube“ vor etwas weniger als Jahresfrist (vergl. Jahrgang 1889, S. 621) befaßt. Wir haben damals das weitverbreitete und treffliche Büchlein, den „Leitfaden für Samariterschulen“ von Prof. Dr. Friedrich von Esmarch unsern Lesern empfohlen und diejenigen Rettungsverfahren erwähnt, die in demselben als die zweckmäßigsten angeführt werden. Die Veröffentlichung unseres Artikels hat einen unerwarteten Erfolg gehabt. Wir haben erfahren, daß diese Verfahren, welche wohl in den meisten Samariterschulen nach dem Leitfaden gelehrt werden, nicht die zweckmäßigsten sind. Der Stellvertreter des Oberkommandeurs vom Hamburger Retter-Corps, Herr Hans Müller, welcher lange Zeit als Schwimmlehrer beim Militär wirkte, eine Reihe von Jahren auf den Hamburgischen Staatsbadeanstalten zur Rettung Ertrinkender angestellt gewesen ist und der ohne jedes Hilfsmittel bereits etwa 200 Personen vom Tode des Ertrinkens gerettet, hat uns eine ganze Reihe beherzigenswerther Angaben gemacht, wie man in zweckmäßigster und sicherster Weise Ertrinkende retten soll. Indem wir im Interesse der Lehrer an den Samariterschulen mittheilen, daß Professor von Esmarch, welchem wir die Ausführungen des Herrn Müller vorgelegt haben, auf Grund derselben in der nächsten Auflage seines Leitfadens Aenderungen anbringen wird, müssen auch wir die Mittheilungen des genannten Sachverständigen dankbar anerkennen und erachten es als unsere Pflicht, dieselben zum allgemeinen Nutzen an dieser Stelle bekannt zu geben.
In dem früheren Artikel der „Gartenlaube“ ist der Rath gegeben worden, den Ertrinkenden beim Haupthaar zu fassen. Auch Herr Müller hat im Anfange seiner Thätigkeit mitunter versucht, diese Rettungsart anzuwenden, ließ aber, nachdem er das Unzweckmäßige derselben eingesehen hatte, sehr bald davon ab. Sie muß schon darum verpönt werden, weil der zu Rettende dabei beide Hände frei behält und den Retter erfassen kann, was ja gerade verhindert werden soll. Man muß den Ertrinkenden derart fassen, daß ihm der Gebrauch der Arme und Hände unmöglich gemacht wird. Auf die Frage: Wie führt man eine Rettung aus, welche für beide Betheiligte die größte Sicherheit bietet? – giebt unser Gewährsmann folgende Antwort:
„Da Schnelligkeit des Retters eine der wichtigsten Forderungen ist, so suche man, wenn es die örtlichen Verhältnisse gestatten, durch flachen Kopfsprung[1] der Unfallstelle möglichst schnell näher zu kommen, achte aber darauf, daß man nicht stromaufwärts zu schwimmen braucht, da dies unnöthig die Kräfte des Retters in Anspruch nimmt. Man laufe lieber erst am Ufer stromaufwärts über die Unfallstelle hinaus, so daß man beim Durchschwimmen des Stromes sich ohne Nachtheil etwas abwärts treiben lassen kann. Dem Ertrinkenden nähere man sich von der Rückseite, fasse mit der eigenen linken Hand unter dessen linkem Arm hindurch nach dem rechten Handgelenk und drücke den Ergriffenen an sich heran. Hierauf schwimme man auf dem Rücken dem Lande zu, wiederum den Fluß schräg durchquerend, damit man nicht gegen den Strom kämpfen muß. Den Geretteten drückt man während dieser ganzen Zeit an sich heran, wodurch vielerlei Vortheile sich ergeben: erstlich behält man die rechte Hand vollständig frei, kann dieselbe also beim Schwimmen mit benutzen; alsdann ragen nur die beiden Gesichtsflächen der Betheiligten aus dem Wasser, nicht aber der ganze Kopf des Geretteten, wie beim Erfassen der Haare. Beide Körper sind demnach beinahe vollständig im Wasser, werden also mehr von diesem getragen, so daß für den Retter lediglich die Arbeit der Fortbewegung bleibt. Ferner kann der Retter beim etwaigen ‚Wildwerden‘ des Geretteten von diesem nicht gefaßt werden, weil derselbe sich nicht umdrehen kann. Versucht er dies nach rechts, so ist ihm dies unmöglich, weil man sein rechtes Handgelenk festhält, will er sich nach links umdrehen, so drückt man einfach seine, des Geretteten, linke Schulter fester an die eigene.“
In unserem vorjährigen Artikel wurde auch der Gefahr gedacht, welche den Retter bedroht, wenn er von dem Ertrinkenden gefaßt wird, und behauptet, daß es Tollkühnheit sei, jemand zu ergreifen, der noch mit den Wellen kämpft, man solle warten, bis er ruhig werde. Hierzu bemerkt uns Herr Müller:
„Wenn dies Tollkühnheit ist, so hätte ich diese bei den meisten meiner Rettungen besessen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Ertrinkende, sobald sie mit den wilden Bewegungen aufhören, oft ganz plötzlich im Wasser verschwinden, und dann sind sie schwieriger wieder aufzufinden und zu retten. Weshalb soll man also zögern, wenn man sich die Rettung erleichtern kann?
Ein großer Theil der Ertrinkenden sinkt aber während des verzweiflungsvollen Kampfes im Wasser immer tiefer, und je mehr der Ertrinkende in die Tiefe geräth, desto heftiger werden die Bewegungen. Soll man nun hier auch warten, bis er ruhig wird? Es dürfte dann manchmal schon zu spät sein! Also ein Ertrinkender wird erfaßt, sobald man ihn erreicht. Gelingt es nicht sofort, ihn richtig zu fassen, so läßt man ihn los und faßt ihn aufs neue.
Man wird mir wohl erwidern wollen, daß man einen Ertrinkenden doch nicht loslassen könne, wenn man von ihm festgehalten wird. Aber trotzdem kann man dies. Die meisten Menschen sind der Meinung, daß beide verloren sind, wenn der Retter vom Ertrinkenden ‚gefaßt‘ wird. Dies ist jedoch noch lange nicht der Fall, wenn Ruhe und Besonnenheit auf seiten des Retters vorhanden sind. Man benutze einfach die feststehende Thatsache, daß jeder Ertrinkende nach oben strebt und sofort fühlt, wenn es nach unten geht. Also, man schwimme nach unten und – der Ertrinkende läßt ganz bestimmt los. Auf diese Weise habe ich mich schon häufig von einem Ertrinkenden losgemacht, wenn ich so ‚tollkühn‘ gewesen war, ihn zu fassen, ehe er besinnungslos war. Die Versuche, den Ertrinkenden richtig zu fassen, wiederholt man nun so lange, bis es endlich gelingt, und dies geschieht sicher, wenn man Ausdauer besitzt.“
Nach dieser Art zu verfahren ist es auch möglich, zwei Personen zugleich zu retten, vorausgesetzt, daß sie „ruhig“ sind, indem man die zweite Person mit dem freien rechten Arm ergreift, dann allerdings auch ohne Mitbenutzung beider Arme zu schwimmen gezwungen ist. Ueber einen solchen Fall einer Doppelrettung theilt uns unser Gewährsmann folgendes mit:
„Ein Schwimmer wollte einem in Gefahr befindlichen Nichtschwimmer Hilfe leisten, wurde aber von demselben ‚gefaßt‘ und konnte nun nichts ausrichten. Beide kämpften im Wasser, der eine, um sich frei zu machen, der andere, um sich festzuhalten. Ich sprang ins Wasser, schwamm zu ihnen, hob die mittlerweile etwa zwei Fuß gesunkenen Kämpfer an die Oberfläche, vermochte jedoch nicht, sie zu trennen. Hierauf faßte ich den Schwimmer bei den Haaren, zog ihn daran unter Wasser, worauf er von dem Nichtschwimmer und dann auch von mir losgelassen wurde und
[564] schleunigst an Land schwamm. Gleichzeitig hatte der Nichtschwimmer aber mich am Bein gefaßt, weshalb ich noch weiter nach unten schwamm, selbstverständlich losgelassen wurde und nunmehr den Nichtschwimmer richtig faßte und schließlich rettete. Trotz der vermeintlichen Schwierigkeit bei dieser umständlichen Rettung war die „Tollkühnheit“ hier in ebendem Maße angebracht, als wenn man nur mit einem Menschen zu thun gehabt hätte. Nur immer besonnen, so wird jede Rettung gelingen! Mir kam in diesem Falle der Glücksumstand zu statten, daß der eine in Gefahr Befindliche nach seiner Befreiung vom andern selbst nach dem Lande schwimmen konnte. Aber selbst, wenn es zwei Nichtschwimmer gewesen wären, würde ich fast genau ebenso gehandelt haben; d.h., da es unmöglich ist, zwei ‚wilde‘ Menschen zu gleicher Zeit zu retten, so müßte man diese erst trennen, den einen nach dem Lande bringen, dann zurückkehren, um zu versuchen, auch noch den andern zu retten. Ist dies ohne Erfolg, nun, dann hat man gethan, soviel man konnte, und besser, nur ein Leben verloren, als zwei oder gar, mit dem des Retters, drei!“
Herr Müller schließt seine Ausführungen:
„Es ist zwar vortheilhaft, sich im Retten nach einer leichten, bestimmten Manier zu üben, aber man mache bei eintretenden Fällen sich darauf gefaßt, die Rettung trotz entgegenstehender Hindernisse auszuführen, selbst wenn diese unüberwindlich scheinen. Hier ist dann Geistesgegenwart und rasche Entschließung am Platz. Ich könnte ausgeführte Rettungen bekannt geben, bei denen mich die Zuschauer für verloren hielten und bei denen alle Theorie von dem Verhalten des Menschen im Wasser – – grau war. Die Erfahrung ist daher auch beim Retten der beste Lehrmeister.
Das Bewußtsein, einen Ertrinkenden retten zu können, und zweckentsprechendes Handeln im Wasser leisten die sicherste Bürgschaft für das Gelingen der Rettung. Es ist einfach unmöglich, daß der Retter ertrinken kann – vorausgesetzt, daß ihm nichts Außergewöhnliches zustoßt, – solange er Geistesgegenwart besitzt und es nur mit einem, selbst einem wild um sich schlagenden Menschen zu thun hat.
Würde das Schwimmen die Verbreitung schon gefunden haben, die ihm eigentlich gebührt, so würden Unglücksfälle im Wasser zu den Seltenheiten gehören; denn einestheils könnten die Betroffenen häufiger selbst sich helfen, anderntheils wären im Nothfalle mehr Schwimmer vorhanden, um die in der Gefahr des Ertrinkens Schwebenden zu retten. Solange aber das Schwimmen nicht Allgemeingut der Menschheit ist, ist es die Aufgabe der Schwimmer, ihren Mitmenschen die Wohlthaten und Vortheile desselben vor Augen zu führen. Recht dankenswerth ist darum das Bestreben der Schwimmvereine, durch jährlich stattfindende Wettschwimmen und Schwimmfeste das größere Publikum für das Schwimmen zu gewinnen, wie auch diese Vereine den Söhnen unbemittelter Eltern unentgeltlichen Schwimmunterricht ertheilen lassen. Die Schwimmvereine haben sich hauptsächlich in den letzten zwanzig Jahren stark vermehrt. –
Was die Thätigkeit der Samariterschulen anbelangt, so erwähne ich, daß in Hamburg ein Verein besteht, – wohl der einzige seiner Art in Deutschland – welcher ähnliche Zwecke verfolgt. Derselbe führt den Namen ‚Sanitäts-Schwimmverein Hamburg‘ und hat sich die Aufgabe gestellt, seine Mitglieder im Schwimmen, Tauchen, Retten etc. soweit auszubilden, daß sie imstande sind, mit Sicherheit, ohne Gefahr für ihre eigene Person, einen in Wassersgefahr befindlichen Menschen selbst in schwierigen Fällen retten zu können. Gleichzeitig erhalten die Mitglieder dieses Vereins monatlich mündliche Belehrungen durch den Vereinsarzt Dr. med. Doering zu Hamburg über die erste Hilfeleistung bei ertrunkenen Scheintodten, wobei die erforderlichen Handgriffe praktisch an Mitgliedern geübt werden. Die Bildung ähnlicher Vereine in anderen Städten wäre wohl zu empfehlen.“
Als Marie nach der Entfernung der Aufwärterin den Blick in das Zimmer zurückwandte, sah sie, daß Hudetz sich wieder aufgerichtet hatte. Sein Antlitz war ganz dasjenige eines Todten, und seine graue Blässe erschien doppelt unheimlich in der Umrahmung durch das wirre dunkle Haar.
„O, sie werden kommen,“ sagte er leise wie im Ton einer geheimnißvollen Mittheilung, „mir ist es, als hörte ich schon ihre heranschleichenhen Tritte. Aber ich fürchte mich nicht mehr, denn ich bin unter Deinem Schutz.“
„Sie haben hier in der That nichts zu besorgen, Herr Hudetz,“ entgegnete Marie, mit muthiger Kraft ihr Grausen überwindend; „aber erkennen Sie mich denn nicht? – Ich bin Ihre ehemalige Nachbarin, Marie van Brenckendorf.“
Ein Lächeln, ein schwärmerisch verzücktes Lächeln huschte um seine blutlosen Lippen.
„Ja, ich kenne Dich, Marie,“ flüsterte er, „denn Du bist meine Zuflucht gewesen und meine Hilfe in der höchsten Noth. Deine Engel breiteten ihre Flügel über mich, als ich meine Hand ausstreckte nach Deinem Bilde, sie schlugen die Augen der Wächter mit Blindheit und nahmen ihnen die Kraft, mich zu halten. ‚Ergreift ihn!‘ riefen sie mir nach. ‚Haltet ihn, den Dieb!‘ Aber eine Wolke nahm mich auf und führte mich davon vor ihren Blicken. Wie hätte mir auch ein Leid geschehen können, da ich Dich unter meinem Mantel trug!“
Er sprach bald zu Marie, bald zu dem Bilde vor dem Spiegel; aber seine letzten Worte waren undeutlich und lallend, wie wenn ihn selbst die Kraft zu reden allgemach verließe.
„Stehen Sie auf!“ bat Marie dringend, von der furchtbaren Enthüllung, die ihr aus seinen wirren, schwärmerischen Phantasien geworden war, mit neuem Entsetzen erfüllt. „Sie haben meine Gastfreundschaft in Anspruch genommen und ich verweigere sie Ihnen nicht. Aber Sie müssen nun auch thun, um was ich Sie ersuche. Sie sind krank und dürfen sich nicht aufregen! Sind Sie imstande, ohne Hilfe das Sofa zu erreichen?“
„Krank!“ murmelte er, indem er sich mit äußerster Anstrengung erhob und taumelnd die wenigen Schritte bis zu dem Ruhebette that. Nein, ich bin nicht krank! – Aber der Böse war hinter mir – der Böse in der Gestalt eines Weibes, jenes schrecklichen Weibes aus dem Museum. O, ich sah es wohl, daß es mich verfolgte, kreuz und quer durch alle Straßen. Wohin ich ging, immer war es hinter mir, das schreckliche Gesicht. Und ein Schatten war neben dem Weibe, ein furchtbarer, schwarzer Schatten, der streckte seine Riesenarme nach mir aus und würgte mich – würgte mich – o, er wußte wohl, daß ich den Talisman nicht mehr besaß, der mich beschützte. Und aus den Ritzen des Pflasters ringsum mich her züngelten gelbe Flammen, große feurige Räder drehten sich in der Luft, und es war ein Brausen und Zischen und Donnern wie am Tag des Gerichts. Da rief mir eine Stimme vom Himmel: ‚Wohin gehst Du, Verblendeter? – Bei ihr – bei Marie ist die Rettung – die Rettung – und – die – Gnade‘ –“
Seine Rede endete in einem Röcheln, seine Augen schlossen sich und sein Kopf fiel schwer auf die Lehne des Sofas nieder.
„Barmherziger Gott, er stirbt – stirbt in meinem Zimmer!“ dachte Marie, „und ich habe niemand, der mir beisteht.“
Sie wagte kaum, sich von ihrem Plätze zu rühren, aus Furcht, daß das Geräusch den Kranken aus der Betäubung wecken und seine schrecklichen Phantasien von neuem heraufbeschwören könnte. Minute auf Minute verharrte sie regungslos, bis endlich draußen die Stimme der Aufwärterin laut wurde, die mit dem rasch gefundenen Arzte zurückkehrte. Der letztere trat sofort an den Kranken heran, prüfte seinen Puls, seinen Herzschlag und richtete unterdessen einige kurze Fragen an Marie. Mit einem Kopfschütteln wandte er sich endlich von dem Sofa ab.
„Der Patient liegt in tiefer Bewußtlosigkeit,“ sagte er, „und um die eigentliche Ursache seines Zustandes festzustellen, müßte ich ihn viel genauer untersuchen. Aber ich halte diese Untersuchung für überflüssig, denn – ich muß mich offen aussprechen, mein Fräulein – seine Lebensgeister sind unzweifelhaft im Erlöschen.“
Marie fühlte, wie ihre Kniee zitterten; aber sie war doch noch stark genug, dem Arzt ihr Erschrecken zu verbergen.
„Sie glauben also, daß – daß er sterben muß?“
„Ein Erschöpfungszustand wie der seinige spottet aller ärztlichen Kunst. Ob eine Krankheit des Gehirns oder lang andauernde Entbehrungen oder vielleicht auch – wie gewisse Anzeichen mich vermuthen lassen – eine hochgradige Alkoholvergiftung diese Erschöpfung herbeigeführt haben, vermag ich wie gesagt nach oberflächlicher Untersuchung nicht festzustellen. Jedenfalls ist es am gerathensten, sich jeglichen Eingriffs zu enthalten. Die größte Wohlthat, die man dem Unglücklichen noch gewähren kann, ist die, ihm ein sanftes, unbewußtes Hinüberschlummern zu vergönnen.“
„Und man kann nichts zu seiner Erleichterung thun – kann keinen Versuch machen, ihn zu retten?“
Der Arzt zuckte mit den Achseln.
„Ich habe Ihnen denjenigen Vorschlag gemacht, welchen die Menschlichkeit mir eingiebt. Alle Belebungsmittel, die ich dem Leidenden einflößen könnte, eine bloße Umbettung oder gar die Beförderung an einen andern Ort würden ihn wahrscheinlich aus seiner wohlthätigen Ohnmacht wecken und neue, vielleicht sehr qualvolle Delirien zur Folge haben. Wenn Sie jedoch darauf bestehen, daß wir versuchen –“
[565] „Nein, nein,“ unterbrach ihn Marie hastig, „nur nicht diese fürchterlichen Reden! – Aber meine Lage, Herr Doktor, ist eine überaus peinliche. Der Kranke ist mir fast ein Fremder, ich kenne seine Verhältnisse nicht, und wenn er nun in meiner Behausung stirbt, so bin ich vollkommen rathlos, denn ich stehe eben ganz allein.“
„Hat denn der Kranke gar keine Angehörigen, welche man benachrichtigen und herbeirufen könnte?“
„Ich weiß es nicht; aber ich glaube kaum, daß ihm hier Verwandte leben. Er führte meines Wissens stets ein sehr stilles und eingezogenes Dasein!“
Der Arzt wiegte bedenklich den Kopf.
„Hum, dann ist es doch vielleicht besser, wenn ich seine schleunige Ueberführung nach der Charité veranlasse. Es ist zwar eine Grausamkeit gegen den Aermsten; aber da er ohnedies hoffnungslos verloren ist, muß die Rücksicht auf Sie doch wohl allem andern vorangehen.“
In begreiflicher Furcht vor den Folgen dieses entsetzlichen Abenteuers fühlte sich Marie gedrängt, ihm ihre Zustimmung zu seinem letzten Vorschlage auszusprechen; da aber fiel ihr Blick zufällig auf das kleine unscheinbare Bild vor dem Spiegel, auf das himmlisch milde Antlitz der Maria im Rosenhag. Und sie dachte daran, daß jener Unselige in seinen wilden Wahnvorstellungen die gnadenreiche Gottesmutter für ihr eigenes Abbild gehalten – daß er in seiner höchsten Verzweiflung, in seiner letzten furchtbaren Noth zu ihr geflüchtet war im Vertrauen auf ihre Barmherzigkeit und Güte. – Nein, was auch immer über sie kommen mochte, sie hatte nicht die Kraft, dies Vertrauen zu täuschen und den Sterbenden von ihrer Schwelle zu jagen.
„Ich danke Ihnen, Herr Doktor,“ sagte sie; „aber ich möchte mir Ruhe und Bequemlichkeit doch nicht durch eine Grausamkeit gegen den Schwerkranken erkaufen. Lassen wir ihn immerhin hier! Auch wenn das Schlimmste wirklich eintreten sollte, wird sich für das, was ich zu thun habe, Rath finden lassen.“
„Das ist ein hochherziger Entschluß, mein Fräulein, und ein muthiger zugleich! Aber Sie dürfen versichert sein, daß es Ihnen an meinem Beistande nicht fehlen wird. Eine unabweisbare Pflicht ruft mich leider jetzt an das Schmerzenslager einer Kranken, die ich nicht im Stich lassen darf, weil sie dem Leben vielleicht noch erhalten werden kann. In längstens zwei Stunden aber bin ich wieder hier, und ich glaube kaum, daß die Entscheidung schon früher eintreten wird. Meine Rathschläge für die Behandlung des Kranken sind sehr einfach. Sorgen Sie vor allem dafür, daß ihm volle Ruhe gelassen wird, daß niemand zu ihm spricht und daß es in seiner unmittelbaren Umgebung möglichst still hergeht. Sollte er trotzdem wieder zu sich kommen und von neuem zu phantasieren beginnen, so flößen Sie ihm einige Tropfen der Flüssigkeit ein, zu welcher ich Ihnen hier das Rezept aufschreibe. Weiter können wir, ohne ihn unnütz zu quälen, nichts für ihn thun.“
Er verabschiedete sich, und Marie schickte die noch immer vor Angst und Aufregung zitternde Aufwärterin hinunter, um das Heilmittel in der nächsten Apotheke anfertigen zu lassen. Nicht mehr aus Furcht vor dem Unglückseligen, welcher da mit wächsernem Antlitz regungslos und unhörbar athmend auf ihrem Ruhebette lag, sondern nur, um nach der Vorschrift des Arztes für die größte Ruhe in seiner unmittelbaren Umgebung Sorge zu tragen, ging Marie in das Nebenzimmer, die Thür desselben weit hinter sich offen lassend. Aber sie war noch nicht dazu gekommen, sich dort niederzulassen, als draußen auf dem Gange ein fester, männlicher Schritt vernehmlich wurde, dessen wohlbekannter Klang sie in Schreck und zugleich in namenloser Freude auffahren ließ. Frau Pahler mußte nach ihrer üblen Gewohnheit die Wohnungsthür wieder nicht verschlossen haben, da ein Besucher so ungehindert hatte eintreten können. Beide Hände auf das klopfende Herz gepreßt, stand Marie mitten im Zimmer; ihr Athem stockte, und sie war außer stande, das Pochen des Ankömmlings mit der üblichen Aufforderung zum Eintritt zu beantworten. Und als nun mit sichtlichem Zögern die Thür geöffnet wurde, als die Gestalt des Mannes, den zu sehen sie erwartet hatte, wirklich auf der Schwelle erschien, da rang sich der Ausruf „Lothar!“ wie ein Freudenschrei von ihren Lippen los, und es war, als ob sie ihm mit erhobenen Händen entgegeneilen wollte. Aber ein einziger Blick in sein ernstes, bleiches, unbewegliches Gesicht bannte sie auf ihren Platz.
„Guten Tag, Marie!“ sagte er, und seine sonst so klare Stimme klang unsicher und verschleiert. „Ich glaubte nicht, daß wir uns hier noch einmal gegenüberstehen würden, und so lange ich nur meinem eigenen Willen zu folgen hatte, wäre es gewiß niemals geschehen. Aber ich gehorche einer Pflicht – ich komme in meiner Eigenschaft als Untersuchungsrichter und ich bitte Dich, mich nicht hinaufzuwerfen, da ich diesmal solcher Aufforderung nicht Folge leisten dürfte.“
Marie starrte ihn an, als hätte er in einer Sprache geredet, welche sie nicht verstand. Eiskalt war es ihr vom Scheitel bis zur Ferse über den Körper gerieselt, und sie fühlte einen Schmerz in der Brust, als hätten eiserne Krallen nach ihrem Herzen gegriffen.
„Als Untersuchungsrichter?“ wiederholte sie tonlos. „Verzeih’; aber ich weiß nicht, was das bedeutet!“
„Es handelt sich um die Ermittelung jenes Verbrechers, welcher Jan van Eycks ‚Madonna im Rosenhag‘ aus dem Berliner Museum entwendet hat. Seine Spur – seine Spur weist hierher, Marie!“
Es gab ein tiefes Schweigen, während dessen sie sich unverwandt in die Augen sahen. Dann, da sie augenscheinlich nicht willens war, ihm zu autworten, fuhr Lothar langsam fort:
Ich suchte lange nach einem Menschen, dessen Zeugniß mir für die Aufklärung der geheimnißvollen That von einigem Werthe schien. Eine junge Malerin, die sein verdächtiges Gebahren in der Nähe des betreffenden Kabinetts beobachtet haben wollte, bezeichnete ihn mit aller Bestimmtheit als den Thäter, aber eine Reihe scheinbar entlastender Thatsachen ließ mich glauben, daß sie sich in einem Irrthum befände. Es ergingen Aufforderungen in den Zeitungen, aber der Mann meldete sich nicht, und alle Nachforschungen der Polizei waren nicht imstande, seine Persönlichkeit wie seinen Aufenthalt zu ermitteln. Vor einer Stunde aber erschien in meinem Bureau jene junge Malerin aus dem Museum. Sie war dem verdächtigen Menschen auf der Straße begegnet, sie hatte ihn, da ein Schutzmann sich weigerte, ihn auf ihre
[566] Verantwortung hin anzuhalten, auf seinem planlosen Umherwandern durch die Straßen fast eine Stunde lang verfolgt, und sie hatte endlich festgestellt, daß er in dieses Haus – in Dein Haus, Marie – eingetreten sei. Und sie gab mir aufs neue eine eingehende Beschreibung seiner äußeren Erscheinung – eine Beschreibung, welche mich nicht länger zweifeln lassen konnte, daß er kein anderer sei als jener Hudetz, der mich vor Deiner Thür meuchlerisch überfiel und dem ich unklug genug seine Freiheit ließ, weil Du ihn Deinen Freund genannt hattest. Einen Mörder aber kann man doch wohl auch eines Diebstahls fähig halten. Ich glaube jetzt, daß er der Räuber des Madonnenbildes ist, und ich bin entschlossen, seine schleunige Verhaftung herbeizuführen mit allen Mitteln, welche mir zur Verfügung stehen. Das allein ist es, Marie, warum ich noch einmal hier bin. Nur wenige Fragen habe ich an Dich zu richten. Vor allem: Ist der Mann, von dem ich sprach, heute in der That bei Dir gewesen?“
„Und wenn ich mich nun weigerte, darauf eine Antwort zu geben?“
„Das wirst Du nicht thun, Marie; denn es giebt ein Gesetz, welches Dich dazu zwingen kann.“
„Und würdest Du – Du dieses grausame Gesetz gegen mich in Anwendung bringen?“
„Ich habe geschworen, meine Pflicht zu thun. So lange ich nur ein ausübendes Werkzeug der Gerechtigkeit bin, giebt es für mich keinen Unterschied der Person.“
Marie richtete sich hoch auf. Ihre Schwäche und ihre Bestürzung waren überwunden, aus ihren Augen leuchtete das Feuer einer unbeugsamen Entschlossenheit.
„Und wenn er nun noch immer bei mir wäre, so würdest Du ihn verhaften – nicht wahr?“
„Gewiß, ich müßte ihn verhaften!“
„Wie Du ihn auch fändest?“
„Wie ich ihn auch fände!“
„Nun wohl! – Er ist nicht bei mir – er hat mich längst wieder verlassen.“
„Und Du weißt nichts von seinem Aufenthalt – nichts von seiner Schuld?“
„Nichts!“
„Marie!“ – Sein Athem ging schwer. „Um Deinetwillen flehe ich Dich an: sage mir die ganze Wahrhrit!“
„Ich sagte, was ich sagen mußte!“
Er that einen Schritt vorwärts, vielleicht um seine Bitte zu wiederholen und um ihr einen noch innigeren Nachdruck zu geben. Er mußte jetzt durch die offene Verbindungsthür einen Theil des Nebenzimmers übersehen können, und in der Erkenntniß der Gefahr wollte ihm Marie mit ihrem eigenen Körper den Ausblick verwehren. Aber es war zu spät. Ein Aufschrei, so schmerzlich, so verzweiflungsvoll, wie sie ihn aus der Brust dieses ernsten, ruhigen Mannes nimmer zu hören erwartet hätte, kam von seinen Lippen, und indem er mit ausgestrecktem Arm auf das Bild unter dem Spiegel deutete, rief er fast weinend:
„Allmächtiger Gott, Marie, was hast Du gethan?“
„Was ich gethan habe? Nun wohl, sieh selbst - und verhafte mich mit ihm, wenn Deine Pflicht es Dir gebietet!“
Sie ergriff seine Hand und zog ihn in das Zimmer hinein.
Da stand, zu seiner ganzen Größe aufgereckt, Hudetz neben dem Ruhebette. Ein Ausdruck herzzerschneidender Seelenangst war auf seinem Gesicht.
„Sie kommen! – Sie kommen! – Heilige Maria, bitte für mich! – Gnade! – Gnade!“
Er warf die Arme in die Luft und stürzte wie ein gefällter Baum zu Boden.
Tief erschüttert war Lothar für einige Sekunden unbeweglich geblieben, dann aber beugte er sich nieder, hob die leichte Gestalt des Unglücklichen auf und legte sie behutsam wieder auf das Sofa nieder.
„Er stirbt!“ sagte er leise. „Geh’ hinaus, Marie!“
Aber sie ging nicht. An den Thürpfosten gelehnt, blickte sie unverwandt nach dem Ruhebett hinüber, an dessen Kopfende Lothar auf dem Fußboden kniete, die Hand des Studenten in der seinigen haltend und ihm tiefernst in das verwüstete Antlitz schauend.
„Gnade! – Heilige – Maria – bitte – für – mich!“ klang es noch einmal leise wie ein Hauch durch die tiefe Stille des Gemaches, dann reckte sich die elende Gestalt auf dem Lager ein wenig aus, – der qualvoll gespannte Ausdruck verschwand allgemach aus ihren Zügen, und ein Seufzer gleich einem Aufathmen namenloser Erleichterung entfloh den blutlosen Lippen.
Lothar legte die Hände des Todten übereinander und schloß ihm mit sanftem Druck die Augen.
„Gott sei Dir gnädig!“ sagte er leise. Dann richtete er sich auf. Mariens Blick begegnete dem seinigen.
„Du mußt fort!“ erklärte er, einen Schritt auf sie zutretend. „Geh’ zu Deinem Bruder, Marie!“
Und da sie zaudernd stehen blieb, ohne sich zu regen, wiederholte er noch dringender:
„Geh’ zu Deinem Bruder – ich bitte Dich darum! – Was hier noch zu thun ist, magst Du getrost mir überlassen!“
Wohin waren all ihr Stolz und ihre trotzige Widerstandskraft gekommen! Gehorsam ging sie in das Nebenzimmer, um sich zum Ausgehen anzukleiden. Als sie nach wenig Minuten zurückkehrte, stand Lothar in tiefem Sinnen vor dem Bilde der Madonna im Rosenhag. Bei dem Geräusch ihrer Schritte wandte er sich nach ihr um, und eine mächtige Bewegung spiegelte sich in seinen sonst so ruhigen Zügen. Aber er beherrschte sich dennoch und seine Stimme klang kaum verändert, als er – Marie zur Thür geleitend – sagte:
„Zur vollen Aufkärung dieses tragischen Kriminalfalles wird man Deines Zeugnisses nicht entrathen können. Aber Du sollst nicht gezwungen sein, es vor mir abzulegen. Unter den obwaltenden Umständen wird man die Angelegenheit auf mein Verlangen ohne Zweifel sogleich einem anderen Richter übertragen.“
Marie reichte ihm ihre Hand, und indem sie die schönen, in Thränen schwimmenden Augen voll zu ihm aufschlug, erwiderte sie leise: „Aber Du wirst es nicht verlangen, Lothar! Denn nur Dir werde ich bekennen, was ich zu bekennen habe!“
Sekundenlang standen sie schweigend Hand in Hand, noch in tiefster Seele erschüttert von der düsteren Majestät des Todes, dessen mächtiges Flügelrauschen sie über ihrem Haupte vernommen, und doch mit einem schüchtern emporkeimenden, wundersamen Glücksgefühl im Herzen.
Und ob sie dann auch ohne ein lautes Wort des Abschieds voneinander gingen, – sie wußten es doch, daß sie einander nach dieser Stunde nimmermehr würden verlieren können.
In einem Berliner Abendblatte fand sich an ziemlich auffallender Stelle folgende Mittheilung:
„Eine eigenartige Ueberraschung brachte den Besuchern des Schillertheaters die Vorstellung am letzten Sonntag. Die Direktion hatte das erste Auftreten einer sehr interessanten Debütantin angekündigt, einer jungen Dame, deren Name aus Anlaß eines unliebsamen Vorkommnisses auf dem großen Bazar für die Ueberschwemmten neuerdings in der vornehmen Gesellschaft Berlins vielfach genannt worden war. Die Logen und Ränge des Theaters hatten sich denn auch mit einer besonders auserlesenen und eleganten Zuhörerschaft gefüllt, und es ging eine Bewegung nicht geringen Erstaunens durch das Haus, als Herr Direkor Konstantin Rainer um sieben Uhr von der Bühne herab dem Publikum mittheilen mußte, daß ihn Fräulein Marie von Brenckendorf unmittelbar vor Beginn der Vorstellung und ohne Angabe genügender Gründe benachrichtigt habe, es sei ihr unmöglich, ihren Verpflichtungen nachzukommen und die Marianne in den ‚Geschwistern‘ zu spielen. Nur der liebenswürdigen Bereitwilligkeit des Fräulein Hellmund, die Partie noch in letzter Stunde zu übernehmen, habe er es zu danken, daß ihm die Aufführung des Stückes überhaupt möglich sei. – Unsere bewährte jugendliche Naive entledigte sich denn auch mit Glanz ihrer Aufgabe und wurde von dem dankbaren Publikum sowohl für ihre prächtige Leistung als für ihre opferwillige Hilfsbereitschaft mit Beifall überschüttet. In den Zwischenakten gab es im Foyer und in den Logengängen begreiflicherweise allerlei abenteuerliche Vermuthungen und Gerüchte über die Natur der Umstände, durch welche Fräulein v. B. am Auftreten verhindert worden sein könnte. Die Diskretion verbietet uns, Näheres darüber mitzutheilen, aber wir dürfen immerhin als gutverbürgte Neuigkeit verrathen, daß gestern im Hause des bekannten Zahnarztes Brenckendorf, welcher trotz seines bürgerlichen Namens der leibliche Bruder der jungen Dame ist, die Verlobung derselben mit ihrem Vetter, dem Gerichtsassessor v. B., stattgefunden hat. Der glückliche Bräutigam wird sich nun allerdings dazu verstehen müssen, die durch den Vertragsbruch seiner Braut verwirkte bedeutende Geldbuße [567] an Herrn Direktor Rainer zu zahlen, aber er dürfte diese Nothwendigkeit kaum sonderlich schmerzlich empfinden, da er ja das Glück hat, einen sehr begüterten Herrn, den kommandirenden General v. B., seinen Vater zu nennen. Den reizendsten Zug in diesem kleinen Familienlustspiel bildet jedenfalls der Umstand, daß der Herr Assessor ein sehr naher Verwandter desselben Dragonerlieutenants ist, welchen man aus Anlaß jener viel bemerkten Bazarscene in Verbindung mit seiner schönen Base zu nennen pflegte.“
Schon mit der ersten Morgenpost hatte der General von Brenckendorf nicht weniger als fünf Exemplare dieses im schönsten Zeitungsstil geschriebenen Artikels erhalten. Die liebenswürdigen Absender hatten sich zwar nicht genannt, aber der General zweifelte keinen Augenblick, daß sie in den Reihen seiner besten Freunde zu suchen seien. Gegen Mittag jedoch war ihm das bedeutsame Blatt zum sechsten Mal und diesmal nicht durch den Briefträger überreicht worden. Der Generallieutenant Graf Hainried hatte es in eigener Person auf den Schreibtisch Seiner Excellenz niedergelegt, und zwischen den beiden hohen Militärs war von vornherein kein Mißverständniß darüber gewesen, daß diese mit einer gewissen Feierlichkeit vollzogene Handlung einer höflichen Kriegserklärung gleichzuachten sei. Und weltmännisch höflich wie die Einleitung hatte sich auch der weitere Verlauf und der Abschluß ihrer Unterredung gestaltet. Der General von Brenckendorf hatte durchaus nichts gegen eine Lösung der zwischen seinem Sohne Engelbert und der Gräfin Helene Hainried bestehenden Beziehungen einzuwenden gehabt, und er hatte mit einer äußerst verbindlichen Miene die Versicherungen des innigsten Bedauerns entgegengenommen, welches der Generallieutenant für seine eigene Person natürlich über diese traurige Nothwendigkeit empfand. Er hatte beim Abschied sogar mit freundschaftlicher Wärme dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß die Damen des Generallieutenants, welche schon in diesen Tagen einen Erholungsaufenthalt im Süden nehmen sollten, recht angenehme und glückliche Reise haben möchten, – und erst als sich dann die Thür hinter seinem Besucher geschlossen, hatte er das unglückselige Blatt wüthend zerknittert und eine eben angezündete Cigarre zwischen den Fingern zerbrochen, als sähe er in ihr den Verfasser jenes Artikels oder eine andere, in diesem Augenblick vielleicht noch bitterer gehaßte Persönlichkeit.
Der Generallieutenant Graf Hainried aber stieß beim Verlassen des Hauses auf den Oberst von Herzogenstein, den persönlichen Adjutanten Seiner Majestät, als derselbe eben im Begriff war, durch die Gartenthür der Villa einzutreten. Die beiden Offiziere begrüßten sich höflich und der Oberst sagte mit einem bedeutsamen Lächeln und mit vorsichtig gedämpfter Stimme:
„Ich gratulire aufrichtig – Excellenz!“
Graf Hainried lehnte ab, aber mit einer Miene, die gut verrieth, wie angenehm ihn der Glückwunsch berührte.
„Das wäre etwas voreilig, lieber Oberst! Noch sind wir nicht so weit –“
„O, ich bin gut unterrichtet; es giebt keine bessere Quelle als die meinige. Majestät selbst hatten die Gnade, mich einzuweihen.“
„Das Vertrauen Seiner Majestät macht mich natürlich über alle Maßen glücklich; aber ich muß bekennen, daß ich die hohe Auszeichnung, welche mir da zugedacht worden ist, nicht ohne eine Regung des Bedauerns annehmen kann. Brenckendorf ist ein so ausgezeichneter Soldat . . .“
„Aber er ist unmöglich geworden, Herr Graf, ganz unmöglich. Und überdies wird es an einem Pflaster für die Wunde nicht fehlen. Im Vertrauen gesagt, Seine Majestät hat ihm eine ungewöhnlich hohe Ordensauszeichnung zugedacht – die erste Klasse des Roten Adlers.“
„Ah, das ist allerdings eine königliche Belohnung seiner treuen Dienste! Doch ich halte Sie auf, mein lieber Herr Oberst! Auf Wiedersehen!“
„Auf baldiges Wiedersehen, Excellenz! – Weiß der Himmel – es ist ja ein allerhöchster Auftrag, aber ich wünschte doch, daß ich erst um eine Viertelstunde älter wäre!“ –
Aufrecht und straff, mit stolz erhobenem Haupte, begrüßte der General von Brenckendorf seinen neuen Besucher. Seine Miene war kalt und gefaßt; aber es war die Gefaßtheit eines Mannes, welcher bereit ist, den Todesstreich zu empfangen. –
| * | * | |||
| * |
Die Generalin und ihre Tochter hatten sich eben zu einem Besuch gerüstet, als der Herr des Hauses in das Zimmer trat.
„Es thut mir leid, daß Ihr auf den Spaziergang oder was Ihr sonst vorhabt, verzichten müßt,“ sagte er mit vollkommener Ruhe; „aber es ist hohe Zeit, die Vorbereitungen zur Reise zu treffen. Wir fahren morgen mit dem Frühzuge nach Groß-Hagenow.“
„Wie? Nach Groß-Hagenow? Auf das Land?“ fragte Ihre Excellenz in maßlosem Erstaunen. „Jetzt – mitten im Winter?“
„Es läßt sich nicht ändern,“ erklärte der General mit einer Bestimmtheit, welche seine Angehörigen kannten. „Ich glaube, der Schlag würde mich treffen, wenn ich nur noch einen einzigen Tag inmitten dieser jämmerlichen Lügengesellschaft zubringen sollte. Packt die Koffer, sage ich Euch! Ich lechze danach, die ehrlich dummen Gesichter unserer Bauern wiederzusehen!“
Fassungslos war die Generalin in einen Sessel gesunken.
„Nein, es ist ja nicht möglich. Was, um Gotteswillen, ist denn geschehen?“
„O, nichts von besonderer Bedeutung! Zwei kleine Ueberraschungen, von denen Ihr die eine schon heute aus den Zeitungen erfahren könnt, während die andere erst in einigen Tagen zum Behagen unserer guten Freunde bekannt werden wird. Lothar hat sich mit einer Theaterprinzessin verlobt –“
„Mit Marie?“ fiel ihm Cilly fast jubelnd ins Wort, und selbst der streng verweisende Blick ihres Vaters scheuchte das freudige Aufleuchten nicht von ihrem Gesicht. „O, es kann ja keine andere sein als Marie!“
„Lothar hat sich mit einer Theaterprinzessin verlobt,“ wiederholte der General mit vermehrtem Nachdruck, „und er hat es für angemessen gehalten, mich diese hübsche Neuigkeit zuerst aus den Spalten eines Klatschblattes erfahren zu lassen. Zum anderen: man hat mir den Abschied gegeben!“
„Den Abschied?“ Die beiden Damen riefen es wie aus einem Munde. Das war allerdings eine Neuigkeit, die ihnen wie ein Märchen klingen mußte.
„Ja! Wenn auch nicht gerade mittels blauen Briefes wie einem überschuldeten Lieutenant. Aber es kommt im Grunde auf eins hinaus. Ich werde also aus Gesundheitsrücksichten um Enthebung von meinem Kommando bitten, der amtsmüde Kriegsminister von Reckenstein wird mein Nachfolger werden, und auf dem Ministersessel wird unser ausgezeichneter, trefflicher Freund Hainried Platz nehmen, der ehrliche Mann, der an diesen Dingen natürlich so unschuldig ist wie Dein Bologneserhündchen.“
„Ist es möglich? Ist es möglich?“ jammerte die Generalin. „Und nun sollen wir nicht einmal morgen mehr das Essen bei dem österreichischen Botschafter mitmachen?“
„Nein! Wir werden mit englischem Abschied verschwinden, wie es gefallenen Größen ziemt. Mir graut vor der Theilnahme unserer lieben Freunde und vor ihren zärtlichen Erkundigungen nach dem Stande meiner erschütterten Gesundheit!“
Ihre Excellenz ergab sich seufzend in das Unabänderliche.
„Dann muß ich wenigstens die Köchin heute nach Groß-Hagenow vorausschicken. Wir können uns doch nicht morgen am Tische des Oberverwalters beköstigen lassen!“
„Entscheide diese wichtige Angelegenheit ganz nach Deinem Ermessen, meine Liebe,“ erwiderte der General mit leisem Spott, „ich werde unterdessen die Anordnungen für die Erledigung der laufenden Dienstgeschäfte während meines Urlaubs treffen. Wenn Engelbert kommt, so sagt ihm, daß ich ihn zu sprechen wünsche. Und sorgt mir vor allem, daß die Abreise nicht irgend welcher Hindernisse wegen verschoben zu werden braucht! Ich habe einen Ekel vor allem, was mich hier umgiebt!“
„Mein armes, armes Kind!“ klagte die Generalin fast weinend, als sie mit Cilly allein war. „Gerade diese Saison ließ sich so lustig für Dich an. Wie viel Bälle hättest Du noch mitmachen können und wie viel ausgezeichnete Mahlzeiten! – Und jetzt sollst Du auf das Land! Es ist eine furchtbare Grausamkeit!“
Cilly aber lachte fröhlich auf und umschlang den Nacken der Betrübten, so weit es bei dem Umfange desselben möglich war.
„Nein, es ist reizend, Mama, es ist himmlisch, und ich freue mich darauf wie ein Kind! Das Schönste aber ist doch, daß Marie und Lothar ein Paar werden sollen – ich könnte mich rein auf den Kopf stellen vor Vergnügen.“
„Cilly! Cilly!“ rief Ihre Excellenz entsetzt. „Wenn das [568] Dein Vater gehört hätte! – Hast Du denn nicht gesehen, daß diese That Lothars ihn bis ins Herz getroffen hat?“
„Nein, Mamachen, davon habe ich wirklich nichts bemerkt. Glaube mir, im Grunde ist’s ihm ganz lieb so, wenn er sich das auch vielleicht heute und morgen selber noch nicht gestehen mag. Wenn man bei strotzender Kraft wegen erschütterter Gesundheit seinen Abschied nehmen soll, muß man wohl ein wenig knurrig und verbissen sein; aber ich wette, nach kaum drei Monaten ist der Papa zu der Erkenntniß gekommen, daß es doch im Grunde viel lustiger und behaglicher sei, den Gutsherrn auf Groß-Hagenow zu machen. Und dann, meine liebe, theure, einzige Herzensmama – dann wird sich auch alles andere finden!“
Sie küßte die verwunderte Herzensmama schallend auf den Mund und flog in ihr Zimmer, um mit eilender Feder einige kleine Briefchen zu schreiben: ihre überströmenden, jubelnden Glückwünsche für Lothar und Marie und zehn kurze Zeilen für Wolfgang Brenckendorf:
„Der Kriegsschauplatz ist verlegt; aber der veränderte Boden macht uns den Sieg gewiß. Wir haben Wind und Sonne für uns, da kann’s nicht mehr fehlen. Morgen früh geht’s mit Sack und Pack nach Groß-Hagenow. Wenn ich Dir nicht binnen heut und einem halben Jahre telegraphirt habe: Komm! – so muß ich wohl inzwischen gestorben sein. Und dazu fühlt sich durchaus nicht aufgelegt
Deine seelenvergnügte Cilly.“
Während die Generalin sorgenvoll überlegte, was man bei einer so überstürzten Uebersiedelung zur ungünstigsten Jahreszeit morgen im Herrenhause zu Groß-Hagenow wohl werde auf den Tisch bringen können, sang und jubilirte es hell wie Lerchengezwitscher durch das Haus:
„Kein Fluß ist so tief, keine Mauer so hoch,
Wenu zwei sich nur gut sind, sie sinden sich doch!“
Und diesmal wenigstens hatte sich das übermüthige Töchterchen des Generals als eine treffliche Menschenkennerin bewährt. Wohl wandelte Herr von Brenckendorf ein paar Wochen lang mit der Miene eines Menschenfeindes in den Gefilden seines prächtigen Besitzthums umher, und es hatte durchaus nicht den Anschein, als ob die reichlich gebotene Gelegenheit zum Anblick von Bauerngesichtern ihm die gehoffte Erquickung bereitete. Aber der Rote Adlerorden und das überaus huldvolle königliche Handschreiben, welches bald in allen Zeitungen zu lesen war, konnten ihre heilsame Wirkung auf sein verbittertes Gemüth nicht verfehlen. Auch machte sich allgemach der Einfluß des zugleich vergnüglichen und bequemen Landlebens mit seinen großen und kleinen Jagdausflügen und seinem lebhaften Verkehr der Gutsnachbarn wohlthuend fühlbar. Nach kaum zwei Monaten war der General frischer und heiterer als seit Jahren, und Cilly, die im Verkehr mit ihrem Vater ein bewundernswürdiges diplomatisches Geschick offenbarte, hatte in einer besonders günstigen Stunde den Muth, ihm mit allerlei vorbereitenden Umschreibungen ihr großes Geheimniß zu offenbaren. Es schmetterte sie durchaus nicht nieder, ja, es schien ihr nicht einmal unerwartet, daß der General mit einem schneidenden „Niemals!“ alle ihre Hoffnungen auf seine Nachgiebigkeit im Keime zu ersticken gedachte. Ohne Thränen und ohne Widerspruch entschlüpfte sie seinem ersten, ziemlich heftig aufwallenden Zorn, und zu seiner geheimen Ueberraschung zeigte sie ihm später weder eine schmollende noch eine trübselige Miene. Aber bei der ersten passenden Gelegenheit lieferte sie ihm durch ein lachend hingeworfenes Wort den Beweis, daß ihr Sinn sich nicht im mindesten geändert habe. Der General gab sich den Anschein, als habe er es nicht bemerkt, denn Cillys heiteres Gesicht und ihr helles Lachen waren ihm längst viel zu unentbehrlich geworden, als daß er sich ohne zwingende Noth der Freude an ihnen hätte berauben sollen. Und das nämliche Spiel wiederholte sich immer häufiger und immer offener, bis der General, fast ohne es selber zu bemerken, allgemach dahin kam, Cillys Anspielungen ohne jede Anwandelung von Aerger vernehmen zu können. Die vollständige Kapitulation aber hätte vielleicht doch noch eine geraume Weile auf sich warten lassen, wenn nicht rasch nach einander verschiedene Ereignisse eingetreten wären, welche Seine Excellenz wohl in gute Laune versetzen mußten.
Da war zunächst der Rücktritt des neuen Kriegsministers Grafen Hainried, welcher ihm eine nur schlecht verhehlte tiefinnige Genugthuung bereitete. Der schmiegsame und liebenswürdige Generallieutenant hatte offenbar die besonderen Erwartungen nicht erfüllt, welche man auf seine Talente gesetzt hatte; in einer schwierigen, parlamentarischen Klemme hatte er eine von der Regierung sehr peinlich empfundene Niederlage erlitten, und sein Abtreten vom Schauplatze der Oeffentlichkeit gestaltete sich demgemäß zu einem viel weniger ehrenvollen, als es das des Generals von Brenckendorf gewesen war. Wenn es dem letzteren aber in diesem Falle aus naheliegenden Schicklichkeitsgründen nicht gestattet war, seiner Freude einen lauten Ausdruck zu geben, so entfiel dieser Zwang um so vollständiger der zweiten Neuigkeit gegenüber, welche Engelbert auf einem Urlaubsbesuche in Groß-Hagenow überbrachte. Der Dragoneroffizier hatte augenscheinlich nicht allzu schwer an dem Schmerz getragen, welchen die Aufhebung seiner noch nicht einmal öffentlich verkündeten Verlobung mit der Gräfin Hainried ihm bereitet hatte. Er strahlte in Gesundheit, Schönheit und guter Laune wie nur je und platzte schon in der ersten Viertelstunde mit dem Bekenntniß heraus, daß Amors Rosenketten ihn abermals gefesselt hielten, und diesmal, wie er versicherte, unauflöslich und unzerreißbar. Die Besorgniß, welche sich bei dieser Erklärung auf dem Antlitz des Generals ausprägte, mußte wohl eine völlig unbegründete gewesen sein, denn nachdem ihm Engelbert in einer ernsthaften Unterredung unter vier Augen den Namen seiner Angebeteten genannt und über den Stand der ganzen Angelegenheit berichtet hatte, war der Herr Vater in der allerbesten Stimmung und ließ zur Mittagstafel die für besonders festliche Gelegenheiten aufgesparten, erlesensten Schloßabzüge aus dem Weinkeller holen.
Schon hatte man bei der heiteren Mahlzeit in dem kleinen Familienkreise auf die verschiedensten Gesundheiten angestoßen, als Engelbert sich plötzlich an die Stirn schlug und ausrief:
„Teufel, wie selbstsüchtig man doch wird, wenn man verliebt ist! Da vergesse ich wahrhaftig, daß ich noch etwas Besonderes zu erzählen habe. Lothar ist als Hilfsarbeiter in das Justizministerium berufen worden, nachdem ihn der Minister auf Grund seiner Abhandlung über die moderne Strafrechtspflege zu einer langen Unterredung eingeladen hatte. Man spricht allgemein davon, daß er sein Glück machen werde.“
Sowohl die Generalin als Cilly hatten, sobald Lothars Name zum ersten Male genannt worden war, etwas zaghafte Blicke auf das Antlitz des Hausherrn geworfen. Und in der That hatte sich etwas wie eine drohende Wolke auf der Stirn des Generals zusammengezogen. Aber ob es nun die Aussicht auf Engelberts glänzende Verheirathung, ob es die Wirkung der feurigen Schloßabzüge oder der durch allen Groll hindurchbrechende Vaterstolz war, welcher diese Wolke verscheuchte – genug, als Engelbert geendet hatte, sagte der General nach einem kleinen Räuspern:
„Es soll mich freuen, wenn man die Wahrheit spricht. Und wie steht es zwischen Euch? Immer noch die alte Feindschaft?“
„Gott bewahre! So was halt’ ich nicht auf die Dauer aus. Ein hitziges Wort läuft einem wohl ’mal über die Zunge, und, hol’s der Henker! gerade dann am leichtesten, wenn man am tiefsten im Unrecht ist! Im Unrecht aber bin ich damals mit der Marie gewesen, das läßt sich nun schon nicht leugnen, wenn’s auch nicht angenehm ist, es einzugestehen. Und das fraß doch ein bißchen an mir herum, obgleich ich mir ja sagen konnte, daß sie nicht allzu lange gebraucht habe, um sich zu trösten. Hundertmal war ich auf dem Wege zu ihrem Bruder, bei dem sie ja seit der Verlobung wohnt, um mir meine Begnadigung zu holen, aber ich weiß nicht, wie es zuging: vor dem Hause gab’s mir jedesmal einen innerlichen Ruck, so daß ich wohl oder übel wieder umkehren mußte. Und die Geschichte hätte sich vielleicht endlos hingezogen, wenn ich nicht eines Morgens in einer menschenleeren Allee des Thiergartens auf meinen Herrn Bruder gestoßen wäre. Wie er mich sah, machte er ein Gesicht wie acht Tage Regenwetter, und wir gingen aneinander vorüber, ohne uns zu grüßen. Aber nach drei Schritten gab es mir wieder so einen innerlichen Ruck, ich fuhr herum und –“
„In den Armen lagen sich beide,“ deklamirte Cilly feierlich, „und weinten vor Schmerz und Freude.“
Na, das nun gerade nicht! Aber es mußte mir wohl auf dem Gesichte geschrieben stehen, was ich ihm gern gesagt hätte, und so streckte er mir denn seine Hand entgegen, noch ehe ein Wort zwischen uns gefallen war. Wir wandelten gemeinschaftlich weiter, und nach einer kleinen halben Stunde war zwischen uns
[569][570] alles wieder glatt und eben, wie sich’s gehört. Seitdem ist keine Woche vergangen, daß wir nicht alle vier einen Abend oben bei Wolfgang gemüthlich verplaudert hätten, und ich versichere auf Ehre: wenn ich früher in Marie verliebt war, so habe ich heute einen beinahe ehrfürchtigen Respekt vor ihr. Das ist die rechte Frau für Lothar, und das Herz geht einem auf, wenn man die beiden so im Stillen beobachtet. Sie ist aufgeblüht wie ein Röslein, und in Lothar werdet Ihr den alten Brummbären und Stubenhocker auch schwerlich wiedererkennen.“
Der General hustete und beschäftigte sich sehr angelegentlich mit seinem Teller. Cilly aber fragte anscheinend ganz unbefangen:
„Und Wolfgang? Du unterhältst jetzt also freundschaftlichen Verkehr mit ihm?“
„Gewiß! Ist ja trotz seiner demokratischen Schrullen ein prächtiges altes Haus, und es weiß ohnedies schon die ganze Welt, daß wir Vettern sind. Stößt sich aber niemand mehr daran, auch nicht unter den Kameraden! Halb Berlin hebt ihn wegen seiner Geschicklichkeit in den Himmel, und das Geld kann er nur so mit Scheffeln messen. Er hat mich übrigens beauftragt, meinen verehrten Eltern die schönsten Empfehlungen und meinem lieben Schwesterchen die herzlichsten Gruße auszurichten.“
Der General schwieg noch immer, aber er sah gar nicht so böse aus, daß man dies Schweigen hätte für ein schlimmes Zeichen nehmen müssen. Das Thema wurde dann nicht weiter berührt; aber als Engelbert am nächsten Tage von Eltern und Schwester in dem eleganten Landauer des Gutsherrn zur Bahnstation begleitet wurde, sagte der alte General plötzlich:
„In drei Wochen feiern wir ja den Geburtstag der Mama; wenn Du Deinen Bruder dazu mitbringen willst, Engelbert, so soll er mir herzlich willkommen sein.“
„Das ist ein Wort, Vater! Seit gestern liegt mir’s auf dem Herzen, ohne daß ich den Muth hatte, damit herauszuplatzen. Aber – eines muß ich doch auf jede Gefahr hin sagen: allein – allein kommt er nicht!“
„Nun, so soll er mit seiner Braut kommen! Ich denke, es ist Platz genug im Schlosse!“
Obwohl sie im offenen Wagen fuhren und obwohl rechts und links auf den Feldern die Tagelöhner an der Frühlingsbestellung waren, sprang Cilly doch aus den Polstern auf, um sich dem General an die Brust zu werfen.
„O Du Herzenspapa! – Aber ich wußte es ja, hier draußen würde sich alles finden!“
| * | * | |||
| * |
An dem nämlichen Tage empfing Wolfgang Brenckendorf ein Telegramm, welches nichts weiter enthielt, als das einzige Wörtchen: „Komm!“ – und wenn es auch nicht gerade der Schah von Persien war, den er im Stich lassen mußte, so nahmen es ihm doch einige seiner vornehmsten Kunden sehr übel, daß er sich genöthigt sah, in dringender und unaufschiebbarer Angelegenheit plötzlich eine Reise anzutreten.
Der Empfang, welchen er auf Groß-Hagenow fand, war zwar ein wenig steif und kühl, doch von verbindlichster Höflichkeit, und nach Beendigung der fast einstündigen Unterhaltung, welche der General in seinem Arbeitskabinett mit dem Besucher hatte, schien auch der Verkehrston ein wesentlich wärmerer geworden zu sein. Jedenfalls hatte Seine Excellenz nichts dagegen einzuwenden, daß Cilly ihrem Vetter ohne weitere Begleitung den Park und die Gewächshäuser zeigte, und als sich der Zahnarzt am Abend verabschiedete, sagte der Gutsherr von Groß-Hagenow beim letzten Händedruck:
„Was bleibt mir altem Manne anderes übrig, als mich besiegt zu geben! Auf frohes Wiedersehen denn, mein lieber Sohn!“ –
| * | * | |||
| * |
Während im festlich erleuchteten Speisesaale des Schlosses Groß-Hagenow die Gläser der Gäste aneinander klangen auf das Glück der beiden Brautpaare des Hauses Brenckendorf, trieb der laue Frühlingswind sein Spiel mit den jungen Grashalmen auf einem schmucklosen Grabe. Weder Kreuz nach Stein nannte den Namen desjenigen, welchen man vor Monaten da unten gebettet hatte. Nur ein schwarzes Stäbchen war am Kopfende des Hügels in die Erde gesteckt, und es trug neben einer Zahl die Buchstaben J. H. – Nichts war da, was die Erinnerung an den armen Studenten aus Galizien auch nur für eine kurze Spanne Zeit hätte wacherhalten können im Gedächtniß der Menschen; die Spur seines Daseins war vertilgt und ausgelöscht, als hätte er niemals unter den Lebenden gewandelt.
Der Arm der irdischen Gerechtigkeit hatte ihn nicht mehr erreicht, um zu strafen, was er verschuldet. Er war vor einen Richter gerufen worden, von dem wir nicht wissen, wie schwer er die Sühne bemißt für unser Irren und Fehlen.
Das nur wissen wir, daß die kleinen Wiesenblumen auch über dem Haupte des Sünders blühen und daß die Nachtigall ihre sehnsüchtig süße Weise singt auch in dem Busch, der aus seinem Grabe sprießt.
Alle Rechte vorbehalten.
Volksheilstätten für Lungenkranke.
Unter allen Krankheiten der Menschheit, die verheerendsten Seuchen nicht ausgenommen, giebt es keine, an welcher jahraus jahrein so viele Menschen zu Grunde gehen, als die Lungenschwindsucht. Nun hat der berühmte „Bacillenvater“ Robert Koch in Berlin unumstößlich nachgewiesen, daß die alleinige Ursache dieser Krankheit der sogenannte Tuberkelbacillus ist, ein schlankes Stäbchen (bacillus = Stäbchen) von etwa fünf tausendstel (0,005) Millimeter Länge, so daß ein solches erst bei mindestens dreihundertfacher Vergrößerung in einem guten Mikroskope und gefärbt sichtbar zu werden anfängt.
Dieser Bacillus ist es, der die Lungenschwindsucht veranlaßt, in der Lunge des Kranken sich stark vermehrt und mit dem Auswurfe hinausbefördert wird. Und dieser Auswurf der Lungenkranken nun ist die hauptsächlichste Quelle der Gefahr für andere; denn wo dem Bacillus einige Wochen Ruhe zur Ansiedelung gelassen werden, wo er ferner ein geeignetes Nährmaterial für sich vorfindet, da richtet er große Verwüstungen an und ist äußerst schwer oder nie wieder zu vertreiben. Ich will hier nicht weiter auf Fragen eingehen, die endgültig noch nicht erledigt sind, so z. B. auf welche Weise der Auswurf ansteckend wirkt: ob dadurch, daß er vertrocknet, verstäubt und ‚eingeathmet‘ sich in den Lungen ansiedelt und die Schwindsucht hervorruft – eine Annahme, die durch ihre Einfachheit verlockend erscheint und von der Kochschen Schule auch zu der ihrigen gemacht worden ist, gegen die aber eine Menge schwerer Bedenken von gewichtiger Seite vorgebracht wird, – oder ob die Bacillen in trockenem oder feuchtem Zustande durch zufällige, wenn auch kleinste Wunden der Haut oder der Schleimhäute der Nase, des Mundes oder auf dem Wege der Lymphgefäße an den Ort gelangen, wo sie festen Fuß fassen – auf diese und andere Fragen ist hier nicht der Platz, näher einzugehen. Doch bleibt von der Beantwortung derselben die Thatsache unberührt, daß der bacillenhaltige Auswurf Lungenkranker der Hauptträger des Schwindsuchtsgiftes ist und deshalb unter allen Umständen so schnell und so gründlich wie möglich vernichtet werden muß. Nebenbei will ich nur noch darauf hinweisen, daß die Milch sowohl wie das Fleisch schwindsüchtiger (perlsüchtiger) Kühe, insbesondere erstere, wohl gar nicht so selten den Ausgangspunkt der menschlichen Schwindsucht bilden. Es ist nämlich nachgewiesen worden, daß die Milch von perlsüchtigem Rindvieh in 55 Prozent aller Fälle Schwindsuchtsbacillen enthielt. Wir sollen daraus die Lehre ziehen, nie rohe Milch zu genießen, sondern nur gekochte; längeres Kochen tödtet die Bacillen in der Milch unfehlbar, ohne den Nährwerth der letzteren herabzusetzen.
Alsbald nach der Entdeckung, daß die Lungenschwindsucht durch einen besonderen Spaltpilz hervorgerufen wird, glaubte eine Menge berühmter und unberühmter Aerzte, daß es nun das wichtigste sei, nach einem besonderen Heilmittel dagegen auf die Suche zu gehen, entweder um mit demselben die Bacillen im Innern des menschlichen Körpers unmittelbar zu tödten oder doch wenigstens die Gewebszellen oder die Gewebsflüssigkeit derartig zu verändern, [571] daß dieselben für die Tuberkelbacillen keinen geeigneten Nährboden mehr abgeben. An und für sich ist eine solche Ansicht und die aus derselben gezogene Schlußfolgerung ja nicht ganz unlogisch; haben wir doch gegen eine Reihe von Krankheiten, welche nachweislich ebenfalls durch Ansteckung infolge Berührung oder Ausdünstung entstehen, ein entsprechend geartetes Heilmittel, z. B. gegen das Wechselfieber Chinin, gegen den akuten Gelenkrheumatismus das salicylsaure Natron etc. Aber der Erfolg, den diese Heilmethode mit den Hunderten von Mitteln, vom benzoësauren Natron und Arsen angefangen bis zum Creosot und zur Einathmung überhitzter Luft, gegen die Schwindsucht aufzuweisen hat, ist mindestens gleich Null, wenn sie nicht, was wahrscheinlicher ist, sogar schädlich wirkt. „Die arzneiliche Behandlung der Lungenschwindsucht hat vollständig Bankerott gemacht“, urtheilt Professor Gerhardt-Berlin.
Trotzdem bricht sich die Ansicht, daß die Lungenschwindsucht eine heilbare Krankheit ist, immer mehr Bahn, dank den Erfolgen, welche hauptsächlich die besonders für Schwindsüchtige eingerichteten Heilanstalten in immer steigendem Maße aufzuweisen haben. Eine Statistik der letzten in der Heilanstalt zu Reiboldsgrün behandelten 2000 Fälle von wirklicher bacillärer Lungenschwindsucht lieferte folgendes Ergebniß: auf 100 Kranke entfallen geheilt 13,66%, bedeutend gebessert (d. h. sie verließen die Anstalt zu früh) 28,02%; gebessert (d. h. meist zu spät gekommen und zu früh abgereist) 28,60%, ungebessert 25,20%, gestorben 4,52%; also 70,28% thatsächliche Erfolge, welche sich noch ganz wesentlich vermehren und befestigen ließen, wenn die Kranken sofort nach den ersten Anzeichen der Erkrankung eine Heilanstalt aufsuchten und lange genug darin verblieben. Ich bin der festen Ueberzeugung, daß mindestens 75% aller Schwindsüchtigen vor einem frühzeitigen Tode bewahrt und wieder in ihrem Berufe arbeitsfähig werden könnten, wenn dieselben zeitig einer Heilanstalt für Lungenkranke übergeben würden und lange, etwa 3 Monate, in derselben verweilten. Diese Ueberzeugung drängt sich immer weiteren Kreisen auf, besonders auch den Führern in der ärztlichen Wissenschaft. Während seit meinem ersten Artikel in der „Gartenlaube“ (vergl. Seite 562 des Jahrg. 1882) manches Jahr verging, ohne daß viel mehr als die eine oder andere Zustimmung zu meinem Vorschlage der Errichtung von Volksheilstätten für Lungenkranke sich kundgab, scheint die Sache jetzt in Fluß zu kommen und durch die berufensten Hände in die richtigen Bahnen geleitet zu werden. Die Beschaffung der nöthigen Geldmittel spielt auch hier wieder wie so oft eine Hauptrolle.
In Berlin war schon vor mehreren Jahren bei den städtischen Behörden der Gedanke angeregt worden, durch Errichtung besonderer Anstalten für Tuberkulöse zu sorgen. Die Frage wurde der städtischen Deputation für Gesundheitspflege vorgelegt (30 Mitglieder) und von dieser einem Unterausschuß von Sachverständigen zur Beratung übergeben. Dieser Ausschuß hatte nun der Deputation für Gesundheitspflege folgende Erklärung vorgeschlagen: „Mit Rücksicht auf die große und voraussichtlich zunehmende Zahl der chronischen Brustkranken, welche in die städtischen Kranken- und Siechenanstalten aufgenommen werden müssen, ist die Errichtung einer besonderen Heil- und Pflegeanstalt für Lungenkranke in der Umgebung der Stadt dringend wünschenswerth.“
Erst am 22. Oktober 1889 kam dieser Vorschlag zur Beschlußfassung vor die städtische Deputation für Gesundheitspflege, und merkwürdigerweise wurde in derselben fast einstimmig beschlossen, die ganze Angelegenheit auf etwa ein Jahr zu vertagen. Als Grund hierfür wurde angegeben einmal die Rücksicht auf die großen anderweitigen gesundheitlichen Aufgaben, welche die Stadt Berlin in der nächsten Zeit zu erfüllen habe, sodann die Ansicht der in dem Unterausschuß anwesenden Aerzte, daß die Zahl der Ansteckungen mit Schwindsuchtsgift im Verhältniß zu der großen Anzahl Lungenkranker doch eine ganz außerordentlich geringe sei. Ein dem Ausschuß angehöriger Oberarzt eines der größten Berliner Krankenhäuser habe geltend gemacht, daß er tausend und mehr Tuberkulöse behandelt habe, ohne je einen vollständig sicheren Fall von Ansteckung festgestellt zu haben.
So wertvoll dieses Geständniß gerade für die Sonderheilanstalten für Lungenkranke ist, und so sehr diese Erfahrung mit meiner eigenen übereinstimmt, so wenig berührt diese Begründung den Kern der Angelegenheit. Denn es sollen nicht Volksheilstätten für Lungenkranke gebaut werden, um die Gesunden vor Ansteckung zu bewahren – das erzielt man viel billiger und einfacher durch die Vernichtung des tuberkulösen Auswurfes – sondern um die von der Tuberkulose Befallenen zu heilen. Obgleich nun auch in gut geleiteten allgemeinen Krankenhäusern Besserungen vorkommen – nach Angabe des oben erwähnten Krankenhausoberarztes bis zu 32,7% – so besteht in solchen Krankenhäusern doch der große Uebelstand, daß Lungenkranke nicht gern lange in denselben behalten werden. Nach dem Geständniß eines andern Berliner Krankenhausleiters werden den von akuten Leiden wie Typhus, Lungenentzündung und andern befallenen, aber durchweg heilbaren und der ärztlichen Fürsorge während der verhältnißmäßig kurzen Dauer ihres Leidens weit bedürftigeren Kranken gegenüber die Lungenschwindsüchtigen mehr oder weniger vernachlässigt und, weil sie den nötigen Platz für Schwerkranke wegnehmen, zu zeitig entlassen. Daß es da bald wieder beim alten sein wird, ist ja selbstverständlich, und es verringert sich damit der Prozentsatz der dauernd Gebesserten bis aus ein verschwindendes Maß.
Von der städtischen Deputation für Gesundheitspflege auf ein Jahr zurückgestellt, wurde die Frage der Errichtung von Schwindsuchtsheilstätten für Unbemittelte vom Geheimen Rath Professor Leyden in der Sitzung des „Vereins für innere Medizin“ vom 20. Januar dieses Jahres wieder vor einer andern, lediglich ärztlichen Hörerschaft auf die Tagesordnung gebracht, um eine lebhafte Erörterung hervorzurufen. Leyden gesteht ebenfalls, daß mit Arzneimitteln gegen die Schwindsucht nichts auszurichten sei, sondern daß der Schwerpunkt der Behandlung in dem hygieinisch-diätetischen Verfahren zu suchen sei, jenem Verfahren, welches den Körper zu kräftigen und widerstandsfähig zu machen bestrebt ist, damit er die Krankheitserreger nach und nach zu überwinden und auszuscheiden befähigt wird. Ferner gesteht er, daß nur die Tuberkulösen in den vorgeschrittenen Krankheitsstufen und mit schweren Nebenerkrankungen in Hospitälern behandelt werden können und sollen, daß aber die Mehrzahl der Tuberkulösen in den gewöhnlichen Krankenhäusern nicht in solcher Weise behandelt werden können, welche geeignet ist, die überhaupt erreichbaren Erfolge bei ihnen auch wirklich zu erzielen. Die Behandlung der Tuberkulösen in besonderen Heilanstalten sei ein wesentlicher Fortschritt der Neuzeit. Auch bespricht er dann die Ansteckungsgefahr der Schwindsucht und ist ebenfalls der Ansicht, daß dieselbe in gut geleiteten Anstalten mit Sicherheit vermieden werden könne. „Nach Beseitigung dieser Bedenken,“ sagt er, „steht die Anstaltsbehandlung wieder in vollstem Ansehen, woran sich der Wunsch knüpfen muß, die Vortheile einer solchen Behandlung einer größeren Zahl dieser unglücklichen Kranken zugänglich zu machen, und zwar entspricht es den großen menschenfreundlichen Bestrebungen unserer Zeit, diese Vortheile nicht bloß wie bisher den besser gestellten Ständen, sondern auch den weniger begüterten Gesellschaftsklassen zugänglich zu machen.“
Am Schlusse seiner Rede kommt er daraus zurück, daß es zweckmäßig und erfolgreich sein würde, wenn von ärztlicher Seite die Anregung zur Errichtung solcher Heilanstalten in der Umgebung Berlins, in welcher es gewiß an den geeigneten Räumlichkeiten nicht fehle, in die Hand genommen würde.
An diesen Vortrag schloß sich in den folgenden Sitzungen vom 3. und 20. Februar eine Besprechung, aus welcher zunächst leider zu ersehen war, daß, trotzdem Berlin durch seine neueren hygieinischen Einrichtungen zu einer sehr gesunden Stadt geworden ist, in welcher die Sterblichkeit der Bevölkerung vom Jahre 1075 bis 1885 von 29,7‰ auf 24,3‰ heruntergegangen ist, doch die Tuberkulose sich in Bezug auf ihre tödlichen Ausgänge in nichts gebessert habe; im Gegentheil starben im Jahre 1876 219, im Jahre 1885 aber 283 auf das Tausend der Gestorbenen an Schwindsucht, das heißt in einem Jahre in Berlin allein 4472 Personen. Und was sagte im Laufe der Verhandlung einer der Redner? „Was thun wir im allgemeinen der tuberkulösen Erkrankung gegenüber? Wir lassen es so gehen, wie es Gott gefällt … Durch die Errichtung von Heilstätten für Tuberkulöse wird man dem Elend der Armut entgegenarbeiten und den Kranken für sich, für seine Familie und für den Staat erhalten.“
Ein anderer Redner meinte: „Vor der Entdeckung des Tuberkelbacillus ist die Ansteckungsgefahr unterschätzt worden, jetzt wird sie überschätzt. Alle für dieselben beigebrachten Gründe sind rein theoretischer [572] Natur.“ Und ein anderer forderte, man solle die Kranken nicht nach dem Süden verschicken, weil sie im Eisenbahnwagen und in den Gasthöfen meist ein recht trauriges Dasein führten. Schließlich gelangte folgender Antrag zur Annahme: „Der Verein für innere Medizin“ beauftragt seinen Vorstand, sich mit den Vorständen anderer Vereine in Verbindung zu setzen, um die Gründung von Heilanstalten für Schwindsüchtige in der Nähe von Berlin zu bewerkstelligen.“ Damit ist diese wichtige Angelegenheit in guten Händen.
Ich habe den Verlauf der Behandlung im Berliner „Verein für innere Medizin“ zuerst geschildert, da diese die letzte Kundgebung in dieser Beziehung ist und aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches kommt. Vorher schon hatte Professor Finkelnburg aus Bonn in der Generalversammlung des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege am 2. Dez. 1889 zu Düsseldorf einen Vortrag gehalten: „Ueber die Errichtung von Volkssanatorien für Lungenschwindsüchtige“, in welchem derselbe ebenfalls, ausgehend von der Nutzlosigkeit aller gegen die Lungenschwindsucht neuerdings empfohlenen Mittel und von der erschreckend großen Verbreitung der Schwindsucht in Rheinland und Westfalen, wo zwischen 18,4 % bis 61 %, in einigen Berufsklassen, z. B. unter den Appreteuren in Crefeld, bis zu 92 % aller Todesfälle auf die Tuberkulose treffen, für die Errichtung von Volksheilstätten für Lungenkranke lebhaft eintritt. Auch Professor Finkelnburg betont die Ungefährlichkeit des Tuberkelparasiten gegenüber gesunden Menschen mit ungeschädigten Organen, die Unzulänglichkeit, ja geradezu Kärglichkeit der den unbemittelten Lungensüchtigen Deutschlands gewidmeten Krankenhauspflege, beweist diese seine Behauptung durch Zahlen, welche feststellen, daß im ganzen Deutschen Reiche auf je 100 Aufnahmen in die allgemeinen Krankenhäuser nur 4 % Lungenschwindsüchtige kamen, und verlangt am Schlusse seiner lehrreichen und vom edelsten Geiste getragenen Rede ein thatkräftiges Vorgehen in erster Reihe seitens der Gemeindeverwaltungen, insbesondere der größeren Städte, und der Krankenkassenvereine, denen größere Verwaltungsverbände, die Provinzial- und die Staatsbehörden zum Vortheil des Gemeinwohls mithelfend zur Seite stehen müßten. Erst nach einem thatkräftigen Vorgehen dieser berufenen Vertretungen öffentlicher Fürsorge sei bestimmt zu erwarten, daß auch die Privatwohlthätigkeit einem so menschenfreundlichen Unternehmen ihre Unterstützung zuwenden werde. Noch auf einen besonderen Punkt in der Rede Professor Finkelnburgs möchte ich hier aufmerksam machen. Er weist nämlich den zu errichtenden Anstalten für unbemittelte Lungenkranke noch einen erziehlichen Zweck zu, indem er annimmt, daß durch die mit Strenge durchgeführte Gewöhnung ihrer Pfleglinge an vorsichtige Behandlung des Auswurfes – und wie ich hinzufügen möchte, an natürliche Lebensweise, an Luft und gesunde Kost – allmählich eine Aufklärung und eine Erziehung weiterer Volksschichten außerhalb der Anstalten zur richtigen Pflege lungensüchtiger Kranken sich ergeben werde. Anstatt zu Ansteckungsherden der Krankheit zu werden, dürften diese Anstalten im Gegentheile Ausstrahlungspunkte einer geregelten Verhütung der Ansteckungsgefahr auch im Familienleben werden.
Nur einen Monat später, am 3. Januar 1890, hielt der – von dem Kehlkopfleiden des Kaisers Friedrich her bekannte – Professor Dr. Schrötter in Wien im „Wissenschaftlichen Klub“ daselbst einen Vortrag „Ueber die Tuberkulose und die Mittel zu ihrer Heilung“. Er weist zunächst darauf hin, daß in Wien durchschnittlich täglich 15 Menschen derselben zum Opfer fallen, was im Jahre etwa 5500 macht, also an sich und im Verhältniß zur Zahl der Todesfälle überhaupt viel mehr als in Berlin. Wien ist recht eigentlich eine Schwindsuchtsstadt, in ihr fallen – statt 1/7 wie anderswo – 1/4 aller Menschen, also 25 % der Schwindsucht zum Opfer, und selbst die Wiener Aerzte nennen die Schwindsucht die „Wiener Krankheit“. Besonders in den Armen- und Arbeitervierteln haust dieselbe schrecklich. Ferner huldigt auch Schrötter wie wohl zur Zeit mit Recht alle erfahrenen Forscher der Annahme, daß sich der schwindsüchtige Mensch zur Zeit der Ansteckung unter ganz besonders günstigen Bedingungen zur Aufnahme der kleinen Lebewesen, also in einer zeitweilig besonders gesteigerten Empfänglichkeit befunden habe. Also auch Schrötter kommt ohne die Annahme einer angeborenen oder ererbten besonderen Veranlagung nicht aus. Besonders neigt er – das sei hier nur nebenbei bemerkt – der Ansicht zu, daß viele Erkrankungen an Schwindsucht in vorgerückterem Alter von einer aus der frühesten Kindheit herstammenden, aber Jahre lang ohne alle äußere Anzeichen bestehenden tuberkulösen Entartung der Lymphdrüsen ausgehen, woraus wir den Schluß zu ziehen haben, daß Kinder, auf denen der Verdacht ruht, mit tuberkulösen (skrophulösen) Drüsenherden behaftet zu sein, ganz besonders reichlich ernährt und durch sorgfältige Abhärtung widerstandsfähig gemacht werden müssen. Dies gilt besonders für die Zeit der Entwickelung.
Nachdem Schrötter sodann noch einige Worte über die nothwendigen Vorbeugungsmittel gesprochen und der Vernichtung der Auswurfstoffe Erkrankter das Wort geredet hat, gelangt er zu der Beantwortung der Frage: „Was haben wir nun aber mit dem einmal erkrankten Individuum zu thun? Ist die Tuberkulose heilbar?“
„Glücklicherweise unzweifelhaft ‚ja‘“ lautet die Antwort. Aber Tausende von Mitteln und Verfahrungsweisen sind als sichere Heilmittel gepriesen worden, keins hat dem vorurtheilsfreien, unparteiischen Prüfen der Wissenschaft standhalten können … „Eines aber hat sich unter allen Umständen als sicherstes Heilmittel erwiesen, nämlich die möglichste Hebung der Ernährung und Kräftigung des Organismus, und um diese zu erzielen, der reichlichste Aufenthalt in reiner Luft mit allen Anregungen, welche durch eine solche auf unsern Körper gegeben sind. In diese Bahn müssen wir somit unsere ganzen Bestrebungen lenken.“ Und nun kommt er ebenfalls zu dem Schlusse, daß es nothwendig sei, für die 3400 mittellosen Schwindsüchtigen Wiens, welche die allgemeinen Krankenhäuser bevölkern, eigene Heilanstalten zu errichten, während man es den Wohlhabenden überlassen könne, nach dem Rathe ihrer Aerzte Kurorte oder Sonderheilanstalten für Lungenkranke aufzusuchen. Die Kosten der Errichtung solcher Pflegestätten für unbemittelte Lungenkranke können nicht in Betracht kommen, wo es sich um das Wohl von Tausenden handele, von denen dem Staate eine große Menge erhalten werden könne. Auf dem Südende der englischen Insel Wight, in Undercliff, bestehe seit 21 Jahren eine solche für 280 unbemittelte Kranke bestimmte, in einer überaus reichen Weise ausgestattete Anstalt. Die Sterblichkeit in derselben betrage nur 3,8 %. Auch in Wien sei ein Verein in der Gründung begriffen, der sich zur Aufgabe stelle, Gleichgesinnte herbeizuziehen, um die nöthigen Mittel aufzubringen. An der Spitze desselben stehen die Direktoren der 3 größten Krankenanstalten Wiens.
Soweit Schrötter.
Es war mir eine große Genugthuung, den geneigten Lesern in kurzem Auszuge die Ansichten dreier so hervorragender Gelehrten an drei verschiedenen Universitäten mittheilen zu können Noch mehr Genugthuung gewährt es mir, daß es überall Aerzte sind, welche die Anregung zu einem so durchaus menschenfreundlichen Werke öffentlich gegeben haben.
Gemeinsam heben alle drei Redner hervor:
a) Die Tuberkulose ist zwar ansteckend, aber ihre Ansteckungsfähigkeit wird bei weitem überschätzt.
b) Die Tuberkulose ist heilbar, aber nicht durch eines der hundert gegen dieselbe angepriesenen Mittel, sondern nur durch dauernden Aufenthalt in reiner Luft und Kräftigung des gesammten Organismus.
c) Das wird am besten erreicht in Sonderheilanstalten für Tuberkulöse, die aber durchweg nur den Bemittelten zugänglich sind; deshalb
d) ist es nothwendig, Volksheilstätten für unbemittelte Lungenkranke in der Näche der großen Städte zu errichten.
Möge die fast gleichzeitig von drei Seiten ausgegangene Anregung auf fruchtbaren Boden fallen!
Wer meinem Berichte aufmerksam bis hierher gefolgt ist und auch meinen Artikel in Nr. 34 der „Gartenlaube“ von 1882 gelesen hat, dem muß es aufgefallen sein, daß keiner der drei angeführten Redner dafür eingetreten ist, solche Anstalten im Gebirge zu errichten. Dies wird verständlich aus dem Zwecke, den dieselben verfolgen. Es sollen die allgemeinen Krankenhäuser der großen Städte von den Schwindsüchtigen entlastet und letztere in möglichster Nähe derselben in besonderen Anstalten untergebracht werden. Da empfiehlt es sich allerdings schon der bedeutend vermehrten Kosten wegen nicht, die Schwindsuchtsheilanstalten für Unbemittelte weit ab von den Städten im Gebirge zu errichten. Sodann aber ist nicht zu verkennen, daß die neuen [573] theoretischen Erwägungen, nach denen zur Heilung von Schwindsucht nur reichliche Ernährung und reine Luft nöthig sein sollen, der Errichtung von Gebirgsheilanstalten nicht förderlich sein können. Und doch wird in wenigen Jahren nach Inbetriebsetzung der Niederungsheilanstalten für Lungenkranke ganz gewiß ein gründlicher Wandel der Ansichten stattfinden, wenn man erst durch die Erfahrung und durch Zahlenausweise gefunden haben wird, wie viel weniger Besserungen und Heilungen in denselben zu erzielen sind, als in Gebirgsheilstätten. Angenommen auch, das Waldgebirge enthalte nichts in sich, was in besonderer Weise auf die Besserung einer schwindsüchtigen Lunge wirkt: weder der geringere Atmosphärendruck, noch die größere Dünne der Einathmungsluft, weder die große Menge des in der Luft enthaltenen Ozons, noch die durchweg günstigeren Grundwasserverhältnisse, weder die stärkere Besonnung im Winter, noch der größere Schutz gegen starke Luftströmungen zu allen Jahreszeiten, weder die größere Kühle der Luft im Sommer, noch die größere Beständigkeit des Klimas im allgemeinen, noch sonstige günstige klimatische Umstände seien einzeln oder in ihrer Gesammtheit ausschlaggebend für die vorzüglichen Erfolge der Waldgebirgsheilanstalten; zugegeben ferner, der Begriff der Sicherheit gewisser Orte gegen Tuberkulose sei hinfällig und zur Heilung von Schwindsucht nur die dauernde Einathmung reinster Luft und reichliche Ernährung vonnöthen, so frage ich: wo in aller Welt giebt es reinere Luft, verbunden mit größerem Schutz gegen etwaige Unbilden der Witterung, als im waldreichen immergrünen Gebirge, und wo entwickelt sich ein solch riesiger Appetit und infolge dessen ein solch rascher Neuaufbau des lungensiechen Körpers wie eben dort? Wie oft habe ich es nicht erlebt, daß selbst Schwerkranke von der ersten Stunde des Aufenthaltes in der Gebirgsanstalt an einen Appetit entwickelten, über den sie sich so freuten, daß sie dies Ereigniß telegraphisch der besorgten Mutter mittheilten, die seit Monaten sich vergebens abmühte, dem Kranken ihre mit eigener Hand bereiteten kräftigen Speisen und Leckerbissen aufzunöthigen! Bei minder schwer Kranken tritt ein solcher Appetit ohne Ausnahme sofort ein. Man soll die Einrichtung von Heilanstalten für unbemittelte Lungenkranke in der Umgebung großer Städte um keinen Preis hindern. Aber man vergesse nicht, bewaldete Höhen zur Anlage zu wählen, wenn sie nahe genug liegen. Denn ich bin aus fast zwanzigjähriger Erfahrung mit Dr. Volland in Davos der noch durch keine stichhaltigen Gründe widerlegten Ansicht, daß es nicht allein darauf ankommt, wie, sondern insbesondere wo der Lungenkranke behandelt wird, und daß bei ins Belieben gestellter Auswahl eines Ortes immer und unter allen Umständen einer geschlossenen Heilanstalt im Waldgebirge der Vorzug zu geben ist. Den Höhenanstalten für Lungenkranke gehört nach wie vor die Zukunft.
Das Kleinod des Fichtelgebirges.
Eine Erinnerung an das Bergfestspiel auf der Luisenburg bei Wunsiedel.
Im Herzen des Fichtelgebirges liegt ein Städtchen, dessen Namen in den letzten Tagen öfter genannt wurde als sonst vielleicht in Jahren. Der gebildete Deutsche kennt es allenfalls als Geburtsort unseres größten Humoristen. „Ich bin gerne in dir geboren, du kleine aber lichte Stadt,“ sagt Jean Paul einmal von seinem Wunsiedel, und er wiederholt: „Ich bin gerne in dir geboren, Städtchen am langen, hohen, hohen Gebirge, dessen Gipfel wie Adlerhäupter zu uns niedersehen! Deinen Bergthron hast du verschönert durch die Bergstufen zu ihm.“ – Der „Bergthron“ Wunsiedels aber ist die Luisenburg, die sich in dunklem Fichtengewande unmittelbar hinter dem Städtchen in nordwestlicher Richtung erhebt.
Dieser Granitberg ist das herrlichste Kleinod des Fichtelgebirges, ja man darf kühn behaupten, der deutschen Mittelgebirge überhaupt; er steigt vor uns in schönen Linien auf, aber wir nehmen nichts Besonderes an ihm wahr, nur ein geheimnißvolles Weben wie von Geistern der Sage scheint über seinem düsteren Grün zu walten. Da trittst du in sein Waldesdunkel, und eine Welt von Wundern thut sich vor deinem staunenden Auge auf! Ein gewaltiges Felsenchaos, so wild, so wirr, daß es aller Beschreibung spottet, bannt plötzlich deinen Blick! Kein Geringerer als der große Goethe schrieb in seinem 71. Jahre von der Luisenburg, daß ihm „dessengleichen auf allen Wanderungen“ – und er war viel und weit gewandert – „niemals wieder vorgekommen.“ Immer neue Wunder, immer neue Reize begegnen dir, wenn du nun weiter vordringst: da blickt aus einer dunkeln Felsengrotte gleißend Gold hervor – du wähnst, es sei ein Traum, und blickst nochmals genauer hin; und siehe, es ist wirklich so: hell leuchtet Goldesschimmer! Unwillkürlich denkt man an das Wort Mephistos im Faust:
Der nüchterne Naturforscher jedoch weiß dir zu erklären, daß dieses goldige Leuchten herrührt von den perlschnurartig aneinandergereihten wasserklaren Zellen des Goldmooses, des zierlichsten aller Moospflänzchen, dem die Fähigkeit zukommt, das Tageslicht in so merkwürdigem Goldglanze zurückzustrahlen. Ueberhaupt findet sich die kleine Welt der Moose in entzückender Mannigfaltigkeit und Schönheit auf den Felsblöcken der Luisenburg. Das ehrwürdige Urgestein ist überall mit wunderbaren Teppichen belegt, aus deren smaragdenem Grunde hellgraue, tief braunschwarze, ja zuweilen lebhaft rothe Farben, alle von Moosarten herrührend, eingewebt sind. Die „Moosgrube“ nennt sich auch ein schöner Felsengang, der auf unserer Abbildung (S. 574) sich zeigt.
Doch wir können nicht alle Herrlichkeiten unseres Berges aufzählen, es würde Seiten füllen, wenn wir auch nur die ausgezeichnetsten Stellen namhaft machen wollten. „Eine Beschreibung der Luisenburg, die einen klaren Begriff von diesem in seiner Art einzigen Felsenhaine gäbe, ist selbst für den begabtesten Stilisten eine Sache der Unmöglichkeit“, so urtheilt schon Ludwig Storch, der im Jahre 1860 die Luisenburg für die „Gartenlaube“ schilderte. Wir wollen heute noch einen Blick auf die Geschichte dieser Bergwildniß werfen!
Uralt wie sein Gestein ist der Ursprung der Sagen des Berges. Sind ja überhaupt „in dem Innern des Fichtelgebirges die geheimen Sagenbehälter wie die Wasserkammern, von denen aus das Land im Norden und Osten, im Süden und Westen gesättigt wird“. Salomo und Karl der Große, der Heiland und der Teufel, alle sollen sie hier gewesen sein. Da finden wir „Druidenschüsseln“ wie auf dem „Kreuz“, einem der höchsten Punkte der Luisenburg, – der Volksmund nennt hier diese rundlichen Vertiefungen in den Felsenflächen „Teufels Rasierschüsseln“; von Kobolden, Nymphen, Walen (goldsuchenden und goldmachenden Dämonen) geben noch Chroniken aus dem vorigen Jahrhundert reichlich Kunde. Folgt man den Spuren der Geschichte, so tritt uns die Luisenburg als Sitz eines Raubritternestes entgegen, das, damals „Losburg“ geheißen, im 13. oder 14. Jahrhundert von den Männern aus Eger zerstört wurde. Nur durch eine List gelang es, so weiß der Chronist zu berichten, der Burg beizukommen: die Mannen von Eger kleideten sich wie Troßknechte
[574] des Raubritters, und der Burgvogt ließ sie ein in dem Wahne, es seien seines eigenen Herrn heimkehrende Leute.
Jahrhunderte lang lagen dann Mauertrümmer und Felsen, ein wirres Labyrinth, durcheinander, selten von einem kühnen menschlichen Fuße besucht, aber lange Zeit hindurch Wohnung von Füchsen und Luchsen. Nur ein Tag im Jahre war’s, der die Wunsiedler massenweise herauflockte, und eine Stelle, die sie besonders anzog und vereinte. Dieser Tag war der in die Mitte des Juli fallende St. Margarethentag, und diese Stätte eine riesige Granitplatte, die Bühne für ein seltsames Volksvergnügen, dessen wir heute gedenken müssen, da wieder dramatische Bilder durch die Luisenburg dahinziehen. Auf jener Granitplatte wurden nämlich lateinische, von Lehrern des Wunsiedler Lyceums verfaßte Schauspiele durch Schüler der Anstalt aufgeführt. Die Stadtkammer verwilligte Geld, es wurden Hütten gebaut; auch saß das nur wunsiedelisch Deutsch verstehende Publikum auf den zerstreuten Granitblöcken umher und stärkte die von ihren lateinischen Anstrengungen sich erholenden Schauspieler mit Wurst, Schinken und Bier. Zuletzt belustigte man sich fichtelgebirgisch auf eigene Faust, so daß der klassisch begonnene Tag schließlich doch noch zum richtigen Volksfeste ausschlug. Noch 1764 wurde der St. Margarethentag auf die angegebene Weise gefeiert. Sonst aber blieb es einsam und leer an der Stätte; es war dort nicht recht geheuer nach dem Glauben des Volkes, und so blieb man lieber weg. – Dies wurde anders am Ende des vorigen Jahrhunderts. Eine Gesellschaft wackerer Wunsiedler Bürger, an deren Spitze der von hohem Gemeinsinn erfüllte Stadtphysikus Schmidt stand, machte es sich zur Aufgabe, die Wunderwelt des Berges zu erschließen und heiterer lebensfroher Geselligkeit zu übergeben. Die unwirthliche Felsenwildniß wurde durch diese Männer, wie Goethe sagt, „spazierbar und im einzelnen beschaulich gemacht“, und dankbar feierten nun am 20. Juli die Enkel den hundertsten Jahrestag der Erschließung der „Luxburg“, wie man damals noch den Berg benannte. – Wie kam aber diese schauerlich großartige Felsenwildniß der Luxburg zu ihrem friedlich schönen Namen „Luisenburg“? – Es war in den Junitagen des Jahres 1805, da weilte in dem nahen Alexandersbad der König Friedrich Wilhelm III. und seine von allen Deutschen hochverehrte Gemahlin Luise. Die Königin Luise stand damals, 29 Jahre alt, in der höchsten Blüthe ihrer majestätischen milden Schönheit, deren Zauber kein Herz in ihrer Nähe sich entziehen konnte. Es ist Thatsache, daß selbst alte Leute aus dem Volke bei ihrem Anblick vor Entzücken weinten und jedermann ihr eine fast abgöttische Verehrung zollte, die durchaus nichts Gemachtes an sich hatte, sondern der nothwendige Herzenszoll an ihre mit sanfter Würde verbundene hohe Schönheit war. Jener Aufenthalt in Alexandersbad waren Tage hohen Genusses für die Königin, vielleicht die glücklichsten ihres Lebens, der Silberblick desselben, hinter welchem die Nacht düster aufstieg. Es war das Jahr vor der Schlacht bei Jena und Auerstädt, in der die Macht des preußischen Staates unter den Tritten des korsischen Eroberers zusammenbrach. Und der Königin Luise war es nicht mehr beschieden, den neuen Tag, der auf die Nacht folgte, noch zu erleben.
Damals aber, in der Idylle von Alexandersbad, ahnte man noch nichts von solchem unsäglichen Unheil. Ein Freudentag reihte sich an den andern; die Hochgefeierte lebte in einem dauernden Wonnerausch. Alles, was Füße hatte, eilte in das grüne Thal der Waldquelle, eine Massenwanderung der preußisch-fränkischen Bevölkerung zum allgemeinen Freudenfeste. Die Königin sehen und ihr zujauchzen, galt den treuen Menschen für das höchste Glück. Greise und Greisinnen mußten herbeigeführt werden, um der hohen Frau einen zärtlichen Blick zuwerfen, ein Segenswort zurufen zu können; Mütter trugen ihre Kinder meilenweit, um ihnen die geliebte Landesmutter zu zeigen.
Darf es uns Wunder nehmen, daß da die Schöpfer der neuen Anlagen in der Luxburg auf den Gedanken kamen, ihr schönes Kleinod mit dem geliebtesten Namen, den sie kannten, zu taufen? Und so geschah’s; als der Hof am 15. Juni dem schönen Fleck Erde einen Besuch abstattete, da trat ein Chor weißgekleideter Mädchen aus der am Wege gelegenen, jetzt „Klingershöhle“ benannten Grotte und vekündigte den königlichen Gästen, daß der Berg von nun an „Luisenburg“ heißen werde.
Doch nun zu der Gegenwart und ihrer festlichen Feier! Den Mittelpunkt derselben bildete ein von Reallehrer Ludwig Hacker verfaßtes Bergfestspiel „Die Losburg“ *[2]. Es läßt den Berg selbst seine Geschicke in großen Zügen erzählen. Der großartige Felsenschauplatz belebte sich mit dramatischen Bildern, durch die sich der einheitliche Gedanke hindurchzieht, daß der Fluch, der auf dem Berge infolge der dämonischen Macht des Goldes lastete, durch die reine Weiblichkeit einer hohen Frau wieder gesühnt wird. So wurde die Feier der Luisenburg-Eröffnung zugleich zu einer nationalen Huldigung für die hochverehrte Königin. Der Erfolg war ein unbestrittener, durchschlagender, und man darf den Lorbeerkranz, welcher dem Verfasser am Schlusse der Vorstellung überreicht wurde, als einen reich verdienten bezeichnen; hatte der Dichter doch auch das mühevolle Amt des Regisseurs auf seine Schultern genommen und nicht bloß alle Rollen den Mitspielenden persönlich einstudiert, sondern auch von seinem erhabenen Beobachtungsposten aus den Gang des ganzen Stückes geleitet!
Aber welch eine Bühne diente auch dem Spiele zum Schauplatz! Die herrlichste, die je eines Menschen Auge geschaut hat! Unter den rauschenden Aesten gewaltiger Tannen und Fichten harrt die Menge erwartungsvoll der Dinge, die da kommen sollen, vor sich den mächtigen Aufbau der moosbewachsenen Felsen, die, vier Stockwerk übereinander aufgethürmt, den „Max-Josephsplatz“ der Luisenburg umgeben. Eine weihevolle Stimmung liegt über dem Ganzen. Himmelstrebende Granitmassen bilden die Coulissen, geheimnißvolle Grotten und Schluchten entdeckt das spähende Auge mehr und mehr, und über all dem rankt sich soffitenartig das dunkelgrüne Gezweige der ehrwürdigen Bäume, das Tageslicht nur gedämpft hindurchlassend. Bricht sich aber ein heller Sonnenstrahl durch das Geäste Bahn, dann erscheint die Bühne in dem Zauber einer unvergleichlichen Verklärung.
Hornsignale und Kampfgetöse tönen vom Fuße des Berges
[575]zur Bühne herauf; die alte Raubritterwelt, die Zeit des Faustrechtes steigt vor uns auf. Ein grauser Mord vollzieht sich vor unseren Augen! Troßknechte des Raubritters auf Losburg tragen Beutestücke die Burgtreppe hinauf. Sterbend verflucht der Erschlagene, ein fränkischer Edelmann, den Raubritter und seine Burg. Eine bange, düstere Stimmung bemächtigt sich der Gemüther beim Anschauen dieses Bildes. Aber bald macht sie einer freudigen Erregung Platz!
Eine ganze Fluth kleiner lustiger Gnomen ergießt sich allmählich aus dem Innern des Berges. Erst einzeln, dann immer zahlreicher kommen sie aus allen Löchern, Klüften, Spalten eilig hervor, die bunten Gestältchen in rothen, blauen, gelben Kapuzen, langen lichten Bärten, in Schurzfell und Bluse, hüpfend und springend; neckische Bilder entwickeln sich, immer von neuem das Auge fesselnd. Der Gnomenkönig Alberich, eine majestätische Erscheinung, kündet neues Unheil an: die bittersten Feinde der Alben, die Walen, auch Venediger geheißen, nahen. Die Alben werden zu treuer Wachsamkeit aufgerufen und verschwinden, wie sie gekommen sind; der Berg saugt sie eiligst wieder ein.
Nachdem die Feinde, die „düstern Wühler in der Erde Schoß“, ihre verführerische Macht auch an schlichten Landleuten geübt, mit teuflischer Gewandtheit in die Herzen frommer Wallfahrer die Gier nach Gold und sinnlicher Lust pflanzend, nachdem Greuel über Greuel auf die Schultern des Berges sich gehäuft, vollzieht sich der Fluch; das Raubnest geht in Flammen auf, der Berg liegt öd und wüst, von Menschen scheu gemieden. –
Da naht die Zeit der Entsühnung!
„Es kam von Norden hergezogen
Ein Stern so hehr, so mild, so klar,
Wie keiner je am Himmelsbogen
Der Heimath aufgegangen war:
Da, als Luise, du erschienen,
Da ward gelöst der Zauberbann,
Vor deinen engelgleichen Mienen
Der alte Fluch in nichts verrann.“
Zum heutigen Feste will wiederum sie erscheinen, die Deutschland seinen guten Engel nennt, will die Fahne mit einem selbstgestickten L, welche sie in jenen Tagen von 1805 den Wunsiedlern geschenkt, von neuem weihen.
Hoch oben tritt die Hehre aus einer Felsengrotte in der Haltung, wie das bekannte Richtersche Bild sie darstellt. Vom hohen Fels segnet sie den Berg, seine Quellen, seine Lüfte und schreitet majestätisch langsam unter den Klängen einer leisen, lieblich feierlichen Musik herab, besteigt den von Alben errichteten Thron und empfängt die Huldigungen der Wunsiedler, die sich vor der hohen, königlichen Gestalt in tiefer Ehrfurcht neigen.
Gar manches Auge sah man feucht werden bei dieser erhebend würdevollen Feier.
Nachdem die Königin die Fahne gesegnet, nachdem die Bürger ihr gelobt, „treu zu stehen zum großen Vaterland in Glück und Noth“, stimmt die Musik „Deutschland, Deutschland über alles“ an; Veteranen mit Fahnen der verschiedenen deutschen Bundesstaaten sämmtliche zweihundert Mitspielende sammeln sich auf der Bühne; Norddeutschland und Süddeutschland, sinnbildlich durch einen preußischen und einen bayerischen Soldaten dargestellt, reichen sich vor dem Throne brüderlich die Hand; und im vollen Chor, auch von den Zuschauern begeisterungsvoll mitgesungen, braust der vaterländische Gesang durch den herrlichen Tann!
Das Spiel ist nunmehr zum Schlusse gelangt.
Rasch bildet sich ein überaus farbenprächtiger Festzug, der sich in wunderbaren Linien die Felsensteige empor und wieder herabwindet bis zum „Gesellschaftsplatz“ der Luisenburg, wo die Alben zum Abschluß des Zuges noch einen trefflich eingeschulten Huldigungsreigen vorführen.
Alle Rechte vorbehalten.
Denksprüche von D. Sanders.
Die Wahrheit und der Diamant
Sind an sich werthvoll; doch erkannt
Wird meist ihr Werth erst und begriffen,
Wenn sie, von Künstlerhand geschliffen,
In rechte Fassung sind gebracht.
Hell funkelnd strahlt dann der Brillant
Und jeder preiset seine Pracht.
Ein Spruch, der jedem leuchtet ein,
Ist eben solcher Edelstein.
Man fragt nicht viel bei deinen Thaten,
Ob Gutes du gewollt, wenn sie sind schlecht gerathen.
Des Vaters wird mit Segen oder Fluch gedacht
Nach dem, was Böses oder Gutes hat der Sohn vollbracht.
Ruhm, der dir folget, erfreut;
doch er peinigt dich, wenn du ihm nachjagst.
Sind Lieb’ und Eifersucht ein Schwesternpaar,
Sind’s Stiefgeschwister doch nur, das ist klar!
Ungleicher könnten nicht die Väter von den zwein,
„Vertrauen“ der und dieser „Mißtrau’n“ sein.
[576]
Vermißten-Liste. (Fortsetzung von Seite 667 den Jahrg. 1889.)
206) Tiefbekümmert bittet eine Mutter um Nachrichten über ihren Sohn, den Schlossergehilfen Paul Haag, gen. Joseph Paul, welcher am 18. April 1868 zu Erlangen in Bayern geboren ist. Haag begab sich 1881 nach Philadelphia, wo ihn noch im Jahre 1887 Briefe unter der Adresse Joseph Paul, 828 Palm-Str. erreichten. Der an diese Adresse im September 1887 gerichtete Brief seines Vormundes kam als unbestellbar zurück. Einem seiner Briefe nach hatte der Vermißte die Absicht, zur See zu gehen.
207) Der Seemann Isidor Reinhard Staberow, geb. am 8. März 1824 zu Tharand in Sachsen, schrieb zum letzten Male aus Greenock, wo er sich im August 1876 auf das Schiff „Arabia“ (Kapitän Kleanforth) als zweiter Steuermann verdungen hatte, um nach Quebec zu fahren. Weiteren eingezogenen Mittheilungen zufolge soll Staberow am 18. Jan. 1879 das Schiff „Alice“, auf welchem er als Only Mate angestellt war, in New-York verlassen haben, woselbst er 338 Peace Street gewohnt hat. Alle bisher angestellten Nachforschungen nach dem Verbleib Staberows sind erfolglos geblieben.
208) Der Schuhmacher Karl Illmer, geb. im Jahre 1827 zu Bistritz in Siebenbürgen, wanderte nach Bukarest aus, von wo er im Jahre 1872 die letzte Nachricht gab.
209) „Eine alte arme Mutter verzehrt sich in Sehnsucht nach ihrem Sohne,“ dem Tischler Philipp Heinrich Wagner, geb. am 22. Aug. 1859 zu Katzenelnbogen (Reg.-Bez. Wiesbaden). Wagner hat in Wiesbaden gelernt und war dann als Geselle in Bruchsal, Weingarten (Baden), Nordhausen, Witzenhausen, Tuttlingen und Triberg thätig. Aus Triberg (Baden) kam noch im Jahre 1884 Nachricht, die bis heute die letzte geblieben ist.
210) Eine mittellose Frau mit 4 unerzogenen Kindern sucht ihren Mann, den Tagarbeiter Heinrich Teichert, geb. am 1. September 1856 zu Krolkwitz, Kr. Freistadt in Schlesien. Teichert gab das letzte Lebenszeichen Mitte September 1888 von Ketzin (Reg.-Bez. Potsdam) aus, wo er als Ziegelarbeiter Stellung hatte.
211) Am 9. Mai 1887 schrieb der Tapezier Ferdinand Dürauer, welcher am 7. Oktober 1861 zu Palt in Oesterreich unt. der Enns geboren ist, aus Finthen bei Mainz, daß er nach Metz oder Paris gehen wolle. Dürauer hat seitdem nicht wieder geschrieben und ist auch durch die Bemühungen des österreichisch-ungarischen Konsulats in Paris nicht aufzufinden gewesen.
212) Ein hochbetagter Vater bittet inständigst um Nachrichten über seinen Sohn. Derselbe, Hugo Emil Edmund Dähn, geb. am 1. Mai 1852 zu Roda bei Ilmenau in Thüringen, wanderte nach Brasilien aus. Seine ersten Briefe kamen aus Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro etc. Seit 1882 fehlt jegliche Nachricht über ihn. Das deutsche Konsulat zu Rio Grande konnte den Angehörigen nur mittheilen, daß Dähn 1879 im dortigen Hospital krank daniedergelegen habe, und das deutsche Konsulat zu Paranagua hat festgestellt, daß der Verschollene etwa im Jahre 1886 sich noch in S. Joao de Triumpho aufgehalten habe, dann aber weggegangen und vorübergehend in Curitiba gesehen worden sei.
213) Seit Dezemb. 1887 fehlt jede Nachricht von Heinrich Friedrich Carl Joachim Möller, geb. am 14. März 1861 zu Kietz bei Neustadt in Mecklenburg, seines Zeichens Schlächter; Möller befand sich im Juni 1887 auf St. Vincent, einer der capverdischen Inseln, wohin er als Oberheizer mit dem Postdampfer „Leipzig“ gekommen war, am 26. Dezemb. desselben Jahres hielt er sich in Bremerhaven auf, von wo er einige Tage nachher wahrscheinlich nach London abgereist ist.
214) Der Maurer Gustav Robert Bosse, geb. am 18. Dezemb. 1850 zu Braunschweig, hat im Juni 1887 seine Wohnung in Groß-Zschocher b. Leipzig verlassen, um nach Leipzig auf Arbeit zu gehen, ist aber nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Bosse ist durch eine Flechte an der rechten Backe kenntlich.
215) Louise Dorothea Lütt, geb. am 19. Febr. 1829 zu Ludwigslust in Mecklenburg, war am Himmelfahrtstage des Jahres 1854 oder 1855 anläßlich des Todes ihres Bruders in Bützow (Mecklenb.) anwesend und soll dann mit einem Bauunternehmer von Cöslin ausgewandert sein. Alle Nachforschungen nach der Verschollenen sind vergeblich gewesen.
216) Der Agent Joseph Heger, geb. zu Klabawa bei Pilsen in Böhmen am 15. Oktob. 1861, schrieb aus Sidney, daß er am 4. Juli 1888 mit einer Anzahl Eingeborener, welche ihm am selben Tag von einem Bekannten namens Cunningham zugeführt werden sollten, nach Deutschland zurückzureisen gedenke. Heger aber ist bis jetzt weder in seiner Heimath angekommen, noch ist sonst wieder etwas von ihm vernommen worden.
217) Der Feuerversicherungsbeamte Gustav Franz Stöckert, geb. am 4. Oktob. 1855 zu Angermünde, wird seit dem Jahre 1884 vermißt. Der letzte Wohnort Stöckerts war Lübeck, die letzte Kunde von ihm kam im April 1884 von Hamburg.
218) Josef Endler, geb. am 26. Septb. 1858 zu Tiefenbach (Gemeinde Prichowitz), war Maler und hielt sich zuletzt in Riga auf. Er wollte am 2. Jan. 1882 von Bremen aus nach St. Jago (Südamerika) fahren. Das sind die letzten spärlichen Nachrichten, welche Mutter und Geschwister noch von dem Verschollenen empfangen haben.
219) Der Kürschnergehilfe Felix Max Siegel, geb. zu Taucha bei Leipzig am 4. Aug. 1857, hat sich, nachdem er im Januar 1881 von Braunschweig nach seinem Geburtsort zurückgekehrt war, am 5. März desselben Jahres dort wieder abgemeldet, um auf die Wanderschaft zu gehen. Seitdem ist von Siegel, um dessen Verbleib sich die Mutter ängstigt, nichts wieder gehört worden.
220) Der am 12. April 1864 zu Hamburg geborene Otto Heinr. Frauen reiste im März 1881 nach New-York und weiter nach St. Louis. Dort arbeitete er bis August 1883 bei den Juwelieren Herold u. Postel und siedelte dann nach New-Orleans über, wo er von Jan. bis März 1884 bei Herrn Bierhorst in Arbeit stand. Später begab er sich nach Mac Lean, von wo im August 1884 die Nachricht kam, daß er beabsichtige, nach New-Orleans zurückzukehren.
221) Sebastian Eduard Sellms, geb. am 13. Dezemb. 1847 zu Hamburg, ging 1868 nach New-York und später nach Savannah in Georgia, wo er laut eigenen Mittheilungen im Dezemb. 1883 noch als Besitzer eines Materialwarenladens (180 St. Julian und 179 Bryanst.) lebte. Schon im Jahre 1884 blieben alle an Sellms gerichteten Briefe unbeantwortet. Einem Schreiben des deutschen Konsuls nach soll Sellms nach Colorado übergesiedelt sein.
222) Im Jahre 1867 machte sich der Kellner Carl Gustav Leberecht Jährig, geb. am 14. Oktob. 1845 zu Beiersdorf (Oberlausitz), auf, um nach Hamburg zu gehen. Einer Mittheilung der Polizeibehörde in Hamburg zufolge hat sich Jährig im Juli 1867 von dort entfernt, der spätere Aufenthalt desselben ist nicht zu ermitteln gewesen. Die betagte Mutter des Verschollenen bittet ihren Sohn um Heimkehr oder wenigstens um Nennung seines Aufenthaltsortes.
223) Seit dem Jahre 1883 werden vermißt die Geschwister Schuster, Adelheid Kornella, geb. am 14. Juni 1869 zu Warschau, und Hedwig Pauline, geb. am 22. März 1872 ebendaselbst.
224) Der Schmiedegesell August Albert Thie, geb. am 6. Oktob. 1823 zu Forsthaus Polte bei Bittkau an d. Elbe, brachte seine Frau im Jahre 1866 nach Magdeburg und ging im Jahre darauf nach Melbourne (Australien), von wo er Ende 1875 das letzte Mal schrieb. Thie war in Melbourne Besitzer eines Panoptikums.
Im Glaspalast zu München. Als vor zwei Jahren nach Schluß der so glänzend verlaufenen Internationalen Ausstellung die Ansicht in Künstlerkreisen laut wurde, München sei als Kunststätte bereits stark genug, um seinen jährlichen „Salon“ zu haben, da gab es viele, die dazu bedenklich den Kopf schüttelten und ein großes Fiasko weissagten. Sie sind heute, wo der alte Glaspalast zum zweiten Male seine Thore zur „Jahresausstellung“ öffnet, glänzend widerlegt, denn jetzt steht durch die Fülle und den Werth des darin Angesammelten die Thatsache fest, daß München die erste Kunststadt Deutschlands ist, trotzdem der bayerische Staat in seiner Fürsorge für die Kunst nicht überall die Unterstützung gefunden hat, die er verdient hätte.
Aber die Münchener Kunst ist bereits selbständig geworden, auch ist es ihren Vertretern gelungen, ein so gutes Verhältniß zum Auslande herzustellen, daß eine überraschende Anzahl französischer, italienischer, englischer, amerikanischer, niederländischer und skandinavischer Bilder und Skulpturen einging. Nirgends in Deutschland ist zur Zeit ein solcher Ueberblick über das ganze internationale Kunstgebiet möglich als in dieser Jahresausstellung, sie enthält eine solche Fülle von vortrefflich gemalten Werken der verschiedensten Meister, daß es schwierig wird, sich zurechtzufinden. Ein hoch gesteigertes technisches Können fällt sofort auf, außerdem aber auch eine bewußte Rückkehr von den Absonderlichkeiten der Helllichtmalerei, von den sozialistischen Tendenzbildern zu dem einfach Schönen und Erfreulichen. Eines Hauptzugstückes, dessen Namen auf allen Lippen wäre, entbehrt die Ausstellung, dafür finden sich in jedem Saal Anziehungspunkte, vor welchen immer neue Gruppen in Betrachtung stehen. München kann mit großer Genugthuung auf dies Unternehmen blicken, das nicht nur den alljährlich durchfluthenden Fremdenstrom vergrößern hilft, sondern zugleich in glücklicher Weise die Bedeutung und Eigenart der Hauptstadt des zweiten deutschen Bundesstaats bezeichnet.
Noch bleibt zu bemerken, daß auch dieses Jahr wieder eine Reihe von künstlerisch ausgestatteten Veröffentlichungen des Buch- und Kunsthandels die Münchener Jahresausstellung zum Mittelpunkt haben. Wir nennen die „Ausstellungshefte“ der Zeitschrift „Die Kunst für Alle“ (München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, vormals Friedrich Bruckmann), die „Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen“ (Münchener Kunst- und Verlagsanstalt Dr. E. Albert u. Ko.); vielfach überraschend dürfte gewirkt haben, daß auch eine große Tageszeitung, die „Allgemeine Zeitung“ ihren Lesern in besonderen Kunstbeilagen bildliche Proben aus dem Glaspalast mitgetheilt bat. Br.
Deutschlands merkwürdige Bäume. Die Eiche bei Krayn. (Zu dem Bilde S. 549.) Es ist eine stolze Gesellschaft, die da auf einer Wiese nahe bei dem Dorfe Krayn zwischen Goldberg und Liegnitz in Schlesien beisammen steht. Es sind 6 uralte Eichen, die auf unserem Bildchen sichtbar sind; diejenige aber, welche im Vordergrunde steht, ist die älteste und stärkste. Neun Meter mißt sie im Umfange, und wie viele Stürme schon über sie hinweggebraust sind, wie oft der Blitzstrahl sie heimgesucht hat, das verkündet uns die vielfach zerrissene und zersplitterte Krone.
„Mehr als tausend Jahre“ soll sie zählen – so geht es im Volksmund und so berichtet eine schöne Inschrift an dem Baume:
„Wohl mehr als tausend Jahre zähl’ ich schon;
Ich sah dereinst das Deutsche Reich erstehn;
Ich sah im Jahre sechs es wiederum vergehn.
Seitdem ich jüngst gesehn sein frisches Auferstehn,
Möcht’ ich um keinen Preis es nochmals sehn im Untergehn.
Das walte Gott auf seinem ew’gen Thron!
Schönau, im August 1871. Die älteste der alten Sechs.“
Freilich, ob der begeisterte Dichter und der willige Glaube des Volkes sich nicht zu hoch verstiegen haben, muß zweifelhaft erscheinen. Denn nach den Ansichten eines Fachmannes, welche der Leser im „Gartenlaube-Kalender“ von 1887 auseinandergesetzt findet, sind Eichen von 600 Jahren mindestens ebenso selten wie Menschen von 100 Jahren.
Wie dem aber auch sein mag, ein gut Stück Geschichte schaut von diesem knorrigen Geäste und Gezweige auf den Menschen der Gegenwart hernieder. Und es ist geschichtlicher Boden, auf dem die Eichen von Krayn
[577][578] stehen. Hier war es, wo der alte Blücher einst am 26. August 1813 mit seinen Preußen und Russen die Franzosen in die vom Regen hoch angeschwollene Wüthende Neiße und Katzbach trieb.
Eine hübsche Sage aber erzählt, vor einigen Menschenaltern habe auf der Wiese eine noch weit gewaltigere Eiche gestanden, die „Sieben Kälber-Eiche“. Und zwar habe sie ihren Namen darum getragen, weil einst in Kriegszeiten eine Frau mit sieben Kälbern in dem hohlen Stamme Zuflucht gefunden habe.
Ein eigen Haus. (Mit Abbildungen.) Zu immer dichteren Massen drängt die Industrie die Menschen zusammen auf verhältnißmäßig engen Raum. In einem drei-, vier- oder fünfstöckigen Häuserkolosse mit ebenso hohen Neben- und Hintergebäuden ohne Luft und Licht wohnen oft so viel Menschen als in einem ganzen Dorfe. Und die mangelhaftesten und ungesundesten unter den Wohnungen in diesen Miethskasernen nehmen oft diejenigen ein, die schon den Tag in stauberfüllten Arbeitssälen zubringen oder in enger dunkler Amtsstube ihren kärglichen Lohn erwerben müssen, Fabrikarbeiter und untergeordnete Beamte.
Menschenfreundliche Großindustrielle haben bereits diese Wohnungsnoth für ihre Arbeiter zu milden, die Bau- und Wohlfahrtspolizei hat durch geeignete Vorschriften die schlimmsten Uebelstände abzustellen gesucht. Genossenschaften aus den Kreisen der Arbeiter oder der kleinen Beamten selbst haben sich gebildet, um durch vereinte
Kraft zu ermöglichen, was dem einzelnen auszuführen nicht vergönnt war: die Beschaffung eines eigenen bescheidenen, Heims, einer ausreichenden gesunden Wohnung.
Man unterschätze nicht den Werth des eigenen Hauses! Er ist nicht bloß äußerlicher, gesundheitlicher und materieller Natur, er greift auch hinüber in das Gebiet des Sittlichen.
Wohl ist es bequemer, seine Ersparnisse in Sparkassen, zinstragenden Papieren oder Hypotheken anzulegen, wohl bedeutet das eigene Haus das Ausgeben eines Theils jener Vortheile, welche das Freizügigkeitsgesetz den Arbeiter sichern sollte, wohl kann der kleine Beamte eine Besserung seiner Stellung oft nur mit einem Wechsel des Wohnorts erkaufen.
Aber wie viel schöner, würdiger, erhebender ist es, in den eigenen Mauern zu wohnen! Wir wollen nicht reden von den Quälereien der Vermiether, von den Beschädigungen der Möbel durch fortgesetztes Umherziehen. Die ganze Freude am Dasein ist eine andere, reinere, wenn es im eigenen Grund und Boden eine feste Wurzel hat. Wie ganz anders fühlt sich der verwachsen mit dem Wohl und Wehe von Land und Staat, von Nachbarn und Mitbürgern, den nicht ein Hauch, ein Zufall, eine Laune hinwegführt und in irgend einem ändern Zufallswinkel zu ebenso unsicherem Verweilen niedersetzt! Wie ganz anders fühlt sich der zu Hause, der sich sagen darf: der Boden, der mich trägt, das Dach, das mich deckt, die Wände, die mich umgeben, sie sind mein, mein freies, wohlerworbenes Eigen! Welche stärkende, sittlichende Kraft strömt von solchen Gedanken aus! Wie viel herrlicher duften die Blumen vor dem eigenen Fenster!
Doch was soll’s mit den Lobpreisungen des eigenen Heims? Es kann nicht jeder Hausbesitzer sein! – So wird man uns entgegenhalten mit einem guten Schein von Recht. Und es ist wahr: alle werden das lockende Ziel nicht erreichen können. Aber mehr, viel mehr, als es heute noch der Fall ist. Bereits ist die Bewegung ans vielen Seiten im Gang, auch die „Gartenlaube“ hat schon wiederholt sich in den Dienst dieser wirklich guten Sache gestellt (vgl. beispielsweise Halbheft 18 des Jahrg. 1887), und sie begrüßt jeden weiteren Versuch, der in dieser Richtung gemacht wird, mit aufrichtiger Freude.
Ein solcher ist neuerdings wieder in die Oeffentlichkeit getreten. Der Baumeister Georg Aster hat eine Gruppe von „Entwürfen zum Bau billiger Häuser für Arbeiter und kleine Familien“ zusammengestellt und herausgegeben (Gera, Verlag von Karl Bauch); beginnend bei der einfachsten Gestalt – das Häuschen, welches unsere Abbildung darstellt, kostet mit seinen 40 m² Baufläche nach Afters Voranschlag 2000 Mark, ausschließlich Bauplatz und Garten – führt es die verschiedenen Formen vor, in welchen billige dabei aber gesunde und wohnliche Häuschen für eine oder auch zwei oder vier Familien hergestellt werden können.
Wie wir sehen, enthält schon die einfachste Anlage alles, was bei bescheidenen Ansprüchen gefordert werden kann, eine große Wohnstube von 15 m² in Flächenraum und eine Küche im Erdgeschoß, einen Vorrathsraum unter der Treppe, zwei Kammern und einen Vorraum im Oberstock. Besonderen Werth legt Aster auf die Anlage der Feuerung. Gesundheitsrücksichten verlangen die Trennung von Küche und Wohnstube; andererseits aber kann man einer schmalen Haushaltungskasse auch nicht zumuthen, daß sie im Winter für zwei Feuerungen auskomme, für die Heizung der Wohnstube und das Kochfeuer in der Küche: deshalb ist die Feuerung so angebracht, daß das Herdfeuer zugleich die Wohnstube heizt. Damit aber dann im Sommer die natürliche Hitze der letzteren nicht noch durch das Herdfeuer gesteigert werde, ist eine Einrichtung vorgesehen, welche es ermöglicht, den Hitzestrom der Küche vollständig von der Stube abzuschließen.
Möge das verdienstliche Werkchen, das bereits die dritte Auslage erlebt hat, vielen, denen an der Beschaffung eines eigenen bescheidenen Heims gelegen ist, ein sicherer Führer sein, möge es mithelfen, der sogenannten Wohnungsnoth der ärmeren Klassen zu steuern, die Liebe zum eigenen Herd, die Freude an den häuslichen Genüssen und dem stillen Glück der Familie zu erhöhen!
In der Brautzeit. (Zu dem Bilde S. 552 und 553.) Wie viel Glück in dem kleinen Raum eines Zimmers! Wie viel ist gegenwärtig und wie viel winkt in nächster und in fernerer Zukunft! In selige Gedanken versunken näht die Braut an ihrer Aussteuer, neben ihr über den Stuhl gebreitet prangt schon das beinahe vollendete Hochzeitskleid; in Schrank und Koffer aber ruhen reiche Schätze an allerlei Linnenzeug, darüber sie einst als waltende Hausfrau gebieten soll im eigenen Heim. Über den rosigen Bildern ihrer Phantasie, über dem emsigen Wert ihrer kunstfertigen Finger und über dem Klappern der Nähmaschine, an der die alte Vera, des Hauses unentbehrlichstes Rüstzeug, der herangeblühten Tochter die Brautausstattung näht, wie sie einst vor Jahren dem Kinde sein erstes Kleidchen gefertigt hatte – über all dem hat das liebliche Mädchen den leisen Schritt überhört, der hinter ihr über den Teppich gleitet.
Ihre Gedanken, die den Geliebten fern in der Residenz als Arzt von einem Krankenbette zum andern eilend, überall Trost und Hilfe spendend wähnen, sie sind noch von keiner Ahnung durchzuckt, daß er ihr so nahe sei, daß nur eine Sekunde sie noch von dem seligen Augenblicke trennt, wo sie von zwei kräftigen Armen sich fest umschlungen und Wangen und Mund von ungezählten Küssen bedeckt fühlen wird. Auch die Mutter, die dem jüngeren Schwesterchen Anleitung in den Künsten der Nähnadel giebt, damit es auch fein Theil zum großen Aussteuerwerke beitragen könne, hat noch nichts von dem unerwarteten Ankömmling bemerkt; wohl aber die alte Vera und der Bruder, dessen Aufmerksamkeit nicht so streng bei seinem Schulbuche war, daß er den Schwager in spe nicht sofort unter der Thür entdeckt hätte. Kaum zähmt er den lachlustigen Mund, und die Gefahr ist groß, daß er noch im letzten Augenblick durch ein vorzeitiges Kichern den Ueberfall vereitle – was übrigens dem Glücke dieser anmuthigen Familiengruppe auch keinen Eintrag thun würde.
Die elektrische Straßenbahn in Bremen. (Mit Abbildung S. 565.) Im Geburtslande der elektrischen Bahnen, im deutschen Vaterlande,[3] scheint man nunmehr der Anlage derartiger Bahnen ernstlich näher treten zu wollen. Aus Dresden, Halle, Berlin und verschiedenen anderen Orten wird gemeldet, daß der Ersatz der Pferde beim Straßenbahnbetriebe durch elektrische Motoren geplant sei und daß die Vorarbeiten dazu eingeleitet seien. Etwas langsam und bedächtig darf’s schon gehen, das ist bei uns so Brauch! Die unternehmenden Amerikaner haben die Erfindung längst praktisch verwerthet, und von den in den Vereinigten Staaten bestehenden Straßenbahnen ist bereits mehr als ein Drittel für elektrischen Betrieb eingerichtet, so daß zur Zeit auf der stattlichen Länge von 1560 Kilometern (gleich der Entfernung Berlin-Moskau) über 1200 elektrische Motorwagen verkehren. In der Stadt Boston allein, wo die Straßenbahnen jährlich 110 Millionen Fahrgäste befördern, wird das ganze 480 Kilometer lange Straßenbahnnetz für den elektrischen Betrieb eingerichtet und am 1. Juli d. J. verkehrten bereits über 200 elektrische Wagen auf demselben.
Es ist nun naheliegend, daß die vielfachen Erfahrungen, welche man in Amerika mit dem elektrischen Bahnbetriebe gemacht hat, bei unsern Neuanlagen verwerthet werden. So hat denn auch die Bremer Pferdebahngesellschaft bei der zur Erleichterung des Verkehres mit der „Nordwestdeutschen Gewerbe- und Industrieausstellung“ dienenden elektrischen Bahn das System der amerikanischen Firma Thomson-Houston gewählt. Das Wesen der elektrischen Bahnen wird ja unsern Lesern wohl bekannt sein. Es besteht darin, daß an einer Centralstelle mittels irgend einer Kraftquelle, sei es Dampfkraft oder Wasserkraft, ein Stromerzeuger, auch „Elektromotor“ oder „Dynamo“ genannt, in Bewegung gesetzt wird, welcher die mechanische Kraft in elektrische Kraft umwandelt. Letztere läßt sich nun mit Leichtigkeit durch einen Leitungsdraht weiter leiten. Mit dem Leitungsdraht in Verbindung steht eine Reihe ganz ähnlicher, aber kleiner Elektromotoren, welche die umgekehrte Ausgabe haben, den elektrischen Strom wieder in mechanische Kraft zu verwandeln, die dann auf die Achse des Wagens wirkt und diese in Umdrehung versetzt.
Die Maschinenstation der Bremer Anlage befindet sich auf dem Ausstellungsplatze; sie enthält eine vollständige Dampfmaschinenanlage für 150 Pferdekräfte, mit welcher der Stromerzeuger betrieben wird. Demnächst soll ein zweiter Stromerzeuger von derselben Leistungsfähigkeit zur Aufstellung kommen.
Der vom Stromerzeuger gelieferte Strom wird mittels eines Kupferdrahtes von reichlich 8 Millimetern Durchmesser über die Bahn geleitet. Wie unsere Abbildung zeigt, sind zu beiden Seiten der Bahn eiserne Pfosten ausgestellt, welche durch quer zur Bahnrichtung sich erstreckende Stahldrähte verbunden sind. Die Querdrähte dienen nur als Träger für den kupfernen Leitungsdraht, welcher mittels einer die Elektricität nicht leitenden Verbindung an denselben aufgehängt wird. Auf der Decke des Wagens ist eine Vorrichtung angebracht, welche den elektrischen Strom zu [579] den unter dem Wagen angebrachten Dynamomaschinen leitet. Die Vorrichtung besteht aus einem beweglichen, durch eine Feder an den Kupferdraht angedrückten Arme, der sogenannten Kontaktstange, deren Ende mit einer Rolle versehen ist, welche beim Vorbeigleiten den Strom aus dem Drahte entnimmt. Die Rolle ist mit einer tiefen Rille versehen, damit die Berührung mit dem Kupferdrahte nicht verloren gehe.
Von dem elektrischen Strome werden nun die zu je einer Wagenradachse gehörenden Dynamomaschinen in Umlauf gesetzt. Da die Umdrehungszahl bei diesen Dynamo zweckmäßig groß gewählt wird und erheblich höher ist als die der Radachse, so muß noch eine Uebersetzung ins Langsame erfolgen, wozu Zahnräder verwendet werden. Die bisher in Gebrauch genommenen Wagen haben je zwei elektrische Motoren, deren jeder 10 Pferdekräfte entwickeln kann.
Die elektrischen Wagen haben sich sehr schnell die Gunst des Publikums errungen und sind durchweg voll besetzt. Bei einbrechender Dunkelheit erstrahlt das Innere der Wagen im Lichte von fünf Glühlampen. Die Probefahrt am 21. Juni verlief so vorzüglich, daß sofort nach deren Beendigung die polizeiliche Erlaubniß zur Betriebseröffnung ertheilt werden konnte. Das Anfahren der Wagen geschieht unmerkbar, das Fahren ist geräuschlos, stoßfrei und rasch; besondere Anerkennung fand der wiederholt gelieferte Beweis, daß es möglich ist, den Wagen bei voller Geschwindigkeit, beinahe augenblicklich mit Hilfe des Stromumkehrhebels und der Bremsen anzuhalten. Nachmittags um 1 Uhr wurde der regelmäßige Betrieb mit drei Wagen eröffnet, und bis abends 10 Uhr waren bereits etwa 2500 Personen befördert.
Welch goldene Zeiten werden aber erst für den elektrischen Bahnbetrieb anbrechen, wenn es sich bestätigt, daß der langjährige Traum der Elektrotechniker, „Elektricität unmittelbar aus der Kohle zu gewinnen“, nunmehr in Erfüllung gehen soll! Wie amerikanische Blätter berichten, ist die Lösung vor kurzem gelungen, und die erforderlichen Einrichtungen sollen so einfach sein, daß sie gar nicht einmal den Namen einer Maschine beanspruchen können. Dann genügt ein Ofen von der Größe eines Stubenofens – und fort geht’s, ohne Draht, über Berg und Thal. Vorläufig gilt für uns allerdings noch das Dichterwort: „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!“
Volksstimmen über die Gründung des Deutschen Reichs. Wenige Monate nur trennen uns noch von dem zwanzigsten Jahrestage der Gründung des Deutschen Reiches. Das großartige Ereigniß ist tausendfältig gefeiert worden in Rede und Gedicht, und ein erhabenes Denkmal dort auf der grünen Höhe des Niederwalds legt in Stein und Erz vor den spätesten Geschlechtern Zeugniß ab von der überwältigenden Macht der Bewegung, welche die Errungenschaft der Jahre 1870 und 1871 in den Gemüthern des deutschen Volkes wachrief.
Die Germania auf dem Niederwald ist das stolzeste, das gewaltigste, das eindrucksvollste Erinnerungszeichen an jene große Zeit. Aber sie ist nicht das einzige! Allüberall drängte die gehobene Freudenstimmung über das Gewonnene zu einem sichtbaren Ausdruck. Von dem weithin das Land beherrschenden Standbild bis zur schlichten Gedenktafel an Baum oder Fels, an Haus oder Kirche ist ein weiter Abstand; und doch will es uns scheinen, als ob diese letzteren oft nicht minder eindringlich zum Herzen des nachwachsenden Geschlechtes sprächen und nicht minder ergreifend für die Tiefe der Empfindung unter den Zeitgenossen von damals zeugten, als die großartigen Schöpfungen der Kunst, zu denen die führenden Männer der Nation die erzgegossenen Sprüche ersonnen haben. Jene bescheidenen, oft vielleicht formlosen Aeußerungen, die ohne jeden andern Antrieb rein aus der Tiefe der mächtig berührten Volksseele geflossen sind, sie enthüllen dem wahrheitsuchenden Auge des Geschichtsforschers oft mehr als die Kundgebungen mehr oder weniger offizieller Kreise.
Auf Seite 576 dieses Heftes ist die Inschrift der alten Eiche bei Krayn abgedruckt.
Solche Inschriften haben wir im Sinne, wenn wir uns heute an alle unsere Leser mit der Bitte wenden, uns „Stimmen des Volkes über die Gründung des Reiches“ sammeln zu helfen, die wir dann zum 18. Januar 1891 in der „Gartenlaube“ der Oeffentlichkeit übergeben könnten. Ausdrücklich bemerken wir, daß die Inschriften an größeren künstlerischen Denkmälern hier bei Seite bleiben sollen; selbstverständlich fallen auch etwaige kurze Vermerke wie „Gestiftet zum Andenken am die Aufrichtung des Deutschen Reichs“ oder dergl. weg. Das angeführte Beispiel zeigt am besten, was wir suchen. – Wir bitten, in der Abschrift des Textes, in der Bezeichnung des Gegenstandes, welcher die Inschrift trägt, sowie in allen etwa sonst zu machenden Angaben über Verfasser oder dergl. ja recht genau zu sein, damit keine Irrthümer sich einschleichen.
Allen aber, die uns bei dem vaterländischen Werke behilflich sein werden, im voraus schon unseren herzlichen Dank! Die Redaktion.
Eine deutsche Kolonialmünze. Unsere obenstehenden Abbildungen zeigen die erste deutsche Kolonialmünze, welche auf Rechnung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft kraft des derselben vom deutschen Kaiser verliehenen Rechts durch die königliche Münze in Berlin geprägt worden ist. Es ist ein aus fast reinem Kupfer hergestelltes Geldstück, etwas größer als unser Einmarkstück. Auf der einen Seite trägt es im Ring um den Reichsadler in lateinischen Buchstaben die Inschrift „Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft“ und die Jahreszahl 1890, auf dem von einem Lorbeerkranz umrandeten Innenraum der andern Seite in arabischer Schrift die Worte: „Die Deutsche Gesellschaft“.
Von diesen „Kupferpesas“ gehen 64 auf eine Rupee. Da die letztere nach dem heutigen Silberpreis etwa den Werth von 1 Mark 75 Pfennig hat, so würde unsere Kolonialmünze ungefähr 2,7 Pfennig gelten.
Den Kupferpesas sollen in einigen Monaten noch silberne Rupees folgen, die in der Größe ungefähr unserem Zweimarkstück entsprechen werden. Dieselben werden, im Unterschied von den Reichsmünzen, den Kopf des Kaisers Wilhelm II. nicht unbedeckt, sondern mit dem Garde du Corps-Helm bekleidet zeigen. =
Hirsch todt! (Zu dem Bilde S. 569.) Hirsch – Schweißhund – das edelste Wild des deutschen Waldes – der edelste Hund des deutschen Jägers! C. F. Deiker, der berühmte Düsseldorfer Jagdmaler, zeigt uns heute den Schluß einer Art von Hirschjagd, die früher ausschließlich im Hannoverschen betrieben wurde, die von hier aus aber mit dem Schweißhunde, einer specifisch hannoverschen Rasse, auch in einige andere Hirschreviere verpflanzt worden ist – das „Lanciren“ des Feisthirsches.
Der hannoversche Schweißhund ist mittelstark, roth oder gestromt ohne weiße Abzeichen, im Gesicht schwarz gebrannt und muß die Eigenschaft haben, sowohl auf einer gesunden Hirschfährte am Riemen nachzuziehen und dieselbe selbst dann zu halten, wenn sie durch die frischeren eines Rudels führt, als besonders auch nach 24 Stunden noch die Schweißfährte eines kranken Stückes „auszuarbeiten“ und dem Jäger zu helfen, dasselbe zur Strecke zu bringen.
August ist es, das Geweih ist „verreckt und gefegt“, und jetzt beginnt des weidgerechten Jägers schönste Zeit, die Jagd auf den Feisthirsch.
Ein starker Hirsch hält zu Felde, aber er tritt so spät aus und hält so früh wieder zu Holze, daß dir nur die frische Fährte zeigt, daß er draußen gewesen ist. So schlau ist aber der alte Bursch, daß er bei Mondschein sich hütet, das Feld anzunehmen. Da heißt es, den Hirsch zu bestätigen. Das ist eine uralte Weidmannskunst oder, wie der mittelhochdeutsche Ausdruck will, „Jagelist“. Söllmann, der Schweißhund, wird „zur Fährte gelegt“, er hält sie bis zu einer Fichtendichtung. Hier wird er „abgetragen“ (nicht mit dem Riemen von der Fährte gezogen), die Fährte wird „verbrochen“, d. h. ein frischer Fichtenbruch auf dieselbe gelegt und dann mit dem Hunde die Dickung „umschlagen“, um zu sehen, ob der Hirsch in derselben stehen geblieben ist. Söllmann fällt aber keine Fährte wieder an – der Hirsch ist bestätigt.
Einige Stunden später werden Jäger auf den Wechseln weit von einander („verloren“) angestellt, du aber erhältst den besten Posten, auf dem Rückwechsel, dort, wo der Hirsch die Dickung angenommen hat. Der Jäger umschlägt mit Söllmann die Dickung noch einmal, um sich zu vergewissern, ob der Hirsch auch stehen geblieben ist, dann legt er den Schweißhund wieder zur Fährte und beide verschwinden im dichten Gebüsch.
Der Hund liegt fest im Riemen und zieht den Jäger vorwärts. Hin und her geht’s durch die Fichten – endlich wird der Hirsch „gesprengt“ oder „aus dem Bette aufgethan“; aber das edle Wild flieht nicht sofort aus dem schützenden Buschwerk, sondern zieht in demselben umher – langsam, aber sicher folgt ihm am Riemen Söllmann. Du aber stehst vor der Dickung mit gespannter Büchse in aufgeregter Erwartung – es ist so still um dich her, kein Ton schlägt an dein Ohr – höchstens kreischt einmal ein Häher – ein Eichkätzchen hüpft über den Weg oder ein Goldhähnchen schlüpft durch das Fichtengeäst – kein Laut – nichts verräth, daß du auf Hirschjagd bist.
Da – was ist das? – ein leises Streifen an den Büschen – langsam hebt sich die Büchse, das Herz droht vor Aufregung zu zerspringen – – alles wieder still, du hörst nur das Hämmern in deiner Brust. Drei lange, bange Minuten – – wieder streift es an den Büschen, die Zweige knacken – – und „hast recht, Söllmann! schon’ dich! schone!“ tönt es leise aus der Dickung zu dir herüber. Der Hirsch ist dem Rande der Pflanzung entlang gezogen – dicht hinter ihm folgt der Jäger mit dem Hunde.
Wieder ist eine lautlose Stunde verstrichen, die heiße Hundstagssonne brennt dir auf den Scheitel – die Aufmerksamkeit läßt schon nach – – vielleicht schleicht sogar der Gedanke sich in dein Jägerherz: wenn der Hirsch doch erst heraus wäre, selbst wenn’s auf einer andern Stelle knallte – – da, ganz unerwartet, plötzlich fliegt 80 Schritt von dir ein rothes Etwas aus den Fichten – du siehst die Umrisse in der Ueberraschung, der Aufregung nur verschwommen – ein starkes Geweih – die Büchse ist am Backen – das Korn liegt dicht vor dem Rothen – Knall – Pulverdampf – Kugelschlag! Du siehst den Hirsch in hoher Flucht in der Luft erscheinen, dann stürmt er durch Ginster und Schmielen in weitem Halbkreis um dich herum – jetzt wird er langsamer – du siehst den Schweißfleck dicht hinter dem Blatte – er bleibt stehen – wie jubelt’s in deiner Brust – das Geweih, der Kopf wird ihm zu schwer, er senkt ihn tief herab zur Erde – – sein Haar sträubt sich, verendet bricht er zusammen, der König der Wälder, und das Horn des Jägers, das die Genossen ruft, singt ihm den lustigen Grabgesang. Karl Brandt.
Ländlich – sittlich! In den südlichen Distrikten von Indien werden neuerdings die hölzernen Telegraphenstangen durch Pfeiler aus Eisen oder Stein ersetzt, weil sich eigenthümliche Unzuträglichkeiten für die ersteren herausgestellt haben. Sie wurden nämlich massenweise von den großen Ameisen an- und durchgenagt, andererseits zeigten die Affen eine besondere Vorliebe dafür, sie zu ihren Turnübungen zu benützen, und erschütterten sie dadurch rettungslos in ihren Grundfesten. So muß denn die Telegraphenleitung den ländlichen Verhältnissen „angepaßt“ werden, wie so viel anderes in Indien, das in seiner Mischung von Naturzuständen und englischer Kultur ein höchst merkwürdiges Gesammtbild darbietet.
G. P., Cassel. Wenn Ihr Bruder sich im ganzen fünf Jahre in den Vereinigten Staaten von Nordamerika aufgehalten und sich dort hat naturalisiren lassen, so fällt er unter die Bestimmungen des Vertrags zwischen dem Norddeutschen Bund und den Ver. Staaten vom 22. Februar 1868, wonach er bei der Rückkehr der Strafe nicht unterliegt und erkannte Strafen unvollstreckt bleiben.
C. Sch. in Hannover. Ungezählte Male schon haben wir bekannt gegeben, daß wir uns auf briefliche Kuren unter keinen Umständen einlassen können. Wenn Ihnen die bisher befragten Aerzte kein Mittel anzugeben wußten, so müssen Sie sich eben an einen andern Arzt oder vielleicht an eine Universitätsklinik wenden.
[580]Allerlei Kurzweil.
Skataufgabe Nr. 5. Von K. Buhle. |
Anagramm mit Akrostichon.
| ||
| Wenn Mittelhand folgende Karte aufdeckt, indem sie Null ouvert ansagt: | Kern, Neid, Lieb, Scheide, Amsel, Lineal, Ried, Acker, Silene, Asien, Riesa, Maler, Lupine, Laster, Lateran. | ||
| Durch Umstellen der Laute ist aus jedem dieser Wörter nach den Hinzufügen je eines Buchstabens als Anfangslaut ein neues Wort zu bilden. In anderer Reihenfolge bezeichnen die neuen Wörter: 1. ein kleines Reptil, 2. einen Nebenfluß vom Rhein, 3. einen deutschen und 4. einen österreichischen Dichter, 5. eine Art der Spinnen, 6. ein Schiffsgeräth, 7. eine Stadt in Oberitalien, 8. einen biblischen Namen, 9. eine dänische Insel, 10. einen Titel, 11. eine Provinz des römischen Reiches, 12. einen Fluß in Norddeutschland, 13. einen Förderer des deutschen Turnwesens, 14. eine Landschaft in Süditalien, 15. eine Stadt in der Nähe des Vesuv. Ist alles richtig gefunden, so nennen die Anfangsbuchstaben der neuen Wörter einen Roman von W. v. Hillern. A. St. | |||
| welches Blatt wird der Gegner in Vorhand mit dieser Karte: | |||
| am richtigsten ausspielen, damit der Spieler sicher gefangen wird, und wie ist bei fehlerloser Spielführung der Gang des Spiels, wenn weder g (p.) noch s (car.) im Skat liegt? | |||
Auflösung der Schachaufgabe Nr. 4 auf S. 548:
| |||
| 1. T f 7 – f 6 K e 6 – f 5 | 1. ...... K e 6 – d 7 | ||
| 2. D g 2 – d 5 † K beliebig. | 2. D g 2 – b 7 † K beliebig. | ||
| 3. D d 5 – g 5, f 3 oder S d 2 – c 4 | 3. D b 7 – d 5, c 8 oder T f 5 – f 8 matt. | ||
| Bemerkung: Nach den Regeln der Ströbecker Schachspielweise kann der schw. B e 7 in einem Zuge nicht nach e 5 gelangen; wenn Schwarz auf 1. .... K c 6 – f 5: 2. D g 2 – d 5 † mit c 7 – c 5 antworten darf, dann ist die Aufgabe unlösbar. | |||
Homonym. |
Bilderräthsel. |
Auflösung der Aufgabe auf S. 548:
| |
Steh’ ich vor dir, Räthsel. And’res Haupt gebt einem Fisch, Trennungsräthsel. Was du vereint durchschreitest |
1. Leer. 3. Leber. 2. Bier. 4. Biber. | ||
Auflösung der Damespielaufgabe auf S. 548:
| |||
| 1. a 1 – b 2 | 1. D c 5 – a 1 † | ||
| 2. f 2 – g 3 | 2. h 4 – d 4 † † | ||
| 3. d 2 – c 3 | 3. d 4 – b 2 † | ||
| 4. c 1 – d 2 | 4. D g 5 – c 1 † | ||
| 5. D f 8 – h 6 | 5. D c 1 zieht | ||
| 6. D h 6 – c 1 † und hat gewonnen, da sämmtliche Stücke des Gegners eingesperrt sind. | |||
Buchstabenräthsel. Ein Mann ist’s, der durchdringt die Weiten |
Auflösung des Logogriphs auf S. 548: Alm, Palm, Palme. Auflösung des Scherzbilderräthsels auf S. 548: Weizenfeld. Auflösung des Trennungsräthsels auf S. 548: Vorfreude – Vor Freude. |
Auflösung des Rösselsprungs auf S. 548: Der beste Mensch wird manchmal zornig, Auflösung des Homonyms auf S. 548:
Die Wehr - das Wehr. |
Soeben ist erschienen und durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen:
Gartenlaube-Kalender für das Jahr 1891.
Preis in elegantem Ganzleinenband 1 Mark.
Aus dem reichen Inhalte des „Gartenlaube-Kalenders“ für das Jahr 1891 heben wir hervor:
Des Lebens Jahr. Gedicht von Anton Ohorn. – Aus meinen vier Pfählen: Flickdorchen. Erzählung von W. Heimburg. Mit Abbildungen von W. Claudius. – Wie Doltor Wächter ein berühmter Mann wurde. Humoreske von J. von Dürow. Mit Abbildungen von A. Lewin. – Warum die Leute nicht heirathen. Novelle von Hans Arnold. Mit Abbildungen von F. Bergen. – Eine dunkle Majestät. – Eine Schwalbengeschichte. Von A. Schnitzer. Mit Abbildung von O. Greiner. – Einiges über gesunde und kranke Füße. Von Dr. E. Clasen. – Die kritischen Tage des Jahres 1891. Von Rudolf Falb. – Ein Rückblick auf die Tagesgeschichte. Von Schmidt-Weißenfels. Mit zahlreichen Abbildungen. – Stanley - Emin und – Deutschland. Mit Abbildungen. – Pflanzenwanderungen. – Humoristisches in Wort und Bild. – Reiche und mannigfaltige Blätter und Blüthen. – Statistische Notizen aus den verschiedensten Gebieten. – Haus-, land- und forstwirthschaftliche Rathschläge. – Reiches und ausführliches Kalendarium mit Marktverzeichniß. – Post- und Telegraphentarife. – Genealogische Nachrichten. – Münz- und Maß-Vergleichungs-Tabellen. – Kleine Mittheilungen der verschiedensten Art.
Zum sechsten Male erscheint der „Gartenlaube-Kalender“, welcher sich von Jahr zu Jahr eine größere Anzahl von Freunden erworben hat, sodaß er den meisten Abonnenten der „Gartenlaube“ nicht mehr fremd ist. Der neue Jahrgang zeichnet sich durch besonders reichen Inhalt und geschmackvolle Ausstattung vortheilhaft aus und kann allen Gartenlaube-Lesern, überhaupt jedem Liebhaber eines gediegenen, nützlichen und unterhaltenden Buches zu billigem Preise zur Anschaffung empfohlen werden.
Die früher erschienenen Jahrgänge 1886–1890 des „Gartenlaube-Kalenders“ sind zum Preise von je 1 Mark ebenfalls noch zu haben.
Bestellungen wolle man der Buchhandlung übergeben, welche die „Gartenlaube“ liefert. Postabonnenten erhalten den „Gartenlaube-Kalender“ in den meisten Buchhandlungen, oder gegen Einsendung von 1 Mark und 20 Pf. (für Porto) in Briefmarken direkt franko von der- ↑ Flach ist derjenige Kopfsprung, bei welchem der Körper schräg ins Wasser hinein nur einige Fuß tief unter die Oberfläche kommt und durch die Kraft des Sprunges selbst wieder an die Oberfläche gelangt und auch noch vorwärts getrieben wird.
- ↑ * Das Festspiel ist auch im Druck erschienen (Wunsiedel, Buchdruckerei von Ad. Beer).
- ↑ Die erste leistungsfähige electrische Bahn wurde 1879 auf der Gewerbeausstellung zu Berlin von Siemens und Halske vorgeführt.