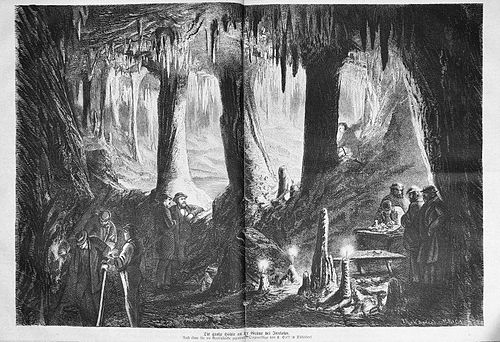Die Gartenlaube (1869)/Heft 9
[129]
| No. 9. | 1869. | |
Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.
Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 15 Ngr. – In Heften à 5 Ngr.
„Das ist ein hartes und sehr – vorschnelles Urtheil, Jutta!“ sagte der Hüttenmeister unwillig. … Ich stelle die Pfarrerin sehr hoch, und ich nicht allein – sie wird geliebt und geehrt in der ganzen Umgegend –“
„Ach mein Gott – was wissen denn diese Bauern!“ warf Frau von Herbeck achselzuckend ein.
„Jutta, ich muß Dich dringend bitten, jenen vortrefflichen Frauencharakter ernstlicher zu prüfen!“ fuhr er fort, ohne den impertinenten Einwurf der Gouvernante zu beachten. „Um so mehr, als Du künftig auf dem einsamen Hüttenwerk beinahe nur mit ihr Verkehr haben wirst.“
Jutta senkte lautlos den Kopf und Frau von Herbeck räusperte sich, während sie sich alle erdenkliche Mühe gab, die Ecken ihres Taschentuchs glatt zu zupfen.
„Und nun erlaubst Du mir, daß ich Dir Hut und Mantel hole, nicht wahr?“ fragte der Hüttenmeister sich erhebend. „Die Luft draußen ist köstlich –“
„Und die Wege schwimmen,“ ergänzte die Gouvernante trocken. „Herr Hüttenmeister, ich begreife Sie wirklich nicht! … Wollen Sie Fräulein von Zweiflingen à tout prix krank machen? … Ich hüte sie ängstlich vor jedem Zuglüftchen, und nun soll sie sich unnöthiger Weise durchaus nasse Füße holen – machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber das gebe ich nun und nimmermehr zu!“
Die leutselige gnädige Frau fiel ein wenig aus ihrer Rolle – ein kalter, lauernder Blick fuhr blitzschnell über den Hüttenmeister hin; dieser eine Blick aber belehrte sie plötzlich, daß der für so simpel gehaltene, wortkarge Mann nicht im Geringsten mit sich spaßen lasse.
„Der Waldweg, auf dem meine Braut mir oft entgegengegangen ist, war fast immer bodenlos – meinst Du nicht, Jutta?“ sagte er lächelnd.
Ein feindseliger Ausdruck erschien auf dem tieferröthenden Gesicht der jungen Dame. … was brauchte denn Frau von Herbeck zu wissen, daß es eine Zeit gegeben hatte, wo sie in fieberhafter Ungeduld und Sehnsucht, durch Wind und Wetter, dem Geliebten entgegengegangen war? … Sie beantwortete die Frage nicht.
„Das ist ein Streit um des Kaisers Bart,“ sagte sie herb, in schneidendem Tone. „Ich gehe eben entschieden heute nicht aus, am allerwenigsten aber in’s Pfarrhaus! … Das erkläre ich Dir hiermit unumwunden, Theobald, nie und nimmer betrete ich diese Schwelle wieder!“
Der Hüttenmeister schwieg einen Augenblick. Er stand noch und stützte die Hand auf die Stuhllehne – seine über der Nasenwurzel zusammengewachsenen dunklen Brauen, die das schöne Gesicht so schwermüthig machten, runzelten sich finster.
„In drei Wochen kehrt die kleine Gräfin Sturm nach A. zurück?“ fragte er, aber mit sehr viel Bestimmtheit und Nachdruck, die eine falsch verneinende oder ausweichende Antwort unmöglich machten.
Die Damen sahen ihn bestürzt an, allein keine widersprach.
„Darf ich fragen, Jutta, wo Du zu bleiben gedenkst, wenn das weiße Schloß leer und verlassen ist?“ frug er weiter.
Plötzliche Stille. … Es giebt Momente, die eine ganze Reihe unaufhaltsamer Ereignisse in eine Zeitdauer von wenigen Minuten einschließen, der Mensch fühlt instinctmäßig ihre Bedeutung – es ist, als stünde er unter dem lose gewordenen Schlußstein eines Gewölbes, die nächste Erschütterung wirft ihn herab, und der Bau bricht zusammen – eine solche Erschütterung ist das erste Wort. … Der Hüttenmeister sprach es aus, gerade weil ein energischer Griff in die gegenwärtigen Verhältnisse unumgänglich nöthig war.
„Bis zu dem Moment, wo ich als Dein einziger Beschützer auftreten und Dich im eigenen Hause haben und hegen darf,“ sagte er – seine Stimme verschleierte sich und bebte, und ein Strahl heimlichen, unsäglichen Glückes brach aus seinen Augen – „bis zu dem Moment giebt es keinen anderen anständigen Aufenthalt für Dich, als eben das Pfarrhaus.“
Jetzt erhob sich Frau von Herbeck auch und stemmte ihre weißen, vollen Hände auf den Tisch.
„Wie, Sie wären allen Ernstes im Stande, Fräulein von Zweiflingen in diese – Gott verzeih’ mir’s – Spelunke zurück zu bringen?“ rief sie. „Soll denn diese lebensfrische Geisteskraft durchaus erstickt werden in der frömmelnden, pietistischen Gesellschaft da drüben? … Mir möchte das Herz brechen, wenn ich mir so viel Seelenadel, diese echt aristokratische Mädchenerscheinung inmitten der pfarrherrlichen Hühner und Gänse und eines rüden, widerwärtigen Kinderschwarmes denke! … Schmale Bissen, derbe Hausarbeit und als geistigen Genuß ein Capitel aus der Bibel – Sie wagen es wirklich, diese köstliche Dreieinigkeit einer hoch gebildeten jungen Dame von Stande zuzumuthen? … Mein Herr Hüttenmeister, Sie mögen Ihre Braut recht lieb haben – [130] ich will es nicht bezweifeln – aber – nichts für ungut – die Zartheit der Liebe besitzen Sie nicht, sonst würden Sie nicht ein Etwas in Jutta’s Seele so rauh ignoriren, das nun einmal da ist, das die Herren Socialisten und Demokraten mit all’ ihrer Weisheit nicht wegzuspotten vermögen, das unter dem schwersten Drucke fortlebt, weil es thatsächlich göttlichen Ursprunges ist – ich meine das Bewußtsein der höheren Abkunft!“
Der Student schnellte ein Stück mit seinem Stuhl zurück, und die hochgehobene geballte Hand wäre sicher mit einem zerschmetternden Schlag auf den Tisch niedergefallen, hätte sie nicht der Hüttenmeister noch rechtzeitig ergriffen und festgehalten; aber so ernst warnend er auch den jungen Heißsporn ansah, er bedurfte offenbar selbst aller ihm zu Gebote stehenden Energie, um seine äußere, ruhige Haltung zu behaupten.
„Und so denkst Du auch, Jutta?“ fragte er mit schwerer Betonung.
„Mein Gott, wie Du doch Alles gleich so tragisch nimmst!“ entgegnete sie verdrießlich.
Ihre großen, dunklen Augen hatten einen Moment mit wahrhaft vernichtender Kälte den Studenten gemustert, der es wagte, seine ungeschliffenen Burschenmanieren in das weiße Schloß mitzubringen. Jetzt richteten sie sich auf den Hüttenmeister.
„Du kannst doch unmöglich verlangen, daß ich eine Hymne zur Ehre des Hauses anstimme, in welchem ich mich namenlos elend und verlassen gefühlt habe?“ fuhr sie fort. … „Aber ich bitte Dich, Theobald, stehe nicht so entsetzlich entschlossen dort! Muß es denn immer heißen: ‚entweder, oder‘?“
Sie deutete mit der Hand auf den Stuhl.
„Komm, setze Dich noch einen Augenblick!“ forderte sie ihn fast zutraulich auf. Ein Lächeln irrte um ihre Lippen, ein flüchtiges, kühles Lächeln, – aber es war für heute das erste und einzige – es hatte etwas Versöhnliches für den jungen Mann. Er setzte sich.
„Ich weiß einen Ausweg“ – hob sie an. Frau von Herbeck, die sich nach ihrer erhabenen Rede wieder in die Sophaecke hatte fallen lassen, legte hastig ihre Hand auf den Arm des jungen Mädchens.
„Nicht jetzt, meine Liebe!“ warnte sie mit bedeutungsvollem Blick. „Der Herr Hüttenmeister scheint mir durchaus nicht in der Stimmung, die an sich so harmlose Sache auch harmlos anzusehen –“
„Aber, mein Gott, einmal muß es ja doch gesagt werden!“ rief Jutta ärgerlich. „Theobald, ich habe einen Vorschlag, Plan, oder – nenne es wie Du willst“ – die Vorschläge schienen heute in der Luft des weißen Schlosses zu liegen – „mit einem Wort: die Fürstin von A. will mich als Hofdame placiren. …“
Da war ja der Moment, wo sich die Fugen lösten, wo es verhängnißvoll knisterte und wankte über dem Haupt eines verrathenen Menschen – er hatte ja selbst mit seinem ersten Wort an das schwebende Unheil gerührt.
Er fragte nicht: „Kannst Du es über’s Herz bringen, Dich von mir zu trennen?“ Diese Frage aus einem Männermunde war bereits, angesichts des „beherzten, wohlüberlegten“ Planes der jungen Dame, zur „lächerlichen Sentimentalität“ geworden. … Er sprach überhaupt nicht. Wollte dies schöne, schwermüthige Gesicht mit den fest auf kein Boden haftenden Augen zur Leblosigkeit erstarren? Nur an den Schläfen stieg es unheimlich roth in die Höhe, als sei der Kreislauf des Blutes jählings aus seinen gewohnten Bahnen gewichen und stürme gefahrdrohend nach dem Gehirn. Erst als er nach einer lautlosen, peinvollen Pause die Lider hob, da sah man, daß seine Seele einen tödlichen Schlag erhalten halte.
„Weiß die Fürstin, daß Du verlobt bist?“ frug er tonlos, den erloschenen Blick auf seine Braut richtend.
„Bis jetzt noch nicht. …“
„Und Du glaubst, man werde in dem etikettestrengen A. die Braut eines bürgerlichen Hüttenmeisters als Hofdame zulassen?“
„Wir hoffen zuversichtlich, daß die Herrschaften diesmal, in Rücksicht auf den alten Namen ‚Zweiflingen‘ eine Ausnahme machen werden,“ nahm Frau von Herbeck rasch und lebhaft das Wort. „Freilich muß man diese delicate Angelegenheit sehr, sehr subtil anfassen – überlassen Sie das mir, mein bester Herr Hüttenmeister! … Zeit bringt Rosen! … Im ersten halben Jahr brauchen die Durchlauchten noch gar nichts zu wissen – und dann –“
„Ich bitte Sie, lassen Sie mich mit meiner Braut allein, gnädige Frau!“ unterbrach der Hüttenmeister den Redestrom der Dame.
Sie starrte ihn wortlos an. … Wie, dieser Mann, den man nothgedrungen hie und da auf eine Stunde im weißen Schlosse duldete, er wagte es, sie hinauszuweisen, und noch dazu aus einem Zimmer, das zu ihren eigenen Appartements gehörte? … Nicht einmal Seine Excellenz der Minister erlaubte sich diesen eiskalten, kurzen Ton, wenn er allein zu sein wünschte. … Eigentlich war die bäurische Naivetät, mit der die Begriffe geradezu auf den Kopf gestellt wurden, einfach lächerlich und amüsant – aber die gnädige Frau brachte das Lachen nicht fertig, dem furchtbaren Ernst und der finsteren Entschlossenheit gegenüber, mit welcher sich der junge Mann erhoben hatte und auf ihr Hinweggehen wartete.
Sie warf einen raschen Seitenblick auf Jutta, und angesichts dieses elastischen Profils mit den in leisem Hohn vibrirenden Nasenflügeln und trotzig geschlossenen Lippen, mit dem Gesammtausdruck eines kaltgrausamen Muthes gab sie plötzlich ihren beabsichtigten Widerstand auf – nun war ihr auch, dem „ungeschliffenen Menschen“ gegenüber, jedes Wort zu kostbar. … Sie erhob sich spöttisch lächelnd in ihrer ganzen Majestät, und rauschte, weder rechts noch links sehend, hinüber in den Salon, während der Student hinausgehend die Corridorthür hinter sich schloß.
Jutta stand auf und trat in die tiefe Fensternische, wohin ihr der Hüttenmeister folgte. … Da stand das junge Paar, in vollendeter Körperschönheit Eines des Anderen würdig. Dicht neben ihnen rauschten die grünen Vorhänge nieder, sie gleichsam abschließend von dem Verkehr und Treiben im Schlosse. Von den Wänden herab kamen die Ranken des großblätterigen schottischen Epheu und schlangen sich versöhnlich über die Beiden, und draußen vor dem Fenster lag die weite Welt, über die der Frühling hinlächelte. … Die jungen Bäume trieben neue Wurzeln, und die Blumen, die dereinst ihre bunten Köpfchen im Sonnenlicht wiegen wollten, drückten den kleinen Fuß fest in das Erdreich – Alles wurzelte und trieb tief ein in dem heimischen Boden, sich selbst fesselnd und bindend, um droben in den sonnigen Lüften um so freudiger und sorgloser blühen zu können . … und hier fiel ein Menschenherz von dem anderen ab, und riß in gewaltsamer Selbstbefreiung erbarmungslos an dem fesselnden Band, das mit tausend Wurzeln und Widerhaken in den tiefsten Tiefen der anderen Seele hing.
„Du stehst bereits in Beziehung zu dem A.’schen Hofe?“ begann der Hüttenmeister – eine entschiedene Frage, der man aber das Herzklopfen angstvoller Spannung anhören konnte.
„Ja,“ entgegnete die junge Dame. Sie streifte mit den Händen über ihre knisternde Seidenrobe. „Diesen Stoff hat mir die Fürstin geschickt, und außerdem eine große Kiste voll der feinsten fertigen Leibwäsche, Shawls, Spitzen etc. – mein Ankleidezimmer sieht aus wie ein Bazar. … Die Fürstin kennt meine finanzielle Lage, und es ist ihr wegen des Hofgeschwätzes unangenehm, wenn ich pauvre nach A. komme.“ …
Dies Alles sagte sie leichthin, als etwas Selbstverständliches, während der Hüttenmeister, sprachlos vor schreckensvoller Ueberraschung, förmlich zurücktaumelte. … Aber jetzt brach auch bei diesem Mann der weisen Geduld und Mäßigung ein heiliger Zorn, ein schmerzlicher Ingrimm durch.
„Jutta, Du hast es gewagt, eine so erbärmliche Komödie mit mir zu spielen?“ stieß er erbittert hervor.
Sie maß ihn mit einem stolzen Blick vom Kopf bis zu Füßen. „Ich glaube gar, Du willst mich beleidigen!“ sagte sie kaltlächelnd, aber ihre Augen flimmerten in unheimlichem Glanze. „Hüte Dich, Theobald – ich bin nicht mehr das unwissende Kind, das sich einst willenlos von Dir und – einer verbitterten Mutter hat regieren lassen!“
Er starrte, wie aufgeschreckt, einen Augenblick in das dämonisch schöne Mädchengesicht – dann strich er sich tiefaufseufzend mit der Hand über die Stirn.
„Ja, Du hast Recht - und ich bin blind gewesen!“ murmelte er, „Du bist nicht mehr das Kind, das sich einst freiwillig an mein Herz legte und mir, dem Verzagten, sagte: ,Ich habe Dich lieb – ach, so lieb!’“ – Er biß die Zähne zusammen.
[131] Die junge Dame aber riß in zorniger Verlegenheit ein Epheublatt ab und zerzupfte es in kleine Stücken – das gleichmäßige Rauschen eines Seidenkleides klang ununterbrochen bis in die Fensternische; die Gouvernante marschirte dicht vor der offenen Salonthür wie eine Schildwache auf und ab.
„Ich begreife nicht,“ stieß Jutta mit funkelndem Blick hervor, „wie Du dazu kommst, mich in so abgeschmackter Weise an meine Pflicht zu erinnern! – Beweise mir, daß ich sie verletzt habe!“ –
„Sogleich, Jutta! – Es giebt keinen Rückweg vom Fürstenhof in das Hüttenhaus!“
„Das sagst Du – nicht ich!“
„Ja, das sage ich! … Und wenn Du wirklich zu mir zurückkehrtest ich verschlösse mein Haus vor Dir. … Ich will keine Frau, die Hofluft geathmet hat! Ich will eine ursprüngliche, unberührte Seele neben mir, wie ich sie einst im Waldhause gefunden! … O, ich bin ein Thor gewesen, ein Wortbrüchiger der alten, blinden Frau gegenüber! Nicht eine Stunde durfte ich Dich im weißen Schlosse lassen! Du bist schon vergiftet – der Plunder, mit dem Du Dich so wohlgefällig behängst,“ er zeigte auf das strahlende Kleid – „hat auch den Thau von Deiner Seele gestreift!“
Das war eine tief einschneidende Verurtheilung, und der sie ernst zürnend aussprach, trug den ganzen Glanz eigener fleckenloser Seelenreinheit auf der Stirn.
Frau von Herbeck kam tiefbesorgt über die Schwelle gerauscht – der streng sittliche Mensch kann in gewissen Momenten für frivole Naturen geradezu furchtbar werden, er hat Gewalt über sie – aber Jutta winkte ihr, zurückzukehren – sie wollte allein fertig werden, sie brauchte keinen Beistand.
„Jutta, kehre um!“ fuhr der Hüttenmeister in bebendem Tone fort, während er beschwörend die Linke der jungen Dame ergriff und sie an sich heranzog.
„Um keinen Preis – ich werde mich nicht so lächerlich machen!“
Er ließ ihre kleine, kalte, sich unwillkürlich krümmende Hand sinken.
„So – dann habe ich Dich nur noch zu fragen, wessen Fürsprache Du Deine brillanten Aussichten verdankst?“
Sie sah ihn unsicher an – diese starre Ruhe hatte etwas Furchtbares.
„Meine Freundin, Frau von Herbeck –“ entgegnete sie zögernd.
„Wer unsere stolzen Herrschaften kennt, der weiß auch, daß eine Untergebene des Ministers keinen directen Einfluß haben kann,“ schnitt er die offenbar ausweichende Antwort kurz ab.
Die Gouvernante fuhr auf ihrem Lauscherposten zurück wie von einer Natter gebissen.
„Jutta, ich persönlich habe Dir nicht ein Wort mehr zu sagen – ich habe keinen Theil mehr an Dir – das ist vorbei!“ fuhr er in erhobenem Ton fort. „Aber im Namen Deiner Mutter muß ich sprechen! … Gehe, wohin Du willst – Deine altadelige Abkunft wird Dir an allen Höfen Zutritt verschaffen – nur bleibe nicht hier! Du darfst nicht Gunstbezeigungen aus den Händen Derer nehmen, denen Deine unglückliche Mutter geflucht hat! … Jutta, er, der Minister –“
„Ah, jetzt kommt die Revanche!“ unterbrach ihn das junge Mädchen wildauflachend – sie floh aus der Fensternische in das Zimmer zurück. „Schmähe ihn, so viel Du willst!“ rief sie wie rasend vor Leidenschaft. „Nenne ihn einen Mörder, einen Teufel! … Und wenn es die ganze Welt schreit und beschwört – ich glaube nichts, nichts – ich höre nicht!“
Ihre kleinen Hände fuhren unter die Locken und legten sich auf die Ohren.
Die bleichgewordenen Lippen des jungen Mannes preßten sich bei diesem Anblick auf einander, als wollten sie verstummen für immer und ewig. Langsam streifte er seinen Verlobungsring ab und reichte ihn der jungen Dame hin – sie griff hastig nach dem ihren, und jetzt – zum ersten Mal während der ganzen stürmischen Scene – wurde ihr Gesicht dunkelroth in Scham und Verlegenheit … also deshalb hatte ihre zarte Rechte unverdrossen das schwere Bouquet gehalten – die unschuldigen Blumen mußten den beraubten Goldfinger bedecken – dort in der Perlmutterschale, auf die der unsichere Blick der treulosen Braut fiel, lag der Ring – sie hatte ihn ja bereits abgelegt. …
Der Hüttenmeister stieß ein markerschütterndes Lachen aus und taumelte durch die Thür, die der Student in demselben Augenblick öffnete, und aus dem Salon eilte Frau von Herbeck herüber und legte zärtlich ihre Arme um „die Standhafte“.
„Er hat es nicht anders gewollt, der Thor!“ murmelte die junge Dame trotzig, indem sie sich ziemlich unsanft der Umarmung entzog. Sie athmete einen Augenblick eine erfrischende Essenz ein, dann warf sie sich eine Handvoll Reispuder in’s Gesicht – als Präservativ gegen das hautverderbende Echauffement.
Die beiden Brüder flohen förmlich nach dem Ausgang des Schlosses. War es doch, als sei selbst die schmeichelnde, parfümirte Lust der langen Gänge mit Verrath und Lüge erfüllt.
Unten in der offenen Thür des Musiksalons stand der Schloßverwalter und rief nach Leuten – der Flügel sollte anders gestellt werden. Man konnte den ganzen brillanten Raum übersehen. Die purpurseidenen Vorhänge waren dicht zugezogen, am den Wänden brannten bereits die Armleuchter, ein helles Feuer loderte im Marmorkamin, und die Diener arrangirten einen Kaffeetisch – lauter Anstalten, den Musiksalon Seiner Excellenz gemüthlich und anheimelnd zu machen. … Das Notturno von Chopin wurde jedenfalls heute noch gespielt, und während man die silbernen Kuchenkörbe leerte und Kaffee aus Meißner Porcellan trank, moquirte man sich über den Verabschiedeten, der sich unterfangen hatte, unmöglich gewordene Ansprüche an die künftige Hofdame Ihrer Durchlaucht der Fürstin von A. geltend zu machen.
In einem dem Kamin nahegerückten Lehnstuhl lag die kleine Gisela. Die schmalen Füßchen lässig gekreuzt, schmiegte sie den kleinen, unscheinbaren Kopf an die farbenreiche Stickerei der Lehne. Als sie die beiden jungen Leute durch das Vestibüle eilen sah, hob sie den Kopf und sprang auf den Boden. Sie war offenbar einen Moment ohne alle Aufsicht, denn in dem Augenblick, wo der Hüttenmeister hinaus auf den Kiesplatz trat, stand sie neben ihm und berührte seine Hand. Sie griff in die Tasche und holte, eine Handvoll nagelneuer Kupferdreier heraus.
„O, nehmen Sie!“ flüsterte sie athemlos. „Ich habe sie gesammelt, weil sie hübsch sind – es ist sehr viel Geld, nicht wahr?“
Der Hüttenmeister blieb zwar mechanisch stehen, allein ein völlig verständnißloser Blick fiel auf das Kind – es sah aus, als habe plötzlich ein verheerender Hauch dieses blühendfrische Körper- und Seelenleben angeweht.
„Rühre ihn nicht an!“ drohte der Student in ausbrechendem Schmerz und stieß die Kleine weg. Er lachte bitter auf, als die Geldstücke aus der Hand des erschrockenen Kindes klirrend über den Kies hinrollten. „Weißt Du kleine Natter auch schon,“ rief er, „wie die Hochgeborenen die Seelenwunden Anderer, behandeln? … Mit Geld, mit Geld! … Was an Dir ist denn hochgeboren, Du gebrechliches, häßliches kleines Menschenkind?“
Seine jugendlich kräftige Stimme hallte alarmirend in dem Vestibüle wider, an dessen Wände sonst fast nur das Geräusch leiser Sohlen und das gedämpfte Geflüster der Lakaien schlugen. Die Diener und der Schloßverwalter fuhren mit langen Hälsen aus der Thür des Musikzimmers, und im Hintergrund des Vestibules erschien Lena. Sie schlug die Hände zusammen, als sie die kleine Gräfin mit allen Zeichen des Schreckens, ohne Umhüllung und mit entblößtem Kopf draußen im Freien stehen sah; dazu hörte sie die beißende Frage des Studenten – bestürzt lief sie hinaus und zog das gräfliche Kind aus dem Bereich des „frechen Menschen“.
In demselben Augenblick raffte eine weiße Hand die zugezogene Gardine eines Fensters im Erdgeschoß zurück, und das bleiche Gesicht des Ministers erschien hinter den Scheiben. Bei diesem Anblick wurden die fieberischen Flecken aus den eingefallenen Wangen des Studenten zur dunklen Gluth. … Er trat dicht an das Fenster heran – der Minister fuhr in sichtlicher Bewegung zurück, allein die langen Lider legten sich sofort wieder über die Augen – der junge Mann hatte keine Waffe in der hochgehobenen Rechten.
„Ja, ja, sieh nur heraus und freue Dich!“ rief der Student mit weithin schallender Stimme. „Die Elende da droben hat ihre Sache gut gemacht – der Plebejer geht! … Fahre nur so fort, [132] Excellenz! Ignorire die Hungersnoth im Lande und jage den Geist aus den Schulen – da hast Du gut regieren! … Was freilich kümmern Dich deutscher Geist und deutsches Elend, Du fremder Eindringling –“
Der Kopf des Ministers verschwand, und die Vorhänge fielen wieder dicht zusammen – durch das Vestibule aber scholl eine heftig angezogene Glocke.
Ob die unmittelbar darauf hervorstürzenden Diener Befehl hatten, „den Schreier“ wegzubringen, blieb unentschieden. Der Hüttenmeister hatte bereits seine Arme um die Schultern des Bruders geschlagen und zog ihn fort.… Die hohe, athletische Gestalt des jungen Mannes aber, der noch einmal den Kopf mit der todesstarren Ruhe in den Zügen nach dem Schlosse zurückwandte, war wohl geeignet, Bedientenseelen Respect einzuflößen – die Leute blieben zögernd stehen, während die Brüder den Schloßgarten durchschritten.
Ein leises Abenddämmern webte bereits über der Gegend. Der Sonnenschein, der heute unermüdlich und energisch an die braunharzige Knospenhülle der Bäume, an das Schlafkämmerlein des Samenkorns und an die winterverschlafene Menschenseele geklopft hatte, war verblaßt; nur auf dem Scheitel der Berge, hinter denen er versunken, loderte noch ein orangefarbenes Licht.… Es war plötzlich sehr kühl geworden; über den Treibhausfenstern lagen längst die schützenden Strohmatten und die Schlöte in Neuenfeld dampften weidlich.
Wußte der Hüttenmeister nicht, daß er die entgegengesetzte Richtung einschlug, als er aus dem Gitterthor des weißen Schlosses trat? Dort drüben lag das Hüttenhaus mit seiner gemüthlichen Stube. Sievert schob sicher in diesem Augenblick ein Scheit Holz um das andere in den riesigen Ofen, warf einige kräftig duftende Wachholderbeeren auf die heiße Platte, deckte den Tisch so sorgfältig, wie nur je bei seiner hochadeligen Herrschaft, und zog die Vorhänge zu.… Dort lag das schützende Asyl, das Heim – und dahinaus ging’s in die pfadlose Wildniß.…
Der Student ergriff besorgt die Rechte seines Bruders – ein Blick fiel auf ihn, und seine Hand wurde mit pressendem Drucke festgehalten – jetzt wußte er, daß die Seelenqual den schweigsamen Mann vorwärts trieb. Er schritt wortlos neben ihm her, und weiter ging es über schwimmende Wiesen, deren versumpfter Boden unter jedem Schritt einsank, durch Erlengebüsch, das nebelathmend die Niederung bedeckte, und da, wo der Berg in fast unwegsamer Steilheit seine mit Tannen bestandene Flanke vorstreckte, stiegen die schweigenden Wanderer aufwärts.… Was hilft es dem zu Tode getroffenen Hirsch, daß er sich in die Einöde rettet? Er trägt das mörderische Blei in sich – es läuft mit ihm über Berg und Thal.… Und der Mann, der in athemloser Flucht bergaufwärts klimmte, schleppte die Last seines Elends mit hinauf – er entrann ihm nicht – nichts, gar nichts behielt das dumpfe Thal drunten. In der todesstillen Einsamkeit schrie das Weh, das er hinter den schweigenden Lippen verbiß, lauter auf – wie der Schrei des wilden Vogels verzehnfacht wiederhallt in den schauerlichen Schluchten und Klüften.
Dunkle Wasser flossen über den mit dicken Nadelschichten bedeckten Boden und machten den steilen Weg schlüpfrig und gefahrvoll. Es dämmerte stark unter den Tannen, die ihre noch schneefeuchten Zweige in fast schwarzer Zeichnung vom Himmel abhoben – nur hie und da, wo das Dickicht schützend seine Arme verschränkte, leuchtete noch ein kleiner verschonter Schneestreifen und nahm spukhafte Form und Gestalt an.
Ueber dem Berggipfel hing der Himmel, ein stahlblauer Schild, auf den die Verheißung geschrieben hat: „Ruhe und Frieden“.… Für das Menschenherz jedoch, das sich auf die Höhe geflüchtet, war der Himmel eingestürzt in dem Augenblick, wo es verrathen wurde.…
Der Hüttenmeister trat weit vor auf der Plattform des Berges, während der Student sich erschöpft an einen Baum lehnte. Drunten im Grund verwischte das hereinbrechende Dunkel bereits alle Linien; nur den schäumenden Fluß betupften noch einzelne schwache Reflexe – sein Rauschen und Tosen scholl dumpf herauf.… Im Dorfe tauchten die Lichter auf; über der Esse des Hüttenwerks aber schwebte die Gluth und leckte mit feurigen Zungen über den Himmel hin. Und dort lag das vornehme, stolze Quadrat, das weiße Schloß, mit seinen lichtstrahlenden Fensterreihen.… Seine Excellenz rollte wohl bereits der Residenz und dem Hofball zu – Triumph auf dem bleichen Gesicht und unter den schläfrigen Lidern – und im Seezimmer, auf dem schwellenden Ruhebett der Gräfin Völdern, lag vielleicht in diesem Augenblick das Kind der Blinden im schimmernden Seidenkleid, dem Handgeld fürstlicher Huld und Gnade, und träumte – von dem nächsten Hofball, wo mit der strahlend schönen neuen Hofdame ein blendender Stern aufging.… Die lange Ahnengalerie im verlassenen Waldhause – dieser durch den Pinsel festgehaltene vollkommene Typus des Adelstolzes lebte noch einmal auf in dem jüngsten Sproß – der alte Name wurde wieder an den Höfen genannt. In diesem jüngsten Sproß steckte Race, der strenge Geist der Vorfahren.… Das uralte Trauerspiel, zu welchem diese Reihe hochadeliger Jäger genug Acteure geliefert, wurde wieder einmal aufgeführt: der aristokratische Hochmuth verrieth die Liebe.
Der verrathene, plötzlich aus der Bahn ruhigen Denkens geschleuderte Mann wäre vielleicht die ganze Nacht, nach einem inneren Gleichgewicht ringend, über Berg und Thal gewandert, hätte nicht endlich der zu Tode erschöpfte Student seinen Arm erfaßt und ihn bittend dem Rückweg zugewendet. Bis dahin war kein Wort zwischen den zwei Umherirrenden gefallen – sie waren den Berg jenseits hinabgestiegen und hatten ein schmales Thal durchschritten, um abermals an einer Felsenwand emporzuklettern. Jetzt standen sie in einer tiefen Kluft, durch welche der hochangeschwollene Fluß donnernd stürzte.
Thier-Charaktere.
Alte Erinnerungen wogten in seltener Frische in mir, als ich im Laufe des vergangenen Sommers eine reichhaltige Sendung theilnahmswerther, ja liebenswürdiger Kriechthiere empfing. Vor meinem geistigen Auge baute sich die von mir längere Zeit bewohnte Behausung im arabischen Viertel Alexandriens wieder auf, und ich gedachte jener Stunde, in welcher ich Bekanntschaft machte mit dem „Kleinstädter in Aegypten“, einem der geistreichsten Menschen, welche mir Afrika zugeführt hat, dessen noch fortdauernde Freundschaft ich als ein liebes Erbtheil jener Zeiten betrachte.
Unter Führung meines Lehrers, des Hadj M’sellem Aali, dessen Mund, gleich den Lippen Mirza Schaffy’s, überfloß von morgenländischer Weisheit, durchwandelte ich den Blumengarten der „Tausend und einen Nacht“, als der „Weise des Abendlandes“ in mein einfaches Zimmer trat, um sich Raths zu erholen bezüglich seiner zu unternehmenden Reise im Lande der Pyramiden. Wie eine Stromschnelle des Nil flutheten die Worte des Unerschöpflichen; – da, plötzlich, stockte die Rede, und Widerschein der Verwunderung, wo nicht eines gelinden Schauders, zog über sein Antlitz. Die Genossenschaft meines Zimmers war rege geworden. Hinter der Kiste, welche dem Gaste zum Sessel gedient, stelzten mit Vogelschritten einige von ihm gestörte Springmäuse hervor, und als das Auge, ihnen wohlgefällig folgend, das Zimmer durchblickt, mußte es nothgedrungen noch ganz andere Geschöpfe gewahren. Sandnattern in Kästen, Schleuderschwänze in Käfigen, Chamäleons auf allen Vorsprüngen, Ecken, Erhabenheiten etc.
„Beim Barte des Propheten, den zu verehren ich mich anschicke, welch’ wundersame Genossenschaft theilt mit Ihnen das Zimmer! Es wird Einem schier unheimlich inmitten solchen Gethieres, von welchem man doch nicht wissen kann – –“
„Ob man seines Lebens sicher,“ fiel ich ihm in die Rede;
[133][134] „seien Sie unbesorgt, Sie befinden sich in der besten Gesellschaft, in viel besserer jedenfalls als in der Ihrer sogenannten Glaubensgenossen, mit denen Sie hier verkehren werden und müssen – von Einzelnen, insbesondere Ihrem ergebenen Diener selbstredend abgesehen.“
Daß ich nicht zuviel gesagt: unser „Kleinstädter“ hat es später bewiesen, als er mehrere Tage die Wohnung mit mir und meinen thierischen Genossen theilte; denn er hatte rasch gelernt, mit ihnen sich zu befreunden.
Seit jenen Tagen in Alexandrien zum ersten Male habe ich jetzt, und zwar hier in Berlin, wiederum die Freude, sämmtliche der genannten Thiere zu pflegen und zu beobachten, und jeder Tag fast bringt zu den alten Erfahrungen neue.
Das „Berliner Aquarium“ verdankt die Chamäleons, welche es gegenwärtig besitzt, dem Sammeleifer Dr. Schweinfurth’s, des bekannten Afrikareisenden, welcher augenblicklich wiederum im Innern des Erdtheils weilt, um die Pflanzenwelt der von Heuglin thierkundlich durchforschten Gebiete des oberen weißen Niles wissenschaftlich festzustellen. Auf meine Bitten hatte er bei Alexandrien eine ziemliche Anzahl gedachter Thiere durch die zu Allem verwendbaren „Chamari“ oder Eseltreiber, gewitzte Buben mit sämmtlichen Eigenschaften unserer Gassenjungen, sammeln lassen und sie, meiner Weisung gemäß, in durchlöcherten, mit festen senkrechten Stäben und Palmenzweigen versehenen Kisten als Eilgut auf die Reise gegeben.
Für die meisten Kriechthiere ist diese Art der Versendung die einzig ersprießliche. Sie sind in ihrem Freileben oft genug in der übeln Lage, wochen-, ja monatelang fasten zu müssen, und haben es in dieser Enthaltsamkeit weit gebracht. Ein mehrwöchentlicher Hunger schadet ihnen in der Regel nicht, während beigegebene Nahrung insofern nachtheilig ist, als sie doch nicht gefressen wird, verdirbt und verfault, die Luft in dem engen Raume verpestet und den Eingekerkerten Verderben bringt. Von fernwohnenden Freunden des „Berliner Aquarium“ haben wir so lebende Schildkröten, Echsen und Schlangen erhalten, welche drei Monate lang unterwegs und zum Fasten gezwungen waren.
Unsere zarten Chamäleons staken nur vierzehn Tage in ihrem Versandgefängnisse, hatten aber doch schon erheblich gelitten, hauptsächlich wohl in Folge der rohen Behandlung, welche sie abseiten ihrer Fänger zu erdulden gehabt. Eine Anzahl von Leichen deckte den Boden: von den „fünfundachtzig guten, beißenden Chamäleons“, welche Schweinfurth abgesandt, bissen nur einige dreißig noch, während andere jede Behelligung widerstandslos über sich ergehen ließen. Die Gesammtheit trug ein und dasselbe Trauerkleid: anstatt des schönen Blattgrüns, von welchem sich die helleren oder dunkleren Längsstreifen, Flecken und Punkte so hübsch abheben, zeigte die Haut ein gleichmäßiges grauliches Strohgelb, ohne deutliche Abzeichnung, ohne lebhaftere Färbung. Die Thiere waren offenbar ermattet, abgespannt, erschöpft, verschmachtet.
Jetzt galt es, ihnen alle Genüsse zu verschaffen, welche das irdische Leben eines Chamäleons verlangt. Der vorbereitete Kasten wurde mit grünen Zweigen geschmückt, Honig herbeigeschafft, um Fliegen anzulocken, Mehlwürmer zum lecker bereiteten Mahle vorgesetzt und eines der Kriechthiere nach dem anderen in die wohnliche Behausung gebracht.
Der Erfolg entsprach den Erwartungen nicht. Es fehlte an etwas: das war ersichtlich. Wohl richteten sich zehn, zwanzig Augen nach dieser Fliege, nach jenem Mehlwurme; aber der Zungenpfeil, welcher, wie ich wußte, mit so viel Sicherheit geschleudert wird, blieb auf dem Bogen, d. h. in seiner Scheide. Sollte die verschrumpfte Haut durch Anfeuchten geglättet, das Thier hierdurch belebt werden können? Versuchen wir es! Ein Schlauch wird in die nöthige Richtung gebracht, der Hahn geöffnet; ein künstlich erzeugter Regen träuft auf die Ermatteten nieder. Welche Veränderung! Zauberischer, belebender, als diese Labung sich erwies, wirkt nicht das erste Gewitter nach langer Dürre, erquickender nicht der erste Trunk, welcher dem Verschmachteten wird. Jeder Tropfen, welcher auf die lederfarbene Haut fiel, gab ihr an der befeuchteten Stelle die Frische wieder, und wie Nebelgewölk vor der Sonne zerflockte, zerriß, verschwand das Kleid der Entsagung, um dem Gewande der Lebensfreudigkeit Platz zu machen. Aber nicht blos die verwelkte Haut erfrischte sich durch das belebende Naß, auch die Zunge leckte gierig die erquickenden Tropfen auf. Und als diese mehr und mehr abgefallen von den Blättern, faßten die verschmachteten Thiere letztere beiderseitig mit den harten Lippen, saugten förmlich an ihnen und suchten ein anderes Blatt, wenn das erstere abgeleckt oder abgesaugt worden war.
Endlich hatten sich alle an dem immer wieder gespendeten Trunke zur Genüge erlabt, und nunmehr erregten die krabbelnden Mehlwürmer, die honiglüsternen Fliegen gebührende Theilnahme. Aus den blätterdürren Leibern der Chamäleons waren wohlgerundete geworden, in die geknickten Beine Kraft und Strammheit, in die matten Augen Beweglichkeit, in das kleine Hirn Thatkraft gekommen. An den Zweigen kletterten die Thiere auf und nieder; um die besseren Plätze stritten sie sich mit drohenden Grimassen und Beißen; mit den Wickelschwänzen umschlangen sie sich gegenseitig, wenn es an Raum fehlte; alle Winkel der Höhe und Ebene durchspähten die von einander unabhängigen Augen. Dutzende von solchen Augen zielten nach einer und derselben Beute; die von der einen Zunge gefehlte Fliege fiel der zweiten, dritten, zehnten gewißlich zum Opfer. Ganze Schüsseln voller Mehlwürmer wurden geleert im Umsehen, und die von Neuem beschickte Tafel war theilweise schon wieder abgegessen, bevor wir, die stellvertretenden Aufwärter, unserem willig geübten Amte allseitig genügt.
So ging es auch in den nächsten Tagen in unserem Gefangenhause zu, und ich verstand die Weisheit des alten Noah, von jeglicher Thierart nur ein Männlein und ein Weiblein mit in die Arche zu nehmen; denn – achtzig Chamäleons hätte er nicht ernähren können. Der Inhalt einer großen, mit Kohlraupen vollständig angefüllten Schachtel, welche ein Gärtner gespendet, war nach vierundzwanzig Stunden in den hungrigen Magen geborgen; ein Pfund Mehlwürmer hielt kaum eine Woche an, obgleich mit diesem theuren Futter nach Möglichkeit gespart und Alles gethan wurde, um Fliegen herbeizulocken. Unsere Thüringer Bauerstuben kamen mir Tag und Nacht nicht aus den Gedanken, weniger ihrer Besitzer als der Fliegen halber, welche in ihnen während des Sommers die unbestrittene Herrschaft führen und metzenweise gefangen werden. Doch auch die scheinbar Unersättlichen hatten allgemach des Guten genug gethan und nahmen zuletzt ein bescheideneres Wesen und damit eine geregelte Lebensweise an.
Die eine Beobachtung, daß selbst Chamäleons vom Durste geplagt werden und über demselben sogar das Fressen, wenn auch nicht vergessen, so doch verschieben, klärte mich vollständig auf über den bis dahin mir räthselhaften Verbreitungskreis unserer Thiere. Früher hatte ich nicht begreifen können, warum man sie blos an der südlichsten Küste Europa’s, im Süden Andalusiens, und an den Küsten Afrika’s findet, weshalb sie häufig vorkommen in der Wüste bei Alexandrien, aber fehlen in den Wüsten zu beiden Seiten des Nilthals, obgleich hier und dort die Pflanzenwelt annähernd dieselbe, insbesondere eine Art von Thymian, ihr entschiedenes Lieblingsgewächs, hier wie dort gedeiht. Aber nicht an gewisse Pflanzen sind sie gebunden, sondern an Gegenden, in denen es zeitweise regnet oder doch allnächtlich so stark thaut, daß sie die lechzende Zunge wenigstens einmal täglich erfrischen können.
Da, wo sie vorkommen, sind sie nicht selten, fallen jedoch keineswegs so leicht in’s Auge, als man wähnen möchte. Die Uebereinstimmung ihrer Färbung mit dem Blattgrün ihres Wohnstrauches ist ihr bester Schutz und ihr geringer Verstand doch immer erheblich genug, um zu wissen, daß solcher Schutz durch Bewegungslosigkeit noch wesentlich verstärkt wird. „Ein gesehenes Chamäleon ist ein verlorenes Chamäleon“; denn zu einer Abwehr feindlicher Angriffe hat unser Kriechthier keine Waffe. Wohl sperrt es angesichts des sich ihm nahenden Menschen, von dem es sich entdeckt sieht, das Maul auf, giebt sich ein grimmiges Ansehen und versucht selbst zu beißen: aber was hilft das Alles einem hungrigen Raubvogel, einem unternehmenden Raben, Nashornvogel oder Storch gegenüber? Verwundet doch der schwachzähnige Kiefer nicht einmal die zarte Haut des Menschen, geschweige denn die beschilderte Klaue des Raubvogels oder den hornfesten Schnabel der anderen genannten Feinde! Wenn man weiß, wie scharf das Vogelauge sieht, wundert man sich billig, daß noch so viele Chamäleons diesem und einem Grabe im Magen des betreffenden Ausspähers entgehen können. Allerdings gleicht die starke Vermehrung viele Verluste wieder aus: ich habe in einzelnen Weibchen einige zwanzig, in anderen über dreißig entwickelte, legreife Eier gefunden und glaube, daß das Wachsthum der überraschenden Verdauungsfähigkeit dieser Thiere entsprechen wird.
[135] Ungestört, treibt es das Chamäleon im Freien genau eben so wie in Gefangenschaft. Es bewegt sich sehr wenig, ohne Noth kaum oder nicht. Vermittels seiner Klammerfüße und des Wickelschwanzes an einem oder mehreren Zweigen festgeheftet, erwartet es Beute, mit einer Beharrlichkeit und Ausdauer, mit einer Anstandsruhe und Unbeweglichkeit, welche sich jeder Sonntagsjäger zum Muster nehmen kann. Wie ein in Erz gegossenes Bildniß verharrt es, ohne sich zu regen, stundenlang auf einer und derselben Stelle; aber ununterbrochen drehen und wenden sich die großen, bis auf den sehr kleinen Stern mit harten Lidern gedeckten Augen nach allen Seiten, um eine Beute auszukundschaften. Das eine schaut nach vorn und unten, das andere nach hinten und oben; dieses dreht sich rechts, jenes links; beide durchforschen jetzt gemeinschaftlich ein und dasselbe Gesichtsfeld, während im nächsten Augenblicke jedes einzelne wiederum unabhängig von dem anderen seine Bahnen beschreibt. Eine kleine Heuschrecke schwirrt, eine Fliege summt daher und läßt sich auf einem Zweige in der Nähe nieder. Das rollende Auge nimmt sie wahr, das andere vergewissert das Hirn dieser Thatsache. Unbeweglich starren beide nach dem Gegenstande. Er ist nah genug, nicht über fünf Zoll von der Spitze der Schnauze entfernt, könnte aber eben so gut auch sechs bis sieben Zoll weit sitzen, der Zungenpfeil des überaus geschickten Schützen würde ihn doch erreichen. Jetzt öffnet dieser langsam und bedächtig das Maul, so weit, als eben nöthig, die dickkolbige Zungenspitze wird zwischen den Lippen sichtbar, – und heraus schnellt das wunderbare Werkzeug mit einer fast unfehlbaren Sicherheit, buchstäblich pfeilschnell, und ist im nächsten Augenblicke mit der angeleimten Beute wieder in das Maul zurückgezogen worden. Ist der Anstand ergiebig, so wechselt das Chamäleon seinen Standort nicht um eines Haares Breite; fiel die Jagd in der letztvergangenen Zeit ungenügend aus, so versucht es wohl auch, ein Wild zu beschleichen. Letzteres thut es unter allen Umständen, wenn es sich um Hochwild handelt, um eine Raupe z. B., eine Käferlarve und dergleichen, weil es erfahrungsmäßig weiß, daß solches Gethier nicht, wie die Fliege, die Heuschrecke, der Schmetterling, planlos umherschweift, sondern seines einmal unternommenen Weges stetig fortgeht, also verfolgt werden muß. Hierbei entfaltet der raubsüchtige Schütz eine überraschende Behendigkeit, und alle Künste des Kletterns, alle Fähigkeiten der einzelnen Glieder kommen zur Geltung. Nicht allein die Zangenfüße werden unter solchen Umständen beansprucht, sondern auch der Wickelschwanz muß ausgiebige Dienste leisten: gar nicht selten hängt an ihm das Chamäleon sich schwebend auf und dehnt und reckt sich, so lang es kann, um noch einen nach der Tiefe gerichteten Treffer zu gewinnen.
Wahrhaft belustigend wird solche Jagd, wenn sie, in Zeiten des Mangels, nach Anstandswild unternommen wird. Eine langsam dahinkriechende Raupe wird bald eingeholt, eine unruhige Fliege nicht immer so leicht berückt. Da sitzt sie, behaglich sich sonnend, mit einem Vorderbeine sich putzend, außer aller Schußweite auf einem Blatte oder Zweige, ohne sich zu bewegen, ohne Miene zu machen, den Standort zu verändern. Lange Zeit haftet das eine Auge des verderbensinnenden Feindes auf ihr, als könne dieser der Hoffnung nicht entsagen, sie doch noch, ohne Aufwand besonderer Anstrengung, zu erreichen. Sie aber rührt sich nicht von der Stelle und hält vielleicht aus, wenn versucht wird, sie zu beschleichen. Bedächtig setzt der Jäger einen Fuß um den anderen wechselständig vor; langsam rückt er weiter, Zoll um Zoll; scharf heften sich seine Augen auf das ersehnte Ziel; schon öffnen sich die Kiefer – da summt die Fliege davon und das Chamäleon hat das Nachsehen. Ein anderer Räuber würde wahrscheinlich ablassen von aller Verfolgung: unser Thier aber besitzt nicht blos Beharrlichkeit, sondern auch grenzenlose Geduld und läßt es sich nicht verdrießen, wiederholt demselben Wilde nachzugehen, so schwierig, so entmuthigend es auch sein mag, es wiederum aufzufinden, sich ihm wiederum zu nähern und, wiederum betrogen, den Waidgang von Neuem anzutreten.
Wie das Chamäleon eigentlich verfährt, um sich einer Beute zu versichern, habe ich noch immer nicht mit Gewißheit erkunden können. Es sieht aus, als leime es dieselbe an den Zungenkolben an; es will aber auch wiederum scheinen, als ob es diesen wie eine Greifzange zu verwenden wisse. So viel habe ich bestimmt wahrgenommen, daß ein getroffenes Kerbthier fast ausnahmslos verloren ist. Nach den mit Mehlwürmern angefüllten Freßnäpfchen eröffneten unsere gefangenen Chamäleons ein wahres Kreuzfeuer von Schüssen, und niemals zog sich eine Zunge ohne Beute zurück, ja, sehr oft hingen zwei oder drei Mehlwürmer an dem Zungenkolben, ohne daß einer von ihnen beim Einziehen desselben abgestreift worden wäre. Die Sicherheit der Schnellschüsse erregte stets unsere Bewunderung, so gewohnt uns diese Treffgeschicklichkeit der Schützen schließlich auch werden mußte.
Verträgliches Zusammenleben ist unter Kriechthieren die Regel und erklärt sich naturgemäß aus der geringen geistigen Begabung der Mitglieder dieser Classe. Unter mehreren Chamäleons aber giebt es oft genug Uneinigkeit, Streit und Kampf. Ein bequemer Sitzplatz in Schußnähe des Freßnäpfchens kann den Neid eines minder Bevorzugten erregen und zu drohenden Fratzen und wirklichen Angriffen Veranlassung geben; viel ernster jedoch gestaltet sich die Sache, wenn das Gefühl, welches wir Liebe nennen, sich geltend macht. Während der Paarungszeit beißen sich die Männchen, vielleicht auch die Weibchen, ganz wüthend, ohne sich jedoch gegenseitig erheblich zu schädigen.
Bei solchen Streitigkeiten, wie bei jeder Erregung überhaupt, wird der vielbesprochene Farbenwechsel am deutlichsten ersichtlich, weil er schneller vor sich geht als sonst. Von ihm macht man sich gemeiniglich eine falsche Vorstellung, indem man glaubt, daß er ohne eigentliche Veranlassung stattfinde. Dies ist nicht der Fall. Der Wechsel geschieht unverkennbar in Folge eines Nervenreizes, gleichviel, ob dieser von äußeren Einflüssen oder innerer Erregung herrührt. Ueber Färbung und Zeichnung eines sich wohlbefindenden Chamäleons läßt sich im Allgemeinen nur soviel sagen, daß der grüne Grund mit helleren oder dunkleren Längsstreifen und regellosen Flecken von sehr verschiedener Färbung geziert ist und daß diese bald deutlicher, bald undeutlicher hervortreten. Dieses Kleid geht oft allmählich in ein düstergraues über, anscheinend dann, wenn das Thier geistig unthätig ist oder schläft, während es bei besonderer Erregung nach und nach lebhafter wird und allgemach die verschiedensten Schattirungen durchlaufen kann. Jenes grauliche Gelb oder Lederfarb, welches ich bei den verschmachteten Chamäleons beobachtete, deutet stets auf Unbehagen oder Krankheit des Thieres, während sehr lichte Färbung sich wiederum gerade bei der höchsten Erregung, gelegentlich der Paarung, bemerklich macht. Licht und Dunkel, Wärme und Kälte äußern einen entschiedenen Einfluß auf den Wechsel, weil sie das Behagen oder Unbehagen des Thieres hervorrufen. Uebrigens ändert sich die Färbung unter gleichen Umständen keineswegs bei allen Stücken in derselben Weise, so daß man also von einer Regel nicht sprechen darf, eine solche mindestens noch nicht hat feststellen können. Ein vom Kinn längs der Bauchseite verlaufender lichter Streifen und die Innenseite der Beine behalten ihre Färbung unter allen Umständen bei.
In Andalusien hält man Chamäleons als Hausthiere behufs Vertilgung der lästigen Fliegen. So leicht die Thiere dort, in dem heimathlichen Klima, die Freiheit verschmerzen, so schwierig ist es, sie bei uns zu Lande vor den verderblichen Einflüssen des Winters zu schützen. Abgesehen von der Nothwendigkeit, ihnen die erste Bedingung zum Wohlsein, eine gleichmäßige Wärme von mindestens achtzehn Graden, zu gewähren, hat man seine liebe Noth, ihnen zusagendes Futter zu verschaffen. Mehlwürmer sind und bleiben immer nur ein Nothbehelf: ihr Verlangen richtet sich auf fliegende Kerbthiere, unter denen sie Fliegen aller Arten den Vorzug geben.
Der Anfang der späteren Herbsttage ist der Beginn ihres Mißbehagens. Sie hören auf zu fressen, welken und sterben dahin. Dazu kommt, daß viele der gesundesten und kräftigsten Weibchen über dem Eierlegen zu Grunde gehen – ein Beweis, daß ihnen auch sorgsame Pflege die Freiheit mit allen ihren Freuden nicht ersetzen kann. Am besten halten sie sich in Gewächshäusern, deren gleichmäßige feuchte Wärme ihnen selbst eine längere Fastenzeit überstehen hilft; im Zimmer dagegen bringt man sie nur in seltenen Ausnahmefällen durch den bösen Winter. Auch wir haben fast alle verloren und dürfen erst nach Beendigung der für sie bestimmten, auf behagliches Leben der Kriechthiere überhaupt berechneten Wohnräume erwarten, sie vor den Unbilden unseres Winters genügend zu schützen.
[136]Seit alter Zeit sind Schlaf und Traum von Philosophen und Naturforschern mit vorwiegendem Interesse behandelt worden, und es muß daher um so mehr auffallen, daß bis ganz vor Kurzem noch eine der wichtigste Fragen in diesem Thema, die nach der eigenen Ursache des Schlafes und dem Grunde seiner periodischen Wiederkehr, nur sehr unvollkommen beantwortet werden konnte. Erst vor zwei Jahren ist es dem Münchener Professor Pettenkofer (demselben, der sich durch Erforschung der Ursachen der Cholera auch in weiteren Kreisen einen Namen erworben hat) bei Gelegenheit seiner Versuche über den Gasaustausch im menschlichen Organismus gelungen, unsere Frage völlig befriedigend zu lösen.
Es ist schon lange bekannt, daß der durch die Athmung aufgenommene Sauerstoff für den Stoffwechsel unseres Organismus eine sehr hervorragende Rolle spielt, in der Art, daß durch seine Verbindung mit den Bestandtheilen unseres Körpers die Lebenskräfte in demselben erzeugt werden. Zu jedem kleinsten Lebensvorgange, den wir leisten, wird ein gewisses Quantum an Sauerstoff verbraucht. Er ist gewissermaßen die Dampfkraft, die unsere Lebensmaschine treibt. Die Menge des verbrauchten Sauerstoffes können wir messen durch die Quantität der durch seine Einwirkung erzeugten und ausgeathmeten Kohlesäure. Derartige Messungen hat nun Pettenkoser in Gemeinschaft mit Voit in einem besonders dazu construirten großen Apparate angestellt und dabei die unerwartete Thatsache entdeckt: „daß wir im Laufe des Tages selbst bei geringer Arbeitsanstrengung verhältnißmäßig viel mehr Kohlensäure ausscheiden, also mit anderen Worten viel mehr Sauerstoff verbrauchen, als wir in derselben Zeit aufnehmen.“
Natürlich knüpfte sich an diese auffallende Thatsache sofort die wichtige Frage: „Aus welchen Mitteln wird dieses im Laufe jedes Tages entstehende Sauerstoff-Deficit gedeckt?“ – Auch hierüber geben Pettenkofer’s Versuche vollständigen Aufschluß: der Schlaf ist der kluge Finanzminister, der allnächtlich durch weise Sparsamkeit das Sauerstoff-Deficit jedes Tages wieder ausgleicht. Denn im Schlafe verbrauchen wir nicht allein nur halb soviel Sauerstoff wie am Tage, sondern wir nehmen auch davon fast doppelt so viel auf als im wachen Zustande.
Während des Schlafes findet also im Organismus eine Aufspeicherung von Sauerstoff statt zu einem Vorrath, mit dem wir dem Deficit des nächsten Tages getrost entgegensehen können. Ist diese Einrichtung nicht wahrhaft bewunderungswürdig? Wie mancher Staat könnte sich glücklich preisen, wenn sein Finanzminister solche Wirthschaft verstünde! Ja, wir sehen es auch hier wiederum: die Natur ist in allen Dingen die beste Lehrmeisterin, und wollen uns denn einmal vom Schlafe einen Vortrag über National-Oekonomie halten lassen!
Schon vorher stellten wir beiläufig den Satz auf, daß wir zu jedem auch noch so kleinen Lebensvorgange unseres Organismus eine gewisse Quantität Sauerstoff verbrauchen. Jede Bewegung, jede Empfindung, selbst jeder Gedanke ist ein solcher Lebensvorgang. Wenn wir also einem Freunde die Hand reichen, wenn wir unsern Blick zärtlich auf Jemand richten, wenn wir lebhaft an Jemand denken, – ja, und wenn gar unser Herz dabei anfängt, schneller zu schlagen, so erleiden wir dabei immer einen bestimmten Verlust an Sauerstoff, der eine gewisse Quantität unserer Körpermasse verzehrt und in Kohlensäure umsetzt. Diese Auffassung klingt entsetzlich materiell; dennoch ist sie vollständig richtig, wenigstens giebt die Oekonomie unseres Körpers hierfür den beste Beweis. Der Körper hat während des Schlafes die Aufgabe, Sauerstoff zu sparen, und diese Aufgabe erfüllt er nun, wie ein rechtschaffener Hausvater, in der Weise, daß er alle unnützen, alle Luxus-Ausgaben vermeidet und sich nur auf das zu seinem Unterhalt Allernothwendigste beschränkt.
Welches sind aber die Luxus-Ausgaben unseres Organismus? Vor allen Dingen müssen wir dazu das ganze Gebiet der Sinnesthätigkeiten rechnen, da dieselben zur Erhaltung des Lebens nicht unumgänglich nothwendig sind. Es kann also im Schlafe getrost der für das Sehen angesetzte Ausgabe-Etat gestrichen werden. Zuerst versagen die Augenmuskeln ihren Dienst. Eine eigenthümliche Empfindung von Druck und Schwere im oberen Augenlide kündigt uns die sich vorbereitende Erschlaffung des Lidhebers an, und die Unmöglichkeit, einen Gegenstand fest in’s Auge zu fassen, den Blick zu fixiren, verräth uns, daß die Muskeln, welche die Convergenz der Sehachsen veranlassen, ihre Schuldigkeit nicht mehr thun können. Unser Blick starrt deshalb in’s Blaue. Mit dem Zufallen der Augenlider hört endlich jede Erregung der Netzhaut auf, und auch der Augennerv kommt zur Ruhe.
Das nächste Organ, welches während des Einschlafens seine Thätigkeit einstellt, sind die Ohren. Dieselben besitzen keinen Verschlußapparat wie die Augen; ihnen wird deshalb auch das Einschlafen nicht so leicht gemacht. Hier muß sich gewissermaßen der Schlaf sein Recht erst erkämpfen. Am besten kann man darüber an sich selbst Studien machen, wenn man das Unglück (oder soll ich sagen das Glück) hat, bei einem langweiligen Vortrage oder einer Predigt einzuschlafen. Nachdem wir allmählich den Faden des Zusammenhanges verloren haben und auch unsere Augen schon die wohlverdiente Ruhe genießen, hören wir noch immer die Worte an unser Ohr schallen. Wir sind aber nicht mehr im Stande, dieselben richtig zu fassen und zu verstehen. Sie werden immer verworrener und lösen sich schließlich in ein dumpfes, unarticulirtes Gemurmel auf, das scheinbar immer weiter – immer weiter sich von uns entfernt und schließlich ganz für uns verschwindet.
Während dessen fängt auch das Hautgefühl an, seinen Dienst aufzukündigen. Vergebens bemüht sich unser freundlicher Nachbar, uns durch leises Anstoßen, Treten auf den Fuß etc. vor der ärgerlichen Scene des Einschlafens zu bewahren. Es ist umsonst! Unser Gefühl ist, wenn auch nicht ganz geschwunden so doch derart erheblich herabgesetzt, daß es nur auf stärkere Reize regelrecht reagirt. Auch Geruch und Geschmack hören auf, thätig zu sein – und so sind wir denn aller unserer fünf Sinne so ziemlich bar.
Endlich erschlaffen auch die willkürlichen Muskeln. Wenn wir liegend im bequemen Bette einschlafen, kommt uns das nicht völlig zum Bewußtsein. Die besten Studien machen wir auch hierüber während eines langweiligen Vortrages, bei dem wir sitzend einschlafen müssen. Wer hat sich da nicht schon über seine impertinenten Nackenmuskeln geärgert, die plötzlich ihren Dienst versagen und den Kopf durchaus nicht mehr aufrecht tragen wollen. So lange noch der Kampf zwischen Schlafen und Wachen geführt wird, entsteht dadurch das für den boshaften Zuschauer so höchst ergötzliche und verrätherische Nicken des Kopfes. Daher das sogenannte „Einnicken“.
Somit hat nun unser Körper als sparsamer Hausvater seine Schuldigkeit gethan und den Etat für Vergnügungs- und Luxus-Ausgaben vollständig gestrichen. Aber damit noch nicht genug, setzt er auch noch den Etat für Ernährung der Körpergewebe und für Stoffwechsel erheblich herab. Das Herz vermindert seine Bewegung in der Minute um drei bis zehn Schläge, das Blut kommt also seltener mit den Körpergeweben in Berührung und giebt daher auch weniger Sauerstoff an dieselben ab. Dadurch wird natürlich die Function sämmtlicher Körperorgane zum Theil nicht unerheblich beschränkt; vor allen Dingen leidet darunter ein sehr wichtiges Organ, das Gehirn. Und darüber müssen wir ausführlicher sprechen.
Das Gehirn ist dasjenige Organ, in dem sich unsere geistigen Functionen vollziehen. Gleichviel, ob wir der materialistischen oder der spiritualistischen Anschauung huldigen, immer müssen wir den Satz festhalten, daß alle Seelen- und Geistesthätigkeit unveräußerlich an das Gehirn geknüpft ist. Das Gehirn ist gewissermaßen das Instrument, durch welches unsere Seele ihre Thätigkeit äußert. Und wie selbst der fertigste Spieler auf einem unvollkommenen musikalischen Instrumente nur unvollkommene musikalische Productionen [137] liefern kann, so ist auch die Leistungsfähigkeit unseres Geistes direct abhängig von der Beschaffenheit des Gehirns. Ist, wie beim Schlafe, die Ernährung des Gehirns durch seltenere Blutzufuhr wesentlich herabgesetzt, sind ferner, wie Durham’s Untersuchungen an schlafenden Thieren, denen er vorher das Schädeldach theilweise geöffnet hatte, zeigten, die arteriellen, d. h. sauerstoffzuführenden Blutgefäße verengert und schwächer gefüllt als im Wachen, so kann auch die Leistungsfähigkeit des Gehirns nur eine viel geringere sein. Die Geistesthätigkeit wird auf ein Minimum reducirt und besonders alle complicirteren Vorgänge innerhalb derselben – so vor allen Dingen die Thätigkeit des Verstandes – müssen vollständig pausiren. Wohl spinnen sich auch im Schlaf unsere Gedanken und Vorstellungen nach ganz denselben unzerstörbaren Gesetzen ab, wie im Wachen, doch entbehren sie der regulirenden und Ausschreitungen verhütenden Leitung der Kritik und des Verstandes. Diese beschränkte Thätigkeit des Gehirns nennen wir „Träumen“.
Der Traum ist also nicht etwa ein wirres, dunkles und unverständliches „Etwas“, von dem wir nicht wissen, woher es stammt, sondern es ist ein Product derselben Gehirnfunction, die auch im wachen Zustande thätig ist.
Unser Traumdenken beruht ebenso wie das Denken im wachen Zustande auf den Gesetzen der sogenannten Ideenassociation, vermöge deren jede Vorstellung gleich während ihres Entstehens eine Reihe anderer durch Aehnlichkeit der Gegenstände, Gleichlaut der Worte, Gleichzeitigkeit des Geschehens oder dergleichen verwandte Vorstellungen und Bilder hervorruft. Und so kommen wir denn, wenn wir uns wachend der Ideenassociation überlassen, ohne willkürlich in dieselbe einzugreifen, beispielsweise von einem Schuß, den wir hören, auf den Gedanken an eine Jagd, und dabei fällt uns die Zeitungsnachricht ein, daß der König von Preußen zur Jagd nach Aulosen gegangen sei. Durch den Gleichklang der Worte werden wir dann bestimmt, an den bekannten Physiker Namens König zu denken etc.
Im wachen Zustande übt unsere Kritik immer doch einen gewissen beschränkenden Einfluß auf das Spiel unserer Phantasie aus und verhütet, daß wir allzu Ungewöhnliches mit einander verbinden. Im Traum dagegen herrscht die Ideenassociation in ungebundenster Weise. Während wir im Wachen die einzelnen Vorstellungen nach einander ablaufen lassen, kommen sie im Traum oft gleichzeitig zum Bewußtsein und verknüpfen sich untereinander zu einem Ganzen. Oder auch, es wird bei der Schnelligkeit und Unklarheit der Ideenverbindung unvermerkt eine Vorstellung an Stelle der anderen geschoben, und wir sehen dann etwa in dem oben angeführten Beispiel nicht den König von Preußen, sondern den Physiker König auf der Jagd. Gerade dadurch entstehen die wunderbarsten Traumcombinationen, deren eigentlichen Ursprung zu entdecken nur selten gelingt.
Im wachen Zustande können wir, wie ich schon sagte, Vorstellungen in uns durch freie Willkür hervorrufen. Wir können denken, woran wir wollen. Doch geschieht dies nicht immer. Sehr oft fällt uns ohne unser Zuthun – wie man sagt, zufällig – aus dem Schatze unserer Erinnerungen irgend ein Gegenstand ein, über den wir entweder weiter willkürlich nachdenken, oder von dem wir unwillkürlich durch Ideenassociation auf einen anderen geleitet werden. Auch im Traum, wo eine willkürliche Hervorrufung bestimmter Vorstellungen nicht möglich ist, werden unsere Gedanken durch Erinnerungsvorstellungen unwillkürlich angeregt. Meist sind es irgendwie markirte und frappante Eindrücke, die wir im Laufe des Tages gehabt haben, oder Gedanken, die uns kurz vor dem Einschlafen beschäftigten, die den ersten Anstoß zu einer Reihe von Traumbildern geben. Oft werden derartige Vorstellungen im Traum weitläufig ausgesponnen; oft aber leitet uns die Ideenassociation schnell auf andere Vorstellungen über, und wir können dann den Zusammenhang zwischen den Tages- und Traumgedanken später nicht mehr nachweisen.
Bei Weitem am häufigsten geben aber im wachen Zustande Sinneseindrücke den ersten Anstoß zu einer bestimmten Gedankenreihe. Im Schlafe haben nun zwar, wie wir sehen, unsere Sinne ihre Functionen eingestellt, trotzdem aber sind sie doch noch in einem gewissen Grade erregungsfähig. Besonders Gehör und Gefühl sind selbst in tieferem Schlafe noch fähig, auf stärkere Eindrücke zu reagiren. Fast immer aber ist das von dem Eindruck gewonnene Bild nur ein unklares und verwischtes, das sich deshalb auch oft zu ganz anderen Vorstellungen gestaltet, so wie wir etwa im Halbdunkel einen Baumstamm für einen am Wege sitzenden Menschen halten. Die Undeutlichkeit des Sinneseindrucks überläßt es dem Spiele der Phantasie, denselben auszumalen, und so kommt es, daß eine im Schlafe erfolgende Erregung des Gefühls oder Gehörs zu einem Traumbilde Veranlassung giebt, das den Sinneseindruck nur in seinen allgemeinsten Umrissen als Grundlage für das Traumgebäude verwerthet. Es werden in der Literatur viele Beispiele der Art angeführt. Meyer (Versuch einer Erklärung des Nachtwandelns) erzählt, ihm habe einmal geträumt, er sei von Räubern überfallen worden, welche ihn der Länge nach auf den Rücken zur Erde legten und zwischen seiner großen und der nächsten Zehe einen Pfahl in die Erde schlugen. Beim Erwachen fand er einen Strohhalm zwischen den genannten Zehen!
Ein Anderer berichtet, er habe einmal beim Zubettegehen eine heiße Wärmflasche an die Füße gelegt und darauf geträumt, er reise auf die Spitze des Aetna und wandere dort auf glühender Lava herum. In ähnlicher Weise träumt uns oft, wenn wir beim unruhigen Schlafen die Bettdecke abgeworfen haben, wir gingen bei strenger Winterkälte halb angekleidet durch die Straßen. Auf dieselbe Weise giebt endlich ein draußen wehender Wind den Anlaß zu einem Traume von großem Seesturm und Untergang eines Schiffes. Oder ein an unserer Thür gehörtes Klopfen ruft einen Traum vom Einbruch einer Diebsbande hervor etc. Sehr selten ist es, daß wirklich gesprochene Worte im Schlafe deutlich vernommen werden und als Worte auch im Träumenden die entsprechenden Vorstellungen erregen. Es werden einige Beispiele erzählt, wie man auf solche Weise die Träume eines Schlafenden gewissermaßen leiten konnte. Dr. Abercrombie erzählt zum Beispiel: „Einem englischen Officier von der Expedition nach Ludwigsburg im Jahre 1758 konnten seine Cameraden zu ihrer großen Belustigung jegliche Art von Träumen durch Worte erzeugen, die sie ihm in’s Ohr lispelten.“ Ein anderes Beispiel erzählt Kluge: „Ein verschmähter Liebhaber, der jedoch die Gunst der Mutter besaß, erhielt von dieser die Erlaubniß, seiner Angebeten im Schlafe seinen Namen in’s Ohr flüstern zu dürfen, was ihm eine kluge Frau gerathen hatte. Bald zeigte sich eine merkwürdige Umstimmung bei dem Mädchen, sie wurde ihm gewogen und gab ihm endlich die Hand. Um ihre plötzliche Sinnesänderung befragt, gab sie zur Antwort, sie habe ihren Mann in lebhaften, oft wiederholten Träumen liebgewonnen.“ Ich bemerke dazu, daß ich die Wahrheit dieser Geschichte zwar nicht verbürgen, aber doch auch die Möglichkeit derselben nicht gänzlich in Abrede stellen kann. Und wer Lust hat, mag dies Mittel immerhin als letzten Versuch in Anwendung ziehen, um das Herz seiner Angebeteten zu erobern.
Fast noch häufiger als die Wahrnehmung der äußeren Sinne giebt die Erregung des inneren Gefühlssinnes Anlaß zu Träumen. Unter innerem Gefühlssinn verstehe ich diejenige Gefühlsaction, die uns über den Zustand unserer gesammten Körperorgane unterrichtet und die in ihrer Summe auch mit dem Namen Gemeingefühl benannt wird. Es gehören hierher die Begriffe des Wohl- und Unwohlseins. Bei völligem Wohlbefinden empfinden wir von den Verrichtungen unserer einzelnen Organe nichts. Wir fühlen es gar nicht, daß wir einen Magen, ein Herz, Muskeln etc. haben. Sobald aber in diesen Organen irgend eine Functionsstörung eintritt, werden wir (abgesehen von dem bisweilen gleichzeitig vorhandenen Schmerz) noch durch ein gewisses unbestimmtes Gefühl des Unbehagens davon in Kenntniß gesetzt.
Auch im Schlafe nehmen wir diese Empfindungen wahr, natürlich aber auch nur dunkel und unklar, und es knüpfen sich daran in gleicher Weise, wie an die Sinneseindrücke, bestimmte symbolisirende Traumvorstellungen. Am bekanntesten ist die hierher gehörige Erscheinung des sogenannten Alpdrückens. Dasselbe entsteht in Folge eines krampfhaften Zustandes der Respirationsmuskeln und einer daraus entspringenden Athembeklemmung. Auch ein übermäßig voller Magen, der das Zwerchfell heraufdrängt und dadurch die Lungen beengt, kann ähnliche Erscheinungen hervorrufen. Während wir im wachen Zustande derartige Athmungsbeschwerden ohne Weiteres auf den richtigen Grund, das heißt auf eine örtliche Affection der Brustorgane, zurückführen, sind wir im Traume solcher Ueberlegung nicht fähig, sondern es entsteht vielmehr ganz entsprechend den Gesetzen der Ideenassociation bei dem Gefühl der Beklemmung der Gedanke eines Druckes und das Bild eines drückenden Gegenstandes. Wir träumen also, ein schwerbeladener [138] Wagen ginge über uns hinweg, oder eine schwarze gespenstige Gestalt, ein wüster Kobold löse sich von der Zimmerdecke ab und senke sich uns langsam auf die Brust. Häufig wird auch an Stelle dessen eine große Angst oder ein plötzlicher Schreck vom Traume fingirt, weil uns derartige Alterationen ebenfalls den Athem zu versetzen pflegen. Wir träumen dann zum Beispiel, wir würden von Räubern angegriffen und wollten uns durch Entfliehen retten, allein die Füße versagen uns den Dienst – wir bleiben wie angewurzelt an dem Boden fest haften. Wir wollen, von größter Angst gefoltert, um Hülfe rufen, aber wir können zu unserem Entsetzen keinen Laut hervorbringen – bis dann endlich nach langer vergeblicher Anstrengung sich der bestehende Krampf der Athmungsmuskeln löst und wir oft mit einem Schrei erwachen.
In ähnlicher Weise erklärt sich der wohl Jedem bekannte Traum des Herabfallens aus großer Höhe. Er kommt hauptsächlich während des Einschlafens vor und beruht darauf, daß die beim Einschlafen allmählich erschlaffenden Muskeln durch einen momentan entstandenen Reiz sich plötzlich wieder zusammenziehen und in Folge dessen ein Zusammenrucken des Körpers veranlassen, wie solches etwa bei einem Falle aus großer Höhe vorkommt. Etwas verschieden davon ist der ebenfalls häufige Traum des Fliegens. Er beruht nach Scherner auf einem zum Bewußtsein kommenden Gefühle unserer Lungenthätigkeit. Das Auf- und Niederbewegen der Lungenflügel beim Athmen soll die genannte Empfindung erzeugen. So giebt es noch eine große Reihe von körperlichen Zuständen, die, wenn sie im Schlafe uns halb zum Bewußtsein kommen, nach den Gesetzen der Ideenassociation ganz bestimmte Traumvorstellungen in uns erwecken. Auch den Gemüthsbewegungen schreibt man einen bestimmenden Eindruck auf die Art unserer Träume zu. „Große Freude erzeugt andere Träume als schweres Leiden, leidenschaftliche Liebe andere als Haß, heftige Reue und Gewissensbisse.“
Wenn man sich daran gewöhnt, auf seine Träume aufmerksam zu achten, so findet man leicht die Bestätigung der eben ausgesprochenen Gesetze. Man wird dabei aber auch bemerken, daß es äußerst schwierig ist, einen Traum richtig und unverfälscht im Gedächtniß zu reproduciren. Das hat seinen doppelten Grund. Endlich sind die Traumbilder in den bei Weitem häufigsten Fällen so unklar und blaß und in ihren Einzelheiten so unbestimmt, daß wir unwillkürlich bei dem Bestreben, sie in unser Gedächtniß zurückzurufen, den Farbenkasten unserer wachen Vorstellungskraft zu Hülfe nehmen und damit den Bildern bestimmtere Färbung und Umrisse geben. Der zweite Grund beruht in dem dem menschlichen Geist innewohnenden Bestreben, Alles im logischen Zusammenhange zu erblicken. Da nun unsere Träume aus einer Reihe von Bildern bestehen, die nur durch das oft sehr lockere Bindemittel der Ideenassociation zusammenhängen, so bringen wir bei der Reproduction derselben im wachen Zustande meist ganz unwillkürlich erst einen logischen und dem realen Leben entsprechenden Zusammenhang hinein, der ursprünglich gar nicht darin war.
Während der Zeit des tiefsten Schlafes ist die Function des Gehirns eine so schwache, daß wir davon gar keine Erinnerung behalten und deshalb den festen Schlaf einen traumlosen nennen. Zuweilen wissen wir wohl, daß wir geträumt haben, aber wir können uns trotz aller Anstrengung auch nicht die Spur des gehabten Traumes in’s Gedächtniß zurückrufen. Erst kurz vor dem Erwachen, wo der in den Blutkörperchen aufgespeicherte Sauerstoff wieder anfängt, den Stoffwechsel im Gehirn energischer in Gang zu bringen, werden die Träume lebhafter und zusammenhängender und haften deshalb auch leichter im Gedächtniß. Sehr selten sind die Fälle, in denen die Lebhaftigkeit des Traumes eine so große ist, daß wir ihn nach dem Erwachen von wirklich Erlebtem nicht zu unterscheiden vermögen. Einer unserer berühmtesten, noch lebenden Irrenärzte, Professor Jessen in Hornheim bei Kiel, erzählt mit folgenden Worten ein dazugehöriges Beispiel:
„An einem Wintermorgen zwischen fünf und sechs Uhr wurde ich, wie ich glaubte, durch den Oberwärter geweckt, welcher mir meldete, daß Leute da seien, um einen Kranken abzuholen, indem er zugleich vorfragte, ob dabei etwas zu erinnern sei. Ich antwortete, daß er den Kranken nur abreisen lassen könne, und legte mich nach seinem Weggehen wieder zurecht, um fortzuschlafen. Mit einem Male fiel mir aber ein, daß ich von der Abholung dieses Kranken vorher gar nichts erfahren, sondern daß mir die bevorstehende Abholung einer Frau desselben Namens angezeigt worden sei. Ich war also genöthigt, mich nach den Umständen näher zu erkundigen, zündete ein Licht an, stand auf, kleidete mich an und ging nach der Wohnung des Oberwärters. Diesen fand ich zu meinem Erstaunen erst halb angekleidet, und auf meine Frage, wo die Leute seien, die den Kranken holen wollten, antwortete er mit verwunderter Miene: ‚er wisse davon nichts, er komme eben erst aus dem Bette, und bei ihm sei Niemand gewesen.‘ Diese Antwort brachte mich nicht zur Besinnung, sondern ich erwiderte, dann müsse der Oekonom bei mir gewesen sein und ich wolle zu ihm gehen, um Erkundigungen einzuziehen. Als ich in der Mitte des Corridors, welcher zu der Wohnung des Oekonomen führte, einige Stufen hinabstieg, fiel mir mit einem Male ein, daß ich die Sache nur geträumt, an deren Wirklichkeit ich bis zu demselben Augenblick nicht im Mindesten gezweifelt hatte.“
Dieses Beispiel ist besonders dadurch auffällig, daß längere Zeit nach dem Erwachen, nachdem der Träumende sich durch das Ankleiden und den Gang zum Oberwärter doch vollständig ermuntert hatte, doch noch die Täuschung, welche das Traumbild für Wirklichkeit hielt, andauerte und dann plötzlich ohne besondere Veranlassung verschwand.
Verhältnißmäßig häufiger sind die Fälle, wo das Erwachen kein vollständiges ist, aber doch hinreicht, um auf das für Wirklichkeit genommene Traumbild in entsprechender Weise zu reagiren. Es werden Beispiele erzählt, wo Leute im halbwachen Zustande, durch ein erschreckendes Traumbild getäuscht, Gewaltthätigkeiten verübt haben, für die sie natürlich nicht verantwortlich waren.
Ein interessantes Beispiel von einem während der Schlaftrunkenheit begangenen Vergehen gegen die Subordination theilt Büchner in Henke’s Zeitschrift für gerichtliche Medicin mit.
„Christian Jünger, Gardist, zweiundzwanzig Jahr alt, seit drei Jahren Soldat, von der besten Aufführung und stillem ruhigen Charakter, schlief auf einer Pritsche in der Wachtstube, Mittags vor zwölf Uhr, als der Corporal ihn zu erwecken versuchte, um ihn die Stube kehren zu lassen. Jünger erhob sich, packte den Corporal, ohne etwas zu sprechen, an der Brust, zog seinen Säbel und hieb auf ihn ein, doch gelang es diesem, mit dem seinigen den Hieb zu pariren. Da Jünger fortfuhr um sich zu hauen, wurde er von den anwesenden Soldaten entwaffnet und arretirt. Er setzte sich lautlos und ruhig auf die Pritsche. Jünger hatte am vorausgehenden Tage und am Morgen der That bei kalter Witterung Posten gestanden, die Nacht durch Karten gespielt, nur wenig getrunken und war Morgens vor Müdigkeit in der heißen Wachtstube eingeschlafen. Bei der Untersuchung ergab sich, daß er geträumt hatte, er stehe auf Posten, ein Kerl packe ihn am Haar und nehme ihm sein Gewehr, worauf er seinen Säbel gezogen und auf ihn eingehauen habe. Von dem, was wirklich passirt war, wußte er nichts. Er konnte nicht begreifen, daß er, der auf Subordination so streng hielt, so etwas gegen seinen Vorgesetzten sich habe zu Schulden kommen lassen. Das ärztliche Gutachten nahm einen Zustand der Schlaftrunkenheit an, worauf die Freisprechung erfolgte.“
Zur Erklärung derartiger Fälle ließe sich etwa Folgendes sagen. Durch Strapazen irgend welcher Art, wie hier durch Postenstehen und darauf folgende Uebermüdung, ist der Sauerstoffmangel des Organismus bis zu einer abnormen Höhe gekommen und das in dem kurzen Schlafe aufgenommene Quantum reicht noch nicht hin, um das Gehirn zu seiner vollen Thätigkeit zu vermögen. Der überschüssige Sauerstoff wird zu der weniger verbrauchenden, gewissermaßen niedrigeren Thätigkeit des Willenimpulses gebraucht, so daß die freie Ueberlegung und das willkürliche Denken noch nicht erwachen können. Wir sehen das ja auch oft bestätigt, wenn wir Jemand aus tiefem Schlafe zu erwecken suchen. Noch ehe wir ihn völlig zum Bewußtsein kommen sehen, wirft er sich im Bett umher, streckt die Arme und Glieder etc., bis endlich das freie Denken wieder die Herrschaft über das Gehirn gewinnt und somit das volle Bewußtsein zurückkehrt.
Aber auch die umgekehrte Erscheinung sehen wir bisweilen auftreten, indem wir, wie schon Aristoteles bemerkt, manchmal im Stande sind, während des Schlafes den Traum als Traum anzuerkennen. Eine interessante Selbstbeobachtung der Art theilt der Engländer Beattie in folgenden Worten mit: „Mir träumte einst, daß ich auf der Brustwehr einer sehr hohen Brücke umherginge. Weshalb ich dahin gekommen, [139] konnte ich nicht einsehen, da ich aber erwog, daß ich nie zu solchen Handlungen geneigt gewesen, so fing ich an zu denken, daß ich vielleicht nur träume. Da ich nun von dieser beunruhigenden und quälenden Vorstellung befreit zu werden wünschte, stürzte ich mich hinab, in der Erwartung, durch diesen Fall meine Sinne wieder zu erlangen, was auch geschah.“ Bei diesem Beispiel ging der Traum dem Erwachen kurz vorher; es hatte also offenbar die Sauerstoffaufspeicherung schon eine solche Höhe erreicht, daß die Organe der freien Denkthätigkeit in beschränkter Weise functioniren konnten, während aber doch theilweise noch die traumhafte Ideenassociation fortdauerte.
Ganz dasselbe findet bei der gewiß Jedem bekannten Erscheinung statt, wo wir kurz vor dem völligen Erwachen einen angenehmen Traum aus freier Willkür fortzuspinnen suchen. Auch hier ist unser Denkorgan schon völlig functionsfähig, wir sind aber noch im Stande, es eine kurze Zeit lang auszuschalten und die im wirklichen Traume begonnene phantastische Ideenassociation weiter wirken zu lassen. Hat aber einmal erst die freie Denkthätigkeit in dies Spiel der Phantasie willkürlich eingegriffen, dann ist’s auch mit dem Traume vorbei und wir sind unwiderruflich erwacht.
Das Erwachen tritt ein, erstlich, wenn die Sauerstoffaufspeicherung ihren höchsten Grad erreicht hat und der Stoffwechsel dadurch wieder in vollen Gang kommt. Aber auch vorher ist ein Erwachen, wie ja allbekannt, durch äußere Einwirkungen möglich. Starke Reize, die unsere Nerven entweder des Gehörs, des Gefühls oder auch des Gesichts treffen, versetzen durch Fortpflanzung der Erregung das Gehirn in einen Reizungszustand, welcher ein stärkeres Zuströmen von Blut und in Folge dessen eine Vermehrung des Stoffwechsels im Gehirn bewirkt, die nach Erreichung eines gewissen Grades das völlige Erwachen zu Stande bringt. Der Schlaf erfordert, wie schon oben angedeutet, eine nur geringe Füllung der arteriellen Blutgefäße. Alles, was eine stärkere Blutzuströmung zu dem Gehirn zur Folge hat, stört den Schlaf und verhindert auch das Einschlafen. Daher verscheuchen alle Leidenschaften und Gemüthsbewegungen, vieles Nachdenken, körperliche und geistige Aufregungen und überhaupt alle Mittel, die das Blut nach dem Kopfe treiben (uns einen heißen Kopf machen), den Schlaf, während umgekehrt Alles, was das Blut aus dem Gehirn treibt oder die Blutgefäße in demselben verengert, Schlaf hervorbringt. So wirken kalte Umschläge auf die Stirn in dieser Beziehung günstig: denn die Kälte verursacht eine Zusammenziehung der Blutgefäße.
Ebenso muß man sich auch die Wirkungskreise der sogenannten schlafmachenden Arzneimittel, d. h. besonders des Opiums und seiner Alkaloide (unter denen das Morphium und Narcein den ersten Rang einnehmen), denken. Durch Experimente ist man mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Schluß gekommen, daß das Opium eine zusammenziehende Wirkung auf die Gehirngefäße äußert, also das Blut aus dem Gehirn heraustreibt. Durch alle dergleichen Mittel kann man aber nur bewirken, daß weniger Sauerstoff im Gehirn verbraucht wird, nicht aber, daß auch gleichzeitig mehr Sauerstoff aufgenommmen und ist den Blutkörperchen aufgespeichert wird. Indeß gerade in den Zuständen, wo man seine Zuflucht zu jenen Schlafmitteln nehmen muß, ist, wie Pettenkofer’s Versuche für einzelne Krankheiten festgestellt haben, die Fähigkeit der Blutkörperchen, Sauerstoff in sich aufzuspeichern, verringert. Und daher kommt es, daß ein durch Opiate erzielter Schlaf unter den genannten Bedingungen nie so erquickend und kräftigend ist. Unter gewöhnlichen gesunden Verhältnissen reicht aber schon die Abhaltung der oben genannten Schädlichkeiten hin, um den Schlaf herbeizuführen. Und zwar spielt dabei die Gewohnheit eine große Rolle. Wir warten für gewöhnlich nicht die äußerste Sauerstofferschöpfung des Organismus ab, sondern verfallen schon früher, dann, wenn dieselbe eine gewisse, durch Gewohnheit bestimmte Grenze erreicht hat, in Schlaf. Darum sind wir auch fähig, jeden Augenblick aus dem Schlafe erweckt zu werden. Es ist immer noch ein Reservefond von Sauerstoff da, der dann das Erwachen ermöglicht. In den Fällen, wo durch Ueberwachung der Sauerstoffmangel bis zu seiner äußersten Grenze gesteigert ist, wird der Schlaf ein so tiefer, daß wir erst nach einer gewissen Zeit aus demselben wieder erweckt werden können.
Die Abhaltung der Schädlichkeiten, die den Schlaf verhindern, liegt nicht immer in unserer Macht, da wir vor allen Dingen nur selten vollständig Herr unserer Aufregungen und Gemüthsbewegungen werden können. Es gehört dazu entweder eine gute Portion Phlegma oder auch ein ungewöhnlich starker Wille und enorme Selbstbeherrschung. So erzählt man besonders von Napoleon dem Ersten, daß er zu jeder Zeit schlafen konnte, wenn er wollte, selbst sogar während der Schlacht bei Leipzig. Er hatte also die Gabe, nicht nur seine Gefühle stets niederzukämpfen, sondern auch nach freiem Belieben mit Denken aufzuhören. Daß gerade auch das Letztere nicht so leicht ist, davon wird sich wohl jeder einmal überzeugt haben. Wenn uns ein Gedanke, ein Plan lebhaft beschäftigt, können wir nicht einschlafen, wir müssen dann unsere Gedanken abzulenken suchen, wir müssen an Dinge denken, die in keiner Weise unser Interesse erregen, wobei also unser Denken kein intensives und mithin der Stoffwechsel im Gehirn kein lebhafter sein kann. Mit einem Worte, wir müsten versuchen, uns zu langweilen. Es werden dazu die verschiedensten künstlichen Mittel angewendet. Da es aber nicht in meiner Absicht liegt, die Zahl derselben mit diesem Aufsatze zu vermehren, will ich hiermit abschließen in der Hoffnung, bei dem geneigten Leser einiges Interesse und Verständniß für die Erscheinungen des Schlaf- und Traumlebens erweckt zu haben.
„Die neue Höhle an der Grüne bei Iserlohn müssen Sie sehen,“ sagte unser alter Freund, Professor Fuhlrott in Elberfeld, als wir in traulichem Gespäche mit ihm seine neu erworbenen Schätze musterten, denn die schon früher in seinem Besitz befindlichen, worunter der berühmte Schädel des wilden Urmenschen aus der Grotte des Neanderthals, waren uns schon seit früherer Zeit bekannt. „Sie wissen, wie reich unsere Gegend an Höhlen, Grotten und Spalten ist und welche Schätze schon daraus zu Tage gefördert worden sind – aber diese neue Höhle übertrifft an Schönheit der Tropfsteingebilde, an Zahl der Kammern und gewölbten Säle Alles, was bis jetzt noch entdeckt wurde, und darf sich in dieser Beziehung den bekanntesten und besuchtesten kühn an die Seite stellen. Die wunderbaren Formen der Tropfsteine, in welchen sogar eine kalte Phantasie alle erdenklichen Formen von Orgeln, Säulen, Sarkophagen, Vorhängen, und was weiß ich noch Alles finden kann, verdienen allein eine Reise dorthin und ich bin überzeugt, daß diese Höhle mit ihren ineinandergeschlungenen Gängen, Nischen und gewölbten Prachträumen bald ebenso ein Ziel der Touristen werden wird, wie die Adelsberger Grotten in Krain oder die Höhlen am Harz – um so mehr als ihre Befahrung durch die bergisch-märkische Eisenbahngesellschaft, der sie als Eigenthum angehört, durchaus gefahrlos gemacht worden ist und nirgends jene unangenehme Feuchtigkeit des Bodens oder jenes durchtropfende Wassergerinnsel sich zeigt, das den Besuch anderer Höhlen oft so lästig macht.“
„Sie ist neu entdeckt, sagen Sie? Auf welche Weise?“
„Wie eben Höhlen entdeckt werden,“ antwortete er, „die einen durch Jäger, denen ein Fuchs, Dachs oder ein Kaninchen entschlüpft, die anderen durch Buben, welche die Schule schwänzen und Beeren suchen, oder durch Arbeiter, die Steine sprengen. Alle diese Entdeckungsarten haben wir in unserem höhlenreichen Kalkzuge, der fast ununterbrochen sich von Erckrath bis über Iserlohn und Balve hinaus fortsetzt. Ich beschäftige mich eben mit einer Zusammenstellung unserer sämmtlichen Höhlen, Grotten und Spalten, der Geschichte ihrer Entdeckung, Erhaltung und leider auch Verwüstung und einer Beschreibung der sehenswürdigsten, mit ihrem Inhalte von Knochen und thierischen Resten, der oft an das Unglaubliche grenzt. Die älteste Nachricht von einer solchen Entdeckung in unserem Lande findet sich in der Lübeck’schen Chronik von Detmar aus dem Jahre 1477 (Ausgabe von Grautoff,
[140][141] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [142] 2. Band, S. 401). In’s Hochdeutsche übersetzt heißt die Stelle folgendermaßen:
‚In demselben Jahre geschah in dem Lande Mark in Westphalen bei dem Städtchen Iserlohn ein gefährliches Abenteuer. Ein Jäger nämlich jagte da zwischen den Bergen und die Windhunde kamen auf die Spur eines Fuchses, der entlief ihnen in die Höhlung eines Berges, vor der ein übergroßer Stein lag; davor standen die Hunde und bellten. Der Jäger kam dazu, stieg vom Pferde und guckte in die kleine Oeffnung, da däuchte ihm, als ob in dem Berge was hauste. Deshalb brachte er wohl vierzig Mann zur Stelle, die mit großer Mühe den Stein von der Oeffnung brachten. Da war der Berg hohl in die Höhe und ebenso in die Länge. Darauf gingen sie hinein mit Fackeln und sahen da Todtengebeine von ungeheurer Größe liegen, Armknochen und Beinknochen, so dick wie der achte Theil einer Tonne, und einen Kopf so groß wie ein Scheffel. Sie konnten aber zu dem Ende der Höhle nicht gelangen, denn, als sie einen kleinen Steinwurf weit darin waren, gingen alle Fackeln und Lichter aus. Da dies der Herzog von Cleve hörte, gebot er bei Geldstrafe, es solle Niemand hineingehen, denn er vermuthete wahrscheinlich, einen Schatz an Geld darin zu finden.‘“
„Da haben wir ja,“ sagte ich, „die ganze Bescheerung, wie sie zusammengehört! Riesige Todtengebeine und Schädel, wahrscheinlich vom Höhlenbären, vom Mammuth und Nashorn, abergläubische Menschen, die das finden und sich davor fürchten, und einen herzoglichen Raubritter, der gleich an vergrabene Schätze und ähnliche Dinge denkt, die natürlich ihm gehören müssen. Aber damit ist unsere neue Höhle noch nicht gefunden – oder ist sie auch von Jägern entdeckt worden?“
„Nein,“ antwortete er, „diese Entdeckung trägt schon mehr den Stempel der Neuzeit. Wir verdanken sie den Eisenbahnarbeiten, von denen man ja fast sagen kann, daß sie durch ihre Einschnitte, Tunnel und Böschungen, durch ihr Bedürfniß nach Steinen, Eisen, Kalk und Beschotterung mehr für die Geologie geleistet haben in zehn Jahren, als alle Fürsten der Welt zusammengenommen seit ihrer Existenz. So hat es denn das gute Glück gewollt, daß die Eisenbahn, welche dem Lenne-Thal folgt und Hagen und Limburg mit Altena und Siegen verbindet, eine Zweigbahn nach dem in jeder Beziehung metallreichen Iserlohn senden mußte, die gezwungen ist, an den steilen Wänden her sich ihren Weg zu suchen. Die Gegend müssen Sie auch besuchen! Schade, daß wir Spätherbst und nicht Sommer haben! Man könnte sie die westphälische Schweiz nennen! Prächtige Felsengruppen, worunter der Mönch und die Nonne bei Letmathe die hervorragendsten, herrliche Wälder auf den Kuppen- und Höhenzügen, saftige Wiesen in den schönen Thälern, durch welche sich die Flüsse und Bäche winden, und überall pocht, hämmert und dampft es, daß es eine wahre Freude ist!“
„Aber die Entdeckung der Höhle, lieber Freund!“
„Nun, das ist es ja eben. Die Eisenbahnarbeiter also sprengen und hämmern und einem derselben fällt der Bickel in ein Loch. Er klettert nach, um ihn zu holen, sieht sich in einer Höhle – man holt Lichter, forscht weiter, folgt den oft verzweifelt engen Gängen und kommt endlich zu dem Bewußtsein, daß man eine weit verzweigte Höhle mit herrlichen Tropfsteingebilden entdeckt hat. Letztere regten denn auch den Vandalismu s an, der in den meisten andern Höhlen unserer Gegend so übel gehaust hat. Einzelne Stücken von Tropfstein waren schon ausgebrochen und verkauft worden, als die Bahngesellschaft, welcher der Grund und Boden und also auch die Höhle gehört, zweckmäßige Anordnungen traf, um der Verwüstung Einhalt zu thun. Die Höhle, deren Eingang in der Nähe der Station Grüne sich befindet, ist verschlossen; es sind, namentlich an Sonn- und Feiertagen, Leute bestellt, welche die Besucher mit Licht versehen und herumführen, und das geringe Eintrittsgeld, welches man bezahlt, fällt in die Vorsichtscasse der Arbeiter und Wärter an der Eisenbahn.“
„Sind denn wirklich solche Vorsichtsmaßregeln nöthig?“ fragte ich erstaunt. „Muß denn nicht Jedem das natürliche Gefühl eingeben, daß ein jeder dieser Tropfsteinzacken ein langjähriges Erzeugniß der still schaffenden Natur ist, das, einmal abgebrochen, nie wieder ersetzt werden kann? Es kann wohl nur rohen Menschen einfallen, Bäume auf öffentlichen Spaziergängen zu beschädigen, und doch kann man Bäume wieder pflanzen und wachsen lassen, aber keine Tropfsteine.“
„Die Erfahrung hat uns anderes belehrt,“ antwortete mein Zwischenredner kopfschüttelnd. „Sie werden noch andere Höhlen in hiesiger Gegend besuchen, wie die von Sundvig, aus welchen der Besitzer, Herr von Becke, so schöne Stücke urweltlicher Thiere zu Tage gefördert hat. Sehen Sie sich in diesen Höhlen um – man hat sie förmlich ausgeraubt! Sie waren voll der herrlichsten Tropfsteinbildungen – heute sehen Sie nur noch die unförmlichen Massen, welche den Boden decken, und die Beraubung würde bis zum letzten Stück fortgesetzt worden sein, wenn nicht der Besitzer die Höhlen ebenfalls unter Schloß und Riegel gelegt hätte. Können Sie glauben, daß es Leute genug giebt, welche bei dem Besuche einer solchen Höhle nicht umhin können, einige Zapfen abzubrechen und in die Tasche zu stecken – etwa in ähnlicher Weise, wie Engländer den Statuen Finger und Zehen abschlagen, um sie als Beweis ihrer gründlichen Betrachtung des Kunstwerkes zu Hause als Curiosität aufzbewahren? – Wir müssen also die Direction der Eisenbahn benachrichtigen, die uns gewiß gern behülflich sein wird, unseren Besuch der Höhle so fruchtbringend wie möglich für weitere wissenschaftliche Forschungen zu machen – einige Freunde wollen sich gewiß Ihnen und mir anschließen, und so werden wir einen Tag zwischen Ihren Vorlesungen vortrefflich ausnützen können.“
So geschah es denn auch. Freund Fuhlrott hatte es übernommen, das wissenschaftliche Programm des Tages zu entwerfen, und nach der Versicherung aller Bewohner des märkischen Landes durfte den Freunden aus Iserlohn das Recht nicht bestritten werden, für die leiblichen Bedürfnisse des Tages zu sorgen. Von allen Seiten her meldeten sich Theilnehmer – in Hagen trafen Künstler von Düsseldorf, Dichter von Barmen, Aerzte und Naturforscher von Elberfeld, Dortmund, Hörde, Industrielle von dort, von Köln und Witten zusammen, und an dem kleinen Bahnhofe von Letmathe fanden wir eine stattliche Wagenreihe von Iserlohn, die uns nach der Grüne und später nach Iserlohn selbst führen sollte. Hoff hatte seine Mappe, ein Doctor, eifriger Käfersammler, seine Blendlaterne mitgebracht, um in den Ecken und Winkeln nach blinden Käferchen zu suchen, die er freilich nicht fand, und riesige Pakete von Lichtern, Fackeln und Magnesiumdraht waren schon in der Höhle abgelagert worden, wo man einstweilen einige Versuchsstollen in den Boden getrieben hatte, um die verborgenen Schätze unter dem Tropfsteinboden hervor zu Tage zu fördern. Auch Apotheker Schmitz in Letmathe, der eifrige Sammler, hatte sich uns zugesellt – einige Tage vorher hatte er die Güte gehabt, seine an interessanten, in den Höhlen der Umgegend gesammelten Stücken außerordentlich reiche Sammlung mir zu zeigen und zu meinen Vorlesungen zur Disposition zu stellen.
Für Alles war demnach auf’s Beste gesorgt, und wenn die Eisenbahndirection dem wissenschaftlichen Programm freundliche Fürsorge zu Theil werden ließ und den lebhaftesten Antheil an der Durchführung desselben nahm, so zeigte die Folge, daß auch die Freunde in Iserlohn der ihnen gewordenen Aufgabe würdig zu entsprechen gewußt hatten. Hatte bis dahin schon die heiterste Stimmung unter den Teilnehmern geherrscht, so wurde dieselbe jetzt noch erhöht, als die Wagen uns aufnahmen und wir, von hellem Sonnenschein begünstigt, die Fahrt nach den Höhlen antraten.
In unmitelbarer Nähe von Letmathe, wo eine große Zinkhütte ihre in allen Farben des Regenbogens spielenden Flammen speit, schließt sich das malerische Lenne-Thal auf das Engste zusammen, und hohe, senkrecht abfallende Kalksteinfelsen zwingen den Fluß, von seinem nördlichen Laufe nach Westen umzubiegen. Zwei dieser mächtigen Felskuppen, nahe zusammengerückt auf dem rechten Ufer, heißen der Mönch und die Nonne – der erstere ist eine steile, ununterbrochene Felswand; an der Nonne aber gähnt über einer steilen Schutt- und Lehmhalde die Oeffnung der Grürmann’s-Höhle, die einst gänzlich mit Ablagerungen erfüllt war, jetzt aber zum Theil ausgeräumt ist und in welcher noch immer nach vorweltlichen Knochen gegraben wird. Die Beherzteren unter der Gesellschaft verlassen am Fuße der Halde die Wagen und klettern, knietief im erweichten Lehme watend, nach der Oeffnung empor. Böte der nackte Fels nicht hie und da einen Anhaltspunkt, man käme jetzt, wo tagelanger Regen den Boden erweicht hat, nicht hinauf!
Man kann wohl wie im Faust (freilich mit einiger Veränderung) sagen: Du mußt des Felsens alte Risse packen! denn [143] überall stehen auf dem Durchbruche schön gesternte Korallen aus dem Kalk hervor – der ganze Fels ist der Rest eines Riffes! Eine weite Wölbung empfängt uns – der hintere Theil der Grotte ist durch ein senkrechtes, von oben einfallendes Kamin erleuchtet – man kann bis zu der Stelle, wo eben gegraben wird, ohne künstliche Beleuchtung vordringen; Knochensplitter, welche von den Grabenden als werthlos bei Seite geworfen werden, decken hie und da den Boden. Die Grotte ist vollkommen trocken – die Felskuppe, welche von ihr durchsetzt wird, ist fast vollständig isolirt in ihrem oberen Theile – die Tropfsteinbildungen fehlen hier durchaus. Man überzeugt sich durch den Anblick der Ausgrabungen, daß dieselben in guten Händen sind, denn man findet unter den zurückgelassenen Stücken keines, welches der Aufbewahrung werth wäre – und weitere Discussionen auf den Besuch der Haupthöhle versparend, steigt man wieder hinab in die Wagen, die uns zu reichem und wohlverdientem Frühstück bei Grürmann tragen.
Mag auch der den ältesten Ablagerungen angehörende Kalk, welcher auf der linken Seite des Rheines in der Eifel so häufig vorkommt und auf der rechten Seite zuerst bei Erckrath auftritt, im Einzelnen noch so marmorartig und fest erscheinen, so zeigt sich doch das Gebirge selbst, welches er bildet und das namentlich zwischen Limburg und Balve eine bedeutende Höhe und Mächtigkeit erreicht, außerordentlich zerklüftet und zerristen. Wunderbar gestaltete Felskuppen, großartige Schuttfelder legen für die zerstörenden Einflüsse, die hier gewaltet, ein äußerliches Zeugniß ab, das durch die zahlreichen Klüfte und Spalten im Innern, die sich häufig zu Grotten und Höhlen erweitern, nur bestätigt wird. Ueber die hier wirkende Kraft kann man keinen Augenblick im Zweifel sein – es sind die Sickerwasser, welche zugleich zerstören und aufbauen, lösen und verkitten. Betrachtet man einen solchen Marmorblock, so wird man in dem dunkelgrauen, fast schwärzlichen Gestein eine Menge weißer Figuren und Adern sehen. Die Einen stammen von den Versteinerungen, von Muscheln und Korallen, die so häufig sind, daß der ganze lange Kalksteinzug für ein einziges Korallenriff gelten kann, das vor Millionen von Jahren in die Tiefe des Oceans versenkt war und nicht ohne Spaltung und Zertrümmerung aus demselben emporgehoben wurde – die Adern aber sind aus seinen weißen Kalkspath-Kryställchen gebildet, die sich offenbar langsam darin absetzten und die ursprünglich klaffende Spalte wieder verkitteten. So liefert jedes Bruchstück den Veweis von der steten Wirksamkeit des einsickernden Wassers. Das Regenwasser zieht sich langsam in die Spalten ein – es löst geringe Mengen von Kalk auf und setzt dieselben weiterhin beim Verdunsten der Kohlensäure, welche die Auflösung des Kalkes erleichterte, in reinen Krystallen theilweise wieder ab. So füllen sich kleinere Spalten und Höhlenräume, sogenannte Drusen, nach und nach mit rein weißen Absätzen von krystallinischem Gefüge an, deren Farbe und Ausehen angenehm gegen das dunkle Muttergestein absticht, welchem sie entnommen sind.
Dieselben Processe sind es auch, welche die sogenannten Tropfsteine, die Stalaktiten, erzeugen. Größere Spalten und Hohlräume, zuweilen erweitert durch im Inneren der Gebirgsmassen strömende Gewässer, welche später versiecht sind oder einen andern Ausweg gefunden haben, Höhlen und Grotten sind niemals ganz trocken, sondern zeigen überall an der Decke und an den Wänden feinere oder gröbere Spältchen und Spalten, durch welche das Wasser nach einem solchen Hohlraume seinen Weg findet. Hier rieselt das Wasser längs den vorspringenden Kanten der Wände ab, dort sammelt es sich in großen Tropfen an der Decke, die oft lange haften, bis endlich ihre Schwere sie zu Boden reißt; an anderen Stellen regnet oder gießt es förmlich aus der Decke hervor, fällt plätschernd auf den Boden und stäubt nebelartig wieder auf. Und überall, wohin nur ein Wassertröpfchen kommt, bleibt auch ein krystallisirtes Kalktheilchen sitzen, und wo ein solches unendlich kleines Kryställchen sitzt, da sammeln sich andere, schießen daran an und vergrößern das ursprüngliche Gebilde. So arbeitet es still und geräuschlos fort, Tag und Nacht, Jahre um Jahre, Jahrtausende um Jahrtausende. Die Rinnsale an den Wänden erheben sich zu Kanten und Vorsprüngen – wo eine Ungleichheit der Wand ein längeres Verweilen des Wassers verursachte und damit stärkeren Absatz, bildet sich eine Verdickung, wo es schneller abläuft, giebt es dünnere Stellen, und endlich ist aus dem Rinnsale ein elegant drapirter Vorhang geworden, mit Knotenschürzungen und Falten, die in schöngeschwungenen Linien hervortreten, sobald man eine Flamme hinter das durchscheinende Gebild bringt. Wo aber ein Tröpfchen im ersten Anfange hing, hat sich nach und nach ein Zapfen angesetzt, der stets an den Seiten und noch mehr an der Spitze wächst, und ihm entgegen hebt sich von unten, von dem Punkte aus, wo das Wasser auftrifft, ein kegelartiges Gebilde, bis beide mit ihren Spitzen zusammentreffen, sich vereinigen und eine Säule darstellen, welche das Gewölbe zu tragen scheint. Das Pflanzenleben trägt das Seinige dazu bei. Feine Wurzelfasern durchdringen das Gestein und suchen in der Höhle nach Boden, indem sie sich übermäßig verlängern; niedere Pflanzenformen, Algen, Schimmel, ja selbst Farnkräuter kriechen auf der feuchten Gesteinsfläche. All’ diese Pflanzentheile umhüllen sich nach und nach mit Scheiden von Kalkstein, sie befördern durch die Aufsaugung der lösenden Kohlensäure aus dem Wasser den Absatz des Tropfsteines, der sie bald in seiner Umarmung erstickt. Die Wurzelfaser, der Algenfaden verwesen und verschwinden – aber ihre Gestalt bleibt erhalten und lange, seine, durchsichtige Röhrchen von Tropfstein hängen von den Decken der Gewölbe herab, oder seine, spitzenartige Gewebe breiten sich an den Wänden aus. Während all’ dieser Arbeit wächst und wächst der Fußboden, und in manchen Höhlen so mächtig, daß steinharte Schichten von krystallinischem Gefüge, die mehrere Fuß dick sind, die Schätze unter diesem Boden bedecken.
Gewiß giebt es auch Zeiten, in welchen die Tropfsteinbildung energischer ist, als in anderen. Die wasserführenden Spalten können sich durch den Absatz in ihrem Innern verschlossen, die Wasser selbst durch eine Spaltenbildung einen anderen Abfluß gewonnen haben – die Oeffnung oder Schließung des Eingangs, der Zwischengänge und Kammern kann auf die Zuführung und Verdunstung des Wassers die verschiedensten Einflüsse geübt haben. Wer wollte alle diese Zufälligkeiten vorausberechnen, wenn sie uns gleich durch ihre Wirkungen offenbar werden? Denn in den meisten Höhlen kommen verschiedene, durch Zwischenlagen von sogenanntem Lehm getrennte Fußböden von Tropfstein vor, die wohl den Nachweis liefern, daß die Bildung von Zeit zu Zeit gänzlich stockte, um später auf’s Neue zu beginnen. Nicht minder unberechenbar sind die Zufälligkeiten, welche die Form der Tropfsteingebilde selbst bedingen. Ein Stäubchen fliegt irgendwo an; das herabtropfende Wasser bringt ein Sandkörnchen, ein Lehmtheilchen, das sitzen bleibt; ja irgend ein höhlenbesuchendes Thier, ein Fuchs oder ein Dachs, streift an einem Orte und läßt dort eine unmeßbare Menge seiner fettigen Hautschmiere zurück, und augenblicklich sucht sich das Sickerwasser einen anderen Weg beim Hinabgleiten, baut sich nach und nach dadurch selbst einen Damm – und eine Cannelirung ist hier gebildet, dort ein Vorsprung, hier ein Knauf oder eine Einschnürung! Dann endlich die wunderbaren Gestalten, die dadurch entstehen, daß zu schwer gewordene Anhänge sich loslösen, Säulen zusammenstürzen unter dem Drucke des Gewölbes der Höhle, Bruchstücke von der Decke fallen und alle diese Trümmer hier vielleicht zusammengekittet und überzogen oder ebenso möglich dort von einem einströmenden Gewässer fortgeführt und umwühlt werden. So wird aus dem einfachsten Momente, dem Absatz durch Sickerwasser, die reichste und unerschöpflichste Mannigfaltigkeit hervorgezaubert, und nur das steht im Voraus fest, daß die Formgestaltungen der Tropfsteine um so reicher, die Farbe um so reiner, das krystallinische Gefüge derselben um so klarer ist, je heller das einsickernde Wasser ist und je ungestörter dasselbe in der geschlossenen Höhle walten konnte.
Alle diese Vorzüge vereinigt die neue Höhle in der Grüne bei Iserlohn. Wir klettern auf steiler Stiege hinan zu dem engen Eingange, betreten eine Vorhalle, wo wir unsere Mäntel und Ueberzieher ablegen und gefällige Führer mit Grubenlichtern finden, die nur zur Besichtigung der Einzelheiten nöthig sind, denn überall sind einfache, aus Latten zusammengenagelte Candelaber mit Kerzen an den mit großem Geschick gewählten, vorteilhaften Punkten aufgestellt. Die zahlreiche Gesellschaft trennt sich bald in einzelne Gruppen, denen ortskundige Führer zur Seite gehen, dort Professor Fuhlrott, hier Baumeister Sebaldt oder Apotheker Schmitz, und bald hallen die Gewölbe, die auf- und absteigenden Zwischengänge von den bewundernden Ausrufen der Menge. Hier die Orgel! und die rundlichen Säulen klingen wehmüthig unter dem Stocke, der über sie hinfährt. Dort die Wolfsschlucht! Hier das Nixenbassin! Ueberall tönt es: „Hoff! kommen Sie hierher! Hoff! [144] dieser Anblick ist der schönste! Hoff! treten Sie auf diesen Block, gerade wo ich stehe! Wundervoll! Das müssen Sie skizziren, Hoff! Diesen Blick in die Höhe! Bewahre, sehen Sie einmal hinab, wie sich der Zug von Lichtern in die Tiefe schlängelt und von unten her der Alhambra-Saal mit seinen maurischen Hufeisenbogen und Arabesken im Blitzesschein des Magnesiumdrahtes erglänzt!“ Der arme Maler weiß kaum mehr, wo ihm der Kopf steht – man zerrt ihn umher – Figaro hier, Figaro da! Endlich wird er stetig und bleibt unverrückt vor dem Venusbade stehen, einer reizenden Grotte, halb versteckt zwischen schimmernden Säulen und durchscheinenden Spitzenvorhängen, mit krystallhellem, rundlichem Wasserbecken, so klar, friedlich und einladend, daß man glaubt, die Göttin der Schönheit selbst müßte jetzt als Schaumgeborene sich erheben aus dem perlenden Naß! Dies ist der Punkt, den unser Freund zu seiner Illustration erkoren, und hier reicht auch die nüchterne Prosa des Naturforschers nicht mehr aus – sie muß dem Dichter und dem Künstler Platz machen!
Die Iserlohner Höhle.
5 Wie oft der Vater flüchtig schon geschautBeim Schein des Grubenlämpchens jene Kleinen. 10 In Gruben, von der Zwerge Hand gemacht. –Ich hab’ an jenen Märchenspuk gedacht 15 Im bunten Schmuck. An den WachholderstämmchenTiefblaue Beeren, Vogelkirschen dort, 20 Was war es? Nur der buntgeschmückte Tod!Auf dem Paradebett des Sommers Leiche! 25 Wir treten ein. Jahrtausende hindurchWar fest verschlossen diese Felsenburg – 30 Ein Schleier dort, von der Natur gewoben.
35 O, schaut nur – eines Bischofs Katafalk!Und dort – o seht – sind es nicht Riesenkeulen? 40 Sie ruft die Sänger in den grünen Hain –Da kommt der Herbst und Alles schlummert ein! 45 Da weiß sie Ewig-Schönes zu gestalten!Da baut sie diese mächt’gen Säulen auf, 50 Da standen dort mit Schild und scharfer WehrDie Mannen Wittekind’s, zum Thale lugend 55 Dann auf dem Hügel heller Hörnerklang!Auf stolzem Rappen sprengt hinab den Hang 60 Mutter Natur an ihrem Werke weiter.
65 Wir zieh’n hervor, die unter’m SäulendachIn Nacht und Dunkel manch’ Jahrtausend schliefen, 70 Erzählen sollt ihr mir von dem, was war!Genug geträumt! Mit Augen, hell und klar 75 Neu aufgebaut der Geist der Welt von heute!wir sehn’s: Aus Moorgrund sprossen Farn und Schwamm; 80 Noch einen Blick den Palmen und dem BadDer Venus – dann ade, Westphalens Höhle! – November 1868. Emil Rittershaus.
|
Der Dichter eilt uns hier im kühnen Fluge der Phantasie voraus – wir selbst aber, nachdem wir uns an den gaukelnden Formen der Tropfsteine ergötzt, wenden unsern Blick nach der Tiefe, wo weitere Räthsel und Wunder unser warten.
K. in L. Die Eckartsberger Broschüre polemisirt gegen die in der
Gartenlaube abgedruckten Beiträge: Marlitt’s Alte Mamsell, Keil’s Brief an eine Gläubige und die Charakteristik Uhlich’s. Sie thut das – von
ihrem frömmelnden Standpunkt aus – zwar mit einiger Umständlichkeit
und nicht sehr glücklich, aber immerhin anständig und mit Umgehung aller
gehässigen Persönlichkeiten, lediglich auf die Sache selbst eingehend. Wenn
sie schließlich alle frommen Gläubigen zur Abschaffung der Gartenlaube
auffordert, so wird es ihr freilich schmerzlich sein, erfahren zu müssen, daß
trotz ihres Angstschreies die Auflage der verhaßten Zeitschrift seit
Neujahr wieder um 30.000 Exemplare gewachsen ist und selbst diese Erhöhung
der Auflage noch nicht ausreichen wird. Uebrigens ist dieser Eckartsberger
Eiferer immerhin noch duldsamer als sein westphälischer katholischer College,
der neulich in seinem Wochenblättchen eine Schmähung der Gartenlaube
abdrucken ließ und geradezu mit den Worten schloß: Es wäre besser, es
würde dem Redacteur Keil ein Stein an den Hals gehängt und er
versenket in das Meer, wo es am tiefsten ist. – Freilich ein kurzer Proceß!
Th. H…n in B…n. Für die Gartenlaube in keiner Weise geeignet; schon der beabsichtigte Umfang des Aufsatzes wäre ein unüberwindliches Hinderniß. Auch als Brochüre für die Verlagshandlung nicht zu gebrauchen; das Interesse für Mexico hat sich in Deutschland nachgerade etwas erschöpft. Manuscript steht zu ihrer Verfügung.
Ein Abonnent in Frankfurt a. M. Die Anstalten, von denen Sie uns schreiben, sollen in ihrer Art allerdings großartig und umfänglich, aber, wie wir auf unsere Erkundigung hin aus bester Quelle erfahren, vom Geiste starrer Buchstabengläubigkeit geleitet und erfüllt sein. Aus diesem Grunde müssen wir auf eine Schilderung derselben in unserem Blatte verzichten.
M. in Dr. Es ist ihre eigene Schuld, wenn ihre Manuscripte ungelesen zurückgehen. Einer vielbeschäftigten Redaction kann unmöglich zugemuthet werden, unleserliche und vielfach corrigirte Handschriften mühsam zu entziffern. Schreiben Sie deutlich oder wenn Sie das selbst nicht vermögen – lassen Sie die Manuscripte von einem guten Copisten abschreiben. Wie viele Einsendungen werden nur der schlechten Handschrift wegen unbeachtet bei Seite gelegt!
Wiederholte, aber letzte Erklärung. Schon oftmals haben wir
ausgesprochen und erklären hierdurch auf’s Neue, doch nun zum letzten
Male, daß wir der „Gartenlaube“ auch fernerhin keine Prämien
irgendwelcher Art beigeben werden, wie wir dies niemals gethan haben. Wenn
einzelne Hauptagenten unseres Blattes dergleichen Prämien für eigene
Rechnung beilegen, so hat die unterzeichnete Verlagshandlung nicht das
Mindeste damit zu schaffen.