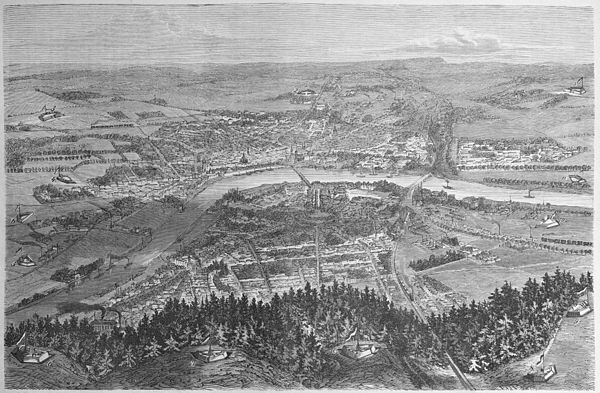Die Gartenlaube (1867)/Heft 7
Der Schein einer Hängelampe erleuchtete ein kleines, aber mit geschmackvoller Eleganz ausgestattetes Gemach und fiel auf den glänzenden Scheitel eines jungen Mädchens, das rastlos in demselben hin und wieder ging. Die Schritte der Wandernden waren unhörbar auf dem weichen Teppich, aber jede Bewegung, die ganze Haltung, welche manchmal ein gespanntes Aufhorchen verrieth, zeugte von großer Aufregung. Sie war in reicher Kleidung, die indessen mit der modernen Einrichtung des Zimmers seltsam contrastirte, denn die Perlengehänge, die geschlitzten, bauschigen Aermel, kurz das ganze Costüm gehörte offenbar dem Geschmack eines längstvergangenen Jahrhunderts an. Trotz ihrer schlanken, nach dem feinsten Ebenmaß gebildeten Gestalt war sie nicht das, was man eine eigentliche Schönheit nennt, aber daß die Züge des bräunlichen Gesichts der Regelmäßigkeit entbehrten, vergaß man über dem Glanz der großen schwarzen Augen, die darin blitzten, und wenn der Mund nicht eben klein war, so blieb das Lächeln, welches ihn zu Zeiten umspielte und dann zwei Reihen blendend weißer Zähne sichtbar werden ließ, nicht minder bezaubernd. In diesem Augenblick schwebte indeß dies Lächeln nicht um ihre Lippen, die vielmehr fest geschlossen waren, wie in einem herben Gefühl, während sich die dunklen Augenbrauen düster zusammengezogen hatten. „Er kommt wieder nicht!“ murmelte sie, und es war, als bebte ihre ganze Gestalt in verhaltener Leidenschaft. „Er kommt nicht!“ wiederholte sie dann leiser und warf sich in die Kissen des Sophas, das Gesicht gegen die weichen Polster gedrückt, als ob sie schluchze.
Nach einer Weile ließen sich Schritte auf der Treppe hören, bei deren Schall sie von Neuem heftig emporfuhr. Den schmerzlich Erwarteten mußte sie jedoch nicht daran erkennen, denn ihre Züge verriethen neben einem gewissen Erschrecken einen lebhaften Unmuth, während sich draußen bereits lachende Stimmen vernehmen ließen. Einen Augenblick verbarg sie den Kopf noch in beiden Händen, und als sie diese dann wieder sinken ließ und das Gesicht den Eintretenden, einer Gesellschaft von mehreren Damen und Herren, zuwandte, trug dieses einen vollkommen veränderten, heiteren Ausdruck.
„Guten Abend, theure Melanie,“ „cara mia,“ „durchlauchtige Prinzessin!“ ertönten die Begrüßungen von allen Seiten, während die Angeredete lachend ringsum die Hände bot und die Gäste zum Sitzen einlud.
„Noch im Costüme des Abends, Liebe?“ bemerkte etwas spöttisch eine der Damen und ließ den Blick über die Gewandung des jungen Mädchens gleiten; „wir sind seit einer Stunde wieder Alltagsmenschen.“
Melanie erröthete flüchtig und erwiderte, daß vorgefundene Briefe ihr nicht die Zeit zum Umkleiden gelassen hätten. „Und wozu auch?“ rief ein Herr, der den Platz an ihrer Seite zu erobern gewußt hatte, dazwischen. „Wir sind entzückt, Sie noch länger als Prinzessin Eboli sehen zu dürfen. Waren Sie an Ihrem Platz heute Abend, und war das eine Gluth in Ihrem Spiel! Ich sage Ihnen, ich erschrak und erzitterte beinahe unter Ihren Blicken, als ich Ihnen als Marquis Posa den Dolch auf die Brust setzte, und bin nur nicht mit mir einig, ob ich meinen Freund Don Carlos als Tropf verachten, oder als Held bewundern soll, daß er Ihnen gegenüber kalt zu bleiben vermochte.“
„Was wollen Sie?“ lachte die ersterwähnte Dame, eine schnippische kleine Brünette, die für die Soubrettenrollen engagirt war. „Der hatte eben nur Augen für seine blonde Elisabeth, die überhaupt während ihres Gastspiels verstanden hat, das hiesige Publicum zu enthusiasmiren. Mir – ich sage es gerade heraus – ist der Geschmack desselben unbegreiflich!“
„Und ich wiederum erkläre, daß mir ihr Spiel Respect eingeflößt hat!“ konnte Melanie sich zu sagen nicht enthalten, „und Manche könnten von ihr lernen.“
Die Brünette maß die Sprecherin mit einem spöttischen Blick und sagte dann: „Das ist denn auch wohl die Ansicht unseres gestrengen Kritikers, des Doctor Feldern, Ihres anerkannten Protectors, Melanie? Ich habe ihn wenigstens begeistert Beifall klatschen sehen, nachdem Elisabeth ihre stolze Vertheidigung vor dem König gesprochen hatte.“
„Ich habe dasselbe bemerkt,“ entgegnete Melanie ruhig und fügte gleich darauf, scheinbar unbefangen und wie um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, hinzu: „Wer mochte die schöne Dame sein, welche in der Loge neben Feldern saß? Ich sah ihn einige Male mit ihr sprechen.“
„Ah, das schöne Fräulein Alma, die Tochter des Oberforstmeisters von Büsching!“ lautete die Entgegnung, und ein Anderer fügte hinzu: „Das Gerücht bringt ihren Namen vielfach mit dem des Doctor Feldern zusammen und man nimmt ein Verhältniß zwischen den Beiden als ausgemacht an. Er soll ein fast täglicher Gast in dem Büsching’schen Hause sein.“
Wäre ein beobachtender Blick auf Melanie gefallen, so würde er vielleicht wahrgenommen haben, daß sich für einen Moment die Lippen des jungen Mädchens fest auf einander preßten, wie um einen unwillkürlichen Ausruf, eine Frage zurückzudrängen, und daß ein Erbleichen über ihre Wangen flog. Eine Secunde später aber war die Röthe derselben zurückgekehrt und als sie den Mund öffnete, war es, um heiter in die Scherzreden der Gesellschaft [98] einzustimmen. Ja, es schien, als sei sie von einer besonderen Munterkeit ergriffen, die sich rasch bis zur Ausgelassenheit steigerte. „Wir wollen unsere Kunst, das Schauspielern, leben lassen; das Leben besteht ja nur darin und dadurch!“ rief sie und zog hastig an der Klingel. „Champagner!“ befahl sie dem eintretenden Dienstmädchen. Eine ältliche Dame, die bald nach dem Erscheinen der lustigen Gesellschaft in’s Zimmer getreten war und in Melaniens Nähe Platz genommen hatte, stand leise auf und flüsterte dem jungen Mädchen, bei dem sie eine Art Ehrendame zu sein schien, etwas zu, augenscheinlich eine Warnung, aber die Schauspielerin schüttelte nur den Kopf und wandte sich ungeduldig von ihr ab. Wenige Minuten darauf schäumten und klangen die Gläser und daneben ertönte das Jubeln und Lachen der munteren Genossen, unter denen Melanie als die Fröhlichste gelten konnte. Erst als die Gesellschaft sich lange nach Mitternacht getrennt hatte, als Melanie sich allein sah – da war es plötzlich mit der heiteren Laune der Schauspielerin vorbei. In krampfhafter Hast riß sie die glänzenden Schmuckstücke von Hals und Armen, um dann die aufgelösten dunklen Locken mit den Händen zu durchwühlen und diese wieder zu ringen in stummer und banger Verzweiflung. –
Eine andere, gemessenere Gesellschaft hatte sich an einem der nächsten Abende im Hause des Oberforstmeisters von Büsching zusammengefunden, der mit seiner Gattin in etwas steifer Weise die Honneurs machte. Vielleicht galt diese mehr als gewöhnlich hervortretende Förmlichkeit der Anwesenheit eines vornehmen Besuchs, eines älteren, unverheiratheten Bruders des Hausherrn, welcher als Minister in der Residenz lebte und zu dessen Ehre und Unterhaltung die heutige Soirée veranstaltet worden war. Die Excellenz selbst schien jedoch gar keinen Anspruch auf besondere Rücksichtnahme für seinen Stand zu machen, denn sie gab sich der Unterhaltung mit voller Ungezwungenheit hin und hatte sich bald in ein so lebhaftes Gespräch mit einigen der anwesenden Herren vertieft, daß sie sich erst durch die directe Anrede des Bruders unterbrechen ließ, welcher zu ihr getreten war, um ihr unter dem Namen „Herr Doctor Feldern“ einen neu hinzugekommenen Gast vorzustellen. Der Minister verbeugte sich artig gegen den jungen Mann und richtete einige verbindliche Worte an ihn, doch da dieser fühlte, daß er eine vielleicht unwillkommene Störung veranlaßt hatte, zog er sich gleich darauf zurück, um sich unter die übrige Gesellschaft zu mischen, während jener die frühere Unterredung noch eine Weile fortsetzte. Bald jedoch wandte er sich mit der Frage an seinen Bruder:
„Wer und was ist eigentlich jener Doctor Feldern, mit dem Du mich bekannt machtest? Er hat etwas Distinguirtes, das mein Interesse erweckt.“
„Seiner Herkunft nach kann er dies wohl nicht haben,“ lautete die Antwort, „aber seine Persönlichkeit ist allerdings ausgezeichnet. Er gilt für einen der geistvollsten Männer unserer Stadt, der sich auch als Schriftsteller einen geachteten Namen erworben hat; daneben ist er Privatdocent an der hiesigen Universität.“
Der Minister schien noch etwas fragen zu wollen, doch wurde seine Aufmerksamkeit in diesem Augenblick von seiner Nichte, der schönen Tochter des Hauses, in Anspruch genommen, die aus einem der Nebenzimmer trat, wo er sie kurz vorher scherzend und plaudernd inmitten einer dichten Gruppe gesehen hatte. Sie blickte wie suchend um sich und nach einigen Secunden bemerkte er, wie ein glänzendes Lächeln über ihre Züge flog und wie sie sich einem alleinstehenden Herrn näherte, in welchem er Feldern erkannte und den sie anredete. Obgleich der Onkel scheinbar nicht auf die Unterhaltung achtete, entging ihm doch kein Wort derselben.
„Man bittet mich, zu singen,“ sagte sie, „aber Sie wissen, ohne Ihre Unterstützung wage ich schon nichts mehr. Wollen Sie mich begleiten?“
„Die Frage gleicht zu sehr einem Befehl,“ antwortete er wie scherzend, „um meine Antwort nicht überflüssig zu machen. Was wünschen Sie zu singen, gnädiges Fräulein?“
„O, ich stehe Ihnen nicht nach an Liebenswürdigkeit und will auch Ihnen Concessionen machen: also etwas Schwermüthiges, denn ich lese auf Ihrem Gesichte den Wunsch danach. Aber nein,“ unterbrach sie sich rasch wieder, „ich will Ihnen nicht das Recht lassen, Ihrer Schwermuth nachzuhängen, Sie sollen mich auch in meiner Stimmung accompagniren, wollen Sie?“ und wieder sah sie ihn mit ihrem strahlenden Lächeln an.
Es war, als läge eine Erwiderung auf seinen Lippen, die er unterdrückte, und er antwortete nur: „Ich begleite Sie, gnädiges Fräulein!“ Damit folgte er seiner schönen Gefährtin in das anstoßende Gemach, wo die Letztere an dem geöffneten Flügel Platz nahm, um sich selbst bei ihrem Gesange zu accompagniren. Feldern begleitete sie mit seiner Stimme, einem überaus angenehmen und kräftigen Tenor, der so vortrefflich zu ihrem schönen Alt paßte, daß sich eine lange Uebung voraussetzen ließ, die solch’ ein harmonisches Zusammenklingen der beiden Stimmen hervorgebracht hatte.
Der Minister hatte sich nachlässig in eine Fensterbrüstung gelehnt und beobachtete von dort aus das junge Paar, fast so gespannt, als ob er die Mienen desselben studire, während er doch ebensowohl ganz in das Hinhorchen versunken sein konnte. Nachdem der Gesang geendet und die Unterhaltung in der Gesellschaft wieder allgemein geworden war, trat er wie zufällig an seine Schwägerin heran und sagte, während seine Finger mit einer Blume spielten, die er aus einer der Vasen genommen hatte:
„Singt und spielt Alma häufig mit dem jungen Doctor Feldern?“
„Seit einem Vierteljahr kommt derselbe mitunter zu diesem Zweck in unser Haus,“ erwiderte die Angeredete. „Er ist gewissermaßen Alma’s Lehrer geworden, denn es hielt schwer, für ihre Stimme die gewünschte Ausbildung zu erlangen, und da Doctor Feldern’s musikalische Begabung außerordentlich ist, konnte uns die Gelegenheit nur angenehm sein.“
„Wenigstens scheint sie dies für Lehrer und Schülerin geworden zu sein,“ warf der Minister scheinbar nachlässig hin.
Das Gesicht. der Oberforstmeisterin verrieth aber, daß sie seine Meinung verstanden hatte, denn es stieg eine plötzliche Röthe darin auf und indem sie den Kopf etwas in den Nacken warf, sagte sie: „O, was das betrifft, Herr Schwager, so vergißt der junge Mann, denke ich, weder seine noch unsere Herkunft und Stellung und jedenfalls ist meine Tochter derselben eingedenk. Rücksichtlich der äußeren Schicklichkeit aber brauche ich wohl kaum zu versichern, daß ich in jeder Minute bei den Zusammenkünften gegenwärtig bin.“
„Zweifle nicht!“ antwortete der Minister, sich gegen seine Schwägerin verbeugend. „Indessen – eh bien – laissons cela!“ Damit bot er ihr seinen Arm und führte sie in den Salon zurück. –
Melanie hatte seit jenem Abend, wo sie zum letzten Male die Bühne betreten und sich darauf im Kreise der Genossen so heiter gezeigt hatte, einige trübe Tage verlebt. Der Erwartete war immer noch nicht bei ihr gewesen und sie verzehrte sich in Angst und Unruhe. In der Dämmerung des hereinbrechenden Abends stand sie jetzt am Fenster und blickte gespannt auf die Straße, als ob sie unter den vorübergehenden Gestalten nach einer bestimmten Persönlichkeit forsche. Sie hatte dabei überhört, daß Jemand die Treppe hinaufgekommen war und daß die Zimmerthür sich geöffnet hatte.
„Guten Abend, Melanie!“ tönte plötzlich eine tiefe, wohlklingende Stimme hinter ihr.
Mit einem Schrei der Ueberraschung wandte sie sich um und wie in überwallender Freude stieß sie das Wort „Friedrich!“ hervor, um dann gleich darauf in leiserem und gehaltenerem Tone ein „Willkommen“ hinzuzufügen.
Feldern, denn er war der Eintretende, hatte unterdessen ruhig an ihrer Seite Platz genommen und that einige gleichgültige Fragen, auf die sie sich bemühte in derselben Weise zu antworten. Bald aber konnte sie diesen Zwang nicht länger ertragen und ihre leidenschaftliche Erregung klang durch, als sie in die Worte ausbrach:
„Sie sind lange nicht hier gewesen – haben Sie mich vergessen, Friedrich?“
Fast verwundert blickte er sie an. „Ich war vielbeschäftigt, Melanie,“ antwortete er und fügte in einen halb scherzenden Ton übergehend hinzu: „Sie haben schon als Prinzessin Eboli dafür gesorgt, daß ich Sie nicht vergessen durfte.“
„Wie gefiel Ihnen mein Spiel?“ fragte sie rasch.
„Haben Sie meine Beurtheilung jener Aufführung nicht in dem Tagesblatt gelesen?“ fragte er dagegen. Sie verneinte.
„Nun, so muß ich Ihnen gegenüber schon Lob und Tadel wiederholen, wie ich Beides dort ausgesprochen. Zuerst will ich [99] Ihnen sagen, daß Ihre Leistung mich von Anfang bis zu Ende interessirt hat, weil ich Sie noch in keiner Rolle sah, die von solch’ einer leidenschaftlichen Gluth erfüllt ist, und im Ganzen fühlte ich mich befriedigt von Ihrer Auffassung, wenn ich schon einige Ausschreitungen tadeln möchte. Im zweiten Act z. B. –“
„Halten Sie ein,“ rief Melanie in fast fieberberhafter Aufregung, „ich kann heute – jetzt keine Recensionen über mich anhören!“
Feldern mußte an die reizbare Stimmung der Schauspielerin gewöhnt sein, denn er verrieth kein Zeichen des Unmuthes, und als die Dienerin in diesem Augenblick mit der brennenden Lampe hereintrat, griff er schweigend nach einem aufgeschlagenen Buch, das auf dem Tische lag. Melanie ging einige Male durch das Gemach und es war augenscheinlich, daß sie ruhiger zu werden suchte. Nach einer Weile nahm sie schweigend wieder an seiner Seite Platz, und als er bemerkte, daß ihre Blicke an dem Buche hafteten, das er in der Hand hielt – es war Mosen’s[WS 1] „Sohn des Fürsten“ – fragte er: „Werden Sie die Orzelska spielen?“ Sie nickte. „Und sagt Ihnen die Rolle zu?“
„Ich weiß noch nicht,“ entgegnete sie, „bis jetzt kaum. Dies leidvolle Entsagen entspricht zu wenig meiner Natur und ich fürchte, den richtigen Ton für die Resignation finde ich nicht.“
„Wollen wir einen Versuch machen, Melanie? Lassen Sie mich einmal wieder Ihren Rathgeber sein und die Rolle mit Ihnen durchnehmen. Ich wette, unseren vereinten Kräften gelingt’s, das Rechte zu treffen.“
Er hatte in freundlichem, fast väterlichem Ton zu ihr gesprochen, aber doch die beabsichtigte Wirkung verfehlt, denn Melanie schüttelte nur traurig den Kopf. Es trat wieder eine Pause ein, doch während Feldern las oder zu lesen schien, entging es Melanie nicht, die, in ihren Stuhl zurückgelehnt, ihn betrachtete, daß ein etwas unmuthiger Zug auf seinem Gesicht hervortrat, und sie sah ein, daß sie ein anderes Gespräch anzuknüpfen habe, um die gute Laune ihres Gastes herzustellen. Daher wechselte sie in einem jener raschen Uebergänge ihres Wesens plötzlich den Ton und fing an, in lebendiger und selbst heiterer Weise von allerlei kleinen Erlebnissen, Vorgängen in der Bühnenwelt etc. zu erzählen, indem sie ihn dabei unbemerkt zu ähnlichen Mittheilungen anregte. Feldern, der froh war, daß die peinliche Stimmung ihr Ende erreicht zu haben schien, ging auf die Unterhaltung ein und ihren geschickten Fragen gelang es, allerlei Einzelheiten, die sich auf sein Leben bezogen, aus ihm herauszulocken. Zufällig geschah dabei auch seines Verkehrs im Büsching’schen Hause Erwähnung, und obgleich er leicht darüber hinzugleiten suchte, trat sie ihm plötzlich mit der Bemerkung in den Weg: „Die Tochter des Hauses ist sehr schön,“ sagt man.
„Man spricht damit die Wahrheit,“ entgegnete er ruhig.
„Ist sie so liebenswürdig, wie schön?“ fragte sie.
„Das kommt auf die persönliche Empfindung an, Melanie.“
„Ist sie nicht vom Glück, vom Reichthum, durch ihre vornehme Geburt verwöhnt, einer anderen Welt angehörend, als der einfachen, bürgerlichen?“
„Ich fürchte, sie ist alles das, Melanie!“
Sie blickte ihn scharf an; die anfängliche Ruhe war aus ihrem Gesicht verschwunden und es ward ihr offenbar, daß er in diesem Augenblick mehr an die Entfernte dachte, als an sie, die Fragende. Ihrer Ueberlegung kaum noch mächtig, rief sie aus:
„Und doch sagt man, daß Sie an eine Verbindung mit jener stolzen, gefeierten Schönheit denken, Friedrich!“
Er blickte sie an, wie erstaunt über die dreiste Bemerkung, dann aber nahm sein Gesicht einen düsteren Ausdruck an und er sagte leise, aber fest: „Sie wird nie mein Weib.“
Das Wort hätte ihr beinahe seinen Freudenschrei entlockt, doch ein Blick auf seine Züge dämpfte ihre Empfindung. „Friedrich,“ stieß sie hervor, „Sie lieben das Fräulein dennoch!“
In seine Wangen schoß eine dunkle Röthe und seine Augen blickten fast drohend auf sie.
„Melanie, mißbrauchen Sie nicht die Rechte, welche ich Ihnen einräumte!“
Ihr ganzes Wesen sank zusammen vor seinem Zürnen und an die Stelle der Leidenschaft trat die schüchternste Demuth. Sie ergriff seine Hand und würde sie an die Lippen gedrückt haben, wenn er es nicht verhindert hätte. „Vergebung!“ flüsterte sie. – Er war wieder weicher geworden und sagte:
„Wir wollen vergessen, Melanie, was heute geredet worden ist!“
„Ja, vergessen!“ sagte sie traurig und angstvoll zugleich; „nur nicht das Eine Wort, das Sie vorhin sagten; nicht wahr, Friedrich?“
Er blickte sie fast mitleidig an und sagte: „Wir wollen nur das aus unserem Gedächtniß zu tilgen suchen, was uns krank und elend macht, dafür aber des Gelöbnisses eingedenk bleiben, welches wir Beide gethan haben: uns selbst und unseren Zielen treu zu bleiben!“ Er stand auf, um sich zu entfernen. Als er schon an der Thür war, faßte sie wieder seine Hand und sagte fast flehend: „Sagen Sie mir noch einmal, daß Sie mir nicht zürnen!“
„Armes Kind!“ murmelte er, während er leise mit der Hand über ihren dunklen Scheitel fuhr, und gütig fügte er hinzu: „Nein, ich zürne Ihnen nicht, Melanie!“
Als er dann aber hinaustrat auf die dunkle Gasse, lag eine schwere Wolke auf seiner Stirn, vielleicht der Sorge, vielleicht des Grams, und zu sich selbst sagte er: „Es geht nicht länger so; es muß zu Ende kommen hier und – dort!“ –
Wenige Wochen später trat Feldern wieder einen Gang nach dem Büsching’schen Hause an; diesmal aber nicht als Gast einer Soirée, sondern um einen einfachen Besuch abzustatten, der indessen einen besonderen Zweck haben mußte, denn sein Antlitz war ungewöhnlich ernst und beim Ueberschreiten der Schwelle zögerte er sogar einen Augenblick, als würde es ihm schwer, hier einzutreten. Seine Frage nach den Herrschaften ward von dem entgegentretenden Diener dahin beantwortet, daß der Oberforstmeister nicht daheim, die gnädige Frau aber von heftiger Migräne befallen sei und das Bett hüte. Eine Secunde schwankte Feldern, dann aber brachte er entschlossen die Frage nach Alma hervor und als er erfuhr, daß dieselbe im Salon sei, befahl er, ihn dem Fräulein zu melden. „Ich will nicht feige von hier und – von ihr gehen!“ sagte er zu sich selbst. Der Diener brachte die Antwort zurück, daß der Besuch willkommen sei, und eine Minute darauf sah Feldern sich dem jungen Mädchen gegenüber, das sich bei seinem Eintritt mit dem Ausdruck freudiger Ueberraschung erhob.
„Sieht man Sie endlich einmal wieder, Sie böser Flüchtling?“ rief sie ihm mit freundlichem Zürnen entgegen. „Seit Wochen warte ich vergebens, daß Sie sich unserer Uebungen erinnern möchten, und hatte mein eifriges Bestreben daran gesetzt, daß die Schülerin dem Lehrer Ehre machen solle, und zum Lohne dafür düpiren Sie mich von einem Tage zum andern. Dürfen Sie da wohl noch die Bitte um Vergebung wagen, die Sie doch wahrscheinlich zu mir führt?“
„Dennoch spreche ich sie aus,“ entgegnete er, „denn ich bedarf eines freundlichen Andenkens an die Zeit, wo ich mitunter in Ihrer Nähe sein durfte.“
Sie blickte ihn erstaunt und fragend an, antwortete dann aber im Ton fröhlichen Uebermuths: „Das klingt ja ordentlich elegisch und soll mich wohl darauf vorbereiten, daß Sie noch länger den Unsichtbaren spielen, am Ende gar eine Reise antreten wollen?“
„Eine Reise – ja; aber keine solche, bei der sich die Voraussicht des Wiedersehens gleich an den Abschied knüpft. Ich werde M. verlassen.“ Er sah nicht oder schien wenigstens nicht zu sehen, daß ein Erbleichen über ihre schönen Züge flog, denn seine Augen wichen den ihrigen aus und erst als sie leise sagte: „Das erwartete ich nicht!“ blickte er sie wieder an, jetzt aber fest und ruhig und auch seine Stimme klang so, als er fortfuhr:
„Ich habe mich vor einigen Wochen um eine erledigte Stelle an der Universität H. beworben und ein amtliches Schreiben verkündet mir heute Morgen die Gewährung meines Gesuchs. Weil gerade die Ferienzeit der hiesigen Hochschule ist, konnte ich mich leicht aus den bisherigen Verhältnissen lösen, und da mich auch sonst nichts fesselt, so denke ich schon in einigen Tagen von hier abzureisen.“
Alma hatte sich über die Stickerei gebeugt, an der sie bei seinem Eintritt gearbeitet hatte, und er konnte den Ausdruck ihrer Züge nicht wahrnehmen; es schien ihm jedoch eine Bewegung aus ihren Worten zu klingen, als sie nach einer Pause antwortete:
„Ist es unbescheiden, wenn ich Sie frage, ob persönliche Vortheile mit dieser Veränderung Ihrer Stellung verbunden sind?“
„Wie Sie es nehmen wollen,“ sagte er; „im gewöhnlichen Sinne – nein! Ja, ich verzichte sogar auf manche Vortheile, die ich hier genoß; dennoch aber sind es gerade persönliche Rücksichten, die mich zu einem Wechsel meiner Verhältnisse veranlassen.“
[100] „Ich verstehe das nicht!“ sagte sie kurz.
„Und zürnen mir dennoch?“ wagte er zu fragen.
„Ja,“ sagte sie und sah ihn dabei wieder offen an, „es thut mir leid, daß Ihnen unsere Stadt so wenig lieb geworden ist, daß Ihnen das Losreißen so leicht wird!“
„So sind die Frauen!“ erwiderte er, mit einem Versuch, zu scherzen: „sie fassen gleich Alles von dem Standpunkt des Gemüths, des Herzens auf!“ und ernster fügte er hinzu: „Sie dürfen nicht vergessen, daß das Wort Herz eine zweifache Bedeutung hat und daß die ferner liegende nicht selten von dem Manne zunächst erfaßt werden muß: er muß das Herz haben, sein Herz zu besiegen.“
Es war fast, als fürchtete er, zuviel gesagt zu haben, denn nach einer kleinen Pause fuhr er fort: „Sie werden sich aber mit meiner Entschließung aussöhnen, wenn ich Ihnen sage, daß ich wirklich einer Forderung des Herzens nachgebe, indem ich nach jener Stadt übersiedle: ich komme damit in die Nähe meiner alten, einsam lebenden Mutter.“
Der weiche Ton seiner Stimme ergriff sie und unwillkürlich fragte sie: „Sie lieben Ihre Mutter sehr?“
„Ja!“ erwiderte er. „Ich liebe sie, wie sie der Sohn lieben muß, der das Einzige ist, was ihr vom Leben und seinen Verheißungen übrig geblieben.“
Sie blickte ihn mit dem Ausdruck der vollsten Theilnahme an und sagte: „Dann ist wohl auch Ihr Leben nicht immer ein glückliches gewesen?“
„Ich habe viele trübe Stunden durchkämpfen müssen, von meiner frühen Jugend an. Sie kennen meine Herkunft, gnädiges Fräulein?“
„Ich weiß, daß Sie sich durch eigenes Talent und eigenen Fleiß Ihren Weg gebahnt haben,“ versetzte sie ausweichend. „Glauben Sie, daß ich Sie darum minder ehre?“
„Das hieße, Ihre Gesinnung unterschätzen, gnädiges Fräulein?“
„Erzählen Sie mir von Ihrem Leben!“ bat sie rasch. „Ich kenne nur die Gegenwart und möchte auch die Vergangenheit wissen.“
Er schwieg einige Augenblicke. „Ist meine Bitte unziemlich, so ziehe ich sie zurück,“ sagte sie etwas verletzt.
„Nein „entgegnete er „es ist besser, Sie erfahren, was hinter mir liegt. So wissen Sie denn, daß ich nicht nur mit Noth und Mangel zu kämpfen hatte, daß ich auch Schmach und Unehre, die sich an meinen Namen hefteten, besiegen mußte. Und was das Bitterste war: mein eigener Vater hatte diese Unehre über uns gebracht.“
„Das habe ich nicht gewußt!“ rief Alma erschüttert aus.
„Er war Cassenbeamter und ward der Unterschlagung städtischer Gelder angeklagt. Es kam ein furchtbarer Tag, wo er aus seiner Familie fort und in’s Gefängniß geführt wurde. Das Gesetz verurtheilte ihn – er starb im Zuchthause.“
„Aber Sie – Ihre Mutter – Sie erkannten ihn für unschuldig?“ fragte Alma in großer Erregung.
„Erlassen Sie mir, davon zu sprechen!“ erwiderte er. „Jedenfalls hatte unser Herz eine Entschuldigung für ihn. Seine Schwäche und Gutmüthigkeit sind wahrscheinlich von Andern und Schuldigeren benutzt worden, um ihn zur Darleihung anvertrauter Gelder zu vermögen, aber die Thatsache blieb dieselbe: unser ehrlicher Name blieb verloren und an uns war es, ihn uns auf’s Neue zu erringen.“
„Und was war Ihre und Ihrer Mutter nächste Zukunft?“ fragte Alma.
„Die Mutter zog mit mir und meinem älteren Bruder in ein entferntes Städtchen und erhielt uns dort – unser kleines Vermögen war natürlich confiscirt worden – durch ihrer Hände Arbeit, bis wir heranwuchsen und im Erwerb behülflich sein konnten. Wie mein Bruder gewann ich mir dann durch Stundengeben die Mittel zu weiterer Ausbildung und durch Vermittlung wohlwollender Freunde erhielt ich später ein Stipendium, das mir den Besuch der Universität möglich machte. Auch dort hatte ich noch mit bitterem Mangel zu kämpfen, aber ich bin glücklich durchgedrungen und jetzt beinahe stolz auf meine früheren Entbehrungen.
„Und Ihr Bruder?“ fragte Alma mit lebhaftem Interesse.
Feldern fuhr sich einen Moment mit der Hand über die Augen. „Er war ein sehr begabter Mensch; er wurde Maler. – Jetzt ist er todt.“
Das junge Mädchen schwieg eine Weile. Feldern’s Erzählung hatte sie tief und zugleich peinlich ergriffen, denn es drückte sie wie eine Schuld, daß sie es gewesen, welche ihn zu seinen Mittheilungen veranlaßt hatte. Und doch wieder wußte sie selbst nicht mehr, wie Alles gekommen war, wodurch sie den ernsten Mann bewogen hatte, aus seiner Verschlossenheit heraustreten und sie mit dem bekannt zu machen, was – sie wußte es nun! – wie ein Wurm an seinem Leben nagte. In ihrer Verwirrung sagte sie: „Das also ist der Grund Ihres ernsten Wesens, das mir manchmal wie Schwermuth erschienen ist und über das ich oft gesonnen habe wie über ein Räthsel!“
Er lächelte fast, als er antwortete: „Allerdings finden Sie in meiner Erzählung angedeutet, warum meine Natur sich so und nicht anders gestaltet hat. Ich habe meistens allein im Leben gestanden.“
„Ließ man denn Sie, den Schuldlosen, Ihr Unglück büßen?“ fragte Alma in aufwallendem Zorn.
„Ob gerade absichtlich, weiß ich nicht,“ entgegnete er, „aber es entwickelte sich früh in mir eine große Reizbarkeit, die mich jede mögliche Berührung scheuen ließ. Selbst im späteren Leben bin ich ihrer nicht ganz Herr geworden.“
Alma überhörte fast die letzten Worte, denn wie ein Blitzstrahl hatte sie die Erkenntniß getroffen, weshalb Feldern ihr diese Enthüllungen gemacht, und sie in leidenschaftliche Erregung versetzt. Es war sein Edelmuth, der es ihm unmöglich machte, um ihre Hand, ihre Liebe zu werben: in seinem stolz-bescheidenen Sinne war er ihrer nicht werth. Und wie es gleich Schuppen von ihren Augen fiel, so leuchtete in ihrem Herzen der Gedanke: Er ist der Mann, den du lieben kannst – er und kein anderer! Der Impuls zu eigenem Handeln war ihr damit gegeben; vor ihn hintretend und seine beiden Hände erfassend sagte sie, und blickte dabei mit ihren glänzenden Augen in die seinen:
„Ich danke Ihnen, Feldern, daß Sie mir das Alles gesagt haben – es ist nun Alles klar und licht vor meinem Geiste und ich weiß, wie Ihr und – mein Schicksal sich gestalten muß.“ Er blickte sie gespannt und forschend an.
„Feldern,“ fuhr sie mit einem strahlenden Lächeln fort, „konnten Sie im Ernst glauben, daß Ihre Vergangenheit, daß fremde Schuld eine Schranke zwischen uns aufrichten würde? Ihre Erzählung hat nur den einen Wunsch in mir erweckt: die Ungerechtigkeit des Schicksals auszugleichen. Und darum trete ich jetzt vor Sie hin und biete Ihnen mit meinem Herzen die Hand, welche Sie sanftere Wege führen soll, als die Sie bisher gewandelt sind. Wollen Sie Beides von mir annehmen, Feldern?“
Als nach den Tagen des Wiener Congresses unserer Nation, welche die Schlachten der Freiheitskriege geschlagen, ein großes und freies politisches Dasein versagt blieb, da wandten sich die ersten Geister unter dem aufwachsenden Geschlechte der Wissenschaft zu; mit ungetheilter Kraft haben sie die stillen Jahrzehnte hindurch auf allen Gebieten der Naturforschung, der Sprach- und Alterthumskunde, der Rechtswissenschaft wie der Geschichte rastlos gearbeitet und so durch ihre Werke, während kaum erst die wundervolle Blüthe unserer Dichtung und Philosophie abstarb, eine neue Blüthe deutschen Geistes gezeitigt, die der realen Wissenschaften. Wohl sind manche von den Meistern auf diesen fruchtreichen Wirkungsfeldern längst dahingeschieden, doch andere leben und wirken, wiewohl hoch in Jahren, noch fort in dem geistigen Berufe, der ihnen das Leben selbst, uns Allen den Werth ihres Lebens bedeutet.
In diesen Tagen nun, am 20. Februar, feiert einer unter ihnen, Leopold Ranke, sein fünfzigjähriges Doctorjubiläum; seine Schüler bringen ihm von nah und fern ihre Glückwünsche [101] dar zur goldenen Hochzeit mit der Wissenschaft. Aber müssen sich nicht viele Andere mit als seine Schüler bekennen? Auch die Leser der Gartenlaube dürfen sein Ehrenfest mitbegehen, denn wer möchte sich nicht des noch rüstigen Lehrers erfreuen und sein Leben und Wirken sich nicht in’s Leben zurückrufen?
Von Leopold Ranke’s äußerem Leben ist freilich wenig zu erzählen! Daß er am 21. December 1795 zu Wiehe in Thüringen geboren, nach mannigfachen historischen, philologischen und theologischen Studien in Leipzig 1817 promovirt worden; daß er zuerst am Gymnasium zu Frankfurt an der Oder gelehrt, darauf 1825 als außerordentlicher Professor der Geschichte an die Berliner Hochschule berufen, dort bald Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ordentlicher Professor, endlich Historiograph der preußischen Monarchie, Mitglied des Staatsrathes und Geheimer Regierungsrath geworden; daß er Königen nahe gestanden, mit hohen Orden ausgezeichnet, am Ende gar in den Adelsstand versetzt worden: dieser sein officieller Lebenslauf ist es nicht, was uns anzieht. Wir fühlen uns als das Publicum, mit dem er in freiem geistigen Verkehre gestanden; dieser Verkehr selbst und der Gewinn, der uns daraus erwachsen, das ist es, was wir heute mit unbefangener Dankbarkeit schätzen.
Fast alle unsere wissenschaftlichen Bestrebungen seit 1815 tragen einen historischen Charakter; mußte da nicht die reine Geschichte selbst eine ganz hervorragende Stellung einnehmen? Sie dahin zu erheben, war vor allen Anderen Ranke bemüht. Er verband nämlich mit dem Rufe des Historikers durchaus nicht das Amt, die Vergangenheit zu richten und die Mitwelt zum Nutzen künftiger Jahre zu belehren, sondern er stellte sich die offenbar weit schwierigere Aufgabe, einfach zu sagen, „wie es eigentlich gewesen“. Denn dazu bedarf es eines den ganzen Stoff umfassenden, für alles wahrhaft Bedeutende empfänglichen Blickes, wie einer gesunden und scharfen Kritik sämmtlicher Quellen. Beide Eigenschaften bewährte Ranke schon in seinem ersten Werke, der „Geschichte der romanischen und germanischen Völkerschaften von 1494 bis 1535“. Indem er die Romanen und Germanen Europas als ein Ganzes betrachtet, sondert er sie von allen übrigen Völkern, sieht in ihnen die Träger der Cultur und der allgemeinen Geschichte, welche ihm eben die Geschichte der ununterbrochenen Entwicklung menschlicher Cultur ist; er begründet kurz ihre Einheit aus ihren gemeinsamen Thaten im Mittelalter, um dann zur Darstellung ihres vielfach entzweiten und doch verwandten und verbundenen Lebens in der Neuzeit überzugehen. Dieselbe Aufgabe und ihre vollständige Lösung in seinen späteren Hauptwerken, als da sind: seine „Fürsten und Völker Südeuropas“, seine „französische“, seine „englische Geschichte“, immer vornehmlich im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert, seine „deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation“ und seine „neun Bücher preußischer Geschichte“. Wenn ihm noch vergönnt wird, nach Vollendung der englischen auch die scandinavische Historie hereinzuziehen, so wäre damit der große Kreis romanisch-germanischer Geschichten vom sechszehnten bis in’s achtzehnte Jahrhundert, wo ein neues Weltalter anhebt, geschlossen. Wir dürfen diese Werke, wie sie eine Einheit bilden, auch nur in ihrer Gesammtheit betrachten.
Vielleicht die Hauptfrage jener Zeiten ist die religiöse; in ihrer Behandlung gerade liegt Ranke’s größte Meisterschaft. Die deutsche That der Reformation, ihr Zug durch Europa, die gewaltige Gegenrüstung des Katholicismus, der Kampf der Bekenntnisse, hier der Sieg des einen, da des anderen, dort endlich Friede und Anerkennung, diese welthistorischen Ereignisse bilden den vornehmsten Inhalt, wie jener Epoche, so ihrer Darstellung durch Ranke. Ein zweites großes Moment, doch rein politischer Natur bildet in den Ranke’schen Geschichten der europäische Streit zwischen der spanisch-habsburgischen und der französischen Macht, ein drittes das Ringen der modernen Monarchie mit den ständisch-aristokratischen Gewalten. Letztere sehen wir in Spanien und Frankreich unterliegen, in England durch die Revolution die Oberhand gewinnen, während sie bei uns schon in der Reformationszeit die Territorialherrschaft an sich reißen und dem Kaiserthume gegenüber das Feld behaupten.
Und dabei erinnern wir uns alsbald, daß wir hier vor der Blüthezeit der absoluten Monarchie, der Zeit der großen Autokraten, der Höfe mit ihren Intriguen, der Cabinetspolitik, der Diplomatie stehen; daraus ergiebt sich denn die Weise der Arbeit für den Historiker. Die echten Denkmale der Verhandlungen selber, Actenstücke, Gesandschaftsberichte, Briefe muß er aufsuchen, die Gewölbe der Archive danach durchwühlen! Es ist dies vor und nach Ranke geschehen, aber Niemand hat vielleicht mit solcher Ausdauer, solcher Virtuosität aus Hunderten von Folianten, Tausenden von Actenstößen das Wesentliche sich zu eigen gemacht, wie gerade er. Er fühlt sich wohl in dieser Luft: „Man bedauere den nicht,“ ruft er aus, „der sich mit diesen anscheinend trocknen Studien beschäftigt und darüber den Genuß manches heitern Tages versäumt! Es ist wahr, es sind todte Papiere, aber sie sind Ueberreste eines Lebens, dessen Anschauung dem Geiste nach und nach aus ihnen emporsteigt.“
Da ist es nun für Ranke und durch ihn für die Wissenschaft [102] von der höchsten Bedeutung geworden, daß er zuerst es unternahm, die Relationen venetianischer Gesandten von allen Höfen Europas, die handschriftlich in den Bibliotheken brach lagen, für die Geschichte auszubeuten. Denn aus ihnen ergab sich ihm nicht nur, wie aus anderen Archivalien, der Gang der Verhandlungen, das Spiel der diplomatischen Künste; nichts war der Beobachtung dieser scharfsinnigen, kaufmännisch-wachsamen Italiener entgangen: über Person und Charakter der Fürsten und Minister, über Hof und Verwaltung, Finanzen und Kriegsmacht, Gesinnung der Unterthanen erstatteten sie ihrer Signoria ausführlichen Bericht, so wenig auch den Fremden solche Anatomie ihrer Höfe, wie sie es nannten, behagen mochte. Es ist gar nicht zu sagen, wie durch diese Hülfsmittel Ranke’s natürliches Talent zu lebendiger Charakteristik, zu anschaulicher Detailmalerei gefördert worden. Die Lectüre dieser Ranke’schen Bücher übt daher einen zwiefachen Reiz auf uns aus: wir überschauen von hohen Standorten aus die gewaltigen historischen Bewegungen und bekommen doch auch einen Einblick in das innere Leben der einzelnen Staaten, ja der handelnden Individuen selber; wir treiben große Politik und lernen zugleich das tägliche Gebahren der Menschen wie aus persönlichem Umgange kennen.
Auch Stil und Form der Darstellung dienen vortrefflich, die Vorzüge des Inhalts in’s Licht zu setzen. Die Sprache fließt rein und munter dahin, bald in gelenken Perioden, bald behend in kurzen Sätzen; häufig wird eine Frage aufgeworfen, wie eine leichte Welle, hier und da ein lebhafter Ausruf. Nirgends trifft man eine schwere Bildersprache; der eigentliche Ausdruck in seiner Einfalt ist der Schmuck der Rede. Ungemein reich an Sentenzen ist die Darstellung; aber sie schießen auf, natürlich, wie Blumen am Rande des Baches. Es sind allgemeine Bemerkungen concreten Inhalts, wie sie sich gleichsam unwillkürlich an jedem Punkte der Erzählung einstellen. Denn nichts liegt diesem Historiker ferner, als abstracte Sätze von außen her in seinen Stoff hineinzutragen. Und das führt uns auf die merkwürdigste Eigenthümlichkeit Ranke’s, die von jeher die verschiedenste Beurtheilung erfahren hat.
Immerdar nämlich hielt er fest an jenem Ideale der reinen Geschichte, wie er es ursprünglich ergriffen, daß sie nur zu sagen habe, wie es eigentlich gewesen, nur das Ereigniß in seinem wirklichen Verlaufe herausarbeiten müsse aus der Vergessenheit oder den Irrthümern der Ueberlieferung; alles Urtheilsprechens aber nach unseren eigenen Meinungen und Wünschen glaubt er sich streng enthalten zu müssen. Ueberaus gewissenhaft trachtet er dem Wahlspruche nach: „Ohne Groll oder Vorliebe!“ Man hat deshalb häufig seine Geschichtschreibung eine charakterlose genannt; und das wenigstens müssen wir bekennen: in den Ranke’schen Schriften scheint die bewegliche Seele des Autors an den Felswänden der Ereignisse zu zerrinnen. Man wird dabei wohl an die Weise Goethe’scher Romane, etwa die Wahlverwandtschaften, erinnert: die Begebenheit rollt an uns vorüber wie eine Naturerscheinung, unbekümmert, ob wir Ja oder Nein dazu sagen.
Zwar muß man sich die Objectivität Ranke’s nicht durchaus als eine grenzenlose vorstellen; erstaunlich unparteilich geht er namentlich in confessionellen Fragen zu Werke; denn so innig er in der deutschen Geschichte das Wesen Luther’s erfaßt, so großartig weiß er in seinen Päpsten die katholische Restauration zu schildern, wodurch ihm freilich die Ehre, auf dem römischen Index zu prangen, nicht erspart worden. Allein neben jener inneren Religiosität, die wir an ihm wahrnehmen, verräth sich uns doch auch noch eine andere persönliche Seite des Verfassers, ich meine die entschiedene Vorliebe für die große politische Erscheinung seiner Epoche, für die legitime Monarchie, das starke Königthum, das im Besitze der höchsten Autorität, erhaben über den Hader der Parteien, den Bürgerzwist schlichtet, die Geister führt, das Königthum, wie es in Heinrich dem Vierten, in Elisabeth, in Friedrich dem Großen hervorleuchtet. Von dieser warmen Theilnahme fallen sogar einige Strahlen auf minder würdige Vertreter der legitimen Selbstherrschaft, wie z. B. auf die letzten Stuarts, bei denen uns doch nicht einmal große politische Gedanken für die dürftige Treulosigkeit ihres Charakters entschädigen.
Auch wird man gerade, wenn man die Geschichte der englischen Revolution bei Ranke liest, an einen anderen Vorwurf erinnert, der ihm zuweilen gemacht worden, daß er von den tiefen Bewegungen des eigentlichen Volksgeistes keine rechte Anschauung habe oder gebe. In der That, von der enthusiastischen Erregung der Massen ist in seiner Darstellung der Cromwell’schen Zeit gar wenig zu spüren; vielleicht hätte er überhaupt seine englische wie seine französische Geschichte treffender mit dem Titel „Geschichte der englischen, der französischen Monarchie“ bezeichnet. Dennoch beweist seine deutsche Geschichte, daß er gar wohl in den Kreisen des Volkes heimisch sein kann; die Abschnitte über den Bauernkrieg oder über die Reformation in den Reichsstädten und den Landgemeinden wird Niemand ohne herzliche Theilnahme lesen. Und ist nicht Luther selbst die populärste Gestalt, der größte Volksmann, der jemals unter uns aufgetreten? Es bleibt daher diese deutsche Geschichte, wenn auch die der Päpste durch den fast romanhaften Reiz der Contraste auf den ersten Blick noch glänzender sich ausnimmt, dennoch Ranke’s gediegenstes Werk, eine wahrhaft nationale That, für die ihm jeder Deutsche zu Dank verpflichtet ist.
Zum Schluß möchte es an der Zeit sein, von Ranke’s Stellung zur Gegenwart überhaupt zu reden. Seine großen Geschichten führen uns stets bis an die Schwelle des heutigen Weltalters, ohne sie zu überschreiten. Hält er vielleicht die Ereignisse der Revolutionszeit für noch nicht reif zur historischen Behandlung? Im strengsten Sinne verstanden mag das seine Ansicht sein. Wie sollte aber ein so geistreicher, alles Menschliche so scharf beobachtender Mann nicht auch den lebendigsten Antheil an der werdenden Geschichte der Gegenwart nehmen? Es wäre, als ob ein Geognost vor den noch andauernden Umbildungen der Erdrinde die Augen schlösse. Kein Wunder daher, daß Ranke eben die neueste Geschichte am häufigsten zum Gegenstande seiner Vorlesungen erkoren. Noch mehr: er unternahm es, in den Jahren 1832 bis 1836 im Vereine mit Savigny u. A. eine eigene historisch-politische Zeitschrift herauszugeben, in der Absicht, denkende Zeitgenossen zu belehren, auf daß sie ihre Zeit nicht nach irgend einem Begriffe, sondern in ihrer Realität zu verstehen und mitzuleben vermöchten. Die Zeitschrift wendet sich an die Menge der wohlgesinnten, ruhigen, verständigen Männer in Deutschland, welche Fähigkeit und Neigung haben, das Wesen von Scheine zu unterscheiden; ihrer Ueberzeugung einen Mittelpunkt zu geben, ist der Ehrgeiz des Verfassers. Es ist deutlich, daß er damit einen Damm aufrichten wollte wider die seit den Tagen der Julirevolution immer mächtiger andringende Fluth der liberalconstitutionellen Ideen. Die Gährung in den constitutionellen Staaten Süddeutschlands, die Aufregung der politischen Presse ist ihm widerwärtig; den Ausdruck der Gedanken möchte er freigegeben, den Ausbruch der Leidenschaft jedoch verhütet sehen. Den verschiedenen Staaten Deutschlands eine straffe Einheit unter gleichen poetischen Formen auflegen, das heißt ihm die naturwüchsige Besonderheit der einzelnen Provinzen gefährden. „Wollt ihr die Unterschiede vernichten,“ lautet sein Warnruf, „hütet euch, daß ihr nicht das Leben tödtet!“
Man wird dabei unwillkürlich an die Anschauungen Friedrich Wilhelm’s des Vierten erinnert. Die Nation aber konnte diesen Mahnungen ihres großen Geschichtschreibers unmöglich mit der Theilnahme lauschen, die sie ihm sonst geschenkt; sie war sich bewußt, mit ihren freisinnigen Wünschen nach einem nothwendigen und idealen Ziele zu streben; von wannen ihr der Anstoß dazu gekommen, verschlug ihr nichts. Fast schien es, als ob Ranke, der sich so sorgfältig gehütet, die Gegenwart in die Vergangenheit hineinzutragen, hier gleichsam den umgekehrten Anachronismus beginge, dem heutigen Dasein vom Standpunkte früherer Epochen aus Maß zu geben. Auch waren mit solchen Worten die Stürme nicht mehr zu bannen. Ranke ist, so viel wir wissen, seit 1836 nicht wieder als politischer Schriftsteller hervorgetreten – hernach erst hat er seine bedeutendsten und umfangreichsten historischen Arbeiten vollbracht – und wie viel hat nicht seitdem das deutsche Volk selber an politischer Erfahrung gewonnen! Wer wollte da noch rechten über die Meinungen der dreißiger Jahre? –
Wir haben versucht, was wir dem Schriftsteller verdanken, kurz andeuten; ein eigenes Buch würde es erfordern, wollten wir noch alle die musterhaften kleineren kritischen oder historischen Aufsätze aus Ranke’s Feder besprechen, deren unter anderen auch jene Zeitschrift eine Menge enthält. Noch minder aber können wir seiner Lehrthätigkeit in den folgenden Bemerkungen gerecht werden, denn die Wirksamkeit eines Lehrers, auf der persönlichsten Anregung beruhend, bleibt immerdar unermeßlich. Mehr denn vierzig Jahre sind es schon, daß Ranke an der Berliner Hochschule die [103] Geschichte vorträgt, zumeist die neuere und neueste, allein auch die alte fehlt nicht durchaus, und vorzügliche Theilnahme schenkt er dem Mittelalter, dessen tiefe und warme Auffassung, wie die Einleitungen in allen seinen Büchern bekunden, ihn besonders auszeichnet. Dem Mittelalter, und zwar dem deutschen, hat er denn auch die historischen Uebungen bestimmt, die er seit Ostern 1833 leitet. Hier haben sich die Waitz, Sybel, Giesebrecht, Köpke, Dönniges, Wilmans, Hirsch, Jaffé, O. Abel und Wattenbach gebildet; von hier gingen die Jahrbücher des deutschen Reichs unter dem sächsischen Hause aus, in denen zum ersten Male das echte Metall der Monumenta Germaniae ausgemünzt und auf den Markt geworfen ward. Wenn jetzt dies Unternehmen von der Münchener historischen Commission in größerem Umfange weitergeführt wird, so übt auch da Ranke den vorwaltenden Einfluß aus, der ihm gebührt. Dort sieht er denn auch andere Wünsche der Erfüllung zureifen, die er einmal ausgesprochen: man sammelt endlich die Acten unserer Reichstage, man schreibt die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Nach solchen Vorbereitungen wird es dereinst möglich sein, eine alle Epochen umfassende, wahrheitsgetreue, gründlich erforschte und den Leser fesselnde Geschichte unseres Volkes zu schreiben, eine Aufgabe, die selbst Ranke heute noch nicht lösen zu können meinte.
Wie muß es ihn erfreuen, nun seine Schüler, ja seiner Schüler Schüler, die Enkel, möchte man sagen, seines Geistes, in emsiger Arbeit dazu begriffen zu sehen! Er selbst aber legt mit nichten die Hände in den Schooß: noch im Sommer 1865 ging er, ein Siebenziger, über den Canal, über die irische See, um für die britische Geschichte in den Archiven zu studiren; noch jetzt verbringt er seinen Tag inmitten seiner Bücher, forschend und schreibend. Ein kleiner Mann, unansehnlicher Gestalt – zu scheinen hat er nie verstanden – aber unter der mächtigen Stirn leuchten die blauen Augen in lebendiger Klarheit. Er trägt frei vor, in den Stuhl zurückgelehnt und doch immer in Bewegung; bald schnell die Worte hervorstoßend, lebhaft, wie der Gedanke in ihm entspringt, bald wieder sinnend, zweifelnd, zaudernd, um bedächtig und sorgsam das Urtheil zu wägen, den Ausdruck abzumessen. Möge er noch lange bleiben, wie er ist, fröhlich, kräftig, rührig, und weiter wirken und schaffen, sich selber zur Freude, dem deutschen Namen zur Zierde, dem jüngeren Geschlechte zur Nacheiferung![1]
| Was Du nicht willst, daß man Dir thu’, |
| Das füg’ auch keinem Andern zu. |
Wer Theater und Concerte besucht, von dem sollte man doch glauben, daß er einige Bildung und also auch Kenntniß von den Rücksichten hätte, die man in Kunsttempeln seinem Nächsten schuldig ist. Allein dies ist ein falscher Glaube, da gar nicht wenige von den echten und unechten Kunstprotzen Anderen den Kunstgenuß in ganz rücksichtsloser Weise stören. Sie selbst, die Störenfriede männlichen und weiblichen Geschlechts, gerathen aber gewöhnlich außer sich, wenn sie durch irgendwelche Allotria aus ihrem wirklichen oder erheuchelten Kunsttaumel (nicht selten nur ein Dusel aus Langeweile) erweckt werden.
Was den erheuchelten Kunstgenuß, sowie das angebliche Verständniß für Kunst betrifft, so machen sich diese heutzutage in einer so widerwärtigen Weise breit, daß Jedem, der sich der Kunst mit einigem Interesse zugewendet hat, Concerte und Theater geradezu verleidet werden. Leute, für deren unmusikalische Ohren eine Polka ein weit größerer Schmauß ist, als eine Mozart’sche Ouvertüre oder eine Beethoven’sche Symphonie, sieht man nach beendigter Aufführung solcher classischer Musikstücke vor scheinbarem Vergnügen außer sich gerathen und sich die Hände wund klatschen, obschon sie während der Aufführung das Gähnen und Einschlafen nur mit Mühe bewältigten. – Wenn in der Oper tremulirende Sängerinnen oder Sänger auch noch so gaumig und unrein singen, brüllen aber zeitweilig hohe Töne heraus oder machen recht lange meckerige oder sogenannte Bockstriller, so nimmt der Beifall kein Ende und jenen eingebildeten und meist ziemlich anspruchsvollen Künstlern, denen man eigentlich Marken zu Gesangsstunden zuschicken sollte, spendet man wohl gar noch Blumen, Lorbeerkränze und Gedichte. – Ein Heldenspieler, wenn er in seinem gezierten Komödiantenpathos auch noch so unverständig declamirt, aber in seiner Rolle stark aufträgt und dabei sein Aeußeres in schönes Licht zu setzen weiß, wird dadurch für das dumme Publicum ein stets gern gesehener und beklatschter Liebling, während er die Verständigen zur Verzweiflung bringt. – So werden die Künstler durch das Publicum selbst für Selbsterkenntniß und das Streben nach Vervollkommnung immer unzugänglicher gemacht.
Mit dem zu späten Kommen, vorzugsweise der becrinolinten, weit vom Eingange beplatzten Damen, beginnen in der Regel die Rücksichtslosigkeiten und endigen nicht selten erst mit dem zu zeitigen Fortgehen, wodurch den Umsitzenden das Finale oft recht gründlich verdorben wird, und warum? Nur damit der voreilig Aufständische in der Garderobe recht schnell zu seinen Ueberkleidern und in seine Batarde gelangt. – Diese Art zu kommen und zu gehen ist aber eine um so größere Unart, je geräuschvoller sie geschieht und je entfernter von der Thür der Kunstgenußstörer seinen Platz hat, je mehr Kniee und Beine (mit ihren Frostballen und Hühneraugen) also dabei gedrückt, gestoßen und getreten werden. – Und wer sind denn nun Die, welche so oft zu spät kommen? Trödelmätze und Eitelinge sind’s, die mit Frisiren, Schleifebinden, Einschnüren, Handschuhanziehen, Schwatzen u. s. f. nicht fertig werden können. – Wer wirklich, in Folge eines unabänderlichen Umstandes, erst nach Anfang einer Production zu kommen gezwungen ist, der merke sich wenigstens: daß er die Thür so geräuschlos als nur möglich zu öffnen und zu schließen, daß er (zumal wenn seine Stiefeln knarren und hohe Absätze haben) recht sanft aufzutreten, daß er eine Pause oder ein Forte zum Platz nehmen abzuwarten und die Sitzklappe hübsch leise niederzulegen, daß er seinen Platz stillschweigend und nicht nach rechts und links laut grüßend oder gratulirend einzunehmen verpflichtet ist. Und werden denn diese Rücksichten, die doch jeder gebildete Mensch nehmen sollte, auch wirklich immer genommen? Mit nichten. Auch während der spannendsten Momente eines Stückes drängen sich die meisten der Spätkommer zwischen Stehenden und Sitzenden hindurch, ganz laut ihren Platz fordernd, nicht etwa leise um Entschuldigung bittend.
Beim Erwähnen des Zuspätkommens kann Verfasser nicht umhin, eine kleine Abschweifung aus dem Concert- in den Speisesaal zu machen, weil hier einzelne zum Diner oder Souper Eingeladene durch ihr gar zu spätes Eintreffen ihren pünktlichen Mitessern großes Magenleid verursachen können. Man beobachte nur einmal eine zum Abendessen um acht Uhr eingeladene Herrengesellschaft, in welcher um neun Uhr noch der Vierzehnte fehlt und die Mägen vor Leerheit knurren. Wie fängt da die Unterhaltung an immer gezwungener und matter zu werden; wie auffallend wird da nach der Uhr und wie sehnsüchtig nach der Thür gesehen, durch die aber anstatt des Erwarteten immer und immer wieder entweder der unruhig gewordene Hausherr oder das theeservirende Wesen mit dem unerwünschten heißen Naß hereintritt; wie explodiren da zeitweilig ganz unchristliche Verwünschungen zwischen trockenen Lippen, und welche Angst steht man nicht wegen der vorsorglichen Hausfrau und wegen der nicht unmöglichen Verderbniß des Essens aus! Um nun allen solchen schlimmen Folgen dieses Zuspätkommens zu begegnen, möchte Verf. den Rath geben, daß man doch auf der Einladungskarte „die Zeit des Zutischegehens“ oder, um uns allmählich mehr an die allgemeine Wehrpflicht zu gewöhnen, die Zeit, „wo zum Essen angetreten wird“, bestimme. Wer dann zur angegebenen Tischzeit nicht vorhanden ist, der mag nachexerciren. – Und die Moral? Wo sich Menschen zu einer bestimmten Zeit zum Genießen vereinigen [104] wollen oder sollen, da sei Jeder zur rechten Zeit auf dem Platze.
Im Concert und Theater bedenken nun Viele nicht, daß sie mit ihren Nächsten in nächster Nähe sich befinden, und werden ihrer Nachbarschaft gar nicht selten auf mannigfache Weise recht unangenehm. Zuvörderst sind es ebenso wohl- wie übelriechende Gerüche, die der Umgebung furchtbar lästig werden können. Zu den ersteren gehört ganz besonders das abscheuliche kopfschmerzmachende Patchouli, welches stets den Verdacht gegen den Parfümirten erregt, daß er etwas Stinkendes an sich hat, was er vertuschen will. Unter den übelriechenden Störungen sind aber, abgesehen von diesem und jenem Schweiße, die aus dem Munde sich entwickelnden Gerüche am wenigsten erträglich. Und wie oft kommt es nicht vor, daß sich unser Nachbar ganz nahe zu uns hinneigt, um uns mit seinem Munde ein „himmlisch“ in’s Ohr zu flüstern, während er gleichzeitig unserer Nase einen „höllischen Gestank“ zuduftet. Auch Raucher sind nicht gerade die angenehmsten Nachbarn, da an ihnen manchmal Alles nach Tabak riecht. Und die Moral? Wo Menschen nahe bei einander weilen, da halte Jeder auf einen reinen Dunstkreis und ganz besonders im Concert und Theater. – Es ist doch wahrlich nicht zu viel verlangt, wenn man in Kunsttempeln, wo Auge und Ohr schwelgen, die Nase nicht maltraitirt zu haben wünscht. Es dürfte deshalb den gebildeteren Besuchern des Theaters und Concerts wohl zu empfehlen sein, daß sie sich vor dem Besuche noch Mund und Zähne reinigen, nicht kurz vorher Käse, Meerrettig oder Zwiebeln essen, und daß sie nach Tabak oder Schweiß riechende Kleidungsstoffe ablegen.
Recht widerwärtig sind auch solche Nachbarn im Concert und Theater, die sich während der Aufführungen nicht ganz still verhalten, sondern mit ihrer Umgebung schwatzen, laut kritisiren, Melodien leise mitsingen, mit dem Fuße den Tact markiren, auf und mit dem Stuhl lebhaft agiren u. s. w.
Das Schwatzen ist leider nicht blos den Damen, sondern auch vielen Herren eigen, und den Stoff dazu liefert in der Regel dieser oder jener, zur Kunstproduction gar nicht gehörige lebende oder todte Gegenstand. Bei den Damen dienen meistens die Anhübschungsgegenstände, sowohl an den Künstlern wie an den Nachbarn, bei den Herren dagegen die angehübschten Theile zum Stoffe des störenden Gesprächs, was gar nicht selten trotz alles Pst’ens kein Ende nehmen will. – Das laute Kritisiren ist in den meisten Fällen eine Unart Solcher, die eigentlich über Kunst und künstlerische Leistungen gar nicht mitreden sollten und deren Weisheit gewöhnlich aus Journalkritiken stammt. – Das hörbare Mitsingen setzt die Nachbarn stets, aber ganz besonders dann in Verzweiflung, wenn es gegen die Melodie und die Musik überhaupt verstößt. Und gerade der Unmusikalische ist es meistens, der sich als überflüssiger Sänger unangenehm macht. - Das Tactpochen mit dem Fuße gehört, zumal wenn es gegen den Tact geschieht, durchaus nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens im Theater oder Concert, wohl aber zu den Rücksichtslosigkeiten, die wenig Tact zeigen. – Daß das stete Hin- und Herrutschen, das Rechts- und Linkswenden, das Vor- und Rückwärtsbeugen, das mit der Hand Auf- und Abfahren eine für die Nachbarschaft höchst beunruhigende Wirkung ausübt, möge vorzugsweise den quecksilberigen Damen gesagt sein.
Ueberlaut zu husten, und zu niesen ist ebenfalls, weil störend, rücksichtslos; man halte doch dabei das Tuch vor Mund und Nase; auch das Gähnen ist so gut als möglich zu verbergen. – Das geräuschvolle Umblättern des Textes könnte wohl auch wegfallen oder doch weit behutsamer und leiser als gewöhnlich geschehen, denn daß das dadurch erzeugte Rauschen eine angenehme Begleitung eines Pianissimo wäre, wird wohl Niemand behaupten. – Und die Moral? Wo durch’s Ohr sich Herzen laben, will man Still’ und Ruhe haben. – Beiläufig sei auch der Unart Erwähnung gethan, welche Manche insofern gegen die ihnen zur Seite Sitzenden begehen, als sie denselben den Rücken zukehren und nicht selten damit die Aussicht versperren.
Schließlich sollen noch Die, welche beim Kommen oder Gehen Diesem oder Jener die Hand darreichen, darauf aufmerksam gemacht werden, daß es höchst unschicklich und beleidigend ist, nur einen oder zwei Finger, oder auch die starr ausgestreckt bleibende Hand dem Bekannten hinzuhalten. Wenn überhaupt ein Handgeben, und zwar wo möglich barhändig, stattfinden soll, so sind stets die Hände mit gebogenen Fingern (wie beim Händedrucke) in einander zu legen.
Und nun noch ein Wort zu Denen, die sich über meine erste[WS 2] und wahrscheinlich auch über diese zweite Strafpredigt gegen rücksichtslose Leute ennuyiren und raisonniren. Ihnen gebe ich auf den Kopf schuld, daß sie ganz gewiß gegen ihre Mitmenschen in verschiedener Weise rücksichtslos handeln und, weil sie die Wahrheit nicht hören wollen, den Verfasser ganz mit Unrecht der Rücksichtslosigkeit zeihen. Es wird aber trotzdem fortgestrafpredigt.
Man rühmt den Franzosen mit Recht eine große Andacht für ihre Nationalgrößen nach. Wer aber hat das geringe Häuflein gesehen, das sich jüngst dem Friedhof von Montparnasse zu bewegte, als eine Königin der Kunst zu Grabe ging, eine Künstlerin, welcher drei Geschlechter Ruhmeskränze wanden, eine Schauspielerin, für die Schlachten geschlagen worden sind, ein Weib, das gekrönte Häupter, den modernen Cäsar, zu seinen Füßen sah, eine Frau, welcher die besten Geister des Jahrhunderts ihre Huldigungen dargebracht haben! Dieser unscheinbare Sarg umfaßte Fräulein Georges, für welche, wie für Josua, die Sonne still stand und deren Lustren nicht mehr zählten, als für vergängliche Schönheit ein Jahr. Diese Künstlerin hatte das Unglück, nicht, wie die Rachel, im Augenblicke zu sterben, wo ihr Ruhm auf seinem Höhepunkte stand. Die Arme war bereits vergessen, ihre ruhmreiche Laufbahn reicht so weit zurück, daß man sie längst todt glaubte. Ja, diese berühmte Georges war verschollen, obgleich sie noch vor wenigen Jahren, im Greisenalter, ihre letzten dramatischen Lorbeern pflückte.
In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war ein gewisser Weymar Capellmeister und Director des Theaters in Bayeux und seine Frau die Soubrette der Gesellschaft. Dies waren die Eltern der Künstlerin Marguérite Georges, die 1786 geboren wurde. Man erzählt, daß die Geburtswehen über Frau Weymar kamen, während ihr Mann am Dirigentenpulte im Theater saß, wo gerade der Tartüffe von Molière aufgeführt wurde. Der zärtliche Gatte, welcher die Katastrophe nahe wußte, fühlte sich plötzlich von unsäglicher Angst erfaßt; zur Verwunderung seiner Musiker legte er mitten in der Symphonie, wie man damals die Zwischenactsmusik nannte, seinen Tactirstock nieder und rannte zum Theater hinaus. Ein dem Director nachgesandter Bote erklärte das befremdliche Betragen des Capellmeisters; er machte Meldung von dem Familienereignisse und fügte hinzu, daß die Mutter und das Kind sich des besten Wohlseins erfreuen. Gleich nach beendigter Vorstellung eilten die Musiker mit ihren Instrumenten vor die Wohnung ihres gern gelittenen Directors und bezeigten ihm ihre freudige Theilnahme durch ein Ständchen, das sie der Wöchnerin brachten. Die Nachricht des Boten aber war eine verfrühte und Frau Weymar stöhnte und ächzte oben im dritten Stockwerke, während unten ihre Niederkunft als eine glücklich vollzogene in der erwähnten harmonischen Weise begangen wurde. Vergeblich suchte der verzweifelte Weymar die ungelegenen Jünger Apollo’s fortzuweisen. Diese mißverstanden die heftigen Geberden, sie bliesen und geigten um so eifriger darauf los, je lebhafter von oben abgewehrt wurde. Die kleine Marguérite Weymar kam während des Concertes zur Welt. So geschah, wie gesagt, im Jahre 1786 zu Bayeux. Wie kommt es nun, daß Amiens sich lange Zeit rühmte, die Geburtsstadt der berühmten Schauspielerin zu sein?
Herr und Frau Weymar gefielen sich nicht lange in der Normandie und sie wandten ihren Schritt nach der Hauptstadt der Picardie, nach Amiens. Auf der Bühne desselben war es, wo Mimi Weymar als Kind ihre ersten Versuche machte. Die kleine [105] Mimi war bald eine Stadtberühmtheit geworden und der Stolz der Bewohner von Amiens. Später, 1801, wurde ihr durch eine einflußreiche Gönnerin, die das begabte Kind auf der Bühne gesehen hatte, eine Freistelle im Conservatorium in Paris und ein Gehalt von zwölfhundert Franken ausgewirkt.
So wanderte denn Fräulein Georges mit ihrer Mutter nach Paris. Das Théâtre français war bei ihrem ersten Auftreten überfüllt, denn die Nachricht hatte sich verbreitet von einem neuen Künstlerstern, und von einer unvergleichlichen Schönheit, allein hinreichend der jungen Anfängerin alle Herzen zu gewinnen.
Schon damals waren alle Berichte voll von der außerordentlichen Schönheit der Künstlerin. Man höre aber erst, wie sie nachmals der Maler in Worten, der Dichter Théophile Gautier, in ihrer Reife und Vollendung beschreibt: „Fräulein Georges gleicht zum Verwechseln einer Medaille von Syrakus oder einer Isis auf einem äginetischen Basrelief. Die mit unvergleichlicher Reinheit und Feinheit gezeichnete Wölbung der Brauen breitet sich über ein Paar schwarzer Augen aus voll Flammen und tragischen Blitzen. Die schmale, gerade Nase, von einem schiefliegenden, leidenschaftlich anschwellenden Nasenloche durchschnitten, schmiegt sich an die Stirn in einer Linie von prächtiger Einfachheit. Der Mund ist mächtig, an beiden Winkeln gewölbt, stolz wegwerfend, wie jener der Rachegöttin, die der Stunde harrt, wo sie ihren Löwen mit den ehernen Klauen entfesselt. Dennoch entblüht diesem Munde ein reizendes Lächeln voll kaiserlicher Anmuth, und wenn er zarte Neigungen aussprechen will, würde man nicht glauben, daß ihm soeben der antike Fluch oder der moderne Bann entfuhr. Das Kinn voll Kraft und Entschlossenheit rundet sich mit Festigkeit empor und endigt in einem majestätischen Umrisse dieses Profil, das mehr einer Göttin, als einer Frau angehört. Wie alle schönen Weiber des Heidenkreises, hat Fräulein Georges eine volle, breite, an den Schläfen ausgebauchte Stirn, aber sie ist wenig hoch, ziemlich ähnlich jener der Venus von Milo, eine eigenwillige, wollüstige, mächtige Stirn. Eine bemerkenswerthe Eigenheit des Halses von Fräulein Georges ist es, daß er, statt innerlich dem Nacken zu sich abzurunden, einen durchwegs ausgebauchten Umriß bildet, welcher ohne alle Krümmung von den Schultern bis zum Kopfe verläuft. Das ist das untrügliche Zeichen eines athletischen Temperamentes, wie es beim farnesischen Hercules seinen Gipfelpunkt erreicht hat. Der Ansatz der Arme hat etwas Furchtbares durch die Kraft der Muskel und die Gewalt des Umfangs. Ein Armband von Fräulein Georges würde einer Frau von mittelmäßigem Leibe als Gürtel dienen können. Aber diese Arme sind sehr weiß, sehr rein und laufen in ein Gelenk aus von kindlicher Zartheit, in winzige Händchen, besät von Liebesgrübchen, wahre königliche Hände, geschaffen, den Scepter zu tragen und den Dolch des Aeschylos und Euripides zu schwingen.“
Wenn die Besten zu dieser dithyrambischen Höhe sich verstiegen, was Wunder, wenn gemeine Sterbliche vom Rausche der Bewunderung zu ungewohnt leidenschaftlichen Kundgebungen hingerissen wurden? Mit dem ersten Augenblicke ihres Auftretens begann jene Reihe von siegreichen Schlachten, von Prüfungen jeder Art, von Wanderungen und abenteuerlichen Fahrten durch das Leben und die Kunst, welche die merkwürdige Laufbahn dieser Schauspielerin ausfüllten. Schon bei ihrem zweiten Erscheinen als Amenaide in Tancred brach der Krieg zwischen den Georgiens und den Carcassiens aus. Mit dem letzteren Namen wurden die Verehrer der durch ungewöhnliche Magerkeit ausgezeichneten Schauspielerin Duchesnois verspottet, da Carcasse im Französischen Gerippe bedeutet. Es war ein Kampf, der in den Journalen und in Flugschriften mit der Feder, im Parterre mit den Fäusten und außerhalb des Theaters mit dem Degen ausgekämpft wurde. Es ging oft heiß dabei her, und als die Georges unmittelbar nach ihrer Nebenbuhlerin in der Phädra auftrat, arbeitete die Pfeife der Carcassiens so gewaltig, daß man im vierten Acte die Schauspielerin ohnmächtig vom Schlachtfelde fortbringen mußte.
Nur ein wirkliches Talent kann Stürmen, wie diese, widerstehen, Schönheit allein kann nicht zum Siege in solchen Kämpfen führen. Aus jener Schlacht ging die Georges um einen Zoll größer hervor. Diese Triumphe auf dem Theater änderten indeß wenig in ihrer Lage, sie blieb Jahre lang in ihrer kleinen Wohnung des Hotel Peru; vertraute Freunde sahen wohl die große Tragödin im einfachen Nachtkleide vor einem Linsengericht sitzen. Aber auch das wirkliche Peru sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein polnischer Fürst, Sapieha, ein Mann von ungewöhnlichem Reichthume, ein Bewunderer der Künstlerin, beschenkte diese mit fürstlicher Freigebigkeit und richtete ihr eine königliche Wohnung ein. Alexander Dumas, der sich nicht gern eine Gelegenheit entschlüpfen ließ, einen Scandal zu erzählen, betheuert, daß die Huldigung des polnischen Fürsten nur der Schauspielerin galt und im Uebrigen stets eine uneigennützige, platonische geblieben ist. Aber Anbeter mit mehr Ansprüchen stellten sich ein; Lucian, der Bruder des ersten Consuls, lag zu den Füßen der schönen Bühnenkönigin. Seine Bewerbung machte Eindruck, sie wäre vielleicht auch nicht ohne Erfolg geblieben, hätte der verliebte Bruder des Helden von Arcole nicht gegen diesen Gott des Tages selbst zu kämpfen gehabt.
Eines Abends erschien ein Bote, ein gewöhnlicher Diener des ersten Consuls – damals gab es noch keine gräflichen Liebesherolde, keine Bacciochis, derlei Sendungen zu erfüllen – um Fräulein Georges nach St. Cloud zu bescheiden. Die aus dieser Zusammenkunft folgenden zärtlichen Beziehungen zu Bonaparte waren von Dauer und der Kaiser Napoleon zeigte sich den gewaltigen Reizen dieser imperialen Schönheit gegenüber nicht unempfindlicher, als früher der erste Consul. Josephine blieb der Künstlerin trotzdem gewogen; sie machte ihr einen mit echtem Golde gestickten königlichen Mantel zum Geschenk, gleichsam als wollte sie die Blöße bedecken, die sich ihr Gemahl gab, vielleicht auch um der nicht zu großen Freigebigkeit des kaiserlichen Helden zu Hülfe zu kommen. Auch Hortense Beauharnais, die Mutter Napoleon des Dritten, war von Anfang her eine Beschützerin der Georges. Dankbar blieb diese ihrem Cultus für die Napoleoniden auch nach der Tragödie von Waterloo treu.
Als Zeichen der Zeit sei hier Folgendes erzählt. Die Begegnung zweier Berühmtheiten von dem Kaliber der Georges und Bonaparte’s konnte in einer Stadt wie Paris kein Geheimniß bleiben. Kurz nach dem ersten Besuche der Schauspielerin in St. Cloud kam der Consul in’s Théâtre français, um einer Vorstellung von Corneille’s Cinna beizuwohnen. Als Fräulein Georges, welche die Rolle der Emilie spielte, zu der Stelle kam: „Si j’ai séduit Cinna, j’en séduirai bien d’autres,“ (Habe ich Cinna in Fesseln geschlagen, so werde ich wohl noch Andere fesseln) brachen die Zuschauer in lebhaften Beifall aus, indem alle Blicke nach der Loge des Consuls sich richteten.
Mit jedem Tage stieg die Georges in der Gunst der Pariser höher, eine jede ihrer Schöpfungen bezeichnet eine neue Eroberung auf dem Gebiete der Kunst. Sogar Artaxerxes, die alberne Tragödie von Delieu, wurde, Dank sei es ihrer Darstellung, bei der ersten Vorstellung als ein Meisterwerk begrüßt. Am Abend der zweiten Vorstellung trat der Regisseur vor das Publicum und machte die Mittheilung, Fräulein Georges sei spurlos aus Paris verschwunden. Eine andere Schauspielerin mußte die Rolle der Flüchtigen aus dem Buche vorlesen. Die Flucht wird verschieden erklärt. Die Einen sagen, die Schauspielerin hätte durch Mangel an Verschwiegenheit beleidigt und sei dem Zorne des Kaisers ausgewichen. Andere behaupten, sie habe sich vom Tänzer Duprat entführen lassen. Wenigstens meldeten die Blätter damals das gleichzeitige Verschwinden des Tänzers und erzählten, derselbe sei in Frauenkleidern über die Grenze entkommen. Beide wurden vergeblich verfolgt. Die Georges taucht zuerst in Wien wieder auf (1808) und erscheint bald darauf in Petersburg, wohin sie glänzende Anerbietungen gerufen hatten. Sie gab zuerst acht Vorstellungen bei Hofe und trat hierauf im großen Theater auf.
Ihr Erfolg in der russischen Hauptstadt war nicht geringer als in Frankreich. Die französische Schauspielerin wurde mit Geschenken und Ehrenbezeigungen überhäuft; Alles huldigte ihr, vom Kaiser bis zum letzten Edelmann. Alexander zeichnete sie in jeder Weise aus. Eines Tages begegnete er der Künstlerin auf einer schmalen Straße, und indem er ihrem prächtigen Viergespann höflich aus dem Wege fahren wollte, stürzte er mit seinem Wagen in einen Graben. Die Georges stieß einen Schrei des Entsetzens aus; da stand der Czar, der sich nicht verletzt hatte, bereits an ihrem Wagenschlage und sagte ihr lächelnd: „Also Sie haben mich tödten wollen, das ist eine Verschwörung; doch seien Sie ruhig, ich werde dem Kaiser nichts davon sagen.“
Trotz Ruhm und Vermögen sehnte sich Fräulein Georges wieder nach ihrer Heimath zurück. Die Ereignisse des Jahres 1812 duldeten sie vollends nicht mehr in Rußland. Als gute Französin und treue Anhängerin des Kaisers wollte sie das Frohlocken der Russen über den mißglückten Feldzug Napoleon’s des Ersten [106] nicht mit ansehen, und sie entfloh nach Schweden. Bernadotte und Frau von Staël, die aus Frankreich verbannte Schriftstellerin, nahmen ihre Landsmännin gastlich auf, und Fräulein Georges blieb bis zum August des folgenden Jahres in Stockholm. Bernadotte gab der Künstlerin eine Sicherheits- und Ehrenbegleitung bis nach Braunschweig, wohin sie dem Könige von Westphalen, Sr. galanten Majestät Jerôme Napoleon, wichtige Depeschen bringen sollte. Jerôme empfing die Georges, wie man es von diesem Verehrer des schönen Geschlechts erwarten durfte, doch sandte er sie gleich zu seinem kaiserlichen Bruder nach Dresden. Napoleon hatte eben einen Sieg über die Verbündeten erfochten, und gab sich die größte Mühe dessen Bedeutung zu übertreiben, um den in Frankreich erschütterten Glauben an seinen Stern wieder zu beleben. Die Bulletins im Pariser Moniteur stellten den über die Verbündeten Heere erfochtenen Vortheil als eine vollständige Revanche für die Niederlage in Rußland dar. Die Aufschneiderei in den amtlichen Berichten sollte durch Veranstaltung von großartigen Festlichkeiten glaubwürdiger erscheinen, und so wurden denn auch die Schauspieler des französischen Theaters nach Dresden berufen. Nur Talma wurde ausgenommen, da es an einer seiner würdigen Schauspielerin fehlte. So wie Napoleon jedoch durch einen der Künstlerin vorausgeeilten Boten erfahren, daß diese auf dem Wege nach Dresden sich befinde, ließ er eiligst auch Talma dahin kommen.
Fräulein Georges sah ihren kaiserlichen Anbeter seit ihrer Flucht zuerst in Dresden wieder. Dieser hatte damals zu viel Sorgen und Arbeit, um mit der Schauspielerin einen alten Zwist auszutragen. Was von einer Napoleon’s unwürdigen Beleidigung der Georges in deren Reizen gefaselt wird, ist jedenfalls unwahr. Wohl aber erzählte die Künstlerin später, daß sie, nach einer Vorstellung in Dresden zum Kaiser gebeten, vom Imperator, der am Tische saß und Depeschen schrieb oder in Betrachtungen vertieft in der Stube auf und ab ging, während einer ganzen Stunde lang sich vergessen sah, was sie in eine um so peinlichere Lage brachte, je bequemer sie es sich gemacht hatte. In Dresden, so sagt man, schmachtete auch ein anderer Kaiser und noch ein drittes gekröntes Haupt in den Fesseln der üppigen Schönheit. Die Georges und Talma gaben, inmitten der kriegerischen Ereignisse jener Zeit, fünfzig Vorstellungen in Deutschland, und erst im Monat November kehrten sie nach Frankreich zurück. Ein kaiserliches Decret setzte Fräulein Georges wieder in ihre Rechte als Mitglied des französischen Theaters ein. Wie Fräulein Mars blieb sie ihren napoleonischen Sympathien treu, und auch sie erregte das Entsetzen der königlichen Anhänger, als sie nach der Rückkehr der Bourbonen bei irgend einer festlichen Gelegenheit am offenen Boulevardfenster mit dem napoleonischen Symbole, einem Veilchenstrauß, am Busen sich zeigte. Sie wurde verklagt und hatte von Herrn von Duras, dem Edelmanne des Königs, welcher den Theatern vorstand, viele Neckereien zu ertragen; sie blieb dennoch Mitglied des Théâtre français bis 1816, wo sie, einen erbetenen und erlangten Urlaub eigenmächtig um mehrere Wochen verlängernd, ihre Entlassung erhielt.
Fräulein Georges benutzte jetzt ihre Unabhängigkeit, um während einiger Jahre in England und den französischen Provinzen Gastvorstellungen zu geben. In London wurde sie, wie früher in Deutschland und Rußland, der Gegenstand der schmeichelhaftesten Ovationen als Weib wie als tragische Darstellerin. Fünf Jahre darauf wurde sie wieder nach Paris berufen, und Ludwig der Achtzehnte ließ zu ihren Gunsten eine Vorstellung des Britannicus in der großen Oper veranstalten, welche gegen vierzigtausend Francs einbrachte. Die Künstlerin aber weigerte sich, wieder zum Théâtre français zurückzukehren, und ließ sich im zweiten französischen Theater, dem des Odeon, anstellen. Zuerst trat sie in ihren classischen Rollen auf, ihre gewohnte Anziehungskraft auf das Publicum ausübend.
Aber erst als Harel, ein ehemaliger Präfect des Kaiserreiches, die Direction des Odeontheaters übernommen, begann die bei Weitem glorreichere Hälfte ihrer theatralischen Laufbahn. Ihr Talent erfuhr eine gänzliche Umgestaltung, und die romantische Schule verdankte dieser ihrer Jüngerin, wie später Fräulein Dorval, ihre glänzendsten Theatersiege. Das waren ihre besten Leistungen, diese Schöpfungen von übernaturgroßen Gestalten. Die classische Tragödie sollte dem modernen Drama Platz machen, das dem Studium Shakespeare’s seinen Ursprung verdankt und durch jene unnatürlichen Uebertreibungen sich kennzeichnete, welche eine nothwendige Rückwirkung des den Fesseln der matten Nachahmung des griechischen Theaters entsprungenen Geistes war.
Das Odeon war indeß kein günstiger Boden für diese exotische Frucht, und erst als Fräulein Georges mit Harel in’s Theater der Porte St. Martin übersiedelte, blühten die dramatischen Erzeugnisse der französischen Jungromantiker in ihrer ganzen Ueppigkeit empor: Lucrezia Borgia, Maria Tudor, Marguérite de Bourgogne, Jeanne de Naples; Isabeau de Bavière, die Marquise Brinvilliers und wie all’ die medusenhaften Erscheinungen heißen, welchen die Georges durch ihre gewaltige Schönheit und durch ihre eben so gewaltige Darstellungskraft Lebenshauch einflößte. Sie ward dabei unterstützt durch Frederic Lemaitre, den unvergleichlichen Schauspieler, der geschaffen schien, der Georges im Drama zur Seite zu stehen, wie einst Talma in der Tragödie. Sie galvanisirte Dramen zu künstlicher Belebung, die ohne sie niemals bis zur letzten Scene gegangen wären und die heute bis auf den Namen vergessen sind. So war sie die eigentliche Dichterin, und unter ihrem mächtigen Hauche schwollen diese Ausgeburten einer krankhaften Einbildung auf, wie jene wasserstoffgefüllten Thiere aus Kautschuk, während sie ohnmächtig zusammenschrumpften, so wie die erhabene Kunst der Georges verstummte. Victor Hugo suchte seiner Künstlerin durch Lobeserhebungen zu danken, was sein dramatischer Ruhm ihr schuldet, und das in den seinen Stücken vorgedruckten Vorreden niedergelegte Urtheil des Dichters, so bestochen dasselbe auch klingen mag, darf von der aufrichtigsten Kritik mit unterschrieben werden:
„… Sie geht nach Belieben und ohne jede Anstrengung von der zarten Leidenschaft zum Schrecklichen über; sie begeistert zu Beifall und rührt zu Thränen, sie ist erhaben wie Hekuba und rührend wie Desdemona.“
Die in dem ganzen Wesen der Künstlerin ausgesprochene Herzensgüte verlieh ihren schrecklichsten Schöpfungen etwas Weiches, so daß in diesen Ungeheuern, in diesen Riesinnen des Verbrechens die Frauennatur doch immer wieder zum Durchbruch kam und ihren Gestalten einen Reichthum, eine Mannigfaltigkeit gab, welche den Zuschauer in unbeschreibliche Bewegung versetzte.
Die Romantiker sind verstummt, das Drama ist zum Melodrama herabgesunken, sowie das Lustspiel zur unkünstlerischen Photographie der Aeußerlichkeiten des geselligen Lebens. Die Georges, die Dorval, Boccage sind zu Grabe getragen, Lemaitre ist ein trauriger Schatten, eine trübe Erinnerung glänzender Zeit geworden, und auch den Dichtern ist mit dem Glauben an das Phantasieleben der poetische Hauch ausgegangen. Der Realismus hat die Octave hinabgestimmt, und die dichterische Kraft, welche den realen Boden, der die Grundlage auch unserer idealsten Bestrebung geworden ist, ausfüllen könnte, muß noch erstehen. Wenn die Franzosen erst Shakespeare bei sich so eingebürgert haben, wie wir in Deutschland, den wirklichen, echten Shakespeare ohne französische Abschwächung, dann wird die dramatische Literatur in Frankreich wieder einen Aufschwung gewinnen, welcher jene Verschmelzung des Realismus möglich macht, wie sie das Drama der Zukunft zu bewerkstelligen hat.
Was die Georges so ganz besonders auszeichnete, das war ihre blitzartige Uebersicht des Gesammtcharakters der darzustellenden Persönlichkeit. Mit nie dagewesenem Instincte vertieft sie sich sofort in ihre Heldin, und die unübertroffenen Einzelheiten und Schattirungen, welche sonst die Frucht der Berechnung zu sein pflegen, erstanden natürlich und folgerichtig, daß es uns wie ein Naturerzeugniß, wie ein Zauber anmuthete. Ihre künstlerische Zuversicht dem Publicum gegenüber war keiner ihrer wenigst bemerkenswerthen Vorzüge. Dem als Buridan debutirenden, von den Zuschauern verhöhnten Melingue ruft sie bei offener Scene laut zu: „Fahren Sie nur fort, Sie machen es ganz gut!“ das Publicum wird aufmerksam, läßt sich umstimmen und bricht in Beifallsbezeigungen aus. Melingue’s Sache war gewonnen.
Bei einer Wettvorstellung mit der Rachel nahm ein Anhänger der letzteren sich heraus zu pfeifen. Fräulein Georges tritt mit der ihr eigenen Majestät vor die Rampe und ruft: „Das ist wohl nicht für mich.“ Nicht enden wollender Beifall, Blumen und Kränze, die auf die Bühne flogen, war die Antwort auf diese Frage. Die Rachel fühlte sich so entmuthigt, daß sie es verweigerte, der Verheißung des Programms gemäß noch in einem anderen Stücke allein aufzutreten. Frau Viardot-Garcia mußte an ihrer Stelle eine Scene singen.
[107] Harel’s Theaterunternehmung ging jämmerlich zu Grunde. Ihren Freund zu retten, opferte Fräulein Georges ihr Vermögen auf, sie verkaufte ihre berühmten Diamanten und behielt nichts für sich. Harel konnte nicht mehr, wie früher bei ihren Wanderungen durch die Provinz, auf den Zettel setzen lassen: „Fräulein Georges wird ihre feinen Edelsteine tragen,“ oder: „An Fräulein Georges ist nichts falsch.“
Nach dem Sturze Harel’s gab Fräulein Georges im Gaieté-Theater Vorstellungen, wo sie die Folle de la Cité von Charles Lafont hundert Mal nach einander spielte. Später durchzog sie abermals Deutschland, kehrte nach Rußland zurück und eroberte noch vor den Westmächten die Krim. Seit dem Jahre 1842 lebte sie in Paris und trat nur zeitweilig im italienischen Theater, im Théâtre historique, und 1855 zuletzt im Théâtre français auf, während eines Ausflugs der Rachel nach Rußland. Es war ein Triumph wie zu ihren schönsten Zeiten; und doch konnten die Pariser zwischen der Ristori, der Rachel und der berühmten Greisin Vergleiche anstellen! Dupin, der bekannte französische Staatsmann und Rechtsgelehrte, sagte ihr damals: „Madame, Ihr Reich dauert noch immer fort,“ und Dupin verstand sich auf die Dauer von Regierungen. Sie bezog eine mäßige Pension von der Regierung und starb in beschränkten Verhältnissen.
König Ludwig von Baiern, als er vor mehreren Jahren durch Paris kam, hörte, die Georges werde auftreten, und kam auf den Gedanken, sie vorher zu besuchen. Er sah sie des Morgens ohne Schminke, von Runzeln bedeckt, mit erbleichtem Blicke. Enttäuscht und betrübt verließ er die ehrwürdige Ruine. Es schien ihm unmöglich, daß dieses zusammengebrochene alte Weib einen andern als einen widrigen Eindruck auf die Zuschauer ausüben könne. Die Neugierde trieb ihn jedoch in die Porte Saint-Martin, wo die Tour de Nesle aufgeführt werden sollte. Ludwig konnte seinen Augen nicht trauen; es schien ihm unglaublich, daß das abschreckende Gespenst vom Morgen diese herrliche Marguérite geworden sein sollte. „So mag denn Seine Majestät sich selber überzeugen, daß ich es bin,“ ließ ihm die Schauspielerin sagen, als man ihr die Zweifel des Königs hinterbrachte, „er wird sehen, daß Alles falsch an mir ist, sogar das Geschmeide, welches ich trage.“ Ludwig besuchte Marguérite von Bourgogne wirklich in ihrer Loge und sagte ihr persönlich, welch’ großen künstlerischen Genuß sie ihm verschafft. Am andern Tage schickte er ihr einen herrlichen Schmuck, den sie lange aufbewahrte. Es waren die letzten Edelsteine, die ihr dargebracht wurden.
Sie starb in Passy bei Paris, in der Nachbarschaft Rossini’s. Die Bewohner dieses Ortes sahen in der letzten Zeit, an schönen Sommertagen, die von drei Geschlechtern bewunderte Melpomene, gefolgt von zwei weißen Windhunden, mühsam einherschleichen.
Im letzten Spätherbst kam ich nach manchem Jahre wieder nach Dresden. Die Sehenswürdigkeiten des schönen Elbflorenz waren mir durch frühere Besuche bekannt, ebenso die herrlichen Umgebungen, neu aber waren mir die Befestigungen, welche die Preußen rings um Dresden theils schon angelegt hatten, theils zu vollenden im Begriff waren. Ein Freund, der eine Reihe von Jahren in St. Louis, im Staate Missouri, gelebt, daselbst die von General Fremont gegen die Rebellen aufgeworfenen Befestigungen genau kennen gelernt und nach den Stürmen des nordamerikanischen Bürgerkrieges in dem friedlichen Dresden angenehme Tage der Ruhe und des Friedens zu verleben gedacht hatte, in dieser seiner löblichen Absicht aber, im Jahre 1866 wenigstens, sich bitter getäuscht fand, führte mich gern zu einigen der Hauptschanzen und Batterien, welche gegenwärtig rechts und links von der Elbe die Befestigungen von Dresden bilden.
Der Krieg, welcher wieder einmal das Sachsenland heimgesucht hatte, lieferte in allen Kreisen den Hauptstoff zum Gespräche. Namentlich aber verhandelte man über die Preußen und die Zweckmäßigkeit der von ihnen angelegten Befestigungen. Die Mehrzahl der echten und etwas stark particularistisch gesinnten Dresdner tadelte kurzweg die Anlage der Fortificationen und behauptete, daß dieselben weiter nichts seien, als ein modernes Zwing-Uri, ein Zwing-Dresden. Allein Diejenigen, welche die Sache unbefangener und deshalb auch richtiger ansahen und beurtheilten, kamen meistens zu einem wesentlich anderen Schlusse. Als geschichtliche Thatsache steht fest, daß Georg der Bärtige im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts Dresden befestigt und daß der Kurfürst Moritz diese Befestigungen später verstärkt und vergrößert hat. Das schwere Kriegsunglück, welches die Stadt zu den verschiedensten Zeiten, namentlich im siebenjährigen Kriege und im Freiheitskriege von 1813, zu ertragen hatte, kann nur einestheils aus ihrer strategisch hochwichtigen Lage, anderntheils aus[WS 3] ihren mehr oder minder starken Befestigungen, die ein vorsichtiger Feind bei seinem siegreichen Eindringen in’s Land nicht ohne Weiteres übersehen konnte und durfte, zur Genüge erklärt werden. Unmöglich ist es ein bloßer „Zufall“ gewesen, daß Dresden so häufig der Gegenstand des erbittertsten Kampfes mächtiger Feinde wurde.
Unser erster Ausflug ging nach dem weltbekannten Waldschlößchen. Nachdem wir uns in der eleganten Restauration der Brauerei ein Töpfchen schäumenden Gerstensaftes hatten munden lassen, begaben wir uns auf das Plateau des sogenannten Meisenberges, der auf der Ostseite des Etablissements liegt. Dieser Platz ist auf dem beigegebenen Bilde leicht zu finden. Hier haben die Preußen fast an derselben Stelle, wo die Franzosen im Jahre 1813 die „Redoute de Bautzen“ errichteten, die geschlossene Redoute Nr. 6 mit einer sogenannten Redanspitze aufgeworfen. Die nächste Schanze auf dem rechten Elbufer ist Nr. 7; sie befindet sich am Ende der Forststraße links von der alten Radebergerstraße, am Rande des Prießnitzwaldes, östlich vom Prießnitzbache, und ist von ganz ähnlicher Stärke und Beschaffenheit, wie Schanze Nr. 6. Auch sie liegt nicht weit von dem Punkte, wo die Franzosen hart an der Raderbergerstraße die „Redoute de Radeberg“ aufgeworfen hatten. Wie unser Bild zeigt, sind beide sogenannte Schanzen auf zwei ziemlich hoch aufsteigenden Anhöhen errichtet, die, wie alle übrigen Stellen, an denen man im Prießnitzwalde Schanzen oder Batterien angelegt hat, durch Niederschlagen der den Um- und Ueberblick verhindernden Bäume die Altstadt und einen großen Theil des linken Elbufers überschauen lassen.
Die zunächstliegende Befestigung ist eine starke Batterie (auf unserem Bilde mit c bezeichnet), sie befindet sich hinter dem Alaunplatze auf der rechten Höhenseite des Prießnitzbaches. Von dort führte uns unser Weg über die sächsisch-schlesische Eisenbahn nach der auf einem Waldwege errichteten Schanze Nr. 8; ihr zunächst liegt am Drachenberge, rechts von der Großenhainer Straße, die Schanze Nr. 9. Die beiden zuletzt genannten Schanzen sind geschlossene Redouten mit zwei Flanken und Face. Unweit Stadt Neudorf, zwischen der Leipzig-Dresdner Eisenbahn und der Elbe, befindet sich endlich die Schanze Nr. 10; sie ist ebenfalls eine geschlossene Redoute und die letzte auf der rechten Seite der Elbe. Auch die französischen Befestigungen im Jahre 1813 reichten vom Plateau des Meisenberges bis zur Elbe, und zwar über Stadt Neudorf hinaus bis zur Westseite des Dorfes Pieschen. Die Franzosen hatten, wie uns später ein alter sächsischer Officier erzählte, auf dieser ganzen Strecke acht Redouten errichtet, die sämmtlich durch palissadenartige Verhaue mit einander in Verbindung gesetzt waren.
Wie ein Blick auf unser Bild darthut, beherrschen die preußischen Befestigungen auf der rechten Seite der Elbe nicht blos die Neustadt, sondern auch die tiefer gelegene Altstadt Dresden vollständig; wohlunterrichtete Sachverständige behaupten sogar, daß die schweren und weittragenden Geschütze, womit die meisten der genannten Redouten und die eine rechts von der Elbe gelegene Batterie, sobald es die Witterung erlaubt, versehen werden sollen, bis zum „großen Garten“ und darüber hinaus ihre zerstörenden Geschosse zu schleudern im Stande sein würden. Die Ausgänge der nach Schlesien und Leipzig führenden Eisenbahnen liegen ganz in dem nächsten Bereiche der preußischen Befestigungen; ebenso wird die Elbe ober- und unterhalb Dresdens vollständig durch sie [108] beherrscht. Wenn nach der genauen und werthvollen Darstellung, welche Aster[AU 1]von der Schlacht bei Dresden giebt, die russischen Batterien auf dem linken Elbufer im Stande waren, im Jahre 1813 den von den Franzosen am Linke’schen Bade aufgestellten Geschützen und sogar der großen, dicht am Waldschlößchen aufgeworfenen Redoute bedeutenden Schaden zuzufügen und die auf der Bautzner Straße heraneilenden Colonnen Napoleon’s zu einem verhältnißmäßig weiten Umweg zu zwingen, so dürfte Aehnliches den von den Preußen auf dem rechten Ufer der Elbe errichteten Befestigungen gegenüber nicht leicht stattfinden können.
In unterrichteten Kreisen nimmt man jetzt allgemein an, daß bei einem etwaigen neuen Kriege Oesterreichs gegen Preußen die österreichische Hauptmacht – schon weil der die Elbe beherrschende Königstein in Preußens Gewalt ist – nicht das Elbthal herauf, sondern von dem Erzgebirge her gegen Dresden heranziehen werde. Um einem solchen allerdings möglichen Angriffe mit aller Energie begegnen zu können, haben nun die Preußen – wie unser Bild ebenfalls zeigt – die Altstadt Dresden und die betreffenden Vorstädte mit einem ähnlichen Kranze von Befestigungen umgeben, wie dies in der Schlacht bei Dresden die Franzosen im Jahre 1813 gethan hatten.
Im Ganzen ist das linke Elbufer mit fünf Schanzen und sechs Batterien gedeckt. Aus verschiedenen Gründen war es mir nicht möglich, alle diese Schanzen und Batterien selbst zu besuchen, nur die hauptsächlichsten habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten persönlich in Augenschein genommen. Der zuletzt erwähnten Schanze Nr. 10 gegenüber liegt im Ostragehege bei „Onkel Tom’s Hütte“ eine starke Batterie (auf unserem Bilde mit a bezeichnet); auch hier wüthete nach Aster’s vortrefflicher Schilderung 1813 der Kampf zwischen den Oesterreichern und Franzosen, und zwar lange Zeit mit abwechselndem Erfolge. Mehr südwestlich – auf unserem Bilde leider nicht verzeichnet – liegen nahe an der Elbe bei den sogenannten Schusterhäusern und am Friedrichsstädter Kirchhofe, zwei andere preußische Batterien. Weiter südlich von diesen drei Batterien erhebt sich hinter dem Dorfe Löbtau, bei den „Drescherhäusern“, die mächtige Schanze Nr. 1. Die Schlacht bei Dresden hat hinlänglich bewiesen, daß dies sowohl zur Vertheidigung wie zum Angriffe ein höchst wichtiger Punkt ist; der General Bianchi errang hier durch geschickte Benutzung des Terrains längere Zeit bedeutende Vortheile über die Franzosen, deren Hauptbefestigungsplatz an dieser Seite näher nach der Stadt zu, vor dem Freiberger Schlage, sich befand.
Außer einer vierten Batterie, welche die Gegend um den Weißeritzfluß und die über Tharand nach Freiberg führende Albertsbahn bestreicht, folgt nun die Schanze Nr. 2; sie liegt an der Chemnitzer Straße nahe dem Feldschlößchen – einer sehr bedeutenden Brauerei – und dem neuen Annenkirchhofe, und ist auf unserem Bilde leicht zu finden. Die Franzosen hatten in dieser Gegend die heftigsten Kämpfe mit den Oesterreichern zu bestehen; sie hatten ihre Schanze nebst Blockhaus an dem Eingange zum Falkenschlage errichtet und beherrschten dadurch zwar die Niederung nach dem Dippoldiswalder Schlage so wie das Plateau des sogenannten Hahneberges und den oberen Plauenschen Marktweg, auch konnten sie die verschiedenen vorliegenden Bergabhänge beschießen und die Niederungen nach der Freiberger Straße hin flankiren; den östlichen Abhang des Hahneberges jedoch, so wie die nach Westen sich neigenden Seiten der genannten Anhöhe vermochten sie weder zu übersehen, noch mit ihren Geschützen zu bestreichen. Diesen Fehler, der ihnen längere Zeit großen Schaden zufügte, haben die Preußen bei der Errichtung der Schanze Nr. 2 und der damit in Verbindung stehenden anderen Befestigungen nach Möglichkeit vermieden.
Die nächstfolgende Schanze Nr. 3 erhebt sich bei dem Dorfe Zschertnitz zwischen den Ortschaften Räcknitz und Strehlen. Dresden hat sich seit 1813 sehr vergrößert, und daher zeigt es sich auch hier wieder, daß die Befestigungswerke, welche von den Preußen errichtet worden sind, in einem weiteren Umkreise von der Stadt entfernt liegen, als viele der früheren französischen Schanzen und Blockhäuser. Eine der Schanze Nr. 3 entsprechende französische Lünette war nicht weit von dem baumreichen, ehemals Moczinsky’schen Garten aufgeführt und flankirte die Dohnaische Straße; auch ließen sich von ihr aus die Wege nach Räcknitz und Zschertnitz, so wie die Dippoldiswalder Straße und der Dippoldiswalder Schlag bestreichen. Die preußische Schanze Nr. 3 aber bestreicht auf der einen Seite den Zelleschen Weg bis zur Bergstraße und die Gegend um Räcknitz, so wie auf der andern Seite das Dorf Strehlen, die sächsisch-böhmische Eisenbahn, den zoologischen und den großen Garten. Südöstlich von Räcknitz ward bekanntlich der General Moreau am 27. August 1813 an der Seite des Kaisers Alexander durch eine Kanonenkugel tödtlich verwundet; diese verhängnißvolle Kugel ward aber nicht von der eben erwähnten Lünette – diese war dafür wohl zu weit entfernt – entsandt, sondern von einer durch Napoleon selbst schnell herbeigeholten reitenden Batterie.
Nordöstlich vom großen Garten sehen wir die Schanze Nr. 4; sie liegt an der[WS 4] Pirnaischen Heerstraße, fast auf demselben Platze, wo die Franzosen im Jahre 1813 eine Schanze aufgeworfen und mit den Preußen, welche mit der größten Bravour durch den großen Garten gegen die Pirnaische Vorstadt vordrangen und die französische Bastion „Jupiter“ heftig beschossen, den blutigsten Kampf zu bestehen hatten. Die Geschütze der Schanze Nr. 4 bestreichen die nördliche Seite des großen Gartens, so wie die Pillnitzer Straße bis zum Landgraben, der auch auf unserem Bilde wohl zu erkennen ist. Jenseit des Landgrabens aber, hinter der Vogelwiese, ist eine Batterie (auf unserem Bilde mit b bezeichnet) aufgeführt, welche die Straße nach Blasewitz und den strategisch hochwichtigen Mühlenberg beherrscht.
Die letzte Schanze (Nr. 5) und die letzte Batterie auf dem linken Elbufer endlich befinden sich am Vorwerk „Lämmchen“ hinter der bekannten Villa Kaskel oder, wie der Dresdner spricht, „Antons“ und am Holzhofe; die Geschütze dieser Befestigungen bestreichen nach einer Seite hin das Blasewitzer Gehölz, während sie nach der andern die Elbe nach Loschwitz zu beherrschen und – sich an die auf dem Meisenberge hinter dem Waldschlößchen befindliche Schanze Nr. 6 anreihend – den Befestigungskranz um Dresden abschließen. Im Jahre 1813 kämpften hier vornehmlich die Russen gegen die im sogenannten Ziegelschlage errichteten Verschanzungen der Franzosen. –
Von den Dresden gegenwärtig umgürtenden zehn Schanzen sind neun besetzt; und zwar nur mit preußischen Soldaten; von den Batterien hat jedoch nur erst die im Ostragehege gelegene Wachtmannschaften erhalten. Es unterliegt aber nicht dem geringsten Zweifel, daß die Preußen bei einem Kriege mit Oesterreich Dresden als einen der ersten Hauptvertheidigungsplätze auf dem Wege nach Berlin ansehen und es in keinem Falle unterlassen werden, die Hauptstadt Sachsens noch mehr zu befestigen, um dieselbe bis auf’s Aeußerste halten zu können. Möge es zu dieser Nothwendigkeit nicht kommen! möge das durch schwere Kriegsdrangsale schon so häufig heimgesuchte Dresden nunmehr recht lange davon verschont bleiben!
Es war Sonnabends und gerade am 1. December, als ich nach dem Frühstück meinen kleinen, gemüthlichen, hart am Rhein winkenden Gasthof „Zur Lorelei“ in Coblenz verließ und einen niedlichen Dampfer bestieg, der mich nach dem eine halbe Meile stromabwärts und auf dem anderen Ufer gelegenen preußischen Städtchen Vallendar brachte. Es ist ein kleines, schmutziges, Städtchen mit etwas Schifffahrt und einigen Tuchfabriken, die aber noch in Folge des Krieges darniederlagen. Ohne Aufenthalt durchschritt ich die engen Gassen und verfolgte zum Thore hinaus die alte unchaussirte Landstraße, die gleich hinter der Kirche ziemlich steil mehrere hundert Fuß hoch hinansteigt. Schon der Berg, an welchen sich Vallendar lehnt, reizte meine Aufmerksamkeit
[109]| Schanze Nr. 3 zwischen Räcknitz und Strehlen. „ „ 4 an der Pirnaischen Straße. |
Schanze Nr. 1 hinter Löbtau. |
[110] und Bewunderung durch seine theils schneeweißen, theils rindfleischrothen Thonschichten, und wie ich weiter wanderte, sah ich, daß der ganze Boden rings umher dieselbe Beschaffenheit zeigt. Der Weg lief durch ein Wäldchen, und als ich wieder in’s Freie trat, hatte ich die ehemalige nassauische Grenze passirt und damit das Krug- oder Kannenbäckerland erreicht, welches sich am südwestlichen Abhange des Westerwaldes ausbreitet, den größten Theil der Aemter Selters und Montabaur einnimmt, mehrere Quadratmeilen umfaßt und durch eine besondere Industrie weit und breit berühmt ist.
Hier wohnen nämlich in zwölf meist großen Dörfern über zweihundert Thonwaarenfabrikanten, sogenannte Krug-, Kannen-, Weißwaaren- und Pfeifenbäcker, die alljährlich an 260,000 Centner Waaren im Durchschnittswerthe von 1,600,000 Gulden anfertigen und diese über Europa und nach Amerika versenden. Dort zur Rechten lag unten im Thale Grenzhausen, wie man mir sagte, das bedeutendste unter den zwölf Dörfern, und das heutige Ziel meiner Reise. Aus einer Menge von Schloten in den blauen Winterhimmel hohe, schwarze Dampfsäulen entsendend, die oben zusammenflossen und niedersinkend das ganze Dorf umwallten, schien es in Feuersgefahr und ich erwartete jeden Augenblick die rothen Flammen hervorbrechen zu sehen. Rings umher auf den kahlen Feldern erhoben sich zahlreiche Pyramiden, von zusammengestellten langen Stangen erbaut, über deren Bedeutung ich im Unklaren blieb, bis ich hinterher erführ, daß es Hopfenstangen seien. Alle andern Feldfrüchte werden im Krugbäckerland nur für den eigenen Bedarf angebaut, Hopfen dagegen wird in bedeutenden Quantitäten ausgeführt und kommt merkwürdigerweise von Köln und Mainz wieder herein.
Man hatte mich an einen Herrn W. Blum den Zweiten gewiesen, der als Großhändler und Fabrikant zu den ersten und wohlhabendsten Industriellen des Landstrichs gehört. Ich fand in ihm einen schlichten, hageren, aber wohlerhaltenen Sechsziger und einen äußerst scharfen Kopf, der mir über seine Heimath die beste Auskunft gab und dabei auch seine Lebensgeschichte berührte.
Er war noch vor dreißig Jahren ein armer Krugbäcker gewesen, welcher für seine Waaren nur mühsam Absatz fand. Mit diesen pflegten seine Handwerksgenossen den Rhein auf- und abwärts zu den Messen der nächsten Städte zu fahren und, wenn sie Glück hatten und Alles verkaufen konnten, zu Fuß wieder heimzukehren. Blum wagte sich mit einer Ladung von Kannen und Krügen nach Amsterdam, fand jedoch keine Käufer, worauf er unverzagt weiter ging und über die See nach Ostfriesland und Oldenburg schiffte. Das Wagniß gelang; er schlug den ganzen Vorrath los und erhielt weitere Bestellungen, die er nach seiner Heimkehr rasch besorgte und spedirte. Fortan verfolgte er diese Reisen und dehnte sie immer weiter aus; die Aufträge vermehrten sich derart, daß er sie allein nicht mehr ausführen konnte, sondern Anderen mit übertragen mußte. Endlich gab er die eigene Fabrikation ganz auf und betrieb das Geschäft rein kaufmännisch, indem er großartige Lieferungen von Thonwaaren übernahm, mit deren Anfertigung er die Krug- und Kannenbäcker rings umher beschäftigte. Gegenwärtig handelt er mit diesen und ähnlichen Artikeln bis Petersburg und nach Amerika; daneben betreibt er eine Knochenmühle und Erdfarben- (Ocker-) Fabrik für Tüncher und Anstreicher. Von seinen Mitbürgern verehrt und geschätzt, saß er 1848 bis 1851 in der Kammer und ist zur Zeit Mitglied der Limburger Handelskammer. Sein Beispiel ist nicht ohne Nachfolge geblieben. Jetzt reisen viele der größeren Kannenbäcker entweder selbst, oder halten besondere Reisende für ihr Geschäft.
Die Thonindustrie im Krugbäckerlande reicht bis in’s vierzehnte Jahrhundert zurück. Anfangs war sie nur Häfnerei, d. h. es wurde blos gemeines irdenes Topfgeschirr angefertigt, bis man sich seit dem sechszehnten Jahrhundert ausschließlich auf Steinzeug warf. Die Krug- und Kannenbäcker waren zu Zünften verbunden, die der Entwickelung des Gewerbes enge Schranken zogen. So wurde die Gattung der Waaren, die jeder zu backen bekam, durch’s Loos bestimmt, die Zahl der Gebäcke, über die kein Meister hinausgehen durfte, von der Zunft festgesetzt. Das fertige Gebäck ward von den Zunftvorstehern besichtigt und das Mangelhafte ausgeschieden. Der Preis aber für die Waare wurde nach Anhören der Zunft von der Landesregierung festgesetzt. Trotz dieser hemmenden Schranken stand im sechszehnten und zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts die Kannenbäckerei in großem Flor, weil damals das gemeine Steinzeug die Stelle des Porcellans vertrat und, wie dieses heute, als Luxusgegenstand diente. Eine schöne Sammlung von Gefäßen aus jener Zeit, die sich durch Güte, Accuratesse und geschmackvolle Verzierungen auszeichnen, befindet sich auf Burg Stolzenfels. Mit dem Jahre 1816 hörte der Zunftzwang auf und es traten die Krug- und Kannenbäcker zu Innungen zusammen, welche in den verschiedensten Dörfern gemeinsame Thongrubenfelder als Eigenthum oder in Belehnung besitzen.
Als ich Herrn Blum verlassen hatte, führte Herr Müller, der evangelische Pfarrer des Orts, ein kleiner noch junger und flinker Mann, mich mit großem Eifer von Haus zu Haus und damit von Werkstatt zu Werkstatt, denn das Dorf zählt unter zwölfhundert Bewohnern gegen vierzig Thonwaarenfabrikanten nebst ihren Gehülfen, Lehrlingen und Familien.
Einige fertigen nur Krüge, welche theils an die Mineralwasserbrunnen gehen, theils nach den Ostseehäfen kommen, wo sie mit Genèvre gefüllt und dann in alle Welttheile, besonders nach Amerika versandt werden. Die Zahl der Krugbäcker im ganzen District beträgt über hundert, welche fast mit ebenso vielen Gesellen arbeiten und jährlich an zehn Millionen Krüge fabriciren. Die Krugbäcker, von denen nur vier in Grenzhausen wohnen, sind unter ihren Collegen die Plebejer. Ihre Waare, welche nur geringe Kunstfertigkeit, aber verhältnißmäßig große Auslagen an Thon, Salz und Holz erfordert, wird äußerst schlecht bezahlt – tausend Krüge mit sechsunddreißig Gulden, wovon fast zwei Drittel baare Auslagen sind – und muß öfters um Spottpreise verschleudert werden; namentlich hat der amerikanische Krieg sie sehr niedergedrückt. Die Krugbäcker essen häufig „vorgegessenes Brod“, d. h. sie leben von Vorschüssen, und der Verdienst ist schon verzehrt, ehe die Waare abgeliefert wird.
Die Kannenbäcker, deren Zahl im ganzen District etwa zweiundzwanzig beträgt, fertigen nur sogenanntes Maßgut, steinerne Bierkannen, wie sie in Süddeutschland, vorzüglich in Baiern, massenhaft in Gebrauch sind. Sie werden nach dem Gemäß des Landes gemacht, woher sie bestellt sind. Nach Hessen, Frankfurt etc. gehen bauchige Bierkrüge von einem halben bis zu einem Maß, welche in den Wirthschaften dem Gast nebst Trinkglas vorgesetzt werden; über ganz Deutschland birnförmige Krüge bis zu sechs Maß haltend, die in den Wirthschaften zum Heraufholen des Getränks aus dem Keller, in den Haushaltungen zur Aufbewahrung des Trinkwassers, Essigs etc. verwendet werden. Man sucht die Kannen so weiß wie möglich zu backen und verziert sie mit Malereien von Smalte. Seit einer Reihe von Jahren werden auch in Metallformen gepreßte Kännchen mit erhabenen Bildern fabricirt, die oft sehr schön gerathen und meist den Gambrinus, Scenen aus Wilhelm Tell, des Jägers Tod etc. vorstellen.
Die vielen Haushaltungsgefäße, welche die größere Masse des Steinzeugs bilden, werden von den Fabrikanten gefertigt, die ihr Product Weißwaare nennen, gegen achtzig im Ganzen. Dazu gehören die Milch- und Einmachtöpfe vom kleinsten bis zum Gehalt von zehn Maß, Küchengefäße und Schüsseln jeder Façon und Größe; ferner Wichstöpfe, Gefäße für Apothekerwaaren und Chemikalien, Ballons für Säuren, Wulf’sche Flaschen-Retorten, endlich Fässer.
„Diese Fässer,“ sagte Pfarrer Müller, „können noch eine große Zukunft haben. Es ist ein Lieblingsproject von mir, steinerne Lagerfässer für Wein herstellen und einführen zu lassen; in ihnen würde der Wein weder zehren noch absterben, mithin, wenn er in’s Faß gefüllt ist, durchaus keine Nachbehandlung mehr nöthig haben.“
Die Weißwaaren- und Kannenbäckerei bewegt sich in günstigern Verhältnissen. Unter diesen Fabrikanten finden sich viele wohlhabende Leute: gar manche mögen wohl einen Besitz von zehn bis zwanzig Tausend Gulden haben.
Der Thon, aus welchem das hiesige Steinzeug gemacht wird, findet sich fast in allen Gemarkungen des Krugbäckerlandes, gewöhnlich acht bis vierzig Fuß unter der Erde und sieben bis dreißig Fuß mächtig. Als Thongräber ernähren sich wohl über hundert Männer. Man verarbeitet rothen, gelben, blauen und weißen Thon; die drei ersten Sorten zu Krügen, besonders die blaue, weil sie die fetteste ist; die weiße zu Kannen und Weißwaaren. Der Krugbäcker verarbeitet den Thon am liebsten so frisch, wie er aus der Erde kommt; die andern Fabrikanten lassen ihn erst unter luftigen Schuppen trocknen oder „edel“ werden. [111] Das Stampfen und Kneten des Thons geschieht noch mit Füßen und Händen, eine überaus harte, anstrengende Arbeit. Ebenso werden die Geschirre vom sogenannten „Wirker“ auf der gewöhnlichen Drehscheibe noch aus freier Hand geformt. Das Garbrennen der Waaren geschieht in einigen Fällen durch Steinkohlen, meistens aber durch Holz, welches hier in hohem Preise steht; die Weißwaarenbäcker haben bisher nur Holz mit Erfolg verwenden können.
Zwischen den Fabrikanten und ihren Gehülfen und Dienstleuten besteht noch ein patriarchalisches Verhältniß, letztere nennen die Herrschaft „Vetter“ und „Base“. Dieselbe Vertraulichkeit waltet auch zwischen dem Pastor und seiner Gemeinde ob. Er redet die Männer und Frauen meist bei ihrem Vornamen, die jüngeren sogar mit „Du“ an, während die Kinder auch von ihm als vom „Pastors Vetter“ sprechen und seine Frau „Pastors Base“ tituliren. Dagegen ist, wie er mich versicherte, der Umgang zwischen Eltern und Kindern entschieden ein zu vertraulicher. Weil die Kinder mit den Eltern stets zusammen sind, werden sie in alle Verhältnisse eingeweiht und schon früh um Rath gefragt. Es kommt vor, daß bei gewissen Familienereignissen die Mutter sich vor dem Unwillen des vierzehnjährigen Sohnes fürchtet.
„Im Uebrigen,“ sagte der Pfarrei, „kann ich den Krug- und Kannenbäckern in Grenzhausen und in den andern evangelischen Dörfern das beste Zeugniß ausstellen. Sie sind sehr arbeit- und sparsam, letzteres bis zum Geize; mäßig und nüchtern, ehrlich und bieder; die Kaufleute in Vallendar borgen einem Grenzhäuser auf das bloße Wort. Man findet unter ihnen viel Neigung zur Lectüre; die Gartenlaube wird in den meisten Familien gehalten. Die Kinder werden fleißig zur Schule geschickt, und wenn es die Mittel erlauben, läßt man ihnen gleich oder hinterher einen gehobenen Unterricht privatim ertheilen. Die im katholischen Nachbardorfe Höhr schicken ihre Söhne sogar auf belgische Institute, freilich oft blos des Namens halber. Gegenwärtig ist unter den Kannenbäckern der Ehrgeiz verbreitet, ihre Söhne als einjährige Freiwillige in die preußische Armee treten zu lassen, was indeß, obwohl es bekanntlich mit den Anforderungen gar leicht genommen wird, häufig dennoch an dem Mangel der nothwendigsten Vorbildung scheitert.
Vom Aberglauben ist, da die religiöse Anschauung der Bevölkerung im Allgemeinen eine rationalistische, im Krugbäckerlande gar nicht die Rede, weder in den protestantischen noch in den katholischen Dörfern. Diese letztern gehörten früher zum Kurfürstenthum Trier, jene zu den Fürstlich Wied’schen Besitzungen. Grenzhausen ist seit 1564 protestantisch, wo sich Hermann, Erzbischof von Köln und Fürst von Wied, für die neue Lehre erklärte. Noch heute ist hier viel Anhänglichkeit verbreitet an das Haus Wied, namentlich auch an den gegenwärtigen Fürsten Hermann, der bekanntlich ein geistvoller Philosoph und Schwager unseres entthronten Herzogs ist. Sonst hat das Krugbäckerland in Trachten, Sitten und Gebräuchen ebensowenig etwas Eigenthümliches bewahrt wie andere Fabrikdistricte: auch hier hat die Industrie Alles nivellirt.“
„Wie aber stehen die protestantischen Dörfer zu den katholischen?“
„Nur in gewerblicher Hinsicht waltet zwischen allen Dörfern mancherlei Eifersüchtelei und Ueberhebung ob; die Confession hingegen hat uns erst in neuester Zeit und dann auch nur mittelbar getrennt. Der katholische Pfarrer im benachbarten Höhr ist mein Duzbruder, wir besuchten uns gegenseitig und standen im freundschaftlichsten Verkehr. Starb in Grenzhausen ein Katholik, so begleitete ich die Leiche bis an das Kirchhofsthor, wo mir mein katholischer Amtsbruder entgegentrat; wir reichten uns die Hände und ich überlieferte ihm den Sarg. Dieses schöne Verhältniß hat aber der jüngste Krieg zerrissen; die protestantischen Dörfer nahmen für Preußen, die katholischen für Oesterreich und den Bund Partei. Seitdem ist zwischen Grenzhausen und Höhr ein Riß eingetreten, und der katholische Pfarrer hat allen Umgang mit uns abgebrochen, vielleicht weil der Bischof ihm denselben verboten. Es ist mir aufrichtig leid!“
Dann kamen wir wieder auf die Industrie des Ortes zu sprechen, die ich, insofern sie einen ganzen District erfüllt und darin allein herrscht, als eine höchst merkwürdige und wichtige rühmte.
„Und dennoch hat ihr der Herzog, der doch nur über ein kleines Ländchen gebot, welches er in Einem Tage durchreisen konnte, während seiner ganzen Regierung nie einen Blick geschenkt,“ sagte der Pfarrer. „Wie oft hat er in Montabaur, eine Stunde von hier, gejagt; aber nie ist er nach Grenzhausen gekommen! Und doch hätte gerade die Thonwaarenfabrikation, die Tausenden von Menschen Beschäftigung und Existenz gewährt und noch einer weit größeren Ausdehnung fähig ist, die Aufmerksamkeit und Pflege der Regierung verdient.“
„Wie Ihnen schon selber nicht entgangen sein wird,“ fuhr er fort, „tritt die Industrie zum größten Theile noch heute wie vor hundert Jahren im Gewande des Handwerks auf, und wenn schon die Krug- und Kannenbäcker sich ‚Fabrikanten‘ nennen, ist von einem fabrikmäßigen Geschäftsbetrieb noch wenig die Rede. Dazu fehlt es ebenso sehr an Capitalien wie an Speculationsgeist. Allwöchentlich geht unser Rohthon in Hunderten von Wagen an den Rhein, um in auswärtigen Fabriken verarbeitet zu werden; ein Beweis, welch’ vortreffliches Material wir besitzen und daß durch die massenhafte Ausfuhr der hiesigen Bevölkerung kein geringer Arbeitsverdienst entzogen wird. Die Ausbeutung des Thones selbst wird in der unverantwortlichsten Weise betrieben. Wenn nach Willkür Gruben aufgeworfen, einige Wochen ausgebeutet und, sobald dieselben mit Einsturz drohen oder sich Wasser zeigt, wieder zugeworfen oder liegen gelassen werden, so ist das ein Raubsystem, welches zum Mindesten den Nachtheil hat, daß das ausgezeichnete Material nicht in dem Maße gewonnen wird, wie es sein sollte. Noch mehr läßt die Bearbeitung des Thones und die Anfertigung der Geschirre zu wünschen übrig. Beides könnte durch Anwendung von Maschinen weit leichter, billiger und besser geschehen. Gerade dadurch nimmt die englische Thonindustrie einen so hervorragenden Rang ein, da es niemals möglich ist, aus freier Hand Gefäße in solcher Vollkommenheit und Güte zu drehen, wie es Maschine und Preßeinrichtung thun. Unsere Industriellen müßten ihre Söhne nach Frankreich und England schicken, um die dortige Fabrikationsweise kennen zu lernen. Ueberhaupt fehlt es unseren Bäckern an theoretischer und künstlerischer Bildung. Man kennt hier noch nicht die Anwendung des Cements, und die Gefäße sind in Folge mangelhafter Anfertigung zu sehr dem Schwinden, Zerreißen und Zerspringen ausgesetzt. – Auch die Construction der Brennöfen ist noch eine sehr mangelhafte, indem sie ein zu großes Heizungsmaterial erfordern und eine Unmasse Holz als dicken schwarzen Rauch entweichen lassen, unter neun bis zehn Klaftern Holz ungefähr eine ganze Klafter. Es müßten Musteröfen gebaut, eine Musterfabrik angelegt werden, welche die Fortschritte in Technik und Wissenschaft zur allgemeinen Kenntniß und Anschauung brächten. Es müßten die gesammten Fabrikanten zu einer Association zusammentreten, um den Thon gemeinschaftlich graben und bearbeiten zu lassen, um auf gemeinsames Lager zu arbeiten und den Verkauf durch eine Commission betreiben zu lassen. Das würde die Ausdehnung und Hebung der Industrie schnell und ungemein fördern. Aber zu Alledem gehört Geld und die Initiative der Regierung. Was diese sonst noch in äußerer und localer Hinsicht für uns thun kann, sollen Sie morgen im Gewerbeverein, den ich Ihretwegen zusammenberufen will, von den Fabrikanten selber hören.“
Pius des Neunten Leben und Gewohnheiten. Ist man auch kein Anhänger des Papstthums, so hat doch vielleicht eine Schilderung des Lebens und Treibens Pius’ des Neunten für Manchen Interesse, da derselbe einer der trefflichsten und wohlmeinendsten, wenn auch nicht kräftigsten Vertreter des Papstthums und aller Wahrscheinlichkeit nach der letzte Nachfolger Petri auf dem apostolischen Stuhle sein dürfte. Der erste Papst, der heilige Petrus, bestieg den heiligen Stuhl im Jahre 34 nach Chr. Geb., der letzte Papst, Pius der Neunte, wurde im Jahre 1846 gewählt. Er ist jetzt ein schöner Greis von vierundsiebenzig Jahren, der sich im weltlichen Leben Johann Maria von Mastai-Ferretti nannte und am 13. Mai 1792 zu Sinigaglia geboren wurde. Anfangs hatte er die Absicht, sich dem militärischen Stande zu widmen, doch wählte er dann den geistlichen Beruf und wurde nach mehrjährigen gefahrvollen Missionsreisen von dem damaligen Papste Leo dem Zwölften zum Director eines dem heiligen Michael geweihten Hospizes ernannt; im Jahre 1827 wurde er Bischof von Spoleto. Sein Vorgänger, Papst Gregor der Sechszehnte, machte ihn 1832 zum Erzbischof von Imola und verlieh ihm 1840 die Cardinalswürde. Was man ihm sonst auch vorwerfen möge, so lassen sich ihm doch die mildesten
[112] echt christlichen Tugenden mit der würdevollsten Einfachheit verbunden, nicht abstreiten, die ihn im Verein mit vielem Unglück zu einer wirkliche Theilnahme erweckenden Erscheinung machen.
Pius der Neunte besitzt eine kräftige Constitution, seine Gestalt reicht über die Mittelgröße, er hat eine breite Brust, kleine, volle Hände und sein Gang ist langsam, aber selbst bei den feierlichsten Gelegenheiten einfach und ungezwungen. Der mächtige Kopf mit den regelmäßigen, harmonischen Gesichtszügen läßt auf seltene Fähigkeiten schließen; die hohe, breite Stirn ist von reichem, silberweißem Haar umkränzt. Beim ersten Anblick bringt das Antlitz des Kirchenfürsten durch den Ausdruck von freundlicher Güte einen überwältigenden Eindruck hervor. Die Züge sind überaus einnehmend und haben durchaus nichts Gewöhnliches oder gar Abstoßendes an sich. Die Nase ist nicht groß, aber adlerartig und ideal geformt; der Schnitt des Mundes, der sich mehr nach dem vorstehenden Kinn zuneigt, ist eigenthümlich, da man inmitten der Unterlippe gleichsam einen vertieften Einschnitt bemerkt. Die ganze rechte Seite des Körpers ist etwas schwächer als die linke: die rechte Wange ist weniger voll, das rechte Auge mehr verschleiert durch das Augenlid, das rechte Ohr hat einen Einschnitt, was jedenfalls einem Unfalle in der Kindheit zuzuschreiben ist. Das ganze Gesicht wird wundersam beleuchtet durch den Glanz und den leutseligen Blick der großen schwarzen Augen.
Jeden Tag steht der Papst des Morgens halb sieben Uhr auf, im Sommer wohl noch etwas früher. Er ist gewöhnt, sich in vielen Dingen selbst zu bedienen, und rasirt sich daher auch selbst. Ueberhaupt hat er gar keine aristokratischen Gewohnheiten beigehalten, als den Geschmack für eine außerordentliche Reinlichkeit. Um halb acht Uhr liest er die Messe in seinem Oratorium, dann wohnt er einer von einem der Hauspriester gelesenen Messe bei, so daß um halb neun Uhr seine priesterlichen Pflichten beendigt sind. Nachdem er die Seele durch Gebet gestärkt hat, ist sein Geist frei und gesammelt für die Arbeiten des Tages. Er verläßt die Capelle und nimmt ein leichtes Frühstück ein, das in Biscuits und einer Mischung von Kaffee und Chocolade besteht. Jetzt erhalten der Majordomus, der Oberstkämmerer und die Geheim-Secretäre ihre Anweisungen über die Audienzen und Verwaltungsangelegenheiten. Dann erscheinen auf den Seitengalerien des Vaticans die Beamten und Bittsteller und bald darauf kommen die Staatsminister, Cardinäle, einige Klostervorsteher, sowie Gesandte oder Fremde, die dem Papst vorgestellt zu sein wünschen, zur Audienz. Der Papst empfängt Alle ohne Ausnahme in seinem Arbeitscabinet, welches mit der strengsten Einfachheit möblirt ist. Die ganze Einrichtung besteht in einem großen Tisch, auf dem sich ein Crucifix und ein Schreibzeug befindet, einem Armstuhl, auf dem der Papst selber sitzt, und einem andern, der für den Gast bestimmt ist.
Um drei Uhr ist die Empfangszeit zu Ende und der heilige Vater begiebt sich in den Speisesaal im rechten Flügel, der die Aussicht auf den Monte Cavallo hat. Dieser Saal ist sehr groß und enthält blos einen mit rothem Sammet bedeckten Tisch nebst einem Armstuhl, welche auf einem erhöhten Tritt stehen und von einem Baldachin mit dem päpstlichen Wappen überragt werden. In Rom speist der Papst, dem Herkommen gemäß, stets allein, nur auf dem Lande, z. B. in Frascati oder Albano, empfängt er einige Cardinäle und Prälaten bei Tisch. Der Haushalt der letzten Päpste war schon immer sehr einfach und ihre Tafel höchst frugal; unter Gregor dem Sechszehnten kostete dieselbe täglich drei römische Thaler und Pius der Neunte, welcher für seinen Tisch als Erzbischof und Cardinal täglich blos einen Thaler ausgab, ist dieser Gewohnheit auch als Papst treu geblieben, natürlich nur, wenn er allein speist. Nach der Mahlzeit zieht er sich in sein Schlafzimmer zurück, wo er sich eine kurze Siesta vergönnt; um vier Uhr steht der Wagen bereit, der ihn auf’s Land führt, wo er gewöhnlich eine Stunde lang spazieren geht, um dann um sechs Uhr bereits wieder im Vatican einzutreffen. Jetzt setzt er sich nieder zur Arbeit, die er nicht vor halb elf Uhr unterbricht; nach einem Gebet und einer Betrachtung in seinem Oratorium zieht er sich dann in sein Schlafgemach zurück, während sein Hausminister eingeführt wird, der jeden Abend beim Schlafengehen des Papstes zugegen sein muß. Er unterhält ihn dabei mit Neuigkeiten und Auskünften über innere Angelegenheiten; wenn Pius der Neunte nicht mehr antwortet, schließt der Minister die Bettvorhänge und geht, nachdem er sich zuvor noch überzeugt hat, daß der Diener des Papstes, welcher in dem Zimmer neben dem Schlafcabinet schlafen muß, auch wirklich zugegen ist.
Bei den früheren Päpsten war es Gebrauch, im Sommer bei großer Hitze stets Sorbet, Gefrorenes und andere Erfrischungen in Fülle bereit zu halten, und die Ueberraschung Pius’ des Neunten war groß, als er einst kurz nach seiner Erhebung zum Papst eine Orangenlimonade verlangte und die Diener mit einer ganzen Masse verschiedener Erfrischungen und Backwerk erscheinen sah. Nachdem er dies Alles zurückgeschickt, ließ er sich ein Messer und eine Orange geben, deren Saft er selbst in ein Glas drückte, während er strenge befahl, ihm ferner nichts Anderes zu bringen, wenn man ihn nicht erzürnen wolle. Diese Einfachheit und Enthaltsamkeit beobachtet Pius der Neunte in Allem, was seine Person betrifft. Seine Leibwäsche war noch lange Zeit dieselbe, welche. er in Imola als Bischof besaß; nach fünfzehnmonatlicher Regierung besaß er nichts Neues als die Soutane, welche er sich gleich nach seiner Ernennung zum Papste anfertigen ließ, und dieser Rock aus weißem, feinem Cashmir zeigte bei der außerordentlichen Reinlichkeit eines Besitzers keine andere Flecken als die Spuren einiger Körnchen Schnupftabak, wovon der heilige Vater reichlichen Gebrauch macht. Wenn alle katholischen Geistlichen diesem ihrem Oberhaupt an Milde, Einfachheit und Sittenstrenge glichen, so stände es besser um die katholische Kirche, und um die gesammte Welt!
Ein chilenischer Messerkampf. In der Nähe von Pichuncari in Chile wird auch Gold gewaschen. Wie in Californien sind die Goldgräber (Mineros) äußerst roh und haben noch die barbarische Form des chilenischen Zweikampfs auf Messer beibehalten. Auf seinen Reisen sollte August Kahl, von dem eben Reisen durch Chile erschienen sind, Zeuge eines solchen Kampfes werden, dessen Abscheulichkeit dadurch gesteigert wurde, daß Vater und Mutter des einen Duellanten zugegen war. Wohl fünfzig Mineros, unter denen der Herausforderer sich befand, waren in den Hof ihrer Hütte eingedrungen. Der Sohn, ein Hirt (Vaquero), mußte sich stellen und Kahl selbst blieb mit seinem Begleiter, um die Familie schützen zu helfen, wenn der Minero unterläge und seine Gefährten Rache zu nehmen versuchten.
Der Kampf sollte beginnen: im weiten Halbkreis umstanden die Mineros die beiden bis auf die Unterkleider entblößten Kämpfer. Ein vier Ellen langer, lederner Riemen, dessen Enden um die Hüften der beiden Gegner geschlungen waren, verband diese. Keiner sollte der Wuth des Andern entfliehen. In ihren Händen blitzte das scharfgeschliffene spitze Messer.
Sobald sich die Männer zurückgezogen, die ihnen den Riemen um die Hüfte befestigt, stürzten die beiden Kämpfer mit hocherhobenem Messer auf einander zu, ohne irgend ein Signal abzuwarten. Die Wucht des ersten Stoßes riß Beide zu Boden. Wie zwei Verzweifelte rangen sie dort, ohne auch nur einen Laut von sich zu geben. Unmöglich konnte man erkennen, wer oben, wer unten lag, so rasch folgte Bewegung auf Bewegung, Stoß auf Stoß. Zuweilen erkannte man das Blitzen eines Messers, das zum Stoße erhoben war, aber blitzschnell wurde es von der anderen Klinge aufgefangen. Es währte nicht lange, bis sich eine Blutlache unter den Kämpfenden bildete, langsam bahnte sich der Blutstrom durch den Sand seinen Weg. Nach einigen Minuten hörte das Ringen plötzlich auf; beide Kämpfer, scheinbar von dieser furchtbaren Anstrengung ermattet, starrten einander an; einen scheußlichen Anblick boten diese Körper, von Kopf bis zu Fuß mit Blut und Staub bedeckt. Die Umstehenden traten näher, um sie auseinander zu bringen, aber nur einen Moment hatte diese Ruhe der beiden Elenden gedauert. Das gräßliche Ringen hatte wieder begonnen. Die Mineros schienen jetzt an dem Blutschauspiel genug zu haben, andrerseits mochten sie auch wohl von dem herzzerreißenden, krampfhaften Geschrei der Mutter, die fortwährend nach ihrem Sohn rief und den ehernen Cirkel, der den Kampfplatz umgab, vergebens zu durchbrechen suchte, gerührt sein, genug, sie eilten jetzt, um die Streitenden zu trennen, aber zu spät, – wieder sahen wir ein Messer aufblitzen, – hoch zum Stoße ausholen, aber keine Klinge wehrte es ab, und tief bohrte es sich in die Brust eines der Unglücklichen. Ein heller, rother Blutstrahl schoß empor. Schaudernd wandte ich mich ab, der Kopf schwindelte mir, kaum erreichte ich die Hütte, wo ich mich kraftlos auf einen Sessel niederließ.
Eine Gestalt, durch Schmutz und Blut ganz unkenntlich, suchte sich zu erheben, aber es gelang ihr nur durch die Hülfe eines Mannes, in welchem ich den alten Vaquero erkannte. Der Verwundete war sein Sohn. Sein Feind lag auf dem Boden ausgestreckt, seine Freunde unterstützten ihn, aber er sollte nicht wieder aufstehen. Sein Röcheln wurde allmählich schwächer, seine Glieder reckten sich im letzten Todeskampf, und bald lag an der Stelle, die wenige Momente vorher ein lebendes, denkendes Wesen einnahm, eine starre, unkenntliche Leiche. Die Mineros, anfangs kleinlaut und still, brachen jetzt in laute Verwünschungen aus. Aber wir waren inzwischen nicht unthätig gewesen. Der junge Vaquero sowie seine ohnmächtige Mutter waren bereits in die Hütte geschleppt und die Thüren gut verbarricadirt.
Vergebens donnerten die Kerle an dieselbe; die festen Eichenbohlen trotzten ihren vereinten Kräften. Auch ein über ihre Köpfe gerichteter Schuß, den ich aus dem kleinen Fenster abfeuerte, that seine Wirkung. Sie mochten wohl einsehen, daß sie nicht viel Nutzen von einem Angriff auf die feste und von Feuerwaffen vertheidigte Hütte haben würden, banden den Leichnam ihres erschlagenen Cameraden auf dessen Pferd, saßen auf und jagten unter wilden Drohungen und Geschrei davon.
Dem Verwundeten wurde jetzt das Gesicht gewaschen und noch dann hatte ich Mühe, in dieser bleichen hinfälligen Gestalt den noch vor wenigen Augenblicken so frischen und kernigen Sohn des Vaquero zu erkennen. Er hatte im linken Arm eine tiefe Wunde und eine andere leichtere in der Schulter. Sie wurde gereinigt und mit den Blättern des blutstillenden, heilenden „Sauco“ belegt. Noch in derselben Nacht sollte er mit seinem Vater nach den nördlicheren Districten reisen, um der gerichtlichen Nachsuchung, die unzweifelhaft erfolgen mußte, zu entgehen.
A. K. in St–t. Die Novelle von Edmund Hoefer: „Die Herrin von Dernot“, kommt unmittelbar nach der jetzt begonnenen Erzählung von F. L. Reimar zum Abdruck.
Inhalt: Getrennt. Novelle von F. L. Reimar. – Eine goldene Hochzeit mit der Wissenschaft. Mit Portrait. – Strafpredigt gegen rücksichtslose Leute. Nr. 2. Für Die im Theater und Concert. Von Bock. – Bewundert von drei Generationen. Von Fr. Szarvady in Paris. – Der Schanzenkranz um Dresden. Mit Abbildung. – Land und Leute. Nr. 24. Im Krugbäckerland. I. – Blätter und Blüthen: Pius des Neunten Leben und Gewohnheiten. – Ein chilenischer Messerkampf.
Die Deutschen Blätter, Literarisch-politische Feuilleton-Beilage zur Gartenlaube, Nr. 6 enthalten: Wen wählen wir? Ein Wort zur Wahl für den Reichstag des norddeutschen Bundes. Von Emil Rittershaus. – Das Gothaer Fürstenbuch. – Umschau: Eine Verherrlichung des Nachdrucks. – Die westliche Seite der Städte. – Das Bettlerwesen in Rom. – Ein origineller Schulmeisterbrief. – Der deutsche Handel und die beabsichtigte Kriegsflotte. – Die Modesclaverei unserer Damen. – Naivetät am grünen Tische. – Das Ende der Mormonenwirthschaft. – Der Carneval in Wien. – Berichtigung.
- ↑ Wie wir erfahren, wird am Tage von Ranke’s Jubiläum im Verlage von Duncker und Humblot in Leipzig der erste Band einer Gesammtausgabe seiner Werte erscheinen. Dieselben werden etwa sechsunddreißig Bände umfassen, von denen vier bis sechs im Jahre zur Ausgabe gelangen sollen. D. Red.
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Julius Mosen, * 8. Juli 1803; † 10. Oktober 1867.
- ↑ Für Die im Trink- und Speisehause
- ↑ Vorlage: ans
- ↑ Vorlage: an an
Anmerkungen des Autors
- ↑ Aster, Schilderung der Kriegsereignisse in und vor Dresden vom 7. März bis 28. August 1813.