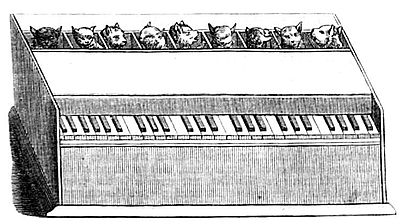Die Gartenlaube (1858)/Heft 42
[597]
| No. 42. | 1858. |
Der Amtmann trat mit dem Schließer auf die Seite. Dort machte derselbe seine Meldung, leise, lange. Der Amtmann blieb unbeweglich. Keine Miene in seinem Gesichte zeigte, daß er etwas Anderes, als eine gewöhnliche dienstliche Anzeige, entgegen nehme. Auch der Schließer sprach mit großer Ruhe. Nur ein einziger unbewachter Seitenblick auf mich verrieth mir, daß er von mir sprach. Handelte es sich um mein nächtliches Abenteuer? Das schien mir gleich darauf das Benehmen des Amtmanns zu bestätigen.
Nach Beendigung seiner Unterredung mit dem Schließer trat er zu mir zurück. Er war ruhig und höflich wie vorher. Nur glitt ein leise forschender Blick wie unwillkürlich aus seinem Auge über mein Gesicht, und etwas kälter und zurückhaltender schien er mir doch geworden zu sein.
„Ich bedauere,“ sagte er zu mir, „Sie nicht in die Gefängnisse begleiten zu können. Ich erhalte in diesem Augenblicke eine Mittheilung, die mich abhält. Es ist mir übrigens sehr angenehm gewesen, einen so intelligenten und strebsamen jungen Beamten kennen gelernt zu haben.“
Da hatte ich zugleich meinen Abschied von ihm.
Ich dankte ihm für seine Freundlichkeit, drückte ihm, sein Compliment erwidernd, meine Bewunderung über Ordnung und Vortrefflichkeit seiner Einrichtung des Amtes aus, und schied von ihm. Er kehrte in seine Wohnung im Klostergebäude zurück. Ging er wirklich dahin, oder welches andere Ziel verfolgte er?
Mich führte der Schließer Martin Kraus zu den Gefängnissen. Ich war sehr neugierig, ob sich diese in der That nicht nach der Kirche, nach dem Kirchhofe, nach der Gegend meines nächtlichen Abenteuers hin befinden würden.
Sie lagen nicht nach dieser Seite, sie lagen, wie schon der Wirth mir gesagt hatte, in der völlig entgegengesetzten Richtung, nach der Stadtseite; die sämmtlichen Klostergebäude befanden sich zwischen ihnen und der Kirche mit dem Kirchhof. Jenes Klagen konnte also aus einem Gefängnisse nicht hervorgegangen sein, oder das Amt mußte mehrere Gefängnisse haben.
Der Schließer Kraus hatte nach der Entfernung des Amtmanns ganz die finstere Miene der vergangenen Nacht. Er sah nur nicht drohend aus. Dafür war er völlig schweigsam. Er führte mich, ohne ein Wort zu sagen, in das Gefangenhaus, in die einzelnen Gefangenzellen. Auf meine Fragen gab er nur die allernothdürftigste Auskunft.
Gefängnisse und Gefangene boten nichts Bemerkenswerthes dar, nur daß auch hier überall die größte Ordnung, Pünktlichkeit und Ruhe herrschte. Ein strenger, aber zugleich humaner Geist mußte auch hier walten.
Die Besichtigung war bald vorüber.
In den Zellen, in Gegenwart der Gefangenen hatte ich über Anderes mit dem Schließer nicht sprechen können. Auch jetzt mußte ich jede Frage über unser nächtliches Begegnen für überflüssig halten. Er stand zwar vor mir wie ein Untergeordneter, der seine Entlassung erwartet. Aber sein finsteres Gesicht sprach den festen Entschluß aus, mir auf keine Frage eine Antwort zu geben. Ich entließ ihn.
Und wie Vieles hätte ich ihn fragen mögen! Wie Vieles den Amtmann, der so plötzlich mich entlassen hatte! Wie Vieles die Leute in dem Städtchen, die aber nichts wußten, als daß es auf dem Kirchhofe spuke!
Aber daß ich hier ein Geheimniß zurücklassen müsse, wahrscheinlich ein furchtbares Geheimniß, um das vielleicht nur zwei Menschen wüßten, der finstere Gefangenwärter und der peinlich-ordentliche, gerechte, humane, aber doch auch kalte, gemessene Amtmann, das ferner aller Muthmaßung und Berechnung nach nur irgend ein gefangen gehaltenes Wesen betreffen könne, darüber war ich nicht in dem mindesten Zweifel mehr.
So reiste ich ab.
Sechs Jahre waren seitdem verflossen. Ich war nie wieder nach Z. gekommen. Ich hatte nie wieder etwas über mein dortiges Abenteuer gehört. Desto öfter hatte ich daran denken müssen.
Meine Mutter hatte auch nie wieder etwas von Nettchen Thalmann gehört. Ob sie noch oft an sie gedacht hatte, weiß ich nicht.
Ich war schon seit mehreren Jahren wohlbestallter Amtsassessor in der Nähe meiner Heimath.
Eines Tages erhielt ich ein mit „sehr eilig“ bezeichnetes, an mich persönlich gerichtetes Rescript aus dem Ministerium der Justiz und des Innern. Es war darin der Befehl für mich enthalten, mich Angesichts dieses nach Z. zu begeben, um an Stelle des plötzlich und schwer erkrankten dortigen Amtmanns die Direction des Amtes zu übernehmen. Der Postenlauf von der Residenz nach Z., hieß es ferner in dem Schreiben, sei ein langsamer; wahrscheinlich sei daher die gleichzeitig an das dasige Amt abgesandte Benachrichtigung von dem mir gemachten Auftrage dort bei meiner Ankunft noch nicht eingetroffen; ich habe dann gleichwohl sofort die Geschäfte zu übernehmen, und durch Vorzeigung dieses Rescriptes mich zu legitimiren.
[598] Der mir ertheilte Auftrag war, bei meiner Jugend an natürlichem wie an dienstlichem Alter, eine große Auszeichnung. Sie beschäftigte gleichwohl meine Gedanken kaum so sehr, als das mit neuer Kraft und Lebendigkeit vor mich hintretende Geheimniß, das ich vor sechs Jahren in Z., in dem Amte zu Z., hatte zurücklassen müssen. Jetzt mußte ich den Schlüssel zu ihm finden.
Mit dieser Gewißheit reiste ich gleich nach Empfang des Ministerialrescripts ab. Ich war noch unverheirathet. Meine gute Mutter lebte nicht mehr. Ich hatte keinen einzigen schweren Abschied zu nehmen.
Es war an einem Sonntag Abend, als ich in Z. eintraf.
Ich konnte an demselben Tage in meine neuen Geschäfte nicht mehr eintreten. Es war schon spät, ich mußte auch fürchten, die Beamten nicht bei der Hand, nicht einmal in ihren Wohnungen zu finden. Und ich wollte überraschen, um jenes Geheimnisses willen, daher vor Allem die Gefängnisse, den Gefangenwärter, den Schließer Martin Kraus, wenn er noch am Leben und im Amte war. Deshalb gab ich mich auch an dem Abende in dem Wirthshause nicht kund, und ließ mich vor Niemandem sehen.
Ich war in dem nämlichen Gasthofe abgestiegen, der mich vor sechs Jahren aufgenommen hatte, denn es gab keinen andern in dem Städtchen. Es war ein neuer Wirth da, der mich nicht kannte.
Am folgenden Morgen, gleich nach acht Uhr, der Zeit des Beginnes der Bureaustunden, begab ich mich auf das Amt. Ich wollte zugleich sehen, ob der strenge Ordnungsgeist des Amtmanns auch während seiner Krankheit nachwirke. Er wirkte nach. Alle Beamten waren auf ihrem Platze.
Ich ließ mich zu dem ältesten Assessor führen, der bis zu der Uebernahme der Geschäfte durch mich einstweilen die Direktion des Amtes führen mußte. Der Diener, der mich führte, kannte mich nicht, auch der Assessor nicht; er hatte mich bei meiner früheren Anwesenheit nicht gesehen.
Der Assessor war eine aufgeblasene Null, eine Schreiberseele, wie man ihrer leider auch in dem Richterstande so viele findet. Als interimistischer Chef hatte er sich doppelt aufgeblasen. Er empfing mich hochmüthig in seinem Arbeitszimmer; er stand nicht auf, er sah kaum nach mir auf.
„Wer sind Sie? Was wollen Sie?“
Ich überreichte ihm schweigend mein Ministerialrescript.
Da flog er freilich schnell genug in die Höhe, und er war nicht blos mein gehorsamster, er war mein unterthäniger Diener, der nur unterthänigst fragte, was zu meinen Befehlen stehe.
„Ich bitte nur,“ erwiderte ich ihm, „daß Sie, nach Inhalt des Rescriptes, mir sofort die Geschäfte übergeben.“
„Zu Befehl. Womit befehlen der Herr Amtmann den Anfang zu machen? Mit den Cassen?“
„Ich bin kein Amtmann; ich bin Amtsassessor, wie Sie.“
„Gehorsamster – unterthänigster Diener. Also zuerst die Cassen, befehlen Sie?“
„Ich denke, zu ihnen gehen wir später, damit die Rendanten unterdeß ihre Abschlüsse machen können.“
„Sie könnten aber auch unterdeß Unrichtigkeiten, selbst Malversationen verdecken.“
„Ich halte die Menschen nicht eher für schlecht, als bis ich sie für schlecht erkannt habe.“
„Ah, ah, im Beamtenleben –!“
„Die Beamten sollten die Besten unter den Guten sein.“
„Freilich, freilich!“
„Aber wenn ich bitten darf, so machen wir den Anfang mit der Uebergabe der Gefängnisse.“
„Wie Sie befehlen.“
Er sandte den Diener, der mich zu ihm geführt hatte, zu dem Schließer.
„Rufe Er auf der Stelle den Schließer hierher,“ befahl er blos.
Einen Namen nannte er nicht. Ich erwartete fast klopfenden Herzens, ob ich Martin Kraus werde eintreten sehen. Ich erkundigte mich unterdeß nach dem Befinden des Amtmanns.
„Er ist sehr schwach,“ erwiderte mir der Amtsassessor. „Er hatte plötzlich eine Lungenlähmung bekommen. Sowohl der Arzt des Städtchens, wie ein herbeigeholter Arzt aus der benachbarten größeren Stadt haben ihn aufgegeben. Er kann höchstens noch drei Tage leben.“
„Hat er Familie?“ fragte ich.
„Nur eine Tochter. Er ist schon lange Wittwer.“
„In welchem Alter ist die Tochter?“
„Sie wird ungefähr zwanzig Jahre zählen.“
War es jenes schöne, heftige, leidenschaftliche Mädchen, das ich an der Taxushecke so traurig bei dem blassen Schreiber gesehen, das sich dann so heftig und doch so liebevoll zärtlich des kränklichen jungen Mannes angenommen hatte?
Der Schließer trat ein. Es war der alte Martin Kraus. Er war in den sechs Jahren nicht älter geworden, war noch eben so kräftig und rüstig, wie damals, als ich ihn zum ersten Male sah, und sah auch noch eben so finster, verschlossen und schweigsam aus. Aber als er mich erblickte und sofort erkannte, da schrak er plötzlich und heftig zusammen, und als der Assessor ihm dann erklärte, daß ich der neue Vorgesetzte des Amtes sei und jetzt gleich mein Amt antreten und zuerst die Gefängnisse mir übergeben lassen wolle, da sank der riesige, kräftige Mann ineinander, daß er sich kaum aufrecht halten konnte; er schien in einer Secunde um zehn Jahre älter geworden zu sein.
Was war das? Hier mußte ich zu meinem Geheimnisse kommen.
„Sogleich befehlen der Herr?“ konnte er kaum fragen.
„Ich wünsche es,“ sagte ich.
„Gewiß!“ rief befehlend der Assessor, der noch, indem er mir das Amt zu übergeben hatte, als erster Beamter befehlen konnte.
Martin Kraus mußte gehorchen. Er gehorchte; er führte uns, als ob er uns zum Richtplatze, zu seinem Richtplatze führen sollte. Auf dem Wege erholte er sich jedoch nach und nach, als wenn näheres Nachdenken ihm eine plötzliche Hoffnungslosigkeit genommen habe. Auch in den Gefängnissen waltete noch der Geist des Amtmanns; überall die frühere Ruhe und Ordnung. Von den Gefangenen, von denen keiner über ein halbes Jahr lang saß, hatte kein einziger eine Klage zu führen, weder über seine Untersuchung, noch über seine Behandlung in der Haft. Das Gefängnißgebäude war das frühere. Es lag für sich allein, von den übrigen Kloster- oder Amtsgebäuden getrennt, von einer hohen Mauer umgeben. Daß zwischen ihm und dem Kirchhofe sich die sämmtlichen anderen Gebäude des Amtes befanden, habe ich schon gesagt. Ich ließ mich in jeden Raum des nicht weitläufigen Hauses führen, immer an mein Geheimniß denkend. Ich fand nirgends etwas Verdächtiges, nirgends eine Spur, daß in einem der Räume jemals ein Mensch etwa in verborgener Gefangenschaft gehalten sei. Ich mußte den Schlüssel zu dem Geheimnisse anderswo suchen. Nur in der Nähe der Kirche und des Kirchhofes konnte er auch jetzt noch zu finden sein.
Leider konnte ich ihn dort nicht sogleich suchen; ich mußte mir die sämmtlichen übrigen Geschäfte des Amtes übergeben lassen, und das nahm den ganzen Tag weg.
Welche Vorbereitungen und Verdunkelungen konnte nicht unterdeß der Schließer Martin Kraus treffen, der auch den Schlüssel des Geheimnisses hatte! Hatte sich darauf seine plötzlich erwachte Hoffnung gebaut?
Außer dem Schließer fand ich bei meiner Einführung in das Amt noch zwei andere Bekannte wieder. Der Actuarius mit dem rothen Gesichte und den rothen Haaren schien seine Kanzlei mit eben so cholerischem Diensteifer zu überwachen, wie vor sechs Jahren. Und der so kränkliche Schreiber Karl Brunner, der Schützling der schonen Amtmannstochter, saß noch auf seinem alten Platze an dem Kanzleitische. Er war noch mehr in die Höhe geschossen; aber auch seine Brust war noch mehr eingefallen und sein hohles Gesicht bedeckte rund um die hektische Röthe auf der Spitze der Backenknochen eine furchtbare Blässe; sein Athem war kurz, beschwerlich; man glaubte zu hören, wie jeder Zug sich mühsam durch zerstörte Lungen hindurcharbeiten müsse. Und der arme Mensch mußte noch immer die kranke Brust über den Schreibtisch krümmen!
Er stand mit jenem Geheimnisse in Verbindung. Auch dieses sein Schicksal?
In sein Gesicht schoß wieder eine dunkle Rothe, als er mich erkannte; dann wurde es so leichenblaß, daß selbst jene verrätherischen rothen Flecken verschwanden. Aber weiter schreiben konnte er. Hatte der cholerische Eifer des Actuar ihn das seitdem gelehrt? Der rothe Mann sah es wenigstens mit zufriedenem Stolze, daß er weiter schrieb. –
Die Uebernahme der Geschäfte war beendet. Ich hatte mit Ungeduld das Ende abgewartet.
Seit sechs Jahren hatte mich der Gedanke nicht verlassen, daß in den Räumen des Amtes auf geheimnißvolle Weise eine gefangene [599] Person verborgen gehalten werde; daß der Amtmann und der Schließer darum wissen; aber auch nur diese Beiden; daß auch nur diese Beiden darum wissen dürften, daß ein sehr wichtiger Grund vorliegen müsse, das Geheimniß zu bewahren, wahrscheinlich zugleich ein neues Verbrechen zu dem des Gefangenen, wenn dieser überhaupt ein Verbrechen begangen hatte.
Beide Beamte wußten aber auch, daß ich eine Ahnung von dem Geheimnisse hatte. Ich hatte sogar schon einmal den Versuch gemacht, meine Ahnung zur Gewißheit zu erheben. Ich hatte es damals aufgeben müssen; mir hatte jedes Mittel dazu gefehlt.
Heute, wenn das Geheimniß noch bestand, wie leicht konnte ich als Vorgesetzter des Amtes alle Mittel dazu mir verschaffen, wenn diese nicht schon vor meiner Ankunft beseitigt waren oder schnell nach meiner Ankunft beseitigt wurden! Und daß das Geheimniß noch bestand, daß der Gefangene – wie ich nun einmal meinte – noch immer in seiner verborgenen Haft war, darüber hatte das Erschrecken des Schließers mir keinen Zweifel gelassen.
Man hatte aber auch vor meinem Eintreffen schwerlich an Beseitigung jener Mittel denken mögen.
Der Amtmann lebte noch. Daß das Ministerium einen fremden Beamten zu seiner Stellvertretung schicken werde, daran hatte Niemand gedacht. Wäre man aber auch darauf vorbereitet gewesen, so hatte dies wenig zu sagen; denn wie außer dem Amtmann und dem Schließer kein anderer Beamter des Amtes das Geheimniß nur geahnt hatte, so konnte auch ein neuer Beamter nicht gefürchtet werden, der nicht schon einen Verdacht mitbrachte.
Das war einzig und allein ich, und ich war völlig unerwartet gekommen.
Freilich, auf desto mehr Eifer und Eile zur Verbergung des Geheimnisses seit meiner Ankunft mußte ich rechnen. Aber der Amtmann lag auf den Tod krank; nur der Schließer allein konnte mithin handeln. Er war indeß den ganzen Tag beschäftigt gewesen und hatte sich überdies immer beobachtet wissen müssen. Meine Anwesenheit hatte sämmtliche Beamte fortwährend in den Gebäuden zurückgehalten; selbst Neugierige hatten sich eingefunden. So hatte er am Tage schwerlich Zeit und Gelegenheit gehabt; erst der Abend konnte ihm diese bringen, und er mußte sie ihm auch bringen; er mußte dann aber auch mir Licht bringen.
So hatte ich combiniren müssen schon während der vielen Geschäfte, die mit der Uebernahme meines Amtes verbunden waren; so mußte ich nach deren Beendigung combiniren.
Aber welchen Weg sollte ich einschlagen, um zu dem Lichte zu gelangen? Mir standen mehrere Wege zu Gebote.
Der erste war, dem Schließer Alles, was ich wußte, meinen ganzen Verdacht geradehin auf den Kopf zuzusagen und ihn zur sofortigen Enthüllung der Wahrheit und Nachweisung des Gefangenen aufzufordern, für den Fall der Weigerung ihm die strengste Nachsuchung und, bis diese ein Resultat geliefert hätte, seine Einstellung in seinen amtlichen Functionen anzudrohen; dieser Weg war der geradeste. Es war von ihm am sichersten ein Resultat zu erwarten, schon darum, weil bei einer Entfernung des Schließers aus seinen Amtsverrichtungen und aus dem Amte der verborgene Gefangene nothwendig dem Verhungern ausgesetzt war und sein Tod im Falle einer Entdeckung ihm, dem Schließer, als einem Mörder zur Last fiel. Zu einem Morde hielt ich ihn nicht fähig. Allein das Alles setzte voraus, daß wirklich ein verborgener Gefangener da war, und dafür hatte ich keinen einzigen tatsächlichen Anhalt, nichts als persönliche Vermuthungen. Wie leicht konnten diese mich täuschen! Und hatten sie mich getäuscht, so hätte ich mich auf die allereinfältigste Weise von der Welt lächerlich gemacht und nicht nur meine Stellung in Z., sondern meine beamtliche Laufbahn für immer verdorben.
Die beiden zunächstfolgenden Wege beruhten auf der gemeinsamen Voraussetzung, daß der Schließer entweder den Aufenthaltsort des Gefangenen oder den Weg dahin noch verborgener als bisher machen oder den Gefangenen an einen noch verborgeneren Ort bringen werde. Beides konnte allerdings nur innerhalb des Umfanges der Amts- oder ehemaligen Klostergebäude geschehen. Ich konnte es aber in zweierlei Weise beobachten. Einerseits, indem ich selbst im Innern der Gebäude mich auf die Lauer stellte; aber es waren der Gebäude so viele, und es war mir völlig unbekannt, welches das rechte war. Andererseits konnte ich mich auf dem Kirchhofe aufstellen, um, wenn auch nicht wieder die Klagetöne jener Mitternacht, doch mindestens ein Geräusch der jedenfalls in der Nähe des Kirchhofes unter der Erde vorzunehmenden Arbeiten zu hören. Allein theils war es auch hier ungewiß, ob ich die richtige Gegend des Kirchhofs treffen werde, theils lief ich Gefahr, die ganze Nacht ohne Resultat auf dem Kirchhofe zubringen zu müssen, um dennoch vielleicht durch irgend einen Zufall entdeckt und zum Gespötte zu werden. Zudem waren beide Wege keine geraden, offenen.
Es blieb mir nur ein vierter Weg übrig. Er war zugleich ein offener und er konnte mich nicht compromittiren. Diesen schlug ich ein.
Es war schon dunkel, als meine Geschäfte beendigt waren.
Ich ließ den Schließer Martin Kraus zu mir rufen. Er kam mit seiner finsteren, verschlossenen, undurchdringlichen Miene und erwartete schweigend, was ich ihm befehlen würde.
Ich sagte ihm nichts auf den Kopf zu; ich wußte ja auch nichts. Aber ich sagte zu ihm:
„Schließer Kraus, Ihr seit der älteste Beamte hier am Amte?“
„Zu Befehl, Herr Assessor.“
„Wart Ihr schon vor dem Herrn Amtmann hier?“
„Zehn Jahre früher.“
„Und wie viele Jahre seit Ihr im Ganzen hier?“
„Sechsunddreißig,“
„Immer als Schließer?“
„Die ersten acht Jahre als Schließerknecht, dann als Schließer.“
„Ihr habt zur Zeit keinen Schließerknecht?“
„Ich versehe den Schließerposten allein, Mein Vorgänger war krank, darum hatte er einen Knecht zur Hülfe.“
„Ihr kennt die sämmtlichen Amtsgebäude hier wohl genau?“
„Zu Befehl, Herr Assessor.“
„Ich wünsche, sie ebenfalls kennen zu lernen. Ihr führt mich wohl umher?“
„Zu Befehl.“
„Jetzt gleich.“
„Zu Befehl.“
„Holt eine Laterne herbei, oder gleich zwei; wenn die eine ausgeht, bleibt die andere.“
„Zu Befehl.“
„Habt Ihr eine Blendlaterne?“
„Zu Befehl.“
„Bringt sie mit, und dazu eine größere.“
„Zu Befehl, Herr Assessor.“
Er ging.
„Zu Befehl! Zu Befehl, Herr Assessor!“ Ich hatte fast keine anderen Worte von ihm gehört. Sie waren immer mit derselben festen, unzerstörlichen Ruhe gesprochen. In dem finsteren, harten Gesichte hatte sich nichts bewegt.
Er war nach wenigen Minuten mit den zwei Laternen wieder da. Ich nahm die Blendlaterne.
„Wohin befehlen der Herr Assessor zuerst?“
Ich hatte mir schon am Tage während einer Mittagspause die Lage der sämmtlichen zu dem Amte gehörigen Gebäude wiederholt betrachtet. Sie bestanden aus dem ehemaligen eigentlichen Kloster. Es war ein langes, gerades Gebäude, in welchem sich jetzt die sämmtlichen Geschäftsbureaux und die Wohnungen der höheren Beamten befanden. Links von ihm, ein wenig vorstehend, lag das Gefangenhaus, isolirt und mit einer hohen Mauer umgeben. In ihm hatte zugleich der Schließer seine Dienstwohnung. Rechts vom Kloster, mit seiner ganzen Front quer vorspringend, befand sich ein großer, hoher Speicher; er diente blos zur Aufnahme und Aufbewahrung der an das Amt als Rentamt einzuliefernden Naturalien, Roggen, Weizen, Gerste und anderer ländlicher Producte. Er war unbewohnt. Rechts von ihm, wieder durch einen Zwischenraum von ungefähr zehn Schritten getrennt, stand die alte Klosterkirche; sie war verfallen und wurde zu nichts mehr gebraucht. Zu ihrer rechten Seite, nach einem Zwischenraume von ungefähr zwanzig Schritten, lag ein langes Gebäude, das zum Aufbewahren der Wirthschaftsvorräthe für die Beamten des Amtes und für die Gefangenen, zu Stallungen und Remisen diente und in dem zugleich die Unterbedienten des Amtes ihre Wohnungen hatten. Sämmtliche Gebäude lagen in einem länglichen Viereck; der Platz in ihrer Mitte war ein freier Hof. Durch diesen gelangte man in ein eisernes Gitterthor zur Rechten des Gefangenhauses, mithin so, daß, wenn man durch das Thor trat, man links zuerst das Gefangenhaus, dann das ehemalige Kloster, jetzt sogenannte Amthaus, darauf gerade vor sich den hohen Speicher, sodann rechts, gerade dem [600] Amthause gegenüber, die Kirche, und hierauf neben dieser, dem Gefangenhause gegenüber, das Wirthschaftsgebäude vor sich sah.
Der hohe Speicher und die Kirche stießen mit ihren Rückseiten an den alten Klosterkirchhof, der zugleich ein Gemeindekirchhof gewesen war, jetzt aber gleichfalls nicht mehr gebraucht wurde.
Das Ganze war nach außen von einer hohen, dicken Mauer umschlossen, jedoch nicht überall. Die nach außen vorspringende Kirche stand frei; der Garten des Amthauses, unmittelbar hinter diesem gelegen, war nur mit einer dichten Taxushecke umgeben.
„Wohin befehlen der Herr Assessor zuerst?“ hatte mich der Schließer gefragt.
„Zu dem Speicher. Ihr habt doch die Schlüssel?“
„Zu Befehl.“
Er führte mich zu dem hohen Speicher.
Wir Beiden waren ganz allein; ich hatte keinem Dritten von der Besichtigung etwas gesagt und mußte auch bezweifeln, daß der schweigsame Schließer davon gesprochen hatte.
Der Speicher war ein altes Gebäude, noch aus den Zeiten des Klosters. Er hatte aber auch schon damals wohl nur seine heutige Bestimmung gehabt. Er bestand in allen seinen drei Stockwerken nur aus fast regelmäßigen, ungeheueren Räumen zur Aufnahme jener Naturalien. Es war jetzt September; sie waren beinahe sämmtlich gefüllt.
An einen geheimen Versteck konnte man hier kaum denken. Ueberall lagen die Mauern, so weit die Vorräthe nicht in die Höhe reichten, nackt und kahl da; nirgends ein Zeichen, daß eine geheime Thür, eine verborgene Treppe vorhanden sein könne.
„Zu der alten Kirche, Schließer!“
„Zu Befehl, Herr Assessor!“
Immer der gleichmäßig ruhige, feste Ton.
Wir gingen zu der Kirche. Speicher und Kirche stießen, wie gesagt, an den Kirchhof. Ersterer war nur durch die hinter ihm laufende Mauer davon getrennt und letztere grenzte unmittelbar daran. Beide lagen zehn Schritt von einander; den Zwischenraum trennte die Mauer gleichfalls von dem Kirchhofe.
In dem Speicher, in dem Zwischenraume, in der Kirche, nur in einem dieser drei Räume konnte der Ort oder der Eingang zu dem Orte sich befinden, an welchem ich vor sechs Jahren das Wehklagen gehört hatte. In dem Speicher hatte sich mir keine Spur eines Verdachtes gezeigt; auch jener Zwischenraum zeigte keine. Ich besichtigte ihn genau, ich leuchtete mit meiner Laterne überall hin; der Schließer mußte überall das Licht der seinigen hinfallen lassen. Der Boden bestand aus harter, fester Erde, die vielleicht seit Menschengedenken nicht aufgewühlt war. Die Steine der Mauer saßen fest, wie sie vor ein paar Jahrhunderten zusammengemauert waren.
„Schließt die Kirche auf, Schließer.“
Er schloß sie auf.
Die Kirche hatte, wie ich schon früher bemerkte, nach dem Kirchhofe hin zwei Thüren, ein großes Portal und ein Pförtchen, das, wie ich meinte, in die ehemalige Sacristei geführt hatte. Nach dem Kloster-, jetzt Amtshofe hin hatte sie ein zweites Portal, es hatte wohl den Haupteingang für die Geistlichen, für Processionen und andere kirchliche Feierlichkeiten gebildet. Weitere, als diese drei Thüren, waren nicht da.
In früheren Zeiten hatte ein bedeckter Bogengang unmittelbar aus einem oberen Stockwerke des Klosters auf ein verschlossenes Empor der Kirche geführt; er war nur für die Nonnen bestimmt gewesen. Seit Aufhebung des Klosters war er abgebrochen und der Eingang vermauert. Der Schließer Martin Kraus schloß das Portal am Hofe auf. Dabei machte mich ein Umstand stutzig. Das Schloß öffnete sich leicht; das Thor drehte sich ohne Geräusch in seinen Angeln. Es mußte also oft, auch in neuester Zeit aufgeschlossen sein. Dennoch war die Kirche außer allem Gebrauch.
„In wessen Gewahrsam befindet sich der Schlüssel zu der Kirche, Schließer?“
„Ich führe die Schlüssel zu allen Gebäuden.“
„Warum?“
„Ich bin der Schließer für Alles.“
„Kommt Ihr oft in die Kirche?“
„Zu Befehl.“
„In welchen Verrichtungen?“
„Ich lasse hier die Kleidungsstücke der eingebrachten Gefangenen reinigen. Der Ort ist am abgelegensten.“
Wir traten in die Kirche ein.
Es war eine gewöhnliche alte, verfallene, zum Theil absichtlich zerstörte Klosterkirche. Sie war nicht groß; sechs kahle, etwas plumpe Säulen bildeten das Schiff; das Chor mit dem Hochaltar war eine große, leere Nische; Emporbühnen, in denen früher hinter Gittern die Nonnen ihre Andacht verrichtet hatten, waren abgebrochen; einzelne Risse in der Mauer zeigten kaum noch an, wo sie sich befunden hatten. Ein Schmuck, nur eine Spur, daß irgend ein Kirchenschmuck vorhanden gewesen sein könne, war nirgends mehr zu sehen. In den hohen Bogenfenstern befand sich keine einzige Scheibe mehr; selbst die Fensterkreuze waren nur noch hin und wieder da. Das Ganze war so vollkommen zerstört, so nackt, so kahl, so vollständig prosaisch, daß selbst die schwache, ungewisse, schwankende Beleuchtung der beiden Laternen an dem späten Abende in dem ehemaligen Gotteshause keinen Eindruck, weder auf Gefühl, noch auf Phantasie machen konnte. Man sah sich eben nur in einem nackten, kahlen, wüsten Raume. Zum Ueberfluß waren im Chor ein paar Seile, wie zum Trocknen von Wäsche, aufgespannt; auf einem lag ein altes, zerrissenes Hemd.
Ich nahm mir nicht die Zeit, Betrachtungen über den Wechsel und Verfall der menschlichen Dinge anzustellen, auch der Gotteshäuser. Ich durchschritt, von dem Schließer gefolgt, die ganze Kirche und besah überall den Erdboden und die Mauern; weiter war freilich nichts da zum Besehen. Aber Mauern und Erdboden waren auch hier überall fest und hart, und wie seit Menschengedenken, vielleicht seit Jahrhunderten nicht gerückt und gerührt. Da konnte gleichfalls nirgends ein heimlicher, verborgener Versteck sein. Ich unterwarf zuletzt die beiden Thüren, die auf den Kirchhof führten, meiner Untersuchung.
Das große Portal, eine Flügelthür von altem, dickem, überall mit ungeheueren Nägeln beschlagenem Eichenholze, lag in festem Verschlusse. Auch von innen zeigten zahllose Spinnengewebe, wie lange sie nicht könne geöffnet gewesen sein.
„Habt Ihr den Schlüssel zu der Thür, Schließer?“
„Es ist kein Schlüssel für sie da.“
Wir gingen zu dem kleinen Pförtchen. Es führte nicht, wie ich vermuthet hatte, in die ehemalige Sacristei, sondern in eine ehemalige Seitencapelle der Kirche, die auch nach innen mit dieser durch eine jetzt zerstörte Thür verbunden war. Wir traten in die Capelle. Sie war kahl und nackt, wie die Kirche; Boden und Mauern darin waren fest und hart, wie in dieser.
Ich untersuchte die Thür, jenes auf den Kirchhof führende Pförtchen. Von außen war es mit Bretern beschlagen gewesen; so war es auch von innen der Fall. Aber ich berührte eins dieser Breter. Ich faßte es stark an, drückte und schob daran, und auf einmal war es mir, als wenn es nachgebe, als wenn es sich schieben lasse. Nur ein wenig, nur sehr wenig; aber es gab doch nach, es wich doch zur Seite, wenn ich auch meine Hand sehr anstrengen mußte. Das war mir ein wichtiger Fund; aber ich durfte mir nicht merken lassen, daß ich ihn gemacht hatte. Freilich konnte ich deshalb auch meinen Begleiter nicht ansehen und nicht gewahren, ob er meinen Fund bemerkt und welchen Eindruck er auf ihn gemacht hatte.
Als ich mich nach einer Weile, wie zufällig, nach ihm umwandte, bemerkte ich nicht die mindeste Veränderung an ihm.
„Auch dieses Pförtchen wird nicht gebraucht?“ fragte ich ihn, gleichgültig, wie ich die anderen Fragen an ihn gerichtet hatte.
„Nein,“ antwortete er nur ruhig, wie er mir immer geantwortet hatte.
Ich war mit meinen Besichtigungen zu Ende. Es war keine Stelle mehr zu untersuchen, welche möglicher Weise mit meinem früheren nächtlichen Abenteuer hätte in Verbindung stehen können.
Ich trat meinen Rückweg an.
Ich hatte nichts Verdächtiges gefunden, als jene verschiebbaren Breter an dem Capellenpförtchen; aber wie gering, wie entfernt, wie unbestimmt war der Verdacht!
Der Schließer war ohne alle Unterbrechung ruhig, unbeweglich geblieben.
Sollte ich ihn nicht doch noch überraschen können, um nur eine einzige verräterische Veränderung seiner Mienen aufzufangen?
Obgleich das Damwild ursprünglich nicht einheimisch bei uns ist, sondern aus dem südlichen Europa und der Berberei stammt, so ist doch gerade diese Gattung beim großen Publicum die bekannteste, weil sie meist nur in Wildgärten gehalten wird und sich der Betrachtung leicht darbietet, zumal da sie vor allen in eingeschlossenem Raum ungemein fromm[1] wird. Suchen wir es denn auch in einem solchen auf, und zwar diesmal auf einem bestimmten, wirklichen Schauplatze. Der schöne Wildgarten umgibt ein Schloß, das wohl die meisten Leser, wenn auch nicht aus eigner Anschauung, doch dem Namen nach kennen – ich meine das königliche Jagdschloß Moritzburg bei Dresden. Wer hätte nicht schon von den glänzenden Festen des prachtliebenden Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen, August des Starken, die in diesem Schlosse und seiner Umgebung abgehalten worden sind, gehört oder gelesen? Oder wer hätte nicht von der weltberühmten, in ihrer Art einzigen Hirschgeweihsammlung vernommen, welche die innern, sonst ziemlich schmucklosen Räumlichkeiten ziert? Gibt es doch hier das vielendigste Edelhirschgeweih, was man überhaupt kennt: ein Geweih von 66 Enden! Geschossen wurde dieser Hirsch, der 6 Centner 11 Pfund wog, von Friedrich I. von Preußen im Jahre 1696 und dem Kurfürsten von Sachsen, August dem Starken, zum Geschenk gemacht. Außerdem befindet sich in dem mit vier großen runden Eckthürmen und einem höheren Capellenthurme geschmückten Schlosse noch manche Sehenswürdigkeit aus der Zeit des starken August; unter anderm sein Himmelbett in einem mit den glanz- und farbenreichen Federn tropischer Vögel bekleideten Zimmer, welche Tapete aus Mexico herrührt und Geschenk des Königs von Spanien ist. Andere Zimmer haben gemalte Ledertapeten, auf denen Jagdscenen mit dem Portrait des Königs, der Gräfin Königsmark, der Gräfin Kosel und anderer bekannter Persönlichkeiten veranschaulicht sind. Auch theilweise sehr werthvolle Bilder fehlen nicht, wie z. B. von Lucas Kranach, dann ein prächtiges Bild: ein Wilddieb einen Rehbock aufbrechend, lebensgroße, ganze Figuren von Ch. Paudig. Dieses Gemälde hat noch ein besonderes Interesse dadurch, daß der darauf dargestellte Wildschütz der letzte (in Sachsen) zum Tode verurtheilte sein soll, und zwar zu einer der grausamsten Todesarten, die es gibt. Er wurde nämlich auf einen lebenden Hirsch gebunden, dem man die Freiheit [602] gab. Natürlich stürzte das durch die ungewohnte Last in Angst versetzte Thier in rasendem Lauf durch Dick und Dünn, bis es verendend zusammenbrach. Es geschah dies auf dem Steinbacher Revier im Moritzburger Forstbezirk, wo der Hirsch mit dem noch festgebundenen zerrissenen Leichnam des Unglücklichen gefunden ward. Doch entziehen wir uns dem gräßlichen Bild, und treten wir von Dresden aus unsere Wanderung an, um die bewaldete Gegend, die eine Hochebene ist, friedlich zu durchstreifen.
Schon auf halbem Wege, ein und eine halbe Stunde von der Residenz, nimmt uns eine schnurgerade, ehrwürdige alte Kastanienallee auf, der sich ungefähr drei Viertelstunden vor dem Schloß eine noch ehrwürdigere, prachtvolle Lindenallee anschließt, welche bis vor das Schloß führt. Da liegt die stattliche Moritzburg, umgeben von zwei Weihern, auf deren einem man eine kleine Insel mit einem von italienischen Pappeln umgebenen Pavillon – ein Anblick, wie die Illustration eines Stammbuches – liegen sieht. Beide Weiher sind nur durch einen Damm getrennt, auf dem eine kurze, zopfig verschnittene Kastanienallee geradezu in die mit verschnittenen Taxus- und anderen Bäumen verzierte Umgebung führt, von wo aus die breite Auffahrt nach dem höher gelegenen, charakteristisch mit Hirschgeweihen verzierten Schlosses beginnt. Am Anfang derselben blasen zwei vortrefflich in Stein ausgehauene lebensgroße Jäger im Roccococostüm, mit mächtigen Flügelhörnern versehen, ihr stummes „Hallali“. Auf beiden Seiten der Auffahrt stehen auf steinernen Geländern pausbackige, ebenfalls steinerne, mit Emblemen der Jagd und Fischerei bezeichnete Jungen. Auch die Terrasse des Schlosses ist rings herum von dergleichen Gestalten umgeben, unter denen sich wiederum auf den Ecken lebensgroße Jäger mit Hunden u. s. w. auszeichnen, besonders zwei, welche ihrem Costüm nach einer früheren, der Zeit des Mittelalters, angehören. Rechts und links gehen Freitreppen hinan, während die hintere Seite abermals eine breite Auffahrt bildet, die in den unmittelbar dahinter liegenden Schloßgarten mündet. Dieser führt uns in seinem Zopfstyl mit den sonderbar künstlich geformten Bäumen und Hecken so recht charakteristisch in jene Tage der Vergangenheit. Sechs kleine pavillonartige Häuschen sind am Fuße des Schlosses vertheilt.
Das Ganze nun umgibt der Thiergarten, und zwar ursprünglich der nicht bedeutend umfangreiche sogenannte alte Thiergarten, in dessen Mitte das „Hellhaus“ steht. Es ist dieses ein achteckiges, zweistöckiges, erhöht liegendes Gebäude, von dem aus acht Alleen den Thiergarten durchschneiden, welche dazu bestimmt waren, bei früheren Jagden wahrnehmen zu lassen, wo sich das Jagen hingewendet habe, indem auf jenem Hellhause nach der betreffenden Richtung eine Fahne ausgesteckt wurde, die man von den Alleen aus bequem beobachten konnte. Außerdem liegt östlich vom Schlosse die Fasanerie mit ihrem charakteristischen, in chinesischem Styl erbauten Schlößchen, an dessen vier Ecken lebensgroße, in Stein ausgehauene verendende Hirsche mit mächtigen natürlichen Geweihen liegen. In Verbindung mit diesem Schlößchen steht das sogenannte Garnhaus, ein ebenfalls in chinesischem Styl erbautes, aus lauter dünnen Latten zusammengefügtes, luftiges Gebäude, in welchem unter lebendigen Taxushecken und künstlichen Palmen Fontainen plätschern und buntfarbige Gold- und hellglänzende Silberfasanen nebst prächtig schillernden Pfauen umherwandeln, während das Proletariervolk der Sperlinge in den blechernen Blättern der Palmeninsel sein Wesen treibt. Dicht dahinter liegt der „Großteich“ von bedeutendem Umfange, versehen mit einem Leuchtthurm und einer Insel, auf der unter Pappeln und Trauerweiden ein Pavillon steht, welcher früher, wie jener auf dem Schloßteiche, bei Festlichkeiten zu fröhlichen Schäferstunden benutzt worden sein soll. Ein Seeschiff in verkleinertem Maßstabe, das ebenfalls früher unter Kanonendonner seine hohen Gäste auf dem Teiche umhergetragen hat, ist nicht mehr vorhanden, hat jedoch noch bis in die neuere Zeit existirt.
Zwischen dem Fasanen- und dem Hauptschlosse zieht sich ein breiter Canal hin, der die „weißen Hirschgärten“ durchschneidet, in denen sich bis in die jüngste Vergangenheit das sogenannte „Bläß-“ und weiße Edelwild befand – Varietäten, die leider in Moritzburg ausgestorben sind. Die verwaisten Räume werden jetzt nur von verwilderten Haideschnucken bewohnt, und doch haben gerade diese Gärten mit ihrem zopfigen und doch so respectablen Schmuck einen eigenthümlichen Reiz. Großartige, für Wasserkünste bestimmte Gruppen, Vasen, Statuen und breite Canäle bilden zu den mächtigen Eichen, Buchen, Fichten u. s. w. einen eigenen Contrast, sowie die dabei stehenden, aus glatt verschnittenen, nach oben zu die Höhe mächtiger Bäume erreichenden Fichtenhecken gebildeten kolossalen Buchstaben A. F. A. für die wunderbare Ausdauer unserer Vorfahren zeugen, die so etwas anlegen konnten, ohne hoffen zu können, ihre Schöpfung je in ganzer Vollendung zu sehen.
Dies ist so der eigentliche Complex von Moritzburg; es ist jedoch dem „alten Thiergarten“ noch eine bedeutende Waldung beigefügt worden, der sogenannte „Hinterwald“ und die „Oberecke“, so daß der ganze, ringsherum durch einen hölzernen Wildzaun vermachte Thiergarten nun gegen 4000 Acker umfaßt. An Wild enthält er Sauen, Hochwild und Damwild, nicht gerechnet die Rehe, welche durch den Zaun ein- und ausgehen.[2] Es steht daher zu erwarten, daß wir auf unserer Wanderung auch noch anderes Wild, als das vorzugsweise gesuchte, zu sehen bekommen, und wir werden unsere Unterhaltung nicht beeinträchtigen, wenn wir es nicht gänzlich unbeachtet lassen. Zuvörderst wenden wir uns wieder dem Hauptschlosse zu, in dessen Nähe wir nicht lange zu suchen haben werden, um auf das Gewünschte zu stoßen.
Wir gehen am Schloßteiche vorüber, dessen Damm eine Kastanienallee bildet. Die ehrwürdigen, alten Baume senken ihre Aeste tief hinunter, um mit Zweigen und Blättern das klare, kühle Wasser zu streifen, als zöge sie eine unbewußte Sehnsucht dahin. Säuselnd und flüsternd klingt’s im Schilf, das unter ihnen wächst, und setzt sich fort in den schwankenden, niedergebeugten Aesten der alten Kastanien, bis es in den hohen Wipfeln wie ein voller Accord dahin rauscht. Weiter hin, ein Stück hinter dem Schlosse, ersteigen wir einen sanften Anhang, dessen hügeliges Terrain stellenweise mit einzelnen mächtigen, silberbemoosten Steinblöcken oder mit Gruppen solcher bedeckt, so wie mit alten, zum Theil schon verwitterten Buchen bestanden ist. Wie ladet hier der kurze Rasen unter dem herbstlich gefärbten, goldenen Laubdache ein, sich darauf hinzustrecken und den bezaubernd schönen Anblick zu genießen, der sich nördlich vom Schlosse dem erstaunten Auge darbietet! Befanden wir uns eine kurze Strecke hinter uns noch unter Statuen, Mauern und Thürmen und unter Bäumen, die, durch Menschenhand in bestimmte Formen gebracht, kaum noch an die Natur erinnerten, so schweift jetzt das Auge über eine echte stille Waldlandschaft hin. Unmittelbar vor uns, unter dem Buchenhange, dehnt sich eine weite, hier und da durch eine einzelne mächtige Eiche oder Buche beschattete Waldwiese hin, hinter der ein weiter Wasserspiegel, der sogenannte „Mittelteich“, umschlossen von Nadelholzwald, sich ausbreitet. In herbstlich morgentlichem, ruhigem, silbernem Ton liegt das Ganze vor uns. Eben rührt sich kein Lüftchen, so daß die alten Buchen über uns wie träumerisch schweigen und nur das Klopfen eines Spechtes, gleichsam der Herzschlag dieser stillen und doch so beredten Zeugen eines liebenden Schöpfers, zu hören ist. Sichtbar sind in diesem Augenblicke von lebenden Wesen nur ein über dem schilfbekränzten Weiher kreisender Reiher und ein paar im Sonnenschein weithin leuchtende Möven, die über der spiegelnden Fläche kreischend umherkreuzen, um dann und wann niederzuschießen und dem Gewässer die scharf erspähte Beute zu entreißen.
Nicht satt sieht man sich an dieser melancholischen friedlichen, stillen, feierlichen Waldesnatur. Immer und immer wieder schweifen die Blicke darüber hin, bis sie dort auf dem Bruch an einem Gegenstande haften bleiben, der sich eben bewegt und den man, wenn dies nicht der Fall wäre, wohl für einen aus dem hohes Grase hervorragenden Ast halten könnte. Aufmerksam gemacht, entdeckt man aber, daß es das Geweih eines Damhirsches ist. Jetzt sieht man auch noch mehrere hervorragen, und genau hinüberblickend gewahrt man die Köpfe eines ganzen Trupps. So haben wir denn vor uns, was wir suchten, wenn auch etwas fern und liegend. [603] Schreiten wir deshalb darauf zu, um die Thiere wenigstens flüchtig und flüchtend zu betrachten; denn so leicht sie am Fütterungsplatze oder auch wohl im Stangenholz an sich herankommen lassen, – auf freier Wiese halten sie ungern.[3]
Und richtig, kaum haben wir uns bis auf 3–400 Schritt genähert, so erhebt sich der ganze Trupp, Eines nach dem Andern, Groß, Klein, Weiße und Bunte. Alle wenden uns die Köpfe zu, uns neugierig anäugend. Jetzt wendet ein altes Thier um und schreitet langsam vorwärts; dann geht es in einen unbeholfenen, bocksteif aussehenden Galopp über und alle Uebrigen folgen in dieser drollig aussehenden Gangart nach, die Blumen[4] dazu hoch emporhebend, bis sie sich in’s gewöhnliche Trollen finden. In einiger Entfernung machen sie sämmtlich wieder Halt, um nochmals zurückzuäugen, und verschwinden dann, ruhig weiterziehend, in dem gegenüberliegenden Walde.
Nachdem wir wenigstens einen flüchtigen Gesammteindruck der gesuchten Wildgattung gewonnen, lassen wir uns verleiten, ihnen nachzufolgen, um sie möglicher Weise nochmals und besser zu Gesicht zu bekommen, oder, wenn nicht dieselben, doch andere. Schon ehe wir zum Saume des über die Wiese hinliegenden Waldes gelangen, springen kurz vor uns im Grase mit erschrecktem, grunzendem Tone mehrere Sauen auf, die – es sind unter ihnen zwei Bachen mit einer Schaar von Frischlingen – eilig die Flucht ergreifen. Ein Keiler nur bleibt in kurzer Entfernung stehen und kommt mit aufgehobenem Gebräch[5] schnaubend ein paar Schritte zurück, eilt aber dann ebenfalls mit grunzend auffahrendem Tone dem Rudel nach. In der Hoffnung, auch dieses Wild weniger flüchtig betrachten zu dürfen, setzen wir unseren Waldgang fort. Meist ist es Kiefernwald, der uns jetzt aufnimmt, obgleich gerade dieser Theil des Thiergartens, „der Hinterwald“, manche echt waldige Partie von Fichten, hier und da eine alte, verwetterte Eiche oder Buche aus alter, guter Zeit bergend, in sich schließt.
Von hohem Reiz sind aber die mitten im Walde liegenden Brüche, auf denen öfter einsam eine oder mehrere viele hundert Jahr alte Eichen stehen und mit ihren zackigen, theilweise vom Blitz zerschlagenen Wipfeln in die Luft hineinstarren. Kreischend tummeln sich darin die Nußheher, die dann mit welligem Fluge dem die Wiese begrenzenden Nadelwalde zufliegen, um hier emsig die im Kropfe aufgespeicherten Eicheln zu verstecken, und so unwillkürlich die Beförderer der Laubholzculturen zu werden. Auch Sauen erblickt man, wie sie ruhig, da sie von uns, die wir still am Waldsaum hingehen, keinen Wind bekommen, die Eicheln unter mächtigen Bäumen aufsuchen. Stören wir sie nicht in ihrer Lieblingsäßung und benutzen wir den Vormittag, um den Hinterwald zu durchstreifen. Wieder kommen wir an stille Teiche, die „Alten Teiche“ genannt, und sehen wohl hier und da ein Stück Wild oder auch einen Edelhirsch hinziehen, aber mit der zunehmenden Tageswärme sucht Alles mehr die schattigen Dickichte auf. Stiller wird’s und einförmiger; kein Vogel, kein sonstiger Ton läßt sich hören, über der blühenden Haide sieht man die Luft zittern, und die Sommerfäden ziehen über die Blößen hin; der Mittag naht heran.
Auch wir suchen einen zum Haltmachen geeigneten Ort, doch nach guter Waidmannsart mit Fourage in der Jagdtasche versehen, nicht im Wirthshause, sondern im duftigen, schattigen Walde. Um unsern nächsten Zweck zu erreichen, gehen wir noch ein Weilchen, und ziehen uns am Hinterwalde zurück. So kommen wir wieder an den Mittelteich, aber an sein anderes Ende. Hier erlauben wir uns, in einer Thorwärterwohnung uns durch einen frischen Trank Bier zu erquicken, worauf wir gestärkt weiter ziehen, und zwar den Teichdamm entlang, der noch vor kurzer Zeit einen der malerischsten Punkte der Umgegend von Moritzburg bildete. An tausend Jahr alte, kerngesunde Eichen standen hier, wundervoll gruppirt, als Baumrecken der Vorzeit – sie verfielen der Neuzeit als Opfer, weil in der Forstverwaltung das Princip aufgestellt wurde: auf Dämmen keinen Baum zu dulden. Kein Mächtiger that Einspruch diese lebendigen Denkmäler grauer Vergangenheit zu schützen. – Also mit einem Seufzer schreiten wir auf kahlem Damme dahin und schlagen uns, wie jener grollende Indianer „seitwärts in die Büsche.“ Im Schatten untermischten Holzes von Kiefern und Fichten, prächtigen Buchen und Eichen erreichen wir das schon Eingangs erwähnte „Hellhaus“, um vor der Hand an diesem Platze zu rasten.
Kaum kann man sich ein reizenderes Plätzchen zum Ruhen wählen, als dieses. Vor der heißen Mittagssonne geschützt durch den Schatten des auf einer Erhöhung liegenden Gebäudes, auf kurzem, von wildem Thymian duftendem Rasen hingestreckt zu liegen, umgeben von prächtigen feinnadeligen Weimuthskiefern, alten bemoosten Lärchbäumen, Fichten und Buchen, die theils die acht Alleen bilden, theils die unmittelbare Umgebung dieses stillen Asyls sind, und Alles dies an einem schönen Herbsttage zu genießen, ist von unnennbarem Reize. Stundenlang möchte man sich dem Wohlgefühle überlassen und den dahineilenden, silberscheinigen Wolken zuschauen, die bald in dieser, bald in jener phantastischen Gestalt am blauen Aether dahinziehen, immer und immer die Formen wechselnd, bis sie zergehen und endlich dem Auge ganz verschwinden. Neue kommen, zerrinnen und verschwinden, immer dasselbe Spiel – und doch immer anziehend, nimmer ermüdend! Dazu löst der linde Wind die aromatischen Wohlgerüche des Thymians und des Nadelholzes und streift weiter durch die feinen, langen Nadeln der Weimuthskiefern und all’ die nadel- und blätterreichen Wipfel des Waldes dahin, daß es wie ein sanftes Schlummerlied klingt. Träumerisch schließt man die Lider, die Eindrücke des Tages am inneren Auge nochmals vorüberziehen zu lassen, bis man dabei entschlummert und die Träume in phantasiereicher Geschäftigkeit zauberische Bilder schaffen. Da eilt man flügelbegabt mit den Wolken über die Wipfel des Waldes dahin, sieht liebliche Wildgruppen unter sich oder läßt sich wohl gar zu den nun vollkommen Zutraulichen hernieder, unter ihnen zu wandeln und mit ihnen verständlich zu verkehren. Ein ganzes Leben lebt man mit ihnen, zieht mit in thaufrischen Gräsern umher, über blühende Haide hinaus auf Wiesen und an die Weiher. Jahre sieht man so an sich vorüberstreichen in freier Ungebundenheit und doch brauchte die Phantasie der Seele vielleicht nur Minuten, ja Secunden dazu, all’ diese glücklichen Bilder herbeizuzaubern. Hier erwacht man aus einem schönen Traume wenigstens zu einer schönen Wirklichkeit und gestärkten, heitern Sinnes gibt man sich wieder froh dem Vollgenusse der freien Natur hin.
Verweilen wir noch etwas auf unserem Ruhepunkte und sehen bald da, bald dort über eine der Alleen ein Stück Hochwild, Damwild oder einen borstigen Keiler ziehen, die sich nun nach und nach dem nahen Fütterungsplatze zuwenden und bis dahin entweder in den umliegenden Dickichten und Stangenhölzern verweilen, oder auf der freiliegenden Wiese im hohen Grase liegen oder sich dort äßen. Dies ist auch der Ort, wo wir unsere Burschen, die Damhirsche nebst Familie, näher in Augenschein nehmen werden.
Auf einem von Nadeln glatten Wege gehen wir, oft ausgleitend, die östliche Allee hinab und kommen auf einen freien Bruch, auf dem am Rande des Waldes bereits allerhand Gewild erscheint, um der baldigen Fütterung, die hier auf einer Blöße geschieht, zu harren.
Inzwischen lassen wir uns auf die von rohen Stangen massiv gezimmerte Bank nieder. Die Zeit kann uns nicht lang werden; denn da sieht man den borstigen, dunkeln Kopf eines Keilers aus dem nahen Dickicht gucken, dort eine Bache, hinter sich her die Frischlinge, über die Wiese traben. Auch läßt sich in gemessener Entfernung schon ein Edelhirsch sehen, während das Damwild schon in ganzen Trupps vorhanden ist.
In nicht zu großer Ferne hört man jetzt auf hartem Wege einen Wagen heranfahren und wie ein Zauberton wirkt dieses sonst so gleichgültige Geräusch auf unsere lebendige Umgebung. Wohlbehäbig grunzend kommen auf einmal aus allen Ecken und Enden aus den nahen Dickichten Rudel von Sauen hervor. Groß und Klein, schnaubend und quiekend ziehen sie allesammt eine kleine Strecke dem gehörten Wagen entgegen, der bald, von den Thorwärtern bespannt und gezogen, sichtbar wird. Angekommen auf dem Platze, umgeben die Sauen die Equipage, auf der sich das Futter für sie befindet, so daß die Leute sich mit den Füßen vor ihrer Zudringlichkeit wehren müssen. Bald ist das aus Kartoffeln, Haidekorn, Erbsen, Eicheln etc. bestehende Futter aus den Säcken geschüttet und in langen Streifen ausgestreut. Nun geht es mit geschäftiger Eile an das Heben[6] desselben. Zuerst nehmen sie die Körner und Eicheln auf; Kartoffeln bleiben bis zuletzt liegen. Dabei streiten sie sich um ein einzelnes Korn, das sie bequem wo anders heben könnten, und nicht selten kommt es vor, daß sie sich mit ihren scharfen Gewehren[7] klaffende Wunden schlagen, die zuweilen tödtlich sind.
[604] Unterdessen ist aber auch unser Damwild herangekommen, und zwar nun so nahe, daß man es zehn bis fünfzehn Schritte vor sich hat. Die harmlosen Thiere halten sich an die Kartoffeln, die sie mitten unter dem Schwarzwild als ungeladene Gäste sich aufsuchen; jedoch immer von Zeit zu Zeit die Köpfe emporhebend und sich sichernd. Da gibt es weiße mit ihren rosigen Nasen und graubläulichen Lichtern, deren längliche Pupillen, wie bei den Ziegen, horizontal stehen, was dem Damwild eigen, dem weißen und bunten sowohl, als dem schwarzen. Wir haben deren von allen Sorten vor uns. Bei allen sieht man auf den ersten Blick, um wie viel feister sie gegen das Hochwild sind, welches sich mit elastischem Schritt auch mehr und mehr genähert hat. Der Grund dieses feisteren Aussehens des Damwildes liegt darin, daß es auch die Naschhaftigkeit der Ziegen besitzt und immer das Beste wählt. Dazu kommt, daß sie in den Thiergärten, wo gefüttert wird und werden muß, sich am besten dazuhalten; ja zur Zeit, wenn Heu und Hafer gefüttert wird, gar nicht von den Raufen und Krippen weichen, sondern gleich dabei liegen bleiben und den ganzen Tag daran herumknuspern. Dabei leidet das Edelwild zwiefache Beeinträchtigung, indem es bald nur das Uebriggebliebene, bald wohl auch gar nichts bekommt, weil es aus Abneigung gegen das Damwild die von diesem hartnäckig besetzten Raufen lieber ganz meidet. Trotzdem sehen die Mitglieder der Damwildsippe bei weitem weniger imponirend aus, als das Hochwild, da sie nicht nur viel kleiner und gedrungener, als dieses, sind, sondern auch ihr ganzer Habitus ein mehr ziegenartiger ist. Das bekanntlich schaufelartige Geweih ist wohl ganz respectabel, mit dem Edelhirschgeweih kann es sich jedoch in Beziehung auf Schönheit und würdevollen Schwung durchaus nicht messen. Außerdem fehlt dem Damhirsch die Mähne oder Krause am Halse, die dem Edelhirsch namentlich zur Brunftzeit so vortrefflich steht, gänzlich, so wie er auch, was freilich äußerlich nichts zum Unterschiede beiträgt, keine Haken[8] hat.
Ein charakteristisches Merkmal des Damwildes ist die Blume, und es sieht gar sonderbar aus, wenn ein Trupp beisammensteht, um mit diesem Werkzeuge die Fliegen und Mücken zu vertreiben, indem sie ununterbrochen damit hin- und herwedeln, als wären eben so viele Perpendikel in Bewegung gesetzt. Ihren originellen Galopp, der nur ihnen eigen ist, haben wir gleich Anfangs zu beobachten Gelegenheit gehabt. Der Schrei des Damhirsches zur Brunftzeit, die im November eintritt, ist ebenfalls nicht mächtig, wie beim Edelhirsch, sondern mucksend und kurz abgestoßen. Sonst ist die Lebensweise dieser Thiere ziemlich gleich der des Edelwildes, und wie bei diesem gehen die Schaufler bis zur Brunftzeit meist beisammen, nur die schwachen Hirsche bleiben mit den Thieren, Schmalthieren und Kälbchen das ganze Jahr über, die Brunftzeit abgerechnet, vereint. Um auf die Farbe zurückzukommen, so gibt es, wie schon erwähnt, weiße, bunte, nämlich rothbraune mit regelmäßig vertheilten weißen Flecken, und schwarze, die am seltensten vorkommen; namentlich sind sie in Moritzburg schwach vertreten. Die Schwärze erstreckt sich über den ganzen Körper, und nur Kopf und Läufte gehen in das Aschfarbene über.
Ehe wir uns vom Fütterungsplatze trennen, fesseln unsre Augen unter dem unterdeß ebenfalls herangekommenen Hochwild ein paar Stücken Bläßwild, worunter ein Hirsch, gleichsam die „letzten der Mohikaner“; denn von dem ganzen derartigen Stamme, den es hier gab, sind sie allein übrig geblieben. Das weiße Edelwild ist, wie schon erwähnt, bereits ausgestorben. Beide Arten sind Varietäten und in Bau und Lebensart vollkommen dem Rothwild gleich, nur etwas zärtlicher. Jedenfalls ist das Bläßwild eine Kreuzung des weißen und des rothen. Gewöhnlich hat es auf der Stirn eine weiße Blässe oder auch wohl einen ganz weißen Kopf, und dabei sind meist die untern Theile der Läufte weiß; sonst hat es die Farbe des Rothwildes, aber bläuliche Lichter, mit denen es wie das weiße Wild, welches ebenfalls derartige besitzt, sehr schlecht sieht.
Wir brechen jetzt auf, und bei der ersten Bewegung, die wir zum Aufstehen machen, fährt Alles auseinander, Sauen, Damwild und Hochwild, das letztere am weitesten. Kaum aber hat man die Lücke durchschritten, so schaaren sich die Gescheuchten wieder zusammen und äßen ruhig weiter; nur wiederum das Hochwild kommt nicht gleich zurück.
Der Abend fängt bereits mit seinem vergoldenden Lichte an herabzusinken, und wir beeilen uns, noch den entgegengesetzten Theil des Thiergartens, „die Oberecke“, auf unserm Heimwege zu durchstreifen. Ehe wir dorthin gelangen, kommen wir nochmals bei dem Schlosse vorbei, so wie wir zur andern Hand noch einmal das Fasanenschlößchen liegen sehen; beide strahlen im purpurnen Abendschein, und die Moritzburg spiegelt sich in der ruhigen, klaren Blänke des Schloßweihers. Hier begegnen unserm Blicke noch ganz in der Nähe zwei starke Damhirsche, die am Wasser stehen und die charakteristische Staffage zu diesem Abendbilde am Schlosse bilden. Im Weiterschreiten sehen wir noch manches verspätete Wild der Fütterung zuwandeln, während wir unsern Weg nach den sogenannten „Dardanellen“ einschlagen. Diesen gewichtigen Namen führt eine ruinenartig im Festungsstyl aufgeführte, mit Schießscharten versehene Mauer, die den Großteich vom Thiergarten scheidet. Jedenfalls dachte man sich den Großteich als Bosporus und das früher darauf schwimmende Seeschiff als türkische oder russische Flotte. Bereits auf der „Oberecke“ angekommen, lassen wir eine kleine Fütterung für die Sauen dieses oberen Theiles links liegen, und durchschneiden ihn seiner Länge nach. Auch hier breiten sich stille Teiche aus, die namentlich jetzt, wo sich der sanft leuchtende Abendhimmel mit den in tiefem Ton gefärbten Waldessäumen auf der durch keinen Hauch gekräuselten Fläche wiederspiegelt, einen melancholischen Eindruck machen. Schon neigt sich das Zwielicht zur wirklichen Dunkelheit, da wir den südlichsten Theil des Thiergartens erreichen, in dessen äußerster Ecke eine kolossale Eiche steht. Den Wald mächtig überragend, überschaut sie wie ein Riesenwächter mit malerisch zerwettertem Gipfel das Ganze. Ist dieser Nestor unter den Bäumen doch ziemlich siebenzehn Ellen im Umfange des Stammes stark! Ein Blick nach dem in geringer Entfernung liegenden „Georgenteiche“ läßt uns noch ein paar Edelhirsche erblicken, die eben auf die Blöße herausgezogen sind. Stolzen Schrittes ziehen sie dahin, und bieten dem Beschauer ein reizendes Bild. Die friedliche Stimmung der Natur wird selbst durch die herbstliche Frische, welche der Abend mit sich gebracht hat, so wie durch die gespenstig hinschleichenden Nebel noch erhöht. Es ist dieser Anblick gleichsam der Scheidegruß eines an einem schönen poesievollen Ort verlebten glücklichen Tages.
Bald nehmen uns die außer dem Thiergarten liegenden Felder, von welchen die Kartoffelkräuter ihren herbstlichen, eigenthümlich scharfen Geruch ausströmen lassen, und dann die Dörfer auf, durch die uns unser Weg führt. Indem wir zögernd rückwärts blicken, bietet sich uns eine neue Aussicht dar: noch einmal winkt uns ein stiller, außer dem Thiergarten liegender, waldumsäumter Teich zu, der die letzten goldigen Säume der im Westen aufsteigenden Wolkenmassen in sich spiegelt. Vor uns tönt das melodische Abendläuten im nahen stillen Haidedorfe, das wir durchwandeln, bis uns hinter diesem abermals Wald, die bis unmittelbar an die Residenz heranreichende „Dresdner Haide“ aufnimmt. An ihrem Saume liegt meine Wohnung, und hier rufe ich meinen Begleitern, die mir willig und nachsichtsvoll gefolgt, ein „Waidmanns Heil“ zu.
Auf der Rückreise machte die Herzogin von Meiningen einen Besuch am gothaischen Hofe und Franziska ergoß die begeisterten Schilderungen vom Kronprinzen bei der Erbprinzessin und legte damit in Louise Dorothee’s Seele den Grund zu der hohen und innigen Verehrung Friedrichs, welche sie ihm ihr Leben lang treu bewahrt hat.
Drei Jahre später (1734) kam der König von Preußen mit dem Kronprinzen zu seiner Tante nach Coburg, auf einer Reise begriffen, um das Hülfscorps zu besichtigen, das er zur kaiserlichen Armee am Rhein marschiren ließ. Nie konnte es Franziska vergessen und in ihrem späteren Leben liebte sie es, oft zu erzählen, daß der König den Kronprinzen seiner Tante mit den Worten vorgestellt habe: „Da bring’ ich Ew. Liebden meinen großen Jungen.“
– „Ja wohl war’s ein großer Junge!“ pflegte die Erzählerin [605] mit einer launigen Gebehrde hinzuzusetzen. Das Epitheton ist für alle Zeiten an ihm haften geblieben.
Von Gotha richtete sich die Aufmerksamkeit der beiden Freundinnen auf das kleine Schloß Rheinsberg, wo Friedrich ganz in ihrem Sinne und Geschmacke, von geistreichen Freunden umgeben, sich dem reizvollen Cultus des Genie’s ergab; ebenso auf das alte Schloß Cirey in Lothringen, wo Voltaire bei der gelehrten Besitzerin desselben, der schönen Marquise du Chatelet, der „göttlichen Emilie“, wie sie Friedrich der Große in einer an sie gerichteten Epistel nannte, wohnte und Geisteswerke schuf, die seinen Namen, mit den unsterblichen Kränzen des Ruhmes geschmückt, über Europa trugen. Die Strahlen, welche von Schloß Cirey ausgingen in den „Elementen der Newton’schen Philosophie“, in den „Gesprächen über den Menschen“, in den Tragödien „Alzire“, „Merope“, „Mahomet“, vergoldeten zuerst die Alpengipfel des Geistes, die geistig und gesellschaftlich hochgestellten Menschen des achtzehnten Jahrhunderts, und unter ihnen stehen die beiden Freundinnen in Gotha in vorderster Reihe. Mit Stolz darf das Wort ausgesprochen werden, wie der königliche Friedrich der erste Priester des neuen Geistescultus war, so waren Louise Dorothee von Gotha und Franziska von Neuenstein seine ersten Priesterinnen in Deutschland, und wenn sie in der Geschichte nicht so strahlend hervortreten, als ihr Zeitgenosse, der königliche Philosoph und Feldherr, und als das später in sein Zenith tretende Doppelgestirn Karl August’s und Goethe ’s, so liegt das in ihrem bescheideneren und stilleren Frauenloose; aber sie haben eben so redlich wie Jener und Diese das Ihrige gethan, die Arbeit des Geistes auf Erden zu fördern.
Von jenen Tagen beginnen ihre Verbindungen mit allen ausgezeichneten Geistern der Zeit, die im Dienste der aus dem damals noch rohen und dumpfen Materialismus, aus der bunten Petrefactenwelt der kirchlichen Zustände auf der einen und aus dem nicht minder starren Dogmatismus der Orthodoxie auf der andern Seite, aus der Chrysalide des Mysticismus und aus der Verschwommenheit des Pietismus sich emporringenden Menschheit standen. Fast die Dauer eines Menschenalters hindurch war der gothaische Hof durch diese beiden Frauen eine Pflegestätte der Wissenschaften und Künste und blieb es auch nachher noch eine geraume Zeit, als Louise Dorothee’s Genius nicht mehr dort unmittelbar waltete. Außer Voltaire waren es Diderot, d’Alembert, La Beaumelle[WS 1], Holbach, Helvetius, Grimm, mit welchen das hohe Frauenpaar nach einander in briefliche Verbindung kam und deren Werke es studirte. Der Natur der Sache nach mußten sie dem aufstrebenden Genius der Menschheit, als er seine tausendjährigen Fesseln abzuschütteln begann, in den Werken französischer Schriftsteller huldigen; schleuderten doch deutsche Gelehrte, wie Holbach und Grimm, von Paris aus ihre Gedankenblitze gegen die alten Götzen in französischer Sprache in die Welt. Aber die beiden Freundinnen ließen keineswegs den deutschen Genius unbeachtet, als er sich anschickte, die erste Schlangenhaut des Pedantismus abzustreifen. Der Name des deutschen Geistesherkules, des rechtskundigen Bekämpfers der Hydra Aberglaube, Christian Thomasius, war am gothaischen Hofe ein mit Ehrerbietung genannter, wo man sich selbst von der Trockenheit der Wolf’schen Philosophie nicht zurückschrecken ließ, welche damals alle guten Köpfe Deutschlands beschäftigte. An der Hand eines Magisters Schenk, welcher Informator der beiden Prinzen von Meiningen, Brüder der Herzogin, gewesen und von dieser nach Gotha berufen war, ihr und der Freundin Vorträge zu halten, wagten sie sich auf das Gebiet des speculativen Denkens. Noch mächtiger wurden sie von den bedeutenden Entdeckungen angeregt, welche im Bereich der Naturwissenschaften gemacht wurden. Sie studirten die naturgeschichtlichen Werke der Marquise du Chatelet, stolz und glücklich, daß ihr Geschlecht sich im Forschen und Ringen nach Erkenntniß so ruhmreich betheiligte. Professor Hamberger von Jena führte ihnen 1742 die wichtigsten physikalischen Experimente vor, und als nur wenige Jahre darauf die Erscheinungen der Elektrizität Aufsehen zu machen begannen, schickte Professor Winkelmann in Leipzig, einer der Ersten, welche in Deutschland diesen Zweig der Naturwissenschaften cultivirten, einen seiner Schüler mit einer Elektrisirmaschine von seiner Erfindung nach Gotha, um den Hof damit bekannt zu machen.
Jean Jacques Rousseau erzählt in seinen Bekenntnissen, daß ihm die Herzogin von Gotha ein Asyl anbot, als er vom Unverstand seiner Landsleute von der Petersinsel im Bielersee vertrieben wurde.
Schon war Franziska vier Jahre in Gotha, als sie den Bitten der Freundin nachgab und ihre Hand einem würdigen, ebenfalls nicht mehr jungen Hofherrn, dem classisch gebildeten Oberhofmeister Schak Hermann von Buchwald reichte. Es war eine Anstands-, keine Herzensverbindung; aber Franziska’s Schwärmerei gefiel sich in dem Gedanken, auch in dieser Beziehung nicht glücklicher zu sein, als ihre fürstliche Freundin. Es war ein eigenthümliches Geschick, gewissermaßen eine in die äußersten Spitzen verlaufende Rache der von einem Uebermaße von Geistigkeit doch beleidigten Natur, daß diese beiden Frauen, welche auf der Sonnenbahn des Geistes ein Ziel erreichten, welches dem schönen Geschlecht selten zu Theil wird und auch, beim rechten Lichte besehen, über die Grenzen der weiblichen Capacität hinausliegt, die süßesten und sanftesten Gefühle, für die das Weib vorzugsweise geschaffen ist und zu welchen wohl keins mehr Befähigung und Anlage hatte, als gerade sie, niemals befriedigen durften. Der Frühling des Herzens, die Liebe, überschüttete sie nie mit feinen duftenden Purpurblüthen: sie mußten sich mit den Blumen und Früchten des Geistes begnügen. Die sichtbare Rache dieser Versündigung am Herzen trat später im unglücklichen Leben des edlen, hochherzigen Herzog Ernst hervor. – Franziska gab als Frau von Buchwald ihre Stellung als Hofdame auf, blieb aber in der unmittelbaren Nähe der Herzogin, ja, sie behielt sogar ihre Wohnung auf dem Schlosse Friedenstein und wurde bald darauf zur wirklichen Oberhofmeisterin der Fürstin ernannt, womit sie die höchste Würde erreicht hatte, welche die Freundin ihr bieten konnte.
Auch die Regierungsgeschäfte gehörten zum Ressort der beiden so engverbundenen Frauen und wenn die Herzogin den Sitzungen des Ministeriums beiwohnte und ihre maßgebende Stimme abgab, so nahm die Oberhofmeisterin gewissermaßen die Stelle eines Cabinets-Ministers ein.
Man kann sich denken, mit welchem Jubel sie ihr Idol auf dem preußischen Königsthrone begrüßten!
Für die verschiedene Geistesrichtung der beiden Freundinnen ist es bezeichnend, daß, als J. J. Rousseau’s Stern am Literaturhimmel des gebildeten Europa aufging und sein Glanz Voltaire’s Neid erregte und dessen unwürdige Angriffe hervorrief, die Herzogin Voltaire’s, die Oberhofmeisterin Rousseau’s Partei nahm.
Als Voltaire durch seine unedlen Leidenschaften seinen königlichen Verehrer so gegen sich erbittert hatte, daß er am 26. April 1753 Berlin verlassen mußte, besuchte er auf der Rückreise nach seinem Vaterlande den gothaischen Hof, wo er mit offenen Armen aufgenommen wurde und fast bis zu Ende des Monats Mai verweilte. Seine Bewunderung und Ehrfurcht gegen die beiden Freundinnen, deren Umgang den tiefsten Eindruck auf ihn gemacht hatte, spricht sich in seinen Briefen und Memoiren in voller Weise aus. Die Herzogin nennt er „die beste Prinzessin der Erde, die sanfteste, weiseste, die gerechteste.“ Die Oberhofmeisterin redete er in einem Briefe also an:
Et des coeurs grande maîtresse.
Er kann gar nicht glänzende Worte genug finden für das hohe Glück, das er „à la cour enchantresse de Gotha“ „dans ce palais enchanté“ bei „la Minerve de l’Allemagne“ genossen. Er wollte auch durchaus nach Gotha zurückkehren, um seine Reichsannalen, mit deren Abfassung er sich von der Herzogin hatte beauftragen lassen, obgleich er weder Lust, noch Talent, noch Kenntnisse für ein solches Werk hatte, dort zu vollenden. Und doch hatte er das Klima in Gotha abscheulich gefunden. Sein Körper fror, aber die Seele des neunundfünfzigjährigen Philosophen stand in Flammen, welche die hohe Liebenswürdigkeit der beiden Frauen entzündet hatte. Seine Briefe an die Herzogin, welche im herzoglichen Archiv zu Gotha aufbewahrt werden, reichen bis ein Jahr vor ihren Tod (1766).
Nicht anders erging es Friedrich dem Großen, als er die persönliche Bekanntschaft der Herzogin von Gotha gemacht und die ihrer Oberhofmeisterin erneuert hatte. Auch er ist wie berauscht von den hohen und glänzenden Eigenschaften der beiden Damen und auch zwischen ihm und der holden genialen Fürstin entspinnt sich ein Briefwechsel, welcher die charakteristischen Eigenschaften Beider zur Erscheinung bringt und die Verehrung ausdrückt, welche sie für einander hegen. Dieser Briefwechsel ist in der von Preuß zusammengestellten Prachtausgabe der Werke des Königs abgedruckt. Aus ihren Briefen lernt man die fürstliche Frau kennen und überzeugt sich, daß der ihr von Voltaire gegebene prächtige Name der [606] „deutschen Minerva“ keine leere Schmeichelei war. König Friedrich hat seine Freundin und Verehrerin zwei Mal in Gotha besucht, beide Male während des siebenjährigen Kriegs, 1757 und 1762. Der erste dieser Besuche ist mit eigenthümlichen Umständen verknüpft. Bei dem bekannten Ausbruch des Krieges, dem Einfalle Friedrich’s in Sachsen, war man in Wien ungehalten auf den gothaischen Hof, weil derselbe ein Bündniß mit England abgeschlossen (die Prinzessin von Wales, Auguste, Mutter des Königs Georg III., war die Schwester des Herzogs Friedrich III. von Gotha und Altenburg) und sich Preußen geneigt gezeigt hatte. Der Kaiserin Marie Theresie war die Verehrung der Herzogin Louise Dorothee für König Friedrich bekannt und sie war derselben deshalb nicht gnädig gesinnt. Nicht ohne Besorgniß erfuhr man in Gotha, daß das kleine Land ausersehen sei, den Vereinigungspunkt der französischen und der Reichsarmee zu bilden. Ein französisches Corps fiel im August unvermuthet im Herzogthum ein und verlangte unter dem Vorgeben, als habe der Herzog seine Verpflichtung als Reichsfürst nicht erfüllt, eine große Contribution, die inzwischen nie bezahlt wurde.
Am 21. August kam das französische Hauptheer nach Gotha, Tags darauf sein Befehlshaber, der feine und liebenswürdige Prinz Soubise, der Günstling der Frau von Pompadour. Die Reichsarmee unter dem Prinzen von Hildburghausen bezog wenige Tage später ein Lager zwischen Arnstadt und Ichtershausen. Prinz Soubise begab sich am 25. August mit seinem Generalstabe nach Erfurt, wo die Vereinigung mit der Reichsarmee stattfinden sollte; täglich gingen französische Durchmärsche durch Gotha. Plötzlich erfuhr man das Heranrücken der preußischen Armee unter dem König. Die Reichsarmee zog sich erschreckt durch das gothaische Land nach Eisenach zurück. Die ganze französische Armee warf sich von Weimar und Erfurt zurück nach Gotha. Die Preußen kamen heran; es schien, als sollte es hier zu einer entscheidenden Schlacht kommen. Aber die französische Armee zog am 13. September nach Eisenach. Dafür rückten österreichische Truppen in Gotha ein. Am 15. September früh zeigten sich plötzlich preußische Dragoner in der östlichen Umgebung der Stadt, es kam zu einem kleinen Scharmützel, die Oesterreicher und was noch von Franzosen da war, zogen sich eilig über die westlichen Höhen nach Eisenach zu. Prinz Soubise, vom Zauber des gothaischen Hofes zurückgehalten, soll mit Mühe in der weißen Jacke und Küchenschürze eines französischen Kochs entkommen sein.
Plötzlich verbreitete sich das Gerücht, der König sei selbst da und reite bereits in die Stadt. Der Zulauf und Jubel der Bevölkerung war ungeheuer. Gegen 3 Uhr kam der gefeierte Held mit seinen Generalen auf Schloß Friedenstein an, wo er von der herzoglichen Familie im Hofe empfangen wurde. Dem Herzog bezeigte der König auf freundliche, verbindliche Weise seine Theilnahme an der beängstigenden Lage, in welcher er sich befinde, der Herzogin eine Hochachtung und Aufmerksamkeit, welche selbst seine Umgebung in Erstaunen setzte. Er führte sie zur Tafel, an welcher seine Generale mit der herzoglichen Familie und auf des Königs ausdrücklichen Wunsch Frau von Buchwald, „seine alte, gute Freundin“, wie er sie nannte, Platz nahmen, und welche bereits für die österreichischen und französischen Officiere servirt war. So ereignete sich das komische Qui-pro-quo, daß für die Oesterreicher gekocht und gedeckt war und die Preußen speisten. Nach der Tafel küßte der König der Herzogin sogar die Hand, bei ihm etwas Unerhörtes, und empfahl sich wieder. Er ritt nach Erfurt zu und übernachtete im Dorfe Gamstedt.
Beim zweiten Besuch hatte der König die schweren Schläge des Jahres 1761 überstanden. Die Welt hatte ihn für verloren gehalten, aber wider Aller Erwarten war im Laufe des Jahres 1762 sein Stern glänzender, als je, aufgeflammt. Nach der Niederlage der Oesterreicher durch den Prinzen Heinrich, Bruder des Königs, bei Freiberg am 29. October, wurde ein Waffenstillstand abgeschlossen, der Husarengeneral von Kleist züchtigte mit 1000 Mann überraschend schnell die noch widerspenstigen Reichsstände, Frankreich schloß mit England Friede; die Waffen ruhten überall. Da gedachte der große König die Muße zu einem zweiten Besuche bei seiner verehrten Freundin in Gotha, mit welcher er selbst während des Krieges in lebhaftem Briefwechsel gestanden hatte, zu benutzen. Am 3. December langte er mit dem Prinzen Heinrich in einem mit acht Pferden bespannten Wagen an, auf das Ehrenvollste empfangen. Als er aus seinen Zimmern zur Tafel abgeholt wurde, erschien er zum Erstaunen seiner Umgebung in Schuhen und seidenen Strümpfen. Seit dem Kriege hatte man ihn nicht in solchem Costüme gesehen. Mit ungemeiner Galanterie führte er die Herzogin unter den für ihn selbst bestimmten Baldachin und nahm neben ihr Platz. Er sprach und lachte während der Tafel ungewöhnlich viel und fühlte sich dem Anscheine nach sehr wohl. Nach der Tafel begleitete der König die Herzogin auf ihr Zimmer, wo er, die herzogliche Familie, Prinz Heinrich und die Frau von Buchwald (sie gehörte also ganz zum fürstlichen Hause) sich ohne Zeugen unterhielten. Aufflackernd vor Entzücken über die geistreichen Dinge, die der König sprach, rief die Oberhofmeisterin plötzlich: „Ach, welcher Mann! Ich muß mich vor ihm beugen.“ Der König versetzte lächelnd: „Nein, Madame, es ist an mir, vor Ihnen auf die Kniee zu fallen und ich sterbe vor Vergnügen. Aber ich tauge nichts zu Scenen großer Leidenschaften.“
Um 11 Uhr entfernte sich der König, um auf seinem mitgebrachten Feldbette zu ruhen. Am folgenden Morgen musicirte er auf der Flöte, nahm dann Abschied von der fürstlichen Familie und fuhr um 7 Uhr früh, begleitet von einem starken Commando, über Langensalza und Freiburg nach Leipzig zurück, wo er sein Winterquartier nahm.
Es ist auffallend, daß die herzogliche Familie diese Besuche später nicht erwiderte. Niemals ist Louise Dorothee nach Berlin gekommen. Vielleicht hielt sie zunehmende Kränklichkeit davon ab. So scheinen sich auch die Herzogin und die ihr ähnliche (nur milder war Louise Dorothee) und mit ihr im gleichen Alter stehende Markgräfin von Bayreuth nicht persönlich gekannt zu haben, obgleich der von der Herzogin gestiftete Orden der lustigen Einsiedler auf dem Lustschlosse Friedrichswerth eine Nachahmung des Einsiedlerordens auf der Eremitage bei Bayreuth war. – [9]
Die französischen hohen Officiere, welche während des Kriegs Gäste auf Schloß Friedenstein waren, zeigten sich nicht minder entzückt von den Eigenschaften der Herzogin. Prinz Soubise, Graf Lugnac, Graf Scey und Andere überboten einander in Lobeserhebungen und Artigkeiten; sie nannten Gotha das zweite Versailles. Ein Marquis de Custine, welcher bei Roßbach drei Säbelhiebe in den Kopf erhalten hatte, an welchen er sterben mußte, begann im heftigen Wundfieber einen sehr drolligen Brief in Versen an die vergötterte Herzogin, den zu vollenden ihm der Tod verwehrte.
Im Anfange ihres Wirkens als Herzogin hatte Louise Dorothee eine eigenthümliche Stellung zu ihrem der bissigsten Orthodoxie ergebenen Hofprediger, Kirchenrath Cyprian, der sich wohl gern den lutherischen Papst nennen hörte. Er donnerte in der Schloßkirche ihr sein Verdammungsurtheil ihrer philosophischen Richtung in die Ohren, ja er ging einst so weit, zum Thema einer Predigt den Satz aufzustellen: Alles Uebel kommt uns aus Meinungen. (Die Doppelsinnigkeit entspringt aus der damals mehr gebräuchlichen Form Meinungen für Meiningen.) Sie urtheilte mild über den Zionswächtereifer des Mannes, und unterwarf sich allen kirchlichen Formen. Im Beichtstuhl redete er sie einst ebenso pathetisch als abgeschmackt an: „Durchlauchtigste gnädigste Herzogin! Große, große, erhabene Sünderin!“ Auf dem Rückwege nach ihren Gemächern lächelte der sie begleitende Page. „Er hat gewiß gehorcht?“ fragte ihn die Fürstin. „Je nun, der Mann meint es doch gut.“
Als Zinzendorf, dessen religiöse Richtung von der ihrigen so himmelweit verschieden war, aus seinem Vaterlande vertrieben, sie bat, mit seinen Glaubensgenossen eine Synode in Gotha halten zu dürfen, wurde ihm vom Herzog auf ihren Betrieb gegen Cyprians und des Oberconsistoriums Willen, die Erlaubniß dazu ertheilt. Ihrem Einfluß war es zuzuschreiben, daß der Versuch, eine Herrnhutercolonie in Neudietendorf zu errichten, endlich doch nicht [607] mißlang. So großartig tolerant war diese fürstliche Frau. – Nach Cyprian’s Tode erhielt freilich ein persönlicher Freund J. J. Rousseau’s und Voltaire’s, Klüpfel, dessen Stelle, ein ausgezeichneter Gelehrter, aber rationaler Theolog, ja, wenn man mündlichen Ueberlieferungen unbedingt trauen darf, ein Stück Freigeist und eine Art französischer Abbé. Ein merkwürdiger Contrast zwischen Cyprian und ihm! Die Extreme berühren sich. Gotha’s Bildung hat Klüpfeln viel zu verdanken.
Erst 57 Jahre alt, starb die Herzogin, fest in ihren Grundsätzen. Ihre Freundin überlebte sie 22 Jahre, und genoß bis an ihren späten Tod die höchste und ausgezeichnetste Achtung am gothaischen, wie an den übrigen thüringischen Höfen, in Stadt und Land. Zuletzt wurde Frau von Buchwald von Jedermann „la Maman“ genannt, selbst von den hohen Gästen des herzoglichen Hauses. Sie war die Liebe und Wohlthätigkeit selbst; wie ein höheres Wesen waltete sie auf Schloß Friedenstein, wo sich ihr Name an der Gallerie, die sie bewohnte, verewigt hat. („Die Buchwald’sche Gallerie.“) An Kunst und Poesie blieb ihr ein lebendiges Interesse bis fast zu ihrem Ende, und mit ganzer Seele freute sie sich der großartigen Entwickelung des deutschen Genius. Wieland, Herder Wieland und Goethe waren mit ihr in Verbindung. Oberon, Egmont u. A. wurden „am grünen Kanapee“ (in ihrem Boudoir) im Manuscript vorgelesen. Der berühmte Thalberg schrieb eine besondere Brochüre über sie.
Ueber ihre greisen Züge vermochte zuletzt der Widerschein des ersten Gluthstrahls der Neuzeit nicht mehr zu zucken. Paris war ihre Geburtsstadt, aber Frau von Buchwald war in der letzten Zeit ihres Lebens abgestorben für die Außenwelt. Sie starb eben so unbekehrt, wie ihre Freundin, am 19. December 1789. Der Dichter Gotter dichtete folgendes Distichon auf sie:
Lange die Zierde der Menschheit, entschlief sie müde des Lebens,
Aber noch immer dem Wunsch zärtlicher Freundschaft zu früh.
Das Urbild von Byron’s „Corsar“. Es hat zu jeder Zeit Individuen gegeben, deren wirklicher Lebenslauf tausend Mal romanhafter war, als die feurigste Phantasie eines Dichters ihn erfinden kann. Eins dieser merkwürdigen Individuen ist der Mann, welchen Lord Byron zum Urbild seines berühmten Gedichts: „Der Corsar“ genommen, dieses Epos voll Blut, Mord und Tod, voll von den düstersten Schilderungen, die den Leser oft bis in’s Innerste erbeben lassen. Die Naturtreue einiger Schilderungen in diesem dunkeln Gemälde und einige Stellen darin haben zu der Vermuthung Anlaß gegeben, daß Lord Byron, dessen Excentricität eine solche Annahme nicht unwahrscheinlich macht, eine Periode seines eigenen Lebens darin geschildert, allein diese Vermuthung ist eine irrige. Vielmehr war es der Lebenslauf eines seiner intimsten Freunde, des Engländern Trelawney, den er in dem Corsar mit so düsterflammenden Farben gemalt. Es war in Italien, wo er die Bekanntschaft dieses kühnen, verwegenen Abenteurers, der meist als gefürchteter Seeräuber die malayischen Gewässer unsicher gemacht, anknüpfte. Von da ging er mit ihm nach Griechenland, wo sich Beide an dem Unabhängigkeitskampfe gegen die Türken betheiligten. Byron fand dort seinen Tod, nicht durch einen Türkensäbel oder eine Albanesenkugel, sondern von einem hitzigen Fieber hingerafft, welches er sich bei einem scharfen Nachtritt zugezogen. Trelawney überlebte ihn, lernte die Tochter seines Gastfreundes, des Griechenfürsten Odysseus, kennen, heirathete sie und ging mit ihr nach England, wo er in Form eines Romans – für welchen man das Werk lange hielt – seine Erlebnisse unter dem Titel: „Abenteuer eines jüngeren Familiensohnes“ herausgab. Das Buch ist in seiner Art eins der interessantesten, spannendsten und enthält Schilderungen, denen man es auf den ersten Blick ansieht, daß sie mit der Farbe des Lebens gemalt sind und nicht mit der bleichen Tinte der Reflexion. Selbst Byron’s Schilderungen in dem Corsar bleiben häufig hinter diesen Darstellungen Trelawney’s zurück, aus denen wir nur eine Episode wählen wollen, wie dieser Seeräuber, an dessen Dolchspitze das Leben von hundert Menschen hing, auch das Geheimniß der Feder, die spannende Erzählung, kennt.
Eines Tagen ging Trelawney mit seiner Geliebten, einer jungen Araberin, Namens Zela, die mit rührender Zärtlichkeit an dem Seeräuber hing, an dem felsigen Ufer der Insel Borneo spazieren. Plötzlich hören sie das Rauschen eines Vogels in der Luft und Zela ruft, als sie ihn erblickt, ängstlich aus:
„Gib Acht – ein Tiger ist in der Nähe. Das ist der Faon.“
Faon ist der Name des Vogels, von dem man auf Borneo sagt, daß er der Begleiter des Tigers sei und diesem voranfliege.
„Mein Karabiner,“ erzählt Trelawney, „war geladen. Ich lud noch eine neue Kugel hinein, legte mein Gewehr gegen den Felsen und beschloß, festen Fußes den Angriff der Bestie zu erwarten. Hätte ich ihn nicht mit dem ersten Schusse getödtet, so war ich verloren, denn zu einem zweiten und um der Schaluppe, die nicht weit vom Ufer lag, zuzuschwimmen, würde ich keine Zeit gehabt haben. Das Rascheln in den Büschen wurde immer stärker. Auf einmal sah ich zu meinem größten Erstaunen nicht den Tiger aus dem Gestrüpp kommen, sondern einen alten, mit grauem Haar bedeckten – Menschen. Ich wollte ihm entgegentreten. Zela hielt mich zurück, gab mir ein Zeichen, zu schweigen und mich nicht zu bewegen. Der Greis – wie ich das wunderbare Geschöpf nach dem ersten Eindrucke, den seine Erscheinung auf mich machte, nennen muß – untersuchte den Ort mit vieler Aufmerksamkeit, bückte sich, um zu sehen, ob Niemand sich in der Nähe verborgen, und richtete sich wieder empor. Als er stand, bemerkte ich die sonderbarste aller Gestalten. Seine außerordentliche Magerkeit, das lange Haar, welches ihn am ganzen Körper bedeckte, sein hoher Wuchs und die ungewöhnliche Länge seiner Hände und Füße erregte mein Erstaunen. Sein Gesicht war schwarz und von tiefen Runzeln durchfurcht, aus denen weißes Barthaar buschweise hervorstand. Er machte sehr große Schritte, hielt sich gekrümmt und stützte sich auf einen keulenförmigen, dicken Baumast. Je mehr ich ihn beobachtete, um so mehr verwunderte ich mich über ihn. Seines anscheinend hohen Alters und seiner Hinfälligkeit ungeachtet glühte ein wildes Feuer, eine wahrhaft teuflische Bosheit in seinen hohlen Augen. Dieses Geschöpf näherte sich hierauf dem Meere, setzte sich auf eine Felsenspitze, ergriff einen scharfen Stein, bediente sich desselben, um vom Felsen einige Schleimthiere abzulösen, verschlang sie, ohne sie zu kauen und wickelte dann mehrere Austern, Ueberbleibsel seiner Mahlzeit, in ein breites Blatt. Dann erhob er sich, tauchte seine langen Finger in’s Wasser und schritt dann rascher fort, als er gekommen. Ich wollte ihm folgen und sprang auf.
„Hüte Dich vor ihm,“ sagte Zela warnend, „dieser Greis ist ein Jungle Admie! Kein wildes Thier ist gefährlicher und grausamer, als er.“
„Er ist allein,“ antwortete ich, „ich fürchte ihn nicht. Mein Karabiner ist geladen, ich will es schon mit ihm aufnehmen.“ Ich folgte in der That, doch auf einem anderen Pfade, als der, auf welchem er ging. Der meinige war dergestalt mit Gebüsch bedeckt, daß ich unmöglich von ihm gesehen werden konnte. Ich hörte des alten Wilden Schritte. Von Zeit zu Zeit bemerkte ich ihn und sah, wie er mit seiner Keule die Zweige zerbrach, welche seinen Weg versperrten. Zela, die ich nicht hatte vermögen können, zurückzubleiben, folgte mir auf der Ferse. So schritten wir einige Zeit schweigend durch das Gehölz. Dem seltsamen Wesen, das unsere Nähe nicht vermuthete, folgend, wendeten wir uns rechts, durchwanderten eine große Ebene, gingen durch das ausgetrocknete Bett eines Baches und standen nun vor einem steil abgerissenen Felsen, einer Art senkrechten Mauer von sechzehn bis siebzehn Fuß Höhe. Eine mit Moos bedeckte Tanne wuchs am Fuße des Felsens und ragte mit ihrem spitzen Wipfel darüber hinaus. Der Greis, wie ich ihn nennen will, klammerte sich um den Baumstamm, kletterte hinan, hielt sich sodann an einen Seitenzweig, auf die Weise der Matrosen, und erreichte so den Felsen, auf dem er sich niederließ. Wir ahmten ihn in allen seinen Bewegungen nach, doch mit Vorsicht, um von ihm nicht bemerkt zu werden. Er überschritt einen nackten Felsgrat, wo nur einige Tannen wuchsen. Er machte viele Umwege, pflückte einige Früchte von Bananen- und Mangobäumen, warf die unreifen bei Seite und wendete sich endlich gegen ein kleines offenes Feld. Der Boden war eben, sandig, wie rein gefegt. Ein prächtiger Baum, mit Blüthen und weißen Knospen bedeckt, beschützte mit seinem Schatten eine wohlerbaute indische Rohrhütte.
„Ich bewunderte den seltsamen Einsiedlers guten Geschmack, der sich durch den malerischen Ort bekundete, wo er seine Wohnung gewählt. – Auf der einen Seite eine Felsenbrustwehr mit Sauerdattel- und wilden Haselnußbäumen bedeckt, vor diesem Felsen die schlanken Stämme von drei Betelbäumen, hinter der Einsiedelei ein Wald von Bambusrohr und Dorngestrüpp, über welches hier und da der Tamarindenbaum, der Cactus, die Acacie, der Banyanenbaum und der Bambus mit seinem schwarzen Laube hoch empor ragten. Des alten Wilden Bewegungen waren merkwürdig durch eine auffallende Gelenkigkeit, die jedoch mehr von thierischem Instinct, als von menschlicher Verstandeskraft bestimmt schien. Er legte vor seiner Hütte die Früchte nieder, die er mitgebracht, und kroch dann durch die niedrige Oeffnung in’s Innere.
„Als er im Innern war, trat ich näher und bemühte mich, zu beobachten, was er weiter thue. Auf einmal vernahm ich hinter mir ein starkes Rascheln im Gebüsch. Ich wendete mich um und sah eine Klapperschlange, deren Augen, funkelnd wie Diamanten, auf meine in einiger Entfernung von mir stehende Begleiterin geheftet waren. Nur an die Gefahr denkend, der sie ausgesetzt war, stürzte ich mich darauf zu. Die Schlange zog sich in’s Dickicht zurück und verschwand. Ich hielt Zela noch in meinen Armen, als diese erschrocken und bleich ausrief:
„O, der Jungle Admie!“
„Ich wendete den Kopf. Der seltsame Greis näherte sich uns mit sichern Schritten. Er bewegte seine Baumastkeule über sich, wie der Tambourmajor an der Spitze des Regiments seinen Stock. Seine Gestalt schien viel höher, als vorher. Alle seine Muskeln waren wie krampfhaft gespannt. Seine Augen sprühten verzehrende Flammen. Die weißen, dicht aneinander gedrückten Zähne fletschten zwischen den schwarzen Lippen hervor, seine Augenbrauen schienen ineinander gewachsen. Ich hielt meinen Karabiner mit der linken Hand zum Schuß bereit. Doch bevor ich ihn an meine Schulter legen konnte, war er durch einen ungeheueren Sprung schon an mich gelangt und versetzte mir einen Streich mit seiner Keule. Ich warf mich einen Schritt zurück und gab Feuer. Die ganze Ladung traf ihn und ging ihm durch die linke Seite. Er fuhr über drei Fuß in die Höhe und fiel auf mich. Seine Schwere schlug mich nieder. Ich lag unter ihm, beständig mit dem zum Tode Verwundeten ringend. Er hatte noch ungeheuere Kraft und mein Tod – durch Erstickung – schien unvermeidlich. In diesem Augenblicke schrie ich Zela zu: „Rette Dich!“ „Er ist todt,“ rief [608] sie. Sie stand neben mir, das mit Blut bedeckte Messer, das meinem Gürtel entfallen, in der Hand. Damit hatte sie ihn vollends getödtet. Nicht ohne Mühe arbeitete ich mich unter dem schweren Körper hervor. Ich betrachtete ihn nun genauer. Der gemordete Greis war ein Orang-Utang, eines jener Geschöpfe, deren Existenz so lange von den Naturforschern geleugnet wurde, bis neuere Forschungen ihr Dasein bewiesen. Die Hütte, welche er bewohnte, war ohne Zweifel die verlassene Wohnung eines jener malayischen Einsiedler, die ziemlich zahlreich auf Borneo zu finden sind. Das Innere war sehr bequem eingerichtet. Die Behaglichkeit (comfort sagt Trelawney) einer schottischen Bauernwohnung war in die Hütte eines Affen der Insel Borneo übertragen.“
Katzen-Orgel. Katzengold, Katzenminze, Katzenkopf, Katzenjammer, Katzenmusik sind Alles Begriffe, die Jedem mehr oder weniger aus dem Sprachgebrauche oder eigener Erfahrung bekannt geworden sind; befremdend möchte aber Vielen die „Katzenorgel“ klingen. Hiermit hat es folgende Bewandtniß: Der Hofnarr irgend eines melancholischen Fürsten, der seine ganze Erfindungskunst aufbot, um seinen melancholischen Herrn zu heilen, kam unter Anderen auch auf die Idee, eine Partie verschiedene Katzen, alte und junge, mit groben und feinen Stimmen, in Abtheilungen einer Kiste gesondert einzusperren, und zwar so, daß die Schwänze derselben durch je ein Loch in so viel Röhren gingen und da festgehalten wurden, so viel der Katzen waren. Am vorderen Theile der Kiste befand sich eine Klaviatur, deren Tangenten unter jene Röhren reichten und je einen Stift trugen, der beim Anschlagen der Tasten die betreffende Katze in den Schwanz stechen mußte.
Diesen Marterkasten stellte er nun an einen passenden Platz und als der Fürst traurig einherkam, griff er nicht, wie einst David, zur Harfe, sondern schlug herzhaft auf die Tasten, und „ein Lied, das Stein erweichen, Menschen rasend machen kann“, wenigstens wenn sie dadurch aus dem Schlafe geweckt werden, vertrieb auf einige Zeit den bösen Geist aus dem Monarchen.
Ob der Hofnarr, dessen Name uns eben so unbekannt, wie der seines Herrn, der Erfinder dieser Katzenorgel gewesen sei oder ob er aus Brüssel Kunde davon bekommen hat, müssen wir dahin gestellt sein lassen. So viel ist aber gewiß, daß Jean Christoval Calvette, welcher die Reise Philipp’s II. im Jahre 1545 von Madrid nach Brüssel beschreibt, unter den daselbst angestellten Festlichkeiten auch der Katzenorgel gedenkt. Sie wurde von einem Bären gespielt, Affen, Bären, Wölfe, Hirsche und andere Thiere tanzten darnach um einen Käfig, in welchem zwei Affen auf Dudelsäcken den Gesang der Katzen accompagnirten. Es gab das sicher ein Concert, gegen welches unsere modernen Katzenmusiken nicht in Betracht kommen!
Aus den holsteinischen Marschen. III. Wir haben in ganz Deutschland keinen Volksstamm kennen gelernt, der im Grunde seines Charakters conservativer wäre, als der holsteinische, zumal in den Marschen. Nur muß man unter diesem conservativen Charakter nicht den Begriff einer gewissen Partei, das zähe, egoistische Festhalten an verrotteten, abgelebten und deshalb naturwidrigen Zuständen verstehen, sondern die beharrliche stete Ausdauer im Kampfe für das durch gewissenhafte Prüfung errungene Rechtsbewußtsein und Geltendmachung desselben, die Scheu vor der Annahme von Neuerungen, über deren Werth oder Unwerth nicht das eigene Urtheil zu Gericht gesessen, und die Pietät, mit welcher jenes Charakteristische der Volkssitte gepflegt wird, über dessen Verschwinden alle wahren Patrioten Ursache zur begründetsten Klage haben. Wir wollen in Bezug auf letztern Punkt nur zwei Seiten hervorheben. Wenn irgendwo in Deutschland, so gilt noch in den Marschen der alte deutsche Spruch: Ein Mann, ein Wort, gilt noch hier das feste, unverbrüchliche Halten des Versprechens. Wir waren Zeuge, wie Landleute bedeutende geschäftliche Verträge, Kauf, Pacht, Darlehn u. s. w. abschlossen, ohne nur eine Zeile darüber niederzuschreiben, das einfache, gegebene Wort genügte. So sind auch die Processe wegen Meineids oder leichtsinniger Eidesleistung die verhältnißmäßig seltensten. Eine andere Tugend der Marschbauern, die allerdings durch gewisse locale Verhältnisse unterstützt wird, ist die Gastfreundschaft, die sie üben. Die Gastfreundschaft der Dithmarschen, dieses kernigen Menschenschlags, die von den ältesten Zeiten an freie Männer waren, nie einen Edelmann, der sie mit Frohnden und Lasten beschweren wollte, unter sich duldeten, dieser kühnen, tapfern Bauern, welche Jahre lange Kriege mit den Königen von Dänemark, den Herzögen von Oldenburg und andern Fürsten und Herren führten, und vor deren langen Spießen und Morgensternen der Schreckensruf herging, welcher mehr als einmal die Söldnerschaaren erbleichen ließ: „Garde, hab’ Acht, der Buer (Bauer) kommt“, diese dithmarschische Gastfreundschaft besteht auch jetzt noch. Sie machen dabei nicht viele Worte, wie denn überhaupt die Leute hier oben, im Vergleich zu den Mittel- und Süddeutschen, weniger redselig, schweigsamer sind. Rege und bewegliche Phantasie besitzen die Süddeutschen überhaupt in bedeutenderem Maße, ein Grund, weshalb das Kunstleben dort auch auf einer viel höheren Stufe steht, als hier, wo schon das alte Sprüchwort: „Holsatia non cantat“ die in dieser Hinsicht geringere Befähigung ausdrückt.
Besonnene Ruhe, praktischer Blick, Kaltblütigkeit in der Gefahr sind die hervorstechendsten Tugenden des Marschbewohners. Es sind dies Vorzüge, die sie mit dem übrigen Volke Holsteins und Schleswigs theilen, und deshalb sind auch die Matrosen aus unsern Herzogthümern Holstein und Schleswig die besten, welche je auf dem Salzwasser gefahren, und weder Holländer, noch Engländer und Amerikaner können in ihren eigenen Ländern so treffliches Schiffsvolk werben, wie das unserer norddeutschen Küsten ist. Die Leser dieser Zeilen werden sich wohl noch des furchtbaren Sturmwetters erinnern, welches am 25. Juli d. J. über das nordwestliche Deutschland mit so unerhörter Heftigkeit, wie es im Sommer seit Jahrzehnten nicht der Fall gewesen, hereinbrach. Eine Menge Schiffe gingen dabei zu Grunde, und auf der Elbe allein verloren gegen hundert Menschen das Leben. Ich befand mich damals gerade an der holsteinischen Küste, und mit einem kleinen Handfernrohr konnte man deutlich den Kampf der vom Sturm überraschten Schiffe gegen die Elemente wahrnehmen. Zwei Schiffe besonders, die ganz in der Nähe der Küste steuerten, ein portugiesisches und ein holsteinisches, erregten unsere Theilnahme. Beide Schiffe waren in gleich gefährlicher Lage – entweder unterzugehen oder zu stranden. Auf dem Portugiesen, dessen Schiffsmannschaft vielleicht 12 bis 15 Mann stark war (genau konnten wir trotz unserer guten Fernröhre bei dem Sturm der entfesselten Elemente die Mannschaft nicht zählen), schienen schon alle Bande der Disciplin gelöst zu sein. Wir sahen die Matrosen rathlos und verwirrt durcheinander laufen, und ein Commando des Capitains schien es gar nicht mehr zu geben. Auf dem holsteinischen Schiff dagegen herrschte eine geordnete Rührigkeit, wie sie kaum besser bei einem Scheinmanöver auf einem Kriegsschiffe Ihrer Großbritannischen Majestät auf der Rhede vor Spithead gefunden werden kann. Unweit des Steuerruders stand die kurze, gedrungene Gestalt des Capitains, mit dem Sprachrohr in der Hand, in dem Tauwerk hing die Mannschaft und die Befehle wurden, wie gesagt, mit einer Pünktlichkeit und Ruhe ausgeführt, als wölbte sich der klarste blaue Himmel über ihren Häuptern und als spiegelte sich das goldene Sonnenlicht in ruhiger, glatter, von sanftem West bewegter Fluth. Das Resultat war leicht vorauszusehen. Der Portugiese ging – ein Rettungsversuch von der Küste aus mißlang trotz der übermenschlichen Anstrengung der Schiffer – zu Grunde und der Holsteiner kam mit schweren Verletzungen, aber doch ohne Verlust an Gut und Mannschaft davon.
Wenn sich je die Hoffnung Deutschlands verwirklicht, eine Kriegsflotte zu besitzen, so werden uns diese Gegenden, sowie Ostfriesland, Mecklenburg, Oldenburg, Matrosen liefern, wie sie kein Land der Erde besser hat. Es ist hier gar nichts Seltenes, daß ein fünfzehn- oder sechzehnjähriger Bursche, der kaum einen Flaum auf der Lippe hat, schon in Valparaiso, Kanton oder Bombay, zum wenigsten aber in Grönland war. Elmshorn und Glückstadt sind nämlich die beiden Häfen des südwestlichen Holsteins, die noch Grönlandfahrer auf Wallfisch- und Robbenjagd nach dem nördlichen Eismeer aussenden. In den letzten Jahrzehnten haben sich diese Grönlandfahrer jedoch bedeutend vermindert. Denn während noch vor vierzig Jahren 10 Schiffe von Glückstadt nach den nördlichen Meeren auf Wallfisch- und Robbenfang ausliefen, ist die Zahl jetzt bis auf zwei oder drei herabgesunken. Die Ursache ist der immer geringer werdende Ertrag dieser gefährlichen Expeditionen, von denen schon so manches Schiff nie wieder zum heimischen Hafen zurückkehrte, und dieser geringe Ertrag hat seinen Grund wieder in dem Hinderniß, welches, bei lange anhaltendem Winter, das Eis dem Auslaufen der Fahrzeuge in den Weg legt. Engländer und Schweden, die gleich in das offene Meer fahren können, sind deshalb stets früher in den Gewässern, wo der beste Fang zu machen ist, und nehmen die beste Beute vorweg. Der heurige Ertrag des einen Schiffs (der Glückstädter „Lucie“) waren 2000 Stück Robben und zwei Wallfische. Die Zeit des Auslaufens fällt gewöhnlich gegen Ende März bis Anfang April, die der Heimkehr gegen Ende Juni oder Anfang Juli.
Eine ganz charakteristische Belustigung des jungen Volks in der Marsch ist im Winter, wenn die Felder hart und fest gefroren sind, und eine glänzende, weiße Eisdecke Gräben und Bäche überzieht, das Eisbosseln. Die Bossel ist eine kleine, eiserne Kugel, welche im Ricochetwurf über die festgefrornen Felder und Wiesen geschleudert wird. Es gehört viel Uebung, eine gewisse Kraft und Geschicklichkeit zu diesem harmlosen Kampfspiel, welches ganze Kirchspiele nach vorhergegangener feierlicher und förmlicher Herausforderung mit einander abhalten. Eine Hauptperson ist dabei der „Kretscher“, welcher in zierlicher, wohlgesetzter Rede die Herausforderung überbringt und dann den Sieg der triumphirenden Partei feiert, während er die unterlegene durch launige Scherzreden neckt. Ein lustiger Abend im Wirthshaus, wo die Sieger von den Besiegten mit Punsch, Grog und Rothwein tractirt werden, beschließt die friedlichen Wettkämpfe. Das Eisbosseln ist ein höchst populäres und beliebtes Spiel in der Marsch, und Männer, die schon seit vielen Jahren in Amt und Würden stehen, erinnern sich noch mit lebhaftem Vergnügen jener Kämpfe ihrer Jugendzeit.
Erwähnen wir zum Schluß unserer Skizze noch eine Tugend des Marschbauers: die Häuslichkeit. Der Besuch der Wirthshäuser und Schankwirthschaften ist bei Weitem nicht so im Schwang, wie in vielen Gegenden Mittel- und Süddeutschlands, wo das Kneipenleben in erschreckendem Maße überhand genommen, und alle edleren Blüthen des Lebens zu ersticken droht. Ist aber nun auch diese Tugend anzuerkennen und zu loben, so darf doch auch nicht unerwähnt bleiben, daß vielleicht mit darin die Ursache einer gewissen Exclusivität zu suchen, die sich sowohl auf dem Lande, als in den Städten der Marsch geltend macht. Die verschiedenen Kreise der Gesellschaft sind viel strenger von einander geschieden, als in dem mittleren und südlichen Deutschland, wo die Gesellschaft unstreitig demokratischere Principien in dieser Hinsicht hat, ein Vorzug, der wohl verdient hervorgehoben zu werden, da er auf die Entwicklung unserer socialen Verhältnisse von bedeutendem Einfluß ist.
- ↑ fromm: zahm.
- ↑ An dieser Stelle erlaube mir der Leser eine kleine Unterbrechung zur Bemerkung und Berichtigung eines Irrthumes, der, wie er früher selbst unter den bedeutendsten Männern der Wissenschaft allgemein gewesen, neulich von mir ausgesprochen worden. Derselbe ist aber durch die neuesten Untersuchungen, von denen ich mich aus den bezüglichen Schriften seitdem überzeugt habe, aufgeklärt und beseitigt worden. Er betrifft nämlich den Gegenstand der Rehbrunft, von der ich im vorigen Artikel gesagt hatte: „im August sei die falsche Brunft.“ Dem ist nicht so, vielmehr geht in diesem Monate die wirkliche Begattung vor sich und es bietet daher die Gattung Reh den auffallenden Umstand dar, ungefähr 42 Wochen tragend zu gehen und zwar so, daß sich bis Weihnachten nichts oder doch nur gegen Ende dieser Zeit die Entwickelung des Embryo zeigt und dann erst einen regelmäßigen Fortgang nimmt. Wir geben die Notiz, um nicht den Vorwurf zu verdienen, wissentlich einen Irrthum aus bloßem Indifferentismus unberichtigt gelassen zu haben. G. H.
- ↑ So zahm das Damwild überhaupt im eingehegten Raume ist, so scheu und schlau benimmt es sich, wenn es im Freien vorkommt.
- ↑ Blume: Schwanz.
- ↑ Gebräch: Schnauze.
- ↑ Heben: aufsuchen, fressen.
- ↑ Gewehre: Eckzähne.
- ↑ Haken: zwei rundliche Eckzähne, die beim Hochwild im Oberkiefer stehen und beim Jäger als Trophäen einen großen Werth haben.
- ↑ Wie ich im Jahrgang 1856 der Gartenlaube das Bild der berühmten Markgräfin in der Ordenstracht der Einsiedler gab, so führe ich heute das Bild ihrer Geistesverwandten, der Herzogin von Gotha, ebenfalls in der Ordenstracht der lustigen Einsiedler von Friedrichswerth, deren Priorin sie war, vor. Das Original befindet sich in köstlicher Farbenfrische im sogenannten Damenzimmer des Schlosses zu Molsdorf, diesem einst so berühmten Lustsitze des Grafen Gotter. Ich werde diesen merkwürdigen Mann und sein Schloß in einem spätern Artikel besprechen, eben so werde ich interessante Mittheilungen über Friedrichswerth und die lustigen Einsiedler machen, obgleich sie von einer andern, aber mit den Verhältnissen nicht genau bekannten Feder in diesem Blatte schon kurz abgehandelt worden sind. Die Herzogin trägt den bebänderten Schäferstab und an der Busenschleife die bedeutungsvolle Ordensdevise: Vive la joie! welche auch in den vier Deckenecken des großen Saales zu Molsdorf en relief mit goldenen Lettern prangt. – Von Frau von Buchwald habe ich leider kein Bild weiter auftreiben können, als das nach einer von Fr. Wilh. Döll gearbeiten Marmorbüste, die sie als hohe, ehrwürdige Greisin darstellt.
Anmerkungen (Wikisource)
- ↑ Vorlage: Baumele